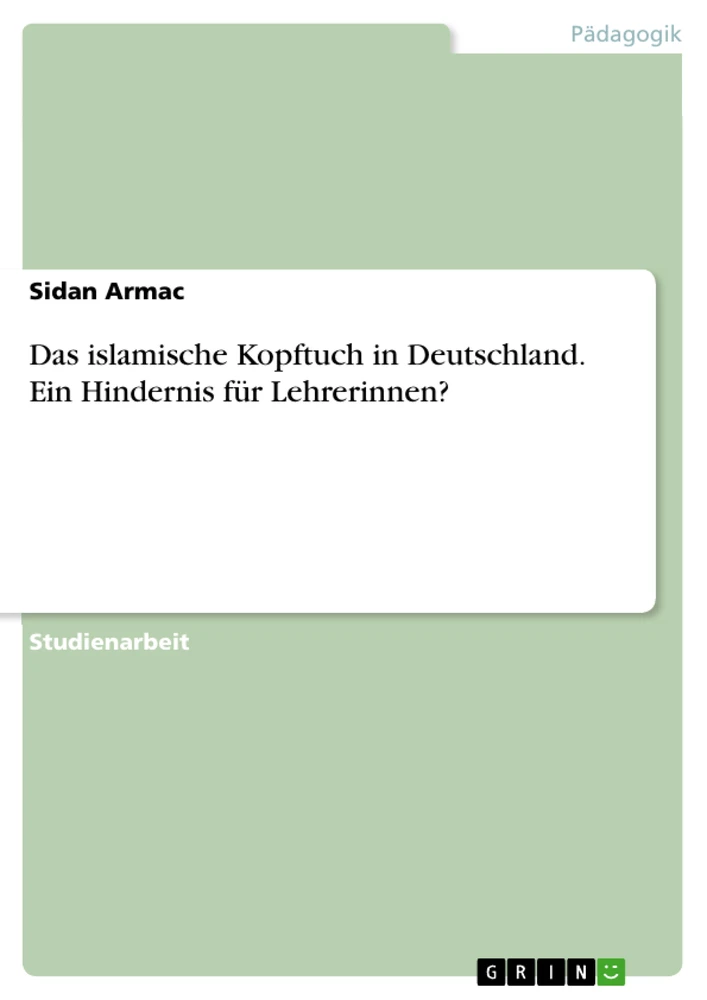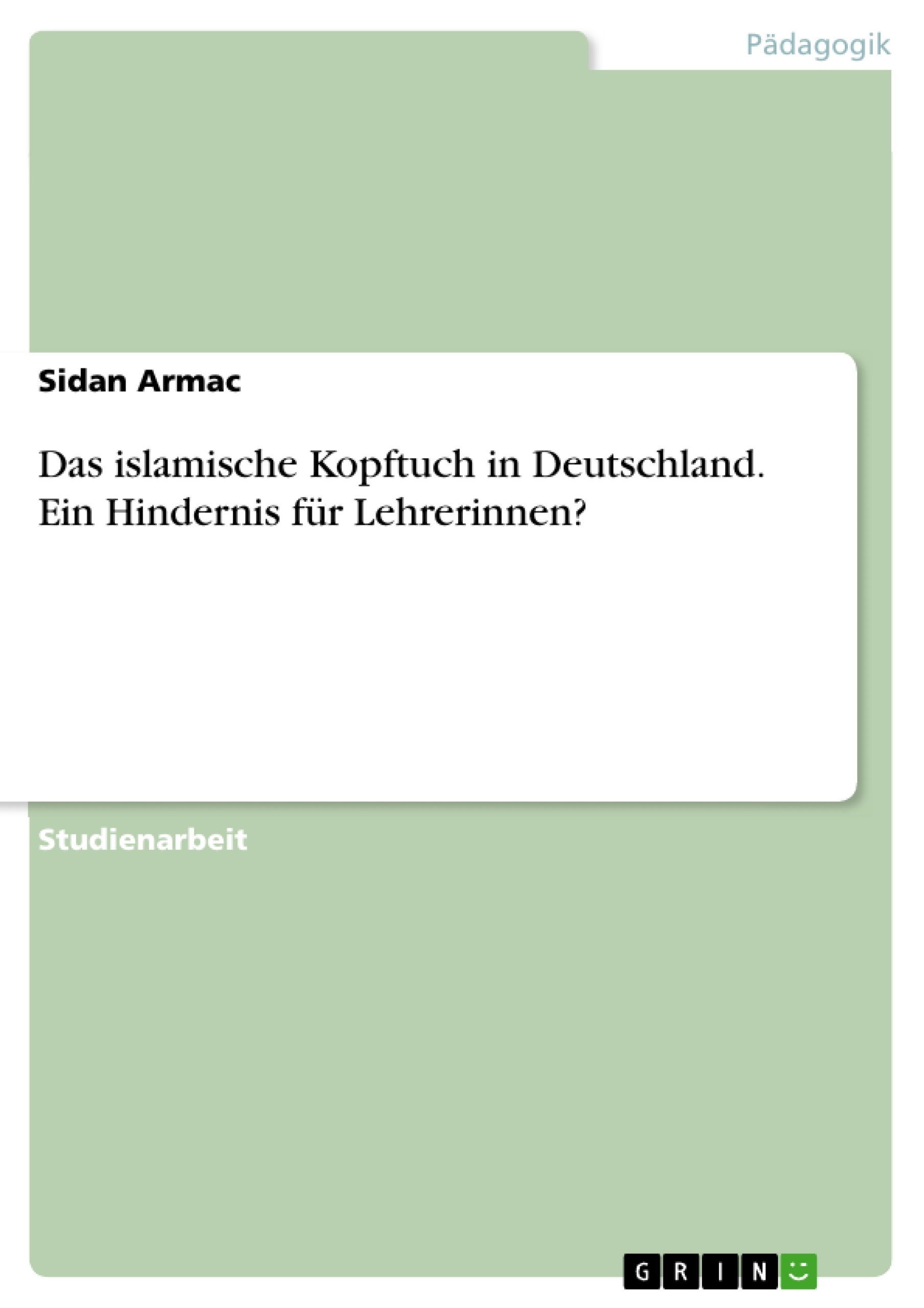Ziel dieser Arbeit ist es, die Kopftuchdebatte anschaulich darzustellen und zentralen Streitfragen und Konzepten unter Berücksichtigung pädagogischer Aspekten nachzugehen. Dabei soll im Besonderen herausgestellt werden, unter welchen
Umständen das Tragen eines Kopftuches im Schuldienst problematisch sein kann, aber auch worin die Notwendigkeit liegt, Lehrerinnen das Recht über die eigene öffentliche Glaubensbekundung zu geben.
Hinsichtlich der Diskussion über die Weiterführung des Berliner Neutralitätsgesetzes, das unter anderem Musliminnen das Tragen des Kopftuches im Schuldienst verbietet, geht die vorliegende Hausarbeit der Frage nach, inwiefern das Kopftuch einen Einfluss auf die Qualifizierung als Lehrerin haben kann. Um dieser Frage nachgehen zu können, wird die Darstellung der Kopftuchdebatte mit erziehungswissenschaftlichen Aspekten verknüpft. Die Debatte wurde erstmalig von Fereshta Ludin ausgelöst und ging dem
Problem nach, ob der Lehrer*innenberuf mit dem Tragen eines sichtbaren religiösen Symbols vereinbar sei. Dies löste zahlreiche Meinungsverschiedenheiten aus und resultierte in einer weltweit kontroversen Debatte. Durch die Mehrdeutigkeit des Kopftuches, das ein hohes Konfliktpotenzial mit sich bringt, stellt sich die Frage, wie mit Lehrerinnen umgegangen werden soll, die ihr Kopftuch im Schuldienst nicht ablegen möchten.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Der Kopftuchstreit
2.1 Entstehung des Kopftuchstreits: Der „Fall" Fereshta Ludin
2.2 Juristische Entwicklung des Kopftuchstreits in Deutschland
3. Pro- und Contra Argumente zum Kopftuchstreit
4. Abschlussdiskussion und Fazit
5. Bibliographie
1. Einleitung
Hinsichtlich der Diskussion über die Weiterführung des Berliner Neutralitätsgesetzes, das unter anderem Musliminnen das Tragen des Kopftuches im Schuldienst verbietet, geht die vorliegende Hausarbeit der Frage nach, inwiefern das Kopftuch einen Einfluss auf die Qualifizierung als Lehrerin haben kann. Um dieser Frage nachgehen zu können, wird die Darstellung der Kopftuchdebatte mit erziehungswissenschaftlichen Aspekten verknüpft. Die Debatte wurde erstmalig von Fereshta Ludin ausgelöst und ging dem Problem nach, ob der Lehrer*innenberuf mit dem Tragen eines sichtbaren religiösen Symbols vereinbar sei. Dies löste zahlreiche Meinungsverschiedenheiten aus und resultierte in einer weltweit kontroversen Debatte. Durch die Mehrdeutigkeit des Kopftuches, das ein hohes Konfliktpotenzial mit sich bringt, stellt sich die Frage, wie mit Lehrerinnen umgegangen werden soll, die ihr Kopftuch im Schuldienst nicht ablegen möchten.
Durch die Uneinigkeit über das Verständnis des Neutralitätsgesetzes und der Differenzierung zwischen christlichen Symbolen und dem islamischen Kopftuch entstehen immer noch Unstimmigkeiten. 'Besonders im feministischen Diskurs lassen sich ähnliche Meinungen finden, wenn der Frage nachgegangen wird, ob das Tragen eines Kopftuches ein Zeichen der Unterdrückung ist oder eine Art und Weise sein kann, Selbstverwirklichung auszudrücken.
Demnach soll im ersten Kapitel Fereshta Ludin als Fallbeispiel dargestellt und diskutiert werden, da sie als Auslöserin der Kopftuchdebatte eine entscheidende Rolle in der Diskussion spielt, wobei die rechtlichen Nachwirkungen nicht außer Acht gelassen werden. Im zweiten Kapitel soll dargestellt werden, inwiefern sich der Streit in Deutschland ausgebreitet und juristisch entwickelt hat. Das dritte und letzte Kapitel behandelt Pro- und Contra Argumente hinsichtlich des Kopftuchverbots und stellt parallel dazu verschiedene Positionen zum Thema dar.
[1] Der feministische Diskurs um den Kopftuchstreit wird nicht in der Hausarbeit verfolgt, da es in der Einleitung unter anderem um Eigeninteresse geht, war wenigstens die Benennung von Bedeutung für mich.
Ziel dieser Arbeit ist es, die Kopftuchdebatte anschaulich darzustellen und zentralen Streitfragen und Konzepten unter Berücksichtigung pädagogischer Aspekten nachzugehen. Dabei soll im Besonderen herausgestellt werden, unter welchen Umständen das Tragen eines Kopftuches im Schuldienst problematisch sein kann, aber auch worin die Notwendigkeit liegt, Lehrerinnen das Recht über die eigene öffentliche Glaubensbekundung zu geben.
2. Der Kopftuchstreit
Der folgende Hauptteil baut sich durch bestehende Literatur auf, wodurch es sich als Literaturarbeit kennzeichnen lässt. Gegebenenfalls können auch Studien zur argumentativen Interpretationsabsicherung herangezogen werden.
2.1 Entstehung des Kopftuchstreits: Der „Fall" Fereshta Ludin
Fereshta Ludin strebte 1997 als 24jährige deutsche Staatsbürgerin afghanischer Herkunft eine Referendariatsstelle in Schwäbisch Gmünd an, nachdem sie die pädagogische Hochschule erfolgreich abgeschlossen hatte (vgl. Karakasoglu-Aydin 1999, 171). Das Oberschulamt Stuttgart blockierte Ludins Aufnahme als Referendarin jedoch, als sie darauf bestand, mit Kopftuch zu unterrichten (vgl. ebd.). Als vermeintliche Begründung wurden zunächst muslimische Schülerinnen angeführt, die eine Lehrerin mit Kopftuch als Vorbild nehmen und daher den Schwimm- oder Sportunterricht verweigern könnten (vgl. ebd.). Auch das Kulturministerium stellte sich gegen Ludin, mit der Begründung, dass das Kopftuch eine äußere Demonstration des Glaubens sei und mit einem Partei-Werbebutton gleichgestellt werden könne (vgl. ebd.).
Diese kurze Skizzierung dient zum einfachen Verständnis der Ausgangssituation des Kopftuchstreits. Im Folgenden wird die juristische Entwicklung dargestellt und unterstreicht den Kopftuchstreit unter anderem als Angelegenheit der deutschen Bundesländer. Bezüglich des Urteils im Fall Ludin wird dies eine entscheidende Rolle spielen.
2.2 Jurisdsche Entwicklung des Kopftuchstreitsin Deutschland
Nach ihrer Ablehnung als Referendarin beruft sich Ludin auf ihr Recht auf freie Religionsausübung, das in Artikel Absatz 1 und 2 GG verankert ist, wobei sie das Kopftuch als religiösen Gegenstand in die Debatte einführt (vgl. Schieder 2005, 11). Dabei stellt sie weder den Symbolwert des Kopftuches hinten an, noch setzt sie es als Ausdruck ihres Stils an (vgl. ebd.). Nachdem Ludins Widersprüche beim Oberschulamt und Stuttgarter Verwaltungsgericht abgewiesen werden, wendet sie sich an das Bundesverfassungsgericht (Kandel 2004, 19 f.) Doch auch das
Bundesverfassungsgericht beschließt, dass ein gesetzliches Kopftuchverbot möglich ist, wobei in den darauffolgenden Jahren die Bundesländer Baden-Württemberg, Niedersachsen, Hessen, Bayern, Berlin, Bremen und Nordrhein-Westfallen Kopftuchverbote für muslimische Lehrerinnen verabschieden (vgl. Schulz 2014) Eine erneute Anrufung des Bundesverfassungsgerichts von zwei muslimischen Pädagoginnen ergibt jedoch, dass ein pauschales Kopftuchverbot für Lehrkräfte grundgesetzwidrig ist (vgl. BverfG, Beschluss des ersten Senats v. 27.01.2015 - 1 BvR 471/10 - Rn. 1-31). Nichtsdestotrotz beinhaltet die Mehrheitsentscheidung des zweiten Senats Widersprüche (vgl. Berghan 2009, 39). Der erste Leitsatz stellt klar, dass ein Verbot für Lehrkräfte, in Schule und Unterricht ein Kopftuch zu tragen, im geltenden Recht Baden-Württembergs keine gesetzliche Grundlage finde (vgl. BVerfGE 108, 282, 282). Im zweiten Leitsatz findet sich jedoch ein Widerspruch zum ersten, aus welchem Grund den Bundesländern die Möglichkeit gegeben wurde, eine Verbotsgrundlage zu schaffen (vgl. ebd.). Man dürfe das „zulässige Ausmaß religiöser Bezüge in der Schule“ (ebd.) neu bestimmen und zwar aus Anlass „zunehmender Pluralität“ (ebd.). Pauschal wurde damit Lehrerinnen erlaubt, ein Kopftuch zu tragen, solange kein spezifisches Verbotsgesetz existiert. Nichtsdestotrotz verfasste die Senatsmehrheit einen faktischen Freibrief an die Bundesländer, Artikel 4 GG bezüglich der Religionsausübung von Lehrerinnen durch anspruchslose Verbotsgesetze auszugraben, um somit die pluralistische Freiheitsgarantie zu unterlaufen (vgl. ebd.). Durch den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts war Fereshta Ludin im Recht, jedoch nur für eine kurze Zeit. Da den Bundesländern die Möglichkeit gegeben wurde, religiöse, weltanschauliche oder politische Kleidung oder Zeichen für Lehrkräfte zu verbieten, erließ Baden Württemberg ein Kopftuchverbotsgesetz, aufgrund dessen Grund Ludin erneut abgelehnt wurde (vgl. ebd.).
Obwohl seitens der Justiz nicht sichtbare Veränderungen in Kraft getreten sind, dürfen in den Bundesländern, in denen keine Verbote bezüglich religiöser Kleidung in Kraft getreten sind, das Kopftuchtragen allein nicht als Ablehnungsgrund aufgezeigt werden (vgl. ebd.). Außerdem dürfen Schulbehörden das Abnehmen einer Kopfbedeckung nicht verlangen, sofern es nicht die staatliche Neutralität, den Schulfrieden gefährdet oder die negative Glaubensfreiheit von Schüler*innen hervorruft (vgl. ebd.).
3. Pro- und Contra Argumente zum Kopftuchstreit
Hinsichtlich des Kopftuchstreits haben sich kontroverse Positionen in der Debatte gebildet. Im folgenden Kapitel werden diese verschiedenen Positionen mithilfe von Pro- und Contra Argumenten, gegebenenfalls auch Studien, dargestellt und diskutiert.
Dadurch, dass Deutschland kein laizistischer Staat ist und das Artikel 4 des Grundgesetzes säkuläre Prinzipien, wie die Religionsfreiheit und das Neutralitätsgebot festlegt, herrscht Unklarheit darüber, wie neutral der Staat sein muss und inwieweit Religiosität in der Öffentlichkeit repräsentiert wird (Göroglu 2015).
Außerdem herrscht in der Gesellschaft bis heute Unklarheit darüber, welchen Ursprung beziehungsweise Bedeutung religiöse Kleidung hat. Im Folgenden wird eine Studie versuchen, über mögliche Motive der Kopftuchbedeckung aufzuklären.
Eine quantitative Studie von Frank Jessen und Ulrich von Wilawomitz-Moellendorf (2006) untersucht die Motive von 315 Frauen zwischen 18 und 40 Jahren aus ausgewählten Moscheegemeinden. Die Ergebnisse ergaben, dass 97 Prozent der Teilnehmerinnen aus religiösen Gründen ein Kopftuch tragen (vgl. ebd., 23). Die Musliminnen lehnten jedoch strikt ab, sich aus Zwang zu bedecken (vgl. ebd., 24). Als weiteres Motiv wurde unter anderem die Zugehörigkeit des Herkunftslandes, das Tragen als Zeichen des Protests, oder als politisches Symbol angegeben (vgl. ebd., 9 ff.). Nichtsdestotrotz solle man die Ergebnisse mit Vorsicht beurteilen, da die Teilnehmerinnen in die Gemeinde integriert sind und daher das Tragen eines Kopftuches als normal und nicht unbedingt als Druck empfinden können (vgl. ebd., 41 ff.).
Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass religiöse Kleidung auf Schüler*innen eine suggestive und überwältigende Wirkung haben kann, oder dass das Kopftuch eine Zwietracht zwischen Schüler*innen, Eltern und Kolleg*innen stiftet (vgl. Wiese 2009, 228). Besonders im Hinblick auf die Gleichstellung der Geschlechter sind Schulen bezüglich des Erziehungsauftrags einer großen Verantwortung unterstellt (vgl. ebd.).
Außerdem spielt der Toleranzbegriff im pädagogischen Kontext eine entscheidende Rolle, da „ein tolerantes Miteinander mit Andersgesinnten“ am nachhaltigsten durch Erziehung geübt werden könne (vgl. BVG-Urteil 2003, 39). „Dies müsste nicht die Verleugnung der eigenen Überzeugung bedeuten, sondern böte die Chance zur Erkenntnis und Festigung des eigenen Standpunktes und zu einer gegenseitigen Toleranz, die sich nicht als nivellierender Ausgleich versteht“ (ebd.). Daraus lässt sich schließen, dass die Aufnahme von Lehrerinnen mit Kopftuch für religiöse Vielfalt sprechen und als Mittel für die Einübung von gegenseitiger Toleranz genutzt werden kann (vgl. ebd.).
Als Gegenargument lässt sich das Mäßigungs- und Neutralitätsgebot eines Beamten anführen. Demnach sei das Tragen eines Kopftuches im Schulunterricht mit den oben genannten Geboten nicht vereinbar, da die Möglichkeit besteht, dass bei Schüler*innen ein Nachahmungseffekt entsteht (vgl. Bundesverfassungsgericht: 2 BvR 1436/02, Urteil verkündet am 24.09.2003). Auch wenn bereits eine Ablehnung gegen das Kopftuch seitens der Schüler*innen vorhanden ist, so wäre ein Wertkonflikt eine mögliche Konsequenz (vgl. ebd.). Durch die objektive Reizwirkung eines politisch-religiösen Symbols, dessen verschiedene soziale Reaktionen das Kind erfährt, könnte sich möglicherweise ein Wertedisput auftun, dass das Kind noch nicht beurteilen kann. Bei solch einem Disput ist eine Zwietracht zwischen kopftuchtragenden Lehrerinnen und eines kopftuchablehnenden Umfeldes, zu dem auch die Eltern gezählt werden können, eine mögliche Wirkung auf das Kind (vgl. ebd.). Außerdem wird bei einem Teil der Muslimen*innen das Tragen des Kopftuches als „Notwendigkeit, die Frau in ihrer dem Mann dienende Rolle zu halten“ interpretiert. Das Grundgesetz sei zwar offen für Freiheit und Toleranz, jedoch würden sie solchen Symbolen Eingang in den Staatsdienst verweigern, die herrschende Wertemaßstäbe herausfordern und somit Konflikte hervorbringen (vgl. ebd.).
4. Abschlussdiskussion und Fazit
Um die Forschungsfrage beantworten zu können, soll abschließend ein kritischer Bezug zu den bisher dargestellten Ergebnissen genommen werden, um abschließend ein Fazit ziehen zu können. Wie bereits in den vorherigen Kapiteln diskutiert wurde, kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass Kopftücher keine suggestive Wirkung auf Schüler*innen haben und somit unter anderem den Erziehungsauftrag der Schulen gefährden. Besonders die Herkunft und Bedeutung des Kopftuchs ist oftmals ungeklärt, weswegen religiöse Symbole und Gegenstände die Glaubensfreiheit der Kinder negativ beeinflussen können. Allgemein ist das Kopftuch als Zeichen der Unterdrückung bekannt, womit eine mögliche negative Wirkung zu erklären wäre. Dabei sollte jedoch beachtet werden, dass Argumente gegen kopftuchbedeckte Lehrer*innen nicht in eine rassistische Richtung gelenkt werden. Pädagogen fällt in dieser Hinsicht eine wichtige Rolle zu, da Aufklärung ein wichtiges Mittel für ein besseres Verständnis ist. Beispielsweise könnten Begriffe wie Toleranz, Pluralismus und Diversität eine Lösung für zukünftige kontroverse Debatten sein.
Ausgehend vom Berliner Neutralitätsgesetz, fällt auch der Judikative eine wichtige Rolle zu. Auch wenn religiöse Symbole zu Recht und Gegenstände nicht ohne Vorbehalte in das Schuldienst eingeführt, so verkomplizieren uneindeutige Gesetzesformulierungen die Entscheidung darüber, inwiefern Lehrer*innen ihre Religiosität zeigen dürfen. In diesem Kontext scheint es nicht möglich, Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern gleichzeitig zu schützen. Eine Partei scheint, im Fall Fereshta Ludins die Lehrerin, im Nachteil zu sein.
Im Hinblick auf die Forschungsfrage darf das islamische Kopftuch erst einen Einfluss auf die Qualifizierung einer Lehrerin haben, wenn eine suggestive Wirkung beabsichtigt wird und somit der Erziehungsauftrag der Schulinstitution gefährdet wird. Bei solch einem Szenario sind Ablehnungen von Lehrer*innen mit dem Wunsch, im Unterricht ein Kopftuch zu tragen, legitim.
Für die Zukunft sind noch einige Veränderungen nötig, damit kontroverse Debatten, die zwar förderlich für die Gesellschaft sind, friedlicher gelöst werden können. Meiner Meinung nach wird durch das Neutralitätsverständnis des Staates die Demokratie zum Teil übergangen. Die Tatsache, dass Lehrer*innen noch heute in vielen Bundesländern im Unterricht kein Kopftuch tragen dürfen, ist ein Zeichen dafür, dass Selbstverwirklichung auch in einem demokratischen Land wie Deutschland nicht immer möglich ist.
5. Bibliographie
Berghahn, Sabine (2009): Deutschlands konfrontativer Umgang mit dem Kopftuch der Lehrerin.
Bundesverfassungsgericht (2015): Beschluss des Ersten Senats v. 27. Januar 2015 - 1 BvR 471/10 - Rn. 1-31.
Bundesverfassungsgericht (2020): Beschluss des Zweiten Senats v.14. Januar 2020 -2 BvR 1333/17 -, Rn. 1-26.
Bundesverfassungsgericht (2003): Urteil des Zweiten Senats v. 24. September 2023- 2 BvR 1436/02.
Göroglu, Rana (2015): Laizismus versus Säkularismus - Wie neutral muss der deutsche Staat sein? verfügbar unter: https://mediendienst-integration.de/artikel/laizismus- versus-saekularismus-wie-neutral-ist-deutscher-staat-kopftuch-schule-lehrerin.html, Stand: 01.04.2015, Abruf: 14.03.2024.
Jessen, Frank; von Wilamowitz-Moellendorff, Ulrich (2006): Das Kopftuch - Entschleierung eines Symbols? Sankt Augustin/ Berlin.
Kandel, Johannes (2004): Auf dem Kopf und in dem Kopf - Der „Kopftuchstreit“ und die Muslime, in: Politische Akademie der Friedrich-Ebert-Stiftung (Islam und Gesellschaft Nr. 3), verfügbar unter: http://libraryfes.de/pdf-
files/akademie/berlin/50509.pdf. Stand: 12.2004, Abruf: 14.03.2024.
Karakasoglu-Aydin, Yasemin (1999): Eine Analyse der Reaktionen auf den" Fall Ludin" in Politik und Medienöffentlichkeit. Die neue religiöse Minderheit, 169.
Schieder, Rolf (2005): Der Streit um das Kopftuch in diskursanalytischer Perspektive, in: Zeitschrift für evangelische Ethik, Heft 1, Jg. 49, S.9-21.
Schulz, Florian (2014): Kopftuchverbot für Lehrkräfte in Deutschland, verfügbar unter: https://www.uni-trier.de/index.php ?id=243 73#c48122, Stand: 17.10.2014, Abruf: 14.03.2024.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kopftuchstreit und wie entstand er?
Der Kopftuchstreit ist eine Debatte in Deutschland, die durch den "Fall" Fereshta Ludin ausgelöst wurde. Ludin, eine muslimische Lehrerin, wurde 1997 abgelehnt, ein Referendariat anzutreten, weil sie darauf bestand, ein Kopftuch im Unterricht zu tragen. Dies führte zu einer breiten Diskussion über die Vereinbarkeit von religiösen Symbolen und dem Lehrerberuf.
Was sind die juristischen Entwicklungen im Kopftuchstreit in Deutschland?
Nachdem Ludin abgelehnt wurde, berief sie sich auf ihr Recht auf freie Religionsausübung. Der Fall ging durch verschiedene Gerichte bis zum Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht entschied, dass ein gesetzliches Kopftuchverbot grundsätzlich möglich ist, aber spätere Entscheidungen stellten pauschale Verbote als grundgesetzwidrig dar. Den Bundesländern wurde jedoch die Möglichkeit gegeben, Verbotsgrundlagen zu schaffen, was zu unterschiedlichen Gesetzen in den einzelnen Bundesländern führte.
Welche Argumente sprechen für und gegen ein Kopftuchverbot für Lehrerinnen?
Pro-Argumente umfassen die staatliche Neutralität, die Vermeidung von Nachahmungseffekten bei Schüler*innen und die Wahrung der Gleichstellung der Geschlechter. Es wird argumentiert, dass das Kopftuch eine suggestive Wirkung haben und den Erziehungsauftrag der Schule gefährden kann. Contra-Argumente beziehen sich auf die Religionsfreiheit, die Möglichkeit zur Förderung von Toleranz und Vielfalt und die Selbstverwirklichung der Lehrerinnen. Studien zeigen, dass viele Frauen das Kopftuch aus religiösen Gründen tragen, ohne sich dazu gezwungen zu fühlen.
Wie beeinflusst das Kopftuch die Qualifizierung als Lehrerin?
Laut der Zusammenfassung sollte das Tragen eines Kopftuchs durch eine Lehrerin nur dann die Qualifizierung als Lehrerin beeinflussen, wenn eine suggestive Wirkung beabsichtigt wird, wodurch der Erziehungsauftrag gefährdet wird.
Welche Rolle spielt der Toleranzbegriff im Kopftuchstreit?
Der Toleranzbegriff spielt eine zentrale Rolle. Befürworter argumentieren, dass die Zulassung von Lehrerinnen mit Kopftuch die religiöse Vielfalt fördert und zur Einübung von gegenseitiger Toleranz beitragen kann. Ein tolerantes Miteinander mit Andersgesinnten sollte durch Erziehung geübt werden.
Wie wird der Kompromiss zwischen Religionsfreiheit und staatlicher Neutralität im Kopftuchstreit behandelt?
Der Kopftuchstreit zeigt die Schwierigkeit, ein Gleichgewicht zwischen Religionsfreiheit und staatlicher Neutralität zu finden. Deutschland ist kein laizistischer Staat, und das Grundgesetz legt sowohl die Religionsfreiheit als auch das Neutralitätsgebot fest. Dies führt zu Unsicherheiten darüber, wie neutral der Staat sein muss und inwieweit Religiosität in der Öffentlichkeit repräsentiert werden darf.
Welche Studien wurden zum Thema Kopftuch durchgeführt?
Eine quantitative Studie von Frank Jessen und Ulrich von Wilawomitz-Moellendorf (2006) untersuchte die Motive von muslimischen Frauen, ein Kopftuch zu tragen. Die Ergebnisse ergaben, dass 97 Prozent der Teilnehmerinnen aus religiösen Gründen ein Kopftuch tragen. Andere Motive waren unter anderem die Zugehörigkeit des Herkunftslandes, das Tragen als Zeichen des Protests oder als politisches Symbol.
Was sind die Schlussfolgerungen der Arbeit zum Kopftuchstreit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass das islamische Kopftuch erst dann einen Einfluss auf die Qualifizierung einer Lehrerin haben darf, wenn eine suggestive Wirkung beabsichtigt wird und somit der Erziehungsauftrag der Schulinstitution gefährdet wird. Sie fordert eindeutigere Gesetzesformulierungen und eine friedlichere Lösung kontroverser Debatten. Abschließend wird angemerkt, dass das Neutralitätsverständnis des Staates die Demokratie teilweise übergangen werden kann und die Selbstverwirklichung in Deutschland nicht immer möglich ist.
- Quote paper
- Sidan Armac (Author), 2024, Das islamische Kopftuch in Deutschland. Ein Hindernis für Lehrerinnen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1500921