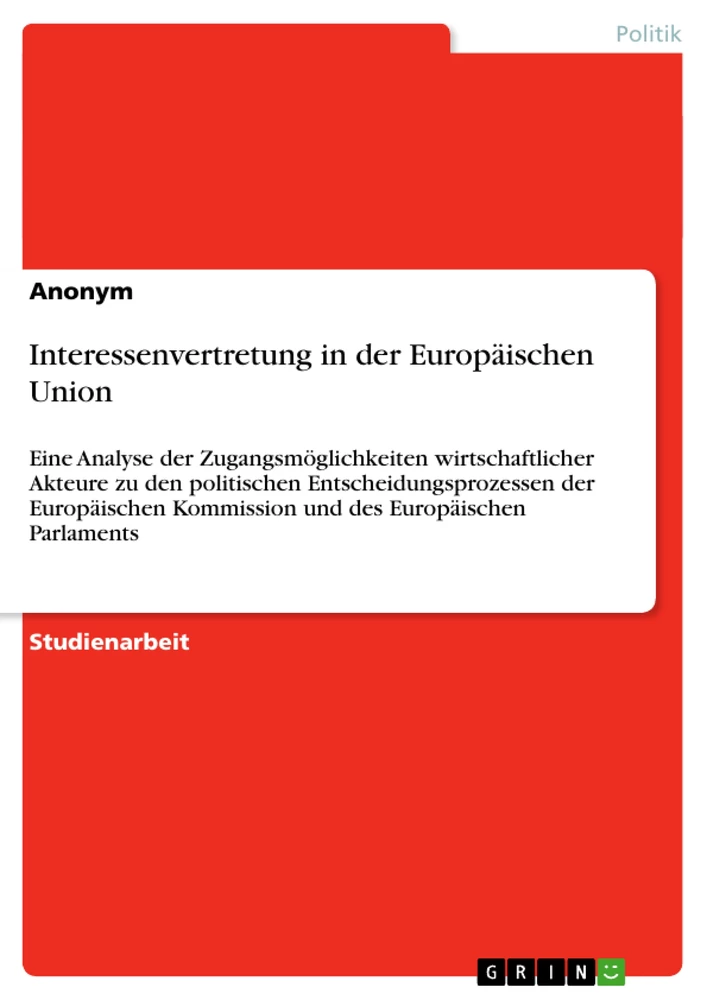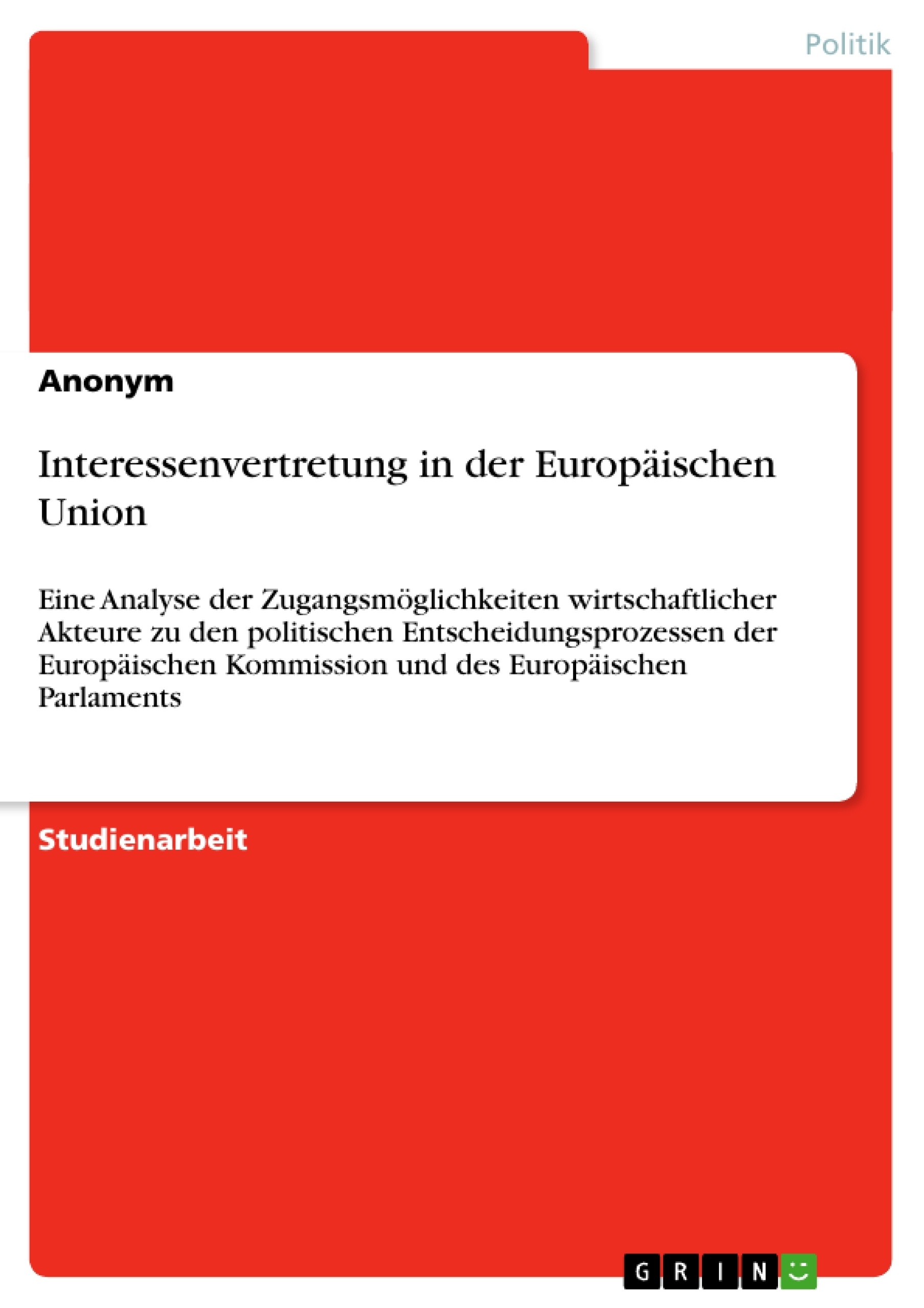Mit der zunehmenden Bedeutung europäischer Entscheidungen im Zuge der voranschreitenden Europäischen Integration haben sich zahlreiche politikwissenschaftlich relevante Veränderungen ergeben, die alle eine grundlegende Gemeinsamkeit aufweisen. Immer spielt die Veränderung der Rolle von Nationalstaaten in einem sich zunehmend europäisierenden System politischer Entscheidungen eine gewichtige Rolle. Auch wenn kein wissenschaftlicher Konsens über die „neue Rolle“ der Nationalstaaten in der Europäischen Union besteht, ist diese Veränderung jedoch maßgeblich durch eine Verlagerung bestimmter Kompetenzen und Aktivitäten von der nationalstaatlichen auf die europäische Ebene gekennzeichnet.
Vor dem Hintergrund dieser Veränderungen hat sich auch die Struktur der Interessenvertretung innerhalb Europas grundlegend gewandelt. Aufgrund der stetig zunehmenden Verlagerung von Gesetzgebungskompetenzen auf die europäische Ebene, ist Brüssel für eine gezielte Interessenvertretung heute unerlässlich geworden. Professionelle Interessenvertretung im europäischen Raum findet daher nicht mehr vorwiegend auf nationalstaatlicher, sondern auf europäischer Ebene statt. Es wird davon ausgegangen, dass gegenwärtig mehr als 15.000 Lobbyisten in Brüssel ansässig sind, um ihre partikularen Interessen zu vertreten. In den vergangenen Jahren hat sich die Europäische Union (EU) damit zur weltweit zweitgrößten Lobbyindustrie entwickelt.
Hinzu kommt, dass sich auch die Akteursstruktur der Interessenvertretung grundlegend verändert hat. Es fand bzw. findet ein grundlegender Wandel vom Korporatismus zum professionellen Lobbyismus statt. Die hauptsächlich nationalstaatlich organisierten korporatistischen Akteure waren nicht in der Lage, die im Zuge der Europäisierung erforderliche Anpassungsarbeit zu leisten. Ihnen ist es nicht gelungen, die eigenen Strukturen an die sich stetig europäisierenden Präferenzen ihrer Mitglieder anzupassen und die klassischen Probleme großer Kollektive zu überwinden. Den Interessen einzelner Verbandsmitglieder wurde nur wenig Beachtung geschenkt, da der Konsens aller Mitglieder im Vordergrund stand. Insbesondere international agierende Unternehmen begannen aufgrund dieser verpassten Anpassungsleistung und der ungenügenden Interessenartikulation immer weniger auf traditionelle Verbände zurückzugreifen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Lobbying: Funktionen und Merkmale
- Akteure und Ziele europäischer Interessenpolitik
- Grundlegende Entwicklungstendenzen der Akteursstruktur
- Interessenvertreter
- Wirtschaftliche Akteure
- EU-Entscheidungsträger: Kommission und Parlament
- Europäische Kommission
- Europäisches Parlament
- Die Europäische Union als offenes politisches System
- Zugangslogik europäischer Interessenpolitik
- Europäische Interessenpolitik als Tauschbeziehung
- Angebot und Nachfrage auf Kommissionsebene
- Angebot und Nachfrage auf Parlamentsebene
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Ausarbeitung analysiert die Zugangsmöglichkeiten wirtschaftlicher Akteure zu den politischen Entscheidungsprozessen der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments. Ziel ist es, die Bedingungen und Mechanismen zu beleuchten, die den Einfluss von Lobbyisten mit wirtschaftlichen Interessen auf die EU-Politik ermöglichen. Die Arbeit untersucht die Struktur der Interessenvertretung in der EU, die Rolle von Lobbyisten als Informationsdienstleister und die Bedeutung von Tauschbeziehungen zwischen wirtschaftlichen Akteuren und EU-Institutionen.
- Entwicklung der Interessenvertretung in der EU
- Rolle von Lobbyisten als Informationsdienstleister
- Zugangslogik europäischer Interessenpolitik
- Tauschbeziehungen zwischen wirtschaftlichen Akteuren und EU-Institutionen
- Offenheit des EU-Systems gegenüber wirtschaftlichen Akteuren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der Thematik der Interessenvertretung in der EU im Kontext der europäischen Integration dar. Sie beleuchtet die Veränderungen in der Akteursstruktur und die zunehmende Bedeutung professioneller Interessenvertretung in Brüssel. Die Arbeit fokussiert auf die Frage, welchen Zugang wirtschaftliche Akteure zum europäischen Gesetzgebungsprozess haben und welche Faktoren diesen Zugang beeinflussen.
Das zweite Kapitel definiert den Begriff Lobbying und beschreibt seine Funktionen und Merkmale. Es wird deutlich, dass Lobbyismus in der EU eine besondere Rolle spielt, da er nicht nur Interessen vertritt, sondern auch als Informationsdienstleister für EU-Entscheidungsträger fungiert.
Das dritte Kapitel analysiert die Akteursstruktur europäischer Interessenpolitik. Es werden die grundlegenden Entwicklungstendenzen der Akteursstruktur, die verschiedenen Arten von Interessenvertretern und die Rolle von wirtschaftlichen Akteuren sowie die EU-Entscheidungsträger, insbesondere die Europäische Kommission und das Europäische Parlament, betrachtet.
Das vierte Kapitel untersucht die Europäische Union als offenes politisches System und beleuchtet die Gründe, warum die EU für Lobbyisten besonders attraktiv ist. Es werden die spezifischen Strukturen und Prozesse der EU hervorgehoben, die den Zugang für wirtschaftliche Akteure ermöglichen.
Das fünfte Kapitel analysiert die Zugangslogik europäischer Interessenpolitik. Es werden die Interaktionen zwischen privaten Akteuren und EU-Institutionen als Tauschbeziehungen betrachtet und untersucht, wie die Nachfrage nach und das Angebot von spezifischen Informationen den Zugang zu Kommission und Parlament bestimmen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Interessenvertretung, Lobbying, Europäische Union, Europäische Kommission, Europäisches Parlament, wirtschaftliche Akteure, Zugangsmöglichkeiten, Gesetzgebungsprozess, Tauschbeziehungen, Informationsdienstleister, Offenheit des politischen Systems.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2010, Interessenvertretung in der Europäischen Union, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/149976