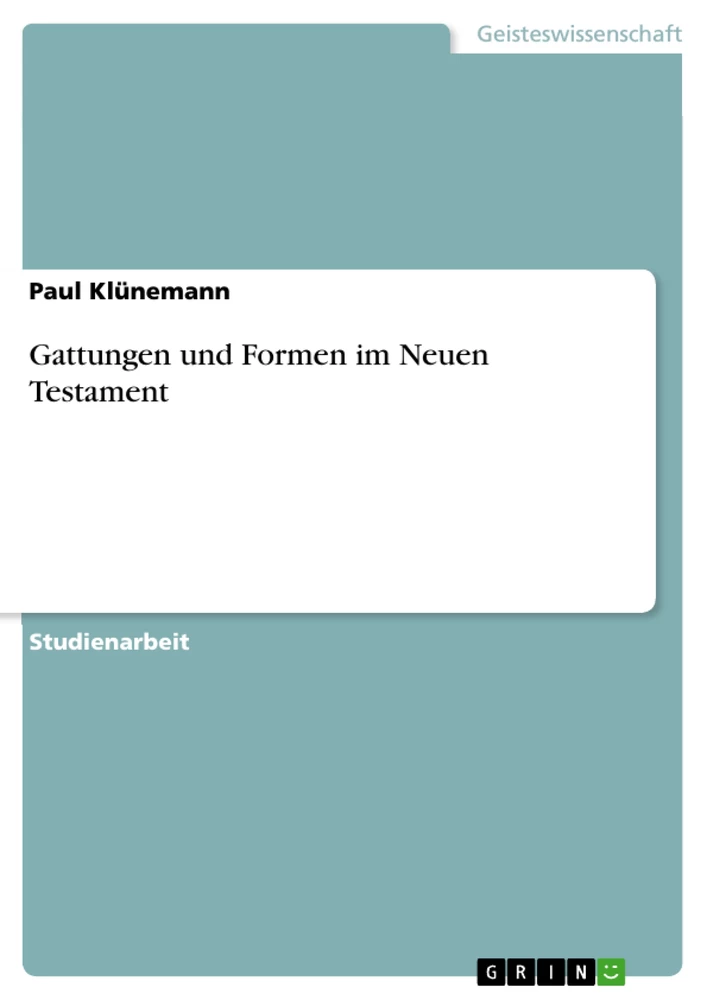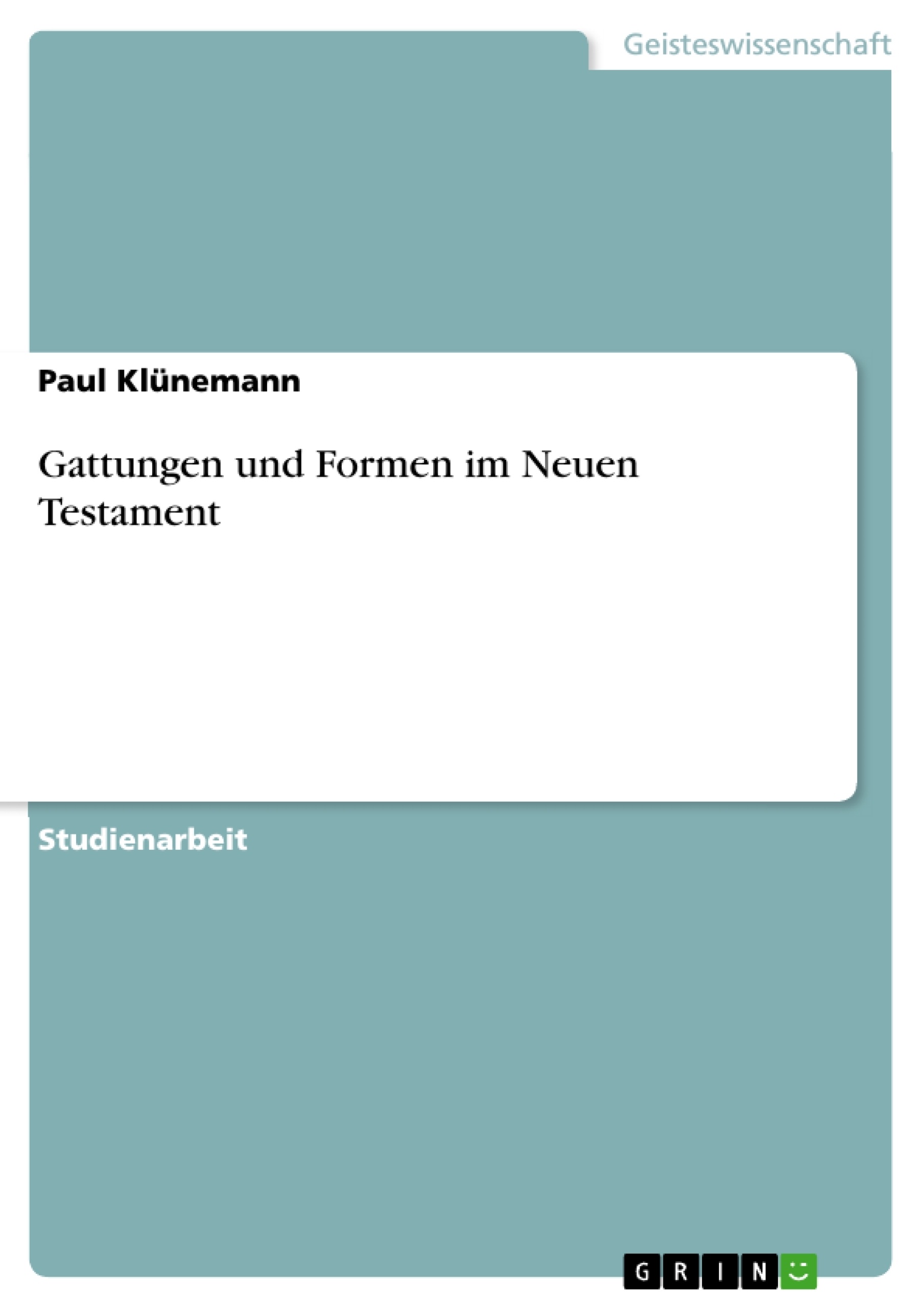[...] Aber worin besteht dieser Zusammenhang, weist doch der zweite Blick in das Inhaltsverzeichnis auf, dass für Texte eine Reihe von Autoren angegeben sind. Weiter weist der Blick auf, das es sich um verschiedene Typen von Texten handeln muss, denn ein Evangelium ist allein vom Begriff her ein Anderes als ein Brief, beide anderes als eine Geschichte, alle drei anderes als eine Apokalypse. Oder gar doch nicht? Oder sind die verschiedenen Autoren nur scheinbar verschieden; also letztlich doch alles ein einziger, tatsächlich zusammengehörender Text? Viele Fragen. Warum heißt dieses Buch Testament, da wir Heutigen doch unter dem Begriff Testament sicher eines gerade nicht verstehen; nämlich ein Buch. Können wir aber so ohne Weiteres unseren Begriff von „Testament“ auf die Zeiten übertragen, in denen die Texte des neuen Testamentes verfasst worden sind? Wann sind die Texte überhaupt verfasst worden; sind sie zeitgleich, zumindest annähernd zeitgleich verfasst worden oder liegen so große Zeiträume zwischen den Entstehungszeiten der einzelnen Texte, dass ein einheitlicher Inhalt des Begriffs Testament auch bei den Autoren nicht mehr vorausgesetzt werden darf? Überhaupt: warum „Neues Testament“: gibt es ein „Altes“? Was aber ist mit diesem Alten: bleibt es gültig, wenn es jetzt doch ein Neues gibt? Alle für das Neue Testament gestellten und noch darüber hinaus möglichen Fragen können mit gleichem Recht für das Alte Testament gestellt werden.
Im Folgenden sollen einige dieser Fragen aufgegriffen werden. Da ist zum ersten die Frage nach den im neuen Testament zu findenden Textformen (Abschnitt 2.). Da ist zum zweiten die Frage danach, ob die gefundenen Textformen einen Zusammenhang bilden, wie welche Textformen zusammenhängen und warum. In den Vordergrund rücken dabei die formale Betrachtungsweise, analog zu den formal zu bestimmenden Textformen. (Abschnitt 3). Schließlich soll dann noch ein Blick auf die Inhalte geworfen werden; konkret: können die Formen für sich gelesen werden oder dürfen, müssen sie gar zusammen gelesen werden, um ihren eigentlichen Sinn dem Leser frei zu geben? (Abschnitt 4) Abschließend sei in (Abschnitt 5) versucht, ein Ergebnis zu formulieren, bevor in (Abschnitt 6) die Ausführungen kurz zusammengefasst werden sollen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Gattungen / Formen
- Großformen
- Evangelium
- Apostelgeschichte
- Briefe
- Apokalypse
- Kleinformen
- Wundergeschichten
- Gleichnisse
- Metapher, Parabel und Allegorie
- Anekdote
- Großformen
- Zusammenhänge zwischen den Gattungen / Formen
- Die Formen untereinander
- Kleinformen zu Kleinform
- Großformen zu Großform
- Zusammenhänge zwischen den Gattungen/Formen
- Kleinformen zu Großformen
- Großformen zum Neuen Testament als Ganzes
- Die Formen untereinander
- Kanonische Lesart als Hilfe zum Verständnis des NT.
- formaler Bezug von AT und NT
- Inhaltlicher Bezug des NT zum AT
- Inhaltliche Bezüge zwischen den Texten der jeweiligen Formen
- Ergebnis
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gattungen und Formen im Neuen Testament, analysiert die Zusammenhänge zwischen diesen Textformen und beleuchtet, wie eine kanonische Lesart das Verständnis des Neuen Testaments vertiefen kann. Die Arbeit konzentriert sich auf die formale Betrachtungsweise der Texte und deren inhaltliche Beziehungen.
- Gattungen und Formen im Neuen Testament
- Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Textformen
- Der Einfluss der kanonischen Lesart auf das Textverständnis
- Formale und inhaltliche Beziehungen zwischen den Texten
- Bezug des Neuen Testaments zum Alten Testament
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentralen Forschungsfragen. Sie hinterfragt den Begriff „Neues Testament“ selbst und wirft Fragen nach dem Zusammenhang der verschiedenen Texte, ihren Autoren und der zeitlichen Entstehung auf. Der Begriff „Testament“ wird kritisch hinterfragt und in seinen historischen Kontext gestellt. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die drei Hauptforschungsbereiche: Textformen, deren Zusammenhänge und die Rolle der kanonischen Lesart.
Die Gattungen / Formen: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Gattung“ und wählt stattdessen den Begriff „Form“ für die Analyse der Texttypen im Neuen Testament. Es unterscheidet zwischen Großformen (Evangelien, Apostelgeschichte, Briefe, Apokalypse) und Kleinformen (Wundergeschichten, Gleichnisse, Metaphern, Parabeln, Allegorien, Anekdoten). Die Definition jeder Form wird kurz angerissen, aber im Folgenden ausführlicher behandelt.
Zusammenhänge zwischen den Gattungen / Formen: Dieses Kapitel untersucht die Beziehungen zwischen den verschiedenen Textformen im Neuen Testament. Es analysiert sowohl die Beziehungen zwischen Kleinformen untereinander und Großformen untereinander als auch die Verbindungen zwischen Kleinformen und Großformen, sowie die Einbettung der Großformen in den Gesamtkontext des Neuen Testaments. Das Kapitel beleuchtet die Interdependenzen und die wechselseitige Bedeutung der unterschiedlichen Textformen.
Kanonische Lesart als Hilfe zum Verständnis des NT.: Dieses Kapitel befasst sich mit der kanonischen Lesart und ihrer Bedeutung für das Verständnis des Neuen Testaments. Es untersucht den formalen und inhaltlichen Bezug des Neuen Testaments zum Alten Testament und analysiert die inhaltlichen Beziehungen zwischen den Texten der verschiedenen Formen. Der Fokus liegt darauf, wie ein kanonischer Zugang das Verständnis des Gesamtkontextes verbessert und neue Interpretationsmöglichkeiten eröffnet.
Schlüsselwörter
Neues Testament, Gattungen, Formen, Evangelium, Apostelgeschichte, Briefe, Apokalypse, Kanon, Zusammenhang, Textanalyse, formale Analyse, inhaltliche Analyse, kanonische Lesart, Altes Testament.
Häufig gestellte Fragen zum Neuen Testament: Gattungen, Formen und Kanonische Lesart
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Gattungen und Formen im Neuen Testament (NT), untersucht die Zusammenhänge zwischen diesen Textformen und beleuchtet den Einfluss der kanonischen Lesart auf das Verständnis des NT. Der Fokus liegt auf der formalen und inhaltlichen Betrachtung der Texte und deren Beziehungen zueinander.
Welche Gattungen und Formen werden im Neuen Testament unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Großformen (Evangelien, Apostelgeschichte, Briefe, Apokalypse) und Kleinformen (Wundergeschichten, Gleichnisse, Metaphern, Parabeln, Allegorien, Anekdoten). Jede Form wird definiert und ihre Bedeutung im Kontext des NT erörtert.
Wie werden die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Textformen untersucht?
Die Arbeit analysiert die Beziehungen zwischen Kleinformen untereinander, Großformen untereinander sowie die Verbindungen zwischen Kleinformen und Großformen. Sie beleuchtet die Interdependenzen und die wechselseitige Bedeutung der unterschiedlichen Textformen und deren Einbettung in den Gesamtkontext des NT.
Welche Rolle spielt die kanonische Lesart für das Verständnis des Neuen Testaments?
Die Arbeit untersucht, wie die kanonische Lesart das Verständnis des NT vertieft. Dabei werden der formale und inhaltliche Bezug des NT zum Alten Testament (AT) sowie die inhaltlichen Beziehungen zwischen den Texten der verschiedenen Formen analysiert. Der Fokus liegt auf der Verbesserung des Verständnisses des Gesamtkontextes durch einen kanonischen Zugang.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu den Gattungen/Formen, den Zusammenhängen zwischen den Gattungen/Formen, der kanonischen Lesart und einem Schluss. Die Einleitung stellt die Forschungsfragen und den Aufbau der Arbeit vor. Jedes Kapitel behandelt einen der genannten Aspekte ausführlich.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Neues Testament, Gattungen, Formen, Evangelium, Apostelgeschichte, Briefe, Apokalypse, Kanon, Zusammenhang, Textanalyse, formale Analyse, inhaltliche Analyse, kanonische Lesart, Altes Testament.
Was wird unter "kanonischer Lesart" verstanden?
Die "kanonische Lesart" bezieht sich auf die Betrachtung der neutestamentlichen Texte im Kontext des gesamten kanonischen Schrifttums, also unter Berücksichtigung der innerbiblischen Beziehungen (insbesondere zum Alten Testament) und der übergreifenden theologischen Zusammenhänge.
Welche konkreten Beziehungen zwischen den Textformen werden analysiert?
Die Analyse umfasst Beziehungen wie Kleinformen zu Kleinformen, Großformen zu Großformen, Kleinformen zu Großformen und die Einordnung der Großformen in den Gesamtkontext des Neuen Testaments. Der Zusammenhang zwischen dem Alten und Neuen Testament wird ebenfalls untersucht.
- Quote paper
- dipl.-ing.agr. Paul Klünemann (Author), 2010, Gattungen und Formen im Neuen Testament, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/149832