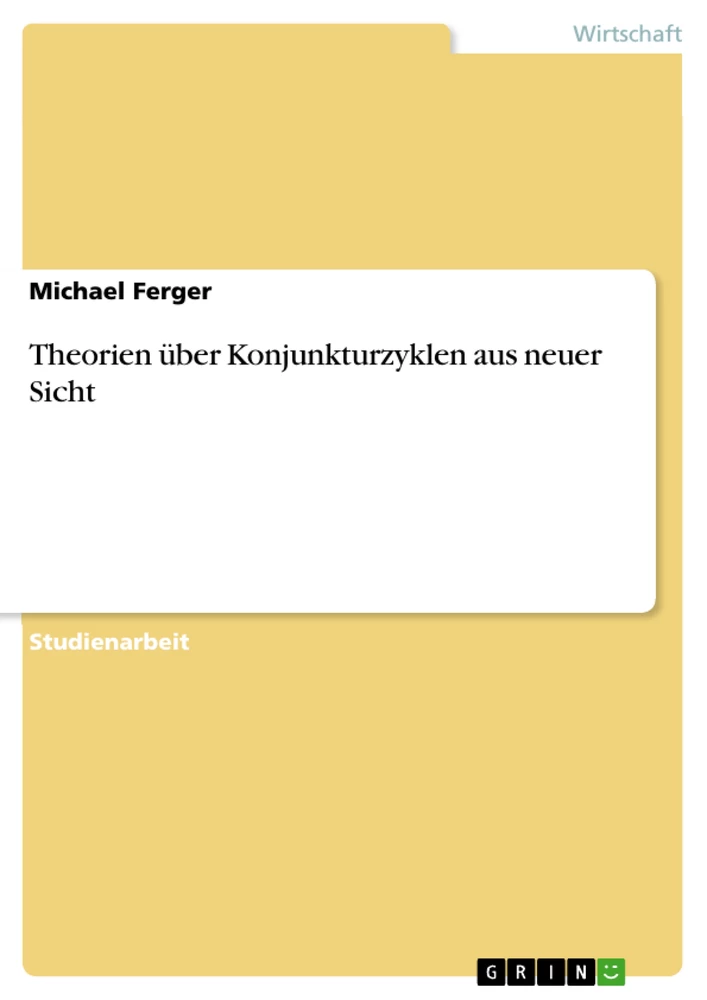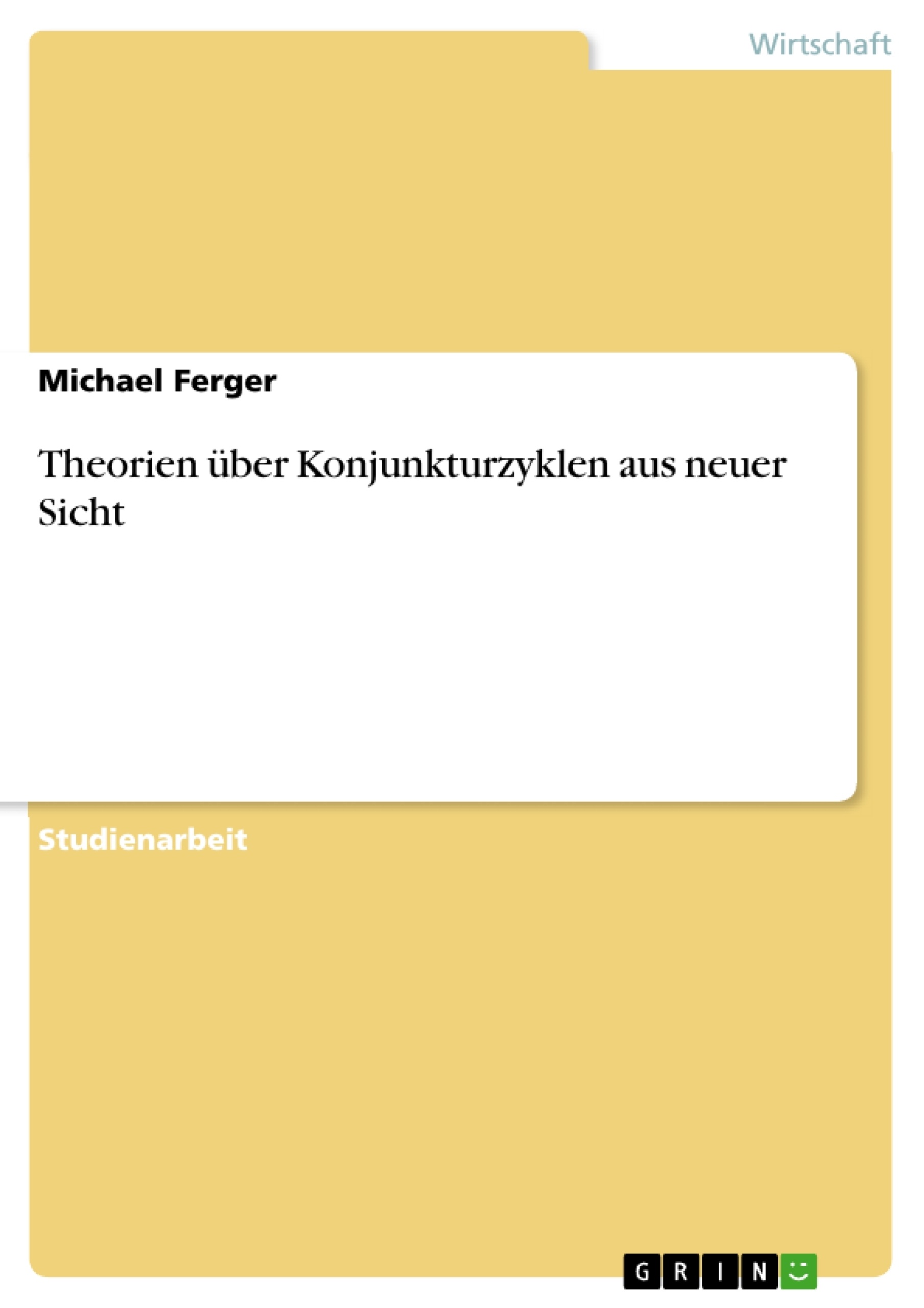Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, ob und in wieweit die Erforschung der Länge von Konjunkturzyklen nach dem heutigen Stand der Forschung noch von wissenschaftlicher und konjunkturpolitischer Relevanz ist.
Konjunkturzyklen werden in unterschiedlichster Form immer wieder beobachtet.
Ein in wenigen Jahren regelmäßig wiederkehrender konjunktureller Modellzyklus konnte jedoch nicht nachgewiesen werden. Erklärunsobjekt der Forschung sind heute Beobachtungen über das typische Entwicklungsverhalten von makroökonomischen Variablen auf kurze und mittlere Sicht, den sog. stilisierten Fakten.
Auch für andere neue Theorien wie die NKM, NCM oder RBC-Modelle existieren regelmäßige zyklische Schwankungen nicht, sondern nur zufällig, wobei aber gewisse Regelmäßigkeiten und Verlaufsmuster in Zeitreihen der ökonomischen Variablen erforscht werden.
„Long Swings“ nach Kuznets lassen sich mit demo-ökonomischen Erklärungsansetzen gut darstellen. Sie lassen sich im Wohnungsbau und der Infrastruktur plausibel mit Schwankungen der Heiratsziffer, Haushaltsgründungen und Ein- bzw. Auswanderungen in Beziehung setzen, jedoch bleibt die empirische Basis sehr schmal und unsicher. Siegenthaler erklärt sie aus der Interaktion zwischen längerem Wachstum und sozio-politischen bzw. kultu-rellem Wandel.
Auch der Nachweis der „Langen Wellen“ ist bisher theoretisch und empirisch unbefriedigend gelungen. Langfristige Trendschwankungen sind nur mit historisch singulären Schocks begründbar. Eine Art „Meta-Theorie“ wäre erforderlich, wie von Bornschier vorgestellt, die alle wesentlich erscheinenden Dimensionen des sozialen, kulturellen, politischen und ökonomischen Wandels einbezieht.
Die Untersuchung von „Langen Wellen“ zeigt, dass sie auf den Normalzyklus zurück verweist und auf die Zusammenhänge zwischen aufeinanderfolgenden Normalzyklen. So ist es wenig sinnvoll, Juglar-Zyklen als separates Phänomen zu untersuchen, weist doch die Untersuchung „Langer Wellen“ auf die zentrale Bedeutung des Trends und periodischer Wechsel in Trendrate und –richtung hin.
Für den Wirtschaftshistoriker erscheint es wichtig, Trend und Zyklus in übergreifende soziale und politische Verhältnisse eingebunden zu sehen.
P. Krugman plädiert in diesem Kontext für einen neuen Typ von Wissenschaftler, der zunächst beobachtet, nicht interpretiert: Den Wirtschaftshistorikerer
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Konjunktur und Wachstum
- 2.1. Konjunktur
- 2.2. Wachstum
- 3. Konjunkturmodelle
- 3.1. Juglar-Zyklen
- 3.2. Kitchin-Zyklen
- 3.3. Kuznets-Zyklen
- 3.4. Kondratieff-Zyklen
- 3.5. Weitere Zyklusmodelle
- 4. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die wissenschaftliche und konjunkturpolitische Relevanz der Erforschung von Konjunkturzyklen. Sie beleuchtet die Entwicklung von Konjunktur- und Wachstumstheorien seit Mitte des 19. Jahrhunderts und analysiert neuere Forschungsergebnisse, insbesondere zu „langen Wellen“. Der Fokus liegt auf der Darstellung frequenzdefinierter Konjunktur- und Wachstumzyklen und der Bewertung ihrer Relevanz.
- Relevanz der Konjunkturzyklusforschung
- Entwicklung von Konjunktur- und Wachstumstheorien
- Analyse verschiedener Konjunkturmodelle (Juglar, Kitchin, Kuznets, Kondratieff)
- Bewertung neuerer Forschungsergebnisse zu „langen Wellen“
- Definition und Unterscheidung von Konjunktur- und Wachstumsschwankungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der aktuellen Relevanz der Erforschung von Konjunkturzyklen in Bezug auf Wissenschaft und Konjunkturpolitik. Sie beleuchtet den historischen Kontext der Entwicklung von Konjunktur- und Wachstumstheorien seit Mitte des 19. Jahrhunderts, deren Ziel die frühzeitige Erkennung von Krisen und die Erstellung genauer Vorhersagen für Wirtschaft und Politik war. Die Arbeit betont den Wandel in der Konjunkturforschung seit den 1970er Jahren, weg von der Erklärung regelmäßiger Zyklen hin zur Betrachtung zufälliger Schwankungen mit gewisser Regelmäßigkeit. Der Fokus liegt auf neueren Arbeiten zur Relevanz von Zykluslängen, insbesondere „langer Wellen“, die verstärkt in rezessiven Zeiten von Wirtschaftshistorikern untersucht werden. Die Arbeit kündigt die Darstellung und Analyse frequenzdefinierter Konjunktur- und Wachstumzyklen sowie die Bewertung neuerer Forschungsergebnisse an, wobei die mathematische Analyse der Zyklen ausgeblendet wird.
2. Konjunktur und Wachstum: Dieses Kapitel definiert die Begriffe Konjunktur, Wachstum und Trend, um die empirischen Daten mit theoretischen Konzepten abzugleichen. Es wird die Unterscheidung zwischen Konjunktur- und Wachstumsschwankungen erläutert, wobei die Frage nach der Berechenbarkeit kurzfristiger Konjunkturzyklen im Verhältnis zu langfristigen Wachstumsschwankungen als grundlegend für die Relevanz von Zyklustheorien herausgestellt wird. Die Konjunkturtheorie wird als makroökonomische Theorie vorgestellt, die wellenförmige Veränderungen der wirtschaftlichen Aktivität analysiert und berechnet. Der klassische Konjunkturzyklus nach Schumpeter (Erholung, Prosperität, Rezession, Depression) wird beschrieben und die unterschiedlichen Zykluslängen anhand empirischer Untersuchungen von Zeitreihen (z.B. BIP oder Diffusionsindex) erläutert. Das Kapitel zeigt die Entwicklung des BIP in Deutschland von 1850-2000, um einen langfristigen Trend zu veranschaulichen, wobei Abweichungen auf Kriegsjahre und spezifische Situationen hinweisen.
Schlüsselwörter
Konjunkturzyklen, Wachstumstheorien, Konjunkturmodelle, Juglar-Zyklen, Kitchin-Zyklen, Kuznets-Zyklen, Kondratieff-Zyklen, Lange Wellen, Wirtschaftswachstum, BIP, Diffusionsindex, Rezessionsphasen, makroökonomische Variablen, Zeitreihenanalyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: [Titel des Textes einfügen]
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über Konjunkturzyklen und Wachstumstheorien. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse verschiedener Konjunkturmodelle (Juglar, Kitchin, Kuznets, Kondratieff) und der Bewertung neuerer Forschungsergebnisse zu "langen Wellen". Die mathematische Analyse der Zyklen wird jedoch ausgeblendet.
Welche Konjunkturmodelle werden behandelt?
Der Text behandelt die Konjunkturmodelle von Juglar, Kitchin, Kuznets und Kondratieff. Zusätzlich werden weitere Zyklusmodelle erwähnt, jedoch nicht im Detail analysiert.
Was ist die Zielsetzung des Textes?
Die Arbeit untersucht die wissenschaftliche und konjunkturpolitische Relevanz der Erforschung von Konjunkturzyklen. Sie beleuchtet die Entwicklung von Konjunktur- und Wachstumstheorien seit Mitte des 19. Jahrhunderts und analysiert neuere Forschungsergebnisse, insbesondere zu „langen Wellen“. Der Fokus liegt auf der Darstellung frequenzdefinierter Konjunktur- und Wachstumzyklen und der Bewertung ihrer Relevanz.
Wie werden Konjunktur und Wachstum definiert und unterschieden?
Der Text definiert die Begriffe Konjunktur, Wachstum und Trend und erläutert die Unterscheidung zwischen Konjunktur- und Wachstumsschwankungen. Die Berechenbarkeit kurzfristiger Konjunkturzyklen im Verhältnis zu langfristigen Wachstumsschwankungen wird als grundlegend für die Relevanz von Zyklustheorien herausgestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Text?
Schlüsselwörter sind: Konjunkturzyklen, Wachstumstheorien, Konjunkturmodelle, Juglar-Zyklen, Kitchin-Zyklen, Kuznets-Zyklen, Kondratieff-Zyklen, Lange Wellen, Wirtschaftswachstum, BIP, Diffusionsindex, Rezessionsphasen, makroökonomische Variablen, Zeitreihenanalyse.
Welche Kapitel sind enthalten und worum geht es in ihnen?
Der Text umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zu Konjunktur und Wachstum, ein Kapitel zu Konjunkturmodellen und ein Resümee. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den historischen Kontext dar. Das Kapitel zu Konjunktur und Wachstum definiert die zentralen Begriffe und erläutert den klassischen Konjunkturzyklus. Das Kapitel zu Konjunkturmodellen analysiert die verschiedenen Modelle im Detail. Das Resümee fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Bedeutung haben "lange Wellen" im Kontext des Textes?
„Lange Wellen“ (Kondratieff-Zyklen) werden als wichtiger Aspekt neuerer Forschungsergebnisse betrachtet, die verstärkt in rezessiven Zeiten von Wirtschaftshistorikern untersucht werden. Der Text analysiert deren Relevanz im Kontext der Konjunkturzyklen.
Worum geht es im Kapitel "Konjunktur und Wachstum"?
Dieses Kapitel definiert Konjunktur, Wachstum und Trend und unterscheidet zwischen Konjunktur- und Wachstumsschwankungen. Es beschreibt den klassischen Konjunkturzyklus nach Schumpeter und erläutert unterschiedliche Zykluslängen anhand empirischer Untersuchungen von Zeitreihen (z.B. BIP oder Diffusionsindex). Die Entwicklung des BIP in Deutschland von 1850-2000 wird als Beispiel für einen langfristigen Trend gezeigt.
- Citar trabajo
- Michael Ferger (Autor), 2009, Theorien über Konjunkturzyklen aus neuer Sicht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/149761