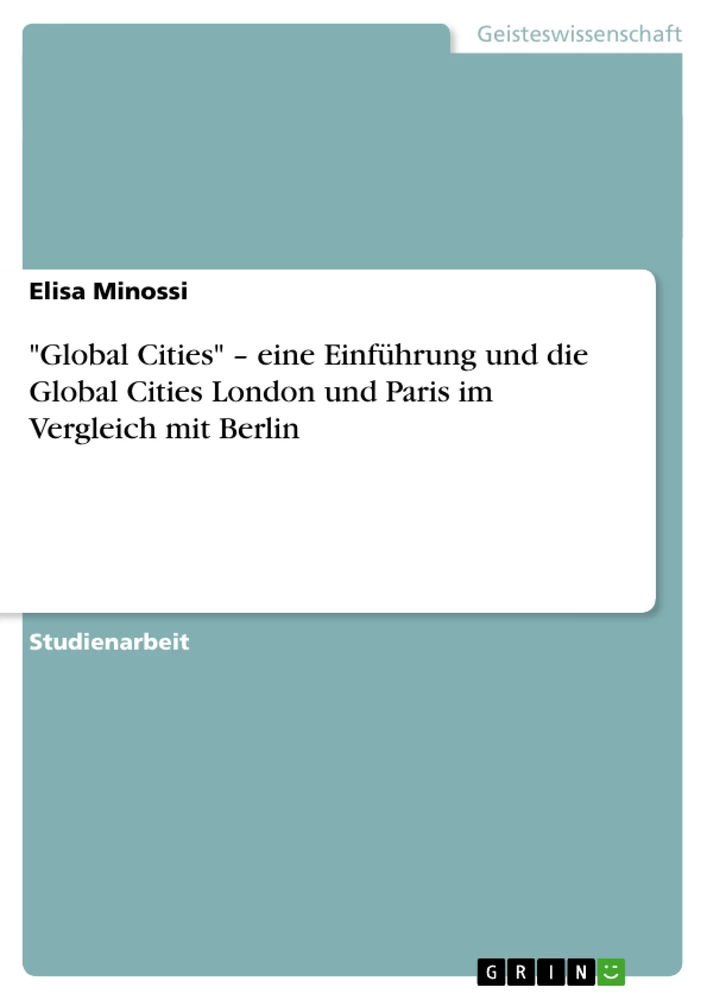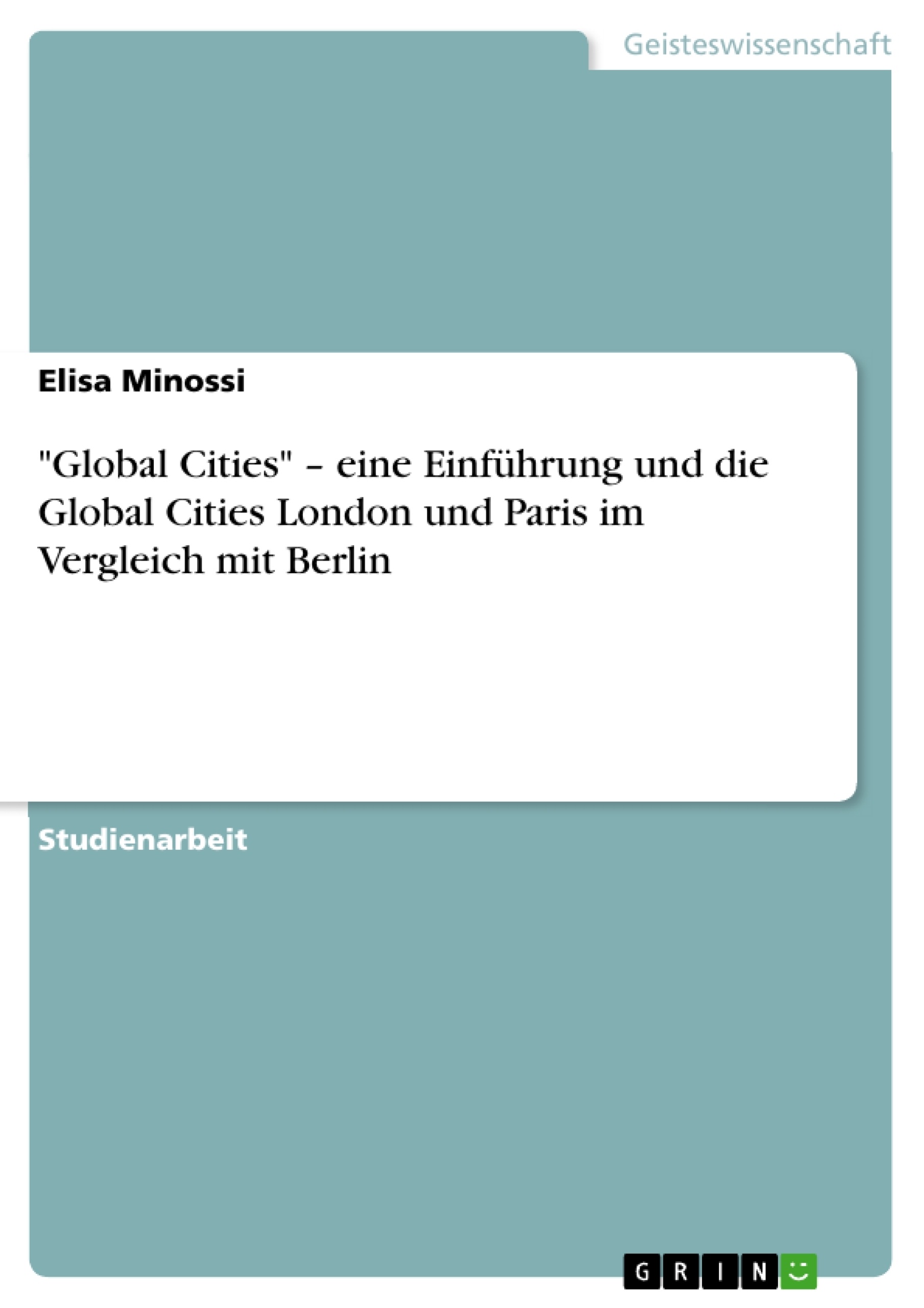In der vorliegenden Arbeit wird zunächst eine Einführung in die Thematik der Global Cities gegeben.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Entwicklung der Global City-Forschung. Konrad Olbricht beobachtete bereits in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts Weltstädte und Peter Hall forschte seit 1966 auf dem Gebiet der globalen Städteentwicklung. In den 80er Jahren traten Friedmann und Wolf, Feagin und Smith verstärkt in Erscheinung. Friedmann und Wolf entwickelten 1982 eine Global-City-Zusammenstellung anhand von sieben Merkmalen. 1986 erarbeitet Friedmann die sieben Weltstadthypothesen mit einer vierstufigen Hierarchie von World Cities. Feagin und Smith begannen ab 1987 eine Hierarchisierung der Kommandozentralen. Saskia Sassen benennt 1996 drei Punkte für Global Cities. Die Arbeiten der Forschergruppe GaWC (Globalization and World Cities) werden erläutert, da diese Forschergruppe mit Sitz in Großbritannien sich seit einigen Jahren ausschließlich mit dem Thema der Global Cities auseinandersetzt. Professor Peter Taylor, Direktor der GaWC, entwickelte den methodischen Ansatz für die vergleichende Metropolenforschung und geht von einem „Weltstadtnetzwerk“ aus, das auf den Organisationsstrukturen transnationaler Dienstleistungsfirmen basiert. Das Netzwerkmodell der GaWC basiert auf der Feststellung, dass es die Dienstleistungsunternehmen sind, die interurbane transnationale Verflechtungen auf- und ausbauen, und nicht die Städte allein.
Im Anschluss daran werden Berlin, London und Paris genauer betrachtet. Bei den drei europäischen Städten geht es um die Frage, weshalb London und Paris als Global Cities bezeichnet werden und Berlin nicht bzw. noch nicht als Global City gilt. Berlin hat sich zum Ziel gesetzt bis 2015 eine relevante Stellung innerhalb des Kreises der Global Cities einzunehmen, doch bisher scheint sich dieses Vorhaben nicht verwirklichen zulassen. In welcher Situation sich die Stadt Berlin momentan befindet und welche Gründe es für den Status einer „Nicht-Global City“ gibt, wird sich im Kapitel 5 und im Endkapitel dieser Arbeit zeigen.
London ist die unangefochtene Global City auf dem europäischen Kontinent. Im Vergleichskapitel 5 werden die wichtigsten Faktoren, welche die Stadt London kennzeichnen, dargelegt. Paris gilt gleich hinter London in Europa als bedeutende Global City, auch wenn darüber in der Literatur nicht immer Einigkeit herrscht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff Global City
- Die Entwicklung der Global City-Forschung
- Wichtige Forscher auf dem Gebiet der Global Cities
- John Friedmanns sieben Weltstadthypothesen
- Die Global-City-These von Saskia Sassen
- Die Arbeiten der GaWC
- Berlin im Vergleich mit London und Paris - ist Deutschlands Hauptstadt bald auch "Global City"?
- Zusammenfassung und Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Global Cities, insbesondere im Vergleich von Berlin, London und Paris. Ziel ist es, den Begriff "Global City" zu definieren, die Entwicklung der Forschung auf diesem Gebiet nachzuzeichnen und die Position Berlins im Kontext der anderen beiden europäischen Metropolen zu analysieren. Die Arbeit untersucht, warum London und Paris als Global Cities gelten und welche Faktoren Berlins Etablierung als solche behindern.
- Definition und Entwicklung des Begriffs "Global City"
- Wichtige Forschungsansätze zur Global City-Thematik (Friedmann, Sassen, GaWC)
- Vergleich der Global City-Merkmale von London und Paris
- Analyse der Herausforderungen für Berlin auf dem Weg zur "Global City"
- Bewertung der Rolle von Dienstleistungsunternehmen in der Entstehung von Global Cities
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Global Cities ein und beschreibt den wachsenden Stellenwert der Stadtgeographie im Kontext der Globalisierung. Sie hebt die Bedeutung von Global Cities als Zentren des Finanzwesens, des Handels und der Politik hervor und weist auf die unterschiedlichen Forschungsansätze hin, die sich mit diesem Thema befassen. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau und die zentralen Fragestellungen, die sie behandeln wird, insbesondere den Vergleich Berlins mit London und Paris.
Der Begriff Global City: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs "Global City". Es erläutert die verschiedenen Bezeichnungen wie "World City", "International City" und "Globalizing City" und zeigt die Synonymität der Begriffe "World Cities" und "Global Cities". Der Fokus liegt auf der weltweiten Bedeutung dieser Städte und der Konzentration ökonomischer und finanzieller Entscheidungsprozesse in ihnen. Das Kapitel verweist auf die historische Entwicklung des Begriffs und seine Etablierung durch Forscher wie Saskia Sassen.
Die Entwicklung der Global City-Forschung: Dieses Kapitel beschreibt die historische Entwicklung der Global City-Forschung. Es erwähnt frühe Beobachtungen von Weltstädten durch Konrad Olbricht und Peter Hall und beleuchtet die Beiträge von Friedmann und Wolf, Feagin und Smith sowie Saskia Sassen. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung unterschiedlicher Ansätze zur Definition und Hierarchisierung von Global Cities und der methodischen Weiterentwicklung der Forschung, insbesondere durch die GaWC.
Wichtige Forscher auf dem Gebiet der Global Cities: Dieses Kapitel analysiert detailliert die Forschungsbeiträge von John Friedmann (seine sieben Weltstadthypothesen), Saskia Sassen (ihre Global-City-These) und der GaWC (Globalization and World Cities). Es beschreibt die unterschiedlichen Perspektiven und Methoden der Forscher und zeigt deren Bedeutung für das Verständnis von Global Cities. Die verschiedenen Ansätze werden miteinander verglichen und kritisch bewertet.
Berlin im Vergleich mit London und Paris - ist Deutschlands Hauptstadt bald auch "Global City"? Dieses Kapitel vergleicht Berlin mit London und Paris, um zu untersuchen, warum London und Paris als Global Cities gelten, Berlin aber (noch) nicht. Es analysiert die Stärken und Schwächen Berlins im Kontext der beiden anderen Metropolen. Der Fokus liegt auf den Faktoren, die Berlins Entwicklung als Global City beeinflussen und auf die Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt.
Schlüsselwörter
Global Cities, Weltstädte, Globalisierung, Stadtgeographie, London, Paris, Berlin, John Friedmann, Saskia Sassen, GaWC, Dienstleistungsunternehmen, Metropolenforschung, transnationale Verflechtungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Global Cities - Berlin im Vergleich mit London und Paris
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Phänomen der Global Cities, insbesondere im Vergleich von Berlin, London und Paris. Sie definiert den Begriff "Global City", verfolgt die Entwicklung der Forschung nach und untersucht Berlins Position im Kontext der beiden anderen europäischen Metropolen. Die Arbeit beleuchtet die Faktoren, die London und Paris zu Global Cities machen und die Herausforderungen für Berlin auf diesem Weg.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Entwicklung des Begriffs "Global City", wichtige Forschungsansätze (Friedmann, Sassen, GaWC), einen Vergleich der Global City-Merkmale von London und Paris, eine Analyse der Herausforderungen für Berlin und die Rolle von Dienstleistungsunternehmen bei der Entstehung von Global Cities.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Definition des Begriffs "Global City", Entwicklung der Global City-Forschung, wichtigen Forschern (Friedmann, Sassen, GaWC), einem Vergleich von Berlin, London und Paris und abschließend einer Zusammenfassung und Schlussbetrachtung.
Welche Forscher werden behandelt?
Die Arbeit analysiert die Beiträge von John Friedmann (sieben Weltstadthypothesen), Saskia Sassen (Global-City-These) und der GaWC (Globalization and World Cities). Ihre unterschiedlichen Perspektiven und Methoden werden verglichen und kritisch bewertet.
Wie wird Berlin im Vergleich zu London und Paris dargestellt?
Das Kapitel zu Berlin vergleicht die Stadt mit London und Paris, um zu erklären, warum London und Paris als Global Cities gelten und welche Faktoren Berlins Etablierung als Global City (noch) behindern. Stärken und Schwächen Berlins werden im Kontext der beiden anderen Metropolen analysiert.
Was sind die Schlüsselwörter der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Global Cities, Weltstädte, Globalisierung, Stadtgeographie, London, Paris, Berlin, John Friedmann, Saskia Sassen, GaWC, Dienstleistungsunternehmen, Metropolenforschung, transnationale Verflechtungen.
Wo finde ich das Inhaltsverzeichnis?
Das Inhaltsverzeichnis befindet sich im oberen Teil des Dokuments und listet alle Kapitel der Arbeit auf, beginnend mit der Einleitung und endend mit der Zusammenfassung und Schlussbetrachtung. Es enthält auch Unterpunkte zu den wichtigsten Aspekten der Forschung zu Global Cities.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung der Arbeit ist die Definition des Begriffs "Global City", die Nachzeichnung der Forschungsentwicklung und die Analyse der Position Berlins im Vergleich zu London und Paris. Es soll untersucht werden, warum London und Paris als Global Cities gelten und welche Faktoren Berlins Etablierung behindern.
Gibt es Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, die die wichtigsten Punkte und Erkenntnisse jedes Kapitels hervorheben. Diese Zusammenfassungen erleichtern das Verständnis des Gesamtinhalts und bieten einen schnellen Überblick über die behandelten Themen.
- Quote paper
- Elisa Minossi (Author), 2010, "Global Cities" – eine Einführung und die Global Cities London und Paris im Vergleich mit Berlin , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/149749