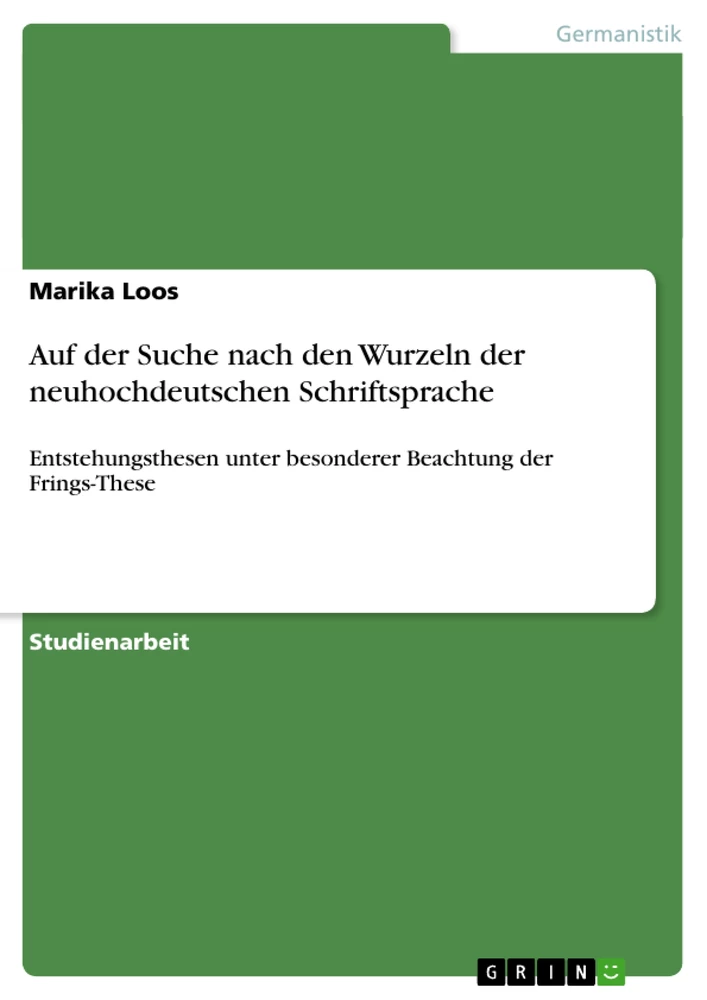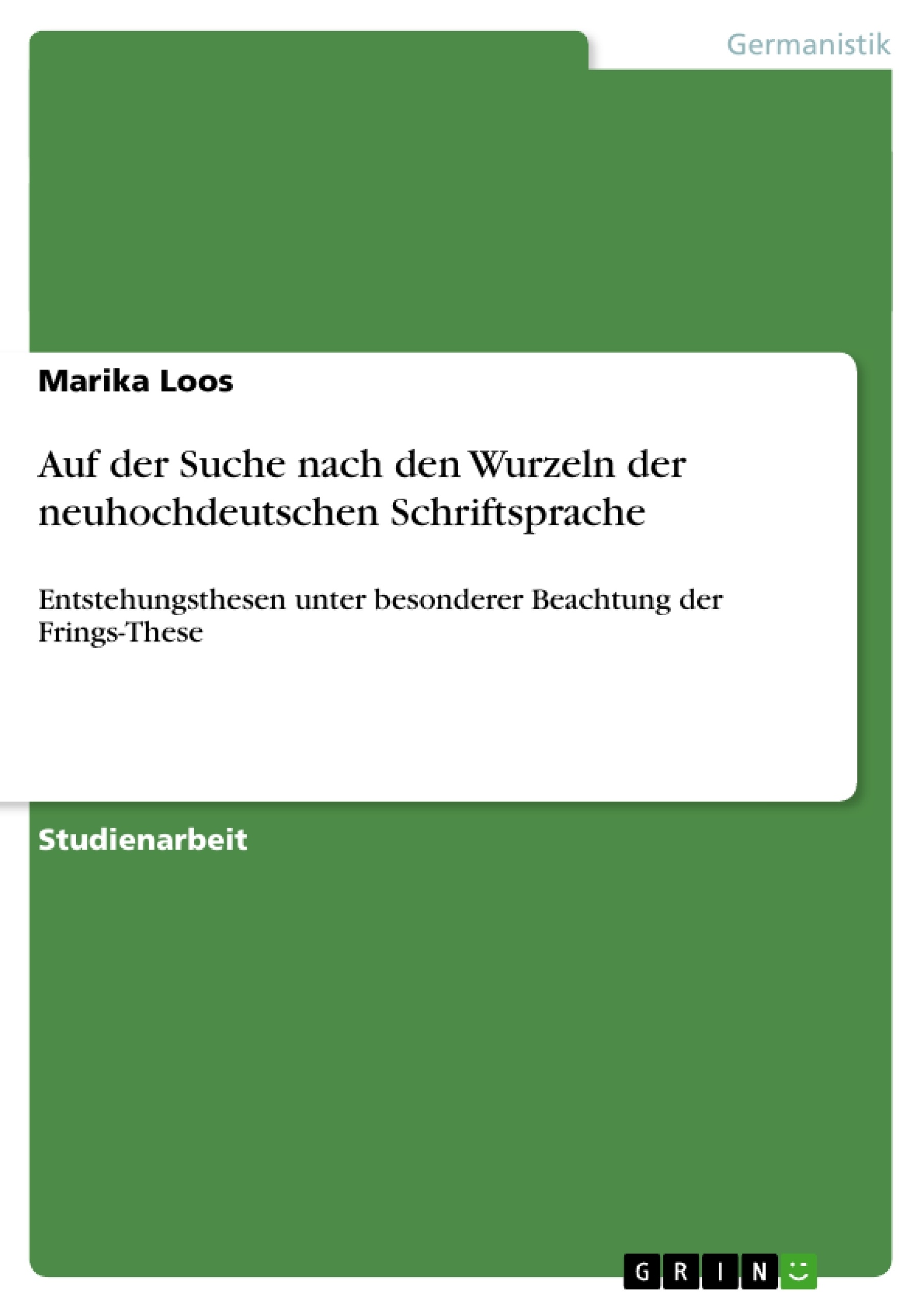Neuhochdeutsch bezeichnet den neueren und neuesten hochdeutschen Sprachzustand. Diesem ging die Schreibsprache des Frühneuhochdeutschen voraus. Obwohl der Terminus Frühneuhochdeutsch eine Einheitlichkeit von geschriebener und gesprochener Sprache suggeriert, handelte es sich um eine Schreibsprache in einer Zeit des Übergangs, der etwa von 1350 bis 1650 stattfand, dass heißt zwischen Spätmittelalter und Dreißigjährigem Krieg. Charakterisierend für diese Periode war eine vielfältige Schreibdialektlandschaft, aber auch, dass diese Vielfalt im Übergang zum Neuhochdeutschen zu Gunsten einer verhältnismäßig einheitlichen Schriftsprache aufgegeben wurde. Im Vergleich zu den Schriftsprachen anderer Nationen hat sich die neuhochdeutsche Schriftsprache recht spät entwickelt. Eine der Hauptursachen dafür stellte die plurizentrische Struktur und die Konkurrenz mehrerer Zentren im deutschen Sprachgebiet dar. Demzufolge war keine politische, kulturelle und wirtschaftliche Einheit gegeben. Aufgrund dessen kann man im gesamten Mittelalter und sogar noch im 15. Jahrhundert von einer „grundsätzlichen territorialen Begrenztheit aller deutschsprachigen Schreibprodukte“ sprechen. Da dennoch die Notwendigkeit, überregional zu kommunizieren, bereits im Mittelalter immer akuter wurde, vollzog sich ein vereinheitlichender Prozess. Wie vollzog sich nun dieser langwierige schriftliche Einigungsprozess, der sich sehr kompliziert entwickelt haben muss?
Ziel dieser Arbeit ist es, die sich teilweise sehr stark widersprechenden Theorien über diese Vereinheitlichung der Schriftsprache und die Entstehung des Neuhochdeutschen zu untersuchen. Wo war die ‚Wiege’ der neuhochdeutschen Schriftsprache, und wer sind die möglichen ‚Schöpfer’ und fördernden Instanzen gewesen? In Kapitel 2.1. erfolgt zunächst eine Skizze der älteren Forschungsmeinungen von MÜLLENHOFF und BURDACH aus dem 19. Jahrhundert. Den Schwerpunkt dieser Arbeit soll die Frings-These aus den 1930er Jahren darstellen, zumal diese in mehr oder weniger modifizierter Form lange Zeit immer wieder vorgetragen wurde und für die Sprachgeschichtsforschung sehr bedeutend war. (...) Dabei soll weiterhin die Überlegung im Auge behalten werden, ob das Meißnische Deutsch der Neuhochdeutschen Schriftsprache Modell gestanden haben könnte?
Inhaltsverzeichnis
- AUF DER SUCHE NACH DEN WURZELN DER NEUHOCHDEUTSCHEN SCHRIFTSPRACHE
- ENTSTEHUNGSTHESEN UNTER BESONDERER BEACHTUNG DER FRINGS-THESE -
- 1. DIE, WIEGE' DER NEUHOCHDEUTSCHEN SCHRIFTSPRACHE
- 2. ENTSTEHUNGSTHESEN DER NEUHOCHDEUTSCHEN SCHRIFTSPRACHE
- 2.1. ÄLTERE FORSCHUNGSMEINUNGEN
- 2.1.1. MÜLLENHOFFS KONTINUITÄTSTHEORIE VON 1863
- 2.1.2. BURDACHS PRAG-THESE VON 1884
- 2.1.3. DER ÜBERGANG ZUR FRINGS-THESE
- 2.2. DIE FRINGS-THESE
- 2.2.1. ZUR PERSON DES GERMANISTEN THEODOR FRINGS
- 2.2.2. DIE DEUTSCHE OSTKOLONISATION UND SPRACHLICHER AUSGLEICH
- 2.2.3. AUBERSPRACHLICHE KRITERIEN
- 2.2.4. SPRACHLICHE ARGUMENTE
- 2.2.5. KRITISCHE BETRACHTUNG
- 2.3. FORSCHUNGSANSICHTEN IN DEN 1950ER BIS 1980ER JAHREN
- 2.4. HAUPTTENDENZEN DER NEUEREN FORSCHUNG
- 3. DER HARTNÄCKIGE BEIGESCHMACK DES SPEKULATIVEN
- 4. ANHANG
- 5. BIBLIOGRAFIE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache und untersucht verschiedene Theorien, die diese Entwicklung erklären wollen. Der Fokus liegt dabei auf der Frings-These, die die Bedeutung der deutschen Ostkolonisation für die Herausbildung einer einheitlichen Schriftsprache hervorhebt. Die Arbeit analysiert die Argumente der Frings-These, sowohl auf außersprachlicher als auch sprachlicher Ebene, und setzt sie in Beziehung zu anderen Forschungsansätzen.
- Die Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache
- Die Frings-These und ihre Bedeutung für die Sprachgeschichtsforschung
- Die Rolle der deutschen Ostkolonisation
- Die Entwicklung der Schriftsprache im Kontext der politischen und kulturellen Geschichte
- Die Bedeutung von Schreibdialekten und ihrer Vereinheitlichung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beleuchtet die "Wiege" der neuhochdeutschen Schriftsprache und stellt die historische Entwicklung der deutschen Schreibsprache vom Frühneuhochdeutschen bis zum Neuhochdeutschen dar. Es werden die Herausforderungen der Vereinheitlichung der Schriftsprache in einem plurizentrischen Sprachraum beleuchtet und die Notwendigkeit einer überregionalen Kommunikation im Mittelalter hervorgehoben.
Kapitel 2.1 widmet sich den älteren Forschungsmeinungen zur Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache. Es werden die Kontinuitätstheorie von MÜLLENHOFF und die Prag-These von BURDACH vorgestellt und kritisch analysiert. Die Argumente und Schwächen beider Thesen werden beleuchtet und die Bedeutung von Machtzentren und kulturellen Zentren für die Entwicklung der Schriftsprache diskutiert.
Kapitel 2.2 stellt die Frings-These im Detail vor. Es werden die Person des Germanisten THEODOR FRINGS, seine "Siedelraumtheorie" und die Rolle der deutschen Ostkolonisation für die sprachliche Entwicklung beleuchtet. Die Argumente der Frings-These werden auf außersprachlicher und sprachlicher Ebene analysiert, und es werden mögliche Kritikpunkte an seinem Konzept diskutiert.
Kapitel 2.3 gibt einen Überblick über die Forschungsansichten zur Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache in den 1950er bis 1980er Jahren. Es werden die wichtigsten Thesen und Debatten dieser Zeit beleuchtet und die Weiterentwicklung der Frings-These in der Forschung dargestellt.
Kapitel 2.4 beleuchtet die Haupttendenzen der neueren Forschung zur Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache. Es werden aktuelle Forschungsansätze und Debatten vorgestellt und die Bedeutung von interdisziplinären Perspektiven für die Sprachgeschichtsforschung hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache, die Frings-These, die deutsche Ostkolonisation, Schreibdialekte, die Vereinheitlichung der Schriftsprache, Machtzentren, kulturelle Zentren, Sprachgeschichte, Sprachentwicklung, Frühneuhochdeutsch, Neuhochdeutsch, plurizentrische Sprachräume, überregionale Kommunikation, historische Entwicklung, Forschungsansätze, Debatten, Kritikpunkte, Argumente, Sprachliche und außersprachliche Faktoren.
- Quote paper
- Referendarin Marika Loos (Author), 2008, Auf der Suche nach den Wurzeln der neuhochdeutschen Schriftsprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/149725