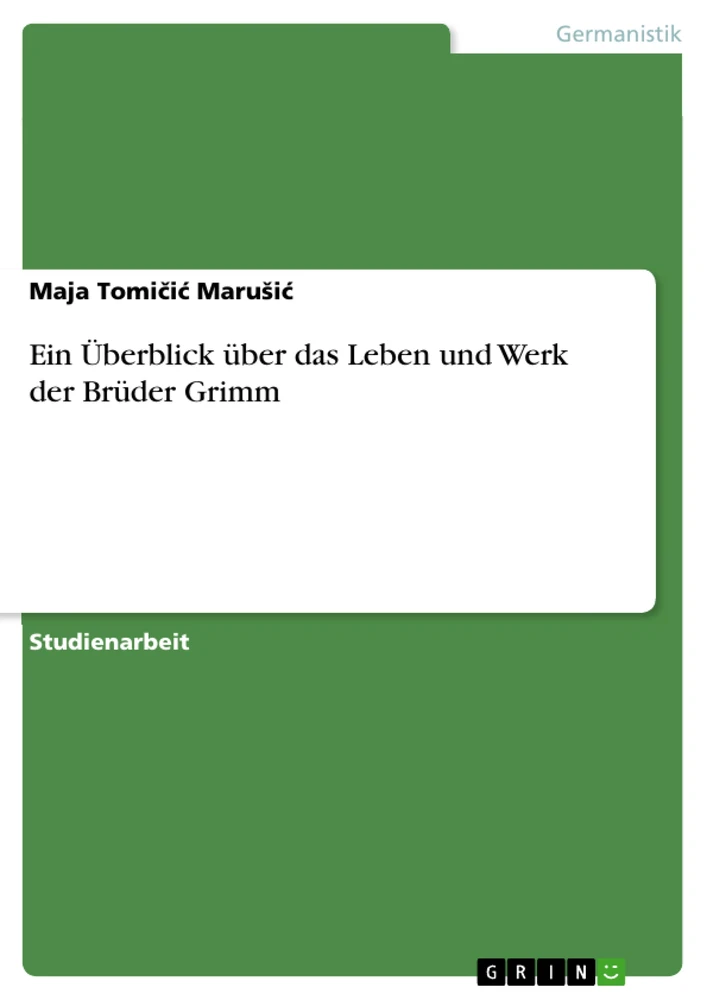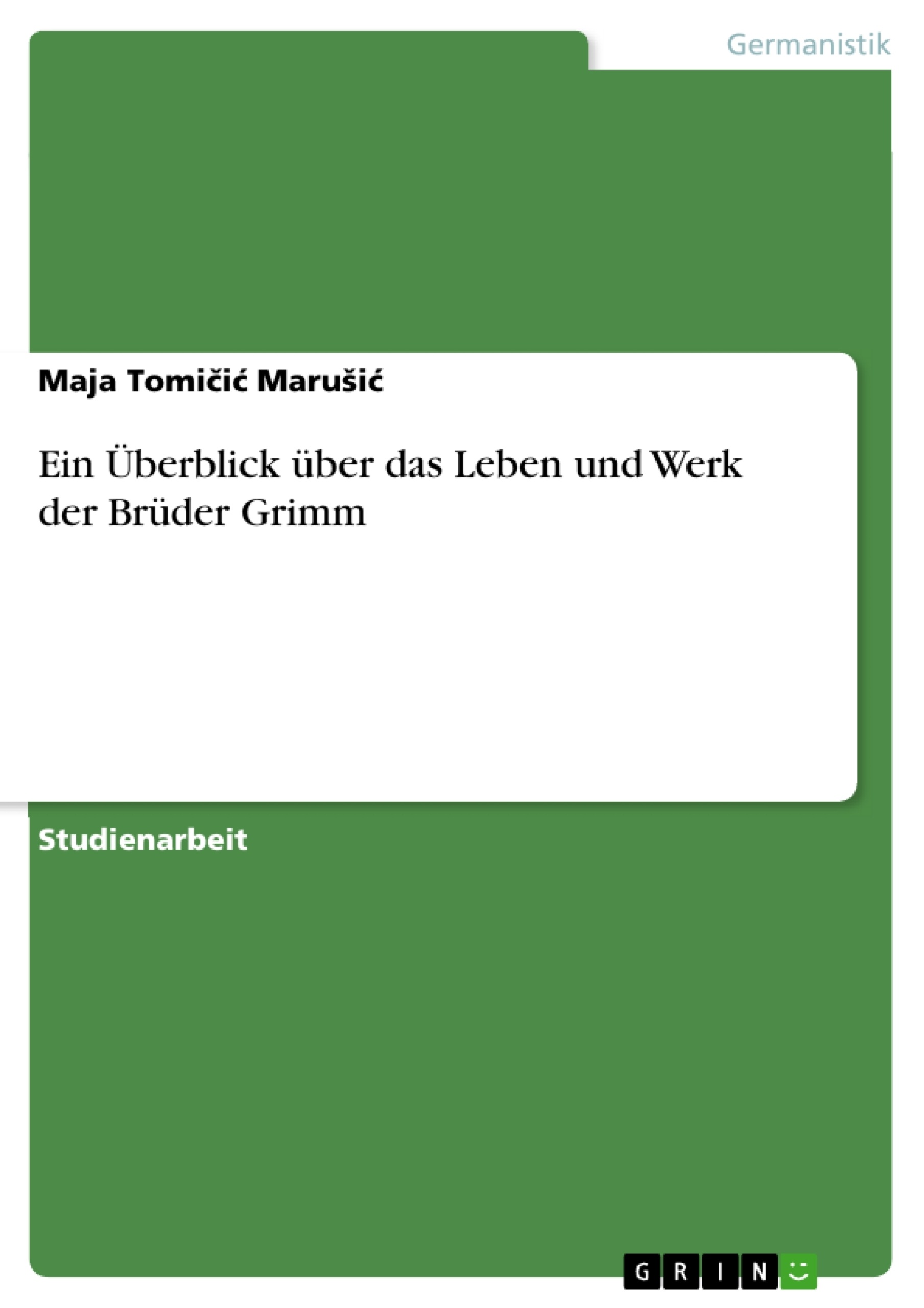Die Brüder Grimm, oft auch Gebrüder Grimm genannten Jacob und Wilhelm Grimm wurden in Hanau geboren, Jacob am 4. Januar 1785 und Wilhelm am 24. Februar 1786. Sie sind weltbekannt für ihre Märchensammlung "Kinder- und Hausmärchen" (KHM, volkstümlich "Grimms Märchen" genannt), aber ihre Tätigkeit war sehr vielfältig und reicht von der Sprachwissenschaft bis hin zur Politik.
In diesem Referat wird insbesondere das Gemeinsame in Leben und Arbeit der beiden Brüder dargestellt. Hier werden erstens die Biografie, die Werke, politische Tätigkeiten der Brüder Grimm, und besonders die deutsche Grammatik als auch Kinder- und Hausmärchen bearbeitet.
„Die Gemeinsamkeit und gegenseitige Ergänzung der beiden Brüder in Hinsicht auf deutsche Wissenschaft und Politik, Überzeugungstreue, Arbeitskraft und Richtung ihres Wirkens steht als ein seltenes Beispiel da...“ (Meyers Konversationslexikon von 1888). Diese vereinheitlichende Sicht auf die gemeinsame Leistung der Brüder mag der Grund dafür sein, dass sie auch nur als Doppelporträt dargestellt werden – ohne zuverlässige Angabe, welcher der beiden Jacob, welcher Wilhelm ist.
Inhalt
1. EINLEITUNG
2. BIOGRAPHIE
2.1 Schulbildung
2.2 Studium und Einfluss Carl von Savignys
2.3 Heidelberger Romantik
2.4 Karriere
3. WERK
3.1 Kinder- und Hausmärchen
3.2 Die Deutsche Grammatik
3.2.1 Das Grimmsche Gesetz
3.3 Das Deutsche Wörterbuch
3.3.1 Die Konzeption der Deutschen Wörterbuchs
3.4 Andere Werke
4. Politische Tätigkeit der Brüder Grimm
5. Schluss
Literatur
1. EINLEITUNG
Die Brüder Grimm, oft auch Gebrüder Grimm genannten Jacob und Wilhelm Grimm wurden in Hanau geboren, Jacob am 4. Januar 1785 und Wilhelm am 24. Februar 1786. Sie sind weltbekannt für ihre Märchensammlung "Kinder- und Hausmärchen" (KHM, volkstümlich "Grimms Märchen" genannt), aber ihre Tätigkeit war sehr vielfältig und reicht von der Sprachwissenschaft bis hin zur Politik.
In diesem Referat wird insbesondere das Gemeinsame in Leben und Arbeit der beiden Brüder dargestellt. Hier werden erstens die Biografie, die Werke, politische Tätigkeiten der Brüder Grimm, und besonders Die deutsche Grammatik als auch Kinder- und Hausmärchenbearbeitet.
„Die Gemeinsamkeit und gegenseitige Ergänzung der beiden Brüder in Hinsicht auf deutsche Wissenschaft und Politik, Überzeugungstreue, Arbeitskraft und Richtung ihres Wirkens steht als ein seltenes Beispiel da...“ (Meyers Konversationslexikon von 1888). Diese vereinheitlichende Sicht auf die gemeinsame Leistung der Brüder mag der Grund dafür sein, dass sie auch nur als Doppelporträt dargestellt werden – ohne zuverlässige Angabe, welcher der beiden Jacob, welcher Wilhelm ist.
2. BIOGRAPHIE
Der Geburtsort der Brüder Grimm, Hanau, liegt im heutigen Bundesland Hessen. Die Eltern der Brüder Grimm waren Philipp Wilhelm Grimm und Dorothea Grimm (geb. Zimmer). Philipp Wilhelm Grimm (1751–1796) war ein Jurist und Amtmann (eine Art Verwaltungsbeamter) in Hanau. Dorothea Grimm (1755–1808) war Hausfrau und kümmerte sich um die Familie. Sie stammte aus einer angesehenen Familie in Kassel.
Jacob und Wilhelm Grimm hatten noch mehrere Geschwister. Insgesamt hatten sie fünf Geschwister:
- Friedrich Hermann Georg Grimm (1783–1784): Er verstarb im Kindesalter.
- Carl Friedrich Grimm (1787–1852): Er war der dritte Sohn der Familie und wurde Rechtsanwalt.
- Ferdinand Philipp Grimm (1788–1845): Er arbeitete als Soldat und später als Bibliothekar.
- Ludwig Emil Grimm (1790–1863): Er war Maler und Kupferstecher und ist bekannt für seine Porträts und Illustrationen, unter anderem von seinen berühmten Brüdern.
- Charlotte Amalie Grimm (1793–1833): Sie war die einzige Schwester der Brüder Grimm und hatte eine enge Beziehung zu ihnen.
2.1 Schulbildung
Nach dem frühen Tod ihres Vaters im Jahr 1796 hatte die Familie Grimm mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen, was die Brüder Grimm zu einem starken Arbeitsethos und einer engen Zusammenarbeit motivierte. Die Familie fand Unterstützung bei den Verwandten in Steinau. Die Mutter wollte ihren Söhnen trotz Schwierigkeiten eine angemessene Bildung ermöglichen und schickte sie aus diesem Grund nach Kassel zu ihrer Tante. Sie besuchten dort das Friedrichsgymnasium in Kassel, wo sie durch ihre akademischen Leistungen auffielen. Sie waren fleißige Schüler, und besonders Jacob zeichnete sich durch seine Disziplin und sein starkes Pflichtgefühl aus.
2.2 Studium und Einfluss Carl von Savignys
1802 begann Jacob sein Jurastudium an der Universität Marburg, gefolgt von Wilhelm im Jahr 1803. An der Universität Marburg wurden sie stark von Friedrich Carl von Savigny, einem bedeutenden Rechtsgelehrten, beeinflusst, der ihr Interesse an der deutschen Literatur und der mittelalterlichen Literatur weckte.
Carl von Savigny (1779–1861) war ein bedeutender deutscher Rechtswissenschaftler und Historiker, der vor allem für seine Beiträge zur Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie bekannt ist. Seine Bedeutung für die Brüder Grimm liegt in der Rolle, die er in ihrer akademischen und intellektuellen Entwicklung spielte, und zwar in mehreren Aspekten. Erstens übte er Einfluss auf die sprach- und literaturwissenschaftlerische Tätigkeit der Brüder. Er war ein wichtiger Mentor und Unterstützer der Brüder Grimm, als diese sich mit der Sammlung und Untersuchung von Volksmärchen und -sagen beschäftigten. Savigny teilte ihr Interesse an der deutschen Volksliteratur und förderte ihre Arbeit auf diesem Gebiet. Savigny betonte auch die Bedeutung des Studiums von Volksliteratur und mittelalterlicher Texte zur Erforschung der nationalen Kultur und Geschichte, was die Brüder Grimm zur Forschung anregte.
Außerdem unterstützte Savigny die Brüder Grimm in ihrer akademischen Karriere und vermittelte ihnen wichtige Kontakte in der wissenschaftlichen und literarischen Gemeinschaft. Dies trug zur Etablierung ihrer Karriere als bedeutende Forscher und Literaten bei. Als Professor an der Universität Marburg, wo Jacob und Wilhelm Grimm studierten, half er dabei, ihre akademische Ausbildung und Forschung zu unterstützen und förderte ihre intellektuelle Entwicklung.
Jacob Grimm, beeinflusst von Savignys Betonung der historischen Forschung, entwickelte das "Grimm'sche Gesetz" zur Lautverschiebung in der indogermanischen Sprachfamilie. Savignys Fokus auf die historische und kulturelle Dimension der Rechtswissenschaft beeinflusste die Brüder Grimm bei ihrer wissenschaftlichen Methodik. Savignys Arbeiten zur Rechtsgeschichte und seine Methode der historischen Forschung beeinflussten die Brüder Grimm, die ebenfalls historische und kulturelle Dimensionen in ihrer Arbeit berücksichtigen wollten.
2.3 Heidelberger Romantik
Die Brüder Grimm entwickelten eine enge Verbindung zu anderen Studenten und Gelehrten, die später als "Heidelberger Romantik" bekannt wurde.
Die Heidelberger Romantik war eine literarische und intellektuelle Bewegung, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Heidelberg, Deutschland, ihren Ursprung hatte. Sie ist Teil der größeren Epoche der Romantik, die sich durch ein starkes Interesse an der Natur, dem Mittelalter, der Volkskunst und der Betonung individueller Emotionen und Phantasie auszeichnete. Obwohl die Brüder Grimm nicht in Heidelberg lebten, standen sie in engem Kontakt zu den Schriftstellern, die zu dieser Bewegung gehörten. Zu den bekannten Vertretern der Heidelberger Romantik zählen unter anderen Clemens Brentano, Achim von Arnim, Joseph von Eichendorff, Heinrich von Kleist u.a. Die Bedeutung der Brüder Grimm für diese Bewegung besteht in der Sammlung und Veröffentlichung der Märchen und Sagen, um die „ursprüngliche“ deutsche Kultur zu bewahren und zu fördern.
2.4 Karriere
Nach dem Studium arbeiteten beide Brüder in verschiedenen staatlichen Positionen. Jacob wurde Bibliothekar in Kassel, während Wilhelm in der Bibliothek und als Sekretär tätig war.
Sie begannen mit der Sammlung und Veröffentlichung von Märchen und Volksgeschichten, was schließlich zu ihrer berühmten Sammlung "Kinder- und Hausmärchen" führte, die 1812 erstmals veröffentlicht wurde.
Außer der Märchensammlung, leisteten Jacob und Wilhelm Grimm in Kassel auch weitere bedeutende Beiträge zur Literatur, Sprachwissenschaft und Kultur. Die bibliothekarische Tätigkeit ermöglichte ihnen, sich intensiv mit alten Texten und Manuskripten auseinanderzusetzen, was ihre literarische und wissenschaftliche Arbeit maßgeblich beeinflusste. Während ihrer Zeit in Kassel verfassten Jacob und Wilhelm Grimm zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten und Essays. Sie beschäftigten sich intensiv mit der deutschen Sprache, Literatur und Volkskunde. Jacob Grimm begann 1811 die Arbeit an der Deutschen Grammatik,deren erster Band 1819 erschien.
Zu den anderen literarischen Projekten gehörten die Sammlung von Sagen und die Herausgabe von Texten aus der deutschen Literaturgeschichte. Sie bearbeiteten und editierten alte literarische Werke und Manuskripte, was zur Vertiefung ihres Verständnisses der deutschen Sprache und Literatur beitrug.
Die Erfahrungen, die sie in Kassel sammelten, sowie ihre Forschungen, bereiteten sie auf ihre späteren akademischen Positionen vor. Die Kenntnisse, die sie in Kassel erlangten, waren entscheidend für ihre spätere Arbeit als Professoren in Göttingen und Berlin.
Die Brüder Grimm zeigten in ihrer Arbeit und ihren Veröffentlichungen ein starkes Interesse an der Kultur und dem Recht des deutschen Volkes. Ihre politischen Überzeugungen und ihr Engagement spiegelten sich in ihrer Arbeit wider, auch wenn sie in Kassel keine explizit politischen Aktivitäten unternahmen.
Durch ihre Märchensammlungen und literarischen Arbeiten trugen die Brüder Grimm zur Förderung und Bewahrung der deutschen Kultur und Traditionen bei. Ihre Sammlung von Märchen und Sagen half dabei, das kulturelle Erbe Deutschlands zu dokumentieren und zu erhalten.
Jacob und Wilhelm Grimm verbrachten eine entscheidende Phase ihres Lebens in Göttingen, von 1830 bis 1837, die sowohl ihre akademische Karriere als auch ihr wissenschaftliches Werk maßgeblich beeinflusste. Sie lebten weiterhin in einem gemeinsamen Haushalt. Jacob wurde 1830 ordentlicher Professor an der Universität, während Wilhelm zunächst Bibliothekar war und 1835 ebenfalls Professor wurde. Jacob setzte seine Arbeit an der Deutschen Grammatik fort und bis 1837 veröffentlichte Jacob Grimm zwei weitere Bände. Im Jahr 1834 schloss er das Werk Reinhart Fuchs ab, das er 1811 begonnen hatte, und 1835 erschien sein bedeutendes Buch über Deutsche Mythologie, in dem er vorchristliche Glaubensvorstellungen und Aberglauben analysierte und mit klassischer Mythologie sowie christlichen Legenden verglich. Dieses Werk hatte großen Einfluss auf die Forschung zu Mythen. Die dritte Auflage der Kinder- und Hausmärchen wurde 1837 von Wilhelm Grimm fast alleine herausgegeben.
Die Brüder Grimm waren auch Mitglieder der Göttinger Sieben – einer Gruppe von sieben Professoren der Universität Göttingen, die im Jahr 1837 gegen die Aufhebung der liberalen Verfassung des Königreichs Hannover durch König Ernst August I. protestierten. Diese Professoren sprachen sich in einer gemeinsamen Petition öffentlich gegen die Aufhebung der Verfassung aus, was zu ihrer Entlassung und teilweise auch zur Ausweisung aus dem Königreich Hannover führte. Ihr mutiger Protest war ein bedeutendes Ereignis in der deutschen Geschichte und gilt als ein früher Ausdruck des Widerstands gegen autokratische Herrschaft und für die Verteidigung der Freiheitsrechte und der Verfassung.
Die Brüder Grimm gingen ins Exil nach Kassel und verbrachten einige Jahre ohne feste Anstellung. Auf Anregung der Leipziger Verleger Karl Reimer und Salomon Hirzel begannen sie die Arbeit an ihrem größten Projekt, dem Deutschen Wörterbuch, „den Grimm“, das unvollendet blieb.
1840 wurden die Brüder Grimm an die Preußische Akademie der Wissenschaften in Berlin berufen, wo sie ihre wissenschaftliche Arbeit fortsetzten. Das war eine Anstellung, die ihnen finanzielle Sicherheit und akademische Anerkennung bot. Jacob Grimm war politisch weiterhin aktiv. 1848 wurde er Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung, wo er für die deutsche Einheitsbewegung arbeitete.
Jacob gab seine Lehrtätigkeit 1848, und Wilhelm 1852 auf. Die beiden sind in Berlin gestorben, Wilhelm am 16. Dezember 1859, und Jacob am 20. September 1863.
3. WERK
3.1 Kinder- und Hausmärchen
Die "Kinder- und Hausmärchen" der Brüder Grimm entstanden durch eine Kombination aus ihrer wissenschaftlichen Arbeit, persönlichen Interessen und den gesellschaftlichen Strömungen ihrer Zeit. Die Motivation für diese Sammlung lag sowohl in der Romantik und Volkskultur, als auch in der Sprach- und Kulturforschung. Die Brüder Grimm waren Teil der romantischen Bewegung, die ein starkes Interesse an Volkskultur, Mythen und Märchen hatte. Sie sahen in den Märchen eine authentische Ausdrucksform des Volksgeistes. Aber sie waren nicht nur Märchensammler, sondern auch Sprach- und Kulturforscher. Sie wollten die ursprünglichen Formen der deutschen Sprache und Kultur bewahren und dokumentieren.
Eine wichtige Rolle spielte auch Clemens Brentano, ein prominenter Dichter und Schriftsteller der Romantik, mit dem die Brüder Grimm in engem Kontakt standen. Brentano war selbst an der Sammlung und Bewahrung von Volksliedern und Märchen interessiert. Anfang des 19. Jahrhunderts, insbesondere um 1805, arbeiteten Jacob und Wilhelm Grimm mit Brentano zusammen. Brentano sammelte Materialien für eine geplante Märchensammlung und bat die Brüder Grimm um Unterstützung.
Clemens Brentano und sein Freund Achim von Arnim planten eine Sammlung deutscher Volkslieder und Märchen, die schließlich in der Veröffentlichung "Des Knaben Wunderhorn" (1806-1808) mündete. Obwohl "Des Knaben Wunderhorn" hauptsächlich Volkslieder enthielt, war es Teil des größeren romantischen Projekts, die Volkskultur zu dokumentieren.
Die Grimms sammelten und transkribierten zahlreiche Märchen für Brentano und Arnim. Diese Märchen waren ursprünglich für Brentanos eigene Sammlung gedacht, wurden jedoch nie von ihm veröffentlicht. Stattdessen ließen die Brüder Grimm das Material in ihre eigene Sammlung einfließen.
Brentanos Interesse und Begeisterung für die Volkskultur und das Sammeln mündlicher Überlieferungen inspirierten die Brüder Grimm, ihre eigene Sammlung systematisch anzugehen.
Während Brentano einen eher poetischen und weniger wissenschaftlichen Zugang zur Volksdichtung hatte, legten die Grimms mehr Wert auf die Authentizität und Genauigkeit der Überlieferungen. Diese unterschiedliche Herangehensweise führte letztlich dazu, dass die Grimms ihre eigene Sammlung von Märchen veröffentlichten.
Es gab aber auch andere Einflüsse – wie zum Beispiel der Philosoph und Schriftsteller Johann Gottfried Herder, der die Bedeutung der Volksdichtung betonte und die Brüder ermutigte, die mündliche Überlieferung zu dokumentieren. Das nationale Bewusstsein war auch dabei wichtig. In der Zeit des aufkommenden Nationalismus im frühen 19. Jahrhundert sahen die Brüder Grimm die Sammlung von Märchen als Beitrag zur Schaffung eines gemeinsamen deutschen Kulturerbes, das über die vielen kleinen Fürstentümer und Staaten hinausging.
Die Brüder Grimm waren Teil eines Netzwerks von Schriftstellern, Forschern und Freunden, die sie ermutigten und unterstützten. Besonders der Kontakt mit anderen Märchensammlern und Volkskundlern war für ihre Arbeit förderlich.
Die Geschichten, die ihnen von verschiedenen Erzählern mündlich überliefert wurden, gaben den Brüdern Grimm wertvolle Materialien, die sie sammelten, bearbeiteten und veröffentlichten.
Die Erzähler der "Kinder- und Hausmärchen" der Brüder Grimm stammten aus verschiedenen sozialen Schichten und geografischen Regionen. Sie waren meist Freunde, Bekannte und Dorfbewohner, die ihre mündlich überlieferten Geschichten den Grimms erzählten. Hier sind einige der wichtigsten Erzähler:
Dorothea Viehmann
Dorothea Viehmann (geboren als Dorothea Catharina Pierson, 1755-1815) stammte aus einem Hugenotten-Dorf in der Nähe von Kassel. Sie war die Tochter eines Gastwirts und heiratete später einen Schneider. Viehmann war eine der wichtigsten Erzählerinnen für die Grimms. Sie überlieferte zahlreiche Märchen, die in die Sammlung der Brüder Grimm eingingen. Ihre Geschichten waren besonders detailreich und gut strukturiert, was den Grimms half, authentische Volksmärchen zu dokumentieren.
Familie Hassenpflug
Marie Hassenpflug (1788-1856) stammte aus einer gebildeten Familie und war eine enge Freundin der Grimms. Sie erzählte ihnen zahlreiche Märchen, die sie wiederum von ihrer Mutter und Großmutter gehört hatte. Auch andere Mitglieder der Familie Hassenpflug, darunter Maries Schwestern Jeannette und Amalie, trugen zur Sammlung bei. Ihre Märchen hatten oft französische Einflüsse, was auf die hugenottische Herkunft der Familie zurückzuführen ist.
Familie Wild
Dorothea Wild (1795-1867), später bekannt als Dorothea Grimm, war die Frau von Wilhelm Grimm. Ihre Familie, besonders ihre Mutter und Schwestern, erzählten den Brüdern Grimm zahlreiche Märchen. Die Wilds stammten aus einer bürgerlichen Familie in Kassel (Apotheker) und hatten eine reiche Erzähltradition. Viele der von ihnen überlieferten Märchen fanden Eingang in die "Kinder- und Hausmärchen".
Andere Erzähler
Ludwig Emil Grimm:
Der jüngere Bruder von Jacob und Wilhelm Grimm, Ludwig Emil Grimm (1790-1863), ein bekannter Maler und Zeichner, trug ebenfalls einige Märchen bei.
Johann Friedrich Krause:
Ein befreundeter Pastor, der den Grimms einige Märchen erzählte.
Die erste Ausgabe der "Kinder- und Hausmärchen" erschien 1812, stark beeinflusst durch die gesammelten Märchen, die ursprünglich für Brentano bestimmt waren. Diese Ausgabe war wissenschaftlicher und enthielt viele Anmerkungen und Quellenangaben. Die Märchen waren näher an den ursprünglichen Erzählungen, oft roher und weniger geglättet.
In den folgenden Jahren erweiterten und überarbeiteten die Grimms ihre Sammlung. Die Grimms bearbeiteten die Märchen sprachlich, um sie stilistisch ansprechender und literarisch kohärenter zu machen. Dies umfasste die Vereinheitlichung des Erzählstils und die Hinzufügung von Dialogen und detaillierten Beschreibungen. Einige Märchen wurden inhaltlich geändert, um moralische Botschaften stärker zu betonen oder an die moralischen Vorstellungen der Zeit anzupassen. Gewalt und Sexualität wurden oft abgeschwächt oder entfernt. Obwohl die Grimms ursprünglich keine reine Kindersammlung beabsichtigten, wurde die Sammlung zunehmend als Kinderbuch betrachtet. Infolgedessen wurden einige Inhalte entschärft, um für Kinder geeigneter zu sein.
Die Märchen wurden in verschiedenen Auflagen veröffentlicht, wobei die Grimms weiterhin Wert auf die mündliche Überlieferung und die Authentizität der Geschichten legten.
3.2 Die Deutsche Grammatik
Die "Deutsche Grammatik" von Jacob Grimm, die ein grundlegendes Werk der germanistischen Sprachwissenschaft darstellt, umfasst insgesamt vier Bände. Der erste Band wurde 1819 veröffentlicht und beinhaltet die Einführung in die germanischen Sprachen und die Darstellung der Lautlehre (Phonologie). Hier legte Jacob Grimm die Grundlagen der Lautlehre (Phonologie) dar und begann, die systematischen Lautveränderungen zu analysieren, die schließlich als Grimmsches Gesetz bekannt wurden.
Der zweite Band der Deutschen Grammatik, 1826 veröffentlicht, setzt die Lautlehre fort und beschäftigt sich mit der Formenlehre (Morphologie), insbesondere mit der Flexion der Substantive und Adjektive. Im dritten Band (1831) wird die Formenlehre weiter beschrieben, hauptsächlich die Flexion der Verben sowie die Pronomina und Numeralia. Im vierten Band (1837) wird die Formenlehre abgeschlossen und die Syntax (Satzlehre) diskutiert. Diese vier Bände bildeten zusammen das umfassende Werk der "Deutschen Grammatik", in dem Jacob Grimm die Entwicklung und Struktur der germanischen Sprachen systematisch darstellte und analysierte.
3.2.1 Das Grimmsche Gesetz
Ein integraler Bestandteil der "Deutschen Grammatik" von Jacob Grimm ist das Grimmsche Gesetz. Jacob Grimm erkannte die systematischen Unterschiede in den Konsonantenlauten zwischen den germanischen Sprachen und ihren indogermanischen Ursprüngen. Das Grimmsche Gesetz beschreibt diese Lautverschiebungen detailliert und ordnet sie in ein historisches und linguistisches System ein. Das Grimmsche Gesetz war revolutionär, da es zeigte, dass der Sprachwandel nach systematischen und vorhersagbaren Mustern abläuft.
Das Grimmsche Gesetz, auch als erste oder germanische Lautverschiebung bekannt, ist ein fundamentales Prinzip der historischen Linguistik. Es erklärt die systematischen Lautveränderungen, die in den germanischen Sprachen im Vergleich zu anderen indogermanischen (indoeuropäischen) Sprachen stattgefunden haben. Diese Lautveränderungen betreffen hauptsächlich die Konsonanten. Das Gesetz beschreibt drei Hauptveränderungen:
- Verschiebung der indogermanischen stimmhaften Plosive (b, d, g) :
- b wird zu p
- d wird zu t
- g wird zu k
- Beispiele:
- Lateinisch „duo“ wird zu englisch „two“ (d -> t)
- Lateinisch „genus“ wird zu altenglisch „cynn“ (g -> k)
- Verschiebung der indogermanischen stimmlosen Plosive (p, t, k) :
- p wird zu f
- t wird zu th (wie im englischen „thin“)
- k wird zu h
- Beispiele:
- Lateinisch „pater“ wird zu englisch „father“ (p -> f)
- Lateinisch „tres“ wird zu englisch „three“ (t -> th)
- Lateinisch „cord“ wird zu englisch „heart“ (k -> h)
- Verschiebung der indogermanischen stimmhaften aspirierten Plosive (bh, dh, gh) :
- bh wird zu b
- dh wird zu d
- gh wird zu g
- Beispiele:
- Sanskrit „bhrātar“ wird zu englisch „brother“ (bh -> b)
- Sanskrit „dhā“ wird zu englisch „do“ (dh -> d)
- Sanskrit „ghans“ wird zu altenglisch „gōs“ (gh -> g)
Das Grimmsche Gesetz war ein bedeutender Schritt in der Entwicklung der vergleichenden Sprachwissenschaft und half, die Beziehungen zwischen den germanischen und anderen indogermanischen Sprachen besser zu verstehen.
Die Bedeutung der Deutschen Grammatik liegt darin, dass Jacob Grimm damit den Grundstein für die wissenschaftliche Erforschung der deutschen Sprache und ihrer Geschichte legte. Er analysierte systematisch die Laut- und Formenlehre des Deutschen und stellte Regeln für deren historische Entwicklung auf. Eine der wichtigsten Leistungen war die Formulierung der ersten und zweiten Lautverschiebung, des oben genannten Grimmschen Gesetzes. Außerdem waren Grimms Methoden innovativ: er führte methodische Ansätze ein, die bis heute in der Sprachwissenschaft verwendet werden, wie etwa die vergleichende Methode und die historische Analyse von Sprachformen.
Das Werk inspirierte und beeinflusste zahlreiche nachfolgende Sprachwissenschaftler und trug zur Etablierung der vergleichenden Sprachwissenschaft als eigenständige Disziplin bei. Die Arbeit der Brüder Grimm trug auch zur Stärkung des deutschen Nationalbewusstseins bei, indem sie die Bedeutung der deutschen Sprache und ihrer historischen Entwicklung betonte.
3.3 Das Deutsche Wörterbuch
Die Arbeit der Brüder Grimm am „Deutschen Wörterbuch“ begann in den 1830er Jahren und war ein monumentales Projekt, das sie bis zu ihrem Lebensende beschäftigte. Hier sind die wesentlichen Schritte und Ereignisse, die den Beginn dieses Projekts prägten:
Die Brüder Grimm hatten schon früh Interesse an der Erforschung der deutschen Sprache. Ihr Engagement für die Sprachwissenschaft und ihre vorherigen Arbeiten, insbesondere die „Deutsche Grammatik“, bereiteten den Weg für das Wörterbuchprojekt. Der eigentliche Anstoß kam jedoch 1838, als sie von der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Berlin den Auftrag erhielten, ein umfassendes Wörterbuch der deutschen Sprache zu erstellen. Jacob und Wilhelm Grimm entwickelten eine umfassende Konzeption für das Wörterbuch, das nicht nur ein Lexikon der deutschen Gegenwartssprache sein sollte, sondern auch die historische Entwicklung der Wörter und ihre Verwendung in verschiedenen Dialekten und literarischen Quellen dokumentieren sollte. Sie begannen mit der Sammlung und Sichtung von Texten und Quellen aus verschiedenen Epochen und Regionen des deutschen Sprachraums. Sie verwendeten eine methodische Herangehensweise, bei der sie Wörter in ihrem historischen Kontext untersuchten und deren Bedeutungsentwicklung nachzeichneten. Jacob Grimm war besonders akribisch und legte großen Wert auf die Dokumentation der etymologischen Wurzeln der Wörter.
1852 erschien der erste Band des „Deutschen Wörterbuchs“, der den Buchstaben „A“ abdeckte. Dieses erste Heft markierte den Beginn eines der ehrgeizigsten lexikografischen Projekte der Zeit. Die Arbeit an dem Wörterbuch erwies sich als äußerst zeitaufwendig und komplex. Beide Brüder arbeiteten bis zu ihrem Tod daran (Wilhelm Grimm starb 1859, Jacob Grimm 1863). Nach ihrem Tod wurde das Projekt von anderen Sprachwissenschaftlern fortgesetzt und erst 1961 abgeschlossen, wobei das Werk über 32 Bände umfasste.
3.3.1 Die Konzeption der Deutschen Wörterbuchs
Die Brüder Grimm verwendeten eine historisch-vergleichende Methode, um die Wörter nicht nur in ihrer zeitgenössischen Bedeutung zu dokumentieren, sondern auch deren historische Entwicklung und etymologische Herkunft zu erforschen. Sie zogen dafür eine Vielzahl von Quellen heran, darunter mittelalterliche Texte, Literatur, Dialekte und Fachsprachen.
Das Wörterbuch basiert auf einer breiten Palette von Quellen, die von literarischen Werken und wissenschaftlichen Abhandlungen bis hin zu volkstümlichen Texten und Dialekten reichen. Diese umfassende Quellenbasis ermöglichte es, die Vielfalt und den Reichtum der deutschen Sprache zu dokumentieren.
Das Wörterbuch ist folgendermaßen aufgebaut: es ist alphabetisch geordnet, wobei jeder Eintrag detaillierte Informationen zu Bedeutung, Gebrauch, Wortgeschichte und etymologischer Entwicklung eines Wortes enthält. Die Brüder Grimm legten großen Wert darauf, die Bedeutung eines Wortes in verschiedenen Kontexten und Epochen zu beleuchten.
Jeder Eintrag enthält Zitate aus Primärquellen, um die Verwendung und den Bedeutungswandel eines Wortes zu illustrieren. Diese Zitate stammen aus einer Vielzahl von Texten und decken einen langen historischen Zeitraum ab.
Die Brüder Grimm strebten nach größtmöglicher lexikalischer Tiefe. Sie dokumentierten nicht nur die Standardbedeutungen der Wörter, sondern auch regionale und dialektale Varianten, veraltete Bedeutungen und spezielle Fachbegriffe. Besondere Aufmerksamkeit wurde der Etymologie der Wörter gewidmet. Sie versuchten, die Ursprünge und die Entwicklung der Wörter bis zu ihren indogermanischen Wurzeln zurückzuverfolgen, sofern dies möglich war.
Das Wörterbuch spiegelt die sprachliche Vielfalt und den Wandel der deutschen Sprache wider. Die Brüder Grimm betrachteten die Sprache als lebendiges und sich ständig veränderndes Phänomen, was in ihrer lexikografischen Arbeit zum Ausdruck kommt.
Die Brüder Grimm waren sich der enormen Größe und Komplexität ihres Projekts bewusst. Sie begannen mit dem Buchstaben „A“ und arbeiteten systematisch weiter, waren sich aber auch bewusst, dass das Wörterbuch ihre Lebenszeit überdauern würde.
Das „Deutsche Wörterbuch“ der Brüder Grimm bleibt bis heute ein herausragendes Zeugnis ihrer wissenschaftlichen Gründlichkeit und ihres Engagements für die deutsche Sprache und Kultur.
3.4 Andere Werke
Außer den genannten Hauptwerken, schufen die Brüder Grimm eine Vielzahl anderer bedeutender wissenschaftlicher und literarischer Arbeiten. Hier sind einige ihrer weiteren wichtigen Werke und Projekte:
Deutsche Mythologie (Jacob Grimm, 1835) ist eine umfassende Sammlung und Analyse von deutschen Sagen, Mythen und volkstümlichen Überlieferungen. Jacob Grimm untersuchte darin die germanischen Götter, Helden und Naturgeister sowie die volkskundlichen Bräuche und Glaubensvorstellungen.
Reinhart Fuchs (1834) ist eine Ausgabe des mittelhochdeutschen Tierepos „Reinhart Fuchs“, die von Wilhelm Grimm herausgegeben wurde. Diese Arbeit ist ein Beispiel für ihre Bemühungen, mittelalterliche Literatur zugänglich zu machen und zu erforschen.
Altdeutsche Wälder (1813–1816) ist eine Sammlung von Texten und Untersuchungen zur altdeutschen Literatur und Sprache. Diese Sammlung wurde von beiden Brüdern veröffentlicht und umfasst alte deutsche Gedichte, Sagen und andere literarische Werke.
Irische Elfenmärchen (1826) sind eine Übersetzung und Bearbeitung irischer Märchen durch die Brüder Grimm. Diese Arbeit zeigt ihr Interesse an internationalen Märchen und deren Vergleich mit deutschen Volksmärchen.
Deutsche Rechtsaltertümer (Jacob Grimm, 1828) ist ein Werk, in dem Jacob Grimm die historischen und rechtlichen Grundlagen des alten deutschen Rechts untersucht. Es enthält Studien zu Rechtstermini, Rechtsbräuchen und Rechtsprechung der germanischen Völker.
Weisthümer (Jacob Grimm, 1840–1878) ist eine mehrbändige Sammlung von Rechtsaufzeichnungen und Urteilen aus deutschen Dorfgemeinschaften. Diese Arbeit ist eine wichtige Quelle für das Verständnis der lokalen Rechtstraditionen und sozialen Strukturen im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Deutschland.
Die Lieder der alten Edda (1815) ist eine Sammlung und Übersetzung der altnordischen Edda-Lieder, die von beiden Brüdern herausgegeben wurde. Die Edda-Lieder sind eine wichtige Quelle für die nordische Mythologie und Heldensagen.
Briefe und Tagebücher: Die Brüder Grimm hinterließen eine umfangreiche Korrespondenz und Tagebücher, die wertvolle Einblicke in ihre Arbeit, ihre Gedankenwelt und ihr Leben bieten. Diese Schriften wurden posthum veröffentlicht und sind für die Forschung von großem Interesse.
Diese Werke und Projekte zeigen das breite Spektrum der Interessen und die wissenschaftliche Akribie der Brüder Grimm. Ihre Arbeiten haben nicht nur die Germanistik und Volkskunde maßgeblich beeinflusst, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur europäischen Literatur- und Kulturgeschichte geleistet.
4. Politische Tätigkeit der Brüder Grimm
Die Brüder Grimm, Jacob und Wilhelm, waren nicht nur bedeutende Sprachwissenschaftler und Märchensammler, sondern auch politisch aktiv. Während ihrer frühen Karriere in Kassel waren die Brüder Grimm weniger direkt aktiv im Sinne von öffentlichem Protest oder Teilnahme an politischen Gremien. In dieser Zeit hielten sie sich weitgehend von direkten politischen Auseinandersetzungen fern und konzentrierten sich auf ihre wissenschaftlichen Arbeiten. Dies war auch eine Zeit, in der sie sich beruflich und intellektuell etablierten und ihre berühmten „Kinder- und Hausmärchen“ sowie weitere wichtige Werke veröffentlichten. Ihr Engagement für die Sammlung und Bewahrung von Märchen, Sagen und Volksliedern kann als Ausdruck eines wachsenden Nationalbewusstseins verstanden werden. Sie sahen die Volkskultur als wichtigen Bestandteil der nationalen Identität und trugen durch ihre Arbeiten zur Stärkung des kulturellen Bewusstseins bei. Schließlich waren sie Teil der Romantik, einer Bewegung, die oft mit einem verstärkten Nationalbewusstsein verbunden war. Sie teilten die Überzeugung, dass die Erforschung und Pflege der eigenen Sprache und Kultur eine Grundlage für nationale Einheit und Identität darstellt.
Die Brüder Grimm lebten in einer Zeit großer politischer Umwälzungen, einschließlich der Napoleonischen Kriege und der Neuordnung Europas im Wiener Kongress. Diese Ereignisse beeinflussten ihre Arbeit und ihre Sicht auf nationale und kulturelle Fragen. Schon in ihrer Kasseler Zeit pflegten sie Kontakte zu anderen Intellektuellen und Wissenschaftlern, die ebenfalls an Fragen der nationalen Identität und Kultur interessiert waren. Diese Netzwerke trugen dazu bei, ihre politischen Ideen zu formen und zu verbreiten. Ihr direkter politischer Aktivismus entwickelte sich später, insbesondere in ihrer Zeit in Göttingen und durch Jacob Grimms Teilnahme an der Frankfurter Nationalversammlung.
Das Ereignis mit den Göttinger Sieben war ein bedeutender Moment in der deutschen Geschichte und zeigt das Engagement der Brüder Grimm und ihrer Kollegen für politische Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Die politische Situation im Königreich Hannover, zu dem auch Göttingen gehörte, sah folgendermaßen aus: Nach dem Wiener Kongress 1815 wurden viele deutsche Staaten neu geordnet. Das Königreich Hannover erhielt 1833 eine liberale Verfassung, die den Bürgern bestimmte Rechte und Freiheiten gewährte. Im Jahr 1837 bestieg Ernst August I. den Thron von Hannover. Er war ein konservativer Monarch und entschied, die liberale Verfassung aufzuheben, um seine absolutistische Herrschaft wiederherzustellen.
Die Göttinger Sieben waren eine Gruppe von Professoren der Universität Göttingen, die sich entschieden gegen die Aufhebung der Verfassung aussprachen. Außer den Brüdern Grimm, zu dieser Gruppe gehörten Friedrich Christoph Dahlmann (1785-1860), Historiker und Politiker, Wilhelm Eduard Albrecht (1800-1876), Jurist, Georg Gottfried Gervinus (1805-1871), Historiker und Literaturwissenschaftler, Wilhelm Eduard Weber (1804-1891), Physiker und Heinrich Georg August Ewald (1803-1875), Orientalist und Theologe.
Am 18. November 1837 unterzeichneten die sieben Professoren eine öffentliche Erklärung, in der sie die Aufhebung der Verfassung als rechtswidrig und verfassungswidrig bezeichneten. Sie argumentierten, dass der König nicht das Recht habe, eine gültige Verfassung ohne Zustimmung der Landstände aufzuheben.
Die Erklärung führte zu sofortigen und harten Reaktionen seitens der Regierung. Die sieben Professoren wurden ihrer Ämter enthoben. Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, Friedrich Christoph Dahlmann und Georg Gottfried Gervinus wurden aus dem Königreich Hannover ausgewiesen. Die anderen Professoren blieben zwar in Göttingen, verloren jedoch ebenfalls ihre Positionen.
Der Protest der Göttinger Sieben erregte großes Aufsehen in der Öffentlichkeit und wurde in ganz Deutschland und darüber hinaus diskutiert. Die Entlassung der Professoren wurde von vielen als Angriff auf die akademische Freiheit und die liberalen Prinzipien wahrgenommen.
In vielen Städten kam es zu Solidaritätsbekundungen, und die Göttinger Sieben wurden als Verteidiger der Verfassung und des Rechtsstaats gefeiert.
Der Protest der Göttinger Sieben hatte einen nachhaltigen Einfluss auf die politische Kultur in Deutschland. Er stärkte das Bewusstsein für die Bedeutung von Verfassungen und bürgerlichen Rechten. Die Ereignisse trugen dazu bei, dass die Forderungen nach politischen Reformen und nationaler Einheit weiter an Bedeutung gewannen, was schließlich zur Revolution von 1848/49 führte.
Das Ereignis mit den Göttinger Sieben war ein bedeutender Moment des Widerstands gegen autoritäre Herrschaft und für die Verteidigung liberaler Werte und akademischer Freiheit. Die Brüder Grimm und ihre Kollegen setzten ein starkes Zeichen für Rechtsstaatlichkeit und politische Integrität, das weit über ihre Zeit hinaus Wirkung zeigte.
Nach ihrer Entlassung und Vertreibung aus Hannover kehrten die Brüder Grimm zuerst nach Kassel zurück. Schließlich fanden sie eine neue Anstellung in Berlin, wo sie ihre wissenschaftliche Arbeit fortsetzten und sich weiterhin für politische und akademische Freiheit einsetzten.
In Berlin setzten sie nicht nur ihre wissenschaftlichen Arbeiten fort, sondern engagierten sich auch weiterhin politisch. Ihre Zeit in Berlin war geprägt von ihrem Einsatz für die Freiheit der Wissenschaft und ihrer Teilnahme an der Frankfurter Nationalversammlung.
Die Brüder Grimm setzten sich für die Freiheit der Wissenschaft und die Unabhängigkeit der Universitäten ein. Sie waren überzeugt, dass wissenschaftliche Arbeit frei von staatlicher Einflussnahme und Zensur sein sollte. Außerdem waren sie Teil eines intellektuellen Netzwerks von Wissenschaftlern, Schriftstellern und Politikern, die sich für liberale Reformen einsetzten. Diese Kontakte stärkten ihren Einfluss und halfen ihnen, ihre politischen Ideen zu verbreiten.
Die Märzrevolution von 1848 führte zur Einberufung der Frankfurter Nationalversammlung, die eine Verfassung für ein vereintes Deutschland erarbeiten sollte. Jacob Grimm wurde als Abgeordneter für den Wahlkreis Kassel in die Nationalversammlung gewählt. Er war Mitglied mehrerer Ausschüsse, darunter des Verfassungsausschusses. Er setzte sich für eine föderale Struktur Deutschlands und die Wahrung der Rechte der Einzelstaaten ein, gleichzeitig plädierte er für eine starke zentrale Regierung, die die Einheit Deutschlands gewährleisten sollte.
Die Nationalversammlung stieß auf starke Widerstände von Seiten der deutschen Fürsten und scheiterte letztlich. Jacob Grimm trat gemeinsam mit vielen anderen Abgeordneten aus Protest gegen die reaktionären Kräfte und die mangelnde Unterstützung für die Verfassung zurück.
Nach dem Scheitern der Revolution und der Nationalversammlung konzentrierten sich die Brüder Grimm wieder auf ihre wissenschaftlichen Projekte. Sie arbeiteten intensiv an ihrem „Deutschen Wörterbuch“ und anderen philologischen Studien. Trotz der Rückschläge blieben die Brüder Grimm überzeugte Verfechter von Freiheit, Gerechtigkeit und der Einheit Deutschlands. Ihre Schriften und ihre wissenschaftliche Arbeit trugen dazu bei, die Idee eines vereinten und freiheitlichen Deutschlands weiter zu fördern.
5. Schluss
Schon die Tatsache, dass die Brüder Grimm ihre gesamte literarische und wissenschaftliche Arbeit zu zweit gemacht haben, genügt, dass man sich für ihr Werk zu interessieren beginnt. Obwohl meistens als Märchensammler bekannt, sind sie viel mehr. Die Brüder Grimm, Jacob und Wilhelm, sind zentrale Figuren in der deutschen und europäischen Kultur- und Wissenschaftsgeschichte.
Sie waren sehr vielseitige Persönlichkeiten und haben in verschiedenen Bereichen Bedeutendes geleistet. Jacob Grimm, der sprachwissenschaftlich begabter als sein Bruder war, hat in der „Deutschen Grammatik“ das Fundament für die moderne Etymologie gelegt, und in der Sprachgeschichte das sogenannte „Grimmsche Gesetz“, über die Gesetzmäßigkeiten bei den lautlichen Entsprechungen in verwandten Sprachen. Andererseits hat der literarisch begabtere Wilhelm mit der kritischen Untersuchung zu Quellen und Entwicklung der Volksmärchen die Märchenkunde als Wissenschaft begründet.
Die Brüder Grimm haben durch ihre Arbeiten in der Märchenforschung, Sprachwissenschaft, Philologie und durch ihr politisches Engagement einen bleibenden Einfluss auf die deutsche und internationale Kultur- und Wissenschaftsgeschichte hinterlassen. Ihre Werke fördern das Verständnis der deutschen Sprache und Kultur und ihre Märchensammlungen inspirieren bis heute weltweit Menschen aller Altersgruppen.
Literatur
Kindlers Literatur Lexikon, Kindler Verlag, Zürich 1972
Lutz, Bernd (Hrsg.), Metzler Autoren Lexikon, J.B. Metzler Verlag, Stuttgart-Weimar, 1994
Bolte, Johannes – Polívka, Georg, Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, Georg Olms Verlagbuchhandlung, Hildesheim, 1963
Die Romantische Schule, Heinrich Heine, Reclam, 2002
Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart, Wolfgang Beutin et al., J.B. Metzler Verlag, Stuttgart-Weimar, 1994
Die Märchen der Brüder Grimm: Quellen und Studien, Heinz Rölleke, WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier, 2004
The Brothers Grimm: From Enchanted Forests to the Modern World , Jack Zipes, Routledge, New York, 1988
Jacob Grimm: „Deutsche Grammatik“. Vier Bände. Göttingen 1819–1837.
Wilhelm Fleischer, „Die Entstehung des Grimmschen Wörterbuchs“, in: Zeitschrift für deutsche Philologie , 1970.
Ulrich Goebel, „Die Brüder Grimm und ihr Wörterbuch“, in: Geschichte der deutschen Lexikografie , 1991.
Ludwig Denecke: Jacob Grimm und sein Bruder Wilhelm. J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1971
https://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCder_Grimm
https://grimms.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Heidelberger_Romantik
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments über die Brüder Grimm?
Dieses Dokument ist eine umfassende Übersicht über das Leben und Werk der Brüder Grimm, Jacob und Wilhelm Grimm. Es behandelt ihre Biographie, wichtige Werke wie die "Kinder- und Hausmärchen" und die "Deutsche Grammatik", sowie ihre politische Tätigkeit.
Wer waren die Brüder Grimm?
Die Brüder Grimm, Jacob (1785-1863) und Wilhelm (1786-1859), waren deutsche Sprachwissenschaftler, Volkskundler, Märchensammler und politische Aktivisten. Sie sind vor allem bekannt für ihre Sammlung "Kinder- und Hausmärchen" und ihr monumentales "Deutsches Wörterbuch".
Welche Aspekte ihrer Biographie werden in diesem Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt ihre Kindheit, Schulbildung, das Studium in Marburg und den Einfluss von Carl von Savigny, die Heidelberger Romantik, ihre berufliche Karriere als Bibliothekare und Professoren in Kassel, Göttingen und Berlin, sowie ihre politische Tätigkeiten.
Was sind die "Kinder- und Hausmärchen"?
Die "Kinder- und Hausmärchen" sind eine Sammlung von Märchen und Volksgeschichten, die von den Brüdern Grimm gesammelt und veröffentlicht wurden. Diese Sammlung umfasst bekannte Märchen wie "Aschenputtel", "Rotkäppchen" und "Schneewittchen". Das Dokument beschreibt auch, wie Clemens Brentano ihre Arbeit beeinflusste.
Wer waren die wichtigsten Erzähler für die "Kinder- und Hausmärchen"?
Zu den wichtigsten Erzählern gehörten Dorothea Viehmann, die Familie Hassenpflug (insbesondere Marie Hassenpflug) und die Familie Wild (insbesondere Dorothea Wild, Wilhelms Frau). Es werden ebenfalls Ludwig Emil Grimm und Johann Friedrich Krause erwähnt.
Was ist die "Deutsche Grammatik" von Jacob Grimm?
Die "Deutsche Grammatik" ist ein vierbändiges Werk von Jacob Grimm, das die Lautlehre, Formenlehre und Syntax der germanischen Sprachen beschreibt. Es ist ein grundlegendes Werk der germanistischen Sprachwissenschaft.
Was ist das "Grimmsche Gesetz"?
Das "Grimmsche Gesetz" (auch erste Lautverschiebung genannt) ist ein Prinzip der historischen Linguistik, das die systematischen Lautveränderungen beschreibt, die in den germanischen Sprachen im Vergleich zu anderen indogermanischen Sprachen stattgefunden haben. Das Dokument gibt Beispiele und Beschreibungen.
Was ist das "Deutsche Wörterbuch" der Brüder Grimm?
Das "Deutsche Wörterbuch" ist ein monumentales Projekt der Brüder Grimm, das darauf abzielte, die gesamte deutsche Sprache umfassend zu dokumentieren, einschließlich ihrer historischen Entwicklung und Verwendung in verschiedenen Dialekten. Das Dokument erläutert die Konzeption und den Aufbau des Wörterbuchs.
Welche anderen Werke haben die Brüder Grimm verfasst?
Neben den "Kinder- und Hausmärchen" und dem "Deutschen Wörterbuch" verfassten die Brüder Grimm weitere bedeutende Werke wie "Deutsche Mythologie", "Reinhart Fuchs", "Altdeutsche Wälder", "Irische Elfenmärchen", "Deutsche Rechtsaltertümer", "Weisthümer" und "Die Lieder der alten Edda".
Welche politische Rolle spielten die Brüder Grimm?
Die Brüder Grimm engagierten sich politisch, insbesondere als Mitglieder der "Göttinger Sieben", die gegen die Aufhebung der liberalen Verfassung des Königreichs Hannover protestierten. Jacob Grimm war auch Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung im Jahr 1848.
Was waren die "Göttinger Sieben"?
Die "Göttinger Sieben" waren sieben Professoren der Universität Göttingen, die 1837 gegen die Aufhebung der liberalen Verfassung durch König Ernst August I. protestierten und daraufhin entlassen wurden. Die Brüder Grimm waren Teil dieser Gruppe.
Was war Jacob Grimms Rolle in der Frankfurter Nationalversammlung?
Jacob Grimm war Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung im Jahr 1848, wo er sich für eine föderale Struktur Deutschlands und die Wahrung der Rechte der Einzelstaaten einsetzte.
Welche Schlussfolgerungen zieht das Dokument über die Brüder Grimm?
Das Dokument kommt zu dem Schluss, dass die Brüder Grimm vielseitige Persönlichkeiten waren, die durch ihre Arbeit in der Märchenforschung, Sprachwissenschaft, Philologie und durch ihr politisches Engagement einen bleibenden Einfluss auf die deutsche und internationale Kultur- und Wissenschaftsgeschichte hinterlassen haben.
Welche Literatur wird in diesem Dokument zitiert?
Im Dokument werden folgende Werke zitiert: Kindlers Literatur Lexikon, Metzler Autoren Lexikon, Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, Die Romantische Schule, Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart, Die Märchen der Brüder Grimm: Quellen und Studien, The Brothers Grimm: From Enchanted Forests to the Modern World, Jacob Grimm: „Deutsche Grammatik“. Vier Bände. Göttingen 1819–1837, Wilhelm Fleischer, „Die Entstehung des Grimmschen Wörterbuchs“, Ulrich Goebel, „Die Brüder Grimm und ihr Wörterbuch“, Ludwig Denecke: Jacob Grimm und sein Bruder Wilhelm sowie Wikipedia und grimms.de.
- Quote paper
- Maja Tomičić Marušić (Author), Kristina Kamalić (Author), 2005, Ein Überblick über das Leben und Werk der Brüder Grimm, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1497166