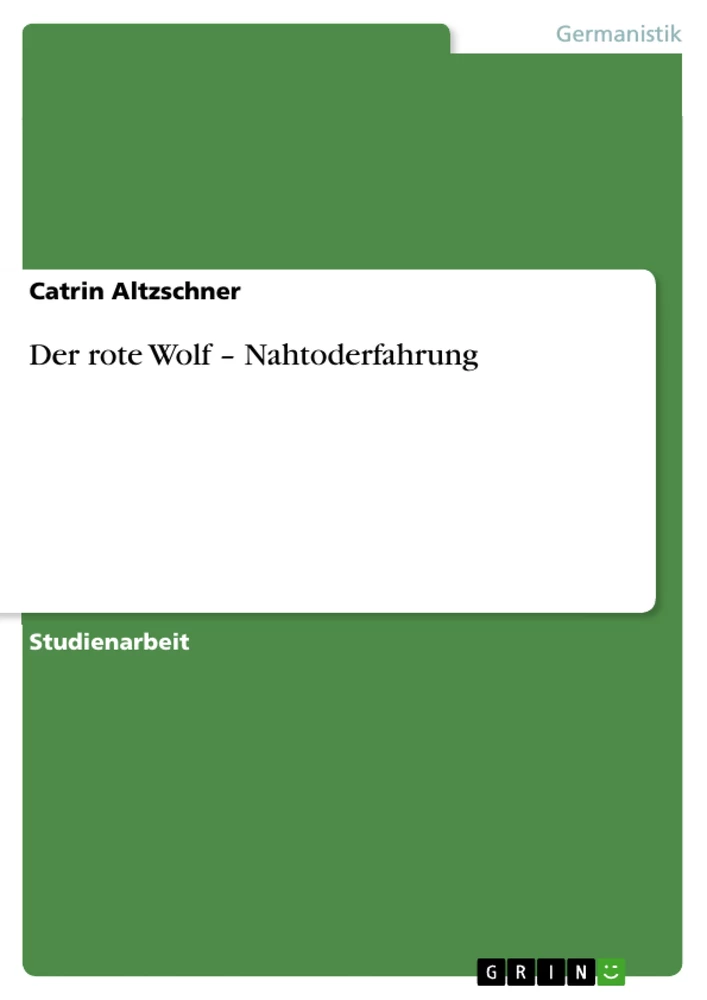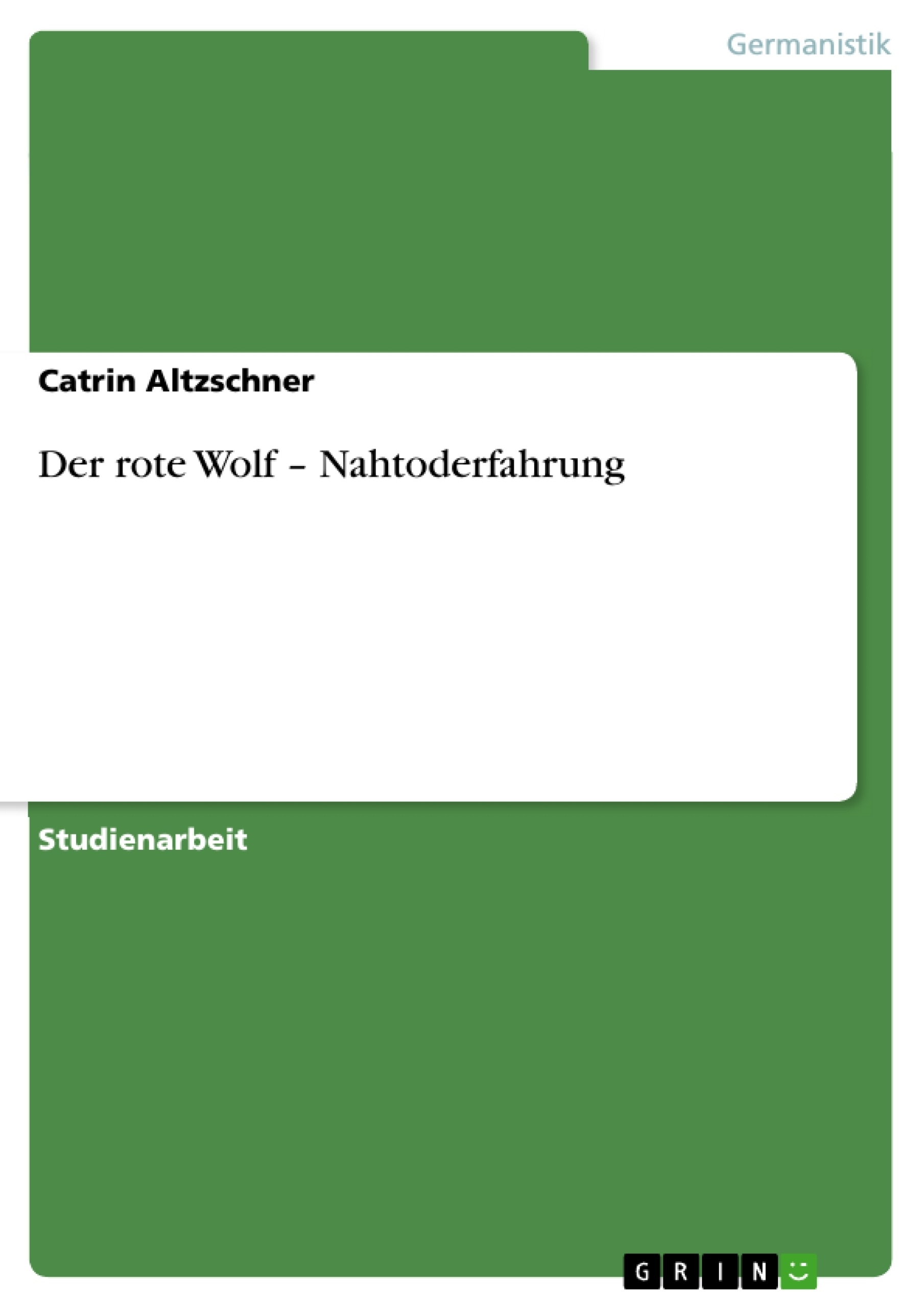Das Bild im Medium Bildergeschichte oder –Buch ist mehr als Illustration, Verzierungen oder schöne Begleiterscheinungen der schriftlich fixierten Geschichte. Es besitzt viel mehr eine eigene teils den Text begleitende, teils unabhängige narrative Qualität. Erst durch die Verzahnung von literarischer Erzählstruktur und narrativer Struktur des Bildes, an der Schnittstelle der beiden Ebenen, erschließt sich das ästhetische Potenzial des Bilderbuches.
Dies ist die Kernthese der vorliegenden Arbeit, die es in den folgenden Kapiteln am Beispiel des Bilderbuches „Der rote Wolf“ von Karl Waechter zu erklären und beweisen gilt.
Dazu sollen zunächst, im ersten Kapitel, einige grundsätzliche Aussagen über visuelle Narrativität getätigt werden. Wie funktioniert erzählen in Bildern? Was sind Besonderheiten, Übereinstimmungen und Abweichungen zum poetischen Erzählen? Und welche Rolle hat der Rezipient? Dann in einem zweiten Schritt soll die Frage noch konkretisiert werden. Was macht überhaupt Bild und was macht Text? Wie ist ihre Wechselwirkung. Dies ist die Frage der Bild-Text-Interpendenz. In der Aktuellen Forschung ist das Thema der visuellen Narrativität in den letzten zehn Jahren wieder vermehrt in die Diskussion gerückt. Diese Entwicklung geht auf das wachsende Interesse an einem weiteren Medium, das ebenfalls im Zeichen des Bild-Text-Diskurses steht, zurück: Dem Comic. Autoren und Herausgeber wie Gisela Vetter-Liebenow, Michael Hein und Bernd Dolle-Weinkauf sind wichtige Vertreter dieser Debatte.
Aber auch zur Problematik der Erzählform Bilderbuch selbst haben sich in jüngerer Vergangenheit Autoren wie Jens Thiele oder Franziska Herlinger-Fuchs zu Wort gemeldet. In der vorliegenden Arbeit werden sich Anleihen von Fachtermini aus den Bereich der darstellenden Künste, dem Theater und dem Film, finden lassen, da diese eine gewisse Parallelität zum Illustrierten Buch in der Art des Erzählens und in der Dramaturgie aufweisen, wie sich weiteren Verlauf noch zeigen wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Visuelle Narrativität
- 2.1. Bild Denotation und Konnotation
- 2.2. Bild und Handlung in Zeit und Raum
- 2.2.1 „Der rote Wolf“: Analepse, Parapsychologisches Lebensresümee
- 3. Bild-Text-Interpendenz
- 3.1. Potenzierung
- 3.2. Modifikation
- 3.3. Parallelität
- 3.4. Divergenz
- 4. Nachwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die visuelle Narrativität im Bilderbuch „Der rote Wolf“ von Karl Waechter. Ziel ist es, die narrative Qualität der Bilder im Verhältnis zum Text zu analysieren und das ästhetische Potenzial des Bilderbuches aufzuzeigen. Die Arbeit beleuchtet die Interdependenz von Bild und Text und untersucht, wie beide Ebenen zusammenwirken, um eine Geschichte zu erzählen.
- Visuelle Narrativität und ihre Funktionsweise im Bilderbuch
- Die Ebenen der Denotation und Konnotation in Bildern
- Die Wechselwirkung zwischen Bild und Text (Bild-Text-Interpendenz)
- Analyse der narrativen Struktur im Bilderbuch „Der rote Wolf“
- Der Einfluss des Rezipienten auf die Bildinterpretation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale These der Arbeit vor: Bilderbücher besitzen ein eigenes ästhetisches Potenzial, das sich aus der Verzahnung von literarischer und visueller Narrativität ergibt. Die Arbeit untersucht am Beispiel von Karl Waechters „Der rote Wolf“, wie Bilder Geschichten erzählen und wie Bild und Text interagieren. Es werden grundlegende Fragen zur visuellen Narrativität und deren Besonderheiten im Vergleich zum literarischen Erzählen formuliert. Die Einleitung verweist auf die Relevanz des Themas in der aktuellen Forschung, insbesondere im Kontext von Comics und Bilderbüchern.
2. Visuelle Narrativität: Dieses Kapitel erforscht die Funktionsweise der visuellen Narrativität. Es wird erläutert, wie Bilder Geschichten erzählen können, analog zu schriftlichen Texten, aber mit eigenen Mechanismen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Unterscheidung zwischen Denotation (Beschreibung) und Konnotation (Interpretation) von Bildern. Am Beispiel des "Roten Wolfes" wird gezeigt, wie historische und kulturelle Kenntnisse des Rezipienten die Interpretation der Bilder beeinflussen (z.B. die Darstellung von Soldaten der Wehrmacht und Roten Armee nach der Szene mit dem Planwagen). Die Analyse der Bilder zeigt, wie visuelle Elemente wie Kleidung, Gesichtsausdrücke, und die Umgebung die Geschichte miterzählen und die narrative Bedeutung verstärken.
Schlüsselwörter
Visuelle Narrativität, Bild-Text-Interpendenz, Bilderbuch, Denotation, Konnotation, Karl Waechter, Der rote Wolf, Erzählstruktur, Bildinterpretation, Rezipient.
Häufig gestellte Fragen zu „Der rote Wolf“: Eine Analyse der visuellen Narrativität
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert die visuelle Narrativität im Bilderbuch „Der rote Wolf“ von Karl Waechter. Sie untersucht, wie die Bilder im Verhältnis zum Text eine Geschichte erzählen und das ästhetische Potenzial des Buches aufzeigen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die visuelle Narrativität und ihre Funktionsweise im Bilderbuch, die Denotation und Konnotation von Bildern, die Wechselwirkung zwischen Bild und Text (Bild-Text-Interpendenz), die narrative Struktur in „Der rote Wolf“, und den Einfluss des Rezipienten auf die Bildinterpretation.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur visuellen Narrativität (inkl. Unterkapitel zu Bild-Denotation und -Konnotation sowie zur Beziehung von Bild und Handlung in Zeit und Raum), ein Kapitel zur Bild-Text-Interpendenz (mit Unterkapiteln zu Potenzierung, Modifikation, Parallelität und Divergenz) und ein Nachwort.
Wie wird die visuelle Narrativität im „Roten Wolf“ untersucht?
Die Analyse betrachtet, wie Bilder analog zu Text Geschichten erzählen, unterscheidet zwischen Denotation (Beschreibung) und Konnotation (Interpretation) von Bildern und zeigt am Beispiel des „Roten Wolfes“, wie historische und kulturelle Kenntnisse des Rezipienten die Interpretation beeinflussen (z.B. die Darstellung von Soldaten).
Welche Rolle spielt der Rezipient?
Die Arbeit betont den Einfluss des Rezipienten auf die Bildinterpretation. Die Interpretation der Bilder wird durch das Vorwissen und den kulturellen Hintergrund des Betrachters mitbestimmt.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Visuelle Narrativität, Bild-Text-Interpendenz, Bilderbuch, Denotation, Konnotation, Karl Waechter, Der rote Wolf, Erzählstruktur, Bildinterpretation, Rezipient.
Welche These vertritt die Arbeit?
Die zentrale These ist, dass Bilderbücher ein eigenes ästhetisches Potenzial besitzen, das aus der Verzahnung von literarischer und visueller Narrativität entsteht.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine interpretative Bildanalyse, die die Interaktion von Bild und Text im Kontext des gesamten Bilderbuches untersucht.
Worum geht es im Unterkapitel „Der rote Wolf“: Analepse, Parapsychologisches Lebensresümee?
Dieses Unterkapitel analysiert eine spezifische Szene im Bilderbuch ("Der rote Wolf") im Detail, indem es Aspekte wie Analepse (Rückblenden) und die Darstellung eines parapsychologischen Lebensrückblicks im Bild untersucht.
- Quote paper
- Magistra Artium Catrin Altzschner (Author), 2008, Der rote Wolf – Nahtoderfahrung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/149674