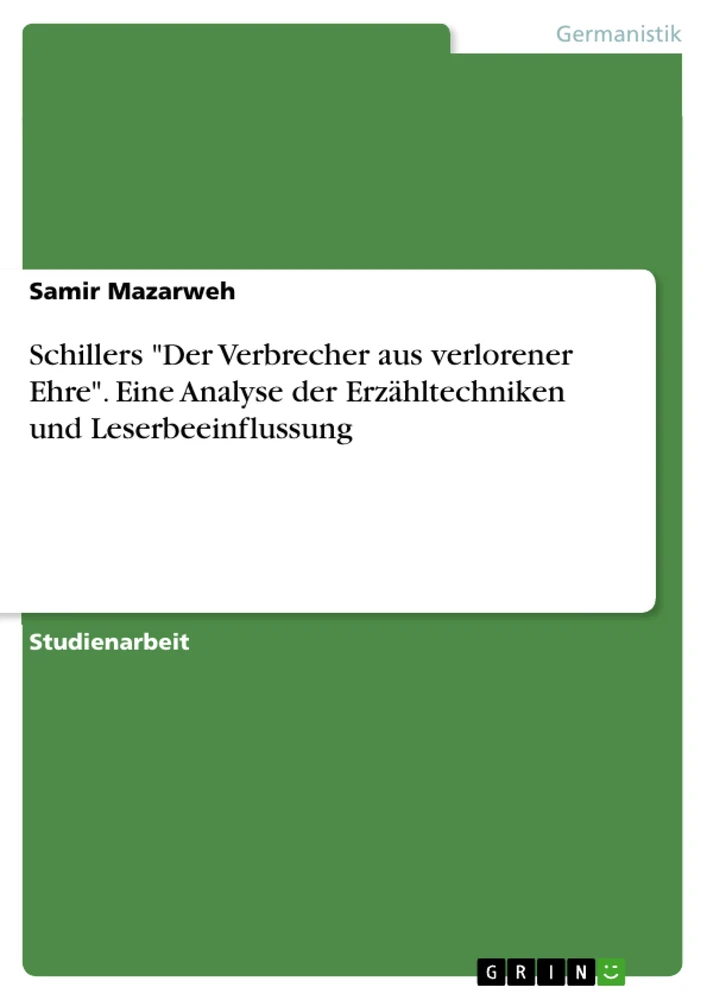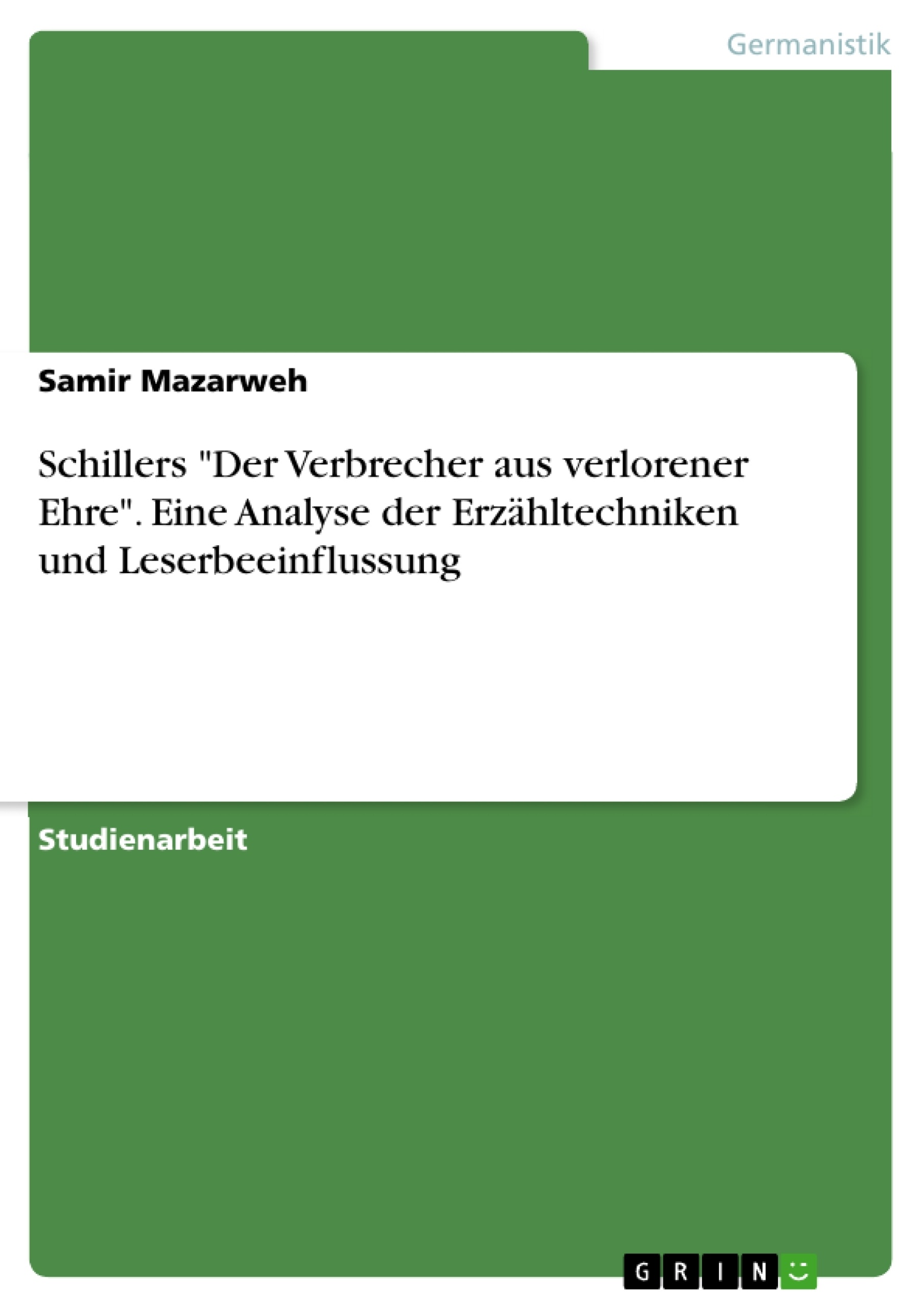Dieses Essay untersucht Friedrich Schillers Novelle "Der Verbrecher aus verlorener Ehre" und basiert auf der 1792 von Julius Petersen und Hermann Schneider herausgegebenen Nationalausgabe. Die Arbeit analysiert, wie Schiller verschiedene erzähltechnische Elemente nutzt, um die Geschichte von Christian Wolf darzustellen. Trotz der Behauptung des Erzählers, neutral zu bleiben, wird im Essay untersucht, inwieweit diese Objektivität tatsächlich gewahrt wird. Wichtige Aspekte wie die Formen von Erzähler- und Figurenrede, die Erzähldauer, die Wortwahl und die Typen der Fokalisierung werden analysiert. Zudem wird die Manipulation der Perspektive durch den Erzähler und deren Einfluss auf das Urteil des Lesers betrachtet. Ziel ist es, zu verstehen, wie der Erzähler narrative Elemente nutzt, um die Wahrnehmung des Protagonisten und die breitere gesellschaftliche Kritik zu beeinflussen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand
- Zielsetzung und Methode
- Hauptteil
- Die Vorrede
- Der primäre Erzähler
- Die Person des Erzählers
- Fokalisierung
- Der autodiegetische Teil
- Der kommentierende Rückblick
- Der Brief an den Fürsten
- Der abschließende Dialog
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Friedrich Schillers Novelle „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“ und analysiert die Erzählstrategie des Autors, insbesondere durch die Verwendung narratologischer Elemente. Ziel ist es, zu untersuchen, wie der Erzähler die Geschichte des Christian Wolf präsentiert und dem Leser die Möglichkeit eröffnet, ein eigenes Urteil zu fällen.
- Analyse der Erzählperspektive und Fokalisierung
- Untersuchung der Rolle des Erzählers in der Gestaltung der Geschichte
- Beurteilung der verschiedenen Formen von Figurenrede und Erzählstrategie
- Analyse der Wortwahl und Textsorten im Werk
- Einordnung der Novelle in den Kontext der narratologischen Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung skizziert den Forschungsstand zu Schillers „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“ und erläutert die unterschiedlichen Ansätze in der bisherigen Forschung. Zudem wird die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit und die zu verfolgende Methode vorgestellt.
- Die Vorrede: Dieser Abschnitt beleuchtet die Vorrede der Novelle und analysiert die Rolle des Erzählers in dieser einleitenden Passage. Es wird diskutiert, ob die Vorrede als direkte Äußerung des Autors Friedrich Schiller zu verstehen ist oder als Teil der erzählten Geschichte.
- Der primäre Erzähler: In diesem Kapitel wird die Person des heterodiegetischen Erzählers, der die Geschichte des Christian Wolf präsentiert, genauer betrachtet. Es werden verschiedene Aspekte wie seine Persönlichkeit, sein Wissen über die Handlung und die Frage der Fokalisierung beleuchtet.
- Der autodiegetische Teil: Dieser Abschnitt untersucht den Teil der Novelle, der von Christian Wolf selbst erzählt wird. Dabei werden die Unterschiede zwischen dem erzählenden und erlebendem Ich des Protagonisten sowie die Rolle des primären Erzählers in der Geschichte der Figur beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Erzählstrategie in Friedrich Schillers Novelle „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“. Zentral sind dabei die Begriffe Fokalisierung, Erzählperspektive, Erzählerrolle, Figurenrede, Textsorten und die Geschichte des Protagonisten Christian Wolf. Die Analyse bezieht sich auf die narratologische Forschung und deren wichtige Theorien, wie z. B. Genettes Fokalisierungsmodell.
- Quote paper
- Samir Mazarweh (Author), 2024, Schillers "Der Verbrecher aus verlorener Ehre". Eine Analyse der Erzähltechniken und Leserbeeinflussung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1495875