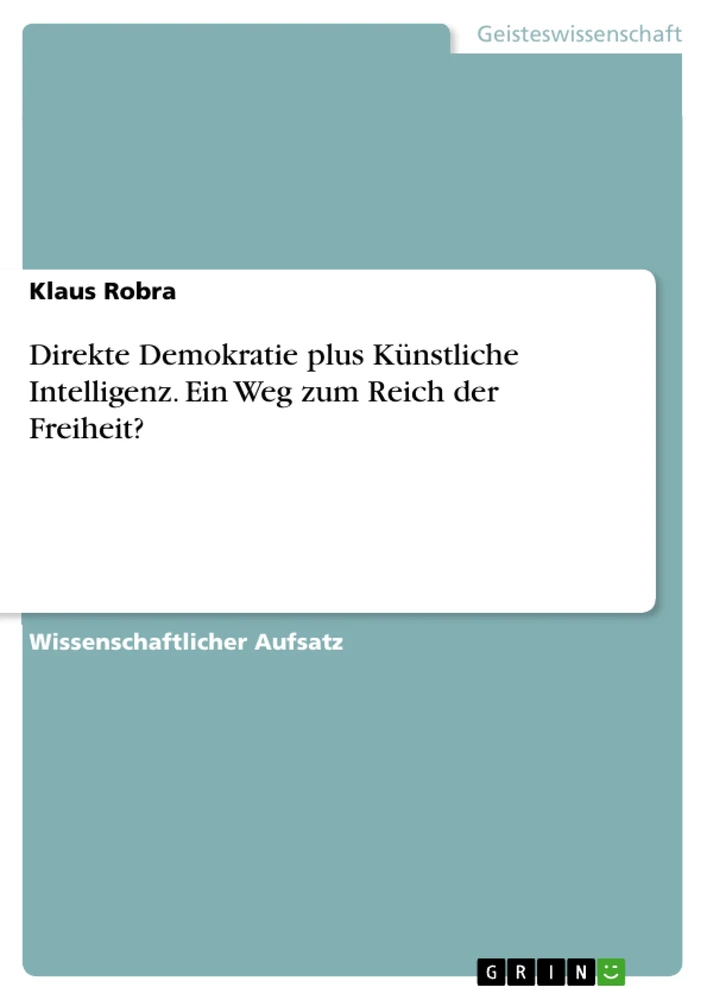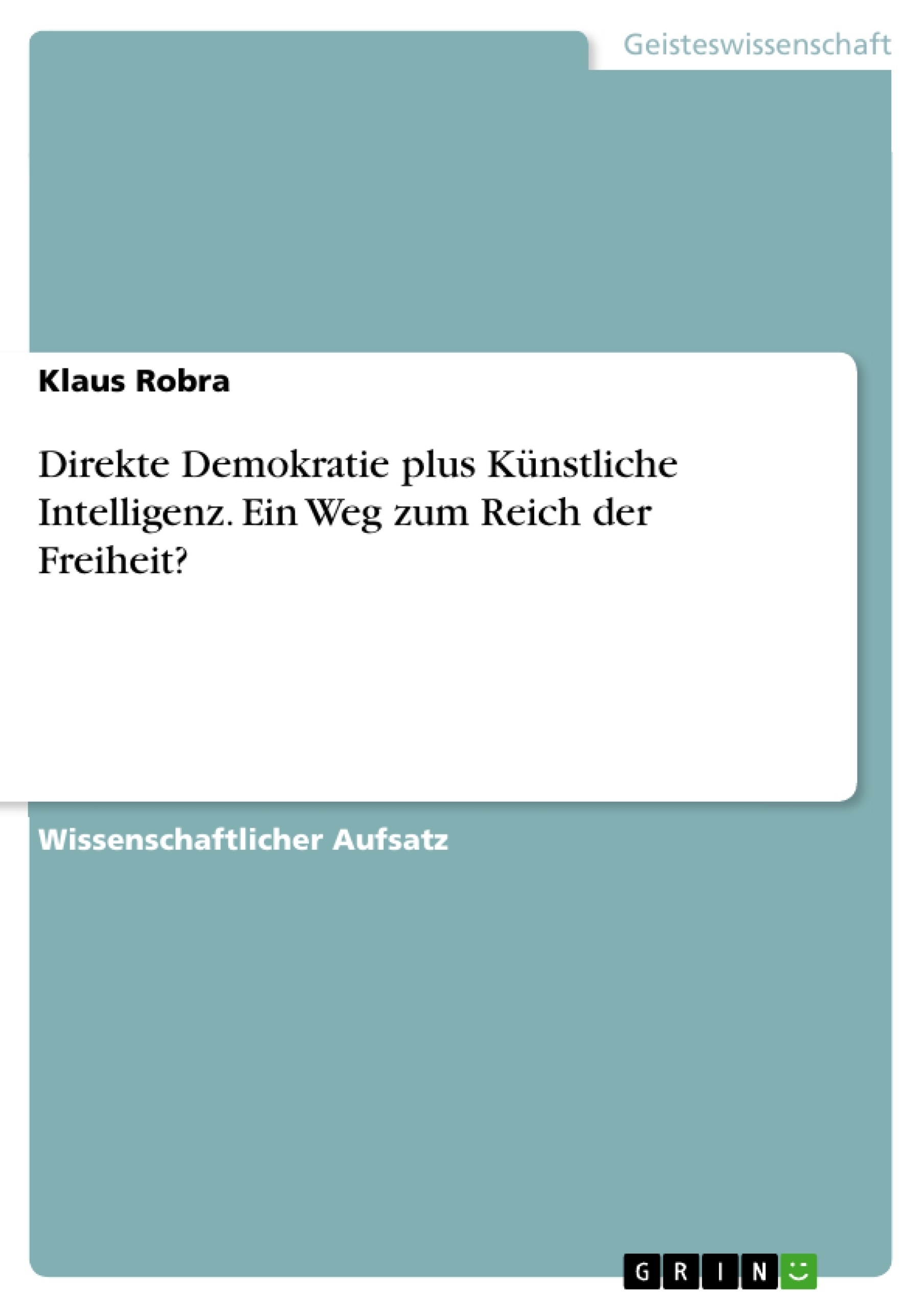"Demokratie" bedeutet in wörtlicher Entsprechung so viel wie „Herrschaft des Volkes“, wobei nicht „die Herrschaft“ entscheidend ist, sondern die mit ihr verbundene Selbstbestimmung des Volkes. Da dieses aber aus einer Gemeinschaft von Individuen, besser: Einzelpersonen besteht, bedarf es weiterer Erklärungen sowohl zu diesen Personen – als Rechtspersonen – als auch zu den von ihnen gebildeten Gemeinschaften. Wodurch die Problemlage unüberschaubar zu werden droht, zumal zwischen Individuum und Gesellschaft Verhältnisse wechselseitiger Abhängigkeit und Beeinflussung bestehen. Möglichst zu berücksichtigen ist die ganze Bandbreite von Wirtschaft und Gesellschaft, in der die Einzelpersonen sich nicht nur am Recht, sondern auch an ethischen Normen orientieren. Ihrem (relativ) freien Willen gemäß handeln können sie im Idealfall stets aufgrund dieser Orientierung. Hinzu kommen aktuell die Erfordernisse einer zeitgemäßen Natur-, Öko- und Tier-Ethik, deren Erfüllung vollumfänglich erst in einem Demokratischen Ökosozialismus bzw. einem darauf fußenden Reich der Freiheit möglich zu sein scheint.
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Warum Direkte Demokratie? Anfänge in der Antike
Direkte Demokratie bei Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
… Die inhaltliche Bestimmung des allgemeinen Willens (das Gemeinwohl) bleibt offen
… Die Form, in der sich der allgemeine Wille ausdrückt, ist das allgemeine Gesetz
„Kritik der Rousseauschen Demokratiekonzeption
… Die allgemeine Form eines Gesetzes schließt die unterschiedliche Betroffenheit nicht aus.
… Die Auflösung der inhaltlichen Argumentation in formale Entscheidungsverfahren
Karl Marx und die Direkte Demokratie
Kritische Würdigung des Marxschen Konzeptes
Weitere Verwirklichungen: Schweiz, USA u.a.
Und wie sieht es mit der DD in der Bundesrepublik Deutschland aus?
DD als Zukunftsvision. Das Konzept von A.U. Sommer
Elektronische Demokratie
Warum Künstliche Intelligenz?
Peter Bezler: „Echte Demokratie durch KI“ (2022)
Kritische Würdigung. Vor- und Nachteile von DD und KI
Vorteile der DD
Nachteile der DD
Vorteile der Künstlichen Intelligenz
Nachteile der KI
Synthese von DD und KI? Demokratischer Ökosozialismus als Ausweg?
Mit DD und KI zum Reich der Freiheit?
Wie aber steht es nun mit der KI im Hinblick auf ein (mögliches) Reich der Freiheit?
Literaturhinweise
Einführung
‚Demokratie‘ bedeutet in wörtlicher Entsprechung so viel wie „Herrschaft des Volkes“, wobei nicht „die Herrschaft“ entscheidend ist, sondern die mit ihr verbundene Selbstbestimmung des Volkes. Da dieses aber aus einer Gemeinschaft von Individuen, besser: Einzelpersonen besteht, bedarf es weiterer Erklärungen sowohl zu diesen Personen – als Rechtspersonen – als auch zu den von ihnen gebildeten Gemeinschaften. Wodurch die Problemlage unüberschaubar zu werden droht, zumal zwischen Individuum und Gesellschaft Verhältnisse wechselseitiger Abhängigkeit und Beeinflussung bestehen. Möglichst zu berücksichtigen ist die ganze Band-breite von Wirtschaft und Gesellschaft, in der die Einzelpersonen sich nicht nur am Recht, sondern auch an ethischen Normen orientieren. Ihrem (relativ) freien Willen gemäß handeln können sie im Idealfall stets auf Grund dieser Orientierung. Mein (vorläufiger) Vorschlag für eine Ethik der Verhaltenssteuerung lautet:
„Achte bei allem, was Du tust, darauf, Dich selbst und Deine Mit-Menschen als Rechtspersonen und Persönlichkeiten zu respektieren und möglichst stets das Sitten-gesetz zu befolgen.
>Möglichst< deshalb, weil es Ausnahmesituationen gibt, wie z.B. die der Notwehr, in denen die Rechte der eigenen Person gegen existenzielle Bedrohungen und Rechtsbrüche jeder Art zu verteidigen sind.“ [1]
Hinzu kommen aktuell die Erfordernisse einer zeitgemäßen Natur-, Öko- und Tier-Ethik, deren Erfüllung vollumfänglich erst in einem Demokratischen Ökosozialismus bzw. einem darauf fußenden Reich der Freiheit möglich zu sein scheint.
Ersichtlich wird jedenfalls, dass das Phänomen Demokratie nicht nur die theoretischen und praktischen Fragen der Regierungsform, sondern darüber hinaus umfangreiche Problemkreise von Ethik, Wirtschaft und Gesellschaft betrifft. Unmittelbar auch die Frage, ob eine Form Direkter Demokratie den gängigen Modellen von repräsentativem Parlamentarismus vorzu-ziehen ist. Desgleichen beziehen sich die genannten ethischen, wirtschaftlichen und gesell-schaftlichen Kriterien auch auf den Umgang mit der Künstlichen Intelligenz und erst recht auf die Frage, wie dabei die konkrete Utopie eines Reichs der Freiheit verwirklicht werden kann.
Warum Direkte Demokratie? Anfänge in der Antike
Die Direkte Demokratie, abgekürzt: DD, ist anscheinend die älteste Form der Demokratie überhaupt. Sie entstand wahrscheinlich im 7. oder 6. vorchristlichen Jahrhundert in den zahl-reichen griechischen Kolonien rund ums Mittelmeer, vor allem in Mittel- und Süditalien. Der Hauptgrund für ihre Entstehung mag kurios erscheinen, lag er doch in einer Notlage, in der sich die frühen griechischen Kolonien befanden. Sie hatten fremdländisches Territorium mili-tärisch erobert und wurden danach immer wieder in kriegerische Konflikte mit Teilen der alt-eingesessenen Bevölkerung verwickelt. Um militärisch standhalten zu können, mussten unter den wehrfähigen Männern ständig Beratungen und Absprachen stattfinden, und zwar mit gleichen Rechten für alle Beteiligten. Demgemäß entwickelten sich die ersten demokratischen Volksversammlungen, von denen allerdings Frauen, Sklaven und Ausländer ausgenommen waren. Die Grundrechte dieser ersten Demokraten waren:
1. Gleichberechtigte Teilnahme und Teilhabe aller Mitglieder der regelmäßig tagenden Volksversammlungen.
2. Gleiches Rederecht für alle Beteiligten.
3. Gleichheit vor dem Gesetz.
Diese Regelungen wurden in Athen seit ca. 510 v.Chr. übernommen, wo sie rund 200 Jahre lang, d.h. bis zum Untergang der Demokratie in Folge der makedonischen Machtübernahme, in Kraft blieben. Hierzu bemerkt Hans Vorländer (2017):
„In den Jahren 508/07 bis 322 v. Chr. herrschte in Athen eine direkte Demokratie mit einer Bürgerbeteiligung, deren Ausmaß von keiner späteren Demokratie wieder erreicht worden ist. Jeder Bürger konnte an der Volksversammlung sowie an den Gerichtsversammlungen teilnehmen; jeder Bürger war befugt, ein Amt zu bekleiden. Gemäß dem Wortsinn des griechischen ta politika, "das, was die Stadt angeht", war "Politik" die Angelegenheit des Bürgers in der Polis.“ [2]
Voraussetzungen für die Einführung der DD in Athen wurden u.a. von den Reformern Solon im Jahre 594 v.Chr. und Kleisthenes 508/507 v.Chr. geschaffen, und zwar vor allem dadurch, dass es ihnen gelang, die Macht des bis dato herrschenden Adels zu brechen; was Vorländer wie folgt beschreibt:
„Solon (ca. 640 – 561/558 v. Chr.) behob große soziale Missstände in Athen, indem er die verarmten Bauern mittels der sogenannten Lastenabschüttelung von ihren Hypo-theken und durch die Abschaffung der Schuldknechtschaft aus der Sklaverei befreite. Die Bevölkerung teilte er in vier Vermögensklassen ein. Solon schuf damit zugleich auch die Voraussetzungen einer politischen Neuordnung, weil das alte, aristokratische Prinzip der auf Herkunft und Abstammung basierenden gesellschaftlichen Stellung durchbrochen wurde. Er erschütterte die Vorherrschaft einiger weniger adliger Familien und erweiterte die Beteiligungsrechte für die unteren Schichten des Volkes.–
Kleisthenes (570 – 506 v. Chr.) reformierte 508/507 die gesamte Sozialstruktur und legte damit die Basis für die Demokratie in Athen. Mit einer territorialen Neueinteilung Athens löste er die alten Stammesverbände auf, zerbrach so die Machtstrukturen der adligen Familien und schuf eine einheitliche, nicht mehr von der sozialen Herkunft abhängige politische Bürgerschaft.
Zur neuen Grundlage der politischen Ordnung wurden die Gemeinden, die Demen. Diese waren, modern gesprochen, Kommunen mit lokaler Selbstverwaltung. Hier entstand eine politische Gemeinschaft, in der sich ein Sinn für bürgerschaftliches Handeln und politische Verantwortung entwickeln konnte. Die Demen delegierten eine ihrer Bürgerzahl entsprechende Quote von Mitgliedern in einen ebenfalls neu geschaffenen "Rat der Fünfhundert", die sogenannte Boule.“ (a.a.O.)
Aufgabe der Boule, die sich aus je 50 Vertretern der zehn Phylen [3] zusammensetzte, war es, die Volksversammlung vorzubereiten. Von den Phylen „war jeweils eine für ein Zehntel des Amtsjahres, also 36 Tage, geschäftsführend. Der Rat beriet die jeweiligen Themen der Volksversammlung, verabschiedete einen vorläufigen Beschluss und bestimmte die Tages-ordnung.
Außerdem ließ Kleisthenes die Demen in dreißig sogenannte Trittyen zusammenfassen. Je zehn dieser Trittyen bildeten die Regionen von Stadt, Küste und Binnenland. Indem Kleisthenes je eine Trittys aus diesen drei Regionen zu einer neuen Phyle kombinierte, waren nicht nur "Querschnitte" durch die Regionen hergestellt, sondern die gesamte Bevölkerung Attikas war nun auch nach repräsentativen Kriterien politisch neu zusammengesetzt. Ein neues politisches Gemeinwesen ersetzte das auf Klientelbindungen, Abhängigkeiten und Patronage beruhende System der alten aristokratischen Ordnung.“ (Vorländer a.a.O.)
Womit der Systemwechsel praktisch vollzogen war, auch wenn es zur endgültigen Konsoli-dierung der neuen Ordnung weiterer Reformen bedurfte. Hans Vorländer (a.a.O.):
„Zum einen wurde der Areopag, der Adelsrat, als letzte Bastion der Aristokratie ent-machtet. Seine Befugnisse – Überwachung der Gesetze, Verfahren bei politischen Vergehen und Beamtenkontrolle – wurden gestrichen oder auf das Volk übertragen.
Schließlich führte Perikles, als führender Staatsmann Athens im 5. Jahrhundert v. Chr., Diäten ein. Dies waren Tagegelder für die Bürger als Ausgleich für den Verdienstaus-fall, den sie durch die Teilnahme an Versammlungen und die Übernahme von Ämtern erlitten.“
Perikles (ca. 490 bis 429 v.Chr.), langjähriger Oberbefehlshaber der Armee, der auch als „Stratege der Demokratie“ bezeichnet wurde, lobt die Regierungsform seines Landes in den höchsten Tönen, und zwar in einer von dem Historiker Thukydides überlieferten, möglicher-weise fiktiv rekonstruierten „Lobrede auf Athens Demokratie“ aus dem Jahre 431 v.Chr.:
„... Weil das Regiment bei uns nicht in der Hand weniger, sondern der Gesamtheit liegt, nennt man unsere Verfassung demokratisch. Denn wie in den Angelegenheiten der einzelnen gleiches Recht für alle gilt, so gilt auch in Beziehung auf Geltung und Ansehen in Staat und Gemeinde nur persönliche Tüchtigkeit als Vorzug, nicht aber die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse, und selbst Armut hindert keinen, der was kann, aus seiner Unansehnlichkeit zu Amt und Würden zu gelangen... Im persönlichen Verkehr sind wir nicht weniger als Splitterrichter, im öffentlichen Leben aber schämen wir uns jeder Ungesetzlichkeit und gehorchen der jeweiligen Obrigkeit und den Gesetzen, vorzüglich den zum Schutz der Bedrängten gegebenen, und den wenn auch ungeschriebenen Gesetzen, deren Übertretung jedermann für eine Schande hält...
Auch für Gelegenheit zur Erholung von Mühe und Arbeit ist bei uns reichlich gesorgt durch Spiele und Feste, wie sie jahrein, jahraus gehalten werden, aber auch durch unser schönes Familienleben, dessen tägliche Freuden die Sorgen verscheuchen. Bei der Größe unserer Stadt kommen die Erzeugnisse aller Länder hier zu Markte, die wir so gut als unser Eigentum ansehen können wie die Erzeugnisse unseres eigenen Landes...
Auch in Beziehung auf das Kriegswesen befolgen wir insofern andere Grundsätze als unsere Gegner, als wir niemand den Aufenthalt hier in der Stadt verwehren. Es kommt nie vor, dass jemand ausgewiesen oder daran gehindert wird, sich hier umzutun und zu belehren, aus Furcht, die Feinde könnten uns Geheimnisse absehen und sich zu Nutze machen...
Seiner Armut braucht sich niemand zu schämen, es sei denn, dass er sie durch Faulheit selbst verschuldet hat. Der Politiker kann sich bei uns auch seinen eigenen Angelegen-heiten widmen und der Geschäftsmann, der sein Gewerbe treibt, sich dabei sehr wohl auf Politik verstehen... Bei uns bildet sich jeder wenigstens ein Urteil über solche Fragen, wenn es auch zunächst den berufsmäßigen Politikern überlassen bleibt, über deren richtige Lösung nachzudenken. Wir glauben nicht, dass die Sachen darunter leiden, wenn man sich erst öffentlich darüber ausspricht; im Gegenteil...
Mit einem Wort, ich sage, unsere Stadt ist die hohe Schule für ganz Griechenland..." [4]
Nachteile oder Schwächen der attischen Demokratie erwähnt Perikles anscheinend nicht. Dass es solche gab, wird oft verschwiegen. Nicht so von Patrick Langer, der in einer Studie des Jahres 2016 unter dem Titel Demokratie unter Perikles. Vorbild für heutige Staatsformen?[5]feststellt, die attische Demokratie sei „die Herrschaft einer Minderheit über die Mehrheit“ gewesen, und zwar wegen des vergleichsweise geringen Anteils der politisch vollberechtig-ten Bürger an der Gesamtheit der attischen Bevölkerung. Außerdem habe der Adel – ungeachtet seiner offiziellen Entmachtung – zumeist die Führung in der Volksversammlung übernommen – dies auf Grund seines Vermögens und seiner viel größeren politischen Erfah-rung.
Diese negativen Besonderheiten gilt es, ebenso wie die von Perikles beschriebenen positiven Aspekte, in eine mögliche Würdigung der DD einzubeziehen.
Direkte Demokratie bei Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
Nicht in der Praxis, aber in einer für die Praxis folgenreichen Theorie hat Rousseau die antiken Ideen einer Direkten Demokratie wieder aufgenommen. Eine der Grundfragen, die der Genfer Philosoph im VI. Kapitel seines ‚Contrat Social‘, des ‚Gesellschaftsvertrags‘ von 1762, stellt, lautet: Wie ist eine Gesellschaftsform (‚forme d’association‘) zu finden, „die mit der ganzen gemeinsamen Kraft die Person und das Vermögen jedes Gesellschaftsmitgliedes verteidigt und schützt und durch welche jeder Einzelne, auch wenn er sich mit allen vereinigt, dennoch nur sich selbst gehorcht und ebenso frei bleibt wie zuvor“? Die Antwort auf diese Frage erteilt er wenig später im gleichen Kapitel; sie lautet: „Jeder von uns vergesellschaftet (‚met en commun‘) seine Person und seine Kraft unter der oberste Leitung des Gemeinwillens (‚volonté générale‘), und wir nehmen jedes einzelne Mitglied in das Gemeinwesen auf als unteilbaren Teil des Ganzen.“
Mit anderen Worten: Die Einzelperson (‚la personne particulière‘) wird zur Gemeinschafts-Person (‚personne publique‘) und damit zur Rechtsperson dadurch, dass sie zunächst alle ihre Rechte an den Souverän, den Gemeinwillen, abtritt, der seinerseits im Gegenzug, d.h. sozusagen als Gegenleistung (‚équivalent‘), jeder Person sämtliche Rechte und damit die größtmögliche Freiheit garantiert. Folglich tritt die „natürliche Person“ in den Zustand der rechtlich völlig gesicherten Person über, was ohne den – durch die Zustimmung aller Mit-glieder des Gemeinwesens gebildeten – Gemeinwillen (und die entsprechende Gesetzgebung) nicht möglich wäre. [6]
Hierzu heißt es in einer Abhandlung der ‚Ethik-Werkstatt‘ (2008):
„Bei der Beschlussfassung kommt es für Rousseau darauf an, dass sich alle Staatsbürger die Frage vorlegen, was zum allgemeinen Besten ist. Rousseau macht dies am Beispiel eines Staatsbürgers klar, der seine Stimme für Geld verkauft: "Der Fehler, den er begeht, besteht in der Änderung der Fragestellung; er antwortet auf etwas ganz anderes, als er gefragt ist. Anstatt durch die Abgabe seiner Stimme zu sagen: 'Es ist dem Staat vorteilhaft', sagt er: 'Es ist diesem oder jenem Manne, dieser oder jener Partei vorteilhaft, dass dieser oder jener Antrag durchgeht'." (S. 151)
Die Staatsbürger sollen bei Beschlüssen also nicht entsprechend ihren privaten Interessen entscheiden, sondern sie bilden eine Art Jury, die diejenige Alternative aussuchen soll, die dem Gemeinwohl am besten entspricht. Wenn die einzelnen Staatsbürger bei einer Entscheidung unterschiedlich abstimmen, so dürfen sich nach Rousseau darin also höchstens Meinungsverschiedenheiten über das Gemeinwohl, jedoch keine privaten Interessenunterschiede ausdrücken.
Rousseau stellt an die Staatsbürger hohe Anforderungen: "Sobald der Staatsdienst aufhört, die Hauptangelegenheit der Bürger zu sein, ... ist der Staat schon seinem Untergang nahe. .. Zur Beratung ernennen sie Abgeordnete und bleiben ... zu Hause. ... Sobald man bei Staatsangelegenheiten die Worte hören kann: 'Was geht mich das an?' kann man darauf rechnen, dass der Staat verloren ist." (S. 138 f.)
Ein Parlament von gewählten Abgeordneten, die in Vertretung der Staatsbürger die Gesetze beschließen, ist für Rousseau nicht zulässig. Der allgemeine Wille kann für ihn nicht durch einen Teil der Staatsbürger formuliert werden: "Die Staatshoheit ... besteht wesentlich im allgemeinen Willen, und der Wille lässt sich nicht vertreten. ... Jedes Gesetz, das das Volk nicht persönlich bestätigt hat, ist null und nichtig." (S. 139f.) "Es ... steht mit sich selbst im Widerspruch, dass das Staatsoberhaupt einen ihm Vorgesetzten ernennen könne." (S. 143) "Sobald ein Volk Vertreter ernennt, ist es nicht mehr frei.“ (S. 142) [7]
Mögliche Einwände gegen eine direkte Gesetzgebung durch die Staatsbürger werden von Rousseau nicht näher erörtert. In größeren Flächenstaaten - so auch in der Ersten französischen Republik von 1789 - gab es gesetzgebende Körperschaften, die aus Abgeordneten bestanden, die von den Staatsbürgern gewählt wurden.
… Die inhaltliche Bestimmung des allgemeinen Willens (das Gemeinwohl) bleibt offen
Angesichts der zentralen Stellung, die der Begriff des allgemeinen Willens in der Theorie des Gesellschaftsvertrages hat, stellt sich die Frage, wie sich feststellen lässt, was der allgemeine Wille beinhaltet. Denn von der Menschheit oder der Gesellschaft als von einem mit einem Willen ausgestatteten Wesen zu reden, ist erstmal nur eine biologische Metapher. Durch den Gesellschaftsvertrag entsteht auch für Rousseau nur ein "geistiger Gesamtkörper", der nicht mit einer konkreten staatlichen Organisation gleichgesetzt werden kann. Die Frage ist also, wie diesem geistigen Gesamtkörper, diesem Staat als "moralischer Person", wie Rousseau auch sagt (S. 47), ein Wille zugeschrieben werden kann und wie sich dieser Wille äußert.
Da das Staatsoberhaupt durch die Gesamtheit der Staatsbürger gebildet wird, stellt sich die Frage nach dem allgemeinen Willen dar als die Frage, wie eine Vielzahl von Staatsbürgern, die als Privatmenschen unterschiedliche und eigenbezogene Interessen haben (" la volonté de tous" ) zu einem einheitlichen, gemeinsamen Willen (" la volonté génerale“) gelangen können.
Dies Problem stellt sich in aller Schärfe, weil nach Rousseau "jeder
einzelne als Mensch einen besonderen Willen haben (kann), der dem
allgemeinen Willen, den er als Staatsbürger hat, zuwider läuft." (S. 47)
Offensichtlich existiert nach Rousseau jedes Individuum einmal als Mensch
mit Privatinteressen (Privatmann) und einmal als Staatsbürger, der sich am
allgemeinen Willen orientiert, wobei "der Wille des Einzelnen unaufhörlich
gegen den allgemeinen Willen ankämpft." (S. 128)
Durch den Übergang in den staatsbürgerlichen Zustand hat sich allerdings
nach Rousseau eine Moralisierung des Individuums vollzogen: "Der Übergang
aus dem Naturzustand in den bürgerlichen bringt im Menschen eine sehr
bemerkbare Veränderung hervor, indem in seinem Verhalten die Gerechtigkeit
an die Stelle des Instinktes tritt und sich in seinen Handlungen der
sittliche Sinn zeigt, der vorher fehlte. Erst in dieser Zeit verdrängt die
Stimme der Pflicht den physischen Antrieb und das Recht der Begierde, so
dass sich der Mensch, der bis dahin lediglich auf sich selbst Rücksicht
genommen hatte, gezwungen sieht, nach anderen Grundsätzen zu handeln und
seine Vernunft um Rat fragt, bevor er auf seine Neigung hört." (S. 48)
Aber auch durch die Hinweise auf das Entstehen von Pflichtbewusstsein und
Vernunft, die den Staatsbürger als Träger des allgemeinen Willens ausmachen,
wird keine inhaltliche Konkretisierung des allgemeinen Willens erreicht.
Immer wieder findet sich der Hinweis, dass der allgemeine Wille auf das
"allgemeine Wohl" bzw. das "Gemeinwohl" gerichtet ist (S. 54 und S. 149),
auf das "allgemein Beste" (S. 58), die "allgemeine Wohlfahrt" (S. 149), das
"gemeinsame Interesse" (S. 150), den "Vorteil des Staates" (S. 151), die
"gemeinsame Erhaltung" (S. 149) usw.
Auch die darüber hinausgehenden Hinweise Rousseaus, dass die Bürger bei der Abstimmung sich nicht von ihren partikulare Interessen sondern vom allgemeinen Besten leiten lassen sollen, bleiben vage und stellen kein inhaltliches Kriterium dar, um entscheiden zu können, ob ein konkreter Beschluss dem "allgemeinen Willen" entspricht oder nicht. Eine Konkretisierung und Systematisierung dieser Vorstellungen vom Gemeinwohl ist bei Rousseau nur ansatzweise auszumachen, etwa wenn er dem allgemeinen Willen das Ziel der Gleichheit zuschreibt.
… Die Form, in der sich der allgemeine Wille ausdrückt, ist das allgemeine Gesetz
Es gibt allerdings die formale Bestimmung, dass der allgemeine Wille sich nur in der Form eines allgemein formulierten Gesetzes ausdrückt. Damit ist eine formale Gleichheit der Staatsbürger vor dem Gesetz gewährleistet.
Unter einem Gesetz versteht Rousseau nicht jede Verhaltensnorm für die Untertanen, sondern nur solche Normen, die einen allgemeinen Gegenstand haben: "Wenn ich sage, dass der Gegenstand der Gesetze immer allgemein ist, so meine ich damit, dass das Gesetz die Untertanen insgesamt und die Handlungen an sich ins Auge fasst, dagegen nie einen Menschen als Einzelnen und ebenso wenig eine besondere Handlung. ... Jedes mit einem einzelnen Wesen vorzunehmende Geschäft ist der gesetzgebenden Gewalt entzogen.“ (S. 69 f.)
Gesetze müssen also insofern allgemein formuliert sein, als sie kein Individuum oder keine Gruppe von Individuen namentlich erwähnen. Sie müssen auf allgemein definierte Klassen von Individuen oder Handlungen zutreffen. Offenbar glaubt Rousseau, dass durch die allgemeine Gesetzesform die Verfolgung partikularer Interessen bereits ausgeschlossen wird, da niemand gezielt bevorzugt oder benachteiligt werden kann. "Die Verpflichtungen, die uns an den Gesellschaftskörper knüpfen (also die Gesetze), sind nur deswegen verpflichtender Natur, weil sie gegenseitig sind, und ihr Wesen ist derart, dass man bei ihrer Erfüllung nicht für andere arbeiten kann, ohne auch für sich zu arbeiten. ... Deshalb ist der allgemeine Wille immer richtig, und deshalb wollen alle stets das Glück eines jeden unter sich, wenn nicht um dessen willen, weil es niemanden gibt, der nicht das Wort ' jeder' sich aneignet und nicht an sich selber denkt, so oft er für alle stimmt" (S. 61) "Sobald das ganze Volk über das ganze Volk beschließt, nimmt es nur auf sich selbst Rücksicht" (S. 69) und man darf nicht mehr fragen, "ob das Gesetz ungerecht sein kann, da niemand gegen sich selbst ungerecht ist." (S. 70)“ [8]
In diesen Überlegungen kristallisiert und fokussiert sich nicht nur Rousseaus revolutionäre politische Philosophie, sondern auch die Quintessenz seiner Anthropologie, durch die er den Wert des Menschen als Person neu bestimmt, nämlich als „absolute Unveräußerlichkeit der Person“ (ein Gedanke, dem Ernst Bloch in Naturrecht und menschliche Würde auf 350 Seiten Nachdruck verliehen hat). Erst in Bezug auf diese Unveräußerlichkeit lassen sich die umfangreichen Analysen des Person-Seins erklären, die Rousseau in seinen philosophischen und literarischen Werken geleistet hat. Wo es um die Person geht, müssen die Horizonte sich öffnen, und zwar so weit wie möglich.
Wie hat der Autor dies bewerkstelligt? Im Unterschied zu den meisten Aufklärern seiner Zeit nicht dadurch, dass er vom Atheismus ausgeht. Im Gegenteil: Gott steht für ihn außer Frage, und zwar nicht aus Erkenntnis- oder Offenbarungsgründen, sondern aus Gründen der Natur- und Gefühlsbeobachtung : „Ich sehe Gott in seinen Werken, fühle ihn in mir und über mir, aber ich kann das Geheimnis seines Wesens nicht erkennen.“ (Zitiert von K. Vorländer 1967, S. 72.)
Materie und Geist – beide von Gott geschaffen – hält Rousseau für Grundprinzipien; auch dies im Unterschied zu den Materialisten. – Formell war er Christ, d.h. keineswegs im klerikalen Sinne, nicht im Sinn der bestehenden Kirchen, die er scharf kritisierte. In Genf calvinistisch erzogen, trat er als junger Mann zum Katholizismus über, kehrte aber in späteren Jahren wieder zum Protestantismus zurück. In seinen posthum (1788) erschienenen ‚Bekenntnissen‘ spielt er hierauf an, indem er bemerkt: „Der Katholik muss die Entscheidung, die man ihm gibt, annehmen. Der Protestant muss lernen, sich selbst zu entscheiden.“
Wenn es einen Gott gibt, schreibt er einmal in einem Brief an Voltaire, dann ist er allgütig, allweise und allmächtig, so dass er auch mir eine unsterbliche Seele verleihen kann. [9] Es ist also ein nicht ganz zweifelsfreier Glaube an einen persönlichen Gott, der ihn bewegt.
Präziser äußert er sich zu religiösen Fragen im vorletzten (VIII.) Kapitel des ‚Contrat Social‘, in dem er eine „Zivilreligion“, eine Religion des Menschen bzw. des Citoyen, des Staats-bürgers, fordert. Hierzu sei nicht das bestehende Christentum, sondern nur dasjenige des davon völlig verschiedenen ursprünglichen Evangeliums geeignet. Religion und Staat seien zu trennen. Als Souverän habe der Gemeinwille keine religiösen Dogmen zu verkünden, sondern lediglich einige wenige, einfache, präzise, ohne Erläuterung oder Kommentar verständliche Glaubenssätze bekannt zu geben, die im Gemeinwesen das Gefühl der Zusam-mengehörigkeit (‚sentiments de sociabilité‘) stärken sollen, und zwar 1.: es gibt eine mächtige, intelligente, wohltätige, vorsorgende und fürsorgliche Gottheit; 2.: es gibt ein Leben in der Zukunft, anscheinend unter Einschluss der Unsterblichkeit der Seele (s. Anm. 357); 3.: Glück für die Gerechten, Bestrafung der Missetäter (,méchants‘); 4. der Gesellschaftsvertrag und die Gesetze sind heilig. – Außer diesen vier positiven zivilen „Dogmen“ gibt es nur ein negatives: das Verbot der Intoleranz. Obwohl niemand gezwungen werden kann, die genannten Glaubenssätze zu befolgen, räumt Rousseau dem souveränen Gemeinwillen das Recht ein, Verstöße gegen diese Regeln der Soziabilität sogar mit Verbannung (!) zu bestrafen. Und er geht noch weiter: Wer die „Dogmen“ öffentlich anerkennt, dies aber durch sein tatsächliches Verhalten dementiert, macht sich des „größten Verbrechens“ überhaupt schuldig: Bruch des Gesellschaftsvertrags durch „Lüge vor dem Gesetz“, was durch die Todesstrafe (!) zu ahnden sei.
Auffälliger Weise äußert Rousseaus sein Bekenntnis zum Gottesglauben auch im Rahmen seiner berühmten Erziehungsschrift, des ‚ Emile‘ von 1762. Darin bekräftigt er seinen Grundsatz, dass der Mensch von Natur aus gutartig ist und negative Eigenschaften nur in Folge schädigender gesellschaftlicher Einflüsse entwickelt (die durch den ‚Contrat Social‘ allmählich beseitigt werden sollen). Im Unterschied zu Voltaire zählt Rousseau auch Kultur und Wissenschaft innerhalb einer fehlgeleiteten, im Argen liegenden Gesellschaft [10] zu den Quellen möglicher Schädigung. Für die Erziehung bedeutet dies: „Der heranwachsende Mensch muß ferngehalten werden von verbildenden Einflüssen. Alles kommt darauf an, die grundsätzlich in jedem Menschen liegende gute Naturanlage auf natürliche Weise werden und reifen zu lassen. Die Aufgabe der Erziehung ist daher eine negative, die besteht im Fernhalten aller Einflüsse des Gesellschaftslebens, die diesen Prozeß stören können.“ (Störig 1961, S. 428)
Fazit.Dann also „zurück zur Natur“? Dieses vielzitierte Bonmot stammt angeblich gar nicht von Rousseau, sondern von Voltaire, der seinen Erzrivalen damit lächerlich machen wollte. Wie dem auch sei, es steht fest, dass Rousseau zeitlebens durch und durch naturverbunden war und stets eine auf „vernünftiger Natürlichkeit“ aufbauende Lebensweise empfohlen hat. In seiner Kulturkritik ging er immerhin so weit, dass er sogar vor Theater- und Konzert-besuchen warnte. Stattdessen solle man sich viel mehr im Freien bewegen, spielen, Sport treiben (z.B. in Regatten auf dem Genfer See), lange Fußmärsche in freier Natur machen usw. Berühmt sind Rousseaus Träumereien eines einsamen Spaziergängers, die (ab 1772) im Anschluss an solche Fußmärsche entstanden sind.
Unbestreitbare Verdienste hat Rousseau sich aber nicht nur durch seine Warnungen vor naturfernem, entfremdetem Leben erworben. Von höchst nachhaltiger Wirkung war vielmehr seine Politische Philosophie (u.a. der Direkten Demokratie) in Verbindung mit seiner neuen Wert-Bestimmung der „unveräußerlichen Person“. Kluger Personalismus erwies sich hier als geistesgeschichtliche und politische Wirkungsmacht ersten Ranges. Diese Philosophie beeinflusste so bedeutende Dichter und Denker wie Goethe, Schiller, Kant, Fichte, Herder, Marx, Nietzsche, Pestalozzi und Basedow und damit Strömungen wie den Sturm und Drang, die Romantik, den Sozialismus, die Lebensphilosophie, den Personalismus, die Psychoanalyse und die Reformpädagogik. Anhänger der heutigen Öko-Bewegung berufen sich ebenfalls auf Rousseau.
Der außerdem den Gang der Geschichte entscheidend mit bestimmt hat, nämlich hin zur Französischen Revolution. Dazu schreibt Karl Vorländer: „Vor allem aber ist ROUSSEAU, wiewohl er persönlich sich gegen jeden gewaltsamen Umsturz ausgesprochen hatte, zum Philosophen der Französischen Revolution geworden. Ihre Schlagworte liberté, égalité, fraternité sind ROUSSEAUschen Gepräges, die Verfassung von 1793, welche die konstitutionellen Ideen von 1791 überwand, ist von ROBESPIERE und SAINT-JUST nach dem Muster des < Contrat social> entworfen.“ (a.a.O. S. 73)
Dass mit diesem mächtigen Einfluss Rousseaus auch Tragik verbunden sein konnte, gibt Hans-Joachim Störig zu bedenken, wenn er erklärt: „Auch der tragische innere Widerspruch, welcher sich in der Revolution entfaltete – die wie manche andere mit der Parole der Freiheit begann und in Intoleranz und Despotie endete – ist schon vorgebildet im Denken Rousseaus. Der entschiedene Individualismus, den er vertritt, bleibt doch in einem trotz Rousseaus Beteuerung unaufgelösten Widerspruch mit den schroffen Forderungen nach unbedingter Unterordnung des Individuums unter den Gemeinwillen, die er im zweiten Teil des >Contrat social< erhebt. Sie gehen so weit, daß in Rousseaus Staat Widerspenstigkeit gegen die Staatsreligion, die er aufstellt, mit Tod oder Verbannung bestraft werden soll.“ (Störig a.a.O. S. 431)
Diese Kritik zwingt zum Nachdenken, auch wenn sie Rousseaus Personalismus außer Acht lässt und überzogen wirkt insbesondere hinsichtlich der „Staatsreligion“ (der ja, mit Ausnahme der übertriebenen Strafandrohungen, enge Grenzen gesetzt sind).
Ähnlich wie bei Lamettrie gibt es eine weitere Schwachstelle in der Philosophie Rousseaus, nämlich bei der Frage, wie wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Mächte so zusammenwirken, dass sie soziale Ungleichheit und Ungerechtigkeit herbeiführen bzw. verstärken. Schuld daran ist nicht das pure Privateigentum (das Rouuseau anfangs als den eigentlichen Sündenfall der Menschheitsgeschichte bezeichnet, später jedoch in seiner bürgerlichen Ausprägung durchaus gutheißt). Nicht Rousseau, sondern Karl Marx fragt, wie im Kapitalismus das „fungierende Privateigentum an den Produktionsmitteln“ (Ralf Dahrendorf) die Klassengegensätze verschärft. [11]
Hinzufügen kann man die folgende
"Kritik der Rousseauschen Demokratiekonzeption"
… Die allgemeine Form eines Gesetzes schließt die unterschiedliche Betroffenheit nicht aus.
Es lässt sich jedoch leicht zeigen, dass die allgemeine Formulierung eines
Gesetzes keineswegs die Möglichkeit ausschließt, dass dies Gesetz im
Interesse bestimmter Teile der Bevölkerung und gegen das Interesse anderer
Teile der Bevölkerung ist. Ein einfaches Beispiel kann dies klarmachen.
Nehmen wir zum Beispiel die gesetzliche Norm: "Jeder, der seine Schulden
nicht rechtzeitig bezahlt, soll in Schuldhaft genommen werden."
Ohne Zweifel hat diese Norm die Form eines allgemeinen Gesetzes, da keine
bestimmten Personen oder Handlungen erwähnt werden, sondern die Adressaten
und die Handlungen allgemein und ohne Ansehen der Person formuliert sind.
Trotzdem ist die Interessenlage der Individuen hinsichtlich eines solchen
Gesetzes zwischen reichen und armen Staatsbürgern sehr unterschiedlich,
denn die Reichen befinden sich als die Gläubiger gewöhnlich nicht in der
Gefahr, dass das Gesetz gegen sie angewandt wird.
Ein anderes Beispiel wäre ein Steuergesetz, das lautet: "Jeder erwachsene Bürger hat eine jährliche Steuer von 1000 Talern zu entrichten". Auch eine solche Norm hätte die Form eines allgemeinen Gesetzes, ohne dass man davon ausgehen könnte, dass ein solches Gesetz immer gerecht ist.
Diese Beispiele zeigen, dass die Annahme Rousseaus irrig ist, dass die
Staatsbürger in ihrer Gesamtheit sich selbst kein Unrecht antun können und
dass es deshalb keinerlei Schranken und Kontrollen für den sich in Gesetzen
ausdrückenden allgemeinen Willen geben dürfe.
Solange die tatsächliche Lage der Individuen in irgendeiner Hinsicht nicht
dieselbe ist, weil die einen zum Beispiel Bauern und die anderen Handwerker,
die einen reich und die anderen arm, die einen Frauen und die anderen
Männer, die einen gesund und die anderen krank sind, solange ist es irrig
anzunehmen, dass allein durch die allgemeine Form des Gesetzes eine
Übereinstimmung der Interessen aller Bürger hergestellt werden kann.
Nur eine völlige Homogenität der äußeren Lage und der Bedürfnisse aller Bürger würde dazu führen, dass jeder bei der Beschlussfassung über ein allgemeines Gesetz nur von sich selber auszugehen braucht, um zu wissen, was im allgemeinen Interesse ist. Eine solche Homogenität ist jedoch real nie gegeben.
Rousseau selber dachte wohl mit Blick auf seine Heimatstadt Genf an eine überschaubare Gesellschaft selbständiger Produzenten, wo "jeder etwas und keiner allzu viel hat" (S. 53) und somit die sozialen Unterschiede relativ gering waren.
… Die Auflösung der inhaltlichen Argumentation in formale Entscheidungsverfahren
Der entscheidende Fehler in Rousseaus Vorstellung von Demokratie zeigt sich an Formulierungen wie: "Aus der Stimmenzahl ergibt sich die Bekundung des allgemeinen Willens. Wenn .. meine Ansicht .. unterliegt, so beweist dies nichts anderes, als dass ich mich geirrt hatte, und dasjenige, was ich für den allgemeinen Willen hielt, dies nicht war." (S. 134).
Rousseau lässt also die inhaltliche Frage, ob etwas wahr ist, durch ein Abstimmungsverfahren beantworten.
Fragen nach dem Gemeinwohl bzw. dem allgemeinen Besten, über die man inhaltlich diskutieren kann und muss, werden bei Rousseau nicht aus praktischen Gründen verfahrens-mäßig durch Abstimmung beendet, sondern das Verfahren entscheidet bei ihm auch inhaltlich. Ein nicht unproblematisches Verfahren, denn die Abstimmung nach dem Mehr-heitsprinzip wird letztlich gleichgesetzt mit dem Prozess der richtigen Beantwortung politischer Fragen.
Die unterlegene Minderheit muss deshalb nach der Abstimmung ihre Meinung als irrig aufgeben. Folglich ist für eine legitime Opposition gegen die Mehrheitsmeinung im Rahmen von Rousseaus Konzeption von Demokratie kein Platz.
Außerhalb des republikanischen Staates gibt es keine Sittlichkeit oder Moral, denn die Moralität des Menschen entsteht erst mit seiner Eigenschaft als Staatsbürger. Und gegen den Mehrheitsbeschluss der Staatsbürger als Kundgebung des allgemeinen Willens kann es keine begründete Kritik mehr geben. Der Staat und sein Handeln erhält somit eine nicht mehr hinterfragbare Autorität.
Wenn man Rousseaus Konzeption des Staates und des Allgemeinen Willens in dem beschriebenen Sinne interpretiert, werden die autoritären politischen Konsequenzen deutlich, die sich aus dieser Theorie ziehen lassen: Unterdrückung aller Minderheitenmeinungen und Minderheiteninteressen, ungehemmte Entfaltung der staatlichen Macht und rücksichtslose Bekämpfung politischer Opposition und politischen Widerstandes.“ [12]
Karl Marx und die Direkte Demokratie
Von Marx ist bekannt, dass er zeitlebens die attische direkte Demokratie bewundert hat. Dem-gemäß entschieden kritisiert er Hegel, der die Demokratie ablehnt, weil er die breite Masse des Volkes nicht für fähig hält, über sich selbst zu bestimmen, und daher die Monarchie befürwortet – Letzteres wohl auch im Blick auf seinen Dienstherrn, den Preußenkönig. Marx bemerkt hierzu in seiner Kritik der Hegelschen Staatsphilosophie (1841/42):
„Der Staat ist ein Abstraktum. Das Volk allein ist das Konkretum. Und es ist merkwürdig, daß Hegel, der ohne Bedenken dem Abstraktum, nur mit Bedenken und Klauseln dem Konkretum eine lebendige Qualität wie die der Souveränität beilegt. …
Die Demokratie ist die Wahrheit der Monarchie, die Monarchie ist nicht die Wahrheit der Demokratie. Die Monarchie ist notwendig Demokratie als Inkonsequenz gegen sich selbst, das monarchische Moment ist keine Inkonsequenz in der Demokratie. Die Monarchie kann nicht, die Demokratie kann aus sich selbst begriffen werden. In der Demokratie erlangt keines der Momente eine andere Bedeutung, als ihm zukommt. Jedes ist wirklich nur Moment des ganzen Demos. In der Monarchie bestimmt ein Teil den Charakter des Ganzen. Die ganze Verfassung muß sich nach dem festen Punkt modifizieren. Die Demokratie ist die Verfassungsgattung. Die Monarchie ist eine Art, und zwar eine schlechte Art. Die Demokratie ist Inhalt und Form. Die Monarchie soll nur Form sein, aber sie verfälscht den Inhalt.
In der Monarchie ist das Ganze, das Volk, unter eine seiner Daseinsweisen, die politische Verfassung, subsumiert; in der Demokratie erscheint die Verfassung selbst nur als eine Bestimmung, und zwar Selbstbestimmung des Volks. In der Monarchie haben wir das Volk der Verfassung; in der Demokratie die Verfassung des Volks. Die Demokratie ist das aufgelöste Rätsel aller Verfassungen. Hier ist die Verfassung nicht nur an sich, dem Wesen nach, sondern der Existenz, der Wirklichkeit nach in ihren wirklichen Grund, den wirklichen Menschen, das wirkliche Volk, stets zurückgeführt und als sein eigenes Werk gesetzt. Die Verfassung erscheint als das, was sie ist, freies Produkt des Menschen; man könnte sagen, daß dies in gewisser Beziehung auch von der konstitutionellen Monarchie gelte, allein der spezifische Unterschied der Demokratie ist, daß hier die Verfassung überhaupt nur ein Daseinsmoment des Volkes, daß nicht die politische Verfassung für sich den Staat bildet.
Hegel geht vom Staat aus und macht den Menschen zum versubjektivierten Staat; die Demokratie geht vom Menschen aus und macht den Staat zum verobjektivierten Menschen.“ [13]
In Kurzform:
1. Hegel geht fälschlicherweise nicht vom Konkreten, dem Volk, aus, sondern vom Ab-strakten, dem Staat.
2. Er anerkennt nur den bestehenden Staat der Monarchie und sieht daher nicht, dass „die Demokratie … die Wahrheit der Monarchie“ ist, aber „die Monarchie … nicht die Wahrheit der Demokratie“.
3. Während in der Demokratie der ganze Demo bestimmt, bestimmt in der Monarchie nur „ein Teil den Charakter des Ganzen“.
4. „In der Monarchie haben wir das Volk der Verfassung; in der Demokratie die Verfassung des Volks.“ In der Monarchie wird das Volk auf seine Funktion als Teil der Verfassung reduziert. Dagegen dient die Verfassung in der Demokratie nur als eine Bestimmung, nämlich die „Selbstbestimmung des Volks“.
5. „Hegel geht vom Staat aus und macht den Menschen zum versubjektivierten Staat; die Demokratie geht vom Menschen aus und macht den Staat zum verobjektivierten Menschen.“
Darüber hinaus entwickelt Marx sein Demokratie-Konzept auch aus seiner Kritik an der fran-zösischen Menschenrechts-Erklärung von 1789, wobei er allerdings zusätzlich die Verfassun-gen von 1791, 1793 und 1795 berücksichtigt, denen die Erklärung … von 1789 jeweils in kaum veränderten Fassungen als ebenso verbindlich vorangestellt wurde.
Marx unterscheidet scharf nicht nur zwischen dem ‚Homme‘, dem Menschen als solchem, und dem ‚Citoyen‘, dem Staatsbürger, sondern auch zwischen den Rechten des Menschen und denen des Staatsbürgers, obwohl eine derartige Trennung in der Erklärung … von 1789 nirgendwo zu finden ist.
Der Homme sei zwar ein Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft, als solcher aber nur ein isolierter, vom Mitmenschen und vom Gemeinwesen getrennter „Egoist“. Als Grund hierfür nennt Marx die Orientierung (bzw. Begrenzung) der Freiheit an der Freiheit des Mit-menschen. Diese Grenze sei „durch das Gesetz bestimmt, wie die Grenze zweier Felder durch den Zaunpfahl bestimmt ist“. Dadurch werde der Mensch nicht mit seinem Mitmenschen verbunden, sondern, im Gegenteil, radikal (in „Absonderung“) von ihm getrennt. Folglich verkomme das „Menschenrecht der Freiheit“ zu etwas völlig Individuellem, Abgesondertem, nämlich zum „Recht des beschränkten , auf sich beschränkten Individuums“.
Abgesichert werde hierdurch nichts anderes als das Privateigentum, über das der Bürger – laut Artikel 16 der Verfassung von 1793 – „nach Belieben“ (‚à son gré‘) verfügen dürfe. Womit dieser Bürger sich nicht als verantwortungs- und pflichtbewusster Citoyen, sondern als „Bourgeois“ entpuppt, so dass die Menschenrechte gar nicht für die Allgemeinheit, sondern nur für die Mitglieder der durch die Revolutionen aufgewerteten bürgerlichen Klasse bestimmt seien. Denn Grundprinzip dieser Klasse sei die völlig willkürliche Verfügung über das Privateigentum – unter Missachtung jeglicher Rücksicht auf das Gemeinwohl.
Daraus folgert Marx, dass dort, wo in den Revolutions-Verfassungen von „Sicherheit“ die Rede sei, in Wirklichkeit nur die „ Versicherung des Egoismus“, der Schutz der „egoistischen Person“ gemeint sei. Der Citoyen werde total herabgewürdigt, nämlich völlig in den Dienst des „egoistischen homme“ gestellt, so dass nur noch „der Mensch als bourgeois für den eigentlichen und wahren Menschen genommen“ werde. Genau hierdurch werde die politische Emanzipation des Menschen verhindert.
Dagegen müsse „der wirkliche individuelle Mensch den abstrakten Staatsbürger in sich“ zurücknehmen, was nur möglich sei, wenn der Mensch seine eigenen Kräfte („forces propres“) nicht mehr als bloß individuelle, sondern als gesellschaftliche erkenne. Dann erst sei das Mensch-Sein nicht mehr vom Sein des Citoyen und die Politik nicht mehr von der Gesellschaft getrennt. (Vgl. Karl Marx: Zur Judenfrage, in: Marx-Engels-Studien-Ausgabe, Bd. 1, Frankfurt a.M. 1966, S. 46-53.)
Zur Marxschen Gegenposition schreibt Alfred Müller (2024):
„Marx war bis zu seinem Tode ein konsequenter Vertreter der Humanität und der Basisdemokratie und setzte sich entsprechend ein … für die Aufhebung „aller Verhältnisse […], in denen der Mensch eine erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist“.“ [14]
Eine Forderung, die Marx auch, in Anlehnung an Kant, als seinen „kategorischen Imperativ“ bezeichnete. Er entsprach dieser Forderung nicht nur in seiner theoretischen Arbeit, sondern auch in praktischem politischem Engagement. Hierzu A. Müller:
„Marx vertrat die Demokratie nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. Während seiner Zeit in Brüssel (1845 – 1848) war er Vizepräsident der Demokratischen Gesellschaft. Gleich nach seiner Rückkehr nach Deutschland gründete er mit der Neuen Rheinischen Zeitung das »Organ der Demokratie«, das nationale Bedeutung er langte und die Ideen der Demokratie verbreitete. Gleichzeitig war er in Köln (April 1848 bis zu seiner Ausweisung Mai 1849) Mitglied der Demokratischen Gesellschaft. In London war er von 1864 bis 1872 führendes Mitglied der Internationalen Arbeiterassoziation (IAA), die sich für die Wahlrechtsreform, die Sklaven-emanzipation, die nationale Emanzipation und für die Emanzipation der Arbeiter-klasse, der Bevölkerungsmehrheit, einsetzte.“ (a.a.O. S. 4)
Den bürgerlichen Parlamentarismus kritisiert Marx zuweilen heftig, wenn auch nicht durchgängig. Dieser Parlamentarismus diene nur dazu, „das kapitalistische System zu verteidigen“ und „die wahren Herrschaftsverhältnisse zu verschleiern“. Genau dieses System sei jedoch durch die proletarische Revolution aufzuheben. Wie dies mit den Idealen der direkten Demokratie zu vereinbaren ist, versucht Marx am Beispiel der Pariser Commune von 1871 zu verdeutlichen. Hierzu schreibt A. Müller (a.a.O.):
„Die Pariser Kommune „war eine Wiederbelebung durch das Volk und des eigenen gesellschaftlichen Lebens. Sie war nicht eine Revolution, um die Staatsmacht von einer Fraktion der herrschenden Klassen an die andere zu übertragen, sondern eine Revolution, um diese abscheuliche Maschine der Klassenherrschaft selbst zu zerbrechen“ (MEW 17, S.541f). „Wenn sonach die Kommune die wahre Vertreterin aller gesunden Elemente der […] Gesellschaft war, und daher die wahrhaft nationale Regierung, so war sie gleichzeitig, als eine Arbeiterregierung, als der kühne Vorkämpfer der Befreiung der Arbeit, im vollen Sinn des Worts international“ (MEW 17, S.346).
Als direktdemokratische Staatsform war für Marx die Kommune „die politische Form
der sozialen Emanzipation, der Befreiung der Arbeit von der [...] Sklaverei der Mono-
polisten der Arbeitsmittel, die von den Arbeitern selbst geschaffen oder Gaben der
Natur sind. [...] Die Kommune beseitigt nicht den Klassenkampf, durch den die arbei-
tenden Klassen die Abschaffung aller Klassen […] erreichen wollen [...]. Sie vertritt
die Befreiung der Arbeit [...], sie schafft das rationelle Zwischenstadium, in welchem dieser Klassenkampf seine verschiednen Phasen auf rationellste und humanste Weise durchlaufen kann“ (MEW 17, S. 545f). Auf dem Weg des direktdemokratischen Kampfes zeige die Kommune wie die Arbeiterklasse die staatliche Macht erobern und ausüben könne. Sie sei im Keim das Musterbeispiel für den proletarischen Staat, indem über die direkte Demokratie der „unterdrückende Charakter der Staatsmacht“ (MEW 17, S.336) aufgehoben und die Herrschaft der Minderheit durch die Herrschaft der Mehrheit ersetzt wird.“
Wobei allerdings zu beachten ist, dass Marx seine Meinung hierzu in späteren Jahren anscheinend in überraschender Weise geändert hat, wozu Klaus Hartmann (1970) bemerkt: „Marx hat … 1881 seine positive Einschätzung der Pariser Kommune drastisch revidiert: sie war ein Ausnahmefall, ohne daß die Bedingungen für den Erfolg – die ökonomische und nicht nur politische Situation – gegeben waren; die Mehrheit war keineswegs sozialistisch gewesen und konnte es nicht sein. Die Kommune entsprach ihrer Entstehung nach nicht der Theorie.“ [15] Weiteren Aufschluss hierüber vermittelt Astrid von Borche(1977), indem sie erklärt, Marx sei im Jahre 1881 sogar „zu einer Art reformistischer, gemäßigter Position“ gelangt, denn nun habe er der Pariser Commune vorgeworfen, seinerzeit die tatsächlichen Machtverhältnisse falsch eingeschätzt zu haben, denn „mit geringem Quantum common sense hätte sie … einen der ganzen Volksmasse nützlichen Kompromiß mit Versailles – das allein damals Erreichbare – erreichen können“ (a.a.O. S. 487); was natürlich auch Marxens Einschätzung einer Diktatur des Proletariats (DdP) durch die Pariser Commune in anderem Licht erscheinen lässt.
Wobei nicht zu bezweifeln ist, dass es sich bei der Pariser Kommune nicht um eine DdP im Sinne einer „Diktatur von oben“ handelte, sondern um eine Rätedemokratie mit Allgemeinem Stimmrecht. Und dies entspricht exakt dem, was Marx und Engels andernorts mehrfach über die Möglichkeit eines friedlichen Übergangs zum Kommunismus erklärt haben, so z.B. Marx: „In England zum Beispiel steht der Arbeiterklasse der Weg offen, wie sie ihre politische Macht entwickeln will. Ein Aufstand wäre dort eine Dummheit, wo man durch friedliche Agitation rascher und sicherer den Zweck erreicht.“ [16] Und bei Engels, wenn auch in seiner Spätzeit, heißt es: „Man kann sich vorstellen, die alte Gesellschaft könne friedlich in die neue hineinwachsen in Ländern, wo die Volksvertretung alle Macht in sich konzentriert, wo man verfassungsmäßig tun kann, was man will, sobald man die Majorität des Volkes hinter sich hat: in demokratischen Republiken wie Frankreich und Amerika, in Monarchien wie in England, … wo diese Dynastie gegen den Volkswillen ohnmächtig ist.“ [17] – Dies ist unbedingt zu berücksichtigen, wenn man den Ansichten von Marx und Engels über die ‚Diktatur des Proletariats‘ gerecht werden will.[18]
Kritische Würdigung des Marxschen Konzeptes
Marx will anscheinend nicht wahrhaben, dass die Verfassung von 1793 nie (!) in Kraft gesetzt worden ist, seine Kritik an deren Art. 16 („nach Belieben“, s.o.) insofern ins Leere läuft.
Außerdem: Wie vor ihnen Locke und Rousseau berufen sich die Revolutionäre der Aufklä-rungszeit auf die naturrechtliche – und durch die moderne Gen-Forschung weitgehend bestätigte – Voraussetzung, dass alle Menschen vom Ursprung her freiund gleich sind. Den eigentlichen Widerspruch des Mensch-Seins sehen sie daher darin, dass alle Menschen frei und gleich geboren sind, aber „überall in Ketten“ liegen. Auch Rousseaus Gesellschafts-vertrag kann diesen Widerspruch nicht beseitigen, solange Freiheit und Gleichheit rechtlich nicht abgesichert sind.
Deshalb heißt es in Art. 1 der Erklärung … von 1789: „Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.“: ‚Die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es.‘ (Übersetzung und Hervorhebung durch mich.) Diese Behauptung geht in einen Rechtsanspruch über („gleich an Rechten“), so dass Freiheit und Gleichheit vor dem Gesetz nicht nur für den Menschen als „Gattungswesen“ (Marx), sondern auch für den Citoyen gelten. Diese Einheit wird in der Erklärung … an keiner Stelle aufgegeben; was Marx ebenfalls nicht wahrhaben will. Er verkennt, dass der Mensch – auch in den Verfassungen von 1791, 1793 und 1795 – nicht als bloßes Individuum, sondern als per se gesellschaftsbezogene Person gewürdigt wird. Schon in der Präambel wird nicht das Glück des Einzelnen, sondern aller („bonheur de tous“) als Ziel genannt.
Demgemäß sollen auch die sozialen Unterscheidungen stets an die „utilité commune“, den gemeinsamen Nutzen, gebunden sein (Art. 1). Zu einem Gemeinwillen könnte ein bloß egoistisches Individuum nichts beitragen (vgl. Art. 6). Wohl nicht zufällig erscheint die `Société‘, die Gesellschaft, in der Erklärung … mit großem Anfangsbuchstaben – ebenso wie ihre „Membres“, ihre Mitglieder (Art. 4). Daraus spricht das Bestreben um Harmonie, nicht die Ausgrenzung des Individuums von der Gesellschaft. – Insofern ist Marxens diesbezügliche Kritik hinfällig.
Was Marx dennoch, anscheinend im Anschluss an Babeuf, wohl richtig gesehen hat, ist die Tatsache, dass die Gründe für die soziale Ungleichheit in den Menschenrechtserklärungen nicht oder allenfalls andeutungsweise erklärt werden. Im 18. Jahrhundert wurde offenbar noch nicht erkannt, was Marx in seiner umfassenden Kapitalismus-Kritik („Das Kapital“ usw.) auf den Punkt gebracht hat: Nicht das Privateigentum als solches führt zur Ungleichheit, sondern dasjenige kapitalistische Privateigentum an den Produktionsmitteln, das zur Ausbeutung von Menschen dient und dadurch Entfremdung, Klassenkampf, Unterdrückung und Verelendung bewirkt (das „funktionierende Privateigentum an den Produktionsmitteln“). Diese Erkenntnis kommt allerdings in Marx‘ Kritik an den Menschenrechtserklärungen (1844) noch nicht zum Tragen.
Umso erstaunlicher ist die Tatsache, dass Marx die Menschenrechte durchaus als Errungen-schaft der Aufklärungszeit zu schätzen weiß. Er stellt nämlich fest, die Französische Revolution habe „Ideen hervorgetrieben, welche über die Ideen des ganzen alten Weltzustandes hinausführen“. Es seien Ideen, die, wenn auch auf Umwegen, in die Ideen des Sozialismus und Kommunismus eingeflossen seien. („Die Internationale erkämpft das Menschenrecht.“) Ernst Bloch merkt hierzu an: „Und der weiterlebende Fortschritt ist, daß genau das politisch-Citoyenhafte: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit in die ‚forces propres‘ der lebenden Menschen eintrete; dann erst, sagt Marx, >ist die menschliche Emanzipation vollbracht<“. („Forces propres“: die ‚eigenen Kräfte‘). Dann erst lebe der Mitmensch nicht mehr „als Schranke der Freiheit“, sondern „als deren Kommunität“. (E. Bloch: Naturrecht und menschliche Würde, 1961/1977, S. 206.) [19]
Weitere Verwirklichungen: Schweiz, USA u.a.
Die weltweit höchste Anzahl von Volksabstimmungen hat es anscheinend in der Schweiz gegeben. 1978 waren es dort „über 300 Referenden und Volksinitiativen, … gefolgt von Aus-tralien mit 39, Frankreich mit 20 und Dänemark mit 13“. [20] Im Jahre 1994 wurden insgesamt 799 Volksabstimmungen durchgeführt. Yolanda Steiger zieht (2006) daraus den Schluss, in ihrem „Schweizer Staat“ sei „die Volksherrschaft sehr gut ausgebaut“. (Eine Aussage, die allerdings mit einem Fragezeichen zu versehen ist. Herrscht in der Schweiz wirklich das Volk oder, wie auch sonst anscheinend überall auf der Welt, das Kapital?)
In der Tat räumt Y. Steiger ein, dass das Geld auch in Direkter Demokratie weiterhin eine herausragende Rolle spielt, nicht zuletzt bei der Finanzierung von Kampagnen, Medien-Prä-senz und -Propaganda, Unterschriften-Sammlungen usw. Dies beeinflusst in hohem Maße die Entscheidungsprozesse bei Volksabstimmungen. Sowohl in der Schweiz als auch in den USA kommt es vor, dass eine Seite über „fünf bis zwanzigmal“ mehr Finanzquellen verfügt als die andere (ebd.).
Umstritten ist dennoch die Frage, ob in Direkter Demokratie (bzw. in einer „Abstimmungs-demokratie“) ungleiche bzw. verfälschte Partizipation herrscht. (Vgl. Linder 1999, S. 339.) Dagegen steht die Behauptung von Cronin , es gebe durch DD eine „gestärkte Sensibilisierung der Behörden hinsichtlich der Präferenzen der Stimmbürgerschaft“ (in: Steiger a.a.O.). An-dererseits hat aber die Einrichtung von Plebisziten weder in der Schweiz noch in den USA zu einer „absoluten Volksgesetzgebung“ geführt, während die unteren sozialen Schichten bei der Partizipation weiterhin benachteiligt werden. Zugleich hat anscheinend „der Einfluss organi-
sierter Gruppen zugenommen und nicht etwa der Einfluss des Volkes“ (Steiger a.a.O. S. 33). In den USA zeigte sich, dass viele Stimmbürger zu wenig informiert sind und deshalb häufig gar nicht an den Abstimmungen teilnehmen.
Und in der Schweiz wird an einem anderen Phänomen deutlich, wie gering dort der Wirkungsgrad direkter Demokratie tatsächlich ist. In der schweizerischen Gesetzgebung beruhen nur 7 von 100 Gesetzen auf einer vorherigen Volksabstimmung. Was der Bundesrat Berset in einem Interview reichlich süffisant kommentiert mit der Bemerkung, „die Schweiz sei ja nur eine „halbdirekte Demokratie“ mit bestens funktionierendem Parlament“. [21] Andreas Urs Sommer präzisiert dies, indem er den Politikwissenschaftler Wolf Linder(s.o.) zitiert, der eingeworfen habe:
„Ein Blick in die Statistik zeigt, dass [in der Schweiz] 93 von 100 Bundesgesetzen ohne Volksabstimmung in Kraft treten. Nur sieben Prozent aller Gesetze werden also durch das fakultative Referendum herausgefordert. Direkte Demokratie ist also tat-sächlich kein Ersatz, sondern eine Ergänzung parlamentarischer Demokratie.“ [22]
Dagegen wendet A. U. Sommer ein, DD sei keineswegs eine bloße „Ergänzung“, sondern „die Basis, das unerschütterliche Fundament“ der Demokratie; was er wie folgt begründet:
„ … das Charakteristikum einer direkt-partizipatorischen Demokratie ist nicht, dass faktisch alles zum Entscheidungsgegenstand aller wird, sondern, dass prinzipiell alles zu einem solchen Entscheidungsgegenstand gemacht werden kann, wenn eine ent-sprechende Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern das will.“ (a.a.O. S. 189)
(Was allerdings bedeutet, dass das repräsentierende Parlament nicht vollständig durch DD ersetzt werden könnte. Wie anders als parlamentarisch sollten denn diejenigen gesetzgebe-rischen Entscheidungen getroffen werden, für die keine „direkt-partizipatorische“ Grundlage, z.B. in Form eines Referendums, vorliegt?)
Und wie sieht es mit der DD in der Bundesrepublik Deutschland aus?
Hierzu zitiert A. U. Sommer zunächst den Artikel 20 (2) des bundesdeutschen Grundgesetzes:
„Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.“
Womit klar ist, dass die oberste Staatsmacht durch „Wahlen und Abstimmungen“ , also durch das Volk selbst – und erst danach durch Legislative, Exekutive und Judikative – ausgeübt werden soll. Sommer bemerkt hierzu:
„Die Verfassung der Bundesrepublik macht mit Artikel 20 (2) große Versprechen im Ausblick auf eine direkt-partizipatorische Demokratie. Allerdings sind diese Verspre-chen weder in der juristischen noch in der politischen Realität bislang eingelöst worden. Neben der Wahl von Repräsentanten sieht das Grundgesetz sehr wohl Ab-stimmungen vor, in denen wir alle Sachentscheidungen treffen können. >Wie Art. 20 GG zeigt, kennt unsere Verfassung also durchaus beide Formen. Sie gestaltet aber nur die repräsentative Demokratie in weiteren Normen näher aus und weist keinen einzi-gen Anwendungsfall für direkte Demokratie im Sine von Volksgesetzgebung auf.<“ (Horst Dreier 2018, in: Sommer a.a.O. S. 192 bzw. 262)
Darüber hinaus stellt Sommer fest, dass durch den Art. 20 (2) keinerlei „Stimmzwang“ festge-schrieben wird. Den Bürgerinnen und Bürgern steht es frei, an der politischen Machtausübung direkt teilzuhaben. Theoretisch könnte es auch in der BRD eine Volksgesetzgebung geben, was aber faktisch nicht der Fall ist. Demgegenüber fällt die relativ geringe Zahl von Bürger-Befragungen und -Initiativen kaum ins Gewicht.
Kein Wunder ist es daher, dass Joseph Beuys schon 1971 mit zwei Künstler-Kollegen die ‚Organisation für Direkte Demokratie durch Volksabstimmung‘ gegründet hat. Hierzu heißt es in einem Eintrag bei Wikipedia23:
„Die *Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung* war eine von den Künstlern Joseph Beuys, Johannes Stüttgen und Karl Fastabend am 19. Juni 1971 in Düsseldorf gegründete politische Organisation. Die anthroposophisch beeinflussten Konzepte des erweiterten Kunstbegriffs und der Sozialen Plastik sollten auch in der Politik umgesetzt werden, um dadurch gesellschaftliche Entwicklungen zu verändern.“
Hierzu Joseph Beuys selbst:
„Ich sage, in dem Augenblick, wo die Mehrheit erkannt hat, wo ihre Interessen liegen und wie sie ihre Interessen durchsetzen kann – einfach über das Prinzip der Volks-abstimmung – und indem sie sich in dem Sinne organisiert, in dem Augenblick werden sich die Verhältnisse ändern.“ / Joseph Beuys, 3.3.1972, Interview Zeitschrift pardon.
In dem Wikipedia-Artikel heißt es weiter:
„In ihrem „Politischen Programm“ beruft sich die „Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung“ auf das Grundgesetz. „Echte Wesensmerkmale der Demokratie“ seien nach diesem Programm:
Die Willensbildung in der Politik von unten nach oben,
1. die unabdingbare Volkssouveränität auf allen Verwaltungsebenen,
2. das Volk als sein eigener Verfassungsgeber,
3. Frauen und Männer ohne Parteibuch gleichberechtigt mit Parteibuchinhabern in den gesetzgebenden Körperschaften,
4. keinerlei Privilegien für einzelne Volksvertreter und Amtspersonen,
5. Volksveto in Einzelfällen (z. B. wo keine Gleichbehandlung aller Menschen gesichert ist),
6. Respektierung des Wählerwillens seitens der Gewählten,
7. Volksabstimmung in wichtigen Angelegenheiten und Grundrechtsfragen,
8. Abwahlmöglichkeit von unwürdigen oder unfähigen Volksvertretern und Amts-personen.
Die Organisation sollte daher in speziellen Arbeitskreisen diesbezügliche Möglich-keiten erforschen und ihre Mitglieder und unzureichend informierten Bevölke-rungsschichten darüber unterrichten.
Frauen und Männer sollten in den Stand versetzt werden, das Grundgesetz und die Landesverfassungen zu verwirklichen oder zu ihrem Teil dazu beizutragen. Insbesondere wollte die Organisation ihr Augenmerk dabei auf die Gleichberechtigung der Interessen derjenigen Bevölkerungsschichten richten, die zu den Benachteiligten des politischen Systems gehören.
Insofern verfolgt die „Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung“ als freie Volksinitiative in Wahrnehmung der Interessen ihrer Mitglieder und zahlloser weiterer Mitmenschen in Deutschland einen gemeinnützigen Zweck.
„/Volksherrschaft heißt in meinen Augen ...: Alle Menschen schaffen sich ihre Verfassung, wählen, nachdem sie die Verfassung gemacht haben, ihre Räteverwaltung oder ihre treuhänderische Verwaltung (...) und alle Lebensgebiete werden entflochten. Das heißt: Es kommt mehr und mehr in die freie Selbstverwaltung sowohl das gesamte Schulwesen als auch die Wirtschaft, so daß der Staat die reine Rechtsverwaltung darstellt ... Volksveto und Abwahl muß jeden Tag möglich sein. ./“ – Joseph Beuys …
Beginnend auf der Volksebene wollte sie sich durch die vom Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland garantierte unzensierte, freie Information im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten auch an politischen Wahlen beteiligen, damit beginnend auf der unteren Verwaltungsebene wie der Gemeindewahlen, auch Frauen und Männer in die gesetzgebenden Gremien kommen, die kein Parteibuch in der Tasche haben.
Offensichtlich strebte Beuys‘ Organisation keine Direkte Demokratie in der Reinform der Volksgesetzgebung an, sondern eine Mischung aus DD und herkömmlicher repräsentativer Demokratie. – Aber auch dieses Ziel hat die Organisation offenbar bisher nicht erreicht.
Umso bemerkenswerter ist das DD-Konzept des Freiburger Philosophen A. U. Sommer:
DD als Zukunftsvision. Das Konzept von A.U. Sommer
Sommer begründet sein Konzept anthropologisch. Menschen sind gesellige Wesen, sie wollen teilnehmen und teilhaben. Was selbstverständlich auch für den Bereich der Politik gilt, wo es aber nicht ohne stete Einübung gelingt, die Sommer auch als „unausgesetztes Teilnahmetrai-ning“ bezeichnet. Anthropologisch begründet der Autor dies folgendermaßen:
„Nimmt man den Menschen als höchst wandelbares, höchst formbares Wesen, dann womöglich auch als das listigste aller Tiere – aber ebenso als dasjenige, das sich am leichtesten von allerlei Listen übertölpeln lässt. Und das man deswegen, gelegentlich auch mit List und Tücke, zu einem direktdemokratisch-partizipatorischen Wesen kon-ditionieren sollte. Gerade weil wir nicht von Natur empathisch sind, gute Menschen, freundlich zu allen anderen, sollten wir direkt-demokratisch partizipieren. Denn da sind wir gezwungen, uns bei jeder Entscheidung auch in die gegenteilige Position hin-einzudenken. Direkt-partizipatorische Demokratie erzieht zu Anteilnahme, neu-deutsch-bombastisch zu Empathie.“ (Sommer a.a.O. S. 135 f.)
Demnach müssten wir Menschen durch DD zur Empathie erzogen werden; was ich für unzutreffend halte. Eine unmittelbar konträre Erkenntnis äußert Ernst Habermann (1996):
„Die Evolution hat zwei feine Sensoren der Solidarität erfunden, nämlich Gewissen und Mitleid, und mit der Befindlichkeit gekoppelt.Die biologisch vorgegebene, spätestens beim Menschenaffen … gesicherte Einfühlung ist eine wichtige Grundlage unseres Ethos.“ 24
Zur Natur des Menschen gehört also von Anfang an beides: die Fähigkeit zum Guten ebenso wie die zum Bösen. Den Kampf zwischen Gut und Böse hat jede Einzelperson für und in sich auszutragen, wofür Empathie hilfreich ist, aber allein nicht ausreicht. Positive, konstruktive Gesinnung und entsprechendes Handeln werden nicht erst durch DD ermöglicht, sondern durch eine fundierte ethische Orientierung. 25
Und nur unter diesem Vorbehalt kann ich A. U. Sommers Anspruch auf DD nachvollziehen, den er wie folgt zusammenfasst:
„Faktisch schwimmt jede und jeder von uns in einem Meer von Möglichkeiten. Aber wir sind ihnen oft nicht gewachsen, weil wir nicht einüben, sie auch zu nutzen. Daher brauchen wir unausgesetztes Teilnahmetraining. Wir müssen uns erziehen, Möglich-keiten zu ergreifen. Genau dazu nötigt uns direkt-partizipatorische Demokratie. Die in ihr angelegten Selbstzweifel rufen Selbstvergewisserungsprozesse auf den Plan. Die direkt-partizipatorische Demokratie ist eine Selbstbefragungs- und Selbstvergewis-serungsdemokratie . … Man muss immer wieder herausfinden, wofür man stehen will. Und wofür das Ganze steht. Wir müssen uns den direkt teilhabenden Demokraten, die direkt teilhabende Demokratin als einen glücklichen Menschen vorstellen.“ (a.a.O. S. 215)
Dieser kurze Aufriss enthält bereits einige Grundbegriffe von Sommers Konzept, und zwar:
1. die „direkt-partizipatorische Demokratie“,
2. die Selbstzweifel,
3. die „Selbstbefragungs- und Selbstvergewisserungsdemokratie“,
4. das „Meer von Möglichkeiten“.
Zu 1. Die auf dem natürlichen Bedürfnis zur Teilnahme und Teilhabe beruhende DD erläutert Sommer folgendermaßen:
„Die lateinische potentia bedeutet sowohl Möglichkeit als auch Macht. … Die potentia des aufgeklärten Menschen ist im parlamentarischen Repräsentativismus noch immer bemaulkorbt. …
Warum also direkte Demokratie, direkte Partizipation? Weil sie immer wieder den Möglichkeitssinn anstachelt oder die utopisch-politische Imaginationsbereitschaft. Die Möglichkeit direkter Partizipation ist nicht nur ein Gebot der Ermündigung, sondern auch ein Gebot der Horizonterweiterung, genauer: der Denkhorizonterweiterung,der Imaginationshorizonterweiterung und der Handlungshorizonterweiterung.“ (a.a.O. S. 108)
Gestärkt werden sollen also vor allem die „Horizonterweiterung“ der Menschen in Denken, Vorstellungskraft, Handlungsfähigkeit und Bereitschaft zur „Ermündigung“, somit zur per-sonalen Souveränität. Ein überaus ehrgeiziges Programm! (Das natürlich nicht nur der DD anheimgestellt sein kann!) Notwendig ist die DD laut Sommer nicht zuletzt auch deshalb, weil Parteien und Medien immer wieder in (teils existenzielle) Krisen geraten:
„Die Parteien … werden der Individualität des Jetztzeitmenschen nicht mehr gerecht und sie verhindern oft den Zugang zur Partizipation eher, als dass sie ihn ermöglichen. Also wird auch da die Selbstermündigung der Jetztzeitmenschen Raum greifen müssen – mit einer direkt-partizipatorischen Demokratie, die der Krücken traditioneller Parteien und traditioneller Massenmedien nicht mehr bedarf.“ (Sommer a.a.O. S. 110)
Hinzu kommt die Tatsache, dass es in der repräsentativen Demokratie „Gesetzgebungs-zwänge“ gibt, die u.a. als Legitimation der „Existenz von Berufspolitikern“ dienen, so dass die Illusion erzeugt wird, dass ständig neue Gesetze produziert werden müssten (vgl. a.a.O. S. 112). Genau dies aber, schreibt Sommer, werde durch DD verhindert, in der
„Nur was wirklich der abstimmenden Mehrheit aller Bürgerinnen und Bürger als rege-lungsbedürftig, gesetzwürdig erscheint, wird zum Gesetz.“ (a.a.O. S. 113)
Zu 2. Selbstzweifel. Sommer hält sie für ambivalent, doppelgesichtig. Einerseits „verzärteln“ sie uns, untergraben unseren Selbstbehauptungs- und Gestaltungswillen. Andererseits wirken Selbstzweifel befreiend, „indem sie den Überhang des angeblich zeitlos Wahren und Gültigen abräumen, indem sie uns Luft zum Atmen schenken, Raum zum Gliederstrecken“ (S. 213). Woraus Sommer schließt, dass Selbstzweifel für die DD unentbehrlich seien (S. 213 f.).
Zu 3. Selbstbefragung und -vergewisserung. Um dem Grundsatz „Wir sollen, weil wir können“ gerecht zu werden, müssen wir immer wieder neu herausfinden, worin unsere wirk-lichen Bedürfnisse bestehen und wofür wir einstehen wollen.
Zu 4. Möglichkeiten der Teilhabe stehen allen offen, aber niemand wird gezwungen, sie zu er-greifen. Im Übrigen sieht Sommer „Machtlagen“ im Spannungsverhältnis von „Möglichkeiten und Verwirklichungsoptionen“, das im bestehenden Parlamentarismus in eine Schieflage ge-raten ist; hierzu erneut:
„Die lateinische potentia bedeutet sowohl Möglichkeit als auch Macht. … Die potentia des aufgeklärten Menschen ist im parlamentarischen Repräsentativismus noch immer bemaulkorbt.“ (S. 108)
Dagegen stellt Sommer eine Vielzahl von Möglichkeiten politischen Engagements durch DD:
„Jenseits des Kardinalverfahrens politischer Partizipation, nämlich der Abstimmung über Sachfragen, gibt es naturgemäß eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich ins Gemeinsame einzubringen. Über Bürgerräte und Losverfahren wird noch zu sprechen sein; auf der Hand liegt es außerdem, sich durch Demonstrationen in der realen Welt und durch Meinungskundgabe in der virtuellen Welt, in Blogs, Kommentaren, Artikeln und Büchern vernehmen zu lassen, ebenso durch politisch orientierten Konsum (z.B. nichts aus Massentierhaltung oder nichts von der russisch besetzten Krim).“ (S. 173)
Es liege förmlich in der Idee der DD,
„ … den Möglichkeitsradius möglichst aller möglichst weit zu stecken. Sie will keine Tyrannei der Mehrheit etablieren, sondern dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen möglichst viele Möglichkeiten haben, und zwar nicht nur die jetzt, sondern auch die künftig lebenden Menschen.“ (S. 215)
Darüber hinaus bietet Sommer einen Ausblick auf die DD als Zukunftsvision bis zum Jahr 2072 – also für ein halbes Jahrhundert nach dem Erscheinen seines Buches zur DD. Die Stationen dieser Vision sind:
2027. „Eine erste auch jenseits des virtuellen Raums für alle sichtbare Veränderung der poli-tischen Landschaft erfolgte 2027 durch die Einführung des Volkseinwands in Sachsen und in Thüringen. Kamen genügend Unterschriften zusammen, konnten die Bürger so ein vom Land-tag beschlossenes Gesetz in Frage stellen und mit einer Mehrheit der Stimmen an der Urne kiuppen.“ (S. 224) Was allerdings auch Probleme verursachte, weil immer wieder versucht wurde, Gesetze zu torpedieren, was jedoch an fehlender Mehrheit scheiterte. Wohingegen in kleineren Gemeinden bessere Erfolge erzielt wurden dadurch, dass Bürgerinnen und Bürger immer wieder ihre Rechte einforderten.
2036. Initiativrechte für alle in mehreren Bundesländern. Schrumpfung des Bundestags auf 350 Abgeordnete.
2038. Referendums- und Initiativrecht auf Bundesebene. (S. 225)
2039. „Verstaatlichung der wichtigsten digitalen Meinungsbildungs- und Entscheidungsfin-dungsplattformen.“ (S. 226)
2042. Die UNO ruft das „Jahr der globalen Demokratisierung“ aus (S. 226). Art. 21 (1) der UNO-Menschenrechtserklärung lautet nunmehr:
„Jeder Mensch hat das Recht und die moralische Pflicht, an der Gestaltung der öffent-lichen Angelegenheiten des eigenen Landes und der Welt insgesamt unmittelbar und ohne Rückgriff auf gewählte Vertreter mitzuwirken.“ (S. 227)
2048. Ende der KP-Herrschaft in China:
„Ein von taoistischer Gelassenheit und konfuzianischer Disziplin geleiteter, friedlicher Übergang zu demokratischer Zivilität gelang ziemlich geräuschlos. Das lag vor allem daran, dass sich die Chinesen die alteidgenössische Institution der Landsgemeinde zu eigen machten und fortan alle politischen Entscheidungen in öffentlicher Voll-versammlung mit öffentlicher Abstimmung unter dem wachsamen Auge aller vollzogen wurden und werden.“ (S. 227)
2072. „Heute, im Jahr 2072, stellt sich die Weltlage insgesamt doch recht
erfreulich dar.
Zwar wurde das klimatische Zwei-Grad-Ziel zunächst dramatisch verfehlt,
seit einigen
Jahren sinkt jedoch die globale Temperatur kontinuierlich, und das Meer
gibt wieder
Landmassen frei, die für die Menschheit, die sich auch unter den neuen
Bedingungen
einzurichten verstand, auf immer verloren schienen. Auch die politische
Betriebstem-
peratur hat sich nach der sehr erhitzten Anfangsphase
direkt-partizipatorischer Demo-
kratie merklich abgekühlt …
Im Jahr 2072 leben immerhin 73,8 Prozent der Weltbevölkerung in Staaten, in
denen
sie das Recht auf direkte politische Partizipation allseits ungehindert in
Initiativen und
Referenden ausüben können. Sorgenkind bleiben die USA, die mit einer
schreckener-
regenden Beharrlichkeit an ihrem Steinzeit-Repräsentativismus und ihrer
manisch-eu-
phorischen Zweiparteien-Bipolarität festhalten. Es hat sich doch längst
erwiesen, dass
Parteien im politischen Leben keine bestimmende, sondern bestenfalls eine
beratende
Rolle spielen sollten und sie wie die längst verblichenen Kirchen (das
waren einst kol-
lektive Heilsbedürfnisanstalten, bevor man entdeckt hat, dass jeder und
jede für das
eigene Glück verantwortlich ist) ein zivilisationsgeschichtliches
Auslaufmodell sind.“
(S. 228 f.)
Ob damit die mit dem (möglichen) Übergang zur DD verbundenen Probleme als zufrieden-stellend lösbar erscheinen, muss vorerst dahingestellt bleiben. Nachzutrage sind Sommers Auffassungen hinsichtlich der „Elektronischen Demokratie“ und der Künstlichen Intelligenz.
Elektronische Demokratie
Sommer versteht darunter die Tatsache, dass das Internet für Abstimmungen, dabei auch für Stimmendelegation und -gewichtung, genutzt werden kann. Voraussetzung hierfür ist aller-dings, dass das Internet vor Missbrauch, z.B. durch kommerzielle Interessen, geschützt wird. Es muss stets eine „öffentliche, freie Domäne“ sein (S. 195). Sommer legt daher Wert darauf, aufzuzeigen, wo im Internet ein „digitales Demokratiegefährdungspotenzial“ entsteht, nämlich durch „das Wegfallen von Vermittlungsinstanzen, die Gefährdung von Minderheiten, die Gefährdung aktiver Partizipation, die Meinungsverklumpung und die Schnelligkeit“ (S. 196). Aktive Partizipation wird vor allem durch „Mobbing und Shitstorm“ gefährdet. Wer im Internet gemobbt wird, zieht sich nicht selten völlig zurück. – Meinungsverklumpung: Ehe das Internet zum „Wegklick- und Wegwischmedium“ verkommt, muss für Netzöffentlichkeit und Meinungsvielfalt gesorgt werden. – Schnelligkeit: ein Markenzeichen des Internets! Dagegen wird es darauf ankommen, die für jegliche demokratische Partizipation erforderliche „Entschleunigung zwecks Reflexion und Deliberation“ sicherzustellen. Trotz solcher Pro-bleme und Gefahren fällt Sommers Fazit relativ optimistisch aus:
„Die Digitalisierung ließe sich also durchaus klug und fruchtbringend in einer direkt-partizipatorischen Demokratie nutzbar machen. Sie kann die Schwellen des Teilhabens senken und den Pegel der Erörterung heben. Selbst wenn sie Arbeitsplätze abschaffen sollte, bekämen wir als von mühsamer Arbeit entlastete Individuen mehr Zeit, uns po-litisch zu betätigen. Digitalisierung bietet eine eminente Politisierungschance. Auch dadurch, dass alle immerzu überall digital mitreden können.
Allerdings ist der Digitalisierung der Demokratie auch ein wesentlicher Sicher-heitsschalter einzubauen: Auch nichtdigitalisierte Bürger müssen ihre Mitsprache- und Mitentscheidungsmöglichkeiten ungeschmälert behalten. Dem Recht auf digitale Teil-habe ist gleichberechtigt ein Recht auf digitale Abstinenz zur Seite zu stellen.“ (S. 199 f.)
Ähnlich positiv äußert Sommer sich zur Künstlichen Intelligenz , wobei er deren negative Seiten keineswegs ignoriert. Ob allerdings seine Empfehlung, notfalls „Stecker ziehen“, ein probates Gegenmittel gegen die mögliche existenzielle Gefährdung der Menschheit durch die KI ist, wage ich zu bezweifeln. 26
Im Übrigen sieht Sommer ein Grundproblem darin, dass sehr unterschiedliche Meinungen darüber vorherrschen, wie KI genutzt werden kann und soll. Kann mehr Klarheit dadurch erreicht werden, dass der KI auch die Fähigkeiten zum Werten und Beurteilen übertragen werden? Wie weit kann der KI Autonomie eingeräumt werden? Würden wir ihr eines Tages vielleicht sogar das Denken überlassen, so dass wir zu ihren „Haustieren“ würden? (S. 102) Vorrangig wichtig sei vorerst die „Einübung“. Wir dürfen nicht zu bloßen Informations-empfängern herabsinken, sondern müssen unsere Fähigkeiten zu aktiver Teilhabe und Gestaltung trainieren. Sommer folgert:
„Digitalisierung zwingt zur direkt-partizipatorischen Demokratie, gerade weil „Leitmedien“ – mangels Existenz – nicht mehr festgefügte Weltbilder vorgeben. Wir müssen im „egalitären Geist des Cyberspace“ die fragmentierten Informationen zu neuen Ganzheiten gießen, zu Ganzheiten unserer eigenen partizipativen Tat. Das Verdunsten aller Eindeutigkeit ist ein gewaltiger Ansporn, es mit dem Welt(bild)-gestalten selbst zu versuchen.“ (S. 103)
Aber Sommers Optimismus, auch im Hinblick auf die DD, wird keineswegs allseits geteilt. Einige halten die Einführung der DD für ausgeschlossen, andere für nicht wünschenswert, wieder andere nur unter bestimmten weiteren Voraussetzungen für möglich. Hierüber mehr und Genaueres im Folgenden.
Warum Künstliche Intelligenz?
Angesichts der rasanten Entwicklung der KI und ihrer Anwendungen geschieht jegliche Aus-sage über sie zweifellos stets nur in einer Momentaufnahme; so auch das Resultat, zu dem ich im Jahr 2023 gelangt bin:
„Natürlich gibt es weltweit neben den besprochenen Gesetzes-Vorlagen der EU, der USA und Chinas weitere, ähnliche Projekte. Wahrscheinlich aber nicht mit höherer inhaltlicher Relevanz. An den drei Gesetzesvorlagen fällt auf, dass sie die Probleme der schwachen KI nur ansatzweise, die der starken kaum oder gar nicht behandeln. Weder der US-amerikanische Nietzsche-Kult und -Hype noch R. Kurzweils „Singularitäts“-Phantastereien noch die monströse „Symbiose“ von Mensch und Technik werden analysiert. Die Gefahr einer Selbstauslöschung der Menschheit durch KI wird ignoriert.
Gravierend kommt hinzu, dass bisher anscheinend in keinem einzigen Gesetzes-Vorhaben die Tatsache erwähnt wird, dass die KI-„Singularität“ das Ende aller Bemühungen um sinnvolle Alternativen zum Bestehenden, d.h. zum globalisierten Neo-Liberalismus, bedeuten würde. An die Stelle eines Reichs der Freiheit würde eine hochexplosive, nicht funktionstüchtige „Symbiose“ von Menschen und Robotern treten.
…
Um ein einheitliches, internationales KI-Recht zu entwickeln, müssen die Menschen-rechte gegenüber der KI geschützt werden. Möglichkeiten hierfür ergeben sich u.a. aus der europäischen Charta der Grundrechte (seit 2012). 27 Darin geht es um Grund-rechte, die sich in sechs Kategorien aufteilen lassen, und zwar in: Würde, Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Bürgerrechte und Justizielle Rechte.
1. In Bezug auf die Menschenwürde kann sich KI sowohl positiv als auch negativ auswirken. Positiv z.B. in der Gesundheitsfürsorge, negativ vor allem durch den Holocaust der „Singularität“. Da die Würde des Menschen unantastbar ist, kann sie nicht zu Gunsten von KI-Robotern aufgegeben werden.
2. Die Freiheit der Person, incl. Gedanken-, Meinungs-, Glaubens- und Pressefreiheit und der anderen Grundrechte – und wohl auch des Rechts auf Arbeit und Bildung –, wird schon durch die schwache KI massiv gefährdet (Diskriminierung etc., s.o.).
3. Gleichheit. Auch hier kann sich schon die schwache KI negativ auswirken. Wenn man, wie in den USA geschehen, fehlerhafte KI gegen Menschen afroamerikanischer Herkunft einsetzt, führt dies zu massivem Rechtsbruch.
4. Solidarität. Droht Arbeitslosigkeit durch KI, muss dem frühzeitig Einhalt geboten werden. Soziale Sicherheit, akzeptable Arbeitsbedingungen und Umweltschutz können durch KI vielleicht gefördert, aber nicht durch sie allein erreicht werden.
5. Bürgerrechte. Auch hier sind sowohl positive als auch negative Folgen des KI-Einsatzes zu erwarten. KI kann Verwaltungsvorgänge vereinfachen, aber auch durch Fehlinformationen z.B. Wahlen verfälschen.
6. Justizielle Rechte. „Die Charta besagt, dass jede/r das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf, das Recht auf ein faires Verfahren und das Recht auf Verteidigung hat (Artikel 47-50). In der Justiz verwendete KI könnte Bedenken in Bezug auf das Recht auf ein faires Verfahren hervorrufen (z.B. wenn derartige Systeme Verzerrungen enthalten).“ (a.a.O. S. 4)
Gesichtserkennungstechnologie darf angeblich unter bestimmten Auflagen zu Justizzwecken verwendet werden, keinesfalls jedoch wie in China zur generellen Überwachung der Bevölkerung. Gegen Letzteres müssen Schutzmaßnahmen getroffen werden, z.B. durch die Einbeziehung von Datenschutzbeauftragten.
Diese Grundrechte in einem verbindlichen internationalen KI-Abkommen zu verankern, scheint ausgeschlossen, solange Großmächte wie die USA und China darauf bedacht sind, eine politische und ökonomische Vormachtsstellung in der Welt zu behaupten oder neu zu erringen. – Oft scheint den Beteiligten nicht klar zu sein, was auf dem Spiel steht: das Schicksal der Menschheit, einschließlich eines möglichen Reichs der Freiheit, zu dem auch eine sinnvoll gehandhabte KI beitragen könnte. Dieses Reich ist eine Konkrete Utopie, die zu den edelsten Ambitionen und stärksten Hoffnungen der Menschheit gehört.“ 28
Solche Überlegungen werden überflüssig, falls sich herausstellt, dass es für die Überwachung der KI eine viel einfachere Lösung gibt, wie sie z.B. Peter Bezler (2022) vorgeschlagen hat:
„Die Nutzung der KI bedeutet keineswegs, dass wir dadurch auf die menschliche Führungsrolle verzichten und uns von Maschinen dominieren lassen. So wie der Mensch bei einem autonom fahrenden Auto das Ziel der Fahrt bestimmt, bleibt der Mensch auch beim Einsatz der KI im politischen Bereich die bestimmende Instanz, die vorgibt, welche Kriterien bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen sind.“ 29
Bezler begründet diese simple Lösung, die als teilweise naiv erscheinen mag, durch eine ausführliche Analyse der KI, in der es heißt:
„Als künstliche Intelligenz (KI) wird die Nachbildung menschlichen Denkens mit Hilfe maschineller Vorrichtungen bezeichnet. Intelligenz ist die kognitive bzw. geistige Fähigkeit, Probleme zu lösen. Der Begriff leitet sich vom lateinischen /intellegere/ ab, das /erkennen, einsehen, verstehen /bedeutet und wörtlich mit /zwischen etwas wählen/ zu übersetzen ist.“ (a.a.O., ebd.)
Dazu macht Bezler weitere Angaben, wobei er zunächst bestimmte Funktionen der KI beschreibt. Er sieht ein Problem darin, dass die herkömmlichen PC-Algorithmen nicht ausrei-chen, komplexe Sachverhalte, darunter auch emotionaler Art, darzustellen. Einen Ausweg bieten künstliche neuronale Netze , die biologischem Vorbild entsprechend entwickelt werden. Wie dieses arbeiten die neuen künstlichen Netze parallel – und nicht bloß sequentiell wie die herkömmlichen Modelle. Von der parallelen Verarbeitung wird erwartet, dass sie die Verar-beitungsgeschwindigkeit beträchtlich erhöht. Um dies zu erreichen, werden im Rahmen dieser Verarbeitung neuartige Verfahren assoziativer Speicherung entwickelt. Ähnlich wie das menschliche Gehirn berücksichtigen diese nicht nur die Informationen selbst, sondern auch deren Assoziationen bzw. assoziativen Bedeutungen.
Im Detail geht Bezler auch auf (verborgene) Zwischenschichten („hidden layers“) künstlicher neuronaler Netze ein. In diesen Schichten werden – autonom – gänzlich neue Informations-Kombinationen gebildet, wobei ausschlaggebend die „Gewichtung“ der Netze ist. Dazu benö-tigen diese nicht mehr die herkömmlichen Algorithmen, sondern Trainingsphasen, wie z.B. beim Schachcomputer. Dabei entsteht durch die „quantitative Qualifizierung erfolgreicher Züge … völlig autonom und selbständig ein Netzwerk von Wahrscheinlichkeiten, durch das auch verborgene Muster erkennbar werden, die wegen ihrer großen Anzahl der Einzel-elemente vom menschlichen Intellekt nicht erfasst und – mangels Kenntnis ihrer Existenz – auch nicht durch Algorithmen beschrieben werden können. Mit Hilfe der neuronalen Netze lassen sich somit auch Aufgaben lösen, für die es keine Algorithmen gibt“. (a.a.O. S. 7 f.) –
Kompliziert wird die Sachlage dadurch, dass es für viele „Lebenssachverhalte“ keine eindeu-tigen Zuordnungsmöglichkeiten gibt; so dass in KI-Systemen teilweise auch auf herkömm-liche Algorithmen zurückgegriffen werden muss. Insgesamt scheint nichtsdestoweniger für die Weiterentwicklung von KI-Netzen ein „nahezu unlimitiertes Potenzial“ vorhanden zu sein (S. 8). In Zukunft wird man wohl nicht bloß elektronisch, sondern u.a. mit „Licht und Quanten“ arbeiten. Fortschritte erhofft man sich auch dadurch, dass man Sprach-Material „den bekannten Regeln der Mathematik, Physik, Kausalität und Logik unterzieht“ (S. 9). Was zu „hochqualifizierter Expertise“ beitragen soll.
Desweiteren setzt Bezler sich auch mit Einwänden gegen die KI auseinander, so z.B.:
Ein KI-System könne nichts erfinden, wohingegen Menschen u.a. auf Grund ihrer Erlebnis-Fähigkeit und ihres Gedächtnisses immer wieder völlig neue Einsichten gewinnen könnten. Dazu Bezler: Dieser Einwand verkennt, dass nicht nur Maschinen, sondern auch das mensch-liche Gehirn auf physikalischer und biochemischer Basis arbeiten. Alle Leistungen des Gehirns können (angeblich) künstlich nachgebildet werden, auch wenn dies gegenwärtig nur auf Teilgebieten der Fall ist. KI könne Bereiche erforschen, die dem Menschen bisher nicht zugänglich waren. Menschen sind fehlbar, weil sie zuweilen bereits gewonnene Erkenntnisse missachten, was bei KI niemals geschehen könne. Gerade für die Politik sei dies von eminen-ter Bedeutung.
Zu den Risiken der KI
Bezler:
„Die Etablierung der KI stößt oft auf die Befürchtung, dass es nicht möglich sei, eine künstliche Intelligenz zu entwickeln, die zwar zu selbständigem Denken und zur Fortentwicklung des bisherigen Erkenntnishorizontes fähig ist, dabei aber den Fortbestand und das Wohlergehen der Spezies Mensch zum obersten Ziel hat. Tatsächlich ist KI bereits in vielen Bereichen vorzufinden und in den Spezial-bereichen, in denen sie eingesetzt wird, dem Menschen weit überlegen. Diese Über-legenheit wird sich mit Sicherheit auf fast alle Bereiche ausdehnen. Trotz dieser Tatsache ist der Primat des Menschen auch in Zukunft nicht gefährdet.“ (S. 11)
Was Bezler wie folgt begründet: KI tritt dem Menschen nicht massiv als Ganze gegenüber, sondern schrittweise auf unterschiedlichen Anwendungsgebieten. Diese könne der Mensch je-derzeit kontrollieren und so verhindern, „dass eine KI-Einheit vollumfängliche Fähigkeiten erlangt, die sie in die Lage versetzten könnten, eine Art Bewusstsein zu entwickeln und eigene Ziele zu verfolgen“ (ebd.).
Eine weitere künftige Möglichkeit bestehe darin, dass der Mensch eines – bisher noch sehr fernen – Tages in der Lage sein werde, „sich mittels zerebraler Implantate die Fähigkeiten der KI selbst zu eigen zu machen“(S. 11 f.).
Die KI sei kein Gegenspieler des Menschen, weil sie ihre sämtlichen Fähigkeiten der Pro-grammierung durch Menschen verdanke. Da KI keine eigenen Interessen besitzt, könne sie diese auch in Zukunft nicht entwickeln. Es müsse nur dafür gesorgt werden, dass die KI nicht über ihre eigentlichen Zweckbestimmungen hinaus ausufert.
Peter Bezler: „Echte Demokratie durch KI“ (2022)
Um seine neue Synthese von Demokratie und KI zu begründen, beginnt Bezler mit einer Ana-lyse der Regierungstätigkeit im herkömmlichen parlamentarischen System. Allgemein sieht er in dieser Tätigkeit „die wohl komplexeste und umfangreichste Tätigkeit dieser Art“. Denn sie habe „nicht nur das gesellschaftliche Leben in unserem Land zu regeln, sondern auch das Verhältnis zu unseren Nachbarländern so zu gestalten, dass der Frieden erhalten bleibt“ (a.a.O. S. 2). Im Zeitalter der Globalisierung erweise sich diese Aufgabe als besonders schwierig, weil die „durch Verflechtungen und Abhängigkeiten zu berücksichtigenden Faktoren so zahlreich“ seien, „dass sie vom menschlichen Intellekt nicht mehr in Gänze erfasst werden können“ (ebd.). (Was Bezler leider nicht näher erläutert.) Immerhin erklärt er:
„Die bisher praktizierte Methode, diese komplexe Aufgabe im Wege der Arbeits-teilung auf verschiedene Ministerien aufzuteilen, führt zu der weiteren Komplikation, dass deren einzelne Arbeitsergebnisse nachträglich zu einem widerspruchsfreien und funktionsfähigen Ganzen zu vereinen sind.“ (ebd.)
Hinzu kommt die als höchst problematisch empfundene Herrschaft der Parteien , gegen die Bezler den Einsatz einer „Regierungs-KI“ empfiehlt, deren Folge sei:
„Insbesondere wird der unheilvolle Einfluss sachfremder Parteiideologien eliminiert, der in einer parteienbasierten Demokratie unvermeidlich ist. Im Gegensatz zu dieser ist es einer KI auch möglich, ein nachhaltiges Regierungskonzept zu entwickeln, das über die kurzzeitigen Regierungszyklen hinaus Bestand hat und politische Zick-zackkurse wechselnder Regierungskoalitionen verhindert.“ (ebd.)
Ein weiterer Faktor, der stets auch für die Forderung nach DD ausschlaggebend war, sei die unzureichende Mitwirkung der Bürger im Parteien-Staat:
„In unserem Land beschränkt sich die politische Mitwirkung des Bürgers darauf, alle vier Jahre eine der zur Wahl stehenden Parteien auszuwählen. Die Mitbestimmung bezieht sich also nicht auf konkrete politische Aktionen. Vielmehr entscheidet der Bürger lediglich darüber, von welcher Partei die Regierung gestellt wird. Bei dieser Entscheidung kann er sich lediglich daran orientieren, welche Werte eine Partei ver-tritt. Dabei besteht auch beim Wahlsieg einer Partei keine Gewähr dafür, dass eine aus mehreren Parteien gestellte Regierungskoalition das vom Wähler favorisierte Partei-programm auch realisieren wird.“ (a.a.O. S. 2 f.)
Ein noch größeres Problem sieht Bezler darin, dass die Wahl einer bestimmten Partei oft uner-wünschte Folgen nach sich zieht, weil diese Partei auch Werte und Ziele hat, die der Wähler ablehnt. Ein Beispiel:
„So fördert ein Wähler, der beispielsweise für eine saubere Umwelt votieren möchte, mit seiner Wahl auch andere von der favorisierten Partei vertretene Ziele und bewirkt damit ungewollt die Etablierung der Gendersprache und die Freigabe von Marihuana. Wählt er hingegen eine Partei, die für die Einhaltung der Schuldenbremse und eine stabile Währung eintritt, dann fördert er damit möglicherweise auch eine Einschrän-kung des Asylrechts. Der Wähler ist damit in derselben Situation wie der Gast eines Restaurants, in dem keine einzelnen Speisen zur Auswahl stehen, sondern nur komplette Menüs angeboten werden.“ (S. 3)
Dagegen könne durch eine Regierungs-KI erstmals die gesamte Bandbreite der politischen Wertvorstellungen der Stimmbürger und -bürgerinnen berücksichtigt und sogar in konkrete gesellschaftliche Praxis umgesetzt werden. Nicht nur über die gesetzlichen Bestimmungen selbst, sondern auch über deren Gewichtung könne durch KI erstmals demokratisch entschieden werden:
„Der Bürger wählt aus einem Katalog verschiedener Vorschläge beispielsweise die Priorität Sicherheit aus und weist dieser Priorität eine Gewichtung im Bereich von 1 bis 10 zu. Sollte eine vom Wähler favorisierte Priorität nicht auf der Wahlliste stehen, kann sie der Bürger individuell ergänzen.“ (S. 3)
Durch KI würden alle bisherigen System-Mängel beseitigt. Das Volk gilt nicht nur als Sou-verän, sondern gewinnt angeblich auch dessen Kompetenz der Umsetzung:
„Die KI ist im Besitz dieser Kompetenz und wird ausschließlich objektiv nach den Regeln der Logik und ohne ideologische Ausrichtung eine Lösung für alle anste-henden Fragestellungen finden. Dabei wird sie den von den Wählern vorgegebenen
Prioritäten und deren Gewichtungen soweit Rechnung tragen, wie dies im Rahmen der gestellten Aufgabe möglich ist.“ (ebd.)
Eigenständige Ziele könne die KI dabei jedoch nicht verfolgen, zumal sie das hierzu er-forderliche Bewusstsein nicht entwickeln könne. Die KI solle dennoch so programmiert wer- den, dass sie sich selbst ständig kontrolliert. Überdies werden ihre sämtlichen Entscheidungen offengelegt, so dass sie notfalls korrigiert werden können.
Abschließend verknüpft Bezler sein Konzept sogar mit der Utopie des Ewigen Friedens . Eine Welt ohne Kriege sei
„erst dann möglich, wenn Regierungen nicht mehr von fehlbaren Menschen gestellt
werden, sondern von KIs, die Konflikte durch einen sachlichen und
emotionsfreien
Interessenabgleich bereinigen. Bis diese Vision Realität wird, dauert es
sicher einige
Zeit. Auch steht noch keine KI zur Verfügung, die diese Aufgabe übernehmen
könnte.
Deshalb sollte die Entwicklung einer regierungsfähigen künstlichen
Intelligenz mit
höchster Priorität begonnen werden.“ (S. 4)
Allerdings gibt Bezler sich nicht der Illusion hin, die Parteien würden ohne weiteres ihre Macht an die KI abtreten. Dennoch ist er überzeugt, dass es eines Tages gelingen werde, die Parteien zu entmachten. Umso rätselhafter ist mir Bezlers Schlusswort:
„Die vorstehend skizzierte Zukunftsvision eines I-Governments (Intelligent Govern-ment) wird mit Sicherheit eines Tages realisiert. In Frage steht nur, ob unsere Zivilisation bis dahin Bestand hat.“ (ebd.)
Wenn Letzteres misslingen kann, kann es keine „Sicherheit“ geben, dass das I-Government „eines Tages realisiert“ werden wird.
Eine ausführliche Würdigung auch dieses Konzeptes wird im Folgenden möglich sein, und zwar im Rahmen einer Gesamt-Übersicht über das bisher Dargelegte.
Kritische Würdigung. Vor- und Nachteile von DD und KI
Vorteile der DD
a) gegenüber Adelsherrschaft und Monarchie
In Aristokratie und Monarchie herrscht eine privilegierte Minderheit über die Mehrheit des Volkes, dem elementare Rechte vorenthalten werden. Dagegen räumte die DD, die im antiken Griechenland, genauer: in den hellenischen Kolonien rund ums Mittelmeer, erstmals einge-führt wurde, dem Volk politische Grundrechte ein, darunter die direkte Teilhabe an der Regie-rung, gleiches Rederecht für alle Stimmberechtigten und Gleichheit vor dem Gesetz, auch wenn ein Großteil der Bevölkerung – Frauen, Sklaven, Ausländer – von diesen Rechten aus-geschlossen war. Nicht mehr nur privates Interesse, sondern das Gemeinwohl sollte Vorrang erhalten.
Rousseau und Marx knüpfen hier an, wobei Rousseau sogar Freiheit und Existenz eines Vol-kes von seiner Funktion als ‚Souverän‘ abhängen lässt. Marx wendet sich gegen Hegels Be-fürwortung der Monarchie. Nur eine demokratische Verfassung könne das unveräußerliche Recht des Volkes auf Selbstbestimmung gewährleisten. Bemerkenswert ist auch Marxens ethische Begründung dieser Forderung, wonach alle Verhältnisse umzustürzen seien, „in denen der Mensch eine erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist“ (s.o.). Wodurch allerdings echte Demokratie nur dann als möglich erscheint, wenn die Soziale Frage gelöst ist – was bis heute nirgendwo der Fall zu sein scheint. – Bedeutsam ist darüber hinaus die Tatsache, dass Marx die Pariser Commune von 1871 als Rätedemokra-tie und zugleich als Modell für die DD ansieht. Engels erklärt sogar, dies sei genau das ge-wesen, was er und Marx als „Diktatur des Proletariats“ bezeichnet haben. (Woraus folgt, dass auch nach gelungener proletarischer Revolution nicht eine Partei-Diktatur, sondern eine Räte-Demokratie einzurichten wäre!)
An Marxens Wertschätzung der Regierungsform der Pariser Commune ändert auch die Tat-sache nichts, dass Marx in späteren Jahren die militärische Strategie und Taktik der Commu-narden gegenüber den Versailler Truppen kritisiert hat. Historisch gewinnt sein Rekurs auf die Commune besonderes Gewicht durch die nach seinem Tod einsetzenden Verzerrungen und Verfälschungen seiner Lehre, vor allem im Bolschewismus. Marx besteht auf der Existenz-berechtigung und Validität von Recht, Gesetz und Verfassung, wohingegen Lenin genau dies ablehnt30; was langfristig dazu beigetragen hat, dass der Bolschewismus politisch immer mehr
an Attraktivität verloren hat – bis hin zum Zusammenbruch des „Sowjet“-Systems nach 1989. Begrün
b) gegenüber der repräsentativen Demokratie
In dieser herrschen Parteien und Medien nach Gutdünken und geraten dabei immer wieder in Krisen. A. U. Sommer und P. Bezler kritisieren dies scharf. Bei der Stimmabgabe für eine Partei kommt es vor, dass man etwas wählt, was man im Grunde ablehnt und bekämpfen will, z.B. eine Partei, die das Asylrecht verbessert, aber gleichzeitig Marihuana freigibt u.a.m. Berufspolitiker verlieren oft den Kontakt zu ihren Wählerinnen und Wählern. Dagegen er-möglicht die DD die wirkliche Teilhabe aller an der Machtausübung, ohne dass dadurch – wie oft im repräsentativen System – ein Gesetzgebungszwang entsteht. Für die Verwirklichung der DD innerhalb der nächsten 50 Jahre entwirft Sommer sogar einen Zukunfts-Fahrplan.
Nachteile der DD
In der attischen Demokratie ist es nicht gelungen, die Adelsherrschaft vollständig zu brechen, weil der Adel weiterhin über hohe Vermögen und langjährige, überlegene politische Erfah-rung verfügte. Quasi durch die Hintertür wurde wiederhergestellt, was man endgültig ab-schaffen wollte: die Herrschaft einer Minderheit über die Mehrheit des Volkes.
Nicht frei von Mängeln sind auch die DD-Theorien von Rousseau und Marx. Rousseau erkennt nicht die wahren sozio- ökonomischen Gründe für die soziale Ungleichheit. Diese er-weist sich als Schranke für eine gerechte Volksgesetzgebung wie auch für gesellschaftliche Homogenität überhaupt. Abwegig ist überdies, dass Rousseau es für möglich hält, eine Ab-stimmung als Wahrheitskriterium anzunehmen. Außerdem: Wird die Volksgesetzgebung und damit die Stimmabgabe zum „Souverän“, entsteht die Gefahr von staatlicher Autokratie und Despotie, weil unterlegenen Stimmen keinerlei inhaltliche Relevanz zugesprochen wird. – Überhaupt unklar ist auch Rousseaus Begriff des ‚Souveräns‘. Dieser besteht nur im Abstraktum der Volksgesetzgebung, soll diese aber in politisches Handeln umsetzen. Politisch handeln können jedoch nicht Abstrakta, sondern nur Menschen aus Fleisch und Blut. Insofern scheint Montesquieus Konzept der Gewaltenteilung dem „Souverän“-Konstrukt Rousseaus überlegen zu sein.
Marx‘ Kritik an den Menschenrechtserklärungen (s.o.) ist weitgehend hinfällig. Positiv zu werten ist zwar sein rätedemokratisches Konzept der DD; da er dieses aber mit seiner Revolu- tionstheorie verbunden hat, bleibt sein DD-Konzept unrealisierbar, solange weltweit das glo-balisierte Kapital herrscht.
Noch unerfindlich ist, ob die DD als bloße Ergänzung oder als maßgebliche Grundlage einer demokratischen Regierungsform dienen kann. Überzeugende Konzepte mit Synthesen aus DD und repräsentativem Parlamentarismus sind anscheinend nicht vorhanden. – Auch außerhalb von Hellas und Pariser Commune sind Experimente mit DD nur selten gelungen. In den USA fehlt es der breiten Masse der Bevölkerung bei Referenden oft an den nötigen Informationen. In der Schweiz beruhen nur 7 von 100 Gesetzen auf Volksabstimmungen. In der BRD garan-tiert das GG zwar das Recht auf „Abstimmungen“, macht hierzu jedoch – anders als zur re-präsentativen Demokratie – keinerlei nähere Angaben oder Erläuterungen.
Ein weiteres Handikap: Die weitverzweigten, komplizierten Beziehungsgrößen der DD in Philosophie, Wissenschaften, Wirtschaft und Gesellschaft. Aus einem irrtümlich negativen Menschenbild lässt sich keine Notwendigkeit für eine DD ableiten (wie A. U. Sommer dies unternimmt). Internet und andere Medien sind krisenanfällig – von Cyber-Angriffen bis zum Daten-Phishing und anderen kriminellen Handlungen. Eine „elektronische Demokratie“ ist bislang eher Desiderat und Utopie.
Fragwürdig ist auch, dass man sich Fortschritte dadurch erhofft, dass man Sprach-Material „den bekannten Regeln der Mathematik, Physik, Kausalität und Logik unterzieht“. (Bezler, s.o. S. 37.) Einem solchen Unterfangen sind nämlich von vornherein bestimmte Grenzen gesetzt. Denn: 1. Sprache macht unendlichen Gebrauch von endlichen Mitteln. Gestützt wird dies durch die unendliche neuronale Kombinatorik des menschlichen Gehirns. 2. Wörter sind Bezeichnungen und haben Bedeutungen. 3. Sprachliche Formen evozieren bestimmte sprach-liche Inhalte, die zunächst stets aus verallgemeinerten Vorstellungen bestehen und sich auf Referenz-Objekte beziehen (können). Mathematik kann dem nur teilweise gerecht werden, zumal sie die Unendlichkeit von Sprache und neuronaler Gehirn-Kombinatorik nicht erfassen kann. Physik bezieht sich auf materiell Bestimmbares, wohingegen Sprache auch Immaterielles evozieren kann. Der Sprach-Logos umfasst vollständig auch die Ausdrücke von Kausalität und Logik, diese aber beziehen sich nicht auf sämtliche Sprach-Inhalte. Logik erfasst formale Beziehungen, Sprach-Logos darüber hinaus auch Inhaltliches, Nicht-Formales.
Anzumerken ist außerdem: Sprachliche Bedeutungen sind sprachspezifisch und daher sinn-voll nur von Linguistik (nebst Psycho-, Sozio-Linguistik usw.) und Philosophie zu unter-suchen, während sich die genannten vier Disziplinen nur auf die Referenz-Objekte der sprach-lichen Bedeutungen beziehen. Die Referenz-Objekte sind aber ohnehin ständig Gegenstände der Disziplinen, so dass sich das genannte Projekt unter diesem Aspekt als höchst fragwürdig, wenn nicht sinnlos erweist.
Zu Joseph Beuys DD-Vorstellungen
Beuys und seine Kollegen von der ‚Organisation für Direkte Demokratie‘ wollen die Demokratie von der Kunst her aufrollen und aufmischen. Zu Grunde liegen Anthroposophie (Steiner u.a.) und ‚Soziale Plastik‘ mit der Devise „Jeder Mensch ist ein Künstler“. Dies wäre nachvollziehbar, wenn Politik tatsächlich „die Kunst des Möglichen“ wäre. Dieser angeblich von Bismarck stammende Spruch ist jedoch irreführend, denn er meint lediglich, wie Hubert Michelis zu Recht feststellt, „dass ein Staat nach außen und innen hin seine Interessen und Möglichkeiten wahren und behaupten soll“. 31 Politik lebt daher nicht von irgendeiner ausge-klügelten Kunst-Fertigkeit, sondern von der Einsicht in die Notwendigkeit (= Hegels Defini-tion der Freiheit!). Wie alle anderen Menschen auch tun Politiker das, was sie für notwendig halten.
Bedenkenswert scheint Beuys‘ Behauptung, die Verhältnisse würden sich ändern, wenn alle Zugang zur direkten DD hätten. In diesem Fall würden sicherlich auch die Angehörigen der unterprivilegierten sozialen Schichten ihre Bedürfnisse öffentlich artikulieren, so dass die Politiker sie nicht länger ignorieren könnten. Leider ist der generelle Zugang zur DD bisher anscheinend weder in der BRD noch anderswo auch nur annähernd verwirklicht worden. Alle von Beuys‘ ‚Organisation …‘ genannten „echten Wesensmerkmale“ der DD (s.o. S. 26) sind gerechtfertigt und nachvollziehbar, aber keines dieser Merkmale ist je in politische Praxis umgesetzt worden. Warum nicht? Sicherlich nicht nur wegen Beuys‘ fragwürdigen Ausgangs von der Kunst, d.h. der ‚Sozialen Plastik‘.
Vorteile der Künstlichen Intelligenz
P. Bezler sieht in der KI ein probates Gegenmittel gegen die Herrschaft der Parteien. An die Stelle von Ideologie setzt die KI objektiv nachprüfbare Information, so dass Folgerichtigkeit und Gerechtigkeit statt Hin und Her und Zickzackkurs einkehren können. Eine „Regierungs-KI“ soll erstmals dem gesamten Spektrum der politischen Vorstellungen, Meinungen und Überzeugungen gerecht werden. Idealerweise enthält die Regierungs-KI auch die Kompetenz zur Umsetzung der Beschlüsse, und zwar nach den „Regeln der Logik“ (!). Auch die Verwirk-lichung der Utopie des Ewigen Friedens rückt angeblich durch KI in den Bereich des Mögli-chen, auch wenn diese KI erst noch zu entwickeln sei.
Unabhängig von diesen politischen Implikationen hält Bezler eine beachtenswerte Lobrede auf die Qualitäten der KI, zumal künstliche neuronale Netze mit ihr verbunden werden können. Diese Netze bilden sogar die Fähigkeit des menschlichen Gehirns nach, parallel, d.h. nicht bloß sequentiell zu arbeiten und Informationen assoziativ zu speichern. „Mit Hilfe der neuronalen Netze lassen sich somit auch Aufgaben lösen, für die es keine Algorithmen gibt.“ (s.o. S. 37)
Zukunftsperspektiven: KI „mit Licht und Quanten“, Synthesen mit herkömmlichen IT-Verfahren; KI werde bisher Verborgenes sichtbar und erkennbar machen. Menschen sind fehlbar, KI angeblich nicht. Die Befürchtungen hinsichtlich einer existenziellen Bedrohung der Menschheit durch autonome KI würden sich als haltlos erweisen, zumal KI kein eigenes Bewusstsein entwickeln könne. Durch zerebrale Implantate sollen eines Tages sämtliche Fä-higkeiten der KI direkt in den menschlichen Körper übertragen werden.
Nachteile der KI
Ob das Letztgenannte wünschenswert ist, muss bezweifelt werden. Kann nicht-organisches, technisches KI-Material ohne weiteres in den menschlichen Organismus integriert werden? Sind mögliche Konsequenzen und Nebenwirkungen derart tiefgreifender technischer Eingrif-fe noch (oder schon) überschaubar und kontrollierbar?
Inakzeptabel ist es jedenfalls, dass Experten wie Sommer und Bezler die überragende Bedeu-tung ignorieren, die der KI inzwischen von den Großmächten USA und China beigemessen wird. Wenn Putin behauptet, wer die KI voll beherrsche, erlange die Weltherrschaft, mag dies fragwürdig sein; nicht zu leugnen ist jedoch, dass in China und den USA die KI-Gesetz-gebungen merkwürdig „weich“ ausfallen. Was womöglich nicht nur darauf zurückzuführen ist, dass Regierungen auf die kommerziellen Interessen industrieller Produzenten Rücksicht nehmen (müssen).
Weitere Probleme der KI: Für eine endgültige, effektive Überwachung und Kontrolle der KI gibt es bisher keine Garantie, zumal die hierfür erforderlichen internationalen Vereinbarungen nicht (oder noch nicht) vorhanden sind. Vielleicht üben die beiden Supermächte auch hier Bremswirkungen aus. – Außerdem ist die KI bisher keineswegs unfehlbar. Vielfältiges Versa-gen, z.B. bei Detail-Problemen, zeugt vom Gegenteil. KI-Gesichtserkennung ist keineswegs überall verboten, schon gar nicht in China.
Bezler verkennt einige Unterschiede zwischen menschlicher und technischer neuronaler Kom-binatorik. Beide sind prinzipiell unendlich, unüberschaubar, mathematisch nicht erfassbar. Dennoch können die Unterschiede nicht einfach durch einen Hinweis auf gemeinsame physi-kalische und biochemische Grundlagen verwischt werden. Was wir Seele nennen, beruht tat-sächlich auf Fähigkeiten, die KI-Maschinen überhaupt nicht zugänglich sind, zumal sie weder über Gedächtnis noch über das typisch menschliche Zusammenspiel von Erleben, Bewusst-sein, Es, Ich und Über-Ich – auch im Unbewussten – verfügen. Seele, Geist und Bewusstsein hat nur das Subjekt, keine Maschine. 32
Synthese von DD und KI? Demokratischer Ökosozialismus als Ausweg?
Wegen der zahlreichen Nachteile von DD und KI ist eine Synthese der beiden Bezugsgrößen nicht möglich. Auch können deren offensichtliche Vorteile (s.o.) vorerst nicht zusammenge-führt werden; dies aus folgenden Gründen:
Es gibt weltweit zwei Grundprobleme, die trotz DD und KI bisher nicht gelöst werden konnten: die Soziale Frage und die Öko-Krise. Nur mit KI lassen diese Probleme sich ohnehin nicht lösen, weil hierzu mehr erforderlich ist als eine noch so große Menge an Informationen. Es ist etwas, wozu KI nicht in der Lage ist, weil sie weder über Willen noch über Gedächtnis, Bewusstsein, Seele und Geist verfügt.
DD versagt hier ebenfalls, zumal Abstimmungen allein noch kein politisches Handeln bewir-ken. Stattdessen gibt es jedoch ein Konzept, das auch über KI erreichbar wäre: das Konzept des Demokratischen Ökosozialismus . Dessen Einzelheiten brauche ich hier nicht zu wieder-holen, weil ich diese schon mehrfach vorgestellt habe, zuletzt 2024. Daher begnüge ich mich hier mit der folgenden Zusammenfassung:
Demokratischer Ökosozialismus
Voraussetzung für diesen ist es, die Öko-Krise zu beheben oder zumindest in den Griff zu be-kommen. Hierzu bedarf es zunächst einer neuen
Öko-Ethik.
Der globalisierte Kapitalismus trägt in sich das Monster Öko-Krise , das zwar auch eine kapi-talistische Fratze trägt, aber nicht nur diese. Auch und gerade in den sogenannten sozia-listischen Ländern wirkte sich verfehlter Umgang mit Natur und Umwelt katastrophal aus. All dies macht das Desiderat einer Öko-Ethik zu einer Mammut-Aufgabe der besonderen Art.
Natur-, Tier- und Öko-Ethik lassen sich unmittelbar aus dem Eigenwert der Natur ableiten. Als Hauptkriterium für die Öko-Ethik nennt Klaus Sojka die „Verträglichkeit mit der Lebenseinheit“ und erklärt dazu: „Das bedeutet: Die zur Pflicht erhobene Selbsterhaltung gebietet die Erhaltung der in Gemeinschaft mit dem Menschen lebenden Tiere jedweder Art und Beschaffenheit, ferner den Verzicht auf den Verbrauch vorhandener Stoffe, sofern er nicht unbedingt zur Notbedarfs-Deckung erforderlich ist. Die vordergründigen Maßnahmen bewirken, Beeinträchtigungen von Lebewesen jedweder Erscheinungsform, insbesondere durch Quälerei, Verstümmelung oder Vernichtung abzuwenden, weil sie als Teil der Einheit und Schicksalsgemeinschaft Solidarität beanspruchen.“ 33 – Jedermann muss sich fragen, ob sein/ihr Verhalten sich nützlich, schädlich oder neutral auf Natur und Umwelt auswirkt. Alles Schädliche muss vermieden werden.
Speziell in der Tier-Ethik ist seit langem umstritten die Frage, ob auch Tieren ein Personen-Status zuerkannt werden sollte. Was unmöglich ist, wenn das Person-Sein als „der totale Umfang des Menschen“ (Mounier) definiert wird. Dagegen schlägt der kalifornische Ethik- und Wirt-schaftsforscher Thomas White vor, Personen von Sachen folgendermaßen zu unterscheiden: Eine Person ist ein Wer?, eine Sache ein Was?, so dass die Tiere, die ja keine Sachen sind, wahrscheinlich ausnahmslos als Personen zu bezeichnen wären. Eine Möglichkeit, auf die White jedoch nicht eingeht. Stattdessen entwirft er einen speziellen Katalog von Kriterien für ein Person-Sein, das Tieren und Menschen gleichermaßen zuzubilligen wäre. Demnach sind Personen gekennzeichnet durch Faktoren wie Leben, Bewusstsein, Wahrnehmung, Gefühle, „eine Vorstellung von sich selbst“, Kontrolle des eigenen Verhaltens, Anerkennung der anderen Personen, hoch entwickelte kognitive Fähigkeiten (z.B. zur Lösung von Problemen), Gedächtnis und die Fähigkeit zur Kommu-nikation von Gedanken. 34 Diese Kriterien seien, so White, auf alle Menschen anwendbar, nicht jedoch auf alle Tiere, sondern nur auf Elefanten, „Wale und Delfine, Große Menschenaffen, Vögel, Reptilien und bei Bedarf sogar auf Außerirdische“ (wo es dann leider etwas unseriös wird ...). – Es stellt sich zu dieser Klassifizierung jedoch sofort die Frage, wo mit ihr die genauen Grenzen des Person-Seins im Tierreich zu ziehen wären. Zeigen nicht auch z.B. Ameisen, Bienen, Hunde, Katzen und Pferde Intelligenzleistungen und andere Fähigkeiten, die den genannten Kriterien in etwa entsprechen? Ein Dilemma, für dessen Lösung ich vorschlage, der gesamten außermenschlichen Welt und allen Menschenkindern im vorgeburtlichen Stadium vorpersonale Eigenschaften zuzubilligen, wobei graduelle Unterschiede gemacht werden können.
Unter dieser Voraussetzung halte ich es für möglich, die Ethik der Person durch eine Ethik der Natur zu ergänzen, wofür ich eine Naturformel des Kategorischen Imperativs vorgeschlagen habe, in der die Tatsache berücksichtigt wird, dass im Umgang mit der Natur legitime Interessenabwägungen erforderlich sein können. Es ist eine Formel, die nicht die noch im Gange befindlichen Diskussionen über (mögliche) Rechte der Natur, der Umwelt, der Tier- und Pflanzenwelt (Natur-, Öko-, Tierrechte) präjudizieren kann oder soll. Sie lautet:
Verhalte Dich so, dass Du die Natur in jeder Person und in jeder anderen Erscheinungsform stets als Zweck – und als Mittel nur zu ethisch begründbaren und moralisch vertretbaren Zwecken – behandelst.
Wenn nun zu klären ist, welche konkreten Rechte und Pflichten sich mit dieser neuen Formel begründen lassen, stellt sich die Frage nach der Legitimierung entsprechender gesetzgeberischer Maßnahmen. Was ist legitim? Rechtspositivistisch zweifellos das aktuelle geschriebene und gesprochene Recht. Und in Fällen staatlicher Willkür? Oder gar in Unrechtsstaaten? Da hilft zunächst wohl nur die naturrechtliche Anerkennung des Eigenwerts der Natur und des Selbstzwecks der Person, die auch in Kants Zweckformel des Katego-rischen Imperativs enthalten ist, wozu meine Naturformel lediglich als Ergänzung dient.
Wenn mit Schelling die schöpferische Natur (‚natura naturans‘) als ihre „eigene Gesetzgeberin“ anzunehmen ist, gilt dies sowohl für die Natur im Menschen als auch für die außermenschliche Natur. „Was „legitim“ ist, muss ethisch und moralisch überprüft und begründet werden. Es sind allgemeine, naturrechtlich verankerte Grundrechte (wie z.B. die Menschenwürde, die Freiheit der Person, die Natur- und Umweltrechte), die jedem Öffentlichen Recht vorzuordnen sind.“ 35
Zum Demokratischen Öko-Sozialismus
Sich gegen den neoliberalen Turbo-Kapitalismus aufzulehnen, ist mit DD, KI, Ethik und Moral allein nicht möglich. Dazu bedarf es vielmehr politischer Gegenwehr mit langem Atem, zumal dann, wenn weder ein „revolutionäres Subjekt“ noch ein entsprechendes Klassen-Bewusstsein vorhanden ist. Dennoch brauchen die ethischen Forderungen davor nicht zu kapitulieren. Vielmehr sind sie in die antikapitalistische Veränderungsethik aufzunehmen, wie sie Ernst Bloch konzipiert hat. Eine solche Ethik kann und muss auch den reformerischen bis revolutionären Kampf stützen, getreu der Marxschen Devise, dass die Philosophie sich nicht verwirklichen kann, ohne sich „aufzuheben“.
Öko-Sozialismus – eine neue Synthese. Zum Sozialismus-Begriff. Ernst Bloch erklärt: „Die Wahrheit des Sozialen ist der Sozialismus“. Und er entwirft die Vision Substanzziel Sozialismus als utopische Einheit von Substanz und Subjekt, d.h. als Endsubstanz in unentfremdetem An- und Fürsichsein . Wobei kein Zweifel daran bestehen kann, dass dieses Ziel mit denjenigen übereinstimmt, die Marx und Bloch dem Kampf für den Sozialismus mit auf den Weg gegeben haben. Aber: 1. Gegen den geballten Widerstand des Großkapitals ist Sozialismus anscheinend nicht durchsetzbar. 2. Ohne die Mobilisierung breiter Kreise der Bevölkerung, insbesondere der Arbeiterschaft, kann ein sozialistisches Experiment nicht gelingen.
Öko-Sozialismus. In der „ökosozialistische Erklärung von Belém“ (2009) wird eine umfassende ökosozialistische Revolution gefordert, und zwar weltweit, so dass endlich auch „der am meisten unterdrückte Teil der menschlichen Gesellschaft, die Armen und die indigenen Völker“ der Dritten Welt, von Elend, Unterentwicklung und Ungerechtigkeit (z.B. durch ungleichen, unfairen Handel!) befreit werden könne. Im Zuge dieser Befreiung könne dann auch die volle Gleichberechtigung von Mann und Frau, die „Geschlechtergleichheit“ als „integraler Bestandteil des Ökosozialismus“, überall auf der Welt gewährleistet werden. Es handele sich um ein Programm, für das die Mehrheit der Bevölkerung allenthalben zu gewinnen sei. Im Übrigen empfehlen die Autoren ihr Programm auch als Anleitung für dringend notwendige Reformen im Hier und Jetzt . Hunger, Not, Elend, Natur- und Umweltzerstörung dulden keinen Aufschub mehr. Abhilfe muss unverzüglich geschaffen werden, wo immer es möglich ist.
Digitaler Sozialismus.Computer und „soziale Medien“ allein können die Probleme der Gesellschaft nicht lösen, zumal die Komplexität der menschlichen Person – auch und gerade als eines Gemeinschaftswesens – sich dem bloß quantifizierenden und rubrizierend-einordnenden Zugriff von Rechnern entzieht. Erforderlich sind jedenfalls gesetzlich geregelte Digitalisierung und ebenso kontrollierte Künstliche Intelligenz . (Näheres hierzu u.a. bei: Peter Bezler: Echte Demokratie durch KI , in: https://übermorgen.org, 2022.)
Sozialistische Planung.Computer und Internet eröffnen dem Sozialismus ganz neue Mög-lichkeiten. Makroökonomie, aber auch Detailprobleme wie die der Arbeitszeiten, sind plötzlich in ungeahnter Schnelligkeit berechenbar.
Direkte Demokratie würde bedeuten: Der durch Arbeit Werte Schaffende selbst wäre endlich Herr im eigenen Haus, und zwar durch die Gewährung positiver Rechte, von denen die Autoren Cockshottund Cottrell im Jahre 1993 als wichtigste nennen: „(1) Das Recht, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, (2) Das Recht, den vollen Wert ihrer Arbeit zu erhalten und (3) Das Recht, über den Wert ihrer Arbeit nach eigenem Wunsch frei zu verfügen.“ 36 Das wären neuartige Eigentumsrechte, und zugleich das Ende von Ungleichheit, Ungerechtigkeit, Ausbeutung, Entfremdung und Fremdbestimmung.
Insgesamt: eine wunderschöne neue Welt der Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Aber: Wie soll sie erreicht, wie geschaffen, wie durchgesetzt werden? Und warum sind wir ihr seit dem Erscheinen der Vorschläge von Cockshott und Cottrell im Jahre 1993 fast keinen Schritt näher gekommen? – Hätte nicht das Scheitern sowohl der sowjetischen als auch der französischen (pseudo-)sozialistischen Experimente (1983 bzw. 1989 ff.) Autoren wie Sarkar, Kern, und Cockshott, Cottrell zu ganz anderen Schlussfolgerungen veranlassen müssen?
Marktsozialismuskönnte wahrscheinlich nur dann möglich werden, wenn die Marktwirtschaft – auch mittels gesetzlich geregelter Digitalisierung und ebenso kontrollierter Künstlicher Intelligenz – gesamtgesellschaftlicher Kontrolle unterworfen wird, makro- und mikroökono-misch durch kompetente Steuerungs-Behörden möglichst auf allen Ebenen, von der Arbeiter-Kontrolle in den Betrieben über lokale und nationale Einrichtungen bis hin zu internationalen Gremien, auch z.B. durch entsprechende Neuerungen in der UNO. Kapitalistische Marktwirt-schaft müsste somit zu einem neuen Marktsozialismus transformiert werden, wozu neben politischer Macht die Zustimmung der Mehrheit der Bevölkerung erforderlich ist. Um einen friedlichen, gewaltfreien Übergang zum Sozialismus angesichts der gegenwärtigen Weltlage wenigstens denkbar zu machen, muss ein neuer Marktsozialismus mit einer demokratischen Verfassung des Gemeinwesens vereinbar sein.
Nah- und Fernziele eines Demokratischen Öko-Sozialismus: Und wie kann ein Demokratischer Öko-Sozialismus Wirklichkeit werden? Zur Teleo-Logik des Sozialismus in Übergangsgesell-schaften. Wenn die Wahrheit des Sozialen der Sozialismus ist, bedarf es sowohl einer Wahrheitstheorie als auch einer Theorie des Sozialen. Wenn das Soziale im Sozialismus zu voller Wahrheit aufblühen soll, muss es selbst als Ausgangsbasis der Umgestaltung dienen, so dass zunächst bei den bestehenden sozialen Errungenschaften, speziell des Sozialstaats, anzuknüpfen ist.
Zur konkreten Analyse der konkreten Situation.Unumgänglich ist es, sich über das bereits vorhandene Soziale einen möglichst klaren Überblick zu verschaffen. – Aufklärende Agita-tion und Propaganda, ‚Agitprop‘ im besten und weitesten Sinne des Begriffs, sind vonnöten, um, möglichst über alle Partei- und Gesinnungsgrenzen hinweg, der gesamt-gesellschaftlichen Emanzipation, dem Vorschein des Reichs der Freiheit, näher zu kommen. [23]
Mit DD und KI zum Reich der Freiheit?
Wenn anzunehmen ist, dass sowohl die Soziale Frage als auch auch die Öko-Krise durch Formen eines Demokratischen Ökosozialismus zumindest in den Griff zu bekommen sind, können Überlegungen über weitergehende gesamtgesellschaftliche Ziele angestellt werden. Wenn DD ermöglicht werden soll, müssen a) die Menschen sich ihrer Lebensgrundlagen sicher sein können und b) die krassen sozialen bzw. finanziellen Ungleichheiten beseitigt oder auf ein Minimum reduziert werden. (Denkbar wäre es allerdings auch, finanziell schwache Initiatoren von Volksabstimmungen regierungsamtlich zu subventionieren.)
Das ‚Reich der Freiheit‘ im Marxschen Sinne wird näher zu erklären sein (s.u.). Gegen dieses ‚Reich‘ wird eingewendet, generelle Freiheit werde doch schon gegenwärtig überall garan-tiert, z.B. vom Grundgesetz der BRD in Formeln wie „Freiheit der Person“ und „freie Entfaltung der Persönlichkeit“. Diese Garantien wurden gegeben, ohne zu bedenken, dass nicht jedes Wirtschaftssystemmit wirklicher Freiheit zu vereinbaren ist; was sowohl für das kapitalistische wie für das bolschewistisch-totalitäre Wirtschaftssystem gilt. Wirkliche Freiheit aller Menschen wird es vermutlich erst dann geben können, wenn alle frei sind; was aber durch soziale Ungleichheit, Ausbeutung und Unterdrückung verhindert wird.
Was versteht Marx nun unter dem ‚Reich der Freiheit‘? Aufschluss hierüber vermittelt der folgende Marxsche Text:
„Das Reich der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das
durch Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört; es liegt also
der Natur der Sache nach jenseits der Sphäre der eigentlichen materiellen
Produktion. Wie der Wilde mit der Natur ringen muss, um seine Bedürfnisse
zu befriedigen, um sein Leben zu erhalten und zu reproduzieren, so muss es
der Zivilisierte, und er muss es in allen Gesellschaftsformen und unter
allen möglichen Produktionsweisen. Mit seiner Entwicklung erweitert sich
dies Reich der Naturnotwendigkeit, weil die Bedürfnisse sich erweitern;
aber zugleich erweitern sich die Produktivkräfte, die diese befriedigen.
Die Freiheit in diesem Gebiet kann nur darin bestehen, dass der
vergesellschaftete Mensch, die assoziierten Produzenten, diesen ihren
Stoffwechsel mit der Natur rationell regeln, unter ihre gemeinschaftliche
Kontrolle bringen, statt von ihm als von einer blinden Macht beherrscht zu
werden; ihn mit dem geringsten Kraftaufwand und unter den ihrer
menschlichen Natur würdigsten und adäquatesten Bedingungen vollziehen. Aber
es bleibt dies immer in Reich der Notwendigkeit. Jenseits desselben beginnt
die menschliche Kraftentwicklung, die sich als Selbstzweck gilt, das wahre
Reich der Freiheit, das aber nur auf jenem Reich der Notwendigkeit als
seiner Basis aufblühen kann. Die Verkürzung des Arbeitstages ist die
Grundbedingung.”
( Aus: Karl Marx: Das Kapital, dritter Band.)
In Kurzform:
1. Marx unterscheidet zwischen dem Reich der Freiheit und dem der Notwendigkeit.
2. Das Reich der Notwendigkeit besteht aus den materiellen Bedürfnissen und der Arbeit, die „durch Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist“. In ihm vollziehen die Menschen den Stoffwechsel mit der Natur. In ihm herrscht Freiheit nur, wenn „die assoziierten Produzenten … diesen ihren Stoffwechsel mit der Natur rationell regeln, unter ihre gemeinschaftliche Kontrolle bringen, statt von ihm als von einer blinden Macht beherrscht zu werden“.
3. An diese Freiheit knüpft das Reich der Freiheit an; es entsteht also aus dem der Notwendigkeit, beginnt aber erst dort, wo die menschliche Kraftentwicklung nicht mehr – wie im Reich der Notwendigkeit – entfremdet wird, sondern als Selbstzweck gilt.
4. Grundbedingung für das Reich der Freiheit ist die Verkürzung des Arbeitstages.
Marx hat dieses Konzept der Freiheit allerdings an seine Revolutionstheorie gebunden. Wonach die kapitalistische Unfreiheit – Ausbeutung, Unterdrückung, Verelendung, soziale Ungleichheit usw. – durch die proletarische Revolution beendet werden muss. Auch in der Übergangsphase zum freiheitlichen Sozialismus ist aber keine Partei-Diktatur, sondern eine Form der Direkten Demokratie, z.B. der Rätedemokratie, einzurichten. Wobei Recht, Gesetz und sozialistische Verfassung stets zu wahren sind.
Genau diese Revolution hat jedoch nie stattgefunden. Stattdessen gab es Verzerrungen und Verfälschungen der Marxschen Lehre vor allem durch Bolschewismus, Stalinismus, Mao-ismus u.a.m. Verfehlt wäre es jedoch, hieraus zu schließen, dass auch die Marxsche Lehre – spätestens ab 1989 – endgültig und vollständig gescheitert sei.
Wobei zu beachten ist, dass diese Interpretation keineswegs überall Zustimmung findet. Ex-perten wie Manfred G. Schmidt (2000) behaupten, es gäbe „Verbindungslinien von der poli-tischen Theorie eines Marx bis zur Theorie und Praxis marxistisch-leninistischer Partei- und Staatspolitik“. 38 Udo Bernbach kritisiert am Räte-Konzept „das Verkennen eines privilegier-ten Zugangs zu Informationsnutzung und der damit verbundenen selektiven Steuerungs- und Manipulationsmöglichkeiten durch Amtsträger; schließlich die mangelhafte Beachtung des Verhältnisses von Zentral- und Basisorganisation …“.39M. G. Schmidt behauptet darüber hinaus, DD führe als Volksgesetzgebung zu einer unerträglichen Monopolisierung der Staats-macht, zu einer durch nichts behinderten Totalisierung . Schmidts Fazit: „Insoweit hat die Theorie revolutionärer Direktdemokratie nicht nur ein extrem egalitäres und aktionistisches Element, sondern auch einen ausgeprägt autoritären Charakter (…) mit größter Anfälligkeit gegen totalitäre Ausdeutungen.“ (Schmidt a.a.O. S. 172)
Ist deshalb die Marxsche Lehre vollständig und endgültig gescheitert? Dagegen steht vor allem die Tatsache, dass immer noch das existiert, was Marx als „die Dauerkrise des Kapitalismus“ bezeichnet hat. Es ist eine weltweit verbreitete Krise, hauptsächlich im Zeichen des globalisierten Neoliberalismus, verstärkt und verschlimmert durch die Öko-Krise. – Und Marxens Konzept der Rätedemokratie wäre nur dann hinfällig, wenn Marx eine Partei-Dikta-tur – ähnlich wie die später von Lenin durchgesetzte – gefordert hätte. Was aber nicht der Fall ist, zumal Marx, anders als Lenin, stets die Validität von Recht und Gesetz betont hat.
Einzuräumen ist dennoch, dass Volksgesetzgebung totalitär werden kann. Hiergegen gibt es jedoch ein weitgehend bewährtes Gegenmittel: die Gewaltenteilung zwischen Regierung, Par-lament und rechtsprechender Gewalt. Auch die DD benötigt personale Repräsentanten, zumal die allgemeine Stimmabgabe allein noch nicht zur Ausformulierung und Annahme von Gesetzen und deren Umsetzung in konkrete gesellschaftliche Praxis führt. Daher müssten, in einer Mischform aus repräsentativer und direkt-demokratischer Regierung, auf allen Ebenen: von der Bezirksregierung bis zur UNO, gewählte und abwählbare Gremien von Exekutive und Legislative – neben der Judikative – sowohl die effektive Volksgesetzgebung als auch die Kontrolle über die KI und eine (mögliche) „KI-Regierung“ (s.o.) sichern, und zwar möglichst gemäß dem Subsidiaritäts-Prinzip. Über Einzelheiten müsste der Demos jeweils selbst bera-ten und entscheiden.
Wie aber steht es nun mit der KI im Hinblick auf ein (mögliches) Reich der Freiheit?
Hier ist im Mai 2024 eine neue Entwicklung dadurch eingetreten, dass die EU erstmals ein umfassendes Gesetz zur Regulierung der KI erlassen hat, das allerdings noch von den 27 EU-Staaten in nationales Recht übertragen werden muss. Eine Zusammenfassung dieses Mam-mut-Gesetzes enthält Folgendes:
„EU-Gesetz über künstliche Intelligenz 40
…. Vier-Punkte-Zusammenfassung
*Das KI-Gesetz stuft KI nach ihrem Risiko ein:*
* Unannehmbare Risiken sind verboten (z. B. soziale Bewertungssysteme und manipulative KI).
* Der größte Teil des Textes befasst sich mit KI-Systemen mit hohem Risiko, die reguliert sind.
* Ein kleinerer Teil befasst sich mit KI-Systemen mit begrenztem Risiko, für die geringere Transparenzpflichten gelten: Entwickler und Betreiber müssen sicherstellen, dass die Endnutzer wissen, dass sie mit KI interagieren (Chatbots und Deepfakes).
* Das geringste Risiko ist unreguliert (einschließlich der meisten KI-Anwendungen, die derzeit auf dem EU-Binnenmarkt erhältlich sind, wie z. B. KI-gestützte Videospiele und Spam-Filter - zumindest im Jahr 2021; dies ändert sich mit der generativen KI).
*Die meisten Verpflichtungen treffen die Anbieter (Entwickler) von risikoreichen KI-Systemen.*
……
Die folgenden Arten von KI-Systemen sind nach dem KI-Gesetz "verboten".
KI-Systeme:
* Einsatz von *unterschwelligen, manipulativen oder täuschenden Techniken*, um das Verhalten zu verzerren und die bewusste Entscheidungsfindung zu beeinträchtigen, wodurch erheblicher Schaden entsteht.
* Ausnutzung von Schwachstellen im Zusammenhang mit Alter, Behinderung oder sozioökonomischen Verhältnissen, um das Verhalten zu verzerren und erheblichen Schaden anzurichten.
* biometrische Kategorisierungssysteme, die Rückschlüsse auf sensible Merkmale (Rasse, politische Meinungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, religiöse oder philosophische Über-zeugungen, Sexualleben oder sexuelle Ausrichtung) zulassen, außer bei der Kennzeichnung oder Filterung rechtmäßig erworbener biometrischer Datensätze oder bei der Kategorisierung biometrischer Daten durch die Strafverfolgungsbehörden.
* *Soziales Scoring*, d. h. die Bewertung oder Klassifizierung von Personen oder Gruppen aufgrund ihres Sozialverhaltens oder ihrer persönlichen Eigenschaften, was zu einer nachteiligen oder ungünstigen Behandlung dieser Personen führt.
* die *Bewertung des Risikos, dass eine Person Straftaten begeht,* ausschließlich auf der Grundlage von Profilen oder Persönlichkeitsmerkmalen, es sei denn, sie wird zur Ergänzung menschliche Bewertungen auf der Grundlage objektiver, überprüfbarer Fakten, die in direk-tem Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten stehen, verwendet.
* *Aufbau von Gesichtserkennungsdatenbanken* durch ungezieltes Auslesen von Gesichts-bildern aus dem Internet oder aus Videoüberwachungsaufnahmen.
* das *Ableiten von Emotionen am Arbeitsplatz oder in Bildungseinrichtungen*, außer aus medizinischen oder Sicherheitsgründen.
* *Biometrische Fernidentifizierung (RBI) in Echtzeit in öffentlich zugänglichen Räumen für die Strafverfolgung* außer wenn:
o Suche nach vermissten Personen, Entführungsopfern und Menschen, die Opfer von Menschenhandel oder sexueller Ausbeutung geworden sind;
o Verhinderung einer erheblichen und unmittelbaren Bedrohung des Lebens oder eines vorhersehbaren terroristischen Angriffs; oder
o Identifizierung von Verdächtigen bei schweren Straftaten (z. B. Mord, Vergewaltigung, bewaffneter Raubüberfall, Drogen- und illegaler Waffenhandel, organisierte Kriminalität,Um- weltkriminalität usw.). …
Einige KI-Systeme werden im Rahmen des KI-Gesetzes als "hohes Risiko" eingestuft. Für die Anbieter dieser Systeme gelten zusätzliche Anforderungen. KI-Systeme mit hohem Risiko sind solche:
* als Sicherheitsbauteil oder ein Produkt verwendet wird, das unter die EU-Rechts-vorschriften in Anhang I … fällt *UND* einer Konformitätsbewertung durch einen Dritten gemäß diesen Anhang I-Rechtsvorschriften unterzogen werden muss; *ODER*
* die unter Anhang III … Anwendungsfälle (unten), außer wenn:
o das KI-System führt eine enge prozedurale Aufgabe aus;
o verbessert das Ergebnis einer zuvor durchgeführten menschlichen Tätigkeit;
o Entscheidungsmuster oder Abweichungen von früheren Entscheidungsmustern aufdeckt und nicht dazu gedacht ist, die zuvor durchgeführte menschliche Bewertung ohne angemessene menschliche Überprüfung zu ersetzen oder zu beeinflussen; oder
o führt eine vorbereitende Aufgabe für eine Bewertung durch, die für die in Anhang III aufgeführten Anwendungsfälle relevant ist.
* KI-Systeme gelten immer dann als risikoreich, wenn sie ein Profil von Personen erstellen, d. h. wenn sie personenbezogene Daten automatisiert verarbeiten, um verschiedene Aspekte des Lebens einer Person zu bewerten, z. B. Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Standort oder Bewegung.
* Anbieter, deren KI-System unter die Anwendungsfälle in Anhang III … fällt, die aber der Ansicht sind, dass es kein hohes Risiko darstellt, müssen eine solche Bewertung dokumen-tieren, bevor sie es in Verkehr bringen oder in Betrieb nehmen. …“
Dies bedeutet einen wesentlichen Fortschritt gegenüber der vorherigen
Situation. Es fällt aber auf, dass der „worst case“, die Auslöschung der
Menschheit durch KI, nicht berücksichtigt wird. Außerdem ist bisher nicht
erkennbar, ob die Bestimmungen auch auf höheren inter-nationalen Ebenen,
z.B. der UNO, übernommen werden. Ebenso unklar sind die (möglichen)
Reaktionen der Großmächte USA und China (s.o.). Solange diese Mächte
Chancen sehen, ihre Ansprüche auf Weltherrschaft per KI durchzusetzen, kann
sich anscheinend niemand in völliger Sicherheit und politischer Freiheit
wähnen. Erst wenn die KI vollständiger Kontrolle, z.B. im Rahmen einer
internationalen Volksgesetzgebung, unterliegt, wird es möglich sein, die
hohen Ziele eines ‚Reichs der Freiheit‘ anzusteuern. Dazu gehört u.a. die
freie Assoziation freier Individuen, in der jeder Mensch seinen
Bedürfnissen und Fähigkeiten gemäß leben und arbeiten und seine
Persönlichkeit frei entfalten kann.
Literaturhinweise
Bezler, Peter 2022:Echte Demokratie durch KI, https://xn--bermorgen-p9a.org/
Borche, Astrid von 1977:Die Ursprünge des Bolschewismus. Die jakobinische Tradition in Russland und die Theorie der revolutionären Diktatur,München
Cockshott, W. Paul / Cottrell, Allin 2001: Alternativen aus dem Rechner. Für sozialistische Planung und direkte Demokratie , Köln
Ethik-Werkstatt 2008:Demokratie bei Rousseau, http://www.ethik-werkstatt.de/Rousseau_ Demokratie.htm
EU-Gesetz über künstliche Intelligenz 2024,In: https://artificialintelligenceact.eu/de/high-level-summary ; der vollständige Gesetzestext unter: https://artificialintelligenceact.eu/de/das-gesetz/
Hartmann, Klaus 1970:Die Marxsche Theorie, Berlin
Langer, Patrick 2016:Demokratie unter Perikles. Vorbild für heutige Staatsformen? https://www.grin.com/document/418591
Marx, Karl 1964:Die Frühschriften, Stuttgart
Müller, Alfred 2024: Marx und die direkte Demokratie , https://alfmueller.wordpress.com/category/direkte-demokratie/
Perikles 431 v.Chr.: Lobrede auf Athens Demokratie , in: https://www.wissen.de/lexikon/perikles-lobrede-auf-athens-demokratie
Robra, Klaus 2015:Wege zum Sinn, Hamburg
Robra, Klaus o.J. (2020):Ethik der Verhaltenssteuerung. Eine Neubegründung, München, https://www.grin.com/document/923015
Robra, Klaus o.J. (2021):Sind die Diktatur des Proletariats und die Bürokratie das Ende des Sozialismus? Die Frage nach Auswegen aus den Sackgassen, München, https://www.grin.com/document/1032082
Robra, Klaus 2022: Gut und Böse. Das Gute als Ursprung und Überwindung des Bösen – oder umgekehrt? Eine neue Hypothese ,München, https://www.grin.com/document/1297008
Robra, Klaus 2023: Künstliche Intelligenz und die Zukunft der Menschheit. Möglichkeiten und Gefahren, München, https://www.grin.com/document/1383067
Robra, Klaus 2024:Hegels System: Welterklärung oder Mystifikation? Mit Antworten seiner Kritiker und Kritikerinnen, München, https://www.grin.com/document/1490033
Schmidt, Manfred G. 2000:Demokratietheorien, Opladen
Sommer, Andreas Urs 2022: Eine Demokratie für das 21. Jahrhundert. Warum die Volks-vertretung überholt ist und die Zukunft der direkten Demokratie gehört, Freiburg im Breisgau
Steiger, Yolanda 2006:Direkte Demokratie – Utopie oder realistische gesellschaftliche Staatsform? In: http://socio.ch/demo/t_steiger.pdf
Störig, Hans Joachim 1961: Kleine Weltgeschichte der Philosophie , Stuttgart
Vorländer, Hans 2017:Grundzüge der athenischen Demokratie, Vorländer (2017) in: https://www.bpb.de>shop>izpb>demokratie-332>g...
Vorländer, Karl 1967: Philosophie der Neuzeit. Geschichte der Philosophie V, Reinbek
[1] Robra o.J. (2020), S. 305 f.
[2] Vorländer (2017) in: https://www.bpb.de>shop>izpb>demokratie-332>g...
[3] Attika bestand aus 10 Verwaltungsbezirken bzw. -regionen, den Phylen.
[4] In: https://www.wissen.de/lexikon/perikles-lobrede-auf-athens-demokratie
[5] In: https://www.grin.com/document/418591
[6] Vgl. Robra 2015, S. 227
[7] Wörtlich heißt es im Contrat Social,3. Buch, Kap. 15: „ … à l’instant qu’un peuple se donne des représentants, il n’est plus libre; il n’est plus.“ ( ‚ … sobald ein Volk sich Vertreter gibt, ist es nicht mehr frei; es existiert nicht mehr‘). Demnach führt repräsentative Demokratie zum Untergang des Volkes! Was Rousseau durchaus ernst zu meinen scheint, zumal er zuvor das frühe Gegen-Modell der attischen Direkten Demokratie ausführlich gelobt hat. Womit er sich deutlich auch von Montesquieu abgrenzt, der ja überzeugt war, dass in der Gewaltenteilung die Judikative sowohl die Legislative als auch die Exekutive zu kontrollieren vermag.
[8] Ethik-Werkstatt 2008
[9] Vgl. J.-J. Rousseau: Du Contrat Social, Paris (Classiques Larousse) 1953, S. 107, Anmerkung Nr. 2
10 Hierzu Rousseau: „Der Mensch ist frei geboren, und überall liegt er in Ketten.“ – und, sinngemäß: Alles ist gut so, wie es aus der Hand des Schöpfers kommt; alles wird schlecht in der Hand des Menschen.
[11] Vgl. Robra 2015, S. 227 ff.
[12] In: Ethik-Werkstatt 2008 a.a.O.
[13] In: Marx 1964, S. 45-47
[14] Alfred Müller 2024, S. 3
[15] K. Hartmann 1970, S. 515
15 K. Marx: Interview vom 3. Juli 1871 , in: MEW 17, S. 641
16 F. Engels: Kritik des SPD-Programms von 1891, MEW 22, S. 234, auch in: www.marx-forum.de/marx-lexikon/lexikon_f/friedlich.html ,
[18] Vgl. Robra o.J. (2021), S. 16 ff.
[19] Vgl. Robra 2015, S. 248 f.
[20] Steiger 2006, in: http://socio.ch/demo/t_steiger.pdf
[21] In: Sommer 2022, S. 188
[22] Linder in: Sommer 2022, S. 188 f.
23https://de.wikipedia.org/wiki/Organisation_für_direkte_Demokratie_durch_Volksabstimmung
24 Ernst Habermann: Evolution und Ethik. Skeptische Gedanken eines Ethik-Kommissars (1996), in: www.geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2013/9705/pdf/GU1996_S?9_38 ..., S. 31. Hervorhebungen durch mich.
25 Näheres hierzu: Robra o.J. (2020) bzw. 2022
26 Näheres hierzu: Robra 2023
27 KI und Grundrechte (2019), https://www2.deloitte.com/de/de/pages/public-sector/articles/ki-un ..., S. 3 ff.
28 Näheres hierzu: Robra o.J. (2021), S. 144 ff.
29 Bezler a.a.O. S. 5 f.
30 Hierzu: Klenner,Hermann 1998:Demokratie, Rechtsstaat und Gesellschaft, in: www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/91_z_klenner.pdf , S. 91 f.; ferner auch: Robra o.J. (2021), S. 41 ff.
31 H. Michelis, in: https://www.presseportal.de/pur/150908/5533321 , S. 1
32 Vgl. Robra 2024, S. 170 f.
33 Klaus Sojka: Öko-Ethik, Göttingen 1987, S. 59
34 Vgl. Karsten Brensing: Persönlichkeitsrechte für Tiere, Freiburg 2013, S. 198 f.
35 Vgl. Robra 2015, S. 518
36 Cockshott und Cottrell 2001 (1993), S. 245
[23] Vgl. Robra 2024, S. 179-181. Näheres hierzu ebd. S. 174 ff.
38 M. G. Schmidt 2000, S. 173
39 Bernbach in: Schmidt 2000, S. 172
40 In: https://artificialintelligenceact.eu/de/high-level-summary ; der vollständige Gesetzestext unter:
https://artificialintelligenceact.eu/de/das-gesetz/
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes?
Der Text ist eine umfassende Analyse der direkten Demokratie (DD) und der künstlichen Intelligenz (KI), wobei die Vor- und Nachteile beider untersucht und die Möglichkeit einer Synthese erörtert werden. Es werden historische Beispiele, philosophische Theorien (Rousseau, Marx) und moderne Konzepte (Demokratischer Ökosozialismus) betrachtet.
Was sind die Vorteile der Direkten Demokratie (DD) laut dem Text?
Die Vorteile umfassen eine stärkere Bürgerbeteiligung, die Förderung des Gemeinwohls, eine Reduzierung der Macht von Parteien und Medien, und die Möglichkeit, Gesetze zu schaffen, die wirklich von der Mehrheit der Bürger gewünscht werden. Im Vergleich zur Monarchie und Aristokratie gewährt sie politische Grundrechte.
Welche Nachteile der Direkten Demokratie (DD) werden im Text genannt?
Die Nachteile beinhalten die Möglichkeit, dass der Adel (oder andere privilegierte Gruppen) weiterhin Einfluss ausüben, die Schwierigkeit, soziale Ungleichheit zu überwinden, die Gefahr von staatlicher Autokratie und Despotie, und die Tatsache, dass Abstimmungen allein noch kein politisches Handeln bewirken. Außerdem wird kritisiert, dass Rousseaus Begriff des Souveräns unklar ist.
Was sind die Vorteile der Künstlichen Intelligenz (KI) laut dem Text?
KI kann als Gegenmittel gegen die Herrschaft der Parteien dienen, objektive und nachprüfbare Informationen liefern, und ein breiteres Spektrum an politischen Vorstellungen berücksichtigen. Künstliche neuronale Netze ermöglichen parallele Informationsverarbeitung und assoziative Speicherung.
Welche Nachteile der Künstlichen Intelligenz (KI) werden im Text erwähnt?
Es gibt Bedenken hinsichtlich des Verlustes der menschlichen Kontrolle, der Gefahr von Manipulation, der Möglichkeit von Diskriminierung und der existenzielle Bedrohung der Menschheit. Es besteht ein Mangel an internationalen Vereinbarungen zur Überwachung und Kontrolle der KI.
Welche Rolle spielt Jean-Jacques Rousseau in dem Text?
Rousseau wird als wichtiger Theoretiker der direkten Demokratie vorgestellt. Seine Ideen, insbesondere der "Gesellschaftsvertrag" und der "Gemeinwille", werden analysiert und kritisch gewürdigt. Kritisiert wird aber seine fehlende Berücksichtigung sozioökonomischer Faktoren.
Wie wird Karl Marx im Zusammenhang mit Direkter Demokratie diskutiert?
Marx' Unterstützung für die attische Demokratie und seine Kritik an Hegel werden hervorgehoben. Seine Analyse der französischen Menschenrechtserklärung und seine Betonung der sozialen Emanzipation werden erörtert. Die Pariser Kommune wird als Beispiel für eine Räterepublik und Direkte Demokratie genannt, auch wenn Marx seine Meinung später änderte.
Was versteht Andreas Urs Sommer unter "direkt-partizipatorischer Demokratie"?
Sommer betont die Notwendigkeit der steten Einübung und Teilhabe der Bürger an politischen Prozessen. Die direkt-partizipatorische Demokratie soll eine Selbstbefragungs- und Selbstvergewisserungsdemokratie sein, die den Möglichkeitssinn anstachelt und zur Empathie erzieht.
Welche Rolle spielt die "Elektronische Demokratie" in dem Text?
Die elektronische Demokratie, also die Nutzung des Internets für Abstimmungen, Stimmendelegation etc., wird als Chance und Gefahr zugleich gesehen. Es wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, das Internet vor Missbrauch zu schützen und die digitale Spaltung zu überwinden.
Was ist der Demokratische Ökosozialismus, und wie passt er zu DD und KI?
Der Demokratische Ökosozialismus wird als möglicher Ausweg aus den Problemen der sozialen Frage und der Öko-Krise präsentiert. Die KI und die DD werden für ihre zahlreichen Nachteile kritisiert, um damit einen Demokratischen Ökosozialismus zu fordern.
Was sind die wichtigsten Literaturhinweise in diesem Text?
Zu den wichtigsten Literaturhinweisen gehören Werke von Peter Bezler, Astrid von Borche, W. Paul Cockshott / Allin Cottrell, Ethik-Werkstatt, Karl Marx, Alfred Müller, Perikles, Klaus Robra, Manfred G. Schmidt, Andreas Urs Sommer, Yolanda Steiger, Hans Joachim Störig und Karl Vorländer. Diese Werke bieten weitere Einblicke in die diskutierten Themen.
- Quote paper
- Klaus Robra (Author), 2024, Direkte Demokratie plus Künstliche Intelligenz. Ein Weg zum Reich der Freiheit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1495819