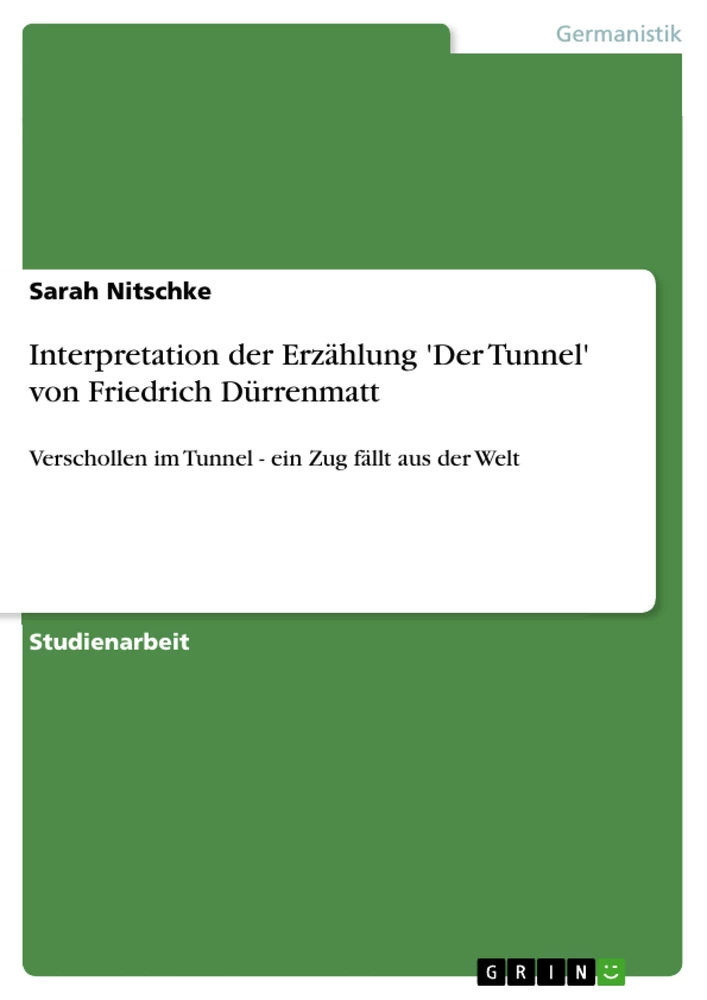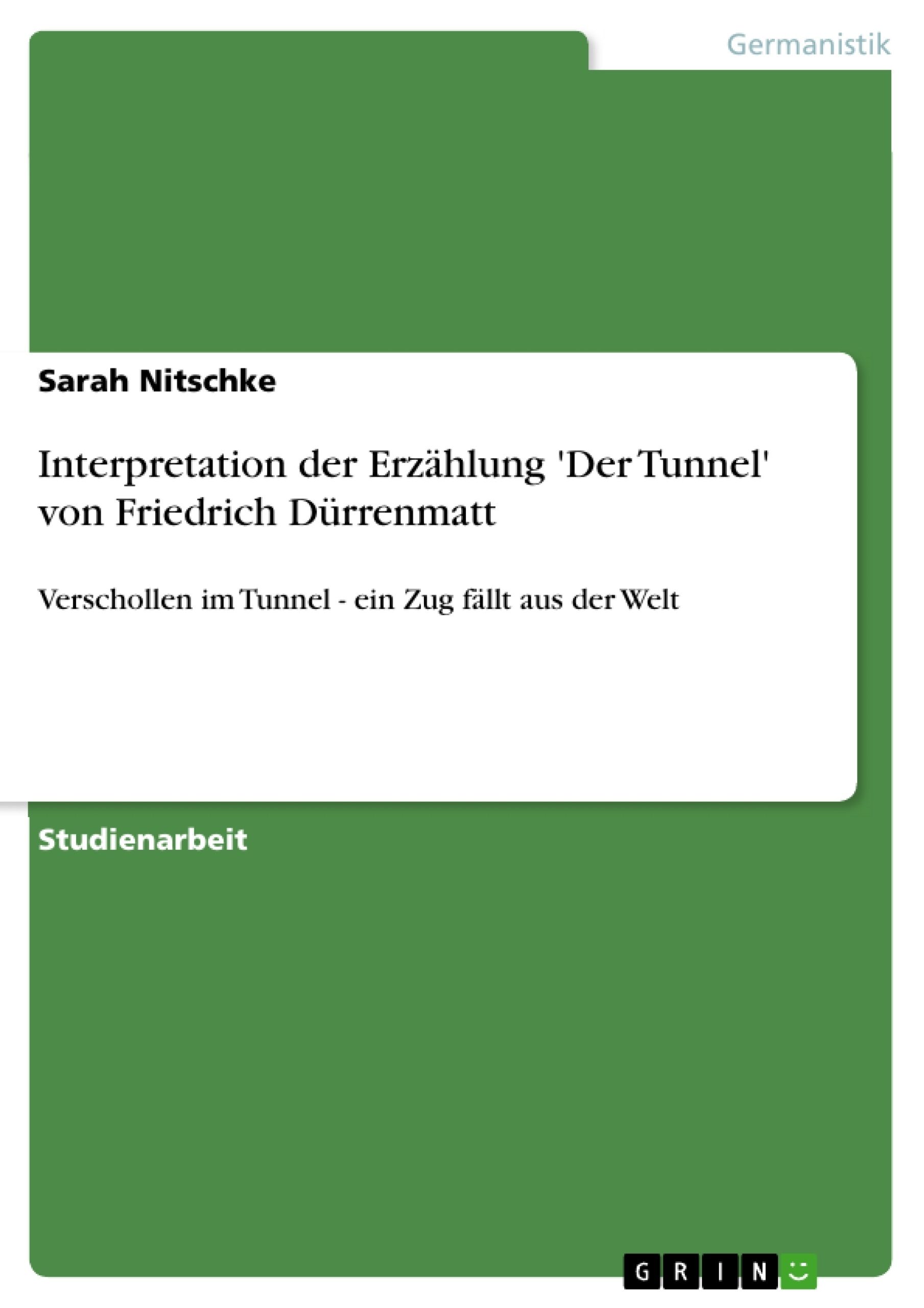Die Fünfziger Jahre in Westdeutschland sind eine sozial- und kulturhistorisch höchst bedeutsame Übergangsphase, welche die Gegenwart und auch die Zukunft Deutschlands durch ihre Auswirkungen prägen, da in dieser Zeit ein großer gesellschaftspolitischer Umbruch stattfand. Die Fünfziger Jahre waren die Zeit des Wiederaufbaus, die eine Normalisierung des Alltagslebens mit sich zog. Durch Modernisierungen bildeten sich auch „die materiellen Voraussetzungen und geistigen Dispositionen heraus, durch die in den darauf folgenden Jahren eine auch äußerlich verwandelte Gesellschaft entstehen konnte“.
Den repräsentativen Gattungsbereich dieser Periode voller gesellschaftspolitischer Errungenschaften stellte der Roman dar. In dieser Zeit plädierten einige Schriftsteller für den Magischen Realismus, „für die ´Überwindung der Realität´, ´Sprengung der sogenannten Wirklichkeit´ sowie einen Aufschwung ins Nichtreale“ .
Die Versuche in nichtrealistischen Erzählweisen lasen sich wie Antworten auf die selbstgewisse Stabilisierung der politischen Systeme.
Die Menschen kämpften mit inneren Schwierigkeiten. Kritische und selbstkritische Themen prägten die Literatur der 1950er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland. Die verdrängte NS-Zeit, der Krieg und der technologische Fortschritt wurden aufgearbeitet. Man unternahm Versuche der Ich-Erkundung, Nachdenken über Schuld und Nichtschuld, um Gewissheit über seine Identität zu erlangen. Wachstum, Konsum und Wohlstand schienen wichtige Themen zu sein, die von Schriftstellern oft in Satiren kritisch betrachtet wurden. Die Angst vor einem
Dritten Weltkrieg (atomare Gefahr, Korea-Krieg) förderte ein Vorschreiten in neue Modelle der Wirklichkeitserfassung .
Das Jahr 1952 wird als Wende in der Geschichte der Erzählprosa Westdeutschlands, Österreichs und der Schweiz betrachtet. In diesem Jahr fanden sich viele „Erzählungen, mit denen Muster einer parabolischen, phantastischen und sprachexperimentellen Kleinform geschaffen wurden“. Viele bedeutende Texte dieser Zeit wurden bemerkenswerter Weise nicht in Westdeutschland, sondern in Österreich, der Schweiz u.A. verfasst. Hierzu gehört auch Friedrich Dürrenmatts Erzählung Der Tunnel.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung - Die Literatur der 50er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland
- Die Erzählung „Der Tunnel“ von Friedrich Dürrenmatt
- Biografische Daten Friedrich Dürrenmatts
- Inhaltsangabe und Interpretation der Erzählung Der Tunnel
- Das Verschollensein in Dürrenmatts Erzählung „Der Tunnel“
- Verschollensein im Nichts?
- Suche nach Identität und Sinn
- Suche im Glauben
- Suche nach Wahrheit
- Schluss
- Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert Friedrich Dürrenmatts Erzählung „Der Tunnel“ im Kontext der Literatur der 1950er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland. Sie untersucht die Bedeutung des Verschollenseins in der Erzählung und beleuchtet die Suche nach Identität, Sinn und Wahrheit im Angesicht des Absurden.
- Die Literatur der 1950er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland
- Die Bedeutung des Verschollenseins in Dürrenmatts Erzählung „Der Tunnel“
- Die Suche nach Identität und Sinn
- Die Suche nach Wahrheit im Angesicht des Absurden
- Die Rolle des Zufalls und der Unberechenbarkeit in Dürrenmatts Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die literarische Situation in der Bundesrepublik Deutschland der 1950er Jahre. Sie zeigt auf, wie die Zeit des Wiederaufbaus und die Verarbeitung der NS-Vergangenheit die Literatur prägten. Die Erzählung „Der Tunnel“ wird in diesem Kontext als ein Beispiel für die Suche nach Sinn und Identität in einer unsicheren Welt vorgestellt.
Das Kapitel über Friedrich Dürrenmatt skizziert seine Biografie und beleuchtet die prägenden Einflüsse auf sein Werk. Es wird auf seine literarischen Anfänge, seine Erfolge im Theater und seine Auseinandersetzung mit gesellschaftlich-politischen Problemen eingegangen.
Die Inhaltsangabe und Interpretation der Erzählung „Der Tunnel“ analysiert die Handlung und die zentralen Motive. Es wird die Situation des Zuges im Tunnel, die Reaktion der Passagiere und die Suche des Zugführers nach dem Lokomotivführer dargestellt. Die Erzählung wird als eine Allegorie auf die Suche nach Sinn und Wahrheit in einer Welt voller Absurdität interpretiert.
Das Kapitel über das Verschollensein in Dürrenmatts Erzählung „Der Tunnel“ untersucht die verschiedenen Aspekte des Verschollenseins. Es wird die Frage nach dem Verschollensein im Nichts, die Suche nach Identität und Sinn sowie die Suche nach Wahrheit im Glauben und in der Welt beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Literatur der 1950er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland, Friedrich Dürrenmatt, die Erzählung „Der Tunnel“, das Verschollensein, die Suche nach Identität, Sinn und Wahrheit, das Absurde, der Zufall, die Unberechenbarkeit, die Angst vor dem Nichts.
- Citation du texte
- Sarah Nitschke (Auteur), 2010, Interpretation der Erzählung 'Der Tunnel' von Friedrich Dürrenmatt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/149051