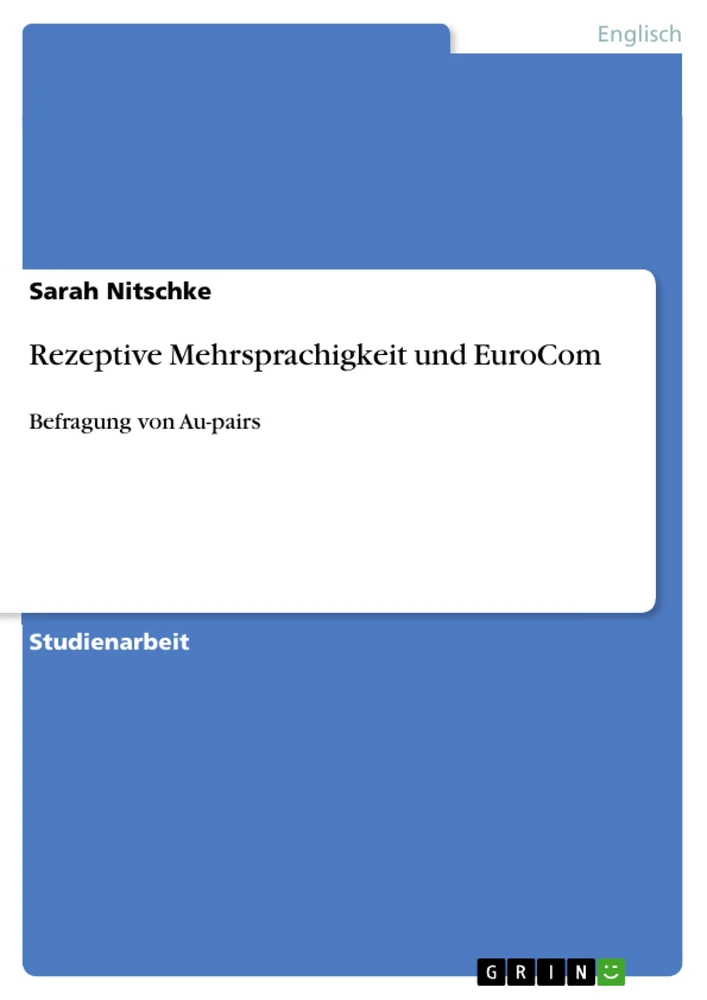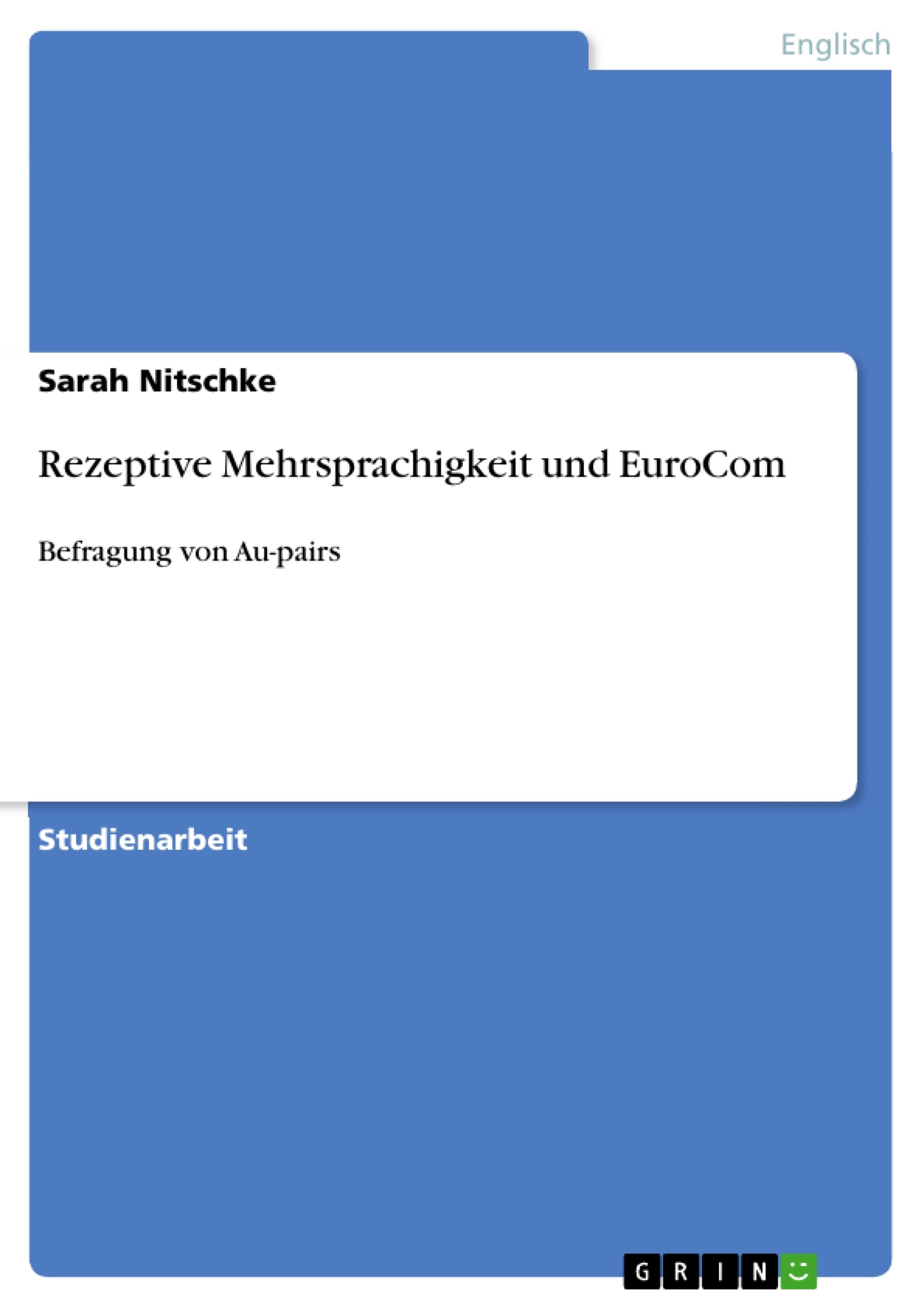According to the White Book of the Council of Europe, every EU citizen should have the opportunity to learn at least two foreign EU languages. In der Realität sieht diese Situation jedoch anders aus, denn nur Länder, deren Muttersprache nur innerhalb der Grenzen ihres Landes gesprochen wird, haben diese Anforderung bereits erfüllt. Finnen, beispielsweise, lernen neben ihrer zweiten offiziellen Sprache Schwedisch, noch Englisch und eine weitere Sprache. Im Vergleich dazu lernen Menschen, die die Weltsprachen Englisch oder Spanisch als Muttersprache sprechen, meistens nur noch eine weitere Sprache. Diese Tatsache deutet darauf hin, dass sich Sprecher von Weltsprachen auf Englisch als lingua franca verlassen, die von Menschen anderer Muttersprachen gelernt werden müsse. Es wird davon ausgegangen, dass die lingua franca die einzige und ultimative Lösung zur Überwindung von Sprachbarrieren sei. Fakt ist, dass sich Europa nach dem Zweiten Weltkrieg politisch und gesellschaftlich weiter entwickelt hat, was zu einer internationalen politischen Zusammenarbeit im Sinne der Friedenssicherung sowie zu starken Verflechtungen im Bereich der Wirtschaft führte. „Grenzüberschreitende Kooperation und Kommunikation, berufliche Mobilität und Migration bestimmen heute den Alltag in Europa“. Für die Menschen entsteht daher die Voraussetzung des sprachlichen und kulturellen Kennenlernens der EU-Länder, um „die wirtschaftlichen, kulturellen und persönlichen Möglichkeiten Europas in vollem Maße wahrnehmen“ zu können. Demnach heißt das Leitziel Mehrsprachigkeit. Dieser Begriff wird jedoch unterschiedlich verwendet. Mehrsprachigkeit ist die Kenntnis nicht nur der Muttersprache und von mehr als einer Fremdsprache. Eine Zweitsprache kann auf viele verschiedene Arten angeeignet werden, in jedem Alter, für verschiedene Zwecke und in unterschiedlich großen Schritten. Zu unterscheiden gibt es den geleiteten und den spontanen Spracherwerb, worauf ich in meiner Arbeit jedoch nicht weiter eingehen möchte. Ein Sprachenlerner muss des Weiteren eine mehrsprachige Kompetenz entwickeln, was bedeutet, dass ein Sprecher auch über die Kompetenz verfügen muss, mit Spracherfahrungen umzugehen und sie auf das Lernen weiterer Sprachen zu transferieren. Diese mehrsprachige Kompetenz will die Forschergruppe der EuroCom durch rezeptive Kompetenzen ausbauen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rezeptive Mehrsprachigkeit
- Auswertung der Fragebögen
- Laientheorien der Au-pairs zum Thema Mehrsprachigkeit
- Laientheorien der Au-pairs zum Thema Rezeptive Mehrsprachigkeit
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Konzept der rezeptiven Mehrsprachigkeit und befragt Au-pairs über ihre Erfahrungen und Meinungen dazu. Die Studie analysiert, wie Au-pairs, die eine zweite Sprache nahezu muttersprachlich beherrschen, rezeptive Mehrsprachigkeit wahrnehmen und bewerten.
- Rezeptive Mehrsprachigkeit als Konzept
- Die Rolle der lingua franca (Englisch)
- Laientheorien zum Mehrsprachigkeitserwerb
- Vergleich aktive/passive Mehrsprachigkeit
- Semikommunikation im skandinavischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet den europäischen Kontext der Mehrsprachigkeit, basierend auf dem Weißbuch des Europarates, das die Notwendigkeit des Erlernens von mindestens zwei Fremdsprachen betont. Sie stellt den Kontrast zwischen Ländern mit weniger verbreiteten Muttersprachen (z.B. Finnland) und Ländern mit Weltsprachen (z.B. Englisch, Spanisch) dar, wobei der Fokus auf der Rolle von Englisch als Lingua Franca liegt. Die Einleitung führt in das Thema der rezeptiven Mehrsprachigkeit ein und beschreibt den Forschungsansatz der Arbeit: die Befragung von Au-pairs über ihre Erfahrungen mit Mehrsprachigkeit, insbesondere im rezeptiven Bereich.
Rezeptive Mehrsprachigkeit: Dieses Kapitel definiert und erörtert das Konzept der rezeptiven Mehrsprachigkeit. Es hinterfragt die Annahme, dass Englisch als Lingua Franca die einzige Lösung für mehrsprachige Kommunikation in Europa sei und präsentiert alternative Perspektiven, die auf passivem Sprachverständnis basieren. Der Fokus liegt auf den noch offenen Forschungsfragen zu rezeptiver Mehrsprachigkeit: Was genau kann verstanden werden? Welche Rolle spielt Weltwissen? Der Unterschied zwischen aktiver und passiver Mehrsprachigkeit wird diskutiert und die Bedeutung des Hörverständnisses als Schlüsselkompetenz für den Fremdsprachenerwerb betont. Der Begriff der Semikommunikation wird als verwandtes Konzept eingeführt, insbesondere im skandinavischen Kontext, wo gegenseitiges Verständnis zwischen nahe verwandten Sprachen auch ohne aktives Sprechen besteht.
Schlüsselwörter
Rezeptive Mehrsprachigkeit, Lingua Franca, Englisch, Au-pairs, Zweitspracherwerb, Semikommunikation, Laientheorien, Mehrsprachige Kompetenz, Interkulturelle Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Rezeptive Mehrsprachigkeit bei Au-pairs"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Konzept der rezeptiven Mehrsprachigkeit und analysiert die Erfahrungen und Meinungen von Au-pairs dazu. Der Fokus liegt auf der Wahrnehmung und Bewertung rezeptiver Mehrsprachigkeit durch Au-pairs, die eine zweite Sprache nahezu muttersprachlich beherrschen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Rezeptive Mehrsprachigkeit als Konzept, die Rolle von Englisch als Lingua Franca, Laientheorien zum Mehrsprachigkeitserwerb, ein Vergleich zwischen aktiver und passiver Mehrsprachigkeit und Semikommunikation im skandinavischen Kontext. Die Studie basiert auf der Auswertung von Fragebögen, die die Laientheorien der Au-pairs zu Mehrsprachigkeit und rezeptiver Mehrsprachigkeit erfassen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu rezeptiver Mehrsprachigkeit, ein Kapitel zur Auswertung der Fragebögen (mit Unterkapiteln zu den Laientheorien der Au-pairs) und ein Schlusswort. Die Einleitung beleuchtet den europäischen Kontext der Mehrsprachigkeit und den Forschungsansatz. Das Kapitel zur rezeptiven Mehrsprachigkeit definiert und erörtert das Konzept und diskutiert offene Forschungsfragen. Die Auswertung der Fragebögen präsentiert die Ergebnisse der Befragung der Au-pairs.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Rezeptive Mehrsprachigkeit, Lingua Franca, Englisch, Au-pairs, Zweitspracherwerb, Semikommunikation, Laientheorien, Mehrsprachige Kompetenz und Interkulturelle Kommunikation.
Welche Rolle spielt Englisch in der Studie?
Englisch spielt als Lingua Franca eine zentrale Rolle. Die Studie hinterfragt jedoch die Annahme, dass Englisch die einzige Lösung für mehrsprachige Kommunikation in Europa sei und präsentiert alternative Perspektiven, die auf passivem Sprachverständnis basieren.
Was ist Semikommunikation und welche Rolle spielt sie?
Semikommunikation wird als verwandtes Konzept zur rezeptiven Mehrsprachigkeit eingeführt, insbesondere im skandinavischen Kontext. Sie beschreibt ein gegenseitiges Verständnis zwischen nahe verwandten Sprachen, auch ohne aktives Sprechen.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung beleuchtet den europäischen Kontext der Mehrsprachigkeit basierend auf dem Weißbuch des Europarates. Sie vergleicht Länder mit weniger verbreiteten Muttersprachen und Ländern mit Weltsprachen und beschreibt den Forschungsansatz der Arbeit: die Befragung von Au-pairs zu ihren Erfahrungen mit Mehrsprachigkeit.
Was ist das Fazit der Arbeit (Schlusswort)?
(Der Inhalt des Schlussworts ist nicht explizit in der Vorschau angegeben. Es fasst vermutlich die Ergebnisse der Studie und die wichtigsten Erkenntnisse zusammen.)
Welche Methode wurde angewendet?
Die Studie verwendet eine qualitative Forschungsmethode basierend auf der Auswertung von Fragebögen, die an Au-pairs gerichtet waren.
- Quote paper
- Sarah Nitschke (Author), 2010, Rezeptive Mehrsprachigkeit und EuroCom, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/149047