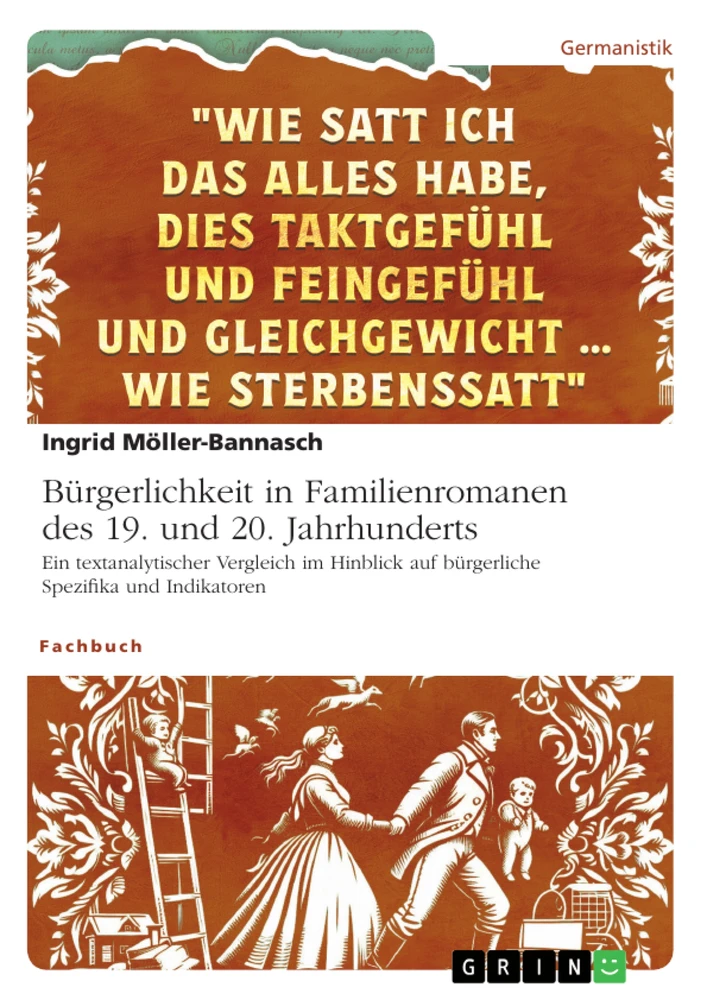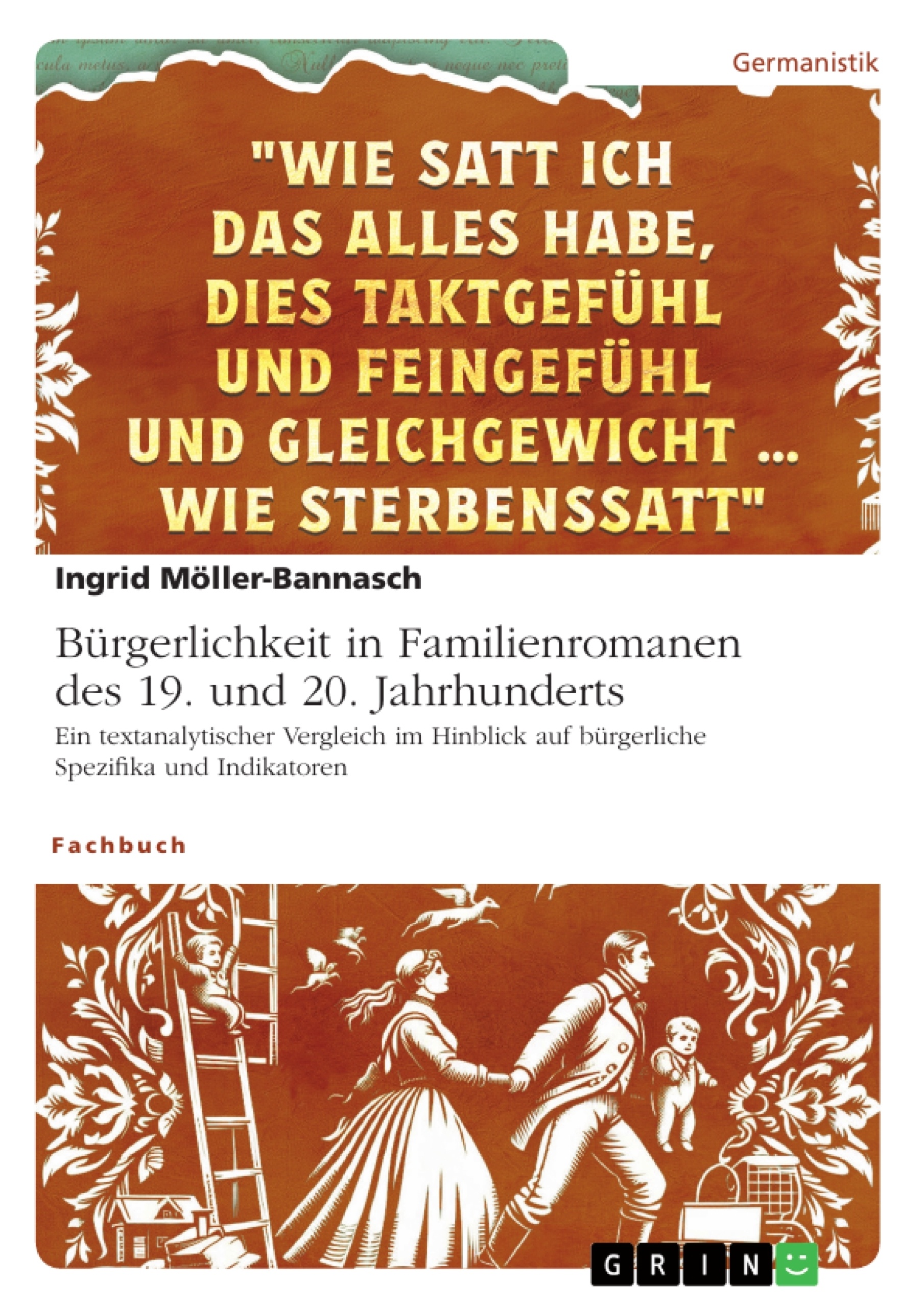Woher kommen eigentlich die Werte, die unsere Eltern uns als Kind vermittelt, die wir dann als Haltungen verinnerlicht haben und diese als so bedeutsam ansehen, dass wir sie auch an unsere Kinder weitergeben? Da wären u.a. die Bedeutung von Bildung, einem qualifizierten Beruf, von Eigentum, um nur einige wenige zu nennen. Warum ist uns der Aufstiegsgedanke wichtig, der Wunsch nach Statussymbolen? Das Schlüsselwort ist „Bürgerlichkeit“ - und was wir darunter zu verstehen haben, wird uns im Familienroman, dem bürgerlichen Genre schlechthin, vor Augen geführt. Die agierenden Familien in den Romanen „Buddenbrooks“ (Thomas Mann), „Es geht uns gut“ (Arno Geiger) und „Im Schatten des untergehenden Lichts“ (Eugen Ruge) sind ein Spiegel ihrer Zeit und ähneln dem, was wir als Generation X und Y in unseren Herkunftsfamilien erlebt haben. Es wird für den Leser verblüffend sein, wenn er erkennt, wieviel von den Werthaltungen des Bürgertums aus dem 19. Jahrhundert er in seinen eigenen Wertvorstellungen wiederfindet!
Inhalt
1.Vorwort
2.Einleitung
3.Aufbau der Arbeit
4. Das Genre: Familienroman/Generationenroman
5. Autoren-Biographisches in den Romanen
5.1 Autobiographisches im Roman „Buddenbrooks“ von Thomas Mann
5.2 Autobiographisches im Roman „ Es geht uns gut“ von Arno Geiger
5.3 Autobiographisches im Roman „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ von Eugen Ruge
6. Erzählform und Stilistik in den Romanen
6.1 „Buddenbrooks“
6.2 . Die modernen Familienromane
7. Temporale und zeitgeschichtliche Situierung der Romane
7.1 Das 19. Jahrhundert im Spiegel des Romans „Buddenbrooks“
7.2 Historie im österreichischen Roman „Es geht uns gut“ von Arno Geiger
7.2.1 Die Geschichte Österreichs im „bürgerlichen 19.Jahrhundert“ - ein Exkurs
7.2.2 Die Zeit des „Austrofaschismus“
7.2.3 Die Zweite Republik seit
7.3 Zeitgeschichtliche und gesellschaftliche Bezüge im Roman „In Zeiten des abnehmenden Lichts“
7.3.1 Die 50er Jahre und ihre Präsenz im Buch
7.3.2 Die 60er Jahre und ihre Präsenz im Buch
7.3.3 Die 70er Jahre und ihre Präsenz im Buch
7.3.4 Die 80er Jahre und ihre Präsenz im Buch
7.3.5 Abwanderung und Ausreise
8. Stadträumliche Situierung der Familienromane
8.1 Lübeck
8.2 Wien
8.3 Ost -Berlin
9. Das Haus als bürgerliche Wohnstätte - Standort und Wohnkultur
9.1 Bürgerliches Wohnen im 19. Jahrhundert bei den Buddenbrooks
9.2 Die Villa der Familie Sterk in Wien
9.3 Die Wohnsituation in der DDR: Geschosswohnung und bürgerlicher Besitz
10. Bürgertum und Bürgerlichkeit im „langen 19. Jahrhundert“
10.1 Das Wirtschaftsbürgertum
10.2 Das Bildungsbürgertum
11. Das Bürgertum im 20. Jahrhundert - bürgerliche Lebensform im Wandel und das Fortleben bildungsbürgerlicher Traditionen
11.1 Der Niedergang der bürgerlichen Denk- und Lebensformen zu Beginn des 20. Jahrhunderts
11.2 Das Bürgertum im Nationalsozialismus
11.3 Das Bürgertum nach 1945 in Westdeutschland und in Österreich
11.3.1 Restauration in den 50er Jahren
11.3.2 Das Bürgertum in den 60er und 70er Jahren - Kritik und Protest
11.3.3 Bürgerliches Selbstverständnis seit den 80er Jahren und bürgerliche Traditionen heute
12.Bürgertum in der DDR
12.1 Wirtschaftsbürgertum in der DDR
12.2 Bildungsbürgertum in der DDR
12.2.1 Der Marxismus im Denken der „sozialistischen Intelligenz“
12.2.2 Geschichtswissenschaft(ler) in der DDR
13. Bürgerliche Normen und Kultur
13.1 Arbeit und Selbstständigkeit in der bürgerlichen Lebensführung - das Leistungsethos des Bürgertums
13.2 Kleidung und Reinlichkeit
13.3 . Der Bürger in der politischen und sozialen Verantwortung als Amtsträger
13.4 Politische Aktivität in der DDR
14. Die Bedeutung von Religion und Kirche im Bürgertum
14.1 Glaubensrichtungen in der protestantischen Kirche des 19. Jh
14.2 Feminisierung der Religion - Die Religion wird weiblich
14.2.1 Herkunft und Verbürgerlichung
14.2.2 . Der Ausbildungsweg zum Pfarrer
14.2.3 Geistlichkeit im Familienroman „Buddenbrooks“
14.5 Religion im Familienroman des 20. Jahrhunderts
14.5.1 Religion und religiöses Leben in der DDR
14.5.2 Der Kommunismus und die Partei als Erlösungsorgan und Religionsersatz
15. Bildung als bürgerlich-kulturelle Praxis
15.1 Geschlechtscharaktere
15.2 Bildung in der Schule des 19. Jahrhunderts
15.3 Das Bildungswesen für Mädchen im 19. Jahrhundert
15.4 Der steinige Weg zur Bildungsberechtigung und Berufstätigkeit der Frau
15.5 Das Bildungswesen in der DDR
15.6 Non-verbale und verbale Verhaltenskultur/Kommunikation im Bürgertum
15.6.1 . Der Sozialwert der bürgerlichen Sprache - Hochsprache und Dialekt
15.6.2 Das Gespräch als Konversation
15.6.3 Der konversationelle Ablauf der Mahlzeit als ein Ritus im Familienleben
15.7 Die bildungsrelevante Bedeutung der Schrift- und Schreibkultur im Bürgertum
15.7.1 Bildung durch/mit Literatur
15.7.2 Literatur und Kultur in der DDR
15.8 Hochkultur als Betätigungs- und Bildungsfeld des Bürgertums
15.8.1 Bildung durch Musik
15.8.2 Bildung durch Malerei
15.8.3 Das Theater als Bildungsstätte
16. Reisen im 19. und 20. Jahrhundert
16.1 Die Bildungs- und Qualifikationsreise
16.2 Erholungs- und Badereisen - der Bürger und das Meer
16.3 Reisen in Zeiten des Massentourismus- eine Form der kulturellen Begegnung
17. Gesellschaftstreffen, Feierlichkeiten und geselliger Verkehr - ein Charakteristikum der bürgerlichen Familie
17.1 Die sozialistische Feierkultur
17.2 Der Spaziergang als Symbol bürgerlicher Geselligkeit
17.3 Bürgerliche Vereinskultur
18.Dienstboten/-mädchen in bürgerlichen Haushalten
18.1 Die Herkunft der Dienstmädchen
18.2 Das Arbeitsverhältnis des Dienstmädchens
18.3 Hausarbeiten im Dienstverhältnis
18.4 Kindermädchen - kein gewöhnliches Dienstpersonal
18.5 Zwischen Distanz und Identifikation - das Verhältnis des Dienstpersonals zur Bürgerfamilie
18.6 Dienstmädchen als Objekt bürgerlicher Sexualphantasien
18.7 Das Ende der Dienstboten-Zeit
19. Das bürgerliche Ehe- und Liebesideal
19.1 Die ( Liebes-) Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau im Bürgertum
19.3 . Ehe und Geschlechterbeziehung in der ehemaligen DDR
19.4 Voreheliche Liebe und sexuelle Beziehungen im Bürgertum und heute
19.5 „Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet! Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang.“
19.5.1 Ehescheidung und Familienauflösung im 19. Jahrhundert
19.5.2 Ehescheidung im 20. Jahrhundert
19.5.3 Scheidung in der DDR
20. Familie und „Ganzes Haus“ - Die Familienorientierung im Bürgertum
20.1 Der bürgerliche Familienverband
20.2 Die moderne Klein-/Kernfamilie im Familienroman
20.3 Historisch verortete Männlichkeit - das Vaterbild und männliche Leitbilder im Wandel der Zeiten
20.3.1 Männlichkeitsideale im Bürgertum des 19. Jahrhunderts
20.3.2 Das Männlichkeits- und Vaterbild im 20. Jahrhundert
20.4 . Die Rolle der Frau und Mutter in der bürgerlichen Familie
20.5 Außerfamiliäre und berufliche Tätigkeiten einer Bürgersfrau
20.6 Die „bürgerliche Frau“ im 20. Jahrhundert - der Wandel der Mutter- und Frauenrolle im zeitgenössischen Familienroman von Arno Geiger
20.6.1 Die Frau in ihrer Doppelbelastung
20.7 Wie sozialistische Familienpolitk in der DDR Familie und Elternschaft prägte
20.8 Die Frau in der DDR
21. Lebensformen neben der klassischen Familie
21.1 Nichteheliche Lebensgemeinschaften
21.2 Ein-Eltern-Familien
21.3 „Stieffamilien“
21.4 Ehelosigkeit und Individualisierung
22. Kindheit und Erziehung als Spiegel des Eltern-Kind-Verhältnisses
22.1 Rousseau - Entdecker und Reformer der Kindheit
22.2 Kindheit im Bürgertum
22.3 Erziehungsziele
22.3.1 Erziehung im 19. Jahrhundert
22.3.2 Erziehung im 20. Jahrhundert
22.3.3 Erziehung in der DDR
23.Die Psychologie von Geschwisterbeziehungen
24. Beziehungen zwischen den Generationen - füreinander, miteinander, gegeneinander
24.1 . Transgenerationelle Übertragungen und Weitergaben
24.2 Beziehungen zwischen Jung und Alt - ein einvernehmliches und konfliktreiches Miteinander
24.3 Generationenbeziehungen in der DDR
24.4 Alte Menschen im Familienroman
24.5 Altern in der DDR
24.6 Großeltern im 18./19. Jahrhundert
24.7 Großeltern im modernen Roman
25. Motive des “Verfalls“ und der Auflösung von Familien in den Romanen
25.1 Nachlassende Vitalität physischer und psychischer Art
25.2 Ökonomisch-wirtschaftlicher Verfall
25.3 Verlust von „bürgerlichen Tugenden und Instinkten“ (Entbürgerlichung)
25.4 Fehlende Kommunikation und Individualisierung (versus Familiensinn)
25.5 Traumatisierung der Kriegsgeneration
25.6 Die veränderte soziale Praxis, mit geerbten Dingen umzugehen
27. Nachwort - Persönliche Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Quellenangaben
1. Vorwort
„Familie“ und „Bürgerlichkeit“, das sind Begriffe, die untrennbar zusammengehören und wenn ein Friedrich Merz davon spricht, dass er „bürgerlich“ geworden ist, als sein erstes Kind geboren wurde, meint er im Grunde eine Kultur- und Lebensform, die ihre Grundlage im Bürgertum des 19. Jahrhunderts hat.
Wir, die wir in Familien aufgewachsen sind, wissen oft gar nicht, woher es rührt, dass wir bestimmte Werthaltungen gutheißen und andere ablehnen und warum wir, wenn wir selber Kinder erziehen, ihnen bestimmte Werte mit auf den Weg geben wollen.
In dieser Ausarbeitung geht es um die Fragestellung: Woher kommen die Werte, die unsere Eltern uns als Kind vermittelt, die wir dann als Werthaltungen verinnerlicht haben und diese als so bedeutsam ansehen, dass wir sie auch an unsere Kinder weitergeben. Als da wären u.a. der Leistungsgedanke und die Bedeutung von Bildung, einem qualifizierten Beruf, oder von Eigentum, um nur einige wenige zu nennen. Warum ist uns der Aufstiegsgedanke wichtig, der Wunsch nach Statussymbolen? Dazu habe ich die drei Romane „Buddenbrooks“ (Thomas Mann/TM)), „Es geht uns gut“ (Arno Geiger/AG)) und „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ (Eugen Ruge/ER)) analysiert. Das Schlüsselwort ist „Bürgerlichkeit“ - und was wir darunter zu verstehen haben, wird uns im Familienroman, dem bürgerlichen Genre schlechthin, vor Augen geführt. Die agierenden Familien in den von mir ausgewählten Romanen sind ein Spiegel ihrer Zeit und führen uns Familienleben mit all seinen Konflikten, die es zwischen Generationen geben kann, vor Augen und ähneln dem, was wir als Generation X und Y in unseren Herkunftsfamilien erlebt haben. Es wird verblüffend sein für den Leser, wenn er erkennt, wieviel von den Werthaltungen des Bürgertums aus dem 19. Jahrhundert er in seinen eigenen Wertvorstellungen wiederfinden wird!
Nicht zuletzt aus diesem Grunde sagte der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzki anlässlich des 50. Todestags von Thomas Mann im Jahre 2005, in Erinnerung an den Verfasser des Urmodells eines Familienromans, dass bis heute der Familienroman an Bedeutung und Aktualität in keineswegs verloren habe, sondern vom Urmodell „hinübergerettet und modernisiert“ wurde. Wie recht er hatte: Noch im gleichen Jahr wurde der Roman „Es geht uns gut“ von Arno Geiger veröffentlicht, eine österreichische Variante der Buddenbrooks1 und mit dem Preis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Die Jury begründete bei der Vergabe des deutschen Buchpreises die Auszeichnung damit, dass er „Vergänglichkeit und Augenblick, Geschichtliches und Privates, Erinnern und Vergessen in eine überzeugende Balance“ bringe. Gleiches gilt für Eugen Ruges 2011 erschienenen Roman „Im Schatten des untergehenden Lichts“, auch dieser wird als ein DDR-Familienroman Buddenbrookscher Prägung bezeichnet und mit der gleichen Auszeichnung prämiert.
Als Gründe für die Popularität des Familienromans könnte man weiterhin anführen: dass „die Gattung[Familienroman] dem Bedürfnis der Zeit als eine Art groß angelegte Zusammenfassung des vergangenen Jahrhunderts gerecht“ wird2 oder: die Popularität des Familienromans als „eine Reaktion auf die in den Pop-Romanen der 90er Jahre dargestellte Single-Existenz“ zu sehen ist.3
Gerade weil die 1- bis 2-Kind-Familie heute verbreitet ist, das Zusammenleben homosexueller Paare zunimmt, die Scheidungsquote bei 30% liegt, in Großstädten wie Berlin 50% aller Haushalte 1-Personen-Haushalte sind und viele Familien vor der Auflösung stehen, werden umfangreiche Familien- und Generationen-Chroniken interessant. Gleichzeitig wächst damit das Interesse an der Geschichte der eigenen Familie, zu erkennen an der sich immer weiter verbreitenden Familien- bzw. Ahnenforschung.
Aber ist es vielleicht nicht auch so, dass wir, die wir in einer Zeit der Globalisierung leben, in der in vielen Lebensbereichen Orientierungslosigkeit und Anonymisierung herrschen, der Familie als kleine soziale Einheit wieder eine größere Relevanz zukommen lassen? „Familie bleibt etwas wie eine allgemeingesellschaftlich akzeptierte Sehnsucht nach Orientierung und umreißt den so genannten privaten Raum des Einzelnen.“4 Die Frage nach der eigenen Vergangenheit beschäftigt Leser und weckt das Interesse am Familienroman. Die Renaissance dieses Genre erinnert uns daran, “.dass man den elementaren Strukturen Verwandtschaft genauso wenig entkommt wie dem Atemholen. Beides vollzieht sich, ganz egal, ob es gefällt oder nicht.“5
Mit der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten gewann die Sehnsucht nach dem Erkunden der eigenen Herkunft an Bedeutung - Eugen Ruges Roman „Im Schatten des untergehenden Lichts“ ist ein Beispiel dafür.6
Statt jedoch das Klischee von familiärer Eintracht und vom trauten Heim zu bedienen, erzählen die Romane von Krise, Zusammenbruch und Degeneration, doch ist es gerade das, was es uns Lesern möglich macht, sich mit der Handlung zu identifizieren, denn nicht selten hat man in seiner eigenen Familie Ähnliches erlebt. Literatur ist ein Fundus allgemeingültiger Erfahrungen, und besonders der Familienroman bietet dazu Identifikationsmöglichkeiten. Dies erkannten bereits die Leser vor hundert Jahren nach der Lektüre der Buddenbrooks. („.genau wie bei uns!.“)
Bis in unsere Zeit, in der Familienromane so beliebt sind, dass sie sogar renommierte Auszeichnungen erhalten, wird in den Laudatien immer wieder auf den BuddenbrooksRoman als Klassiker des Genres verwiesen, der seit seinem Erscheinen 1901 eine erstaunliche Karriere gemacht hat. Schon damals nannte man ihn „zersetzend“7, bestätigt aber hat sich eher die Kritik von Samuel Lublinski im Berliner Tageblatt:
„Er [Der Roman] wird wachsen mit der Zeit und noch von vielen Generationen gelesen werden: eines jener Kunstwerke, die wirklich über den Tag und das Zeitalter erhaben sind, die nicht im Sturm mit sich fortreißen, aber mit sanfter Überredung allfällig und unwiderstehlich überwältigen.“8
Und so ist es: Jede Generation findet die ihr eigenen Bedeutungen und für sie Aktuelles und Bleibendes in diesem Meisterwerk,9 auch wenn 1901, als Thomas Mann seinen Roman herausgab, das Morbide und Dekadente, das Unbürgerliche größere Resonanz fand als das Familienthema, weil es eher den Nerv der Zeit traf. Der Roman war schon damals für den Leser ein Spiegel der gegenwärtigen Situation, in ihm erkannte er seine Gebrochenheit und Nervosität wieder10 und fand beim Lesen Orientierungs- und Lebenshilfe.
Thomas Mann war ein „Seelenkenner nicht nur seiner selbst. Sondern auch ein Seelenkenner der Welt, die ihn umgab“11 - und sein Roman gibt uns bis heute noch viele nachdenkenswerte Impulse.
Bei den von mir ausgesuchten modernen Familienromanen wird uns in Arno Geigers Roman eine neue Form der Familie und des Miteinanders zwischen den Generationen vor Augen geführt. In ihm verbirgt sich die Frage, welche Bedeutung Familie in einer zunehmend individualisierenden Gesellschaft heute noch hat und welche Ursachen es für ein verändertes Familienbild gibt.
Eugen Ruge verknüpft in seinem Roman biographische Elemente mit dem Leben in der DDR und will es so vor dem Vergessen retten: ein Roman über die individuellen Folgen historischer Zäsuren.
Literatur ist geschichtlich geworden, das zeigt sich in den Familienromanen. Ich werde den Klassiker mit den aktuell bedeutendsten deutschsprachigen Familienromanen linear und horizontal vergleichen und herausfinden, wie sich literarische Prozesse im Familienroman vollziehen und erklären lassen, warum bestimmte Thematiken und Haltungen dominant werden, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen und wie bestimmte Faktoren zwischen den Romanen interagieren.
2. Einleitung
„Ich möchte begreifen, was mich ergreift…
Schwerpunkt meiner Arbeit ist es, bedeutende Familienromane auf ihre Bürgerlichkeit und ihre bürgerlichen Elemente hin zu untersuchen. Aus der Vielzahl der Romane habe ich die drei herausgegriffen, die mich innerlich am meisten zum Nachdenken über die Welt und des In-der-Welt-Seins anregten und halfen, zur Selbst- und Welterkenntnis zu gelangen, denn: „Nur das ist ein gutes Buch, das mich verändert.“
Die zur Untersuchung gewählten Roman-Beispiele entspringen meiner privaten Lektüre und repräsentieren gleichzeitig breite Strömungen des Publikumsgeschmacks (Verkaufszahlen, Preise, Auszeichnungen). Die Textauswahl bezieht sich auf ausgezeichnete, von der Literaturkritik hervorgehobene und prämierte Bücher, populäre Vertreter des Genres. Die thematischen Schwerpunkte der Analyse und Interpretation aber können auf jeden Familienroman angewandt werden, so dass der Leser eigene Lieblingsromane diesbezüglich einordnen kann.
Alle drei Romane thematisieren die Familien der Autoren und reflektieren dessen Vergangenheit in der eigenen Familie mit ihren Familienbeziehungen, und in allen
Romanen sind die Familien in der horizontalen und vertikalen Ebene präsent. Es treten mehrere Personen einer Generation und mehrere Generationen auf, deren Informationswert, wie man sehen wird, unterschiedlich ist: die eine Person hat einen hohen Informationswert, die andere nur einen geringen.
Jeder Autor formuliert seine lebensgeschichtliche Chronologie und zeittypische generationstypische Ereignisse unter dem Gesichtspunkt, was subjektiv von Bedeutung war, und konzipiert aus der Retroperspektive die eigene Lebensgeschichte und Entwicklung des biographischen Ichs. Von großer Bedeutung sind und waren für ihn stets das soziale Umfeld und die sozialen Bezüge, und da es männliche Autoren sind, zeigt sich in manchen Szenen auch eine maskuline Perspektive.
Meine Ausführungen basieren auf Romanen, in denen jeweils Drei-Generationen-Familien im Mittelpunkt stehen und in denen Großeltern, Kinder und Enkel die Repräsentanten historischer Generationen in deutschsprachigen Ländern sind.
Anhand einer komparativen Analyse unternehme ich den Versuch, lebensgeschichtliche Erfahrungen bürgerlicher und literarischer Familien und ihren Wandel im 19. und 20. Jahrhundert in Westdeutschland, Österreich und der DDR zu untersuchen und dabei Familienromane als Zeugnis bürgerlicher Elemente einem Vergleich zu unterziehen.
Es ist ein historischer, ein linearer und vertikaler Vergleich, den ich anstelle, und eine Komparatistik der besonderen Art: eine Gegenüberstellung deutschen Familienlebens im 19. Jh. und des österreichischen im 20. Jh. Bei Eugen Ruge findet sich schon aufgrund der Lokalisierung im östlichen Teil Deutschlands eine Abweichung in mancherlei Punkten (Erwerbs- Bildungsstruktur im Bürgertum, Mentalitäten, Kirchlichkeit/Religiosität...).
Meine Arbeit hat einen deskriptiven Charakter: Ich untersuche die Romane im Hinblick auf die dargestellten Familienmuster und deren Bürgerlichkeit und überprüfe das Familienideal des Bürgertums im 19. Jahrhundert auf den Grad der Realisierung in den Romanen anhand der Drei-Generationen-Familien und der dort innerfamilial erlebten Kindheit, Jugend und Erwachsenenzeit.
Thomas Manns RomanBuddenbrooks, Arno GeigersEs geht uns gutund Eugen RugesIn Zeiten des abnehmenden Lichtsstellen literarische und gleichzeitig autobiographisch motivierte Texte dar. Wie wird aber Bürgerlichkeit in einem Roman Ende des 20. Jahrhunderts in Österreich und in einem Roman, der das Leben in der früheren DDR vermittelt, erfasst? Die Präsenz des Bürgerlichen zeigt sich in vielerlei Hinsicht und ist eine aufregende Entdeckerreise in die Territorien von Wohnung, Familienleben, Beruf, Bildung, Sozialisation und Kleidung des Bürgertums, um nur einige zu nennen.
Durch die Fokussierung auf die Kategorie des Bürgerlichen im österreichischen Roman und in Ruges DDR-Roman erfolgt eine Neuakzentuierung. Thomas Manns RomanBuddenbrooksist ein „Stück Seelengeschichte des europäischen Bürgertums überhaupt“, so sagte Th. Mann selbst12. Ich werde die literarische deutsche Bürgerfamilie des 19. Jahrhunderts mit der österreichischen Familie der Gegenwart und mit einer Familie aus der DDR vergleichen, deren Bürgerlichkeit bzw. Individualität erfassen und herausfinden, was ihnen gemeinsam ist bzw. was sie von einander abhebt. Wie wird bürgerliche Lebenswelt und -kultur aufgegriffen und dargestellt und wie und wo finden sich die Werte, Normen, Verhaltensweisen des Bürgertums und seine Praktiken in den Romanen? Wie unterscheiden sich die Sphäre des Privaten und der familiäre Schauplatz? Wie sieht es mit den geschlechtsspezifischen Unterschieden und der innerfamilialen Rollenstruktur aus? Ist die Familie zu allen Zeiten das Fundament und die Vermittlungsinstanz von Kultur und Werten? Wie sieht das Alltagsleben in der Familie aus? Ist der Stellenwert von Gehorsam und Autorität im Familienalltag jederzeit zu finden? Wie gestaltet sich die Verbindung von Arbeit/Beruf und Familienleben, welche bürgerlichen Distinktionen spielen eine Rolle?
Ich thematisiere die innerfamilialen Wandlungsprozesse und zeitgeschichtlichen Veränderungen in den familialen Rollen und die Beziehungen zwischen den Mitgliedern der Familie, d.h. ich gehe der Frage nach, wie die Beziehung von Frauen und Männern im ehelich-familialen Lebenszusammenhang und wie die Ausgestaltung von Mutterschaft und Vaterschaft aussehen.
Der Wandel der Vater- und Mutterrolle ist ein zentrales Thema beim Vergleich der Romane, ebenfalls von großer Bedeutung: das Thema „Paarbeziehungen“, deren Wandel mit der veränderten Rolle der Frau nicht außer Acht gelassen werden darf.
In dem Zusammenhang stellt sich dann die Frage: Ist es ein „Defizit an Bürgerlichkeit“, wenn die Rolle der Frau als Hausfrau, Ehefrau und Mutter abgelehnt wird und sich stattdessen eine akademische Bildung und eine Erweiterung der beruflichen Zukunftsperspektiven für die Frau im literarisch modernen Familienbild findet?
Ich kontrastiere die Familien und die sozialen Rollen der Familienmitglieder miteinander, lasse den Autor sprechen und belege die Behauptungen mit Zitaten aus den Romanen.
Die Romane sind auf den ersten Blick sehr unterschiedlich: Es gibt drei Orte, zwei Epochen, über die letzten beiden Jahrhunderte verteilte Daten und auch eine Differenz in den Erscheinungsjahren der Romane von hundert Jahren. Wir lernen unterschiedliche Kulturen kennen und drei Romanfamilien: die Kaufmannsfamilie als eine Großfamilie einerseits, eine kleine österreichische bürgerliche Familie andererseits und eine Familie in der DDR, die zur Schicht der Intelligenz gehört.
Doch es sind Gemeinsamkeiten vorhanden: Die drei Romane gehören zum Genre der Familienromane, erzählen eine Familiengeschichte und verknüpfen diese mit historischen gesellschaftlichen Ereignissen. Da gibt es die Einsamkeit der Protagonisten: bei Thomas Buddenbrook, bei Philipp und bei Sascha, und da ist ein Schluss, der ein „Versickern der familiären Linie“13 nahelegt. In den Buddenbrooks spiegelt sich in dem Bild der übrig gebliebenen Frauen das Ende der Welt des Großbürgertums, der einsame Held bei Arno Geiger verlässt das Land seiner Familie und löst damit das Familienerbe auf, Sascha aus der DDR-Familie zieht in den Westen, verlässt seine Familie, um nach der Wende wieder bei dem an Demenz erkrankten Vater zu sein, dann aber reist er alleine nach Mittelamerika, um die Orte seiner Großmutter zu erleben.
Qualitative Studien zeigen die soziale Realität der Romane. Ich ergänze Interpretation und Inhaltsanalyse mit der Aufnahme von Daten aus der aktuellen Familienfoschung/ Forschungsliteratur, so dass die Wechselbeziehung vom sozialen und kulturellen System und den Romanfiguren, die die Normen und Sanktionen auf der Handlungsebene transformieren, verdeutlicht werden. Übereinstimmungen und Unterschiede bzw. Besonderheiten werden von mir interpretiert und verglichen und mit quantitativen Forschungsergebnissen zum spezifischen Thema in Zusammenhang gebracht, z.B. Heiratsalter, Scheidung, Generationenbeziehung, Wohn-, Arbeits- und Geselligkeitsformen und der Kontakt zwischen den Familiengenerationen.
3. Aufbau der Arbeit
„Beherrsche die Sache, dann folgen die Worte…
(Marcus Porcius Cat…
Im Mittelpunkt meiner Arbeit steht, wie o.g., die vergleichende Analyse der Familie und ihre Bürgerlichkeit in den von mir ausgewählten Familienromanen, in denen über Jahrhunderte hinweg unterschiedliche und gemeinsame Muster von Familie wiederkehren und je nach historischem Ort divergieren.
Überblickt man die existierende Sekundärliteratur zu diesem Thema, erkennt man, dass ihm viele Spezialuntersuchungen zu Teilbereichen gewidmet sind. Ich möchte das Phänomen der bürgerlichen Distinktionen in den beispielhaften Roman-Familien im 19. und 20. Jahrhundert an sich in den Mittelpunkt rücken.
Die Arbeit besteht aus theoretischen Teilen, in denen es um Begriffserklärungen, Historie des Bürgertums und Aspekte der Bürgerlichkeit geht und den textpraktischen Teilen mit dem zugrunde gelegten Textkorpus der Romanwerke. Diese werden hinsichtlich der thematischen Aspekte interpretiert und plausibilisiert. Auftretende Wiederholungen sind ein uneleganter Nebeneffekt, zeigen aber stets den übergeordneten Gedanken in den untersuchten Teilbereichen des Phänomens „Bürgertum und Familie“.
In meiner Arbeit setze ich mich mit der Fragestellung auseinander, wie der soziale und historische Wandel individuelle Lebensverläufe und Strukturen, sozio-ökonomische Lebensbedingungen, tradierte Einstellungen, individuelle Lebensorientierungen, das Beziehungsverhalten von Menschen, Geschlechterrollen, -verhältnisse und -beziehungen, den Kontext des familialen Geschehens und die Erwerbsarbeit veränderte.
Die vergleichende Gegenüberstellung der Werke macht erkennbar, wie der Wandel der Lebensbedingungen aufgrund der notwendigen Anpassungsprozesse im Verhalten auch eine Veränderung von Werten, Einstellungen und eine andere alltägliche Lebensführung mit sich brachte.
In diesem Zusammenhang kann zeitgenössische und auch ältere Literatur, auch wenn Fiktion nie faktentreu ist, sondern die Realität der jeweils zeitgenössischen Gesellschaft verfremdet, über die Grenzen des Faches der Literaturwissenschaft hinaus Bezüge und Diskurse öffnen und Erkenntnisse aus Psychologie und Soziologie mit einbeziehen und literarische Motive interdisziplinär betrachten, z.B. werden von mir Ergebnisse von soziologischen und historischen Forschungen über die Geschichte der Familie in Deutschland Entsprechungen in den Familienbildern der Romane gegenübergestellt und dabei die familiäre Situation und die Eltern-Kind-Beziehung in Vergangenheit und Gegenwart beleuchtet.
Meine Vorgehensweise ist folgendermaßen:
In einem ersten Schritt wird es um das Genre des Familien- bzw. Generationenromans gehen und die darin auftretenden Generationen.
Damit eng verbunden sind die Autorenbiographien, die sich in den Inhalten der Romane wiederfinden. Erzählstruktur und Sprache werden in aller Kürze, da in zahlreichen Publikationen bereits erläutert, gestreift.
Im dann folgenden Teil werden von mir Ähnlichkeiten und Unterschiede in der temporalen zeitgeschichtlichen Situierung der Romane im historisch-gesellschaftlichen und stadträumlichen Kontext dargelegt. Ein Augenmerk lege ich auf das Haus als Symbolik bürgerlicher Wohnstätte.
Nach der Vorstellung der Romane und ihrer Autoren referiere ich die Bestimmung der Begriffe ,Bürger’, ,Bürgertum’ und ,bürgerliche Gesellschaft’ und ihre Qualifikationskriterien.
Der darauf folgende Teil stellt das Bürgertum in Geschichte und Gegenwart vor, während danach dessen gesellschaftlich-historische Phänomene in den Romanen untersucht und mit Zitaten belegt werden.
Das Herzstück meiner Arbeit bildet die Darstellung der Sphären bürgerlicher Kultur und Lebenswelt. Ich informiere u.a. über das bürgerliche Selbstverständnis, die Selbstdarstellung, Politik, den Einfluss von Kirche und Religion und über die dem Bürgertum eigene Form der Kommunikation.
Ein Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich von Ehe und den Beziehungen zwischen Ehemann und Ehefrau, gefragt wird nach Heiratskreisen, Wahl der Ehepartner und der Bedeutung der Scheidung früher und heute.
In einem weiteren Schritt beschäftige ich mich mit der Frage, wie die Romane die Familie mit ihren unterschiedlichen Vorstellungswelten als Ort der Erziehung und als Vermittlungsinstanz in den Blick rücken und durch das Erzählen ein Ensemble von Familie in einer entfernteren und gegenwärtigeren Epoche widerspiegeln. Die ausgewählten Romane greifen Aspekte der Erziehung und Beziehung auf und skizzieren Familienleben, zum Teil mit vergleichbaren Konstellationen, wie z.B. die Großelternfamilien, Erziehungsstile, Beziehungen, bürgerliche Distinktionen etc., aber auch Varianten und
Differenzen im innerfamilialen Leben. Diese Vergleichsanalyse wird zeigen, wie sehr Familienbilder im historischen und soziokulturellen Kontext verankert sind.
Danach stelle ich ausführlich die Inhalte bürgerlicher Kindererziehung vor und gehe der Frage nach, welche Stellung Töchter und Söhne hatten/haben und wie die Geschlechterrollen sich in den Romanen darstellen. Die Veränderungen moderner Geschlechterverhältnisse durch die Erziehungs- und Bildungskonzepte für Jungen und Mädchen werden von mir besonders in den Blick genommen.
Ein weiteres Kapitel beschäftigt sich mit den Generationenbeziehungen im Roman. Ich lege die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung der alten Menschen in der Familie, insbesondere auf die Großeltern, die ihre Rollen im Roman unterschiedlich ausfüllen.
Schließlich greife ich den Begriff des „Verfalls“ auf, der immer wieder im Zusammenhang mit Familienromanen genannt wird. Ich bezeichne es lieber als „Auflösung“ der Familien und werde versuchen, Ursachen dafür zu finden. Neu wird der transgenerationale Aspekt traumatischer Kriegserlebnisse sein, der sich auf Arno Geigers Roman bezieht und den Bereich der Epigenese streift.
Nun zur Sprache: Mein Buch soll nicht den Berg ungelesener geisteswissenschaftlicher Fachliteratur weiter wachsen lassen, nein, es zielt auf ein breiteres, am Thema interessiertes Publikum. Da stellte sich mir die Frage, wie ich den Spagat zwischen einem wissenschaftlichen und dem populärwissenschaftlichen Schreibstil lösen sollte. Ich entschied mich dafür, nach mehrmaligem Korrekturlesen, statt der wissenschaftlichen Termini, Begriffe aus der Alltagssprache zu wählen, die den LeserInnen bekannt sind und die für mich inhaltlich Dasselbe aussagten. Ein wiederkehrendes Element ist hierbei eine klare Sprache, ohne Schachtelsätze, oftmals reiht sich ein Hauptsatz an den anderen ohne ausgefeilte Formulierungen, ein Stil jenseits üblicher germanistischer Gepflogenheiten, aber so möchte ich die Sachverhalte in wenigen verständlichen Worten greifbar machen.
4. Das Genre: Familienroman/Generationenroman
Es ist das Schicksal jeder Generation, in einer Welt unter Bedingungen leben zu müssen, die sie nicht geschaffen ha…
(John F. Kenned…
Das Merkmal aller Familienromane ist es, die Geschichte einer Familie zu erzählen. Sie bildet das Gerüst des Romans und die Grundlage für Ereignisse und Themen.
Nicht nur Arno Geiger ist der Ansicht, dass alle im Privaten angesiedelten Romane Familienromane sind.14 „Alle Romane setzen eine Gattungstradition des romanesken Familienepos fort, die fortan zugleich einen schmalen Grat zwischen Modernismus, populärer Unterhaltungsliteratur und dokumentarischer Fiktion beschreibt.“15
Gero von Wildert definiert den Familienroman wie folgt: „Ein stofflich im Problemkreis des bürgerlichen oder adligen Familienlebens, den Konflikten und Bindungen des Zusammenlebens, im weiteren Sinne auch noch der Generationen und der Ehe angesiedelter Roman (...) meist spielen beim anspruchsvollen Familienroman umgreifende und allgemein soziale Fragen hinein.“16
Familienromane wurden in der Vergangenheit oftmals als Frauendichtung, als altmodischrealistisch oder weiblich-sentimental deklassiert17 “.wie so vieles wurde nicht selten das, was akademischen Lesern als zu affektbesetzt erscheint, als ,weiblich‘ diffamiert. Durch diesen normativen Zugriff sind kontinuierliche Formen des gefühlsintensiven Lesens wie auch dessen Sujets und Gattungen abqualifiziert worden.“18 Sicherlich bietet ein Familienroman Möglichkeiten emotionaler Befriedigung, aber es lassen sich, so werden wir sehen, auch durchaus reflektierte Schlussfolgerungen aus ihm ziehen.
Mit den Familienromanen von Thomas Mann und der Forsyth Saga wurde diese Gattung so populär, dass sie bis heute ein erfolgreiches und populäres literarisches Genre ist. Es entfaltet eine besondere Wirkung beim Leser, weil in ihm stets ein Stück Wirklichkeit und menschlichen Daseins enthalten ist, es typische und repräsentative Züge von uns Menschen herausarbeitet und an Erfahrungen, Gewohnheiten, Wünschen und Wertvorstellungen anknüpft - auf diese Art finden wir als Leser uns in den Figuren und Handlungen wieder.19
Bereits im 19. Jahrhundert produzierte man Unterhaltungsliteratur für den Geschmack des bürgerlichen Lesepublikums und es waren Realisten, Naturalisten und Thomas Mann als ein Autor der ästhetischen Moderne20, die auf besonders großes Interesse stießen. Speziell der Familienroman galt (gilt) als ein Ausdruck bürgerlichen Schreibens.In ihm zeigt sich eine Fokussierung auf den privaten Bereich und bürgerliche Individualität spiegelt sich in der Ausformulierung des bürgerlichen Wertekanons und in der ihm eigenen Sprachkultur wider.
Im Familienroman besteht immer ein enger Zusammenhang zwischen Familienleben und Historik, oder genauer gesagt: Die Familie wird zu einem Modell historischer Kontinuität.Der Romancier bereitet ein historisch entferntes Geschehen für den zeitgenössischen Leser didaktisch auf 21 und reflektiert Probleme und Fragen der jeweiligen Zeit im privaten Raum der Familie, so dass eine Geschichte/Geschichtlichkeit des menschlichen Daseins entsteht und der Eindruck vermittelt wird, dass menschliches Dasein „grundsätzlich von gesellschaftlichen Umständen und zeitgeschichtlichen Ereignissen geprägt ist.“22 Solche Romane können ein Dokument einer Gesellschaft und eines Zeitalters sein und somit Leben bewahren.23
In der zeitgeschichtlichen Verankerung werden exemplarische Situationen und Themen der Zeit im Denken und Verhalten, in Moden und Beziehungsverhältnissen in der figuralen Umsetzung geschildert und reflektiert verankert.24 Die Familie ist folglich der Ort, an dem eine erfahrungsgelenkte Geschichtsschreibung wahrgenommen wird.25
Auch wenn Familienromane Modelle historischen Erzählens sind, sind es weniger gesellschaftliche Großereignisse oder politische Einschnitte, die in die alltägliche Lebensführung hineinreichen, stattdessen geht der Autor mit historischem Wissen „unscharf“ um26: historische Geschichte erscheint „intimisiert“, auf das eigene oder familiäre Erleben beschränkt und auf die Generationengeschichte übertragen.
Wir erwarten vom Familienroman aber auch gar nicht, wie wir es von Texten der Historiker tun, dass historische Ereignisse objektiv beschrieben werden, wichtiger ist, wie das historische Panorama in die fiktionale Geschichte integriert wird und wie unterschiedliche soziale und generationelle Meinungen und Lebensformen zu Wort kommen. Geschichte wird nur ausschnitthaft wiedergegeben und dabei wird stets auf Wissensbestände des Lesers zurückgegriffen.27 Der Autor gestaltet das Verhältnis von Fiktion und historischer Dokumentation, indem er Recherchen und Dokumente vermischt, so wie z.B. Arno Geiger, dem die Vertrautheit der Geschichte bzgl. des persönlich Erlebten wichtiger war als das Suchen nach der historisch getreuen Wiedergabe - diese Möglichkeit bietet eben nur die Fiktion und nicht die wissenschaftlich-historische Art des Erzählens.28
Familien werden im Roman zu soziokulturell geprägten Orten, wo gesellschaftliche Werte und die dazugehörigen Verhaltensnormen vermittelt werden und entsprechen der jeweiligen Zeit.Im 19. Jahrhundert im Roman von Thomas Mann zeigt sich z.B. die damalige hierarchisierte Welt, deren Mitglieder Rollen und Aufgaben ebenso übernahmen wie Verbindlichkeiten und Verpflichtungen.
Form und Thema des zeitgenössischen deutschen Familienromans sind geprägt von einer zeitlichen, epochen- und generationsüberbrückenden Dynamik29, er „erzählt […] immer auch Varianten des Freudschen Familienromans, bei dem es bekanntlich um die Verhandlung archaischer Erbschaften und die Bearbeitung kindlicher Enttäuschungen geht.“30
Mit der Verknüpfung von Biographischem und Historie, von Fakten und Fiktion, Erfindung und Authentizität konstruiert der Autor Geschichte neu - mit dem Wunsch nach neuen Aspekten der historischen Wahrheit. „Erinnerungen bedürfen [,..| eines Quantums Fiktion, um sie wirkungsvoll zu inszenieren..“31 Dem Leser erschließt sich die Vergangenheit, indem die kleine Geschichte auf die große Geschichte übertragen und ihm mit der Verbindung von familiärer und geschichtlicher Thematik eine Überschaubarkeit des „großen Ganzen“ gegeben wird.
Eine besondere Wirklichkeitsnähe vermitteln die Romane durch ihre dem Leser bekannten Schauplätze und die Einbeziehung belegter Vorgänge und Personen eines bestimmten Zeitabschnitts. Hierbei zeigt sich das Hauptprinzip des Genres: „das Erzählen entlang einer Generationenfolge, die Auslegung des familiären Mikrokosmos als Fallbeispiel historischer Zeitgeschichte.“32
Die Begriffe Familien- bzw. Generationenroman werden im engen Zusammenhang oft synonym gebraucht, da generationale Konzepte dazu dienen, den Wandel im Umgang mit der Vergangenheit“ zu kommentieren, zu erklären und zu bewerten und mit den Erinnerungen des Individuums die Geschichtsschreibung zu ergänzen. „Das Konzept der Generation hilft hier in der Form literarischer Narrative eine komplexe, postmoderne Gegenwart, in der Fragen von historischer Wahrheit und Zeitzeugenschaft problematisch geworden sind, zu erklären.“33
Die Kontinuität in der Abfolge der Generationen sichert die Unsterblichkeit und versinnbildlicht Wiederkehr und Dauerhaftigkeit in der Familie.34 Das Metzler Lexikon Literatur spricht von der „Generationenproblematik“ des Familienromans.35 Generationenromane umfassen wie die vorliegenden Familienromane eine „mehrere Generationen umfassende Handlung“36 mit der zentralen Dimension des Erinnerns. Man kann hier von „Erinnerungstexten“ sprechen, wohingegen der Familienroman die persönliche Identität und die Familiengeschichte verknüpft und „der historische Rahmen von prägender Bedeutung ist und einer speziellen Aufarbeitung bedarf, die durch Erinnerungsarbeit vollzogen wird.“37
In den Familienromanen finden sich mindestens drei Generationen: So erzählt Thomas Manns Roman von einer Reihe von Generationen der Familie Buddenbrook auf dem Hintergrund des Zeitraums von 42 Jahren.
Stets gibt es im Mikrokosmos der Familie die Abfolge von erziehenden und erzogenen Generationen: Die Eltern geben die kulturellen Muster einer Gesellschaft und das Familienkapitel, d.h. die psychosozialen Ressourcen an die nachgeborenen Kinder weiter. Um die vorhergehenden Generationen nicht lediglich als „Zuträger“ der Enkelgenerationen mit einer weniger wichtigen Vergangenheit zu sehen oder einer „Mythisierung“ der Großelterngeneration Vorschub zu leisten, wählt Arno Geiger einen Kunstgriff:
„Letzten Endes war es das Nachdenken über den Familienroman, das mich veranlasst hat, die Zeitebene aufzubrechen und im Präsens zu schreiben.“38
In Arno Geigers Roman erzählt jede Generation, seien es Großeltern-, Eltern- oder Kindergeneration, einen Zeitabschnitt aus ihrer Perspektive, die Großelterngeneration über die 30er Jahre, die Elterngeneration über die 40er und 50er und 70er Jahre, Philipp über das Jahr 2001.
Im DDR-Roman von Eugen Ruge wiederum finden sich Erlebnisse der Aufbaugeneration, der in der DDR sozialisierten Generation und der Wende-Generation.
Diese modernen Familienromane orientieren sich zunächst auf eine Generation der Zeitzeugen des Nationalsozialismus’ mit oftmals traumatischen Erfahrungen von Kriegsund Fluchterlebnissen. Diese bleiben wegen der Sprachlosigkeit zwischen den Generationen unausgesprochen. Geigers Erzählung der Kriegserlebnisse ist als Dokument einer Erfahrungs- und Erlebniswelt der Kriegsgeneration anzusehen, in dem das Unausgesprochene mit der Phantasie des Autors neu imaginiert wird.
Auf diese Kriegsgeneration folgt die Generation der ,Kriegskinder‘, die späten 68er, die sich in ihren Wert- und Welthaltungen von ihren Eltern unterscheidet, gefolgt von der
,Enkelgeneration‘, den Kindern der 68er Generation, mit der Erfahrung des wiedervereinigten Deutschlands.39
Geigers und Ruges Romane zeigen, wie verschieden das kulturelle Erbe und die Verhaltensdispositonen der Generationen zwischen West und Ost sind: Generationen der 50er Jahre haben, je nachdem, ob sie in West oder Ost groß wurden, ein ganz unterschiedliches Weltbild, gleiches gilt für die Generationen, die die Erfahrung des NS- Regimes machten, sie erleben unter dem Einfluss des offiziellen Antifaschismus in der DDR eine andere weltanschauliche Sozialisation. Dies ist, so werden wir im folgenden Kapitel sehen, der Biographie der Autoren geschuldet.
5. Autoren-Biographisches in den Romanen
„Wir können unser Leben nur verstehen, indem wir zurückschauen, aber wir können es nur leben, indem wir vorwärtsblicken…
(Soren Kierkegaar…
Einen Familienroman zu schreiben ist für den Schriftsteller Teil seiner Erinnerungsliteratur und „die Fokussierung auf ein fiktives oder autobiographisches Ich, das sich seiner/ihrer Identität gegenüber der eigenen Familie und der […] Geschichte vergewissert“.40 Es geht ihm„um die Integration des eigenen Ichs in einem Familienzusammenhang, der andere Familienmitglieder und Generationen mit einschließt.“41
Solch eine Literatur gibt Raum „für die Erkundung der zum Teil ungewollten Zusammenhänge zwischen persönlicher Identität und familialen Geschichten von Schuld und Leiden [Kriegstrauma]“.42 Geiger schreibt seinen modernen Familienroman explizit aus diesem Grund, denn: „Familie ist Stoff, über den die meisten Autoren Bescheid wissen, aus eigener, oft blutiger Erfahrung. Und dasselbe gilt für die Leser, die vergleichen und ihre eigenen Erfahrungen hineinlesen können“.43
Menschen in „Literaturdeutschland“, d.h. in Familienromanen, weisen Ähnlichkeiten mit dem Leben der Schriftsteller auf, verdienen zwischen 1800 und etwa 10 000 Euro brutto im Monat, haben Stress mit der Familie, der Liebe und ihren Gefühlen und sind gern allein und auf Reisen.44
Wenn wir den empirischen Autor als die Instanz der Erzählung hinzuziehen, erkennen wir, wie sich Fiktion und Autobiographisches/Reales verweben und deutliche Parallelen zu seiner Vita entstehen: Protagonisten und Bedingungen, die vergangene Geschichte der Familie und die Geographie kommen aus dem autobiographischen Reservoir, der Plot ist erfunden.45
Familienromane werden zur Erinnerungsliteratur und zur literarisierten Autobiographie und man kann fast behaupten, diese Autoren befänden sich auf der „Couch einer narrativen
Selbsttherapie, um ihre Vergangenheiten im selbstkreierten ,Behandlungszimmer’ der Familienerzählung zu vergessen.“46 O-Ton unserer Autoren dazu:
„Natürlich bildet die eigene Biographie und die Familie den Hintergrund für das Schreiben eines Autors.“47
„Wenn jemand einen Familienroman schreibt, wird es selbstverständlich auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Erfahrung. Auch, weil es immer gut ist, wenn man über das schreibt, wovon man etwas versteht.“48
Spiegelt sich bei Buddenbrooks das Schicksal der Gesellschaft und des Bürgertums im Niedergang einer Familie, finden sich in den neuen Familienromanen nicht mehr solche repräsentativen, sondern eher exemplarische Geschichten: Eugen Ruge privatisiert z.B. die deutsche Geschichte so, dass der Leser neben der offiziellen Geschichtspolitik „private Zugänge zur deutschen Geschichte gewinnt“.49
Oftmals regt der Tod eines Familienmitglieds den Schriftsteller an, Erinnerungen in narrativ autobiographisch geprägten Texten zu verfassen, „aber auch Bindungsenergien auf dem Feld der Literatur und ihrer Protagonisten experimentell zirkulieren zu lassen mit dem Ziel, Möglichkeiten und Grenzen von Identitätsentwürfen, die aus der Abhängigkeit von Familie oder anderen starken Bindungen entstehen, zu ergründen; freilich ohne damit den Anspruch zu erheben, ein normatives Konzept familiengebundener Identität zu etablieren.“50 Veränderungsprozesse in Beziehungen setzen dann eine Neuperspektivierung der eigenen Biographie in Gang51, und mit Niederschrift der Romane erfolgt der Versuch einer Vergegenwärtigung der eigenen Familiengeschichte.
Die Autoren greifen auf Dokumente der Erinnerung zurück, wie Fotos, Tagebücher etc. und versuchen mit Hilfe der Protagonisten ihren Gefühlen wie Wut, Schmerz und Einfühlung Ausdruck zu geben: „Die literarischen Texte inszenieren an dieser Schwelle einen fingierten Dialog, der einen Reflexionsraum eröffnen soll für Trauerarbeit, die Ablösung und den Identitätsbildungsprozess des Sohnes und der Tochter im innerfamiliären, genealogischen Generationsgefüge.“52.
Bei unseren Autoren treffen die o.g. Gründe für die Abfassung der Romane sowohl auf Thomas Mann als auch auf Arno Geiger und Eugen Ruge zu. Sie schrieben ihre Romane nach der Auflösung ihrer Familie: der Vater von Thomas Mann war verstorben, die Eltern von Arno Geiger hatten sich scheiden lassen, Ruges Eltern waren tot und sein Heimatland hatte sich als politischer Staat aufgelöst und der Bundesrepublik angeschlossen.
Im Folgenden nun die konkreten autobiographischen Bezüge zwischen dem Autor und seinem Roman.
5.1 Autobiographisches im Roman „Buddenbrooks“ von Thomas Mann
Um zu verstehen, welche autobiographischen Details im RomanBuddenbrooksvom Autor Thomas Mann selbst zu finden sind, zunächst eine kurze Inhaltsangabe des Romans, auch wenn der Aufstieg und Verfall der Roman-Familie hinlänglich bekannt sein dürfte:
Das BuchBuddenbrooks - Der Verfall einer Familiehandelt von der Lübecker Kaufmannsfamilie Buddenbrook und deren langsamen Niedergang. Zu Beginn des Romans, wir schreiben das Jahr 1835, erwirbt diese Familie ein neues prachtvolles Haus. Johann Buddenbrook führt gemeinsam mit seinem Sohn Konsul Jean Buddenbrook ein florierendes Geschäft.
Nach dem Tod des alten Buddenbrook übernimmt Jean das Familienunternehmen. Von den drei Kindern Thomas, Christian und (Antonie)Tony wird Thomas 1855 sein Nachfolger. Der Bruder Christian, ein exzentrischer und hypochondrischer Mensch, verkehrt in Theater- und Schauspielkreisen und verbringt seine Zeit in Clubs. Als er in späteren Jahren selbst in der Firma tätig ist, kommt es zum Streit mit seinem Bruder Thomas, so dass dieser ihn auszahlt und Christian nach Hamburg zieht.
Die Schwester Tony verliebt sich während eines Urlaubs in Travemünde in den angehenden Arzt Morten Schwarzkopf, heiratet jedoch aus Pflichtbewusstsein ihrer Familie gegenüber den Hamburger Geschäftsmann Grünlich, der, so stellt sich heraus, bankrott ist und sie lediglich der Mitgift wegen geheiratet hat. Die Ehe wird geschieden und Tony kehrt in ihr Elternhaus nach Lübeck zurück. Ihre zweite Ehe mit dem Münchener Alois Permaneder scheitert ebenfalls.
Thomas Buddenbrook heiratet die aus reichem Hause stammende Gerda Arnoldsen aus Amsterdam, eine musisch-künstlerische Frau. Gemeinsam haben sie einen Sohn: Hanno, der von Geburt an kränklich und von schwacher Konstitution ist, und sich, wie seine Mutter der Kunst widmet.
Unter der Leitung von Thomas Buddenbrook floriert die Firma. Thomas wird zum Senator der Stadt ernannt und bezieht ein neues repräsentatives Haus. Doch Erschöpfung und nervliche Schwäche zehren an ihm, er stirbt nach einem Zahnarztbesuch 1875. Die Firma wird aufgelöst. Der einzige männliche Nachkomme Hanno verliert sich im Klavierspiel und in Träumereien, ist der Schule nicht gewachsen und stirbt mit sechzehn Jahren an Typhus. Seine Mutter Gerda zieht zurück nach Amsterdam und Tony Buddenbrook bleibt mit ihrer Tochter Erika allein in Lübeck zurück.
Auch wenn Thomas Mann seinen Roman nicht als Schlüsselroman bezeichnete und sich gegen in Lübeck kursierende Listen verwahrte, war seine eigene Familie mit ihren Figuren und Konflikten doch Vorbild für diesen Roman. Eigenschaften und Merkmale von Personen wurden auf die Romangestalten übertragen und „von Jugenderinnerung lebt der ganze Roman, der unter meinen Büchern zu Lübeck die unmittelbarste stoffliche Beziehung besitzt.53 Mit diesem Roman setzte sich der Autor mit der eigenen Herkunft und der Heimatstadt Lübeck, zu ihr entwickelte Thomas Mann eine Hassliebe, auseinander - auch wenn der Name der Stadt Lübeck nirgendwo im Buddenbrooks-Roman auftaucht.
Eine „phantastische Aufladung der Wirklichkeit“ verändert die reale Wirklichkeit Lübecks und die literarischen Figuren, hier wird das Vorbild zum Abbild: Personen werden benutzt zur Darstellung eines Problems, „das ihr vielleicht fremd ist, und Situationen, Handlungen ergeben sich, die dem Urbild wahrscheinlich völlig ferne liegen.“54
Die Reaktion der Lübecker war alles andere als positiv. Man warf Thomas Mann vor, seine Landsleute und Lübecker Bürger in seinem Roman verunglimpft zu haben, was ihn wiederum veranlasste, sich in der Schrift „Bilse und ich“ zu verteidigen: Die „Beseelung“, „die Durchdringung und Erfüllung des Stoffes mit dem, was des Dichters ist“ , so schrieb er, war für ihn der Zweck der Darstellung gewesen.55
Die Biografie von Thomas Mann spiegelt die Ähnlichkeiten mit dem Roman wieder:
Schon der Urgroßvater Johann Siegmund betrieb von 1790 bis 1848 ein erfolgreiches Kaufmannsgeschäft (Getreidefirma) in Lübeck, eine Heirat vergrößerte den Besitz und die Reputation der Familie, der Sohn Johann Siegmund d. J. erweiterte den Firmenbesitz durch eine zweite Heirat, nachdem die erste Frau gestorben war. Johann Siegmund d .Ä., der Großvater von Thomas Mann, stieg bis zum Senator auf und lebte mit seiner Familie in dem prächtigen Stadthaus in der Mengstraße.
Der Vater von Thomas Mann, Thomas Johann Heinrich Mann, übernahm, nachdem sein Vater plötzlich zur Zeit der Revolutionsunruhen an einem Schlaganfall starb, 1863 im Alter von 23 Jahren die Getreidefirma. Schon nach kurzer Zeit erhielt Thomas Johann Heinrich Mann den Titel des Konsuls, später den des Senators und war damit nach dem Bürgermeister der mächtigste Mann der Stadt. Er galt „als sehr vornehmer Mann. Manche fanden ihn gar ein wenig eitel, mit seinen englischen Anzügen, seinen russischen Zigaretten, seinem herben Parfum und dem goldenen Kneifer. .Auch dass er französische Romane - Zola! - las, war für einen lübischen Kaufmann durchaus ungewöhnlich.“56
Ein solcher Mann der Extravaganz, Thomas Buddenbrook nicht unähnlich, heiratete eine besondere, eine exotische Frau: Julia da Silva-Bruhns: Sie kam in Brasilien zur Welt, ihr Vater aus Lübeck stammend, hatte dort eine Exportfirma gegründet und die Tochter seines Nachbarn Don Manoel Caetano da Silva geheiratet. Als Julias Mutter starb, zog ihr Vater zurück nach Lübeck, wo Julia, von der Lübecker Gesellschaft mit Vorurteilen behaftet und wenig angesehen, zurecht kommen musste. Th. J. Heinrich Mann und Julia da Silva Bruhns zogen von der Mengstraße in ein neu erworbenes Haus in der Beckergrube, in der Nähe des bisherigen Hauses. Julia führte die Kinder an die Musik und die Literatur heran, und verließ die Stadt nach dem Tode des Ehemannes - die Ähnlichkeiten mit Gerda Buddenbrook sind offensichtlich. Gerda Buddenbrook, ihr Pendant im Roman, wohnte, als sie sich mit Thomas liierte, mit ihrem Vater in Amsterdam. Ihre äußere Erscheinung mit dem roten Haar, der blassen Haut, ihre Vorliebe zur Musik, das Geigenspiel, all das unterschied sie von den eingesessenen Kaufleuten und wurde von der Lübecker Gesellschaft kritisch beäugt. „Julia schien wie konserviert in ihrer repräsentativen Kühle. Ihrem Mann gelang die Konservierung weniger gut.Thomas Mann hat diese sonderbare
Ehe kühler Vertrautheit in der Beschreibung der Ehe von Thomas und Gerda in den „Buddenbrooks“ verewigt.“57
Thomas Manns Beziehung zu seiner Mutter war sehr eng. Ihr künstlerisches Wesen beeindruckte und beeinflusste ihn. Vermittelte der Vater eher das praktische geschäftliche Wissen, hatte sie stets den Wunsch, in Thomas einen erfolgreichen Künstler zu sehen.58
1871 kam bei den Manns das erste Kind Luis Heinrich zur Welt, es folgten 1875 der zweite Sohn Paul Thomas (Tommy mit Rufnamen), Julia, Carla, die beiden Töchter, und als letzter der Sohn Viktor.
1883 bezog man ein noch prächtigeres Haus in der Fischergrube. Senator Mann hatte ein altes Giebelhaus gekauft, es abreißen und ein modernes Stadtpalais im Stil der niederländischen Neurenaissance bauen lassen, entworfen vom Berliner Architekten Julius Grube. Es war ein Haus geselligen Lebens, mit einem Tanzsaal und einem geräumigen Kontor für die Arbeit als Kaufmann, Reeder und Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzenden und das Haus der Kindheit und Jugend von Thomas Mann. Die Familie führte ein offenes Haus und gab Gesellschaften, bei denen Julia Mann Klavier spielte und mit ihrer südlichen Erscheinung dem anwesenden Publikum ins Auge stach.
Ein biographischer Bezug ist der Verkauf des Hauses in der Beckergrube bzw. des Stadtpalais von Thomas Manns Vater durch den in Lübeck bekannten Testamentsvollstrecker Krafft Tesdorpf, im Roman Stephan Kistenmaker, an ihm nahm Thomas Mann auf diese Art Rache. Der Verkaufserlös erschien der Witwe Julia Mann da Silva-Bruhns zu gering, ein späterer überhasteter Verkauf war dann verlustreich.59
„Die Kinder des Senators lernten die Gesellschaft von oben herab kennen.“60 Ihnen wurde aufgrund ihrer bedeutenden Herkunft von Seiten der Bewohner Respekt entgegen gebracht und dass ihr Umgang stimmte und sie nur zu besten Kreisen Kontakt pflegten, darauf achtete ihr Kindermädchen, dem die Erziehung oblag, ähnlich Ida Jungmann bei den Buddenbrooks. Die Söhne sollten Abitur machen und studieren bzw. die Firma weiterführen, so waren die Ansprüche des Vaters. Thomas besuchte nach der Privatschule 1889 zwar das Gymnasium „Katharineum“, schaffte die Versetzungen jedoch zweimal gar nicht und sonst nur mit Mühe. Seine Misserfolge und sein Schulversagen als Senatorensohn galten in Lübeck als ein Skandal, die Romanfigur Hanno Buddenbrook erlebt die Schulzeit ebenso freud- und erfolglos.
Im Mai 1890 wurde das hundertjährige Jubiläum der Firma Mann gefeiert, zu dem Thomas Mann schreibt: „Ich war ein Knabe und passiver Zuschauer. Ich sah den Reigen der Gratulanten, der Deputationen, mit furchtsamer Zärtlichkeit den geliebten Mann des Tages, meinen Vater, weltgewandt ein Jahrhundert bürgerlicher Tüchtigkeit repräsentieren, und mein Herz war beklommen.“61 Er fühlte, dass weder er noch sein Bruder den Erwartungen und Hoffnungen des Vaters auf Weiterführung der Firma gerecht werden konnten, und weil dies auch der Vater erkannte, ordnete er zeitlebens bereits testamentarisch die Liquidierung der Firma nach seinem Tod an. Auch das wurde im
Roman verarbeitet: Die 150 Jahr-Feier der Firma Buddenbrook ist eine Wende in der Erfolgsgeschichte des Geschäfts, Thomas Buddenbrook sieht in seinen Sohn Hanno keinen geeigneten Nachfolger und bestimmt im Falle des Todes die Liquidation der Firma.
Als der Vater 1891 starb, Thomas war gerade 16 Jahre alt (und beim Sterben und Tod des Vaters anwesend), verlor sich das Ansehen der Familie. Die Witwe verkaufte die beiden Häuser und zog mit ihren Kindern nach München, Gerda Buddenbrook zieht mit ihrem Sohn vor das Holstentor in eine kleine Villa.
Thomas Mann besuchte noch zwei Jahre die Schule in Lübeck, begann dann eine Feuerversicherungslehre, ein Beweis, dass er er den Wunsch des Vaters nach einem bürgerlichen Leben zu realisieren versuchte. Gleichzeitig jedoch schrieb er Novellen und fasste im künstlerischen Bereich Fuß.62
Dass der RomanBuddenbrookseinen Gesellschaftsskandal in Lübeck auslöste, hing mit dem Figurenkreis der karikierten Akteure zusammen, in ihnen sahen sich Verwandte und Bekannte der Lächerlichkeit preisgegeben. Schon bald kursierten nach dem Erscheinen des Romans Schlüssellisten in Lübeck, in denen leibhaftige Figuren den Protagonisten zugeordnet wurden, und trugen damit zur Faszination und zum Erfolg des Buches bei:
Neben den Figuren wie Pastor Köllig, der eine Anlehnung an Pastor Johann Funk in Lübeck ist, galt das besondere biographische Interesse der Figur Tony und ihrer Liebe zu dem Sohn des Lotsenkommandanten Schwartzkopf. Das Vorbild dazu war Elisabeth Haag-Mann, die die Liebe zu einem standesgemäßen Kaufmannssohn aufgab zu Gunsten eines ungeliebten Hamburger Mannes. Sie soll große charakterliche Ähnlichkeiten mit Tony gehabt haben: ihren Optimismus, den nichts erschüttern konnte, ihre Naivität und ihren Stolz auf die Familientradition.
Für Christian galt der Onkel Frieden als Modell, dieser warf dem Autoren vor, ein Nestbeschmutzer zu sein.
1953 bestätigte Thomas Mann die Übereinstimmung der Person des Direktor Weinschenk mit dem „zeitweiligen Direktor der Lübecker Feuerversicherungsgesellschaft Biermann.. Er erhielt wegen geschäftlicher Unregelmäßigkeiten einige Jahre Gefängnis und verschwand danach aus unserem Gesichtskreis“.63
Die Personen Thomas und Christian Buddenbrook tragen autobiographische Züge, dabei spielt der lebenslange Bruderzwist, die Konkurrenz zwischen Heinrich und Thomas in der Kindheit und in politischer Sicht, in diesen Roman hinein. Heinrich, der Ältere war zwar durch sein Alter dem Bruder Thomas in der Entwicklung voraus, die Abhängigkeit des literarischen Bruders Christian von seinem Bruder Thomas Buddenbrook passt aber zu der Abhängigkeit Heinrich Manns von seinem Bruder Thomas. Konnte letzterer im amerikanischen Exil seinen großbürgerlichen Lebensstil beibehalten, wurde Heinrich von seiner Gunst abhängig.
Thomas Buddenbrook, der den Vornamen von Thomas nicht umsonst trägt, spiegelt mit seiner Leistungsethik eine wichtige Eigenschaft von Thomas Mann wieder. Den Zwiespalt zwischen Bürgerlichkeit mit dem Willen zur Leistung und dem sensiblen grübelnden Künstler erlebte Th. Mann zwar an sich selber, aber anders als im Roman kommt es bei ihm nicht zum Scheitern der Künstlerseele an den Ansprüchen des Kaufmannsethos.64 Thomas Manns Teilidentitäten spiegeln sich in Hanno,der ihm in seinem Wesen ähnlich und der letzte Spross der Buddenbrooks ist. Obwohl sein Vater erwartet, dass er Kaufmann wird, fehlt Hanno die Leidenschaft für das Geschäft und jegliches Engagement für die Firma. Er ist ein schlechter Schüler, unterscheidet sich von seinen Mitschülern im Denken und Fühlen und wurde damit zu einem Außenseiter.
Th. Buddenbrook spiegelt ebenso Thomas Johann Heinrich Mann wieder: Der Vater von Thomas Mann übernahm die Firma 1863 und konnte hohen Kapitalzuwachs verzeichnen, mit dem z.B. ein großer Getreidespeicher gebaut wurde und der ihm einen Posten im Aufsichtsrat der Commerzbank einbrachte. 1874/75 kam es durch Fehlspekulationen zur Krise und der folgende Kauf von Aktien brachte weitere Verluste mit sich. Die Ereignisse, die den Verfall von Thomas Buddenbrook beschleunigen, ähneln zeitlich dem Agieren von Th. Manns Vater, nur dass sich dessen Firma wieder konsolidierte.
Die Senatswahl im Roman von 1863 charakterisiert Thomas Buddenbrook als Person der Tradition aufgrund seiner familiären Herkunft und Modernität, im Kontrast zu Hageström, einem Geschäftsmann, der das Althergebrachte weniger ehrt und z.B. Denkmalpflege ablehnt. In diesem Fall sind Parallelen zur Historie der Stadt Lübeck erkennbar, wo 1863 eine Debatte um die Stadtentwicklung entbrannte, von der Thomas Mann in seinem Elternhaus erfuhr: Wegen des Baus einer Eisenbahntrasse war das mittlere Holstentor abgebrochen worden, nun aber entschied die Bürgerschaft sich gegen einen Abriss des „Inneren Holstentores“ aus Gründen der städtebaulichen Kontinuität. In den Figuren von Th. Buddenbrook und Hagenström stehen sich die zwei Auffassungen und Haltungen gegenüber. Die neue Bauordnung von 1881, an der Senator Mann beteiligt war, ließ Raum für Spekulationen mit Gebäuden und bewilligte individuelle und freie Entscheidungen über Nutzen oder Abriss des eigenen Gebäudes, so dass das alte Lübeck zum großen Teil verschwand.
Ursprünglich sollte dieser Familienroman lediglich eine kurze Novelle von Hanno erzählen: „Ich wollte nach gutem norwegischen Muster eine Familiengeschichte schrieben - nichts weiter. Aber das Buch wuchs mir unter den Händen“, sagte Thomas Mann.65
Thomas Mann ließ sich die Familienpapiere, u.a.das Familienbuch von seiner Mutter nach Italien schicken, wo er mit seinem Bruder weilte. Sein Onkel, Kaufmann in Lübeck, gab ihm Informationen in geschäftlichen und (lokal)politischen Fragen, und Thomas Mann wandelte die Mann-Familie zur Roman-Familie Buddenbrook um. Das Erzählte wurde in die historische Zeit transferiert, diese verlegte Th. Mann wiederum um 25 Jahre zurück, d.h. die alten Buddenbrooks starben jeweils ca. zehn Jahre früher als ihre Modelle.
Die Abfassung des Romans bedeutete eine Bewältigung familiär auftretender und persönlich-psychischer Probleme. So schrieb der Autor 1901, dem Jahr der Veröffentlichung des Romans an seinen Bruder: „Wenn der Frühling kommt, werde ich einen unerhört bewegten Winter hinter mir haben. Depressionen wirklich arger Art mit vollkommen ernst gemeinten Selbstabschaffungsplänen.“66
Der Erfolg des Romans und der Aufstieg des Autors in die höchsten Gesellschaftsschichten Münchens durch die Heirat von Katja Pringsheim brachten ihm Ansehen und Anerkennung und in eine seinem Vater ähnliche Postion.67 Welch große Relevanz dies für Thomas Mann hatte, lesen wir in seiner Rede „Lübeck als geistige Lebensform“, in der er sich als Bürger, ein Kind deutsch-bürgerlicher Kultur, bezeichnet und den Vater als Vorbild für sein Tun und Lassen sah. Er und sein Bruder haben „vom Vater … das Ethische, das mit dem Bürgerlichen in so hohem Grade zusammenfällt. das Ethische ist recht eigentlich Lebensbürgerlichkeit, der Sinn für Lebenspflichten.“68 Die Ernennung zum Senator der Deutschen Akademie in München war einer der Höhepunkt seines Erfolges und eine weitere Parallele zum Leben seines Vaters.
5.2 Autobiographisches im Roman „ Es geht uns gut“ von Arno Geiger
Auch hier zunächst ein kurzer Abriss des Inhalts: Der Roman beginnt in Österreich im Jahr 2001, als Philipp Erlach, der Protagonist und Enkel von Alma und Richard, 30 Jahre alt, das Haus seiner Großeltern erbt und dort eine Aufräumaktion startet, indem er Mobiliar und alle vermeintlichen familiären Erbstücke entsorgt.
Das Buch ist im Ansatz ein Mehrfamilienroman, zwei Familien, die Familien Erhard und Sterk, werden in kontrastierender Absicht erzählerisch vorgestellt. Die Kontrastfunktion bezieht sich auf die ideologische Haltung der Familien in der Zeit des Nationalsozialismus, auf die unterschiedliche ökonomische und wirtschaftliche Situation und die soziale Differenz (Wohnsituation, Bildung).
Die private und die österreichische Geschichte werden miteinander verzahnt, das einheitsstiftende Prinzip ist die Stadt Wien.
Genealogische Strukturder Familie Erlach:
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Und während die Zeit vergeht, werden die Figuren bei ihrem Älterwerden von der Kindheit über die Jugend zum Erwachsenen bis zum Alter mit seinen Krankheiten (Richard) begleitet. Textimmanent sind die Familien Erlach und Sterk bereits 1945 aufeinander bezogen, als die Söhne Peter und Otto sich gegenseitig im Krieg wahrnehmen. Otto überlebt den Krieg nicht.
Die Tochter Ingrid Sterk gehört zu einer bedeutenden Wiener Familie, die durch die Dominanz des Vaters gekennzeichnet ist, während Peters Familie sich durch den Krieg aufgelöst hat. Montagetechnik strukturiert den Roman, in dem Ereignisse in der jeweils historischen Zeit von den Großeltern (Alma in Kap 2 und 20; Richard in den Kap 4 und 12), von Ingrid (Kap 9 und 14) und von Peter (Kap 7 und 17) erzählt werden.
Alma greift in ihren Erinnerungen aus der fiktiven Gegenwart in die fiktive Vergangenheit zurück, woraufhin wieder in die fiktive Gegenwart zurückgekehrt wird.
In Rückblenden und aus verschiedenen Perspektiven erzählt der Autor die Geschichte der Familien, beginnend 1938 während der Naziherrschaft. Nach dem Anschluss Österreichs erfahren wir, wie das gutbürgerliche Familienleben der Familie Sterk durch die Affäre Richards mit dem Hausmädchen getrübt ist.
Das Jahr 1945 beschreibt das Kriegsende und die Flucht Peter Erlachs.
Im Jahr 1955 besitzt Richard Sterk als Minister großen politischen Einfluss, das Verhältnis zu seiner Tochter Ingrid jedoch ist von Unverständnis und Entfremdung geprägt, weil ihr Lebensgefährte Peter nicht seinen bürgerlichen Vorstellungen entspricht.
In den 60er Jahren, in der Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs, heiraten Ingrid und Peter und gründen eine Familie, die Beziehung zu Alma und Richard ist weiterhin belastet.
In den 1970er Jahren arbeitet Ingrid als Ärzten, fühlt sich in ihrer Mehrfachbelastung unglücklich und überfordert, weil Peter sie in keiner Weise unterstützt. Bei einem Unfall kommt sie ums Leben.
Im Jahr 1978 reist Peter mit den beiden Kindern Sissi und Philipp in den Urlaub, es tritt ein Vater-Tochter-Konflikt zutage.
Fragmente setzen sich als Ganzes zu einer Familienchronik zusammen, auch wenn sie dem Leser so Manches vorenthält, wie z.B. die Entwicklung Peters/Philipps vom Jugendlichen zum Erwachsenen, seine Ausbildung bzw. die Zeit des Studiums, also eine Zeit, in der die Weichen für die Zukunft gestellt werden.
Im Schluss deutet sich ein radikaler Schnitt bei Philipp zum großen Neuanfang hin an. Es ist ein Szenario, das an Münchhausen erinnert.
Der Autor wurde 1968 in Bregenz geboren und wuchs in Wolfurt, einer kleinen Gemeinde im Vorarlberg, in der Nähe von Bregenz auf. Der Einfluss Österreichs und die österreichische Mentalität finden sich im Roman, sei es im Dialekt in den Dialogen (,deppert‘, ,Tropf‘), im Humor oder in der Situierung des Romans in Wien.
1987 absolvierte A. Geiger in Bregenz die Matura. Als einziger Schüler der Schule ging er zum Studium der Jurisprudenz nach Salzburg, finanziell unterstützt von seinen Eltern. Er arbeitete in den Sommermonaten als Videotechniker bei den Bregenzer Festspielen.
Während seines Jurastudiums begann er mit dem Schreiben und spürte, dass dies seiner Neigung entsprach; er brach das bisherige Studium ab und wechselte 1987 zur Germanistik, sein besonderes Interesse galt der vergleichenden Literaturwissenschaft und der Geschichte.
Geiger spricht davon, dort als Schriftsteller „viel gelernt“ zu haben und vergleicht es mit dem Verhältnis von „Kommissar und Kriminellen. Dort ist es auch von Vorteil, wenn der Kriminelle die Seite des Kommissars kennt, will er ein guter Krimineller werden.“69
Waren die ersten Texte bei Geiger noch durch sprachliche und formale Aspekte geprägt, „Schreiben um des Schreibens willen“70, steht heute der Inhalt an erster Stelle und erst dann die Umsetzung. Er sieht sich als Beobachter, der über die Existenz staunt und darüber, wie merkwürdig sie ist und zieht das Erzählen dem Betrachten, Beurteilen und Bewerten vor.71
Sein Schreiben ist ein Ergebnis der Erfahrung, Dinge erlebt zu haben, die den Eindruck machten, normal und durchschaubar zu sein, es aber nicht waren, „ein Erzählen und Nachdenken (...) Verstehen-wollen und trotzdem-nicht-verstehen. Ein Pendeln zwischen materieller Welt und Vorstellung, zwischen Stoff und Wort.“72
Schon früh hatte er, so erklärt er in einem Interview, Interesse für andere Menschen und begründet dies damit, dass er „keine allzu ausgeprägte Vorstellung hatte, wer er selbst war.“73 Die Romanfigur Philipp stellt eine Personifikation seiner selbst dar, er gehört der modernen Generation mit ihren unbegrenzten Möglichkeiten an, fühlt sich in Anbetracht dessen überfordert und tritt den Rückzug an. Die Haltung Philipps zur Vergangenheit ist eine Parallele zu Österreichs Haltung gegenüber der eigenen Geschichte - „Es geht uns gut“ wird aus diesem Grund als ein Schlüsselroman eingestuft.74
Fiktion und Wirklichkeit der Geschichte wechseln sich in diesem Roman ab, der Autor zeigt dem Leser die Vertrautheit des persönlichen Erlebens im Zusammenhang mit der Geschichte.75 Um die historische Dimension der Figuren zu begreifen, las Arno Geiger Tageszeitungen, Magazine, Aktuelles, Briefe und Tagebücher, die er in der AK Bibliothek oder der sozialwissenschaftlichen und historischen Präsenzbibliothek fand, und schuf auf dieser Art eine zeitnahe Atmosphäre.
Aber auch ganz persönliche Erinnerungen wurden in dem sonst fiktiven Roman verarbeitet. Eine davon findet sich in der Krankenhaus-Szene mit Richard Sterk in der Personalisierung von Geigers Onkel Toni: Dieser zeigte stets einen so starken Leistungsgedanken, dass er sogar im Sterbezimmer des Krankenhauses mit dem Zimmernachbarn stritt, wer „im Leben mehr geleistet“ hat: „Der Ingenieur habe immer gerufen, was er alles gebaut habe, und Onkel Toni habe zur Decke geschimpft, das sei alles Unfug und vergeudetes Geld gewesen. Er habe beim Zoll dafür gesorgt, dass Geld in die Kassen kommt, und beim Bundesheer hätten sie es verpulvert.“76 Eine ähnliche Szene findet sich im Roman:
S. 342
Donnerstag vor vier Tagen wurde Hofrat Dr. Sindelka, Richards Zimmernachbar im Pflegeheim, in Richards Bett angetroffen. Richard lag mit einem Oberschenkelbruch und mehreren Platzwunden am Fußboden davo…
… Aller Wahrscheinlichkeit nach hat sich Dr. Sindelka, der ebenfalls ein hoffnungsloser Sklerotiker ist, im Zimmer geirrt und gedacht, sein Bett sei widerrechtlich von Richard okkupiert. Die beiden haben sich von Anfang nicht vertragen, teils aus politischen Gründen, teils aus Eifersucht, wer sich in physisch besserer Verfassung befindet. Sindelka muss mit einem hölzernen Kleiderbügel auf Richard losgegangen sein, auf diese Weise gelang es ihm, Richard aus dem Bett zu werfen und es für sich in Beschlag zu nehme…
Ebenso finden sich Züge von Arno Geigers Vater August in der Person Richards: Erste Anzeichen von Alzheimer nimmt zunächst nur seine Frau wahr, während Bekannte, die ihn als geachteten, beliebten und allseits bekannten Gemeindeschreiber wertschätzen, sich weigern, diese Erkrankung zu akzeptieren.( In dem Buch „Der alte König im Exil“ beschreibt Arno Geiger das Zusammenleben mit dem alleinlebenden alten Herrn und dessen zunehmenden Verlust von Gedächtnis und Fähigkeiten.
S. 32f
Alma sagte, dass sie - bevor sie ihre Bitte ausspreche - einiges erzählen wolle, so dass Richard überall behaupte, sie (Alma) nenne ihn Mörder. Und dass er beim Weggehen zwei Anzugröcke übereinander anziehen wolle mit der Begründung, dass er nichts anderes habe. Zuletzt kam sie zum Eigentlichen und bat Frau Ziehrer, sie solle ihr die Demütigung erspraren, mit Richard auf die Bank zu gehen, falls er sie darum ersuchen sollt…
-Sie wollen damit sagen, der Herr Doktor ist deppert.
-Ich habe dieses Wort nicht gebraucht.
-Nein, gebraucht nicht, aber Sie haben mir den Herrn Doktor so beschrieben, dass ich es bei mir nicht anders als mit ,deppert‘ zusammenfassen kann. Und wie ich ihn das letzte Mal gesehen habe, war nichts zu merken, das auf einen Zustand schließen ließe, wie Sie ihn schildern. Sie haben nicht immer recht, Frau Doktor Sterk. Schon vor Jahren war ich schockiert, als Sie dem Herrn Kommerzialrat Lonardelli sagten, Ihr Mann wisse nicht, was er red…
5.3 Autobiographisches im Roman „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ von Eugen Ruge
„Eugen Ruge erzählt eine Familiengeschichte, die den Vergleich mit den Buddenbrooks nicht scheuen muss.“77 Hier wird eine Familiensaga überliefert, mit ihr werden Zusammenhänge mit der Geschichte des Heimatlandes erzählt und gleichzeitig die Relativität von Normen gezeigt. Die Familiengeschichte der Familie Ruge, einer Vorzeigefamilie der DDR, ist der biografische Ausgangspunkt des Romans. Es ist die Geschichte vom Verlöschen der Familie und gleichzeitig vom Verlöschen einer Ordnung, eines Landes und einer Idee.78 Eugen Ruge selber als der letzte Überlebende schrieb das Schicksal seiner Familie auf, um Erinnerungen und Erfahrungen zu bewahren (siehe dazu: Ererbte Dinge).79
Ruge konstatierte für sich eine Verbindung zwischen den politischen Ereignissen seit dem Jahre 1989 und seinem literarischen Interesse an der Familiengeschichte. Er wollte nach dem Tod der Eltern an die Einflussfaktoren der Familie und seiner Herkunft erinnern und hatte das Ziel „bevor alles vergessen wird von der DDR und alles zum Negativen berichtet wird“ dies in Erinnerung zu bewahren.
Der Roman spiegelt die Identitätsbildung Ruges und seine Prägung durch die Lebenserfahrungen unter dem sozialistischen Regime wider und wie sich das eigene Ich in einem Familienzusammenhang integriert. Anders als Geiger, der das Thema Vergessen in den Mittelpunkt stellt, ist bei Eugen Ruge die Vergangenheit der zentrale Gegenstand, durch diese Art der Erinnerungs-Literatur werden Einblicke in historische Prozesse möglich, Geschichte aber nicht gedeutet.
Zunächst zum Inhalt:
In Anknüpfung an bürgerliche Literaturtraditionen kommen vier Generationen der Familie Umnitzer zur Sprache. Der Roman beginnt im Jahre 2001, als Alexander, die Reflektorfigur, nach einem Krankenhausaufenthalt, bei dem ein unheilbarer Tumor diagnostiziert wurde, seinen dementen Vater Kurt besucht und versorgt. Dort nimmt er Geld aus dem Wandtresor und kündigt eine Reise an, eine Reise nach Mexiko, die eine Spurensuche nach den Ursprüngen seiner Familiengeschichte darstellt.
Das Leben der Familie Umnitzer wird fast über das ganze 20. Jahrhundert erzählt. Dreh- und Angelpunkt ist der 90. Geburtstag von Wilhelm im Jahre 1989, der aus verschiedenen Perspektiven wiedergegeben wird. Wilhelm wird an diesem Abend von seiner Frau Charlotte vergiftet.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Die Großeltern Alexanders (Sascha) sind Wilhelm und Charlotte, überzeugte Kommunisten, die zu Beginn des Romans im mexikanischen Exil leben, dann in die neu gegründete DDR reisen, um beim sozialistischen Aufbau eines neuen Deutschlands zu helfen. Ihr Sohn Kurt kehrt aus der Sowjetunion aus dem Straflager mit einer russischen Frau nach Hause zurück. Alexander, der Sohn von Kurt und Irina, steht im Mittelpunkt der Zuneigung seiner Großmutter Charlotte und seiner Mutter Irina.
Während Wilhelm in der DDR immer wieder Ehrungen von Seiten der Partei erfährt, obwohl er nichts leistet, schreibt Charlotte Buch-Rezensionen für das „Neue Deutschland“, ohne für ihre Leistungen belohnt zu werden. Der versprochene Führungsposten an der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaften bleibt ihr versagt.
Kurt wird ein anerkannter Historiker und verfasst Biographien über historische Persönlichkeiten. Er und Irina arrangieren sich mit den Gegebenheiten der DDR, sympathisieren mit dem Kommunismus und leben noch als Rentner in der DDR. Alexander flieht in den Westen, er hat keinen Glauben an den Sozialismus. Irina sucht Zuflucht im Alkohol. Markus, der Sohn Alexanders aus erster Ehe, erlebt die DDR nur noch als Kleinkind und lebt wie ein West-Jugendlicher, was ihm zwar Freiräume, aber keine eigentliche Zufriedenheit schenkt. Er erscheint 1995 auf Irinas Beerdigung, ohne Kontakt zu seinem Großvater oder Vater aufzunehmen, diese erkennen ihn auch gar nicht mehr. Seine Mutter ist nun mit einem Pfarrer verheiratet, der vor der Wende Friedensgebete organisiert hat und nun im Bundestag arbeitet.
Im Roman ist der Rückgriff auf eine autobiographische Vorlage unverkennbar: Ruge benutzt die verwandten Personen als Vorlage für ein Erinnerungsbuch nach dem autobiografischen Erlöschen der Familie bzw. dem Tod der Familienmitglieder.
Der Autor selber wurde am 24. Juni 1954 in Soswa, Oblast Swerdlowsk in der Sowjetunion als Sohn von Wolfgang Ruge geboren, der als Kommunist vor den Nazis nach Russland geflohen war und als Deutschstämmiger nach Kriegsbeginn nach Kasachstan deportiert und ins GULAG gesperrt wurde. In einem Arbeitslager erlebte Wolfgang Ruge als Häftling unmenschliche Bedingungen, Kälte, Hunger und kaum erfüllbare Arbeitsnormen.80 Nach seiner Zeit als Zwangsarbeiter musste er im Nordural bleiben, wurde Fernstudent an der 300 km entfernten Universität von Swerdlowsk und absolvierte sein Diplom als Historiker. Dort lernte er seine russische Frau kennen. 1956 durfte der Vater des Autors nach Deutschland zurückkehren und hoffte dort auf den echten Sozialismus. Er wurde ein berühmter DDR Historiker.
Eugen Ruge war zwei Jahre alt, als er mit den Eltern aus dem Ural nach Ost-Berlin kam und dort eine DDR-Eliteschule besuchte.
Nach dem Mathematikstudium und dem Diplom an der Humboldt-Universität in Berlin wurde er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentralinstitut für Physik an der Akademie der Wissenschaften der DDR. Mit Mitte dreißig wandte er sich 1986 einer Tätigkeit als Schriftsteller, Drehbuchautor und Dokumentarfilmer zu. Er siedelte 1988 in die Bundesrepublik über und wirkt seit 1989 als Autor für Hörspiele, Drehbücher, Theaterstücke und als Übersetzer von Stücken aus dem Russischen. Er war Gastprofessor an der Universität der Künste Berlin. Eugen Ruge ist Vater von vier Kindern und lebt in Berlin und auf Rügen.
Wir können bei Ruges Roman von einer Mischform des Schlüsselromans sprechen, der zwischen Fiktion und Faktualität schwankt: Er weist eine besondere Form des Wirklichkeitsbezugs auf und exemplifiziert anhand der Viten mehrere Jahrzehnte deutscher Geschichte - stellt aber keine historische Quelle dar (typisch für den Familienroman). Eugen Ruge versetzt sich aus der Distanz von Jahren in seine Figuren, gibt ihnen Züge der Verwandtschaft und lässt sie erzählen 81 :
Durch Alexander /Sascha Umnitzer, einem Vertreter der Nachkriegsgeneration, wird Ruge selbst im Roman vertreten. So wie Sascha, sein Alter Ego,schreibt der Autor Eugen Ruge Theaterstücke und erlebt die Welt der Künstler in ihren politischen Ausprägungen, die die bürgerlichen Werte und Normen infrage stellen. Wie bei Alexander wurde auch beim Autor eine Krebserkrankung diagnostiziert.
Kurt Umnitzer repräsentiert Ruges Vater Wolfgang Ruge (geb. 1917). Er emigrierte wie die Romanfigur nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten in die Sowjetunion, wurde nach dem deutschen Angriff nach Kasachstan deportiert und kam später in ein Arbeitslager.
1956 kehrte er in die DDR zurück und wurde ein bedeutender Historiker der DDR. Ebenso wie Kurt veröffentlichte er seine Memoiren. Wolfgang, der Bruder Kurts, wurde nicht wie im Roman im Gulag ermordet. Er überlebte und und lernte in der Verbannung seine russische Frau Irina kennen. Deren Namen hat Eugen Ruge auf die Frau Kurts übertragen.
Den Namen seiner deutschen Großmutter Charlotte übernahm Eugen Ruge in den Roman, ihr zweiter Mann war, wie sein Pendant Wilhelm, ein Kurier der Komintern. Die Großeltern retteten sich vor den Nazis nach Mexiko. Das Denken und Fühlen der Großmutter war Eugen Ruge unbekannt und wurde neu von ihm erfunden. „Ich weiß nicht, wie sie sich bei der Rückkehr in die DDR fühlte.“ 82 Anders als im Roman haben die Großeltern die Wende jedoch nicht erlebt, sondern sind in den 60er Jahren gestorben.
Des weiteren verfremdet Eugen Ruge die Namen bekannter Persönlichkeiten aus der DDR, so erscheint der Verleger Walter Janka als Frank Janko, der Philosoph Wolfgang Harich mit dem vielsagenden Namen Karl Irwig und die Brecht-Schauspielerin Steffie Spira-Ruschin als Stine Spier.
So wie bei vielen Autoren Umbrüche in der eigenen Biographie zum Schreiben eines Familienromans führten, war für Eugen Ruge der Zusammenbruch des Systems ein Grund, noch einmal auf die Vergangenheit zu blicken und sich mit dem vergangenen System literarisch auseinanderzusetzen. Er verschriftlichte seine Erlebnisse der vergangenen Jahrzehnte aus der Retrospektive und machte abrupte Brüche in der Alltagswelt der DDR durch die Wende sichtbar. Es war nicht sein Bedürfnis, eine Bewertung ideologischer Art abzugeben, z.B. zum Mauerbau, sondern sich narrativ im Erzählen an die Vergangenheit zu erinnern, das Leben im anderen Deutschland lebendig zu halten und die verlorene Heimat (ebenso wie Geiger) zu rekonstruieren, „die als Kompensation und Gegenwelt zur BRD verstanden werden muss“.83
Solch eine Form der Erinnerung war in der Nachwendezeit nicht außergewöhnlich, nach der Vereinigung und dem Verschwinden des ehemaligen ostdeutschen Staates und der damit verbundenen Assimilation der dortigen Bürger in die westdeutsche Gesellschaft kam es in den 90er Jahren bei vielen ehemaligen DDR Bürgern immer mehr zu einer Identifikation mit der verlorenen Heimat. Man nannte dies „Ostalgie" und beschrieb damit eine Erinnerungskultur, die ein Unbehagen an die Anpassung an die fremde Gegenwart artikulierte und die nicht wollte, dass die realsozialistische Vergangenheit diskreditiert wurde und ihr früheres Land lediglich als ein Land mit Opfern und Tätern in die Geschichte einging. Stattdessen sollte es eine emotionale und narrative Erinnerung geben, eine „Erinnerung, die mit Fragmenten, Relikten, Einzelheiten jener verlorenen Zeit arbeitet“ .84
Auch Ruge fühlte sich durch die Negativurteile über die DDR betroffen. Die private Erinnerung des Buches ist eine normale und fröhliche Erinnerung eines in der DDR sozialisierten Schriftstellers, der mit normalen Menschen unter alltäglichen damaligen Belastungen aufwuchs und damit bis zu einem bestimmten Zeitpunkt auch leben konnte. Erfahrungen der Mikroebene des Alltagslebens bilden den Kern seines Romans und bestimmte Spezifika des DDR-Alltags finden ihren Niederschlag, wenn eine Vielzahl von Begebenheiten und Gefühlen in kleinen Geschichten zwar multiperspektivisch, aber nie sozialgeschichtlich erzählt werden.
Die politische Diktatur der Politik in der DDR mit ihrer Unfreiheit und Totalkontrolle einerseits und das Alltagsleben der Menschen mit der Wärme der Gemeinschaft und der Sicherheit des Arbeitsplatzes sind für Eugen Ruge zwei Seiten einer Medaille - und in diesem Roman soll Letzteres von Bedeutung sein. (Die Gründe für die Ausreise des Autors spiegeln den Zusammenhang wider.)
Und so ließ er die Lebenswirklichkeit seiner Familie vor und nach der Wende zu Wort kommen, schuf glücklichere Bilder von der DDR als die, die Wissenschaft und Publizistik lieferten und setzte der Entwertung der DDR das Lebenswerte des damaligen Lebens entgegen.
Dabei muss man als Leser erkennen: Erinnerung ist nie objektiv. „Aus der Gedächtnisforschung wissen wir, dass Erinnerung immer ein Konstrukt ist (...) Im Schreiben werden Erinnerungs-möglichkeiten erprobt; man spielt mit Imagination und unterschiedlichen Perspektiven, um herauszufinden, wie es gewesen sein könnte.“85
6. Erzählform und Stilistik in den Romanen
Jeder Mensch hat seine eigene Sprache. Sprache ist Ausdruck des Geiste…
(Novalis,1772 - 1801, eigentlich Georg Philipp Friedrich Leopold Freiherr von Hardenberg, deutscher Lyrike…
Quelle: Novalis, Fragmente. Erste, vollständig geordnete Ausgabe hg. von Ernst Kamnitzer, Dresden 1929. Kunstfragmen…
Die drei Familienromane wurden zu jeweils unterschiedlichen Zeiten und literarischen Epochen geschrieben und nutzen Erzählmuster auf unterschiedliche Weise, um Geschichte und Gegenwart, Kontinuität und Veränderung der bürgerlichen Institution „Familie“ literarisch darzustellen.
6.1 „Buddenbrooks“
In einem Brief ordnet Thomas Mann selber das Buch einerseits der „Decadence“ zu, da es „mit einer Art spaßiger Hoffnungslosigkeit als Grundstimmung das Problem der Decadence behandelt.“86 Das Schlagwort des „Fin de siecle“ galt für ihn als eine „Formel des Ausklangs, die allzu modische und etwas geckenhafte Formel für das Gefühl des Endes, das Gefühl eines Zeitalters, des „Bürgerlichen“ war.87 Andererseits sah er den Roman als „städtische Chronik“ in der Nähe des Naturalismus.88
Thomas Manns Familienroman lässt sich jedoch nur schwer einer bestimmten literarischen Epoche bzw. Strömung zuordnen, er schrieb in einer Zeit, die als Schnittstelle zwischen Realismus (ca. 1850 - ca. 1890) und der „Frühen Moderne“ (1890 - ca. 1930) gilt.89 Der normative Anspruch der familiären Wertvorstellungen ist für diese Zeit ebenso typisch wie „moderne“ psychologisch motivierte Figurenproblematiken.90
Im Realismus grenzte man die Psychologie des Bewussten und Unbewussten noch aus und setzte das Werte- und Normensystem mit dem Bewusstsein gleich, wohingegen man die Nichteinhaltung von Normen sanktionierte. Normen galten als soziale Spielregeln, die „ein sich sozial zu integrieren strebendes Individuum einzuhalten hat,“ 91 und so wurde eine Figur, wenn sie gegen Normen verstieß, negativ bewertet und die Verzichtleistung dagegen hoch angesehen.
Realität war in der Epoche des Realismus das, was zwischen den Subjekten konsensfähig war.
Der Protagonist erfüllt seine Rolle und bleibt in der Gesellschaft integriert, statt auf sich bezogen seine Gefühle auszuleben. Er verändert sich nicht, sondern ist auf Konstanz seiner Merkmale und auf Entwickungslosigkeit festgelegt. Der Roman von Thomas Mann zeigt uns die Konsequenzen, die ein fremdbestimmtes Leben ohne Selbstverwirklichung für einzelne Figuren (Tony, Thomas, ...) hat. Anstatt neue Möglichkeiten zu eröffnen, dominiert „noch die ,realistische’ Erfahrung der Realität als ein zu Ende gehender Prozess“.92
Anders das Literatursystem der „frühen Moderne“, das „Entwicklungsprozesse im Erwachsenenalter zulässt und legitimiert“ und das Subjekt auch in dem darstellt, worin es nicht mehr konsensfähig ist93 Das Figurenbewusstsein erweiterte sich um den Bereich des Nicht- oder Unbewussten. Man ließ unbewusste Verhaltensantriebe zu, ohne die Figuren deswegen negativ zu bewerten, z.B. wurden Themen der radikalen individuellen und leidenschaftlichen Liebe,im Realismus noch eine Normverletzung, der die Figuren sich entsagen mussten, in der „Frühen Moderne“ legitim. Ebenso thematisierte man nun den Tod, Sterben wurde bewusster und der Sterbende zu Jemanden, der sich aus dem sozialen Bereich des Lebens ausgegrenzt fühlte und die Normen des Lebens in Frage stellte.
Zeitromane’ des Realismus, und als einen solchen können wir dieBuddenbrookslesen, beziehen die sozialen und gesellschaftlichen Bedingungen ein und sollen als Sitten- und Gesellschaftsromane ein Bild der jeweiligen Zeit widerspiegeln. „Er soll uns, unter Vermeidung alles Übertriebenen und Hässlichen, eine Geschichte erzählen, an die wir glauben. Er soll zu unserer Phantasie und unserem Herzen sprechen, Anregung geben, ohne aufzuregen; er soll uns eine Welt der Fiktion auf Augenblicke als eine Welt der Wirklichkeit erscheinen, soll uns weinen und lachen, hoffen und fürchten, am Schluss aber empfinden lassen, teils unter lieben und angenehmen, teils unter charaktervollen und interessanten Menschen gelebt zu haben, deren Umgang uns schöne Stunden bereitete, uns förderte, klärte und belehrte.“94
Die Wertvorstellungen des deutschen Bürgertums und seine Lebensinhalte und -werte werden zu Forderungen der Literatur und nach dem Scheitern der großen Ideale in der Revolution 1848, die in den Romanen verdrängt oder diffamiert werden95, galten nun Lebenserfahrung und der gesunde Menschenverstand als wichtige Prinzipien.
Eine formale Tugend des Bürgertums waren Objektivität, Maß und Ordnung, und diese Strenge zeigte sich in einer sprachlich-intellektuellen Zucht. Statt einer pathetischen Sprache waren Dialoge nun gekennzeichnet durch Unkompliziertheit und der Hinwendung zur realen Welt.96 Der realistische Stil schildert die Wirklichkeit in genauer Beschreibung, spielt im bürgerlichen Milieu, mit durchschnittlichen Menschen. Anders als im Naturalismus, werden Randexistenzen, Krankhaftes und Negatives nicht zum Thema.
Fontane - er gilt als Begründer des modernen Gesellschaftsromans und übte auf Thomas Mann großen Einfluss aus - spricht von dem „Wahren“, das er in der „Widerspiegelung des wirklichen Lebens dargestellt wissen will.“97
Vieles vom bisher Gesagten ist im Familienepos Th. Manns zu erkennen: Dieses Sprachkunstwerk, an dessen Sätzen man sich nicht satt lesen kann, war der „bürgerlichen Form“ verbunden und wurde bereits kurz nach seinem Erscheinen von Kritikern wegen seiner Sprache und des Stils hervorgehoben, beides vom Autoren beheimatet in der niederdeutsch-hanseatischen Sprachlandschaft, „das Instrument eines eher langsamen, spöttischen und gewissenhaften. Geistes“.98
Thomas Mann selbst betonte die Unterhaltungsfunktion des Romans, auch wenn ihm damit eine Anpassung an den Lesergeschmack vorgeworfen wurde99 und bewertete den Humor in den „Buddenbrooks“ als besonders positiv und stark.100 Besonders hervor hob er, dass „der Zug zum Satirischen und Grotesken die große epische Form nicht nur nicht stört, sondern sogar unterstützt.“101
Im formalen Sinn war es für ihn vor allem ein deutsches Buch: „.es lässt sich wohl hören, dass dies Werk in französischer Sprache ein Unding und Monstrum wäre“. 102
Die Erzählstruktur ist linear, die Ereignisse von Heirat, Geburt, Begräbnis werden neben den auftretenden Ereignissen chronologisch, mit Datum und Jahreszeit erzählt. Es finden sich keine Rückblenden oder Vorgriffe in die Zukunft.
Das Verhältnis von erzählter Zeit und Erzählzeit wechselt, manche Ereignisse werden ausführlicher als andere geschildert, insbesondere die im Bürgertum beliebten Briefe dienen als ein Stilmittel der Zeitraffung. In den ersten Teilen des Romans gibt es noch einen großen Unterschied zwischen erzählter Zeit und Erzählzeit, beide nähern sich zum Schluss, wenn Hannos Leben erzählt wird, immer mehr an.
Der Autor präsentiert die Geschichte durch einen neutralen Erzähler. Fundament ist das „objektive (.) Erzählen, in dem sich die schildernde Darstellung mit der direkten Rede verbindet.“103 Die vielen verschiedenen Figuren verlangen eine Multiperspektive im Darstellen der Ereignisse: z.B. des Firmenjubiläums, das aus der Sicht von Thomas Buddenbrook, oder: das Nahen des Weihnachtsfestes, das aus Hannos Perspektive erzählt wird.
Leser und Erzähler haben nie mehr Wissen als die Figur selber.
Die Zeitform ist fast durchgehend die des Imperfekts. In Präsens lesen sich die Spannung tragenden Situationen (z.B. Senatorenwahl), oder wenn die Geschwister sich in ihren Eigenarten darstellen.
Auf deren Charakter schließen wir u.a. durch Selbstcharakterisierungen, z.B. wenn Tony des Öfteren von sich sagt, dass sie „eine Gans ist“ oder:
S. 456
Denn ein so dummes Weib ich bin, …
Christian sieht sich als ein gescheiterter Versager:
S.539
Theater ..und sowas... Das taugt nichts, glaube deinem Onkel. Ich habe mich auch immer viel zu sehr für diese Dinge interessiert, und darum ist auch nicht viel aus mir geworde…
Thomas Mann ist ein Könner der Personenbeschreibung. Stets erkennen wir die Personen an ihren geläufigen Ausdrücken und der glaubwürdig-realistischen und individuellen Figurensprache, die die Figuren charakterisiert,oft auch humoristisch persifliert, z.B. in der floskelhaften Sprechweise Grünlichs:
S. 97
Aber ich inkommodiere nicht länger, nein, bei Gott, Frau Konsulin, ich inkommodiere nicht länger! Ich kam in Geschäften.allein wer könnte widerstehen. Nun ruft die Tätigkeit…
Zahlreiche Sprachvarianten neben dem Hochdeutschen tragen zur Charakterisierung und Originalität der Figuren bei:
Französisch und Plattdeutsch beim Großvater, was ihn als gebildeten und volksnahen Menschen kennzeichnet:
S. 43
Na, min Söhn Johann! Wo geiht di da…
Monsieur Gotthold- voila! . Ein Mann von conduite dein Herr Stiefbruder, Jea…
Dialekte wie Bayrisch karikieren die Figur Permaneder:
S. 343
Die Zugspitz’ wird’s halt net sein, aber a weng kraxeln wermer doch, und a Hetz wermer ham, a Gaudi a sakrisches, geltens, Frau Grünlich…
Das Ostpreußische charakterisiert das Kinderfräulein:
S.336
Ja, ja, Tonychen, mein Kindchen, . Schlaf nur, wirst morgen früh aufstehen müssen, wirst nicht ausgeschlafen habe…
Als Schriftsteller der Frühen Moderne wählt Thomas Mann auf der Discours-Ebene im Zusammenhang mit der Zulassung und Integration von irrationalen unbewussten Verhaltensantrieben neue Darstellungsformen wie innere Monologe und Bewusstseinsstrom,z.B. im Selbstgespräch von Thomas Buddenbrook, in dem er sein Handeln und Leben für die Werte der Firma rechtfertigt und seinem Onkel die Fähigkeit der Erkenntnis dessen, was Firma und Familie darstellen, abspricht .
S. 275
Du hast es nicht sehr gut gehabt, Onkel Gotthold, dachte er. Du hast es zu spät gelernt, Zugeständnisse zu machen, Rücksicht zu nehmen. Wenn ich wäre wie du, hätte ich vor Jahr und Tag bereits einen Laden geheirate…
Im Schopenhauer Erlebnis Thomas Buddenbrooks wechselt die direkte Rede zum inneren Monolog in die erlebte Rede, beides geht ineinander über, „verringert] die ironische Distanz und lässt die Lektüre des Romanabschnitts für den Leser geradezu zu einem ,Schopenhauererlebnis’ zweiten Grades werden.“104
S. 657f
In meinem Sohne habe ich fortzuleben gehofft? In einer noch ängstlicheren, schwächeren, schwankenden Persönlichkeit? Kindische, irregeführte Torheit! Was soll mir ein Sohn? Ich brauche keinen Sohn!. Wo ich sein werde, wenn ich tot bin? … In allen denen werde ich sein, die je und je Ich gesagt haben, sagen und sagen werden: besonders aber in denen, die es voller, kräftiger, fröhlicher sagen, Und während er es nun begreifen und erkennen durfte - nicht in Worten und auf einander folgenden Gedanken, sondern in plötzlichen beseligenden Erhellungen seines Inneren - war er schon frei,…
Nichts begann und nichts hörte auf. Es gab nur eine unendliche Gegenwart, und diejenige Kraft in ihm, die mit einer so schmerzlich süßen, drängenden und sehnsüchtigen Liebe das Leben liebt…
Thomas Mann ist der „reichste Autor deutscher Sprache“ und als Humorist mit all seinen komischen Effekten schwer zu übertreffen.105 Dem Humor kommt die wichtige Rolle zu, Optimismus auszudrücken, negative Seiten der Wirklichkeit zu überdecken und Gegensätze zu überbrücken.106 Das wichtigste stilistische Prinzip ist dabei die Ironie, durch sie wird die dargestellte erlebte Wirklichkeit nicht mehr ganz ernst genommen, sondern „vermittels Herausheben ihrer Widersprüche, Absonderlichkeiten und Brüche des vordergründigen Scheins entkleidet.“107 Dem Autor dient sie nicht als „kalten Spott sondern ...[als] Zug der Objektivität“108 und ist in ästhetischer Hinsicht die Form, in der Th. Mann in der Zeit des fin de siecle Halt sucht und findet.109
Sie zeigt sich im Kontrast zwischen Realität und Selbstdarstellung der Personen, z.B. bei Tony und Christian, in der karikierenden und sarkastischen Darstellung von Lehrern und Politikern, der Beschreibung der Revolution, die ihre Härte verliert oder in der immer wiederkehrenden Äußerung „Sei glücklich“ von Sesemi Weichbrodt, insofern es niemals eintrifft.110
Zum Personalstil Manns gehört es, 111 dass die Syntax den Gedanken- und Redefluss nachbildet, „mit kleinen Stauungen und Schnellen und Mäandern und Kaskaden. Und ab und zu einem Wasserfall.“112 Syntaktisch und rhythmisch oft geballt, umfasst sie lange und gedehnte Beschreibungen und dient sowohl der indirekten Charakterisierung der Personen (z.B. ersten Auftreten Grünlichs) und der Schilderung einer Atmosphäre, z.B. der musikalischen Hingabe Hannos:
S. 506
Irgend ein ganz einfacher harmonischer Kunstgriff war durch gewichtige und verzögernde Accentuierung zu einer geheimnisvollen und preziösen Bedeutung erhoben. Irgend einem Accord, einer neuen Harmonie, einem Einsatz wurde, während Hanno die Augenbrauen emporzog und mit dem Oberkörper eine hebende, schwebende Bewegung vollführte, durch eine plötzlich eintretende, matt hallende Klanggebung eine nervös überraschende Wirkungsfähigkeit zu teil …
S. 748
Und nun begannen bewegte Gänge, ein rastloses Kommen und Gehen von Synkopen, suchend, irrend und von Aufschreien zerrissen, wie als sei eine Seele voll Unruhe über das, was sie vernommen …
„Mir wirft man meine langen Sätze vor und findet meinen Stil ,pompus‘ und ,ponderous’.“113
Aber es gibt zudem noch einen ganz anderen Stil, einen wissenschaftlichen Traktatstil im Typhuskapitel und in den allgemeine Reflexionen, und ausgedehnte psychologische Deutungen in den letzten beiden Teilen des Romans:
S. 752
In der zweiten Woche ist der Mensch von Kopf- und Gliederschmerzen befreit; dafür ist der Schwindel bedeutend heftiger geworden, und in den Ohren ist ein solches Sausen und Brausen, dass es geradezu Schwerhörigkeit hervorruft. Der Ausdruck des Gesichts wird dum…
Th. Mann scheut keine schönen Wiederholungen und auch das Leitmotiv (Atlasschleifen z.B., die von Tony in ihren Handarbeiten verarbeitet werden) entfaltet auf den Leser eine wiedererkennende „behagliche“ (Maar) Wirkung, da beides den Eindruck der Unveränderlichkeit erweckt und gleichzeitig anzeigt, wieviel Zeit mit all ihren historischen und familiären Veränderungen vergangen ist. Die ständige Wiederkehr eines Vorgangs, wie z.B. der Verweis Tonys auf ihre gescheiterten Ehen und auf ihre ,politischen Kenntnisse’ aus den Gesprächen in Travemünde, stellt Gegenwart und Vergangenheit nebeneinander und friert die gewesene Dynamik ein.114 Solche wiederkehrenden Worte oder Wortgruppen erhalten eine Symbolik und verknüpfen Textpassagen miteinander - Thomas Mann spricht hier von der „vor- und zurückdeutenden magischen Formel“.115
6.2. Die modernen Familienromane
Im Gegensatz zur Familiensage von Thomas Mann ist die Erzählstruktur in den modernen Familienromanen von Geiger und Ruge achronologisch und diskontinuierlich, beides macht die Relativierbarkeit von menschlichen und moralischen Werten erkennbar.116 Die Wahl der unterschiedlichen Perspektiven statt einer Monoperspektive soll zeigen, dass niemand „alleinigen Anspruch auf die Wahrheit bzw. die wahrheitsgetreue Darstellung besitzt und dass es keine monoperspektivische historische Wahrheit geben kann.“117 Diese Romane sind weder an ein chronologisches Nacheinander gebunden noch an die Einheit von Zeit, Ort und Handlung und können so die Fragmentierung von Raum und die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, die die Geschichte des 20.Jahrhunderts in besonderem Maße auszeichnet, mit genuin literarischen Mitteln erfassen. 118
Historische Wissensbestände werden beim Leser vorausgesetzt: die Zeit des Nationalsozialismus und die der DDR-Wende.
Der fragmentarischer Charakter zeigt sich in einem offenen Schluss.
In Eugen Ruges Roman „In Zeiten des abnehmenden Lichts“gibt es drei Erzähl-Linien:
1. Den 90.Geburtstag von Wilhelm im Jahr 1989, das zentrale Ereignis und das „geheime Zentrum“119 des Romans. Dieser demente Greis ist noch fest im Kommunismus verankert und seit 70 Jahren Mitglied in der Kommunistischen Partei.
Seine Frau sehnt sich danach, dass er stirbt, ebenso hoffen die Söhne und Enkel auf Befreiung - eine Parallele zur Hoffnung auf ein Ende der erstarrten Ideologie des DDR- Staates. 120
2. Die Reise Alexanders wird als Rahmenhandlung in die Familiengeschichte eingeblendet. Alexander/Sascha/der Autor geht 2001, das Jahr der Erzählgegenwart, nach einer Krebserkrankung auf Spurensuche in der Familiengeschichte. Erzählanlass ist seine Erkrankung, durch sie rücken Gedanken über die Endlichkeit des Lebens und über Unvergängliches in den Mittelpunkt. So reist er nach Mexiko, um der Vergangenheit seiner Großmutter nachzuspüren, die dort im Zweiten Weltkrieg und in der Nachkriegszeit im Exil gelebt hatte. Er wird zum Aussteiger, und findet Beruhigung (S. 407, Er schaukelt leicht, stößt sich.) in dem Erleben der Gleichheit und der Wiederkehr. (S. 425, Einzig das Knirschen.)
3. Und dann gibt es die zwischen diesen beiden Strängen erzählte Familiengeschichte in chronologischer Wiedergabe: 1952, 1959, 1961, 1966, 1973, 1976, 1979, 1991, 1995, unterbrochen von dem wiederkehrenden Datum 1989. Das Buch beginnt im Jahr 2001 und führt im zweiten Kapitel in das Jahr 1952 zurück.
Der Roman hat insgesamt 20 Kapitel, Vergangenheit und Gegenwart kreuzen sich in der Abfolge der Kapitel: fünf tragen den Titel „2001“ und erzählen aus Alexanders gegenwärtiger Perspektive, sechs Kapitel haben als Überschrift das Datum „1. Oktober 1989“, den Geburts- und Todestag von Alexanders Großvater. Dieser Tag wird aus den sechs verschiedenen Perspektiven der Familienangehörigen wiedergegeben. (Wilhelm, Charlotte, Irina, Nadjeshda, Kurt und Markus)
In Eugen Ruges Roman wird der Erzählfluss durch Montage unterbrochen: Der Beginn spielt in der Gegenwart, um dann aus der Retrospektive und der Erinnerung die Vergangenheit rückwärts zu erzählen.
Die Handlung des Romans hat unterschiedliche Zeitformen:
- Das Präteritum in den Kapiteln 1 - 10, 12 - 14, 16 - 19
- Das Präsens in den Kapiteln 11, 15, 20
- und Präsens und Futur II im Kapitel 20. Gewöhnlich verwendet ein erzählender Text das Präsens und das Präteritum, hier sind lediglich einige reflektierende oder erinnernde Passagen im Präsens gehalten. Insofern kommt der außergewöhnlichen Verwendung des Futurs in Kapitel 20 eine besondere Funktion zu und könnte auf eine offene Zukunft Alexanders verweisen oder aufgrund seiner Krankheit auf eine bereits abgeschlossene Zukunft.
Das multiperspektivische Erzählen zeigt ein Ereignis von Wilhelms Geburtstagsfeier, z.B. die Blumenüberreichung und Ordensverleihung, aus den verschiedenen Wahrnehmungen der anwesenden Personen. Dadurch wird einerseits eine komisch-ironische Wirkung erzielt, die dem Leser eine weitere Erkenntnisperspektive gibt und die Spannung steigert, da jede Person die Situation und auch die anderen Personen anders bewertet.
Andererseits reflektiert der Autor damit das heterogene Erscheinungsbild der Familie, setzt es wie ein Puzzle zusammen und spiegelt eine Entfremdungsoptik wider, die die scheinbar kollektiv geteilte Wirklichkeit in individuelles Bewusstsein separiert. 121
Der anonyme personale Erzähler schlüpft in die Personen und gibt jedem das gleiche Mitspracherecht über die Familiengeschichte, ohne dass einer Generation eine besondere Position zukommt, und macht dadurch Motivationen, Gedanken, und die gesellschaftliche Position der Figur erkennbar. Im Verband der Familie wird jedes Mitglied mit den an die verschiedenen Generationen und Zeiten gebunden Perspektiven der anderen Mitglieder konfrontiert und kann sich auf diese Weise am besten entfalten.122
Es gibt kein chronologisches Erzählen, weil die durchgehend beibehaltene Multiperspektivität der Erzählung Abschweifungen in die noch fernere Vergangenheit beinhaltet und der Roman darauf angelegt ist, „etwas von der inneren Erfahrung der Überwältigung, der nachwirkenden Last und Bedrohung, der Faszination und der Unverständlichkeit der Geschichte mitzuteilen.“123
Jede Figur erzählt Privates und Persönliches und für die damalige Zeit Typisches, hebt für sie alltägliche und bedeutsame Elemente hervor, ist Individuum und Stellvertreter für bestimmte Themen (so z.B. ist Irinas Thema: ihre Kochrezepte). Die weiblichen Figuren thematisieren l. Ingrid Meyer Legrand, in Jahrbuch, l. Ingrid Meyer Legrand, in Jahrbuch.Keine Antwort, somit auch kein Interesse.
S. 329
- Schau, sagt sie, alles, was du machst, verspricht nicht den geringsten Erfolg. Weil du nichts anpacken wills…
In Geigers Roman geben nicht, wie man erwarten könnte, die Enkelfiguren die familiäre Vergangenheit wieder. Stattdessen erzählt in den vergangenheitsbezogenen Kapiteln ein heterodiagetischer Erzähler aus der Perspektive von Vertretern anderer Familiengenerationen.124
In jedem Kapitel des Romans wird ein bestimmter Tag zwischen 1938 und 2001 aus der Erinnerung einer Generation/eines Protagonisten wiedergegeben und die erzählte Situation reflektiert, so dass Vergangenheit und Gegenwart der Erzählstruktur sich durchdringen; und da in der dritten Person erzählt wird, erschließt sich dem Leser erst beim Lesen, um welche der Personen es sich hierbei handelt. Die Lebensgeschichten der Personen sind auf eine bestimmte Situation beschränkt und versinnbildlichen gleichzeitig eine zeitliche Epoche, man spricht von einem „postmodernen Puzzle“. Das Persönliche wird „in eine Art objektive correlative verlagert, [es] vermeidet sowohl naive Lösungen von Familienkonflikten wie auch das rein Dokumentarische der Zeitgeschichte“.125
Ein Neben- und Übereinander von Erzählsträngen spiegelt das Dokumentarische einer reinen Zeitgeschichte wider. Literaturwissenschaft und Geschichte, Fiktion und Wirklichkeit, gehen ein Verhältnis ein, und stets besitzt die Ansprache des Lesers und das fiktionale Erzählen für den Autor die größere Bedeutung126, z.B.:
Alma erzählt in der Vergangenheit von den noch weiter in der zurückliegenden Ereignissen ihres Lebens: den Kriegs- und Nachkriegszeiten der österreichischen Republik und der Wende im Jahr 1989:
S. 346
Also beginnt sie zu erzählen von den Umstürzen bei den Nachbarn im Osten, von Ungarn, wo die Diktatur des Proletariats dieser Tage zu Ende gegangen ist, von der Entwicklung der DDR …
S. 348
Ich weiß noch genau, wie wir uns kennengelernt haben, da waren wir noch ein bisschen jünger als heute, so jung wie das Jahrhundert damals ... die zwanziger und dreißiger Jahre, ich glaube, das war bei mir, was man die Blüte des Lebens nennt. ..für dich waren die fünfziger Jahre die Blüte des Lebens. Ich glaube, in den fünfziger Jahren hast du die Zeit wiedergefunden, in die du hineingeboren wurdest, die Zeit vor dem ersten Weltkrieg …
Peter und Ingrid erleben die 60er und 70er Jahre:
S. 259
Die Probleme begannen in den Jahren des zweiten Studienabschnitts, als Ingrid bis an den Rand des Nervenzusammenbruchs schuftete und von Peter keine Unterstützung bekam. Das begann schon in Hernals los, noch bevor Peter die Lizenzen seiner Spiele verkaufte. Mit dem Verkauf der Lizenzen Ende 1960, während der Schwangerschaft mit Sissi, hoffte Ingrid, dass jetzt ein besseres Leben beginnen werde. Stattdessen wurde es schlimmer. … Die vielen einsamen Spaziergänge am Wilhelminenberg mit dem Kinderwagen und später das langweilige Entenfüttern mit Sissi …
S. 207
Als der ockerfarbene Kleinbus, den Peter sich ausgeborgt hat, hupend in die Einfahrt biegt, ist es kurz nach vier …
S. 212
Du musst dich damit abfinden, dass unsere Tochter Stahlrohrmöbel bevorzugt. …
S. 238
Drei Aufnahmen und Telefonate um ihre Lohnzettel mit der AUVA und mit dem Rathaus. .. Beide schicken ihr die Lohnzettel von 196…
S. 303
Und er weiß, dass die Jahre vor Ingrids Tod die am wenigsten erfolgreichen Jahre seines Lebens waren, das will was heißen …
Vor allem in den letzten Jahren hatten sie viel gestritten, meistens war der Ausgangspunkt eine Kleinigkeit…
Philipp ist derjenige, der den Beginn des 21. Jahrhunderts verkörpert:
S. 7f
Er hat nie darüber nachgedacht, was es heißt, dass die Toten uns überdauern. …
Philipp sitzt auf der Vortreppe der Villa, die er von seiner im Winter verstorbenen Großmutter geerbt ha…
In der Metafiktion des eiternden Zahns von Richard oder der letzten Spielregel in Peters Spiel bricht der Autor den Bezug zur Realität:
S. 23
Wegen eines eitrigen Backenzahns waren 1955 die Feiern zur Unterzeichnung des Staatsvertrags für Richard ins Wasser gefallen. Er fehlt auf sämtlichen offiziellen Fotos und in allen Filme…
S. 202
Vaterland gerettet, doch das gilt nicht für ihn. Er, der den Staatsvertrag mit ausgehandelt hat, aber auf den wichtigen Fotos fehlt. Pech gehab…
S. 255
An dem Tag, an dem die Verhandlungen um den Staatsvertrag zum Abschluss gekommen waren und Ingrid erst um elf Uhr zu Hause eintraf, weil sie mit Peter im Magazin geschlafen und sich vertrödelt hatte, rechnete sie mit einem Riesenwickel. Wegen der Zahnschmerzen ihres Vaters, die so akut geworden waren, dass sogar Sehstörungen auftraten, fiel aber niemanden etwas au…
In diesen modernen Familienromanen gibt es nicht die Platzierung in einer längst vergangenen Zeit und auch keinen „raunenden Beschwörer des Imperfekts“.127 Statt einer chronologischen Darstellung ist eine neue nicht kontinuierliche Zeitstruktur und mit ihr das Präsens charakteristisch.128. Arno Geiger schreibt durchgängig in Präsens und nicht im Präteritum, so dass im Moment des Lesens die Zeit vergeht129. Er wählt diese Zeitform, um nahe an die Figuren herangehen zu können. „Im Ergebnis ist sowohl die Zeithierarchie aufgebrochen, die etwas Wertendes hat, weil weniger wichtig erscheint, was länger her ist, als auch die Generationenhierarchie.“130
Diese moderne Form der Zeitstruktur hat ihren Grund in der Gleichberechtigung aller Figuren, damit „nicht die Figuren der älteren Generation nur Zuträger der Enkelgeneration“ sind.131 Jeder Zeit und ihrem Protagonisten wird dabei die gleiche Bedeutung eingeräumt, so dass das, was länger her ist, nicht weniger wichtig ist.132 Der Leser erlebt die frühere Zeit der Familiengeschichte so, als sei es die Gegenwart. Das Vergangene ist präsent, aber doch vergangen und somit dem Vergessen von Phillip anheim gegeben. Geiger spricht von einer „Reibungsfläche zwischen Erinnern und Vergessen“.133
Das Inhaltsverzeichnis besteht aus Zeitangaben, von denen dreizehn auf die Gegenwart, vier auf die Zeit der Großeltern und vier auf die der Eltern entfallen. Im Hauptstrang fallen Erzählzeit und erzählte Zeit zusammen, festgelegt auf das Jahr 2001, in ihm kommt es zu einer Vergangenheitsbewältigung, bezogen auf die Gegenwart.134
Die Sprache wird im Roman kontrolliert eingesetzt, so dass dieser Roman von einer „hochkomplexe[n] formale[n] Grundlage, die die Geschichte ausmacht“, getragen wird.135 Geiger setzt hier das um, was er im Studium während seiner literarischen Sozialisation136 beim Experimentieren mit Form und Sprache lernte: „Diese frühen Jahre sind eine ganz wichtige Phase meiner Entwicklung, ohne die die aktuellen Bücher gar nicht denkbar wären. Die Experimente und Erfahrungen, die ich damals im Bereich der Prosa gemacht habe, bilden heute ein relativ breites Fundament, von dem aus ich nun weiter schreibe.“137
Arno Geiger „begleitet“ seine Personen138 in Form des inneren Monologs oder der erlebten Rede und gibt die innere Welt der Protagonisten, deren Reflexionen, Aktivitäten und
Gefühle aus der persönlichen Sicht und in ihrem je eigenen Sprachduktus wieder. So fördert er beim Leser das Verständnis für die Personen und eine Identifikation mit deren sozialen Rollen in den dargestellten Handlungssituationen.
Erzählformen fließen ineinander, wenn aus der erlebten Rede ein innerer Monolog oder ein stream of consciousness wird oder der vermeintliche Leser durch Apostrophe angesprochen wird.
Im Stilmittel der „erlebten Rede“ befindet sich der Erzähler nicht in einer auktorialen Höhe, sondern nahe an den Figuren. (Im Gegensatz dazu würde eine Ich-Perspektive die Sichtweise auf die Figur, die spricht, hervorheben und betonen.) „Die erlebte Rede ist nicht nur ein Handwerkszeug, sie ist eine Methode, die Welt zu erschließen^..) im Wechselspiel verschiedener Innenwelten, im Erfassen von Stimmungen, wie sie entstehen und sich verändern, oft nur durch eine Geste oder das richtige Wort.“139 Der Autor „kennt seine Figuren ganz genau und führt sie dem Leser plastisch vor Augen, und doch lässt er ihnen genügend Spielraum.“140
Ingrid S. 146
… Nur zu, das wollen wir mal sehen, dann wird sich zeigen, wofür die Erfahrungen, die er beim homo sovieticus gesammelt hat, zu gebrauchen sind, da wird er nämlich gegen eine Wand laufe…
Alma S. 355
… Weshalb er seiner Schwester den Garten in Schottwien überschrieben hat, das hat sich ihr nie erhellt. Und weshalb er 1938 ohne Angabe plausibler Gründe sein Geld aus dem Geschäft ihrer Mutter gezogen hat, das hat sich ihr ebenfalls nie erhellt. Und warum die Lüge mit Gastein ...Almas Träume:
S. 371
Gesagt wird vie…
Das Vergessen ist der beste Gehilfe des Henker…
Man lebt nicht nur einmal einmal …
Dialoge werden in den Erzählfluss integriert und oft nicht wörtlich wiedergegeben. Gesagtes, Gedachtes, Figurenrede und Erzählerstimme verwischen sich, die Erzählerstimme nimmt dabei die Merkmale mündlicher Rede an, die Dialoge klingen natürlich und nicht nach Schriftsprache, eine „Ästhetik der Beiläufigkeit“.141
Die Protagonisten äußern sich in
- Fachsprachen mit Fachausdrücken und bringen damit ihre Kompetenz und intellektuelle Entwicklung zum Ausdruck, z.B. im Kapitel 17, als Peter auf dem Weg in den Urlaub seiner beruflichen Tätigkeit als Verkehrsexperte für Kreuzungen nachgeht.
S. 308
Es ist ein Knoten mit drei Ästen, ein schiefes T, wo ein Nebenast in eine stark mit Durchgangsverkehr belastete Hauptstraße stößt. Der schwächere Ast hat lediglich lokale Bedeutung und mündet von unten in spitzem Winkel in den Hauptast. Das bringt Nachteile bei der Übersichtlichkeit, zumal die Kreuzung durch private Liegenschaften in der Breitenwirkung beengt ist. Wie Peter feststellt, werden auf der - für sich betrachtet - übersichtlich verlaufenden Hauptachse hohe Geschwindigkeiten gefahren. Trotzdem gibt es für abbiegende Fahrzeuge keinerlei Verzögerungs-und Vorsortierungsspuren, dadurch auch keinen Stauraum…
Ebenso zwischen Johanna und Philipp im 18. Kapitel:
… Also über den Wassergehalt der Wolken … die zu untersuchende Luft durch Kohlensäure absorbierendes Material leitete und den C0 2 Gehalt aus der Gewichtzunahme der absorbierenden Substanzen erschloss ...
- der Umgangssprache (Vulgarismen) und im Dialekt in emotionalen Dialogen:
S. 332
„Schleicht’s euch“wird von Philipp ausgerufen( Bedeutung: „Haut ab, geht weg.“).
S. 289
„Das zipft mich so an,..“von Sissi geäußert in der negativen Stimmung der Urlaubsfahrt. Es bedeutet: „es ärgert mich“, „ es macht mich verdrossen“.
S. 291
„grindig“,was soviel heißt wie „ekelhaft“, „hässlich“
Bedeutsame weitere Stilmittel sind:
- Sprachwitz: S. 30 Ein Minister a.D. Adé, wie’s die Sieben Schwaben sagen. Auf Wiedersehen, servus.
- Humor (in der komischen Übertreibung):
S. 343
Bis in sechs Wochen haben wir das ausgestanden, Herr Doktor, beruhigte ihn die Krankenschwester. Und Richard beinah gütig: Das will ich allen Mitgliedern des Hohen Hauses empfehlen.
S. 311
Voraussetzung für eine derartige Ausbildung wäre allerdings, dass man dieses Haus niederreißt. Nette Aussichten. Die Miene der Frau bleibt ziemlich ausdruckslo…
- Ironie, diese bereits im Titel: Die Floskel „Es geht uns gut“ wird verwendet, wenn keine ausführliche Antwort / Auskunft gegeben wird; sie ist nichtssagend und lässt keine Widerrede zu,142 ist eine Schutzbehauptung, um keine weitere Auskunft auf Fragen geben zu müssen.143 Diese Floskel als kurzer, fünfsilbiger Postkartengruß bedeutete in Österreich eine Portoermäßigung, die Alma skeptisch und als ein staatliches Prinzip beurteilt, das geringe Kommunikation unterstützt:
S. 28
„.als ob man an Staatsbürgern interessiert sein müsse, die für eine Ersparnis von zwei Schillingen darauf verzichteten, mehr mitzuteilen als nur Mama, mir geht es gut…
Kurz darauf kommt Alma auf diese Floskel zurück, sie erzählt von familiären Konflikten und erkennt, dass die Lebenswirklichkeit der konventionellen Phrase widerspricht. Es geht eben keiner Person im Roman gut, es herrscht Kommunikationsunfähigkeit und letztendlich erzählt der Roman, was hinter der Floskel steht.144
S.33
Unterm Strich, weiß Gott: Von gut ist das alles weit entfern…
Der Verfasser bedient sich weiterhin dessen, was er in seiner literarischen Sozialisation als Handwerkszeug lernte, z.B.
- das ,pars pro toto“-Prinzip: Der Bienenstock besitzt Symbolcharakter und weist auf frühere Ereignisse hin, auf die Enteignung und Deportation der jüdischen Familie145 Als Alma den Bienenschwarm auseinander treibt und die Bienenkönigin tötet, ist dies ein Sinnbild für die Zerstreuung ihrer Familie.
- das Stilmittel der Metonymie: Die Unordnung im Haus wird parallel gesetzt zur Unordnung in der Familie und in der Welt: Ebenso deutet das Gebiss Richards auf die historische Situation um 1955 hin, als er noch Minister war.
Bereits die literarische Epoche des Realismus verlegte Prozesse des Alterns und Sterbens in die Winter- und Herbstzeit oder in die Dämmerung und wählte eine Tages- und Jahreszeitensemantik.146 Im Roman von Th. Mann ist z.B. das herbstliche Wetter beim Kuraufenthalt in Travemünde „öde“, „müde“, „starr“, (S. 665ff), und spiegelt mit den dazu gehörenden Naturbeschreibungen eine Untergangs- und Niedergangsatmosphäre wieder. Metaphern wie z.B. das Wetter und das Wasser werden auch bei Geiger zu Leitmotiven: In fast jedem Kapitel spielt sich die Handlung vor Sonne oder Regen ab und zumal Philipps Partnerin Meteorologin ist, wird das Wetter oftmals zum Thema bzw. Ersatzthema ihrer Gespräche. Das Wetter ist wechselhaft wie die Beziehungen und das Leben und dient als Metapher für das Leben in seiner Wechselhaftigkeit und Unbeständigkeit.147 So unvorhersehbar wie das Wetter mit seinem permanenten Wechsel, (S. 168: man kann sich„aufs Wetter genauso wenig verlassen wie auf so vieles“) so temporär sind Ereignisse im Familienleben und können dieses durch ihre jeweiligen Umstände und Geschehnisse verändern.
Eine weitere Metapher ist außerdem das Wasser der Donau, es verkörpert Zufälligkeit, Vergänglichkeit und stetige Veränderung (z.B. die tödliche Bootsfahrt von Ingrid).
7. Temporale und zeitgeschichtliche Situierung der Romane
Ich weiß nicht, ob die Geschichte sich wiederholt: Ich weiß nur, dass die Menschen sich wenig änder…
(Octavio Pa…
Eine Leistung des Familienromans ist die „Verknüpfung von Einzelschicksal und Weltenlauf“148. Alle drei von mir untersuchten Romane stehen auf dem Hintergrund der Geschichte - historische Ereignisse werden durch den subjektiven Blick der Autoren anschaulich wahrgenommen - und zeigen uns, wie das Leben der Individuen durch das politische System beeinflusst wird und dass man stets in einem Kontext sozialer, politischer und wirtschaftlicher Zwänge lebt.
Sie sind somit zeitabspiegelnd und geben die Außenwelt realistisch, mit realen Erscheinungen wieder und informieren uns als Leser über damalige Vorkommnisse.
7.1 Das 19. Jahrhundert im Spiegel des Romans „Buddenbrooks“
Im folgenden die genealogische Struktur der Familie Buddenbrook:
Der Roman von Thomas Mann spielt in der Zeit von Oktober 1835 bis Oktober 1877 in Lübeck. Für den Autor waren für die Niederschrift historische Studien notwendig.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Die Datierungen der Ereignisse gleichen in ihrer Objektivität einer Chronik149, in deren Mittelpunkt die Familie und ihre vier Generationen stehe. Die dritte Generation um Thomas Buddenbrook bildet den Schwerpunkt des Romans, Hannos kurzes Leben wird mit wenigen zeitlichen Lücken erzählt.150
Der Autor wählt einzelne wichtige Ereignisse aus und gibt diese chronologisch wieder.
Das Buch umfasst 11 Teile mit einer unterschiedlichen Zahl von Kapiteln. Die zehn Kapitel des 1. Teils geben eine geniale Exposition, denn bereits dort treten fast die gesamten Figuren auf und benennen Ort,Thematik und die Problemstellungen.
1. Teil. 10 Kapitel
2. Teil. 11 Kapitel
3. Teil. 9 Kapitel
4. Teil 11 Kapitel
5. Teil 8 Kapitel
6. Teil 11 Kapitel
7. Teil 8 Kapitel
8. Teil 9 Kapitel
9. Teil 4 Kapitel
10. Teil. 9 Kapitel
11. Teil. 4 Kapitel.
Die Kapitel erzählen die Zeit der Familie Buddenbrook zwischen 1835 und 1877, es kommt sowohl zu allgemeinen Überblicken als auch zu starken Verdichtungen, letzteres bei der ausführlichen Erzählung von kleineren Zeiträumen.151
Bereits beim Tischgespräch zu Beginn des Buchs wird mit der Situation der Zeit bekannt gemacht. In einer familiären Anekdote, veranschaulicht durch Pastor Wunderlich, finden sich gesellschaftliche und politische Zeitbezüge zur Franzosenzeit 1806,mit General Blücher, der vor Napoleon flieht, als dieser in die Stadt eindringt und sie plündert.
S. 24
Fürst Blücher war fort, die Franzosen waren in der Stad…
Der alte Johann Buddenbrook, so erfahren wir, hatte in den napoleonischen Kriegen Gewinne gemacht:
S. 12
… war anno 13 vierspännig nach Süddeutschland gefahren, um als Heereslieferant für Preußen Getreide einzukaufen …
Die Restaurierung der alten Lübecker Verfassung von 1813 betonte die Privilegien der Fernhändler und erteilte Umlandkaufleuten nicht die Genehmigung für den Senatsbeitritt: Davon profitierte Johann Buddenbrook, so dass ein Umzug in ein ansehnliches Haus 1835 erfolgen konnte.
Der Roman selber entfaltet sich zu Beginn vor der geschichtlichen Wirklichkeit Lübecks in der Zeit von 1835 bis 1850. Die beiden ersten Buddenbrook-Generationen verkörpern die Zeittendenzen Lübecks. Im zweiten Romanteil, der von Thomas Buddenbrook und Hanno handelt und die dritte und vierte Generation der Familie zwischen 1855 und 1877 umfasst, werden vom Verfasser autobiographische Elemente mit der Welt der Romanhelden vermischt.
Die Zeit danach, in der Lübeck eine Modernisierung und eine Verfassungsreform erlebte, in der die dominierende Stellung der Fernhandelskaufleute relativiert wurde und Lübeck eine technische Entwicklung mit dem Anschluss an das Deutsche Reich mitmachte, wird vom Autoren ausgeblendet. Für ihn war die Einzigartigkeit Lübecks im Zusammenhang mit der Senatorenschaft des Vaters aus der Riege der Fernhandelsleute von großer Bedeutung. Dies begründete sein bürgerliches Bewusstsein 152 und spiegelt sich im Roman wieder.
Nun ein kurzer historischer Rückblick auf die politische Entwicklung in Preußen und Lübeck und ihre Darstellung im Roman:
Das Königreich Preußen war bereits im 18. Jahrhundert eine europäische Macht mit einem funktionierenden Beamtenapparat und einer schlagkräftigen Armee. Markt und Wettbewerb bestimmten die Wirtschaftsordnung. Nach dem Ende des Zunftzwangs herrschte Berufs- und Gewerbefreiheit, man setzte eine Schul- und Hochschulreform und ebenso eine Kommunal- und Heeresreform um und kam der Idee einer Bürgerlichen
Gesellschaft nahe. Es fehlten dafür aber noch die bürgerlichen Grund- und Freiheitsrechte und eine Verfassung, die das gewählte Parlament mit Judikative und Legislative an den Willen der Bürger band.
Die Forderung nach einer Verfassung, die die Grundrechte und Freiheit, Mitbestimmung und Mitarbeit am staatlichen Gemeinwesen der Bürger garantieren sollte, kam im Vormärz. Nach der napoleonischen Fremdherrschaft war der Wunsch nach einem Nationalstaat vorhanden, es folgte 1815 der „Deutsche Bund“als lose Föderation unabhängiger Staaten mit den Führungsmächten Preußen und Österreich. Diese schränkten die Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit stark ein und unterbanden Kritik an bestehenden politischen Verhältnissen durch Polizeigewalt.
Der Beitritt zum Zollverein des Norddeutschen Bundes 1835, von Preußen initiiert, bedeutete für Lübeck eine Verfassungsänderung, da Lübeck bisher ein Staat mit eigener Zollpolitik war und von Zolleinnahmen lebte.
Jean Buddenbrook heißt dies, im Widerspruch zu anderen Gästen, aus wirtschaftlichen Gründen gut.
S. 39
… Konsul Buddenbrook war begeistert für den Zollverei…
„Bei erster Gelegenheit sollten wir beitreten …
Herr Köppen aber war nicht dieser Meinung, nein, er schnob geradezu vor Oppositio…
„Und unsere Selbständigkeit? Und unsere Unabhängigkeit…
„Aberim Zollverein würden uns die Mecklenburgs und Schleswig-Holstein geöffnet werden ..“ „Unser System ist doch so einfach und praktisch, wie? Die Einklarierung auf Bürgereid…
„. das mit dem Bürgereid ist ein Unfug, allmählich, das muss ich sagen! Es ist eine Formalität geworden, über die man ziemlich schlank hinweggeht. und der Staat hat das Nachsehen.…
In den 40er Jahren entwickelten sich in Deutschland soziale Spannungen und es bildete sich eine liberale Opposition gegen Ständegesellschaft und Obrigkeitsstaat: Das Bürgertum als führende Kraft in Wirtschaft und Kultur verlangte nach mehr Teilhabe und Freiheiten, gleichzeitig politisierten sich auch die sozialen Unterschichten mit dem Ziel einer Verbesserung ihrer ökonomischen und politischen Lage.
Die Pariser Februarrevolution von 1848 brachte auch in Deutschland große Versammlungen zusammen: Politische Vereine, liberale Clubs expandierten, Forderungskataloge wurden verabschiedet.
Als 1848 in Frankreich die Republik ausgerufen wurde, griff die Revolution in kurzer Zeit auf alle deutschen Staaten über, wobei sich Wirtschafts- und Bildungsbürger zurückhielten und nicht auf die Straßen gingen, denn sie befürchteten eine unkontrollierbare Machtergreifung des ungebildeten und besitzlosen „Pöbels“ und forderten eine kontrollierte Bewegung in „geordneten Bahnen“.
1848 begann die Nationalversammlung in Frankfurt mit der Ausarbeitung einer Verfassung und einem Katalog von Grundrechten, wie die Abschaffung der Standesprivilegien, Versammlungs- und Pressefreiheit, Gewerbe- und Niederlassungsfreiheit. Zur Durchsetzung kam es nicht, die Machtverhältnisse verschoben sich zugunsten des alten Regimes, und der Adel bewahrte sich seine Privilegien trotz der Gleichheit der Staatsbürger vor dem Gesetz.
Die politischen Ereignisse von 1848 spielen nur eine unbedeutende Rolle im Roman und haben für die Familie geschäftlich und politisch keine Bedeutung. Sie bilden stets den Hintergrund, Schwerpunkt bleibt im Roman die innere charakterliche Entwicklung der Protagonisten, deren Lebensprobleme und -entscheidungen und der Verfall einer Familie. Thomas Mann verspottet die Ereignisse vom 9. Oktober 1848 anhand einer Anekdote und stellt sie als einen Protest von jungen Leuten aus den unteren Schichten dar.
S. 190f
Diese Menge war an Zahl nicht viel stärker, als die Versammlung im Saale und bestand aus jugendlichen Hafen- und Lagerarbeitern, Dienstmännern, Volksschülern, einigen Matrosen von Kauffahrteischiffen und anderen Leuten. Auch drei oder vier Frauen waren dabei, die sich von diesem Unternehmen wohl ähnliche Erfolge versprachen, wie die Buddenbrooksche Köchin. Einige Empörer, des Stehens müde, hatten sich, die Füße im Rinnstein, auf den Bürgersteig gesetzt und aßen Butterbro…
„Ja, HerrKunsel...“brachte Carl Smolt kauend hervor. „Dat’s nu so ,n Saak... öäwer. Dat is nu so wied... Wi maaken nu Rvolutschon…
Aus heutiger Sicht wäre diese Darstellung aufgrund der Ernsthaftigkeit des Zwischenfalls zu kritisieren.
Konsul Buddenbrook empfindet Unmut über die nicht angezündeten Lampen,„eine offenbare und unerhörte Unterbrechung der Ordnung“(S. 190), Leprecht Kröger verachtet die aufständische „Canaille“ und stirbt vor Entrüstung nach einem Steinwurf.
S. 195
Der alte Kröger schwieg, er schwieg beängstigend. ..Dann aber kam es ganz tief aus ihm heraus. langsam, kalt und schwer, ein einziges Wort: „Die Canaille…
In Wirklichkeit war die 48er Revolution in Lübeck, anders als Thomas Mann erzählt, ein Protest von selbständigen Handwerkern, die die Beibehaltung des ständischen Prinzips verlangten und in die Versammlung der Bürgerschaft eindrangen, als diese die Einführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts beschließen sollte.153 Der Senat in Lübeck forderte auf dem Hintergrund der Frankfurter Nationalversammlung und der dort gefassten Bestimmungen die Schaffung des freien und gleichen Wahlrechts. Die Bürgerschaft stimmte für die Senatsvorlage, woraufhin Demonstranten eine allgemeine Ständewahl verlangten, aus Angst vor der Verschlechterung der eigenen wirtschaftlichen Lage. „Kenner wirtschaftsgeschichtlicher Zusammenhänge haben geäußert, den Demonstranten, in der Mehrheit Handwerksgesellen, sei es in der Sache weniger um das Wahlrecht gegangen als um die Befürchtung, durch die neue Verfassung werde kurz über lang die Gewerbefreiheit eingeführt.“154
Die Person des Konsuls Jean Buddenbrook agiert heroisch und behält als Mitglied der Bürgerschaft unter den Eingeschlossenen im Versammlungssaal die Oberhand. Er trägt die Züge von Th. Manns Großvater.
S. 189f
„Sie sehen mich gewillt, zum Volke zu reden…
Der Konsul sagt…
„Nein, lasen Sie mich das lieber tun, Gosch. Ich habe wahrscheinlich mehr Bekannte unter den Leuten…
Man machte sich aufmerksam, stieß sich in die Seiten und sagte gedämpf…
„Dat’s Kunsel Buddenbrook! Kunsul Buddenbrook will ,ne Re‘ hollen! Holl din Mul, Krischan, hei kann höllschen fuchtig warn!…
„Na Lüd“ sagte schließlich Konsul Buddenbrook, „ick glöw, dat is nu dat Beste, wenn ihr Alle naa Hus gaht!…
die Menge fing an, sich in der allerbesten Laune zu zerstreuen.…
Die Verfassung von 1848 zog eine Verwaltungsreform und eine Gewaltenteilung zwischen Verwaltung und Justiz im Jahre 1852 nach sich und veränderte die Privilegien der Fernhandelskaufleute.
Der aristokratische Kaufmannsgeist, vertreten im Roman durch Konsul Kröger, löste sich auf.
Aufgrund der dänischen und mecklenburgischen Zollschranken hatte Lübeck sich bereits 1849 für die Hegemonie Preußens in der Reichsversammlung ausgesprochen. Der Krieg 1864 - er wird im Roman geschildert - bringt preußische und österreichische Einquartierungstruppen in die Stadt.
S. 436
Krieg und Kriegsgeschrei, Einquartierung und Geschäftigkeit. Preußische Offiziere bewegen sich in der parkettierten Zimmerflucht der Bel Etage von Senator Buddenbrooks neuem Haus.…
Im Spätherbst und Winter kehren die Truppen siegreich zurück, werden wiederum einquartiert und ziehen unter den Hochrufen der aufatmenden Bürger nach Hause. - Friede. Der kurze, ereignisschwangere Friede von fünfundsechzi…
Im Jahre1866 begann Bismarck einen Krieg gegen Österreich und besiegte eine Reihe von deutschen Mittelstaaten. Daraufhin löste sich der Deutsche Bund auf und ein „Norddeutscher Bund“ wurde gebildet, in dem Preußen die Führung über den Zusammenschluss der Staaten nördlich der Mainlinie innehatte. Der Weg zum Nationalstaat war offen und 1871 folgte die Gründung des Deutschen Reichs als konstitutionelle Monarchie mit einem Kaiser an der Spitze.
Im Zusammenspiel von Liberalen und Otto von Bismarck verwirklichte man einige bürgerliche Reformen, wie Freizügigkeit, eine Gewerbeordnung mit einer Beseitigung der alten Zunftverfassungen, ein neues Eherecht, das die freie Wahl des Ehepartners garantierte und die Einführung der Zivilehe. Die Befugnisse der Kirche wurden beschnitten, die Gegensätze zwischen der katholischen Kirche und der preußischen Regierung verschärften sich in einem „Kulturkampf“.
Carl Crüger beschreibt in seiner Handelsgeographie von 1834 noch Lübeck als eine Provinzstadt mit wenigen Getreide- und Weinhandelshäusern, schlechten Straßen und geringer Industrie, lediglich Gerbereien werden erwähnt und die Produktion von Seife und Spielkarten.155.
Als ab 1850 in Deutschland ein Aufschwung einsetzte, litt Lübeck noch unter den Folgen der Kontinentalsperre, die zum Konkurs vieler Firmen und Banken führte und unter der Politik Dänemarks die Verkehrsanbindung Lübecks verhinderte.
Fischfuhren waren eine einträgliche Beschäftigung für Fuhrleute aus Travemünde, die mit großen vierspännigen Wagen bis zu sieben Tonnen Fisch in die Stadt fuhren und Fisch auf dem Markt anboten, die Marktszene im Roman erzählt davon anschaulich:
S. 673
Im Centrum der Stadt war es lebendig, denn es war Sonnabend und Markttag. ..Auf dem Marktplatz selbst aber, um den Brunnen herum, war Fischmarkt. Dort saßen, die Hände in halb enthaarten Pelzmüffen und die Füße an Kohlenbecken wärmend, beleibte Weiber, die ihre naßkalten Gefangenen hüteten. Man konnte sicher sein, etwas Frisches zu erhandeln, denn die Fische lebten fast alle noch, die fetten, muskulösen Fische. Einige hatten es gut. Sie schwammen, in einiger Enge zwar, aber doch guten Mutes, in Wassereimern umher und hatten nichts auszustehen. Andere aber lagen mit fürchterlich glotzenden Augen und arbeitenden Kiemen, zählebig und qualvoll auf ihrem Brett und schlugen hart und verzweifelt mit dem Schwanze, bis man sie endlich packte und ein spitzes, blutiges Messer ihnen mit Knirschen die Kehle zerschnitt. Lange und dicke Aale wanden und schlängelten sich zu abenteuerlichen Figuren. In tiefen Bütten wimmelte es schwärzlich von Ostsee-Krabben. Manchmal zog ein starker Butt sich krampfhaft zusammen…
Die rückständige Wirtschaftsverfassung und -praxis Lübecks änderte sich nach der Eingliederung ins Deutsche Reich, als sich die Transportwege verbesserten und sich Industrien ansiedeln konnten.
Seine besondere geographische Lage, die Schifffahrt und der Handel im Ostseeraum brachte Lübeck eine wirtschaftliche Macht, in der sich eine starke Kaufmannschaft mit Geschäftsverbindungen zu anderen Ländern entwickelte. Der Kaufherr wurde zu einem einflussreichen Bürger im Rat der Stadt und übte oberste exekutive und judikative Gewalt aus, „Ratsherr oder Senator wurde man auf Lebenszeit. Drei Schichten der städtischen Bürger waren ratsfähig: die alten Patrizierfamilien, die Gelehrten und die Kaufleute.“156
Später als im restlichen Preußen wurden in Lübeck die Infrastrukturen der Eisenbahnlinien und Straßen ausgebaut, die Gewerbefreiheit eingeführt (erst 1866). Damit war die Ausgangslage für eine ökonomische Entwicklung durch die industrielle Revolution geschaffen. Wir lesen davon im Roman, als Thomas Budddenbrook darüber mit dem Friseur Wenzel plaudert:
S. 359f
Was hat zum Beispiel nach 48 und zu Anfang dieses Jahrzehnts mein Vater nicht Alles für die Reformation unseres Postwesens getan! Denken Sie mal, Wenzel, wie er in der Bürgerschaft gemahnt hat, die Hamburger Dilegencen mit der Post zu vereinigen, und wie er anno 50 beim Senate, der damals ganz unverantwortlich langsam war, mit immer neuen Anträgen zum Anschluss an den deutsch-österreichischen Postverein getrieben ha…
… welche Genugtuung ich empfinde, dass nun die Arbeiten für die Gasbeleuchtung begonnen haben und endlich die fatalen Öllampen mit ihren Ketten verschwinde…
1851 entstanden die ersten Bahnverbindungen, die für Lübeck den wirtschaftlichen Anschluss brachten. Th. Buddenbrook erzählt seinem Barbier von dem Mitwirken seines Vaters am Bau er Bahn, gemeint war der Großvater von Th. Mann:
S. 3…
„Ja, Herr Konsul, und das Dumme ist, dass die Altona-Kieler Eisenbahngesellschaft und genau besehen ganz Holstein dagegen ist;…
„Versteht sich, Wenzel. Solch neue Verbindung zwischen Ost- und Nordsee. Und Sie sollen sehen, die Altona-Kieler wird nicht aufhören, zuintrigueren.Sie sind imstande, eine Konkurrenzbahn zu bauen: Ostholsteinisch, Neumünster-Neustadt, ja, das ist nicht ausgeschlossen. Aber wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen, und direkte Fahrt nach Hamburg müssen wir haben…
Ich interessiere mich für die Eisenbahnpolitik, und das ist Tradition bei uns, denn mein Vater hat schon seit 51 dem Vorstand der Büchner Bahn angehört, und daran liegt es denn auch wohl, dass ich mit meinen zweiunddreißig Jahren hineingewählt bin …
Die Vorstadtentwicklung Lübecks, von der Th. Buddenbrook spricht, begann 1864 mit der Abschaffung des Ansiedlungszwangs innerhalb der Stadtmauern:
S. 361
Wir haben nicht mehr 37 000 Einwohner, sondern schon über 50, wie Sie wissen, und der Charakter der Stadt ändert sich. Da haben wir Neubauten, und die Vorstädte, di sich ausdehnen, und gute Straßenkönnen die Denkmäler aus unserer großen zeit restauriere…
Und wieder ist an dieser Stelle der Zollverein ein Thema, für den sich der Konsul starkmacht:
S. 361
der Zollverein, Wenzel, wir müssen in den Zollverein, das sollte keine Frage mehr sein, und Sie müssen mir Alle helfen, wenn ich dafür kämpfe. Als Kaufmann, glauben Sie mir, weiß ich da besser Bescheid, als unsere Diplomaten, und die Angst, an Selbständigkeit und Freihit einzubüßen, ist lächerlich in diesem Falle. …
1861 bildete sich der Verein zur Förderung der Gewerbefreiheit, eingeführt wurde diese von der Bürgerschaft 1866.
Es gab in Lübeck bereits 1838 mit über hundert Bierbrauern eine Brauzunft, die alle im sog. „Reihebrau“ Bier herstellten. Doch trotz dieser großen Anzahl von Bierbrauern verbesserte sich die Qualität des Getränks erst, als der Senat 1865 die Brauzunft aufhob und den Weg für eine Großbrauerei frei machte. Bis dahin hatten mittelalterlichen Zunftverhältnisse und die verschiedenen Befugnisse stets eine Hürde für die industrielle wirtschaftliche Entwicklung dargestellt.
Thomas Buddenbrook bietet dem Besuch aus Bayern Bier an, Herr Permaneder ist in Verhandlungen mit einer Brauerei in Lübeck:
S. 330
…..“ Dös is fei a nett’s G’schäfterl! Mer machen a Geld mit der Aktion-Brauerei, wovon der Niederpaur Direktor is, wissen’s “
S. 335
Zwei „Kindertagen“ hatte der Hopfenhändler schon angewohnt - denn obgleich er bereits am dritten oder vierten Tag nach seiner Ankunft beiläufig zu erkennen gegeben hatte, dass sein Geschäft mit der hiesigen Brauerei erledigt sei, waren allgemach anderthalb Wochen seitdem verflossen…
Die Tony-Morten-Episode lässt Travemünde, beherrscht von den Interessen Lübecks, als ein exklusives Seebad erscheinen, obwohl es in Wirklichkeit zur Zeit Th. Manns aufgrund des Eisenbahnanschlusses bereits zum Volksbad geworden war und sich die Fischer dort ein Zubrot durch Lotsendienste und Zimmervermietungen verdienten.
Während der Lotsenkommandant im Roman sich den Forderungen der Herrschaften aus der Stadt unterordnet und das hierarchische Gefälle akzeptiert, ist sein Sohn Morten ein Mitglied der Burschenschaft und des „Vormärz“ und sympathisiert mit den Ideen der Pressefreiheit. Er fordert die Abschaffung der Standesprivilegien und die Anerkennung von Leistung als Maßstab der Wertschätzung.
S. 136
„. wir, die Bourgeoisie, der dritte Stand, wie wir bis jetzt genannt worden sind, wir wollen, dass nur noch ein Adel des Verdienstes bestehe, wir erkennen den faulen Adel nicht an, wir leugnen die jetzige Rangordnung der Stände.wir wollen, dass alle Menschen frei und gleich sein, dass niemand einer Person unterworfen ist, sondern alle nur den Gesetzen untertänig sind…
Vor vier Jahren sind die Bundesgesetze über die Universitäten und die Presse erneuert worden - schöne Gesetze! Es darf keine Wahrheit niedergeschrieben oder gelehrt werden, die vielleicht nicht mit der bestehenden Ordnung der Dinge übereinstimmt. Verstehen Sie? Die Wahrheit wird unterdrückt, sie kommt nicht zum Worte…
Im Jahre 1866 trat Lübeck dem Norddeutschen Bund bei, trotz des Misstrauens dem König von Preußen und Bismarck gegenüber. 1868 folgte als nächstes der Eintritt in den Deutschen Zollverein.
Befürworter wie Konsul Johann Buddenbrook wiesen in diesem Zusammenhang auf die florierenden Städte wie Kiel, Stettin und Wismar hin, während anders denkende Kaufleute um ihre Freiheit und Selbständigkeit fürchteten.
Letztendlich wuchs durch den Eintritt der Handelsverkehr, insbesondere der skandinavische Handel.
Von nun an zog preußischer Drill in die Stadt ein. 1871 erfolgte der Bau der ersten Kaserne und die Niederlassung einer Bundes-Garnison, die mit der seit 1814 bestehenden Bürgergarde für Ruhe und Ordnung sorgte. Wie preußisch Lübeck infolge der politischen Ereignisse geworden war, zeigt sich im Besuch des Realgymnasiums von Hanno: Die Schule funktionierte wie ein Staatswesen mit Konkurrenzstreben und „preußischer Dienststrammheit“, mit Untertanenmentalität, dem Recht des Stärkeren, mit Unterdrückung und Ungerechtigkeiten.
S. 722
Damals war Doktor Wulicke, bislang Professor an einem preußischen Gymnasium, berufen worden und mit ihm war ein anderer, ein neuer Geist in die alte Schule eingezogen. Wo ehemals die klassische Bildung alsein heiterer Selbstzweck gegolten hatte, den man mit Ruhe, Muße und fröhlichen Idealismus verfolgte, da waren nun die Begriffe Autorität, Pflicht, Macht, Dienst,Carrièrezu höchster Würde gelangt. . Die Schule war ein Staat im Staate geworden, in dem preußische Dienststrammheit so gewaltig herrschte, dass nicht allein die Lehrer, sondern auch die Schüler sich als Beamte empfanden, die um nichts als ihr Avancement und darum besorgt waren, bei den Machthabern gut angeschrieben zu stehe…
S. 740
Direktor Wulicke musterte eine Weile die salutierenden Kolonnen, worauf er die Arme mit den trichterförmigen, schmutzigen Manschetten erhob…
Das Wirtschaftspotential in Lübeck im Zeitraum von 1835 bis 1877 wuchs, der Getreidehandel florierte, so dass „die Liquidation der über hundert Jahre alten Firma nach dem Tode des Senators Mann denn auch keineswegs von wirtschaftlichen Notwendigkeiten diktiert [wurde].“157 Es gab wichtige Handelsverbindungen von Lübeck mit St. Petersburg und Riga, und die Vereinigung zur allgemeinen Kaufmannschaft stärkte die Interessenvertretung des Handels. Von jetzt an nahm Lübeck am Exportaufschwung und der Hochkonjunktur teil, so wie vorher bereits Hamburg und Bremen.
Vieles von dem, was sich historisch nach 1855 in Lübeck ereignete, findet im Roman keine Erwähnung, „der Autor mischt von dem Augenblick an, wo Th. Buddenbrook die Firma übernimmt, Vergangenes, Erfahrenes und Erlebtes.“158
Aber einem Familienroman, so haben wir gelesen, geht es ja weniger um historisches Wissen oder um politische Einschnitte, die in die alltägliche Lebensführung hineinreichen, sondern um das familiäre Erleben, in diesem Fall bei den Buddenbrooks, die als wohlhabende Kaufleute das Bild eines Bürgertums verkörpern, das sich Ende des 19. Jh. als bürgerliche Klasse herausgebildet hatte.
7.2 Historie im österreichischen Roman „Es geht uns gut“ von Arno Geiger .
Bevor ich genau schreibe, wie sehr sich in Arno Geigers Roman Biographien und die Geschichte des 20. Jahrhunderts im Parallelisieren von individueller und historischer Entwicklung verflechten, sich private und öffentliche Geschichte verzahnt und das historische Panorama in die fiktionale Geschichte integriert werden, gebe ich in Kürze die Historie Österreichs im „bürgerlichen 19. Jahrhundert“ wieder, die der deutschen nicht unähnlich ist.
7.2.1 Die Geschichte Österreichs im „bürgerlichen 19.Jahrhundert“ - ein Exkurs
Österreich,ein Kaiserstaat mit der Herrschaft der Habsburger, war im 19. Jahrhundert ein Konglomerat verschiedener Länder, die ihr Eigenrecht besaßen und Loyalität gegenüber dem jeweiligen Landesfürsten zeigten. Es gab kein gesamtösterreichisches Volk sondern einen Vielvölkerstaat, in dem die Deutschen 23% der Gesamtbevölkerung repräsentierten, die Ungarn 18% , weiterhin gab es Völker wie die Slowaken, Rumänen, Slowenen, Serben, Kroaten. Das Ziel, ein „Totum“ Österreich zu bilden, konnte aufgrund der Heterogenität der Königreiche und Länder nicht wie erhofft erfolgen, stattdessen wurde diese Völkervielfalt im 19. Jahrhundert ein Konfliktfeld und ein Grund dafür, dass sich eine Demokratisierung des Staates verspätete und nur langsam im Vergleich zu Europa vollzog.
Die Epoche Maria und Josephs II. von 1740 bis 1811 gilt als Grundlage für die Herausbildung eines modernen Staates: Eine Verwaltungsreform mit hierarchisch gegliedertem Verwaltungsapparat, die die Entmachtung der Stände initiierte, schuf die Voraussetzung für eine moderne Staatlichkeit: Man führte die deutsche Sprache als Amtssprache ein und vereinheitlichte damit das Verwaltungshandeln. Dem folgte eine Professionalisierung und Bürokratisierung auf staatlicher Ebene durch eine Systematisierung der Dienstklassen und der Aufgabenbereiche der Beamten. Eine allgemeine Wehrpflicht ermöglichte von nun an der Jugend den sozialen Aufstieg und beendete das Vorrecht des Adels als „Wehrstand“.
Als bedeutendste Reformmaßnahme galt die gesetzliche Durchsetzung der allgemein Schulpflicht und ein Schulsystem, das den Einfluss der Kirche reduzierte. Die ersten Bildungsinstitute für Mädchen schufen eine Vorbereitung für Offiziers- und Beamtentöchter auf den Beruf der Erzieherin und Gouvernante.
Man spricht „im Zusammenhang mit der österreichischen Geschichte gerne [vom] ,aufgeklärten Absolutismus’ “159. Regenten handelten im Zeichen der Vernunft und distanzierten sich von der römischen Kurie und der Volksfrömmigkeit und schufen so ein geistiges Klima, geprägt vom „liberalen Katholizismus, der Glaube und Vernunft zu vereinen hoffte“.160 Die Politik versuchte, die Vormachtstellung der katholischen Kirche zu beenden, definierte die Ehe als bürgerlichen Vertrag neu, hob den Jesuitenorden auf und schränkte die Wallfahrten ein. Die sozialen Maßnahmen von Joseph II führten zur Einrichtung von Armen- und Waisenhäusern und Schulgründungen.
Eine sehr wichtige Reform war die Vereinheitlichung des Rechts und damit die Beschränkung der adeligen, kirchlichen und städtischen Rechtsträger:
Das Privatrecht mit dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch von 1811 unterwarf alle Untertanen der staatlichen Obrigkeit und sah eine ständisch ungebundene Gesellschaft vor, u.a. mit dem vom Staat garantierten Recht auf Eigentum. Das ständisch-feudale Denken und die ständische Grund- und Stadtherrschaft blieben jedoch weiterhin erhalten. „Das vereinheitlichte bürgerliche Privatrecht garantierte den Staatsbürgern moderne Freiheitsrechte, dennoch bildeten die ständische Grund- und Stadtherrschaft weiterhin die Grundlage des öffentlichen Rechts.“161
Die sog. „Heilige Allianz“ von 1815 zwischen Russland, Preußen und Österreich sah nicht das Volk sondern Gott als den Souverän für die „christliche Nation“ in Europa. Ruhe und Ordnung wurden mit Hilfe eines bewaffneten Interventionsrechts bewahrt und eine politische Partizipation der Staatsbürger durch die absolute Alleinherrschaft des Kaisers unterbunden.
Der erfolgreiche Abschluss des Wiener Kongresses schuf eine österreichische Vormachtstellung in Europa: Der Österreichische Kaiser galt als höchster europäischer Würdenträger, Österreich hatte den Vorsitz innerhalb des Deutschen Bundes und galt bei den Bundesversammlungen als führende Macht.
Es folgte die Ära Metternich, eine Zeit der Restauration. Ihr Ziel war es, die europäische Führungsposition Österreichs in der Nachfolge des römisch-deutschen Kaisertums wiederherzustellen, und dies durch Zensur, Meinungskontrolle, mangelnde Bürgerrechte und gegenrevolutionäre Politik. Politisches Handeln und staatsbürgerliche Partizipation wurden verhindert.
1830 begann die Industrialisierung. Sie führte insbesondere durch die Textilproduktion zu wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen, beschleunigte den Ausbau der Eisenbahn und schnellere Verbindungswege. Eine expandierende Papierindustrie ermöglichte die Publikation von Druckerzeugnissen, die wiederum auf das Leseverhalten breiter Bevölkerungskreise wirkte.
Eine allgemeine Schulpflicht wurde eingeführt: Realschulen und die Gymnasien, die zu höheren Bildungsanstalten wurden, standen nun den Bürgersöhnen offen. Sie rekrutierten sich nicht nur aus den Beamten- und Kaufmannsfamilien, sondern auch aus Teilen der neuen technischen Berufe und Wirtschaftsbereiche, die nun vermehrt an die Universitäten strebten.
Die Bevölkerung stieg zwischen 1790 und 1850 von 22 auf 31 Millionen. Als soziale Gruppen gewannen die Arbeiterschaft und der Mittelstand, d.h. Akademiker, Kaufleute, Beamte und Künstler an Bedeutung. Mit letzteren etablierte sich wie in Deutschland eine bürgerliche Kultur, in Österreich insbesondere in Kaffeehäusern, in Salons und in der Kultur dienenden Vereinen. Zu diesem bürgerlichen Spektrum gehörten Bankiersfamilien wie Rothschild. Sie pflegten einen feudalen Lebensstil, wurden nobilitiert und rangierten fast auf der Höhe der Hocharistokratie. In der bürgerlichen Wohnkultur und einer entsprechend der unterschiedlichen Geschlechterrollen modischen Differenzierung der Kleidung präsentierten sie den Wohlstand eines neuen Standes.
Beide Gesellschaften („erste Gesellschaft, d.h. der Adel und die „zweite Gesellschaft“, d.h. das Bürgertum) waren Förderer des kulturellen Schaffens, wobei die Bürger sich durch besonders großes Interesse und Fachkundigkeit auszeichneten und ein breites Publikum mit hohem Bildungsniveau darstellten, für die „die Lektüre schöngeistiger Literatur, der Besuch von Opern- und Theateraufführungen, Museen und Kunstgalerien allmählich zum selbstverständlichen Bestandteil eines neuen Lebensstils wurde.“162
Besondere Bedeutung kam der Tanz- und Unterhaltungsmusik, geprägt durch den Walzer, und der Hausmusik zu. Die Mehrheit der Künstler selbst stammte aus (groß)bürgerlichen akademischen Elternhäusern, hatte eine gymnasiale Ausbildung und übte ihre Kunst ohne Förderung von Seiten des Hofs aus - denn waren bis ins 18. Jahrhundert Kunst und Musik im höfischen Kontext angesiedelt, entwickelte sich nun ein neuer Künstlertyp, der von der Kunst lebte, unabhängig seinen Beruf ausüben konnte, wenn auch finanziell von Mäzenen abhängig.
Unter den Künstlern und ihren künstlerischen Sujets zeigte sich der Trend zur Verbürgerlichung: Der ,freie‘ Künstler war als Auftragskünstler für Kaiserhof, Adelshäuser und für finanzkräftige Bürger, Kaufleute und Unternehmer tätig. Damit war Kunst nicht mehr das Privileg der Aristokratie, sondern diente auch der Selbstrepräsentation breiterer Kreise.163 Das Bewusstsein für die Freiheit der Kunst ermöglichte es Musikern und Komponisten wie Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, und Johann Strauß sich ganz der Musik zu widmen.
Dann kam das Jahr 1848 und trotz präventiver Maßnahmen von Seiten Metternichs regte sich der Widerstand des Volkes gegen die herrschenden Systeme.
Dem Bürgertum mit einem gemäßigten konstitutionellen Programm standen zwar radikalere Studenten gegenüber, die die soziale und nationale Frage einbezogen, doch der Sturz Metternichs, die Zusage einer Verfassung und das Ende der Zensur waren im Sinne des Bürgertums. Es hatte für sich verfassungsmäßig gesicherte Rechte und Mitsprache in Wirtschafts- und Finanzfragen gefordert, gleichzeitig aber politische Rechte für die Arbeiterschaft ausgeschlossen.164
Mit der Niederschlagung der Revolution bildete sich das Prinzip der Gleichberechtigung aller Nationalitäten in Österreich.
Das Gemeindegesetz von 1849 konstituierte die Ortsgemeinden als kleinste Einheit der Verwaltung und ermöglichte eine politisch aktive Gestaltungsmöglichkeit für die freien und gleichen Staatsbürger. So waren nach der Revolution bürgerlich-liberale Eliteregierungen an der Umgestaltung des Staates zur Doppelmonarchie beteiligt, und ebenso wie in Deutschland gab es die Forderung der bürgerlichen Eliten nach einer Garantie für bürgerliche Freiheiten wie Wirtschafts-, Meinungs- und Pressefreiheit. Verstärkt wurde dieser gesellschaftliche Emazipationsprozess durch eine unabhängige Justiz.
1848 schuf man ein neues Unterrichtsministerium. Es modernisierte Gymnasien mit der Einführung der Maturitätsprüfung nach acht Jahren und der stärkeren Betonung der naturwissenschaftlichen Fächer und der Mathematik. Realschulen boten eine höhere Bildung auf verschiedenen Wissensgebieten mit einer modernen Fremdsprache und mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern für den Teil der Bevölkerung, der kein Studium absolvierte.
Bildung wurde nun die wichtigste Möglichkeit des sozialen Aufstiegs und ermöglichte auch jungen Männern aus bäuerlichen und kleinbürgerlichen Milieu mit der Maturitätsprüfung den Einritt in die „bessere“ Gesellschaft.
Die Umbildung der Universitäten erfolgte nach dem Vorbild der „preußischen Lehranstalten“ mit der Einheit von Forschung und Lehre und brachte mit der Neuregelung des Lehramtsstudiums eine Professionalisierung des Lehrerberufs.
Als 1868 die „Maigesetze“ die Schulaufsicht dem Staat unterstellten, entfiel das Aufsichtsrecht der Kirche und der Wechsel des Glaubensbekenntnisses wurde nun gesetzlich möglich, begrüßt von den bürgerlich-intellektuellen Kreisen.
Was war mit der Bildung der Frauen? Durch den Einfluss der Frauenvereine ermöglichte man ihnen auf der höheren Bildungsschule in Wien und auf dem Grazer Mädchenlyzeum ab den 1870er Jahren eine Ausbildung mit dem Schwerpunkt auf die musische Ausbildung und auf moderne Fremdsprachen. Ab 1897 wurden die Frauen an den österreichischen Universitäten zugelassen.
Franz Joseph I. schuf in der Zeit der neoabsolutistischen Reformpolitik eine liberale Handels- und Wirtschaftspolitik in Form der freiheitlichen Gewerbeordnung, die eine Voraussetzung für eine hierarchisch aufgebaute Staatsstruktur war.
Ab 1861 ließ das an die Steuerleistung gebundene Zensuswahlrecht das städtische Bürgertum und die ländlichen Oberschichten zu den Wahlen zu. Die politische Gruppierung der Liberalen war nun erfolgreich und in der Wiener Regierung dominierten die Deutsch-Liberalen, genauer: das Bürgertum.
Gleichzeitig verschärfte die liberale Wirtschaftspolitik soziale Gegensätze, Beschäftigungszahlen und Löhne sanken, so dass in den 80er Jahren unter der konservativen Regierung Taaffe Sozialgesetze die Arbeitszeit beschränkten und Unfall- und Krankenversicherungsgesetze eingeführt wurden. Es folgte eine Abkehr von der liberalen Wirtschafts- und Gewerbepolitik hin zu Einschränkungen der Presse- und Meinungsfreiheit und zu Sozialistengesetzen’.
Außenpolitisch änderte sich die Bedeutung Österreichs: Otto von Bismarck wurde ab 1862 zum außenpolitischen Gegner und stellte im Deutschen Bund dem katholischgroßdeutschen Modell Österreichs die protestantisch-kleindeutsche Lösung unter der Dominanz Preußens gegenüber.
Der Norddeutsche Bund und die Deutsche Reichsgründung 1871 beendeten die Führungsrolle Österreichs, und es folgte eine politische und diplomatische Annäherung zum Deutschen Kaiserreich. Das Drei-Kaiser-Abkommen von 1873 zwischen Wilhelm I., Kaiser Franz Joseph und Zar Alexander II betonte das Interesse am Erhalt der Monarchie als Staatsform, anders als Frankreich, das 1871 die Erste Republik ausgerufen hatte.
Den Imperialismus der europäischen Großmächte mit einer aggressiven europäischen Expansionspolitik setzte Wien kaum um, lediglich der Südosten Europas blieb zur politischen Machtentfaltung übrig. Im Krieg mit dem Osmanischen Reich wurde er aber russischer Machtbereich, was die Rivalität und die konkurrierenden Interessen zwischen Russland und Österreich verstärkte und aufgrund der Machtbestrebungen auf dem Balkan zur größeren Annäherung zwischen Deutschland und Österreich führte.
In den Jahren zwischen 1848 und 1918 hatte sich in Österreich eine Massengesellschaft gebildet: die Bevölkerungszahl stieg auf 50 Millionen, Städte wuchsen, so hatte z.B. Wien bereits vor dem Ersten Weltkrieg 2 Millionen Einwohner.
Der Bau der Eisenbahn beschleunigte ab den 80er Jahren die Bauwirtschaft, die Eisen- und Maschinenindustrie und den Kohlenbergbau, die zunehmende industrielle Produktion veränderte die Zahl der Beschäftigten in den einzelnen Wirtschaftssektoren und ließ sie insbesondere im nicht-landwirtschaftlichen Sektor stark anwachsen.
1893 formierte sich die Christlich-Soziale Partei, deren Politik sich gegen das jüdische Kapital richtete und antisemitischen Charakter hatte. Als nach der Einführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts 1907 die hocharistokratische und großbürgerliche Vorherrschaft endete, zog sie neben den Sozialdemokraten, Konservativen und deutschnationalen Gruppierungen in den Reichsrat ein.
Eine antiliberale und antikapitalistische Grundstimmung machte sich breit. Sie kritisierte die liberale Wirtschaftspolitik, die zur Verelendung breiter Bevölkerungsschichten geführt hatte und insbesondere die weiblichen Dienstboten in den Großstädten das Elend dieser
Zeit spüren ließ: Ihnen wurde oft nur eine Schlafstelle auf/in dem Flur oder in der Küche in der bürgerlichen Wohnung zur Verfügung gestellt.165
Man forderte, dass die sozialpolitische Verantwortung von nun an beim Staat liegen sollte und strebte durch die Stärkung des bürgerlichen Mittelstandes und handwerklicher Familienbetriebe an, die Kluft zwischen den Unterschichten und dem bürgerlichen Großkapital zu überbrücken. Bürgerliche Schichten setzten sich durch Vereins- und Genossenschaftsgründungen für die Verbesserung der Lebensbedingungen der sozialen Unterschicht ein, bürgerliche Frauenvereine traten für eine Öffnung der Bildungseinrichtungen für Frauen und für bessere Arbeitsmöglichkeiten ein. Ähnlich wie in Deutschland bewirkten Vereine als bürgerliche Organisationsform des 19. Jahrhunderts durch sozial- und bildungspolitische Aktivitäten eine Milderung der Armut breiter Bevölkerungsschichten. Genossenschaften, z.B. Raiffeisen-unterstützten Landwirtschaft und Handwerk mit Darlehen und Krediten bei Ernteausfällen oder Erbenauszahlungen.
Das Leben der Menschen hatte sich verändert: Technische Erneuerungen wie das Automobil, die Schreibmaschine, das Fahrrad, Kommunikationstechnologien/Telefon prägten den Alltag und das Arbeitsleben, neue Energieträger wie Erdgas und Elektrizität setzten sich durch, und in Wien siedelten sich in den neunziger Jahre die ersten Elektroindustrien an.
Mit dem Attentat auf den Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gattin in Sarajevo am 28. Juni 1914 durch einen radikalen serbischen Nationalisten kam es zur Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien. Der nun folgende vierjährige Krieg brachte innenpolitische Zerfallserscheinungen: Gewaltbereitschaft, Lebensmittelknappheit, Hunger und soziale Spannungen nahmen zu. Kaiser Franz Joseph starb 1916, sein Nachfolger wurde Kaiser Karl I..
Hatte bereits seit dem Revolutionsjahr 1848 die Habsburgmonarchie ihre Macht sukzessive verloren, waren nach dem 1. Weltkrieg die siegreichen Alliierten nicht bereit, eine Monarchie oder das Haus Habsburg zu unterstützen, so dass Karl I. am 12. November abdankte. Wilhelm I.war bereits am 9. November zurückgetreten.
Eine Republik Deutsch-Österreich wurde ausgerufen, und nach und nach erklärte man die Unabhängigkeit der „österreichischen Völker“. Der Plan, einen freiwilligen Staatenbund mit den Nachfolgestaaten zu bilden, hatte keine Aussicht auf Realisierung, und so erfolgte vertraglich eine Eingliederung Österreichs in die Deutsche Republik. Die Siegermächte verboten den kompletten Anschluss an Deutschland und zwangen die Republik in die Selbständigkeit.
Die freien Wahlen 1919 brachten eine Koalitionsregierung unter sozialdemokratischer Führung und den Christlich-Sozialen. In der Folgte schafften sie radikaler als in Deutschland in der Weimarer Republik die Adelstitel und -vorrechte ab und führten sozialpolitische Reformen wie die Arbeitszeit- und Urlaubsregelung und die Arbeitslosenversicherung ein.
Ab Mitte der 20er Jahre begann ein Wirtschaftswachstum, es fußte auf der (proto)industriellen Produktion (Textilindustrie) durch den Ausbau von Manufakturen, und dem Wachstum im landwirtschaftlichen Sektor.
Die Verfassung von 1920 war moderner als die deutsche und stattete das Parlament mit wichtigen Kompetenzen aus. Trotzdem gewannen paramilitärische Ortswehren und Frontkämpfervereinigungen, von Parteien teilweise gegründet und auf das Führerprinzip eingeschworen, mit der Idee des faschistischen Ständestaates (Heimwehr) immer mehr an Einfluss. Die patriarchalischen Strukturen in der Gesellschaft und eine militaristischen Ausrichtung führten zu immer weniger Akzeptanz des parlamentarisch demokratischen Systems. Als angesichts der Weltwirtschaftskrise und starker Arbeitslosigkeit sich in ganz Europa autoritäre Regime entwickelten, hatte die Verfassungsreform von 1929 mit der Etablierung eines starken Bundespräsidenten Ähnlichkeit mit dem Hindenburg-Modell in Deutschland.
Die Nationalsozialisten errangen 1932 auf Kosten der Christlich-Sozialen und der Sozialdemokraten große Erfolge. Man wandelte die christlich-soziale Partei in die „Vaterländische Front“ um. Dollfuß, die Symbolfigur des ,Austrofaschismus‘, wurde 1933 Kanzler. Er lehnte sich eng an den italienischen Faschismus an, wurde 1934 Opfer eines Putschversuchs der illegalen SS-Standarte 89.
Aus der Republik wurde ein „christlich deutscher Bundesstaat auf ständischer Grundlage“, und dieser kann durchaus als „repressiv“ charakterisiert werden: Nun ruhte die Macht auf dem Kanzler und der katholischen Kirche, sie erhielt durch ein Konkordat größeren Einfluss auf das Schulwesen und auf das Eherecht.
7.2.2 Die Zeit des „Austrofaschismus“
Ab hier beginnt die Zeit, die den Hintergrund für den Familienroman von Arno Geiger bildet.
Die Familiengeschichte spielt in der Zeit des 20. Jahrhunderts zwischen 1938 und 1989 mit wechselnden Perspektiven der Hauptfiguren bzw. Familienmitgliedern.
„Die Familie wird zur Allegorie des Weltgeschehens.“166
Geiger fasst das vergangene Jahrhundert in Form von Diskursen der geschichtlichen, die Familie berührenden Ereignissen zusammen und gibt den Alltag von Alltagsmenschen wieder. So gelingt es ihm, dass „die Leser den Wert und die Bedeutung des Alltags in den Schilderungen erkennen können.“167
Neun einzelne Tage mit exakten Daten, ähnlich Tagebucheinträgen, stellen ein halbes Jahrhundert dar, wobei nicht die wichtigsten politischen Ereignisse im Vordergrund stehen, sondern Alltäglichkeiten und gewöhnliche Situationen der Protagonisten, „Kleinigkeiten, die so sehr ins Gewicht fallen“, so der Autor.168
Folgende markante real-politische Ereignisse und Daten der österreichischen Geschichte werden zum Hintergrund familiärer Ereignisse und im Zeitraum einiger weniger Tage erzählt:
1938 Anschluss Österreichs
1939 Beginn des 2. Weltkriegs
1945 Kriegsende
1955 der Staatsvertrag
1962, 1978, 1979, 1982 beliebige Tage und Zeitkolorit
1989 Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten
Kurze dokumentarische Passagen in Kursivdruck in Form von Kurzmeldungen aus dem Radio, Dokumente, Zeitungs- und Radiomeldungen, Redewendungen, Merksätze zu Ereignissen des Tages spiegeln die Ereignisse der Figuren und das Verhalten der Figuren in Abhängigkeit der Zeit wider und suggerieren Authentizität und konkretisieren Historizität: S. 206 1962
Im Jemen heißt es, bilden die Rebellen eine Regierung. Die Beduinen drohen mit Bürgerkrieg … Boykott gegen Negerstudenten löst Staatskonflikt in den USA aus. …
All die genannten Ereignisse und politischen Veränderungen in den einmontierten Pressemeldungen und Schlagzeilen sind plötzlich, unberechenbar, negativ und vom Zufall bestimmt (so wie manche der geschilderten Familienereignisse, z.B. Ingrids tödlicher Badeunfall). Die Daten dienen lediglich der besseren zeitlichen Orientierung des Lesers, denn letztlich ist das Familienleben das, was diesen Familienroman bedeutsam macht, auch wenn die Protagonisten politisch und kulturell in der österreichischen Geschichte verankert sind.
Zunächst ist die Zeit des Nationalsozialismus und der Zweite Weltkriegs der Hintergrund, vor dem individualisierte erlebte Geschichten erzählt werden.169
Biographische Elemente deuten den historischen Wandel der Kriegs- und Nachkriegszeit, die Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs, der Frauenemanzipation an und berühren dabei Themen wie
- „Verwurzlung in Geschichte und Gegenwart,
- verlorene und neu gewonnene Heimat,
- Erinnerungsarbeit und Liebesbeziehung,
Menschenwürde und die Gestaltung einer freiheitlichen zivilen Lebensweise“.170
In den Lebensabschnitten der Figuren verschränkt sich ein Panorama verschiedener Motive: Liebe und Glück, Sehnsucht, Missbrauch von Gefühlen, familiäres Unglück, richtige Entscheidungen und falsche, Selbstvertrauen und Zweifel; aber auch soziales und nationales Selbstverständnis, Geschlechterrollen, Klassendünkel.
Geschichte und erzählerische Gegenwart des Jahres 2001 wechseln sich in den Kapiteln in ungleicher Reihenfolge ab.
Beginnen wir mit der Historie des Nationalsozialismus im Roman, dem sog. „Austrofaschismus“
Der deutschfreundliche Kanzler Kurt Schuschnigg schloss auf innen- und außenpolitischen Druck 1936 ein Abkommen, das nationalsozialistische Funktionäre in der Politik förderte und ihnen freie politische Entfaltung garantierte. Auf Druck von Hitler setzte er den nationalsozialistischen Innenminister Seyss-Inquart ein. Als Hitler einmarschierte, wurde dieser von den Österreichern, die auf ein Ende der Arbeitslosigkeit und eine Verbesserung ihre wirtschaftlichen Situation hofften, begeistert empfangen.
(AG)
S. 125
Dann: Wie Peter sich als Achtjähriger durch eine dichte Menge jubelnder Menschen hindurchtunnelte und plötzlich den Führer sah, der aus seiner Limousine heraus die Wiener Bevölkerung begrüßt…
Richard erlebt Hitlers Einmarsch davon abweichend:
S. 65
Am 13. März, dem Tag nach Beginn des Einmarsches, einem Sonntag, wurde Richard morgens von der Polizei aus dem Bett geholt und auf das Kommissariat in der Lainzer Straße verbracht. Mit zunehmendem Schrecken richtete er sich auf seine erste Nacht im Arrest ein, die dann aber doch nicht stattfand, weil die Aktion wenigstens in seinem Fall vor allem der Einschüchterung dient…
Er muss ein Gelöbnis unterschreiben, dessen Inhalt ihn verpflichtet, sich nicht mehr politisch zu betätigen.
S. 66
Als ob er sich je ernsthaft politisch betätigt hätte. Daraufhin wurde er nach Hause entlassen.Wirtschaftlicher Aufschwung durch eine massive Kriegsrüstung, Großprojekte im Autobahnbau und in der Schwer- und Rüstungsindustrie ließen die Arbeitslosigkeit sinken. S. 126 (Peters Vater)
Die glückliche Zeit nach dem Anschluss, als der Vater plötzlich wieder in Arbeit und Brot stand und die Anspannung von ihm abfiel und es plötzlich eine größere Wohnung gab im gleichen Haus weiter oben …
Und wie der Vater ihn ins Vertrauen zog, dass selbstverständlich er und seine Kollegen es gewesen seien, die das Telefonhütterl gesprengt und die Hakenkreuze hinterlassen hatten, und wie glücklich er über die Ankunft der Genossen aus dem Altreich sei und dass der Tisch in Zukunft reicher gedeckt sein werd…
Hinzu kam in Österreich der mentale Aspekt: „Man war aus der Enge des außenpolitisch machtlosen Ständestaates herausgetreten, gehörte zu einer großen Nation, deren Führer alles zu gelingen schien, auch die Tilgung der Schmach von 1919. Der Preis - Wohlverhalten - war für viele zahlbar, man arrangierte sich.“171
(AG)
Richard ist ein Beispiel für den alltäglichen Opportunismus allenthalben,1938 bekommt er Besuch von NSDAP-Mitglied Crobath:
S. 80
Crobath hält Richard einen fünfminütigen Vortrag über erhebliche Veränderungen, vor denen man stehe, anhaltende Hochstimmung in der Stadt und darüber, dass Richards Verhalten ein ungünstiges Licht auf seine politische Einstellung werf…
S. 84f
Wenn ich Sie richtig verstehe, soll ich angesichts der Zukunft, an der Sie und Ihre Parteikollegen arbeiten, meine eigenen Interessen in die zweite Reihe rücken. …
Er überdenkt seine guten Gründe, er versucht sich darin, Crobaths Argumente mit seinem Dilemma abzugleichen und auf diesem Weg zu einer Lösung zu gelangen: … und dass es insofern angebracht wäre, sich mit den neuen Herren gut zu stellen, das wäre nur natürlich. Er, Dr. Richard Sterk, ist keiner, der sein Zeitalter überragt, er hätte ein bisschen Ruhe verdient, findet e…
S. 89
… kann er sich unauffällig verhalten …
Schuschniggs geplante Volksabstimmung für ein freies, unabhängiges Österreich, in der er nach internen Umfragen eine Mehrheit von 70% erhalten hätte, war wegen des Drucks der deutschen Reichsregierung zurückgenommen worden. Terrormaßnahmen, Manipulationen und eine immense Werbemaschinerie hatten die Volksabstimmung zur „Wiedervereinigung“ im April 1938 vorbereitet.
Mit Hilfe des propagandistischen Aufwands und der wirtschaftlichen und sozialen Maßnahmen erbrachte sie eine Zustimmung von unwahrscheinlichen 99,6%. Juden und politische Gegner (8% der Stimmberechtigten, in Wien 18%) waren nicht wahlberechtigt .
Aus der österreichischen Bundesregierung wurde nun eine Landesregierung, es entstanden sieben Reichsaue. Das österreichische Bundesheer wurde von der Wehrmacht übernommen, von 1939 bis 1945 leisteten 1,25 Mio. Österreicher/innen militärische Dienste, wovon 247 000 im Krieg starben, 100000 als Invaliden heimkehrten und eine halbe Millionen Österreicher in Kriegsgefangenschaft gerieten.172
„Doch rasch wurde klar, dass Österreich nicht als gleichberechtigter „zweiter deutscher Staat“ integriert wurde, sondern dass Funktionäre aus dem „Altreich“ häufig den Ton und die Richtung vorgaben. „Aber Seilschaften aus ehemaligen österreichischen Nationalsozialisten^..) kompensieren ihre Degradierung durch besonders umfassende und rasche Ausplünderung und Vertreibung der jüdischen Bevölkerung nach einer Vermögenserfassung.“173
Es begannen antisemitische Aktionen, Verhaftungen von Juden aus rassistischen Gründen, wobei sowohl diejenigen nach den Nürnberger Rassegesetzen als Juden galten, die „von mindestens drei der Rasse nach volljüdischen Großeltern abstammten, als auch mit Juden verheiratete Mischlinge“.
Die Staatspolizei Wien nahm 20793 Personen in „Schutzhaft“, Todesurteile gegen Sozialdemokraten wurden ausgesprochen und Transporte in das KZ Dachau durchgeführt. Man plünderte jüdische Geschäfte und Wohnungen und veränderte durch „Arisierungen“ Besitzverhältnisse zugunsten der NS-Sympathisanten.174
Die Bereicherung an jüdischen Vermögenswerten, wie Wohnungen und Betrieben war groß: man beschlagnahmte 320 Mio. Reichsmark, löste jüdische Betriebe zügig auf und gab fast alle 26000 jüdischen Geschäfte in kommissarische Hände.
(AG) ..
Dr. Richard Sterk agierte ambivalent, nachdem Deutschland in Österreich einmarschiert war: Die Emigration der jüdischen Nachbarsfamilie hat (positive) Auswirkungen für ihn in privater Hinsicht:
S. 83
- Denken Sie an die eigenen Vorteile, an die wegfallende Konkurrenz bei sprunghaft steigender Nachfrage durch das deutliche Mehr an Männern in der Stadt und durch das Geld, das in Umlauf gebracht wird …
Es folgte die „Ausschulung“ jüdischer Schüler aus den öffentlichen Schulen und die Ausgrenzung der jüdischen Jugend durch diffamierende Parolen von der HJ und dem BDM.
127 000 Juden wanderten bis 1941 unter Beschlagnahmung des Vermögens aus, zwei Drittel der in Österreich lebenden Juden mussten ihre Heimat verlassen, ohne dass Rücksicht auf ihr Alter oder ihre Ausbildung genommen wurde, darunter Künstler, Wissenschaftler, Schriftsteller und Journalisten. Ihre Zukunft war ungewiss, viele scheiterten oder begingen Selbstmord, diejenigen, die geblieben waren, bekamen Berufsverbote, wurden verpflichtet den Judenstern zu tragen oder deportiert.175 (AG)
S. 87f
Dann die Mauer zu den Nachbarn, die nach London gehen. …
Ottos weit auseinanderliegende Augen, die er on seiner Mutter hat, spähen nochmals zu den Nachbarn, dann wendet er sich zurück und ruf…
- Vorhänge und auch ein paar Teppiche hängen in den Bäumen! …
Gleichzeitig würde er sich bei Dr. Löwy erkundigen, ob ein Herauslösen des Bienenhauses aus der Verkaufsmasse möglich is…
- Sie haben den Rasen mit Teppichen ausgeleg…
Solidarität mit den Juden war selten, es gab lediglich einige wenige Aktionen der Fluchthilfe durch kirchliche Organisationen, einzelne Priester widersetzten sich, 27 davon starben in Konzentrationslagern.
Wien, wo ein Drittel der Österreicher lebte, war das Zentrum der Sozialdemokratie und unterschied sich politisch von den anderen konservativ dominierten Bundesländern. Und doch wurden auch dort 70 000 Wohnungen „arisiert“ und jüdische Kulturgüter in Museen und Bibliotheken überführt.
Um den 10. November 1938 verhaftete man in Wien 7800 Juden, plünderte ihre Wohnungen und Geschäfte, zerstörte Synagogen und ermordete in der Klosterschule 27 Juden, 88 wurden schwer verletzt,4600 Verfolgte in das KZ Dachau gebracht, 680 Menschen begingen Selbstmord.
Die Bevölkerung reagierte auf dieses Massaker nicht ablehnend, so dass die SS berichten konnte: „Mitleid mit dem Los der Juden wurde fast nirgends laut, und wo sich ein solches dennoch schüchtern an die Oberfläche wagte, wurde diesem von der Menge sofort energisch entgegengetreten, einige allzu große Judenfreunde wurden festgenommen.“176 65500 österreichische Staatsbürger jüdischer Abstammung fielen dem Holocaust zum Opfer.
S. 85
Selbst der äußere Anschein bei Arisierungen kümmert niemanden meh…
Bürgerlich-liberale Schichten akzeptierten trotz Verachtung der NS-Ideologie das Regime, auch hierfür ist Richard ein Beispiel.
S. 60
Das große Reich der Ordnung und Gerechtigkeit hebt an. Na ja, denkt er, vorstellbar ist vieles, auch das Unwahrscheinliche, doch muss man von dem ausgehen, was wahrscheinlich ist, weshalb er an die nationalsozialistische Verheißung nicht recht glauben kan…
Richard verhielt sich unauffällig in der Zeit des Nationalsozialismus:
S. 26
Richard musste nie für die Jahre vor 1945 Rechenschaft ablegen, als es um seine Karriere gin…
Verfolgungen, Militarisierung, Enteignung und Deportation spiegeln sich in den Gesprächen der Familie Sterk wider. 177
S. 68
-Werden weiterhin Truppen in die Stadt verlegt? fragt Alma.
-Wer Augen hat zu sehen, der sehe, antwortete Richar…
S. 74
- Und stimmt es, dass wir jetzt, wo wir Deutsche sind, niemanden mehr zu fürchten brauchen?
- Von wem stammt das? Doch bestimmt nicht von Frieda. Sie fürchtete sich ja vor jedem Soldaten.
- Fredl, der Sohn von Frau Puwein, sagt es.
- Na, in gewisser Weise hat er sogar recht, da wir bisher nur die Deutschen gefürchtet haben und das jetzt wegfällt, weil wir ja selber Deutsche geworden sind.
- Mir gefällt es, dass wir Deutsche sind. Am besten hat mir gefallen, als die Flugzeuge die Hakenkreuze aus Aluminiumfolie abgeworfen habe…
Am Morgen des 12. März bei niedrigstehender Sonne, wie ein riesiger Schwarm gleißender Fische sah es au…
Die Euphorie nach Hitlers Siegen führte zu einer noch stärkeren Unterstützung Hitlers und auch nach der Niederlage in Stalingrad blieb der Widerstand gering: 100 000 verfolgten Widerstandskämpfern standen 700 000 NSDAP-Mitgliedern gegenüber. Im Raum Wien bildete der Anteil der Facharbeiter und der Intellektuellen eine Mehrheit in den entstandenen Widerstandsgruppen, wie die aus dem Arbeitermilieu stammende Jugendgruppe „Die Schlurfs“, sie demonstrierten als Zeichen der Opposition eine unangepasste Freizeit- und Lebensgestaltung.
Österreich trug seinen Teil zur Endlösung der Judenfrage bei: In Linz entstand das Konzentrationslager Mauthausen. In ihm kamen 100 000 Häftlinge um, und in der „Heilanstalt“ am Steinhof in Wien und in Schloss Hartheim in Oberösterreich ermordete man die nach der NS-Rassentheorie „minderwertigen“ Menschen, wie z.B. Geisteskranke oder missgebildete Kinder.
Auch die deutsch-faschistischen Erziehungsabsichten mit den Prinzipien des Führerkults und der Betonung von Volk und Heimat verwirklichte man ab 1933/34 in Österreich in straff organisierten Bünden. Nach deutschem Vorbild kam es zu Zentralisierungsbestrebungen der Jugendorganisationen und zu deren Eingliederung. Innerhalb der HJ bereitete eine militärische Schulung auf den Krieg vor. Aus ihnen rekrutierte sich das „letzte Aufgebot“ 1945. Verbände der Wehrmacht, der SS und des „Volksturms“ leisteten trotz auswegloser Lage noch in den letzten Kriegstagen erbitterten Widerstand und bereiteten der Roten Armee große Verluste, bevor sie selber aufgaben und abzogen.
Peter und Otto gehören diesem Volkssturm an:
S. 102ff
Wien ist Frontstadt. Auf klappernden Holzsohlen, eine Panzerfaust über der Schulter, rennt der fünfzehnjähriges Peter Erlach über die Straße und verschwindet in einer bizarr aufragenden Eckhaus-Ruine, in der sein Fähnleinführer und vier weitere Hitlerjungen Position bezogen hab…
Unter den Tausenden Hitler-Jungen, die in den letzten Kriegstagen umkamen, befand sich Otto, der einzige Sohn von Dr. Richard Sterk: S. 113f
Nach einiger Zeit unternimmt der Bub den Versuch, auf Peter zuzugehen. . Schwach die Lippen bewegend, wie fluchend, macht der Bub einen weiteren Versuch zu gehen, als wolle er das bisschen Leben, das er noch vor sich hat, dafür verwenden, einen oder zwei Schritte zu machen. Aber die Kraft reicht nicht…
Im letzten Kapitel wird, wenn die Motive des „Verfalls“ bzw. der Auflösung und des Auseinanderfallens der Familie analysiert werden, näher auf die transgenerationale Weitergabe solch traumatischer Kriegserlebnisse und auf die Erziehung in den Jugendorganisationen, wie in der HJ, eingegangen.
Die Zerschlagung des Nationalismus erfolgte mit dem Einmarsch und der Befreiung durch die Rote Armee und die Westalliierten. Die meisten Verluste hatte die Rote Armee in ihrem Kampf in Wien und Niederösterreich erlitten.
Österreich war bei aller Kollaboration mit dem NS-Regime auch ein Opfer der Aggressionsziele des Deutschen Reiches: 170 800 Wehrmachts- und Waffen-SSAngehörige kamen im Krieg ums Leben, mehr als 70 000 galten als vermisst und 600 000 Österreicher kamen in Kriegsgefangenschaft.
7.2.3 Die Zweite Republik seit 1945
Bereits 1943 gab es eine Moskauer Erklärung, in der man Österreich als Opfer des Nationalsozialismus bezeichnete und ihm die Souveränität in Aussicht gestellt wurde. So setzte man 1945 von Alliiertenseite aus auf eine autonome, von Deutschland unabhängige Zukunft.
Der Alliiere Rat erkannte am 11. September 1945 die Wiedereinrichtung Österreichs in seinen Grenzen von vor 1938 an, es wurde in vier Besatzungszonen unterteilt, die innere Stadt Wien von den vier Besatzungsmächten gemeinsam verwaltet.
Die sozialen und politischen Probleme nach dem Krieg mit Flüchtlingen, Zwangsarbeitern, und Zerstörung waren groß.
S. 116
Auch die Landschaft, durch die Peter stolpert, scheint einen Angsttraum abbilden zu wollen, die krüppeligen, wie in Agonie verkrampften Weinstöcke, der säuerlich brandige Rauch überall, … Herumfliegendes Papier, zertrümmerte Materialkisten und weggeworfene Ausrüstungsteile. Eine Panzerwabwehrkanone mit zerfetzten Lauf ist zwischen die Reben gefahren …
Sie erreichen den Baum überraschen schnell, Baum und Erhängter wachsen plötzlich heran. …
S. 121
… sein leerer Magen, der sich, seit Onkel Johann Trude zum Essen geschickt hat, immer wieder zusammenkrampft, in rasch kürzer werdenden Abständen. Peter hat Angst, sich übergeben zu müsse…
Care-Pakete aus den USA linderten die Not und bereits im April 1945 gab es eine „Provisorische Staatsregierung“ unter dem Sozialdemokraten Renner, der von 1918 bis 1920 Staatskanzler gewesen war, mit den Parteien der SPÖ, KPÖ und ÖVP. Sie proklamierten die Republik Österreich, die Vorkriegsgrenzen blieben bestehen.
„Die politische Nachkriegselite der SPÖ und ÖVP setzte sich kaum mit dem Leid, Elend und den Traumata der überlebenden wenigen Juden und Jüdinnen in Österreich in den Konzentrationslagern und im Exil auseinander.“178 Bei der Aufarbeitung der Judenverfolgung rechnete man die Verfolgung der Parteigenossen und ihr Opferstatus gegen die Judenverfolgung auf und statt Profiteure der „Arisierungen“ zu benennen, wurden „Alt-Reichsdeutsche“ und kleine Alt-Nazi-Gruppen für das Unglück verantwortlich gemacht. Aktiv am Holocaust beteiligte Österreicher und Kriegsverbrecher blieben unerwähnt, zumal existenzielle Not und Hunger dies verdrängten und für die Mehrheit der österreichischen Gesellschaft die Unschuldsvermutung galt.
S. 130
Auf der Donau, die gerade eine weite Biegung macht, beginnen die Spuren (des Krieges) sich bereits wieder zu verwische…
Das Kielwasser glättet sic…
Die zaundürren, mit gestreiften Pyjamas bekleideten Häftlinge, die in tagelangen Märschen das Donauufer entlang nach Westen getrieben und, wenn sie erschöpft niedersinken, von Mitgliedern der Ortsgruppen erschossen werden, lässt man ebenfalls verschwinde…
Eine Entnazifizierung erfolgte von Seiten der Besatzungsmächte durch die Einrichtung von Internierungs- und Arbeitslagern, in sie wies man die Betroffenen ohne gerichtliches Verfahren ein. Ein Verbotsgesetz zum Verbot der NSDAP verpflichtete Parteiangehörige, sich registrieren zu lassen. Etwa 537 000 Männer und Frauen, „Illegale“, d.h. Parteiangehörige in der Zeit von 1933 bis 1938 und Personen, die vor dem „Anschluss“ der Partei finanzielle Zuwendungen leisteten, erhielten Sonderbestimmungen.
Über nationalsozialistische Betätigungen wie Denunziation, Hochverrat, Verletzung der Menschenwürde wurden in Volksgerichten Urteile gefällt, bis 1955 ergingen 13 500 Schuldsprüche, darunter 43 Todesurteile. Seyß-Inquart verurteilte man in Nürnberg zum Tode.
Ehemalige Mitglieder der NSDAP mussten zwar mit der Entlassung oder Versetzung rechnen, oft aber stufte man sie als „kleine Nazis“ ein und ließ sie ungeschoren davon kommen. Man vermied es in der Nachkriegsidentität der Alpenrepublik, sich als eine nationalsozialistisches Nation darzustellen und betrachtete sich eher als Opfer Hitlers.
S. 119ff
Im Vorgarten des Hauses wird ein Haufen Papier verbrannt. Onkel Johann fährt mit dem Laubrechen zwischen die glimmenden Bücher, Bilder und Dokumente, er steht mit dem Rücken zur Straße. …
- Als Neffe wärst du willkommen, aber nicht als Soldat. Wo doch die Russen. Du musst verstehen. die Familie. Da ist es besser, wir sind ab jetzt neutra…
Eine Sanktion für die ehemaligen 500 000 NSDAP Mitglieder war es, dass sie bei der ersten Wahl im November 1945 nicht wählen durften. 1947 folgte das NS-Gesetz, das zwischen „Belasteten“ (Funktionäre, SS-Angehörige) und „Minderbelasteten“ differenzierte und entsprechende Maßnahmen vorsah. Die 42 000 belasteten Personen durften ab sofort keine freien Berufe, kein Gewerbe und keine Betriebe betreiben, quasi ein Berufsverbot. Minderbelastete zahlten Sondersteuern und wurden von Wahlen ausgeschlossen.
S. 149
Es ist ja nicht Peters Schuld, dass sein Vater mit Berufsverbot belegt war …
S. 172
Dass sich Peters Vater zweimal vor einem Volksgerichtshof zu verantworten hatte und dass er nach mehreren Monaten Ziegelschupfen zur Zwangsarbeit war, für anderthalb Jahre in St. Martin am Grimming zur Verbesserung der Gesinnung, was nicht viel gebracht hat. Wie Richard behauptet. Was der alles weiß. In so was heiratet man besser nicht rei…
Wer beim Aufbau Österreichs Engagement zeigte, erlebte nur eine kurze Sanktionierung. Letztendlich wurden die Sanktionen zwischen 1948 und 1955 aufgehoben bereits 1948 die Maßnahmen gegen die Minderbelasteten beendet.179
Eine Aufarbeitung des Nationalsozialismus fand zur damaligen Zeit weder in den Schulen statt noch gab es eine Abschaffung der Drillschule. Aufgrund der kurzen demokratischen Tradition in Österreich waren autoritäre Einstellungen im Alltag weiterhin verbreitet und änderten sich erst in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts.
Der Film „Hofrat Geiger“ ist ein Abbild dessen, wie wenig in Österreich in den 50er Jahren die nationalsozialistische Zeit mit der Judenverfolgung und die Entschädigung der Juden aufgearbeitet wurde bzw. Unterstützung fand:
S. 243
… der Hofrat trifft seine Jugendliebe, Marianne Mühlhuber, die er vor achtzehn Jahren sitzengelassen hat … Der Hofrat verspricht Wiedergutmachung ,,, Doch die ehemalige Geliebte verhöhnt ihn:- Weil wir ja jetzt im Wiedergutmachungszeitalter leben, nicht wahr! Wiedergutmachung! Wiedergutmachung! Ich kann das Wort schon nicht mehr höre…
Richard als Vater ist ein Beispiel für das weiterhin existierendes autoriär-patriarchalisches Denken/Verhalten:
S. 150f (1955) zu Ingrid:
… Und jetzt ist Schluss! Ich stelle mich nicht länger zur Verfügung, damit du deine Launen befriedigen kannst. Solange du die Beine unter meinem Tisch hast, tust du gefälligst, was ich sage. Haben wir uns verstande…
- Ob wir uns verstanden haben?
- Ja, sagte sie kleinlaut.…
S. 25 (1982)zu Alma:
Trotzdem trugen ihr ihre Deutungen mitleidige Blicke, abschätzige Hand beweg ungen und gönnerhafte Repliken ein, die alle auf dasselbe hinausliefen, dass in ihrem Kopf nicht allzuviel los sein könn…
Ist überhaupt so eine fixe Idee von ihm. Alles, was sie sagt, ist am Ende lächerlich oder banal oder überdreht. Davon verstehst du nichts, hört sie dann meisten…
Die Verdrängung der österreichischen Vergangenheit wird an Richard deutlich: Er verweigert die Aufarbeitung der Geschichte auf nationaler und individueller Ebene180. Ein Symbol dafür ist seine desolate Zahnprothese, die er seit der Unterzeichnung des Staatsvertrages besitzt und nicht abgeben will.
S. 24
Es war immer noch dieselbe Prothese, in den fünfziger Jahren teuer wie ein Moped, österreichisches Handwerk, gestützt auf Erkenntnisse aus der noch jungen sowjetischen Weltraumtechnik. Das befremdliche Elaborat war trotzdem nicht für die Ewigkeit geschaffen, und ab Mitte der siebziger Jahre unternahm Alma verschiedentlich dezente und weniger dezente Versuche, Richard zu einem neuen Modell zu überreden. …
Als er diesmal kam, hoffte Alma, dass die Epoche der Staatsvertrags-Zähne endlich vorbei sei. Doch die verlangte Begutachtung führte lediglich zu der Feststellung, dass die von Richard beargwöhnten Sprünge nichts weiter waren als die dem Gaumen entsprechenden Erhöhungen und Vertiefunge…
- Von kaputt kann keine Rede sein. Abgenutzt und schlecht, das allerding…
Er selber sieht sich nicht als Nationalsozialist:
S. 206
Jawohl, das hat er davon, dass ihm die Nazis nicht passte…
Alma dagegen kritisiert seine Form der Verdrängung und das politische Vergessen:
S. 195.
-Ein friedliches, ein freundliches und schönes Land.
- Vergesslich fehlt in deiner Aufzählung. Ein Land, in dem man bei der Einreise die Vergangenheit abgeben muss oder darf, je nach Lage der Ding…
Peter setzt sich ebensowenig mit der Vergangenheit auseinander. Sein erfundenes Spiel „Wer kennt Österreich?“ ist geographisch angelegt, ohne Geschichtsbezug:
S. 161
Wer kennt Österreich? Ein Reise- und Geographiespiel, das die kleine, besetzte (und bald die Unabhängigkeit wiedererlangende?) Republik in ihrer Schönheit und Harmlosigkeit in den Mittelpunkt stell…
Die erste demokratische gesamtösterreichische Wahl endete mit dem Ergebnis einer Koalition von SPÖ und KPÖ, die ÖVP wurde die stärkste Partei.
Im November 1947 begann dann die Zeit der „Großen Koalition“ von ÖVP/SPÖ, die bis 1966 gehen sollte. Die kontrollierte Demokratie war eine Sozialpartnerschaft zweier Parteien, in der die Proporzverteilung eine große Rolle spielte und die als ein wichtiges Kontrollelement galt. Beide politischen Lager konnten in Ministerien, auf Beamteneben, bei Stellenbesetzungen, Subventionen und in den Medien Einfluss nehmen.
Relevant für den Aufbau der Zweiten Republik wurde die „Sozialpartnerschaft“ zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, sie diente der Kontrolle der Lohn-Preis-Entwicklung und sicherte den sozialen Frieden des Landes.
Von den USA erhielt Österreich die Zusicherung für Hilfslieferungen über lebenswichtige Güter, Finanz- und Warenhilfe, was insofern eine politische Bedeutung hatte, da man damit den kommunistischen Einfluss verringern konnte.
Bereits 1946 hatten die Verhandlungen der Außenminister um einen Staatsvertrag begonnen. Bis zur Verabschiedung dauerte es aufgrund des Kalten Krieges neun Jahre. Als Stalin starb verbesserte sich mit dem neuen amerikanischen Präsidenten Eisenhower und der pragmatischen Politik der Regierung Raab gegenüber der UDSSR das Gesprächsklima, und Österreich wurde 1954 bei der Außenministerkonferenz gleichberechtigter Partner.
Man führte unter dem österreichische Staatsmann Julius Raab (1946 bis 1953 Präsident der Bundeswirtschaftskammer, 1953 bis 1961 Bundeskanzler und Bundesparteiobmann der ÖVP) die Verhandlungen direkt mit der Sowjetunion. Diese akzeptierte die Neutralität Österreichs als Voraussetzung für einen Vertragsabschluss, ebenso wie die Westmächte - Bündnislosigkeit und ökonomische Westorientierung sollten sich vereinbaren lassen. Die Mitverantwortung Österreichs am Zweiten Weltkrieg wurde durch das Bemühen von Außenminister Figl im Vertrag gestrichen.
Die Neutralität blieb eine der Säulen österreichischer Identität und „genießt bis heute bei der Bevölkerung eine hohe Wertschätzung“.181
Im April 1955 kam es dann in Moskau zu Verhandlungen zwischen der USA und der Sowjetunion, der Staatsvertrag wurde unterschriftsreif, die Unterzeichnung erfolgte am 15. Mai 1955 im Schloss Belvedere in Wien. „Der Abschluss des Staatsvertrages war für die meisten Österreicher/innen ein erstes weithin sichtbares Zeichen nationaler Selbstbestimmung, und die ausländischen Delegationen wurden im Mai 1955 dementsprechend herzlich begrüßt: Für viele, die damals in Wien dabei waren, war es in der Retrospektive der bedeutendste Tag in ihrem Leben.“182
Im militärischen Bereich entschied man sich für die Einführung der Allgemeinen Wehrpflicht, für ein Bundesheer und für die bewaffnete Neutralität nach Schweizer Muster, ebenso für ein Verbot der politischen und wirtschaftlichen Vereinigung mit Deutschland, für die Anerkennung der Menschenrechte und der Rechte der slowenischen und kroatischen Minderheit. Die Auflösung nazistischer und faschistischer Organisationen und die Unterbindung nationalsozialistischer Betätigung galten als eine wichtige Aufgabe.
(AG) ..
Richard Sterk ist als Verhandlungs-Teilnehmer von Österreichischer Seite tätig und gehört zur bürgerlichen Reserve nach 1945, die von den Besatzungsmächten gezielt abgerufen wurde. Als Teil der unbelasteten Honoratioren gelingt Richard die Kooperation mit den Alliierten, als „mündiger Bürger“ handelt er politisch und half mit, die neue Verfassung zu konzipieren.
S. 199
Als politischer Mandatar hat er die Verpflichtung, nicht nur für diejenigen da zusein, die ihn gewählt haben, er muss das ganze im Auge behalte…
S. 201
Dort (im Ministerium) hat er seit 1948 alles im Rahmen seiner Möglichkeiten gemeister…
Er fehlt aber ironischerweise auf den offiziellen Fotos der Politik wegen eines vereiterten Zahns.
(Metafiktion)
S. 14
Überhaupt geht ihr die Großmannssucht ihres Vaters und der ganzen Komitatschibande, die mit den Verhandlungen betraut ist, auf den Wecker. Die mit ihrer Trinkfestigkeit. Als ob das etwas mit dem Staatsvertrag zu tun hätt…
S. 202
Er, der den Staatsvertrag mit ausgehandelt hat, aber auf den wichtigen Fotos fehlt. Pech gehabt. War lange genug ein hohes Tie…
Richard lehnt Peter, den ehemaligen Hitlerjungen aus einer Nazi-Familie als Partner von Ingrid ab, was letztendlich zum Zerwürfnis führt.
S. 145
Ich verhandel nicht jahrelang mit den Sowjets, damit meine Tochter den Verstand verliert…
Es folgte die Aufnahme Österreichs in die Vereinten Nationen und in den Europarat.
Das Wirtschaftswunder mit einer rasanten Entwicklung der österreichischen Volkswirtschaft in den 50er Jahren brachte einen enormen Aufschwung, der Lebensstandard stieg, mit entscheidend dafür waren die staatsvertraglich festgeschriebene Neutralität und die Nichteinmischung in militärische Konfrontationen.
S. 176
Er hält einen Moment inne, um die Baustelle über dem Feld zu betrachten. Ein Mann, eine Frau und zwei Kinder stehen vor einem Rohbau. Der Mann und die Kinder mit den Händen am Rücken, herausgeputzt in Sonntagssachen, geschniegelt, mit Zöpfen, mit Scheiteln wie zu Fronleichna…
Peter setzt in dieser Zeit sein Studium nicht fort, sondern gründet eine Firma zum Vertrieb seines Brettspiels - der Erfolg ist gering:
S. 148
Richard lässt sich gerade über die Ungeklärtheit von Peters wirtschaftlichen Verhältnissen aus, und dass es viele junge Männer gebe, die durch die Kriegs- und Nachkriegsverhältnisse in ihrer Berufsentwicklung zurückgeworfen wurde…
S. 161ff
Ingrid, die nicht wenig erstaunt ist, dass nach einer Firma, die nichts als Verluste einfährt, eine solche Nachfrage besteht …
Wieviel das Warenlager wert ist, abzüglich der Spielpläne, die er wird wegwerfen müssen, weil - ein weiterer Fehlschlag im Leben des Peter Erlach, ein weiterer Hieb unter die wirtschaftliche Gürtellinie - der Staatsvertrag kommt und die Zonengrenzen falle…
S. 167
Du musst doch einsehen, wenn wir heiraten, will die Verwandtschaft wissen, wie und was mit dir ist, und da würden sie reihenweise auf den Rücken fallen, wenn sie erfahren, dass du ein Nachhilfelehrer bist, der mit dem Vertrieb von Brettspielen Schulden mach…
S. 263
In Wahrheit war es eine Fortsetzung des Tschick-Sammelns in der Erbsenzeit, ein während der ersten Nachkriegsjahre entstandenes, aus der Not geborenes, völlig ineffizientes, letztlich sinnloses Unternehmen, mit dem Peter sich beschäftigte, um größeren Plänen aus dem Weg gehen zu könne…
In den späten 50er Jahre begann in Österreich die Jugend- und Protestbewegung, wenn auch in schwächerer Form als in Deutschland und Frankreich.
Ingrids Auseinandersetzungen mit ihrem Vater sind hierfür ein Beispiel:
S. 149
Solange diese Spiele nichts einbringen, sind sie windige Unternehmungen, nichts weite…
- Ja, weil für dich einer geerbt haben muss, damit er etwas anfangen darf. Alle anderen sind Gauner und Nulle…
Alma sagt erinnern…
- Ingrid
- Mama, es ist so ungerecht, dass er sich zwischen zwei Menschen stellt, die sich lieben…
1955 gründete sich die FPÖ, die „sich unter einem dünnen liberalen Deckmäntelchen vor allem als Interessenvertreter der ehemaligen NSDAP-Mitglieder präsentierte und gegen Entnazifizierung und Restitution von „arisiertem“ ehemals jüdischen Eigentum polemisierte.“183
Ideologisch und ökonomisch zeichnete sich eine Integration in den Westen ab, so dass in den 60er Jahren der Schritt Richtung EWG gegangen wurde.
Der Korea-Krieg findet im Buch nur nebenbei Erwähnung, nämlich in Bezug auf seine persönliche Bedeutung für Ingrid und Peter:
S. 173
- Peter, wenn der Koreakrieg nicht gewesen wäre, hätte ich nicht mit dir geschlafen. Nicht gleich.
- Schön für uns, schlecht für Korea. Dein Vater sieht es vermutlich genau umgekehr…
Restauration war ab 1966 mit der Wahl von Bundeskanzler Josef Klaus (ÖVP) angesagt, er regierte allein und war als der einzige Kanzler, der der „Heimkehrer“-Generation angehörte, einem konservativ-christlichen Kulturbild verbunden: Die Wiederbelebung eines katholisch-bürgerlich-bäuerlichen Weltbildes war der Rückgriff auf Bewährtes.
Die Familiengründung von Ingrid und Peter spiegelt dies wieder:
S. 159
Mit dem Verkauf der Lizenzen Ende 1960, während der Schwangerschaft mit Sissi, hoffte Ingrid, dass jetzt ein besseres Leben beginnen werde,. Stattdessen wurde es schlimmer. Ingrid lag im Krankenhaus, Peter war beruflich unterwegs…
Die vielen einsamen Spaziergänge am Wilhelminenberg mit dem Kinderwagen und später das langweilige Entenfüttern mit Sissi, als Ingrid eigentlich hätte lernen sollen.…
Richard wird 1962 von der Partei nicht mehr benötigt und hat das Gefühl, sowohl politisch als auch privat überflüssig zu sein. Kritisch hinterfragt er den politischen Zeitgeist und bezichtigt seine Parteimitglieder und Politiker einer mangelnden Verpflichtung ihres Gewissens und ihres öffentlichen Mandats:
S. 198f
Schieben ihn aufs Abstellgleis ohne ein einziges sachliches Argument. Oder weil ihm das Fernsehen nicht passt, wo es einem auf dem Bildschirm den Kopf verzerrt wie in einem Fischauge. Oder weil die Jungen sich einbilden, sie seien John F Kennedy. …
Von politischen Charme und der Höhe der Zeit faseln, aber nicht wahrhaben wollen, dass die wichtigsten Grundlagen in Leben Verantwortungsgefühl, Sorgfalt und Respekt sind. ..Es sind schon bittere Pillen zu sehen, wie man den Sozialisten die Wähler in die Hände treibt. …
Es ist die Lehre, die er seiner Meinung nach im Leben erteilt bekommen hat: dass man nicht anfangen soll, den Mitmenschen Gutes zu tun, wenn man es gedankt haben will. …
Auch er selbst, muss er sich eingestehen, hat bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg die Christlichsozialen für bessere Menschen angesehen, ganz wie auch die Sozialdemokraten dachten, sie seien bessere Menschen. …
Er muss erkennen, dass christlich-sozial nicht automatisch bedeutet, dass es einem um mehr als nur die eigenen Annehmlichkeiten geht, nicht bedeutet, dass man der Meinung des Gegners vorurteilsfrei entgegentritt…
Vielleicht ist irgendwohin ein Samen gefallen, vielleicht kommt seine Auffassung von der fundamentalen Verpflichtung eines öffentlichen Mandats in einigen Jahren wieder in Mod…
Langsam begann ein sozialer und mentaler Wandel patriarchal-autoritärer Strukturen. Das Obrigkeitsdenken wurde hinterfragt und so manche Partei sprach mit ihrer Mentalität und ihren Schlagworten die neue aufstiegsorientierte Mittelschicht nicht mehr an.
1970 kam es zur Minderheitsregierung der SPÖ, ab 1971 übernahm sie mit absoluter Mehrheit die Regierung. Bundeskanzler Bruno Kreisky, Jude, Emigrant und Intellektueller hatte zwar wegen seines großbürgerlichen Habitus mit Vorurteilen zu kämpfen, doch gilt seine Ära bis heute als die Zeit des Aufbruchs.
S. 266
Anschließend redet ihr Vater eine Weile über den Linksruck nach der letzten Wahl, über den sich Alma insgeheim freue. Er lässt einfließen, dass diese Entwicklung ihm keineswegs, wie man vermuten könne, das Gefühl gebe, er haben den Sinn seines Lebens verfehlt. Mittlerweile seien die einen wie die andere…
Die Modernisierungs- und Demokratisierungsvorstellungen der Bevölkerung wurden erfüllt und umfassende Reformen verabschiedet, wie die Abschaffung von Studiengebühren, die Einführung von Heiratsbeihilfen, die Straffreiheit der Homosexualität und des Schwangerschaftsabbruchs in den ersten drei Monaten. Die Gleichberechtigung der Geschlechter wurde eine Grundlage des Familienrechts. Eltern und Schülern bekamen Mitbestimmungsrechte, es gab Gratisschulbücher, freien Universitätszugang für alle, und es kam zu sozialen Umverteilungsmaßnahmen durch den Ausbau des Sozialsystems. Die Zahl der Studierenden stieg von 20 000 Mitte der 50er Jahre auf 175 000 Mitte der 80er Jahre.
(AG) ..
1970 hat Ingrid ihr Studium beendet und arbeitet inzwischen als Ärztin.
S. 238
Die „momentane Einteilung mit Mann-Kinder-Berufstätigkeit-Haushalt“ wächst ihr zum Kragen herau…
S. 272
Sie liebt ihren Beruf. Es ist der Beruf, den sie haben wollte. … In der Dienstkleidung fühlt sie sich als moderne, selbständige und kräftige Frau. Ihre Schrift in den Krankenakten. Der Umgang mit den Patienten und dem Personal. Sie gefällt sich dabei, es entspricht ihrem Gefühl von sich selbst, es ist das, was sie brauch…
Bis in die 70er Jahre und später war die ÖVP besonders einflussreich, was Kulturfragen betraf: das Monopol der Hochkultur, d.h. Staatsoper, Wiener Philharmoniker und Burgtheater garantierten ihre gesellschaftliche Dominanz, in der Literatur dominierten weiterhin Heimatromane und konservative und restaurative Themen. Kunst, die Österreich-Kritik zum Inhalt hatte, wurde aufgrund ihrer internationalen Erfolge anerkannt.
In den 80er Jahren kam es zur kleinen Koalition zwischen SPÖ und FPÖ, sie zerbrach an der Debatte um die Kriegsvergangenheit des gewählten Bundespräsidenten Kurt Waldheim (ÖVP); Waldheim, der seine Rolle in der NS-Zeit und im Zweiten Weltkrieg verdrängt hatte, spiegelte den Umgang mit der NS-Zeit und dem Zweiten Weltkrieg in Österreich wider. In der Folgezeit entwickelte diese Waldheim-Affäre eine VergangenheitsBewältigungs-Debatte, die Zeit der Verdrängung und die Betonung der Opferrolle Österreichs in der NS-Zeit war von nun an beendet.
Ende der 70er und in den 80er Jahren formierte sich eine Umweltbewegung und eine zivile Opposition z.B. gegen Atomkraftwerke (Atomkraftwerk Zwentendorf). Die Große Koalition von SPÖ und ÖVP unter Franz Vranitzky (SPÖ) folgte in den Jahren 1986 bis 2000 und konnte den EU-Beitritt 1994, mit Unterstützung der Beitrittsambitionen von Seiten Helmut Kohls,, als ihren Erfolg buchen. Im Vorfeld hatte die Sowjetunion hierin eine Neutralitätsverletzung und einen Bruch des Staatsvertrags gesehen, aber letztendlich war es Vranitzky, der Gorbatschow überzeugte, dass die Gefahr eines neuen „Anschlusses“ obsolet war.
S. 346
Michail Gorbatschow war in Berlin und hat zu weiteren Reformen gemahnt. Sie erzählt von den Wahlen in Vorarlberg, wo die ÖVP ihre absolute Mehrheit gehalten ha…
1998 kam es zur Aufnahme Österreichs in die Euro-Zone, 2002 führte Österreich als Zahlungsmittel den Euro ein.
So weit die historische Zeit in Arno Geigers Roman.
7.3 Zeitgeschichtliche und gesellschaftliche Bezüge im Roman „In Zeiten des abnehmenden Lichts“
„Erinnerung ist Interpretation…
Ruge erzählt in dem Roman „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ eine Familiengeschichte aus der ostdeutschen Vergangenheit und markiert als Eckpunkte darin die Kriegs- und Nachkriegszeit und die 70er Jahre bis zur Wende und Nach wendezei…
„Dieses Buch ist Teil der Wende-Literatur, die „höchstens Ende-Literatur der ehemaligen DDR [ist]“184 und umfasst den autobiographischen Hintergrund des Autoren.
In der Zeit einer geschichtlichen Wende erfolgt in der Regel eine Zäsur im Leben des einzelnen Menschen, so geschehen auch bei Eugen Ruge. Er thematisiert den Abschied von der Welt der DDR-Väter und wendet sich der historischen, biographischen und familiären Vergangenheit zu. Dabei setzt er nicht auf Politisierung, sondern legt den Schwerpunkt auf eine Privatisierung in Form von Familienprosa und den Grunddimensionen des menschlichen Lebens - sie sind in jedem politischen System ähnlich bzw. gleich.
Dieses Buch ist einzuordnen in den damaligen Erinnerungsboom an die DDR. Die Multiperspektivität und die Datierungen im Laufe der 40 - 50 Jahre geben uns eine Beschreibung des damaligen Lebens, dessen Alltag, Entwicklungen und Veränderungen in einer sozialistischen Gesellschaft, wie es die meisten Ostdeutschen unter den wechselnden Bedingungen, beeinflusst durch den realen Sozialismus, während dieser vier Jahrzehnte erlebten. Der Autor schildert eine individuelle Geschichte, in der nichts von den repressiven institutionellen Strukturen und dem Widerstand zu spüren ist und wo an kaum einer Stelle die DDR als ein Land der Überwachung und einer unter Repressionen lebenden Bevölkerung wahrgenommen wird.
Es gibt kein düsteres Bild der Unterdrückung und Angst, diese Ostdeutschen hatten nicht das Gefühl, in einer inneren Emigration oder in ständiger Angst und Konspiration zu leben. Wir als Leser hören nichts von den dunklen Aspekten des Lebens in einer von sowjetischen Panzern beherrschten Diktatur, es wird uns das „normale“ Leben der DDR- Bürger mit ihren (ungeschriebenen) kulturellen und spezifischen Regeln und Normen vor Augen geführt, aber es gibt auch kaum Momente des Glücks in diesem Roman, der knapp 50 Jahre überspannt.185
Wir erfahren, was die Menschen in der DDR bewegte und wie sie das halbe Jahrhundert im anderen Teil Deutschlands erlebten, sei es in Bezug auf Erziehung, Ausbildung, Kameradschaftlichkeit im Umgang miteinander oder in Bezug auf die Schwierigkeiten im Angebot an materiellen Gütern, von Autos bis zu Lebensmitteln
Eugen Ruge zeigt, dass das Leben in der DDR ein „Mitlaufen, das Abtauchen in Nischen, das Suchen nach dem ganz privaten Glück fern jeder Ideologie inmitten einer oft als grau empfunden Umwelt war.“186
Individuelle Gedächtniswelten ersetzen gesellschaftliche Gegenwartswelten. Es sind Erinnerungen an persönliche Erfahrungen (Gerüchen, Alltagsritualen), geformt durch den politischen und historischen Kontext.187
Diese Familiensaga gibt die Geschichte von 4 Generationen zwischen 1952 bis 2001 wieder, erzählerische Rückblenden reichen bis in die Zeit des Kaiserreichs und der Weimarer Republik. Der Leser erfährt die Geschichte der DDR von ihren Anfängen bis zum Mauerfall.
Die unterschiedlichen Generationen, die jeweils für eine Phase der Zeitgeschichte ihres Landes stehen, spiegeln die Gefühle, Ängste und Wünsche, Hoffnungen von Großeltern, Eltern, Kindern und Enkeln wider, stets auf dem gesellschaftlich-politischen Hintergrund der DDR:
- Charlotte und Wilhelm werden in der Weimarer Rebpublik sozialisiert und erleben den 2. Weltkrieg in der Emigration in Mexiko;
- Kurt und Irina werden sozialisiert im Dritten Reich und erleben den Gulag in der Sowjetunion.
Saschas Großeltern und Eltern sind Kommunisten und Angehörige der Aufbaugeneration in der DDR und haben zur DDR eine positive Grundhaltung: Sie wollen eine Welt und einen Staat ohne Ausbeutung .
- Sascha gehört zur Generation, die in der DDR aufgewachsen ist und deren Sozialisierung in der DDR stattfand. Sie hatte sich daran gewöhnt, nach den Regeln des Regimes zu leben. Für Sascha spielt Politik keine große Rolle, für ihn stehen die Schule, seine Hobbys und Freundinnen im Mittelpunkt.
- Markus ist ein Kind der Wende-Generation.
Im folgenden werde ich das halbe Jahrhundert der DDR-Existenz rekapitulieren und ergründen, ob und wie es sich im Roman wiederfindet.
Das Buch streift die Zeit vor 1952 in den Personen von Charlotte und Wilhelm.
Charlotte erlebt ihre Kindheit im Kaiserreich.
S. 134
- Als ich so alt war wie du, begann sie zum dritten Mal, da musste ich jeden Sonntag mit meiner Mutter in den Tiergarten gehen, weil meine Mutter den Spleen hatte, dem Kaiser, der dort manchmal spazieren ging, ihre Aufwartung zu mache…
…und tritt nach dem 1. Weltkrieg in die Kommunistische Partei ein, da sie dort intellektuell und beruflich gefördert wurde: S. 46f
Was wäre sie heute, fragte sie sich, ohne die Partei? Kunststopfen und Bügeln hatte sie gelernt an der Haushaltsschule. Noch heute würde sie kunststopfen und bügeln für Herrn Oberstudienrat Umnitze…
Erst die Kommunisten, die sie ursprünglich für Banditen gehalten hatte.hatten ihreTalente erkannt, hatten ihre Fremdsprachenausbildung geförder…
Wilhelm Powileit, gelernter Metallarbeiter und überzeugter Kommunist, fühlt sich in seiner proletarischen Tradition gewissermaßen geadelt und belegt dies mit einer historischen Begegnung mit Karl Liebknecht, einem führenden Linken während der Revolution 1918. In seiner Erinnerung bleiben aber keine bedeutungsvollen politischen Worte, stattdessen muss er seine eigene Erinnerung auf eine Banalität reduzieren: Der Revolutionsführer sagt zu Wilhelm: „Junge, putz dir doch mal die Nase.“ In einer weiteren Stufe der Ironisierung wird die historische Gewissheit, dass es sich überhaupt um Liebknecht gehandelt habe, relativiert:
S. 190
Oder war es gar nicht Liebknecht gewesen? Oder war das gar nicht beim Eintritt in die Parte…
Wilhelm ist für seine Partei in der Zwischenkriegszeit immer aktiv, übernimmt Aufträge im Milieu der Geheimdienste, unterstützt von Charlotte.
S. 42
Zwar war er tatsächlich einmal - auf dem Papier - Co.Direktor der Lüddecke & Co. Import Export gewesen. Aber erstens hatte er dies-aufgrund einer lebenslänglichen Geheimhaltungsverpflichtung - nicht einmal in seinem von der Partei verlangten Lebenslauf angegeben. Und zwar war Lüddecke Import Export nicht mehr als eine von den Russen finanzierte Scheinfirma gewesen, die dem Geheimdienst der KOMINTERN zum Schmuggel von Menschen und Material dient…
S. 124
Drei Jahre lang hatte er im Büro gesessen und Zigaretten geraucht. Das war Wilhelms „Geheimdiensttätigkeit“. Drei Jahre auf verlorenem Posten. Nichts ging mehr. Nachrichten über Verhaftungen trudelten ein, und Wilhelm saß da und wartet…
Nach der Machtübernahme Hitlers 1933 ist diese Tätigkeit zunehmend gefährdet, denn Kommunisten wie Wilhelm/Charlotte erleben das Regime Hitlers von Anfang an als ein Regime der Unterdrückung. Sie fliehen als potentielle Opfer der NS-Verfolgung vor den Nazis, emigrieren nach Südfrankreich und gehen über Marokko in das Exil nach Mexiko. S.120
Schon 1940 in Frankreich, im Internierungslager Vernet, hatte Wilhelm durch den Skorbut alle Zähne verloren … Du lieber Gott, was für eine Zeit, was für Ängste, was für ein Durcheinander.Dort arbeiten sie in verschiedenen Berufen und engagieren sich bei der kommunistischen „Demokratischen Post“: S. 36
Am Mittwoch war Redaktionssitzung wie immer. Wilhelm war zwar aus der Leitung der Gruppe abgewählt, hatte aber seine bisherigen Funktionen bei der Demokratischen Post' behalten: Er machte die Abrechnung, verwaltete die Kasse, half beim Umbruch. und in dem Artikel, den man ihr zum Korrekturlesen gab, übersah sie absichtlich Druckfehler, damit die Genossen in Berlin auch wahrnahmen, auf welches Niveau die Zeitschrift gesunken war, seit man sie als Chefredakteur abgelöst hatt…
Für sie ist die Nachkriegshoffnung auf eine bessere Zukunft und der planmäßige Aufbau des Sozialismus eine Rechtfertigung für das, was auf das Exil folgen soll.
S. 47
… kehrte sie, die nur vier Klassen der Haushaltsschule besucht hatte, heute nach Deutschland zurück, um ein Institut für Sprachen und Literatur zu übernehme…
Werner und Kurt, die Söhne Charlottes werden für ihre weitere Ausbildung in die Sowjetunion geschleust.
S.350
…, und zwar (auch das wusste er sofort) beginnend mit jenem Augusttag 1936, an dem er neben Werner an Deck des Fährschiffes stand und zusah, wie der Leuchtturm von Warnemünde im frühen Nebel verblasst…
Wegen ihrer Kritik am Hitler-Stalin-Pakt im Jahre 1939 verurteilt man beide in der Sowjetunion 1941 zu Haft und Zwangsarbeit im Gulag.
S. 369
- Du hast einfach nicht lang genug gesessen. Dir hätten sie nochmal zehn Jahre aufbrummen solle…
Werner stirbt im Lager Workuta.
S. 136
Dein Sohn ist ein Workuta ermordet worde…
S. 185
Und wie so oft in diesen Momenten, wenn er es kaum fassen konnte, dass er tatsächlich lebte, dachte er zugleich daran, dass Werner nicht mehr lebt…
7.3.1 Die 50er Jahre und ihre Präsenz im Buch
Als der 2. Weltkrieg beendet war, wurden kleine Gruppen deutscher Kommunisten von Moskau in die sowjetische Besatzungszone geflogen, mit dem Auftrag, dort mit gleichgesinnten Genossen ein besseres Deutschland aufzubauen. Diese Kommunisten hatten Verfolgung und Exil in der Sowjetunion oder in anderen Ländern erlebt und kehrten nun aus Verstecken und aus dem Ausland zurück, um die Idee des Aufbaus zu realisieren. So wie zahlreiche Ostdeutsche beteiligen sich Teile der Familie Umnitzer (Ruge), insbesondere die Großeltern, aktiv an sozialen und kulturellen Projekten, um so die Vision einer besseren Gesellschaft bewusst zu gestalten.
Zum Jahreswechsel 1951/1952 reisen Charlotte und Wilhelm nach Puerto Angel, um sich von ihrer Arbeit und den Schwierigkeiten mit der Partei zu erholen.
S. 33
Ein Kaffeelaster brachte sie von dem kleinen Flugplatz nach PuertoÁngel.Ein Bekannter hatte den Ort empfohlen: romantisches Dorf, malerische Bucht mit Felsen und Fischerboote…
Mehrere Rückreiseanträge sind abgelehnt worden, die Sorge um die Söhne lastet auf Charlotte, von Kurts Überleben ist sie informiert:
S. 35
Charlotte wünschte sich zuallererst, dass Werner am Leben sei. Kurt lebte, von ihm hatte sie inzwischen Post..Nur von Werner - nicht…
Die Großeltern Saschas hören den Aufruf der SED zum Aufbau:
S. 50
Dieses Land brauchte sie. Sie würde arbeiten. Sie würde mithelfen, dieses Land aufzubauen - gab es eine schönere Aufgab…
Im April 1952 erhalten sie die Einreiseerlaubnis und die berufliche Beauftragung für Tätigkeiten an der Akademie zur Ausbildung der Diplomaten der DDR.
S. 43
Schon mehrmals war ihnen die Rückkehr in Aussicht gestellt worden, aber immer war am Ende etwas dazwischengekommen Aber dieses Mal schien es anders zu laufen. Tatsächlich wurden ihnen auf dem Konsulat Einreisevisa ausgehändig…
S. 47
… um ein Institut für Sprachen und Literatur zu übernehme…
Charlotte tritt die Rückreise in die DDR mit großem Enthusiasmus an, erlebt aber eine deprimierende Trümmerlandschaft (50 ff.), während Wilhelm ein politisch motiviertes Hochgefühl empfindet.
S. 48
Was sie von der Stadt zu sehen bekamen, unterschied sich im Grunde kaum vom Hafen, und obwohl Charlotte auf den ersten Blick keine unmittelbare Zerstörung erkennen konnte, sah eigentlich alles zerstört aus: die Häuser, der Himmel, die Menschen, die ihre Gesichter hinter hochgeschlagenen Kragen verbarge…
S. 54
Dann Berlin. Eine abgebrochene Brücke. zerschossene Fassaden. Dort ein zerbombtes Haus, das Innenleben entblößt: Schlafzimmer, Küche, Bad. Ein zerbrochener Spiegel.. Nichts kam ihr bekannt vor. Nichts hatte mit der Metropole zu tun, die sie Ende der dreißiger Jahre verlassen hatte…
Kurt überlebt den Gulag. In der sich der Lagerhaft anschließenden Verbannung in Slawa heiratet er 1951 Irina.
S. 242
Damals war sie Zeichnerin im Projektierungsbüro gewese…
S. 243
… ob er derjenige Kurt Umnitzer sei, der von 1941 bis 1956 in Slawa, im Nord.Ural, gelebt habe. 1956 reisen sie mit ihrem Sohn Alexander in die DDR au…
Anders als in Westdeutschland und Österreich, wo man sich für Demokratie unter Beibehaltung der alten wirtschaftlichen Ordnung entschied, veränderte sich für die Menschen im Osten weitaus mehr durch die neue wirtschaftliche Ordnung und die Änderung der Eigentumsverhältnisse. Die Schuld am Krieg und am Faschismus wurde auf die Kapitalisten und Kriegsgewinnler übertragen, die Bundesrepublik als eine Neuauflage des Nazireichs angesehen, während die Arbeiter und Bauern durch ihre Klassenzugehörigkeit als entsühnt galten. Die Bürger der DDR, die das System ablehnten und die sozialistische Umgestaltung als repressive Maßnahme empfanden, entschieden sich für den Weggang.188
Die Nachkriegszeit war geprägt von Hunger und Lebensmittelrationierung.
5. 77f
Im Konsum gab es Milch gegen Marke. Mit einer großen Kelle füllte die Verkäuferin die Kanne. Früher hatte das immer Frau Blumert getan. Aber Frau Blumert hatte man verhaftet. Er wusste auch, warum: weil sie Milch ohne Marke verkauft hatte. Hatte Achim Schliepner gesagt. Milch ohne Marke war streng verboten. Deswegen war Alexander entsetzt, als er die neue Verkäuferin sagen hört…
- Macht nichts, Frau Umnitzer, dann bringen Sie Ihre Marke morgen…
… Er begann zu weine…
Zusätzliche Nahrungsmittel bekamen die „Opfer des Faschismus“. Man behandelte sie bevorzugt und räumte ihnen in dem neuen System in vielerlei Hinsicht Vorteile ein.
Von Anfang an war die DDR eng verbunden mit der UDSSR, so dass ,der große Bruder’ als Besatzungsmacht nach seinen Vorstellungen einen sozialistischen Bruderstaat formen konnte, diese enge Beziehung und Freundschaft zu Russland bestand bis zum Erscheinen von Gorbatschow.
Im Roman zeigt das Missverständnis der anwesenden Parteimitglieder bei Nadjeshdas Lied die ideologische Verblendung der Parteibonzen und ihre sinnleere Begeisterung, sie blamieren sich in ihrer Russenfreundschaft und entlarven den Charakter der Herrschenden.
S. 288
Baba Nadja war es , die sich plötzlich im Takt hin und her zu wiegen begann und mit tiefer rauer Stimme russische Laute hervorbrachte, welche sofort die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zogen. Psst-psst, hieß es, sogar Urgroßmutter wurde niedergepsst, man warf Baba Nadja aufmunternde Blicke zu, schon fingen die ersten Köpfe an, sich im Takt zu wiegen, ..fingen die Ersten an mitzusingen, immer an der Stelle Wodka, Wodk…
S. 344
… denn natürlich zeigten sich alle begeistert von der russischen Babuschka, wetteiferten darum, ihre Verbundenheit mit dem sozialistischen Brudervolk unter Beweis zu stelle…
40 Jahre herrschte die Sozialistische Einheitspartei (SED) in dem unter sowjetischer Kontrolle stehenden Teil Deutschlands. Ihr Ziel war eine veränderte, bessere Gesellschaft mit Gleichheit und Gerechtigkeit, wobei sie zur Umsetzung dieser Idee nichtdemokratische Mittel verwandte und die anfänglichen autoritären Strukturen der fünfziger Jahre während der 40jährigen Existenz des Staates beibehielt.
Die DDR verstand sich als eine Diktatur des Proletariats mit einer klassenlosen Gesellschaft, in der jeder Mensch die eigenen Interessen und Begabungen entwickeln konnte. Der Westen dagegen schätzte diesen Staat als Unrechtsstaat ein, weil es in ihm keine einklagbaren Grundrechte, keine Freiheit der Meinung und keine freien Wahlen gab.
Die Geschichte des SED Staates begann mit Stalin. Stalin personifizierte Sinn, Kraft und Tat, war der Sieger über den Faschismus. Ihm waren nicht nur viele Intellektuelle und Künstler treu ergeben. Die Verehrung und der Personenkult um ihn führte bis zur Verherrlichung und einem quasi-religiösen Treueverhältnis.
Wilhelm und Kurt sind zwei von „Stalins jungen Hunden“ aus den späten vierziger Jahren. Wilhelm, ein Greis, der nie aus Stalins Schatten getreten ist, verkörpert das System der Repression. Als rückwärts gewandter Altstalinist stellt er die Ideale der Partei über seine eigene Familie. Da er nie unter autoritärer Herrschaft leiden musste, hat er auch keine Abneigung gegenüber stalinistischer Ideologie.
Kurt erinnert seine Mutter daran, dass Werner vom Stalinismus ermordet worden sei. Sein Brief an Werner, in dem er den Deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt vorsichtig in Frage gestellt hat, brachte den Brüdern zehn Jahre Lagerhaft wegen Bildung einer konspirativen Vereinigung ein und führte damit zu Werners Tod. Charlotte verdrängt dies:
Jetzt sah er ihn vor sich. Frappierende Ähnlichkei…
- Sie haben Kritik an der Außenpolitik des Genossen Stalin geäußer…
Der Sachverhalt: Anlässlich des „Freundschaftsvertrags“ zwischen Stalin und Hitler hatte Kurt damals an Bruder Werner geschrieben, die Zukunft werde erweisen, ob es vorteilhaft sei, mit einem Verbrecher Freundschaft zu schließe…
S.136
- Ich verstehe dich nicht, sagte Kurt, und obwohl er gedämpft sprach, klang seine Stimme scharf, und er betonte jedes Wort, als er sagte: Dein Sohn ist in Workuta ermordet worden. Charlotte sprang auf, bedeute Kurt mit der Hand, zu schweige…
S. 250
Und es kam ihr,., wie ein böser Traum vor, dass sie tatsächlich einmal verblendet genug gewesen war, möglichst bald für diese Heimat sterben zu wollen: Für die Heimat, für Stalin! Hurr…
Wilhelm stimmt mit seiner geradezu magischen Wirkung auf die anwesenden Parteimitglieder bei seiner Geburtstagsfeier ein stalinistisches Parteilied an.
Trotz seiner Demenzerkrankung kann er sich noch an das „Lied der Partei“ erinnern, so sehr ist ihm das Dogma in Fleisch und Blut übergegangen.
S. 208
Er sang leise, für sich, jede Silbe betonend. In leicht schleppendem Rhythmus, er merkte es woh…
Er unterschätzt Kurts Erfahrungen im sowjetischen Gulag, hält ihn für einen Schwächling und verabscheut seine liberale Einstellung zum Sozialismus.
S. 207
Aber Kurt? Kurt hatte währenddessen im Lager gesessen. Hatte arbeiten müssen, wie schrecklich, mit seinen Händchen, mit denen er noch nicht mal ein Gurkenglas aufkriegte. Andere, dachte Wilhelm, hatten ihren Arsch riskiert. Andere, dachte er, waren draufgegangen im Kampf für die Sach…
Stalin starb 1953. Im selben Jahr kam es durch Normerhöhungen und wegen des Entzugs von Lebensmittelkarten zu Arbeiterstreiks in den Fabriken. In dieser gesellschaftlichen Krise suchte man vergebens die protestierende Stimme der Intelligenz.
Nikita Chruschtschow enthüllte 1956 auf dem XX. Parteitag der KPdSU die Verbrechen Stalins und dessen Terrorsystem, das den Tod von 25 Mio. Menschen zu verantworten hatte. Es war eine finstere Zeit gewesen, in der Menschen einfach verschwanden und nie wieder auftauchten, in Arbeitslager verschleppt und hingerichtet wurden. Sowohl die Intelligenz als auch die jungen Menschen waren erschüttert und ließ sie auf Abstand zum Stalinismus gehen, nicht aber zum offiziellen Marxismus.189 DDR und Sowjetunion distanzierten sich von dem grausamen Diktator und demontierten seine Denkmäler, doch gesprochen werden durfte über die stalinistischen Verbrechen nicht: „Das Schweigen darüber war so total, dass heute kaum noch jemand um die Verbrechen der Anfangszeit der DDR weiß, obwohl es nahezu keine Familie geben kann, die davon unberührt blieb.“ 190
Das Umbenennen von Straßenamen und Bahnhofsnamen mit Stalins Namen (Stalinallee zur Karl-Marx-Allee z.B. ) sollte auch seine Verbrechen vergessen machen, stellte aber nicht die Frage nach der Ursache für den Terror des Stalinismus und ließ auch die von Stalin geschaffenen Machtstrukturen bestehen.191
Die politische Spannung in der Zeit des Kalten Krieges spiegelt sich in den Ängsten von Alexander wieder und den politischen Indoktrinationen, denen er als Kind durch Wilhelm ausgesetzt ist.
Alexander erlebt den Stalinismus, ohne ihn zu verstehen, mit der Angst vor staatlicher Bedrohung:
5. 77f
Im Konsum gab es Milch gegen Mark…
- Ich will keine Milch.Aber Saschenka, ich werde doch nicht verhaftet! ...
- Aber Frau Blumert ist verhaftet worden, sagte er.
- Ach, Unsinn! die Mama verdrehte die Augen. Wir sind doch nicht in der Sowjetunion!
- Warum?
- Ach, das rede ich bloß so daher, sagte die Mama. Nicht, dass du Omi erzählst, in der Sowjetunion wird man verhafte…
Von Wilhelm erfolgen politische, ideologische Belehrungen z.B. über Amerika und Indianer:
S. 92
- Die Indianer, erklärte er, sind heute die Ärmsten der Armen. Unterdrückt, ausgebeutet, ihres Landes beraubt. Omi sagte:
- In der Sowjetunion gibt es keine Ausbeutung und keine Unterdrückung.
- Das ist klar, sagte Wilhel…
Dann kam es in Ungarn im Oktober 1956 zu Ereignissen, die Ängste vor einem Bürgerkrieg schürten und in der Intelligenz der DDR zu neuen Diskussionen über das Verhältnis der Partei zu Arbeitern und Intellektuellen führte. Ulbricht, in der Zeit der 50er Jahre SED-Vorsitzender, prüfte daraufhin die wissenschaftliche und literarischkünstlerische Intelligenz in Prozessen auf ihre Verlässlichkeit und enthob, da das System noch nicht fest etabliert war, allzu kritische und reformistische und in seinen Augen konterrevolutionäre Intellektuelle von ihren Posten.
Es war eine Zeit, gekennzeichnet durch die Unterdrückung alternativer Stimmen. Verunsicherung und Verzweiflung machten sich breit und es kam die Forderung nach einer neuen Politik und freier Meinungsäußerung auf.192
Dies findet im Buch Erwähnung:
S. 332
Früher waren zu Wilhelms Geburtstag hin und wieder ganz interessante Leute erschienen: ..Karl Irrwig, der, immerhin, gegen Ulbricht einen deutschen Weg zu Sozialismus hatte durchsetzen wolle…
Die gesellschaftlichen Bereiche in der DDR waren an der Idee und Realität eines zentralistischen Sozialismus ausgerichtet und alle Bürger im nationalen Aufbauprogramm Anfang der 50er Jahre aufgerufen, beim Bau von Straßen und Gebäuden und Industrie mitzuhelfen. Zu diesem Zweck sollten Arbeitsnormen erhöht werden. Die damit verbundene Lohnminderung führte am 16. und 17. Juni zu Streiks und Demonstrationen, in deren Verlauf man politische Freiheit, freie Wahlen und die Wiedervereinigung forderte. Demonstranten riefen auf, SED-Einrichtungen zu erstürmen, in manchen Städten gelang dem Volk die Machtübernahme. Erst als Sicherheitskräfte und sowjetische Truppen zum Einsatz kamen, beruhigte sich die Situation.
Die SED behauptete propagandistisch, unterstützt von so manchen Persönlichkeiten der DDR, es sei ein „faschistischer Putsch“ gewesen, der vom Westen ausging und die Arbeiterklasse verführt hätte. Kritiker dagegen erkannten, dass Veränderungen und neue Entwicklungen in der DDR nur durch allmähliche Reformideen erreicht werden konnten bzw. mussten.193
Die Produktionsverhältnisse und die sozio-ökonomische Struktur veränderten sich: größerer Besitz in der Industrie und im Bankenwesen wurde abgeschafft, Bildungswesen, Justiz und die Lokalverwaltung neu organisiert.
Alle Maßnahmen richteten sich gegen die bürgerlichen Schichten und ehemaligen Adlige und bewirkten, dass diese in den Westen flohen.
Man begann mit der Umgestaltung von Landbesitz und der Kollektivierung der Landwirtschaft. Dafür enteignete man große Bauernhöfe ohne Entschädigung, so dass es schon bald kein freies Bauerntum mehr gab, und zwang Bauern bis 1960 den LPGs (Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften) beizutreten und sich durch die Kollektivierung der Landwirtschaft zu landwirtschaftlichen Spezialisten zu entwickeln.
Während in Westdeutschland die europäische Wirtschaftsgemeinschaft wirtschaftliche Entwicklung nach sich zog, wurde dies in der DDR durch die Einbeziehung in den Rat für Wirtschaftshilfe (RGW), in dem weniger industrialisierte Länder vertreten waren, verhindert.
Man begann im Rahmen der Planwirtschaft mit dem Ausbau der Schwerindustrie und erhöhte damit das Prestige des Industriearbeiters.
Wegen fehlender finanzieller Mittel konnte die Sanierung alter Häuser/Wohnungen und der Bau neuer Wohnhäuser nicht in vollem Umfang finanziert werden, was dazu führte, dass viele Menschen in ihren Altbauten weder Warmwasser, noch ein Bad oder eine eigene Toilette besaßen.
S. 54
Nichts kam ihr bekannt vor. Nichts hatte mir der Metropole zu tun, die sie Ende der dreißiger Jahre verlassen hatte. Geschäfte mit armseligen, handgemalten Schildern. Leere Straßen. Kaum ein Auto, wenige Passante…
S. 76
Es dämmerte schon. Bald kam der Mann, der die Gaslaternen anzündet…
Auch das Gesundheitssystem verschlechterte sich in seiner Leistung durch die großen wirtschaftlichen Probleme der DDR: Die Versorgung mit Medikamenten und mit Personal funktionierte nicht und je nach Macht, Privilegien und Produktivität, gab es mehr oder weniger eine Gesundheitsrationierung und eine unterschiedliche Behandlung für verschiedene Gruppen.194 Spezialkliniken hatten Vorrang und Gelder für wenig produktive Mitglieder wie Behinderte, Alte und Heimkinder fehlten. Oft waren es kirchliche Einrichtungen, die Sterbende nicht nur oberflächlich die elementarste Pflege, sondern auch Fürsorge und aktive humanitäre Zuwendung gaben.
Für alte Menschen waren nur wenige Pflegeplätze vorhanden waren, sie wohnten bei ihren Kindern, was wegen der Größe und Ausstattung von deren Wohnung oftmals zum Problem wurde:
S. 78
Sie wohnten im Steinweg. Unten wohnten Omi und Wilhelm. Oben wohnten sie. Mama und Papa und e…
Ende der 50er Jahre waren die Grundbedürfnisse der DDR-Bürger im Großen und Ganzen erfüllt, die DDR-Bürger erlebten einen kleinen Aufstieg und eine Modernisierung des Alltagslebens.
Kurt beginnt eine in der DDR erfolgreiche Karriere als Historiker.
Das Konsumverhalten wandte sich in dieser Zeit ungesunden „Luxusartikeln“ zu: Alkohol, insbesondere die proletarischen Getränke Bier und Schnaps wurden ein Teil der ostdeutschen Geselligkeit und eine gesellschaftlich akzeptierte Droge bei Familienmahlzeiten - ,,Saufen’ und Alkoholmissbrauch gehörten zum Lebensstil, waren eine ständige Begleitung und nicht nur auf Anlässe beschränkt oder zur Entspannung gedacht.
Es war anormal, abstinent zu sein, und so formten regelmäßige Trinkgewohnheiten den Menschen. Dabei steigerte sich bei vielen Erwachsenen das Niveau des Konsums. Sie verbrauchten hochprozentige Spirituosen, und nicht selten entwickelte sich der übermäßige Alkoholkonsum zum Alkoholismus und damit zu einem Problem. Das Thema „Alkoholabhängigkeit“ war ein Tabu und statt nach sozialen Ursachen zu forschen, sah man es als individuelle Geisteskrankheit und psychisches Problem. Das Buch schildert dies beeindruckend in Irinas steigender Abhängigkeit:
S. 155 (Geburtstagsfeier)
Er griff zur Schnapsflasche, um ihr noch einmal einen einzugießen…
S. 267 (Weihnachtsfeier)
So, jetzt brauche ich einen Kogna…
S.364
Sie (Irina) trank Whisky - das Zeug drehte ganz schön! - und rauchte noch eine Zigarett…
Ein normales Leben zu führen, war für sie nicht mehr möglich, als eine gewisse Schwelle überschritten war.
Ebenso war das Rauchen in der DDR ein akzeptierter Lebensstil und gehörte in allen Schichten zum normalen Bestandteil des Alltags. Nachdem in den 50er Jahren Zigarettenautomaten aufgestellt wurden, gab es Anfang der 60er Jahre unter den Männern 70% und unter den Frauen 20% Gewohnheitsraucher.
Die Folge war in diesem Zusammenhang das vermehrte Auftreten von Lungenkrebs. 195
S. 65
Ich muss erst eine rauchen, beharrte Irin…
S. 262
Na, komm schon, wir rauchen eine zusammen. Er nahm eine ,Club‘ aus ihrer Schachtel, Irina hielt ihm das Feuerzeug hi…
7.3.2 Die 60er Jahre und ihre Präsenz im Buch
Die 60er Jahre waren eine Zeit des Aufbruchs und des Neubeginns in der DDR: Einerseits verstärkte sich die Abwanderung, andererseits richteten sich die Menschen, die nicht abwanderten, darauf ein, zu bleiben, so dass sich eine sozialistische Gesellschaftsordnung verfestigen konnte.
Die einzelnen Figuren des Romans sind ,angekommen’, Saschas Eltern waren mit der Realität im real existierenden Sozialismus einverstanden.
S. 130f
Alexander wartete am Auto, Irina ebenfalls. Das Auto war blau, winzig klein: ein Trabant. Man bestaunte es zunächst von allen Seiten ..Irina hielt am Fuchsbau. Das Haus war von Baugerüsten umstell…
S. 133
Kurt hatte promoviert, hatte sein erstes Buch geschrieben, ein großartiges Buch…
Der Lebensstandard zwischen der Bevölkerung in der DDR und der Bundesrepublik klaffte jedoch immer weiter auseinander. Die Industrieproduktion der DDR ging zurück, und es kam durch die Bildung der Produktionsgenossenschaften zu Engpässen in der Versorgung. Volksgenossenschaftliches Arbeiten hatte Desorganisation und mangelnde Arbeitsmoral zur Folge.196
S. 176
… zu den erfreulichen Seiten des notorischen Mangels in der DDR gehörte, dass es auch an Büroräumen mangelte…
In Berlin konnten sich die im Westteil Arbeitenden aufgrund des neuen Wechselkurses von 1:4 zwischen DM und DDR-Mark einen anderen Lebensstandard leisten als die Restbevölkerung, andererseits fuhren Westberliner zum preiswerten Einkauf von Nahrungsmitteln in den Osten, was die Versorgungslage noch mehr verschlechterte. Die DDR Bürger nahmen es auch mit Humor und zeigten in den DDR-Witzen die Grenzen der SED-Herrschaft und ihre Entbehrungen, die zu keinerlei materiellen Wohlsand führten.
S. 299
- Kenn’ Se den, flüsterte der andere Mann - offenbar von so viel Zustimmung ermuntert: Wat sin’ die vier Hauptfeinde des Sozialismus? Das Paar wechselte Blicke.
- Frühja, Somma, Herbst und Winta, sagte der Mann und kicherte in sich hinei…
Das Kapitel 6 fängt die politische Stimmung in der DDR 1961 kurz vor dem Mauerbau und zur Zeit der Kubakrise ein.
Wilhelm fordert eine Abriegelung der Grenze zur BRD, Charlotte erinnert an die Flucht des Hausmeisters.
S. 128
- Ein Affentheater mit Westberlin. Dann muss man die Staatsgrenze eben abriegeln.
- Der Hausmeister ist auch weg..
- Der Wollmann?
- Genau, der Wollmann, sagte Charlotte.
- Zum Teufel mit Wollmann, sagte Wilhelm. Aber die jungen Leute! Verstehst du: Studieren auf unsere Kosten und dann hauen sie ab. Da muss man den Riegel vorschiebe…
In Wirklichkeit erfolgte die Schließung der Grenze in Berlin und der Mauerbau wegen der großen Zahl derer, die aus wirtschaftlichen und politischen Gründen das Land verließen, und in Übereinstimmung mit den Warschauer Pakt-Staaten. Der „antifaschistische Schutzwall“ sicherte und stabilisierte Ulbrichts Machtstellung und machte die DDR zu einer geschlossenen Gesellschaft und zu einer Zwangsanstalt, in der die Mentalität der Bürger nun von dem Bewusstsein geprägt wurde, wie in einem Käfig zu leben. „Die Mauer wurde zur Voraussetzung eines gigantischen Sozialexperiments am lebenden Objekt. Die DDR wurde zum Laborversuch für eine neue Gesellschaft samt neuen Menschen, für die lichte Zukunft des Kommunismus.“197 Unzählige Kontrolleure und Polizisten sicherten neben Zäunen, Stacheldraht und Stahltoren die Staatsgrenze.
Das Ereignis des Mauerbaus selber hat im Roman keine Auswirkungen auf die Lebensrealität und wird im häuslichen Umfeld der Umnitzers akzeptiert.
Lediglich das Thema„Schießbefehl“ an der Berliner Mauer findet Erwähnung, als Alexander zur Armee eingezogen wird:
S. 212
… während jetzt irgendein Unterfeldwebel mit der Dienstvorschrift in der Hand erläuterte, welche Position vom Schützen beim Liegendschießen einzunehmen sei, nämlich in sich gerade, schräg zum Ziel, nichts davon würde er je sehen, nichts davon würde er miterleben, weil zwischen hier und dort,.. zwischen der kleinen, engen Welt, in der er sein Leben würde verbringen müssen, und der anderen, der großen, weiten Welt, in der das große, das wahre Leben stattfand - weil zwischen diesen Welten eine Grenze verlief, die er, Alexander Umnitzer, demnächst auch noch bewachen sollt…
Charlotte ist Sektionsleiterin und arbeitet erfolgreich und mit großem Engagement an der Akademie. Ihre Karriere bleibt jedoch wegen ihrer mangelnden akademischen Qualifizierung begrenzt.
S. 116
- Als Frau, hatte Gertrud Stiller heute beim Mittagessen gesagt, musst du doppelt so viel leisten, um dich durchzusetze…
S. 122f
Sie war berufstätig, sie arbeitete wie ein Pferd, sie bekleidete einen wichtigen Posten an jener Akademie, an der die künftigen Diplomaten der DDR ausgebildet wurden..Sie war Sektionsleiterin an einer Akademie - und was war Wilhel…
Wilhelm, der als Verwaltungsdirektor gescheitert war, betätigt sich ehrenamtlich als Wohnbezirks -Parteisekretär, engagiert sich in der Parteiarbeit, wobei er durch sein öffentlichkeitswirksames Handeln zunehmend Anerkennung erfährt.
S. 122
Ein Nichts.sie selbst hatte ihn ermutigt, den Posten des Wohnbezirksparteisekretärs zu übernehmen, sie hatte ihm eingeredet, dass dies eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe sei - das Problem war nur, dass Wilhelm dies inzwischen selbst glaubte. Und, was noch schlimmer war: Die anderen glaubten es offenbar auc…
Um sich gegenüber einem Rivalen im Institut zu profilieren, verfasst Charlotte für das Neue Deutschland eine Rezension zum Exilroman „Mexikanische Nacht“ eines BRD- Autors, die mit dem Verdikt endet, das Buch sei „defätistisch“ und „gehör[e] nicht in die Regale der Buchläden unserer Republik“.
S. 127
Es ging um das Buch eines westdeutschen Schriftstellers, das jüngst in einem DDR-Verlag erschienen war. Es war ein schlechtes, ein ärgerliches Buch...Nein, dieses Buch, las Charlotte und fand sich mit jedem Wort, jeder Silbe im Recht, dieses Buch eignet sich nicht, um die Jugend zu einer weltzugewandten, humanistischen Haltung zu erziehen. Es eignet sich nicht, um die Menschen gegen das drohende atomare Inferno zu mobilisieren. Es eignet sich nicht, um den Glauben an den Fortschritt der Menschheit und an den Sieg des Sozialismus zu fördern, und deswegen gehört es nicht in die Regale der Buchläden unserer Republi…
Charlottes Rezension zeigt politische Differenzen zu Kurt, der ihr ein naives Verständnis der aktuellen politischen Lage in der Zeit kurz vor dem Mauerbau und der Kubakrise vorhält und ihr vorwirft, sich für einen härteren politischen Kurs und eine Rückkehr zum Stalinismus instrumentalisieren zu lassen. Kurt gerät als Befürworter eines demokratischen Sozialismus mehrmals mit den Erwartungen des Regimes in Konflikt. Im Gegensatz zu seinem Stiefvater Wilhelm befürchtet er die Rückkehr des Stalinismus in die DDR:
S. 136
- Nein, sagte Kurt. Es geht hier um Richtungskämpfe. Es geht hier um Reform oder Stillstand. Demokratisierung oder Rückkehr zum Stalinismus…
Bei einer Reise 1966 zu einem Treffen mit Wissenschaftlern in Moskau traut sich Kurt, inzwischen einer der führenden Historiker der DDR, nicht, diese nach der Einschätzung der politischen Lage zu fragen.
S. 163
Und dass er einsam gewesen war zwischen all den wohlgesinnten Menschen, von denen er keinen so gut kannte, dass er es gewagt hätte, die Fragen, die ihn beunruhigten, auch nur anzutippen - zum Beispiel die Frage, inwieweit, nach Ansicht seiner Kollegen, eine Re- Stalinisierung der Sowjetunion drohte, nachdem der tölpelhafte, aber doch irgendwie sympathische Reformer Nikita Chruschtschow (ohne den er, Kurt, noch immer als „ewig Verdammter“ hinterm Ural säße) als Parteichef abgelöst worden wa…
Nach der Rückkehr von einer Dienstreise nach Moskau wird Kurt von einem Parteisekretär über den „Verrat“ eines Kollegen aus seiner Forschungsgruppe informiert, der die Einheitsfrontpolitik der KPD während der Weimarer Republik in einem Schreiben an einen BRD-Historiker kritisch betrachtete und das darüber verhängte Denkverbot in der DDR kritisierte.
S. 171
(welche, wie jedem klar war, die die Sozialdemokratie verunglimpft und das Erstarken des Faschismus auf schlimmste Weise gefördert hatte…
S.. 171
Die Angelegenheit war ebenso einfach wie dumm. Paul Rohde, ein immer schon etwas übermütiger und nicht immer disziplinierter Mitarbeiter aus Kurts Arbeitsgruppe, hatte in der ZfG das Buch eines westdeutschen Kollegen besprochen, in dem die sogenannte Einheitsfrontpolitik der KPD Ende der zwanziger Jahre kritisch beleuchtet wurde.., und dann hatte Rohde dem westdeutschen Kollegen persönlich seine Rezension geschickt, versehen mit der Bemerkung, er möge entschuldigen, dass sie so negativ sei, die gesamte Arbeitsgruppe finde das Buch klug und interessant, aber in der DDR sei es leider noch längst nicht so weit, dass das Thema Einheitsfrontpolitik offen diskutiert werden könn…
Die Geschichtsverfälschung des SED-Regimes zeigt sich in dem folgenden Prozess um den Parteiausschluss des Historikers Rohde.
S. 171
Mit wachsendem Unbehagen hörte er sich an, wie Günther vom Fortgang der Sache berichtete, welcher, kurz gesagt, darin bestand, dass die Abteilung Wissenschaft des Zentralkomitees der SED eine harte Bestrafung des Genossen Rhode forderte, welche Morgen, am Montag, auf der Parteiversammlung beschlossen werden sollt…
Auf einer Institutsversammlung von ZK-Mitgliedern folgt die Verurteilung und die Enthebung aus seinen Ämtern. Kurt nimmt am Partei-Gericht über Rohde teil, ohne sich zu exponieren.
S. 178
… während er von den revisionistischen und opportunistischen Kräften sprach, innerhalb denen, so der Genosse Ernst, der Hauptfeind zu suchen sei, und bei dem Wort Hauptfeind senkte sich seine Stimme, und Kurt entdeckte Paul Rohde, ., grau, geschrumpft, den Blick ins Leere gerichtet, erledigt, dachte Kurt. Paul Rohde war erledigt, Parteiausschluss, fristlose Entlassung, plötzlich war es ihm klar..Hier ging es längst nicht mehr um Paul Rohde Hier geschah, was Kurt seit langem, genauer gesagt, seit der Ablösung Chruschtschows … befürchtet hatte...das letzte Plenum, auf dem man kritische Schriftsteller niedergemacht hatt…
Bei diesem Anlass erinnert sich Kurt an seine Verhaftung 1941 in Moskau und an seinen damaligen Vernehmer, dessen „Schweinsgesicht“ (S. 181) dem des ZK-Genossen, der die Anklagerede gegen Rohde hielt, verdächtig ähnelte.
Kurt tröstet sich mit der Erkenntnis, es sei schon ein Fortschritt, wenn Kritiker nicht mehr erschossen, sondern nur noch aus der Partei ausgeschlossen werden:
S. 184
Und war es nicht auch ein Fortschritt,, wenn man die Leute - anstatt sie zu erschießen - aus der Partei ausschloss? Was erwartete er? Hatte er vergessen, wie mühsam die Geschichte sich vorwärtsbewegt…
Dementsprechend erscheint Kurt auch die Festrede eines Parteifunktionärs zu Wilhelms 90. Geburtstag als ein Sammelsurium an Lügen, zu denen er aber dennoch Beifall klatscht (S. 341). An diesen Stellen verdeutlicht der Roman, wie sehr die fehlende Offenheit in der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit zu den Geburtsfehlern der DDR gehörte und dazu beitrug, dass das sozialistische Experiment misslingen musste. Und es zeigt sich, dass, wer zur Opposition gehörte, als mangelnde ideologisch gereifte Persönlichkeit angesehen wurde und als vom westlichen Feind beeinflusst. Und so wie Eltern erzieherische Maßnahmen bei einem Kind ergriffen, vollzog der Staat erzieherische Maßnahmen am Erwachsenen.
Im Laufe der 60er Jahren begann ein im Vergleich mit dem Westen bescheidenes Wirtschaftswachstum. Lohnsteigerungen, eine vermehrte Freizeit mit dem Ausbau der
Gastronomie und Konsummöglichkeiten durch Nachahmung westlicher Produkte brachten Signale der Hoffnung. Mit der Ausbreitung des Wohlstands stiegen aber gleichzeitig auch die Ansprüche und die Erwartungen der Bürger.
Waren in den 50er Jahren Bauern und Schwerindustrie die Symbole des DDR Zeitgeistes, kamen in den 60er Jahren Wissenschaft und Chemie hinzu, die es ermöglichen sollten, die Bundesrepublik auf wissenschaftlich-technischem Gebiet einzuholen.
Wichtig für den Bürger war das Arrangement mit der Mangelwirtschaft und damit der Erwerb bzw. die Jagd nach knappen Artikeln. Durch Beziehungen und Freundschaften war der Alltag gut zu bewältigen. Man fühlte sich nicht unfrei, Gesetze und Verhaltensnormen waren klar definiert und bei Anpassung war es ein friedliches und ruhiges Leben. „Aus der Unfreiheit resultierte tatsächlich eine Art von Geborgenheit“.198 Die DDR bot ein idyllisches Bild. Die Bürger hatten sich in ihrem Land ihrem Vernehmen nach gut eingerichtet, ohne Kritik oder Widerspruch zu äußern.
Die Frauen im Roman sind ein Beweis dafür. Irina hat einen ausgeprägten Pragmatismus: Sie ist stolz auf die eigene Arbeit und auf die Fähigkeit, Güter und Dienstleistungen zu organisieren und Strategien zu entwickeln. Sie hat gute Kontakte - und die waren in der Mangelgesellschaft der DDR von großem Nutzen. In diesem Bereich blühte die Eigeninitiative, Kreativität im Improvisieren war gefragt. Beziehungen und ein Netzwerk von Menschen, die in Schlüsselpositionen saßen, wie Klempner, Maurer, Elektriker musste man haben, und es entwickelte sich im informellen Bereich ein Tauschmarkt, der die Versorgungslage im privaten Bereich verbesserte und Versorgungsengpässe mit sonst zu knappen Gütern umging.
S. 168
Betrachtete, während er die zunehmende Hitze am Hintern spürte (ja, auch die Gasheizung war eine gute Idee gewesen!), die schwedische Importbücherwand, die Irina ihm vermittels irgendwelcher undurchsichtiger (hoffentlich nicht krimineller) Transaktionen beschafft hatt…
Nadjeshda besitzt eine ganz besonders ausgeprägte Ausdauer, z.B. in ihrer Kindheit, beim Betteln:
S. 144
… als Kind hatte sie immer Ausschau gehalten nach solchen Schuhen, wenn sie in irgendein Dorf kamen und sie vor der Kirche saß, gehasst hatte sie das, die beiden Großen durften sich Arbeit suchen im Dorf, und sie, die Kleinste, musst die Hand aufhalten, den ganzen Tag lang, Kopf runter, Hand hoc…
…in ihrem steten Gesang an Wilhelms Geburtstag:
S. 288
… während Baba Nadja ernst und stur eine Strophe nach der anderen ableierte, bis schließlich alle, am lautesten der Dicke mit dem Pavianarschgesicht, mitbrüllten…
Charlotte kämpft um berufliche Anerkennung in der DDR:
S. 115
Wie immer am Freitag war sie die Letzte. Sie war seit fünf Uhr morgens auf den Beinen. Vor der ersten Briefkastenleerung hatte sie noch einmal, ein letztes mal, den Artikel durchgesehen, den der Genosse Hager bei ihr bestellt hatte. Am Vormittag zwei Stunden Spanisch. Nach dem Mittag das Realismus-Seminar: Fortschrittliche Literatur Nordamerikas….Autodidakt. Das Wort kam ihr in den Sinn, jetzt um Viertel nach vier, während sie den Schreibtisch aufräumt…
Die Menschen der DDR dachten an ihr berufliches Fortkommen und daran, die Entwicklung und Laufbahn ihrer Kinder zu fördern. „Alte deutsche Tugenden schienen hier ihren Wert behalten zu haben: Ruhe, Ordnung, Sicherheit, Sauberkeit und Pflichterfüllung.“199
S. 147
Ein guter Mann, Kurt, immer höflich, immer mit Vor- und Vatersnamen. Professor war er, fuhr nach Berlin jeden Montag, mit einer Aktentasche, machte da irgendwas, sie wusste nicht genau, aber von Staats wegen irgendwas, und Geld verdiente…
S. 173f
Gewiss bestand keine akute Gefahr, dass Sascha „Gammler“ wurde. Aber seine lasche Haltung, seine Faulheit, sein Desinteresse für alles, was er, Kurt für wichtig und nützlich hielt. Wie konnte man dem Jungen nur begreiflich machen, worauf es ankam. Der Junge war intelligent, keine Frage, aber irgendwas fehlte ihm, dachte Kur…
Auf die linke Studentenbewegung im Westen reagierte die DDR Bevölkerung mit aggressiver Aversion, so wie der Großteil der westlichen Bevölkerung.
S. 174
- Aber wenn deine Begeisterung für diese Beatmusik dazu führt, dass du Gammler werden willst, dann muss ich dir sagen, dass deine Lehrer recht haben, wenn sie so was verbieten. trägst du das Ding etwa auch in der Schule?…
- Ich frage dich: trägst du das Kreuz auch in der Schul…
- Ja, sagte Sascha. Kurt merkte, wie der Ärger in ihm aufstie…
- Bist du denn wirklich so dämlic…
S. 176
… weil ein hundertprozentiger linientreuer Direktor.den Einfluss einer westlich-dekadenten Jugendkultur wittert…
S. 212
… niemals würde er Paris oder Rom oder Mexiko sehen, niemals Woodstock, noch nicht einmal Westberlin mit seinen Nacktdemos und seine Studentenrevolten, seiner freien Liebe und seiner Außerparlamentarischen Oppositio…
In der Tschecheslowakei wurde in den 60er Jahren der Gedanke eines „Dritten Weges“ als Modell des Sozialismus mit menschlichem Antlitz durch die Wahl von Alexander Dubcek zur Realität. Die DDR Bürger reisten als Touristen in dieses Bruderland, um die freie Kultur mit ihren Westwaren zu erleben. Der Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes erfolgte am 21. August 1968 und machte ein Ende mit dem „Prager Frühling“.200
7.3.3 Die 70er Jahre und ihre Präsenz im Buch
In den 70er Jahren entstand im Zuge einer Ostpolitik der westdeutschen sozialdemokratischen Führung eine Akzeptanz der DDR als Staat, und auch Ulbricht setzte sich von der Seite der DDR für eine friedliche Koexistenz und eine Annäherung an die BRD ein. Dies war im Sinne der Sowjetunion, denn so konnte sich der Graben zwischen den beiden Staaten vertiefen und die Position der DDR festigen.
Als Ulbricht 1971 aus alters- und gesundheitsbedingten Gründen abgesetzt wurde, begann die Zeit Honeckers, ebenfalls ein von der Sowjetunion gestützter Apparatschik. Er gewann als SED-Vorsitzender eine enorme Macht und Bedeutung.
Zentrale Gestalt aller mächtigen Männer war Stasi-Chef Erick Mielke, mitentscheidend von 1957 bis 1989 als Minister für Staatssicherheit und die Sicherheitspolitik, zuständig für Überwachung und Unterbindung politischer Oppositionsbewegungen.
S. 223
… während er dem Tischgespräch lauschte, das zwischen verschiedenen Themen mäanderte, .. und ..auf die Erdölkrise im Westen kam (wo, Gott sei Dank, auch nicht alles klappte) und schließlich .. zu irgendeinem politischen Handbuch, über das Christina und Kurt sich einvernehmlich amüsierten, weil der Name von Honeckers Vorgänger in der Neuauflage vollständig eliminiert worden war, nachdem er ursprünglich auf beinahe jeder Seite gestanden hatt…
Auf gegenseitige Bespitzelung seitens der DDR-Bürger wird im Roman mehrmals angespielt:
S. 94
- Und gewählt haben die auch wieder nicht, die Schliepners. Aber die kriegen wir auch noch dran, sagt Wilhel…
S. 276
- So einfach ist das nicht, Muddel sprach leise, als hätte sie die Omi vorn im Bus unter StasiVerdacht: Da brauchst du ein Visum für Ungarn, aber das kriegst du nicht mehr…
Der Machtwechsel zu Honecker war mit Liberalisierungstendenzen verbunden. Es zeigte sich eine gewisse Offenheit in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft, wodurch man schon fast an eine Aufweichung des strikten vorgegebenen Kurses glauben konnte.201 Honecker korrigierte die Wirtschaftspolitik Ulbrichts zum Konsumsozialismus: Das materielle und kulturelle Lebensniveau sollte angehoben werden, um Arbeitsniederlegungen und wirtschaftliche und politische Unzufriedenheit in der Bevölkerung zu verhindern, ein höherer Lebensstandard hatte die Bürger zufrieden zu stellen und die Lebensbedingungen der Arbeiterklasse zu verbessern. In der Warenproduktion selber zählte in der Folgezeit der Umfang, die Menge - Farbe, Design und die ästhetische Qualität waren für die Verantwortlichen irrelevant.
S. 213
Kurt schrieb wieder an seinem Buch über Lenis Exil in der Schweiz, hoffte, nach dem Amtsantritt Honeckers, nun doch auf Veröffentlichun…
Der Umlauf der D-Mark als Zweitwährung war nun nicht mehr direkt verboten und all die staatseigenen HO-Läden und Intershops existierten von jetzt an für den einfachen Bürger. Jedem fiel aber eine „Versorgungshierarchie“ auf: Städte wie Ost-Berlin und Leipzig wurden bevorzugt und boten Westwaren an, kleine Städte dagegen hatten nur ein trostloses Sortiment - Pendlerfahrten wurden üblich.
Die Zwischenbilanz von Honecker in den 70er Jahren sah nach all den Maßnahmen gut aus: Der Lebensstandard der DDR war der höchste im Ostblock und nach dem VIII. und IX. Parteitag 1976 erfolgte die Anhebung der Mindestlöhne, die Einführung der Mindestrenten, die Erhöhung der Urlaubstage. Es gab von nun an Vergünstigungen für berufstätige Mütter und zinsgünstige Kredite für junge Paare und als soziale Zugeständnisse u.a. die schrittweise Einführung der 40-Stunden-Woche.202
Ein weiterer Wohlstandsschub bahnte sich an. International bedeutsam war in den 70er Jahren der sog. „Grundlagenvertrag“ zwischen der Regierung Brandts und der DDR, er regelte die Beziehungen zwischen den beiden Ländern: Die Bundesrepublik verzichtete auf ihren Alleinvertretungsanspruch und erklärte sich einverstanden, dass keiner der beiden Staaten den anderen international vertreten könne. Damit war der Weg in die UNO und andere internationale Organisationen für die DDR zwar offen, doch die Einrichtung von „Ständigen Vertretungen“ (und nicht von „Botschaften“) zeigte, dass die DDR von Westdeutschland immer noch nicht als Ausland betrachtet wurde. 203 „Die Anerkennung des Status quo führte zu dessen Überwindung. Im Grunde begann damals ein langfristiger Prozess der Destabilisierung durch Stabilisierung.“204
S. 225
… wie auch das knallkurze Acrylkleid, das sie unter dem nun absichtlich geöffneten Mantel trug, von ihrer im Westen lebenden Schwester stammte (beides unmittelbare Konsequenzen des Grundlagenvertrags zwischen der DDR und der BRD…
Die DDR änderte ihren Artikel 1 der Verfassung in der Hinsicht, dass sie nun nicht mehr ein „sozialistischer Staat deutscher Nation“, sondern von nun an ein „sozialistischer Staat der Arbeiter und Bauern“ war. Für die Bevölkerung änderte sich damit nichts, aber man signalisierte damit der Bundesrepublik, dass man von nun an eigene Wege gehen wolle.
Die 70er Jahre im Buch stellen sich 1973 im Wehrdienst von Alexander an der Grenze zur BRD dar. Er leistet seinen Wehrdienst widerwillig, empfindet sein Leben als unfrei, sein Wunsch nach persönlicher Freiheit durch die Möglichkeit, Rock- Konzerte im Westen zu erleben, scheint unerfüllbar. Nur ungern trägt er bei einem Besuch Wilhelms im Krankenhaus die Uniform.
S. 209
Ein Kopf erschien. Der Kopf trug eine Uniformmütze. Der Kopf begann zu schreien.Im Übrigen war nicht zu verstehen, was der Kopf schrie: Seltsame Sprache, die fast nur aus Vokalen zu bestehen schie…
S. 211
Alexander sah auf den Nacken des Vordermanns, auf seine Ohren, welche genauso aussahen, wie seine eigenen Ohren sich anfühlten, nämlich knallrot - und musste auf einmal an Mick Jagger denken; fragte sich, was wohl jetzt, während er hier stand. ein Mensch wie Mick Jagger ta…
S. 212
… niemals würde er die Rolling Stones live erleben, niemals würde er Paris oder Rom oder Mexiko sehen, niemals Woodstoc…
Explizite zeitgeschichtliche Bezüge finden sich in diesem Kapitel zur Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann 1976 und zu Christa Wolfs Roman „Kindheitsmuster“. Kurt und Sascha diskutieren zu Weihnachten miteinander darüber: S. 253
… immer hatten sie sich etwas zu sagen, immer redeten sie sofort und laut aufeinander ein, hatten drängende Neuigkeiten auszutauschen, in diesem Fall, wie auch anders, über das BiermannKonzert in Köl…
S. 254
Es war gerade von Christa Wolf die Rede, großartiges Buch, warf Irina ein, obwohl sie das Buch gar nicht zu Ende gelesen hatte, aber sie hatte so viele Diskussionen darüber gehört, dass sie schon zu vergessen begann, wie sehr sie der umständliche Stil zermürbt hatt…
Seit Bestehen der DDR stellte die Subventionspolitik Milliarden bereit für die Beibehaltung von Wohnungen, deren niedrige Mieten nie erhöht wurden, für niedrige Preise von Grundnahrungsmitteln, so dass die Lebenshaltungskosten stabil blieben, für Verkehrstarife/Verkehrswesen und sowohl im kulturellen und sportlichen Bereich als auch im Gesundheitswesen. Bis in die 70er Jahre war diese Subventionspolitik erfolgreich, doch sicherten die Mieten nicht die Kosten für Instandsetzung und Modernisierung. Abgaben (Mehrwertsteuer) auf hochwertige Industriewaren und „Delikat- und Exquisitwaren“ mussten erhoben werden, um die wachsenden Subventionen finanzieren zu können.205 Mahnende Stimmen sahen, dass die Finanzierung des Sozial- und Konsumprogramms nicht aus eigener Wirtschaftskraft geschah und registrierten eine steigende Verschuldung. Es wurde mehr verbraucht als produziert, so dass letztendlich der ökonomische Kollaps nur mit Hilfe von Krediten aus der Bundesrepublik verhindert werden konnte.206 Um die Zinsen für die Kredite aufzubringen, verringerte die DDR den Import von Waren und erhöhte den Export.
Als Gegenleistung für die Kredite aus Westdeutschland entfernte die DDR Selbstschussanlagen und Minen an der innerdeutschen Grenze, bewilligte eher als sonst Westreisen von DDR-Bürgern und lockerte Besuchsmöglichkeiten bei „dringenden Familienangelegenheiten“. Die Folge war eine Flut von Ausreiseanträgen.
Zur gleichen Zeit bewirkte der Einfluss des Westfernsehens eine Teilnahme an Kultur-und Freizeittrends des Westens und Ost-Jugendliche entwickelten Konsumwünsche nach westlichen Maßstäben - die die DDR aber nicht erfüllen konnte.
S. 164
Stattdessen nahm er jetzt mit dem Tonbandgerät neumodische Musik im RIAS au…
S. 140
… Amerika, sie kannte es ja aus dem Fernsehen, das andere Programm, zweimal schalten, sie guckte, ehrlich gesagt, meisten das andere Programm, Breschnew hatte sie genug geguckt, war irgendwie doch interessanter, Amerika, auch wenn man sich manchmal nicht hinzuschauen getraute, was die alles zeigte…
Bis Mitte der 70er Jahre gab es zwar für die DDR keine existenzbedrohende Krise, jedoch die Entbehrungen im Vergleich zu Westdeutschland zeigten jedem, wie gering die eigene Wirtschaftskraft war. Eine Szene im Buch spiegelt dies wieder:
Im Januar 1979 (14. Kapitel) sucht Kurt Alexander auf, der sich illegal in einer leerstehenden und völlig heruntergekommenen Wohnung im Prenzlauer Berg einquartiert hat, nachdem er Melitta und seinen kleinen Sohn Markus verlassen und sein Geschichtsstudium abgebrochen hat. Der Gang auf den zugeschneiten Bürgersteigen durch das baufällige Stadtviertel auf der vergeblichen Suche nach einem geöffneten Restaurant und das ständig vom Verkehrslärm unterbrochene Gespräch spiegeln sowohl die gestörte Kommunikation zwischen Vater und Sohn als auch das Scheitern des sozialistischen Aufbaus wider. Letzteres kommentiert ein in der Schlange stehender Gaststättenbesucher mit folgendem Witz: „Wat sin‘ die vier Hauptfeinde des Sozialismus? […] Frühjah, Somma, Herbst und Winta“.
S. 290
Die hohen Mietshäuser links und rechts sahen erbärmlich aus. Die Stuckfassaden waren vom Rauch er Kohleöfen geschwärzt, wo nicht nacktes Mauerwerk bleckte. Die Balkone sahen aus, als könnten sie einem jeden Moment auf den Kopf falle…
S. 292
Inzwischen war es dunkel geworden. Nur die Hälfte der alten, von vor dem Krieg stammenden Laternen funktionierte…
S. 293
An der Ecke Gleimstraße war die Gaststätte Vineta. An der Tür hing ein handgemaltes Schild: „Wegen technischer Probleme geschlossen…
Die DDR-Bürger erlebten hautnah das Fehlen von Waren- und Dienstleistungsangeboten und wie wenig das Angebot die Nachfrage deckte und in wie geringem Maße sich individuelle Konsum- und Lebensstile entwickeln konnten. Auch wenn die Realeinkommen und Haushaltsnettoeinkommen stiegen, war es nicht möglich, die Kaufkraft in Konsum umzusetzen. Dies verringerte die Lebensqualität und frustrierte die Menschen. „Die gesellschaftliche und individuelle Bedeutung des Konsums sind […] in gerade grotesker Weise verkannt worden.“207
Als sich im Zuge der Liberalisierung der visafreie Reiseverkehr zwischen der DDR und Polen bzw. CSSR entwickelte, lernten die Menschen der DDR dort zum ersten Mal ein freiheitlicheres Lebensgefühl kennen. Im eigenen Land aber entwickelten sich die Bürger zu „Jägern und Sammlern“. Auf einem informellen Konsummarkt tauschte man knappe Waren, Tätigkeiten und Beziehungen, kaufte auf Vorrat und plante lange im Voraus wegen des allzu knappen planwirtschaftlichen Angebots: Man erwarb durch persönliche Anstrengungen notwendige Güter, kaufte ein, was es gab, nicht das, was man brauchte, erwarb vorrätige Ware für irgendwann in der Zukunft - und so blieb es bis zum Ende der DDR. Genuss und Entspannung gab es selten, das Zeitbudget der meisten Frauen wurde durch Organisation und Wartezeiten belastet.
Die Mangelwirtschaft der DDR wird in Eugen Ruges Roman an mehreren Stellen und aus verschiedenen Figurenperspektiven dargestellt und zeigt sich vor allem im Bereich des Wohnens und Essens. Da viele Produkte schwer oder überhaupt nicht verfügbar waren, fehlte es oft an Zutaten, um etwas einfallsreichere Gerichte zu kochen. Die begehrten Lebensmittel konnten nur durch persönliche Kontakte und einen manchmal extrem aufwändigen Tauschhandel erworben werden. Dies wird im 12. Kapitel durch Irina verdeutlicht:
S. 244
Der größte Teil des Sobakin’schen Kaviars jedoch ging als Schmier- und Zahlungsmittel in den undurchsichtigen Kreislauf der unter Ladentischen und in Hinterzimmern gehandelten Waren ei…
Am Weihnachtstag des Jahres 1976 (12. Kapitel) trifft Alexander mit seiner neuen Freundin Melitta bei seinen Eltern ein. Mutter Irina bereitet ihre französische Klostergans zu, deren Zutaten sie sich jedes Jahr durch einen umfangreichen Tauschhandel organisieren muss.
S. 245
… und zwei[Aale bekam, I.MB]schließlich eine ehemalige Kollegin, aus deren väterlichen Kleingarten jene getrockneten Aprikosen stammten, außerdem Quitten und dickschalige Winterbirnen, die Irina schälte und würfelte und zusammen mit den schon eingeweichten Aprikosen sowie halbierten Feigen aus dem Russenmagazin, Rosinen (die sie anstelle von Weintrauben benutzte), Esskastanien.in eine Pfanne ga…
Geduld, Geschicklichkeit, Taktieren und Insiderwissen waren erforderlich, um an Waren und Material zu kommen. Dies zeigt Irina beim Hausbau.
S. 244
In der Galerie am Stern erstand Irina gegen Zuzahlung von Kaviar mehrere Stücke der begehrten Waldenburg-Keramik, Ofenbrand mit bräunlichen Flugascheresten, die sie wiederum als Schmiermittel beim Erwerb von Dachfenstern verwendete; einen Teil der Dachfenster, die sie selbst nicht benötigte, brachte sie mit dem PKW-Anhänger nach Finsterwalde und tauschte sie dort gegen etwas breitere Dachfenster (100cm)ein, welche alsbald Fischer Eberling aus Großzicker auf Rügen abholte und dafür eine Kiste Aal hinterließ, den er - natürlich illegal - in einer hinter der Garage versteckten Kammer geräuchert hatt…
Ende der 70er Jahre entstanden immer größere Defizite bei der Planerfüllung, die Gründe waren vielfältig: schlechte Arbeitsorganisation, fehlende Motivation bzw. Arbeitsdisziplin.
Wirtschaftlich investiert wurde schwerpunktmäßig in die Mikroelektronik. Computertechnik sollte die Gesellschaft zwar modernisieren, konnte jedoch nicht mit den internationalen Standards konkurrieren. Es gab hohen Sanierungsbedarf,und dies vermehrt bei den Anlagen der Chemieindustrie, wo die Bevölkerung und die Beschäftigten von nun an einer noch stärkeren Gesundheitsbelastung ausgesetzt waren.
7.3.4 Die 80er Jahre und ihre Präsenz im Buch
Immer mehr zeigte sich, wie sehr die sozialistische Wirtschaft im Vergleich zur profitorientierten Wirtschaft der westlichen Länder zurückblieb.
Von Beginn an war die Abhängigkeit der Wirtschaft von der Sowjetunion groß gewesen, und ohne deren Rohstofflieferungen hätte die DDR nicht existieren können. Der sozialistische Partner jedoch reduzierte aufgrund von Missernten und den daraus resultierenden Nahrungsmittelimporten aus dem Westen und wegen der Unruhen in Polen in den 80er Jahren die Erdöllieferungen. In der DDR wurde daraufhin von Öl- auf Braunkohleantrieb umgerüstet - mit schweren ökologischen und strukturpolitischen Auswirkungen.
Hinzu kam, dass das Bild der Arbeiterklasse sich veränderte: Der Anteil der Arbeiter an der Gesamtbevölkerung sank, die Arbeiterbewegung wurde schwächer und trat bei dem aktuellen Thema der ökologischen Umgestaltung gar nicht in Erscheinung.
Die DDR war hohe Verbindlichkeiten eingegangen, um Technologie zu importieren und näherte sich nun der Zahlungsunfähigkeit. Milliardenkredite aus Westdeutschland entschärften nur kurzfristig die Krise, denn die Subventionierungen für Verkehrsmitteln, Wohnungen, Grundnahrungsmitteln, Sozialleistungen wie Kinderbetreuungen und Gesundheitsfürsorge bestanden weiterhin und ließen die Wirtschaft immer mehr in den wirtschaftlichen Niedergang abgleiten. Hinzu kam die Unfähigkeit der DDR, Auslandsschulden zu tilgen.
Besonders groß war die Unzufriedenheit mit dem Wohnungswesen, das in einer auffälligen Abhängigkeit vom Staat bestand. Viele Bürger forderten eine Verbesserung, schrieben Bittschreiben und Briefe an staatliche Behörden, wurden oft aber nur schroff abgefertigt.208 S. 347
Hier waren die Häuser so niedrig, dass man die Dachrinnen mit der Hand erreichte. Kurt folgte dem Zickzack der kurzen, kopfsteingepflasterten Straßen, die in dieser Gegend, wo es aus offenen Fenstern nach Küche und Alkohol roch...über der mit Stacheldraht bewehrten Mauer des Reichsbahnausbesserungswerks, seit Jahren (oder Jahrzehnten?) ein blassrotes Transparent mit der Aufschrift ,Der Sozialismus siegt'vor sich hin rottet…
In den 80er Jahren änderte sich das Lebensgefühl: materielle und erlebnisbezogene Orientierungen verstärkten sich, das Streben nach Selbstverwirklichung bekam eine besondere Bedeutung.
Die Menschen der DDR machten die Erfahrung, dass der Sozialismus nicht funktionierte. Finanzielle Anreize und eine Konsummöglichkeit für ein erweitertes Warenangebot fehlten, und die Loyalität zum Staat ließ nach.
S. 275
Die LPG kam in Sicht, ein verwahrlostes Gelände: überall verrostete Maschinen im hohen Gras. Dann das Schweine-KZ, ein Bauwerk aus rohen Betonplatten, das ihm immer einfiel, wenn sie in der Schule das Lied singen musste…
Unsere Heimat, das sind nicht nur die Städte und Dörfer.…
Für die DDR-Bürger war wieder der Witz ein „Ventil für aufgestaute Unmut und zugleich ein Barometer für ihre Stimmung.“209 S. 290
Ruinen schaffen ohne Waffen, der Witz fiel ihm ein: die Losung der Kommunalen Wohnungsverwaltun…
Viele wussten nicht mehr, wofür sie sich engagieren sollten und verweigerten sich, denn schon
längst hatte sich die DDR-Gesellschaft an dem Konsum und die Lebensweise des Westens orientiert. „Der Besuch des Intershops.. war zu einer Art Sonntagsvergnügen avanciert. Auch die Delikat- und Exquisitläden, die Produktion von Farbfernsehern und
Heimcomputern zählen wohl zu den Versuchen, die immer deutlicher spürbare Stagnation und individuelle Perspektivlosigkeit zu kompensieren.“210
Bei Sascha zeigt sich eine Entwicklung weg von den Traditionen hin zu einer entwurzelten und traditionslosen Lebenswelt, in der politisches Interesse, kulturelle und gesellschaftliche Teilnahme nicht mehr vorhanden sind.
S. 291
Kurt betrat eine leere Wohnung. Er nahm kaum Einzelheiten war - es gab kaum Einzelheiten. Ein brutal kahler Flur. Eine Küche ohne ein einziges Möbel, alle Küchenutensilien standen auf einer alten Kochmaschine herum. Das Zimmer: blanke Dielen von roter Fußbodenfarbe…
S. 292
- Ich habe ein neues Schloss eingesetz…
- Du willst sagen, du bis eingebroche…
- Vater, die Bude steht leer. Da kümmert sich kein Mensch dr…
- Und wie kommst du hier rein? Woher hast du den Schlüsse…
S. 296
- Und eins sag ich dir: Wenn das rauskommt, dass du dort eingebrochen bist. Das ist kriminell, ist dir das klar? Dann ist dein Studium beende…
- Mein Studium ist sowieso beendet, sage Sascha und betrat die Gaststätte Balkan-Gril…
S. 299
- Hast du deine Diplomarbeit ferti…
- Ich schreibe meine Diplomarbeit nicht ferti…
- Sag mal, drehst du jetzt vollkommen durc…
Sascha schwie…
- Du kannst doch nicht hinschmeißen, so kurz vorm Schluss. Was willst du denn machen ohne Diplom? Auf’n Bau gehen oder wa…
- Weiß nicht, sagte Sascha. Aber ich weiß, was ich nicht will: Ich will nicht mein Leben lang lügen müsse…
Für die einen war die Bundesrepublik ein imperialistischer Staat, für die anderen das Ziel ihrer Wünsche und Sehnsüchte, und dementsprechend sahen viele ihre Bedürfnisse nach Autos und Reisen im Westen mit seinem höherem Lebensstandard für die breiten Massen eher befriedigt als im östlichen Deutschland. „Der Westen war in der DDR Projektionsfolie aller Bedrohungsängste, Hoffnungen und Sehnsüchte.“211 „Statt um den Freiheitsbaum tanzten die Menschen nun um das Goldene Kalb der Wohlstandsgesellschaft und vollzogen damit die unausweichliche Logik der bürgerlichen Revolution nach.“212
Insbesondere die Generation der jungen Erwachsenen und Jugendlichen hatte in den 80er Jahren ein anderes Verhältnis zum Staat und zum Gesellschaftssystem als die älteren Generationen, die Kriegsende und Wiederaufbau erlebt hatten. Die utopischen Hoffnungen der Nachkriegszeit waren kaum noch erkennbar und als der dynamische jüngere Gorbatschow auftrat, wuchs die Kritik am Staat. Das Echo auf ihn als den neuen Generalsekretär der KPDSU war in der DDR differenziert: Die DDR-Politiker blieben in Distanz und steuerten einen Gegenkurs zu seinem neuen Denken und seiner Perestroika und ein großer Teil der Intelligenz „unterließ .den Bruch mit der autoritären, dogmatischen Führung“213, lediglich eine reformbereite geistige Intelligenz aber bildete eine leise Front und sah in Michail Gorbatschow ihren Hoffnungsträger. Mit ihm hoffte sie auf Reformen und Erneuerung in der DDR, wurde aber enttäuscht, als Gorbatschow das Recht der Deutschen auf Selbstbestimmung achtete und der Auflösung der DDR und der Wiedervereinigung zustimmte.
Kurts Haltung als Historiker zu den Geschehnissen 1989 ist nicht eindeutig und wenig konkret:
S. 69
- Das ist die Warnung, dozierte Kurt. Das bedeutet: Leute, wenn es hier zu irgendwelchen Demonstrationen kommt, dann machen wir das wie die Chinesen auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Herrgott, nee wirklich, Beton, sagte Kurt. Beto…
S. 336:
Aussichtslos, dacht er, diesen Leuten seine Meinung über Gorbatschow begreiflich zu machen: dass Gorbatschow nicht weit genug ging.dass er konzeptionslos und inkonsequent war. dass ein Buch über die Perestroika nicht die Spur eines theoretischen Ansatzes enthiel…
S. 343
Die Wahrheit, sagte er oder wollte es sagen - der Satz, den zu bilden er im Begriff war, hätte in etwa gelautet: Die Wahrheit ist nicht etwas, das die Partei besitzt und an die Bevölkerung als eine Art Almosen austeil…
Im Gegensatz dazu verstand ein Großteil der Bevölkerung die abweisende Haltung der SED-Führung nicht. Für viele stellte sich die UDSSR als ein Reich der Hoffnung und Freiheit dar. Sie unterstützten Gorbatschows reformerisches Denken und wünschten sich eine demokratische Transformation des eigenen sozialistischen Systems. Honecker sah die Perestroika als eine innere Angelegenheit der UDSSR und als ein Problem mit einer zerstörerischen Kraft und lehnte die Reformpolitik von Gorbatschow ab.
S. 335
- Wenn unser Nachbar tapeziert, brauchen wir ja nicht auch gleich zu tapeziere…
- Auf Korbatschow, sagte Bunke. Auf die Berestroika in der DDR. Till wehrte ab, als man ihm einen Becher reichte. Der Abschnittsbevöllmächtigte tat, als hätte er nichts gehör…
Wilhelm zählt zu dem Häufchen alter Leute, das, wie Honecker, die DDR der siebziger Jahre verkörpert und eine nostalgische Sicht auf die Parteigeschichte hat.
S. 195
Gern hätte er ihm erklärt, dass Probleme - solche Probleme - in Moskau gelöst wurden und dass das Problem gerade darin bestand, dass Moskau selbst das Problem wa…
Die sozialistische Welt war in Bewegung geraten: In Polen fanden im Juni 1988 die ersten halbdemokratischen Wahlen statt, die den Kommunisten eine Niederlage brachten, in Ungarn gab es Demonstrationen für Freiheit und Demokratie.
Mit diesem Wandel und der Offenheit in den Bruderstaaten entstand in der zweiten Hälfte der 80er Jahre in der DDR eine Diskussionskultur, die auch die literarische Intelligenz, zu der Sascha gehörte, beeinflusste. In Foren, Diskussionsrunden, Versammlungen wurden unterschiedliche Meinungen zum Ausdruck gebracht und zwangen letztendlich die Partei 1988, die Zensur abzuschaffen, wenn auch, da das Papier kontingentiert war, weiterhin eine Erlaubnis für Druckerzeugnisse eingeholt werden musste. 1989 stellte man die volle Verantwortlichkeit der Verlage her.
Und dann kamen die unvergesslichen historischen Momente im Herbst 1989: Immer mehr DDR-Bürger flüchteten in die Botschaft, eine Ausreisewelle setzte ein. Doch noch immer wurde der Kurs der Partei nicht auf die Realität bezogen und korrigiert214, wurden keine Antworten auf konkrete Fragen gegeben oder von den Medien objektiv über die Probleme informiert. Man rechnete damals im Herbst 1989 einfach noch nicht mit dem Zusammenbruch des Systems, und die bevorstehenden Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der DDR schränkten die Handlungsfähigkeit der DDR-Führung ein. Der 40. Jahrestag der DDR sollte nämlich mit Militärparaden gemeinsam mit dem prominenten Zuschauer Gorbatschow begangen werden. Als es so weit war, kam es zur Demonstration und zu „Freiheit“-Sprechchören, und obgleich nach dem Heimflug von Gorbatschow die AntiTerror-Einheit des MfS zuschlug und auf Demonstranten einprügelte, kam es an den folgenden Tagen und in den Wochen danach zu weiteren Demonstrationen.
Am 11. September 89 wurden in Ungarn die Grenzen nach Österreich geöffnet und eine Ausreisewelle setzte ein, auf deren Höhepunkt das „Neue Forum“, unterstützt von großen Teilen der Bevölkerung, mit offenen Worten hervortrat und einen demokratischen Dialog über Fragen des Rechtsstaates, der Wirtschaft und Kultur forderte. Die Partei reagierte mit einem Verbot. Begründung: Staatsfeindlichkeit, doch zeigte das alles keine Wirkung mehr, im Gegenteil, es organisierten sich immer weitere Gruppierungen.
Markus denkt an die Möglichkeit eines Ausreiseantrags: S. 276
- Warum stellen wir eigentliche keinen Ausreiseantrag, fragte e…
- Wenn wir heute einen Ausreiseantrag stellen würden, sagte Muddel, dann würde er - und auch nur vielleicht, genehmigt werden, wenn du achtzehn bist. Oder zwanzi…
- Oder wir hauen ab, sagte Marku…
- Nicht so laut, sagte Muddel…
- Und wie willst du das machen, fragte Mudde…
- Na, wie alle - über Ungar…
Schriftsteller gingen im November auf die Straße und forderten in einer Protestdemonstration Reformen, sie votierten nicht gegen das Land, aber gegen die Massenflucht. Um sie aufzuhalten, verlangten sie, wie im Aufruf u.a. von Christa Wolf, einen menschlichen Sozialismus und eine veränderte DDR, eine bessere Gesellschaft auf demokratischer Grundlage, und keinen Ausverkauf der DDR. Dieser Aufruf fand ablehnende und zustimmende Reaktionen215, hatte aber keine politischen Konsequenzen mehr, denn im gesamten kommunistischen Bereich stand nun der Untergang bevor - die sozialistische Utopie existierte nicht mehr. Die DDR, im Zuge des Kalten Krieges entstanden, endete, als das sowjetische Imperium zusammen brach.
Am 9. November kam es zur Öffnung der Grenzübergangsstellen und jeder DDR Bürger konnte sie passieren. Die Mauer fiel, virtuell und real, die Kulissen des alten Systems stürzten ein.
Die Ausreisenden wollten keine Utopie mehr, sondern das kleine solide Glück im Westen, andere aber erfuhren die Wende 1989 als Demütigung und als Entwertung ihrer Lebensleistung und Biografie. Beides findet sich im Roman:
Wilhelms 90. Geburtstag ist das private Pendant zur nur sechs Tage später stattfindenden, von Protesten umrahmten und von Gorbatschows Perestroika überschatteten staatlichen Jubelfeier zum 40. Jahrestag der DDR. In den Ehrungen zu Wilhelms Geburtstag zeigt sich, wie sehr die DDR ein Land der Jubiläen und der proklamierten Jahrestage war. „Je mehr die DDR in Bewegungslosigkeit erstarrte, desto liebevoller wurden die Rituale der Erinnerung zelebriert.“216
Die Ehrenreden an Wilhelms Geburtstag sowie die Überreichung von Orden und Geschenken sind seit Jahren gleich oder ähnlich, wirken leer und nicht zukunftsfähig. Wilhelm sieht in den Blumenvasen „Grabsteine“ (192) und kommentiert die Blumengeschenke, eigentlich ein traditionelles Lebenszeichen, mit „... Bring das Gemüse zum Friedhof" (194 u.ö.). Die Ehrenreden sind weder zukunfts- noch gemeinschaftsorientiert und wirken wie Grabreden auf die DDR und absurde Totenreden auf Wilhelm.
Kurt erkennt in der Feier und den Ehrungen ein Zeichen des Untergangs des politischen Systems der DDR.
S. 241f
Die ganzen zwanziger Jahre waren eine einzige Lüge - und die dreißiger Jahre auch. Auch der „antifaschistische Widerstand“ war in Grunde genommen nichts als eine Lüg…
S. 343
… begriff er, was Wilhelm sang: Nee, dümmer ging’s nicht. Oder nein, nicht dumm, dachte Kurt, sondern verbrecherisch. Im Grunde, dachte er, war es die kürzeste Formel für das gesamte Elend. Im Grunde genommen, dachte er, war es die Rechtfertigung allen Unrechts, dass im Namen der „Sache“ begangen worden war, die Verhöhnung von Millionen Unschuldigen, auf deren Knochen dieser sogenannte Sozialismus erreichtet worden war: die berühmte Parteihymn…
Wilhelm wird am Ende aufgrund seiner ideologischen Gesinnung in die Rolle des Täters gedrängt, obwohl er zum Besten des Volkes in seiner Überzeugung gelebt hat.
S. 198
- Ich bin Metallarbeiter. Ich bin siebzig Jahre in der Parte…
S. 203
Die Sondermanns. Deren Sohn im Gefängnis saß: wegen versuchter Republikfluch…
- Euch kenn ich nicht, sagte Wilhel…
- Aber das sind doch Sondermanns, erklärte Charlott…
- Euch kenn ich nich…
Das Grummeln im Raum würde für einen Augenblick leise…
- Gut, sagte Sondermann. Drückte Charlotte den Blumenstrauß in die Hand und verschwand, zusammen mit seiner Gatti…
Am 13. November traten Regierung und das Präsidium der Volkskammer zurück, am 3. Dezember das Politbüro und das ZK der SED. 1990 folgten freie Volkskammerwahlen, am 1. Juli 1990 kam die Währungs- , Wirtschafts- und Sozialunion und am 3. Oktober 1990 trat die DDR gemäß Art 23 des Grundgesetzes der Bundesrepublik bei. In der gesamtdeutschen Bundestagswahl im Dezember 1990 wurde Helmut Kohl zum Bundeskanzler gewählt.
Die vollzogene Einigung „löste bei der Intelligenz einen Schock, einen Mentalitätssturz aus..Obwohl die Einheit dem Wunsch der oppositionellen wie auch der systemtreuen Intelligenz entsprach, sollte sie sich nicht so vollziehen, wie sie sich vollzog.“ 217
S. 367
- Aha, sagte Kurt, darf man jetzt also nicht mehr über Alternativen zum Kapitalismus nachdenken! wunderbar, das ist also eure Demokrati…
- Scheiß auf eine Gesellschaft, in der zwei Milliarden Menschen hungern, schrie Kur…
Für die Aufbaugeneration, zu der die Romanfiguren Charlotte und Wilhelm gehören, zerbrach die Bindung zur Sowjetunion, die aufgrund der Opfer und des Widerstands in der Zeit des Nationalsozialismus von Achtung und Zusammengehörigkeitsgefühl geprägt gewesen war. Am Ende der DDR standen für die noch lebenden Menschen der Aufbaugeneration der Verlust aller Ideale und Hoffnungen.
Für Wilhelm bedeutet es die Aufgabe der eigenen Biografie:
S. 191
Wofür hatte er seinen Arsch riskiert? Wofür waren die Leute draufgegangen? Dafür, dass irgend so ein Emporkömmling jetzt alles zugrunde richte…
Die friedliche Revolution und der Vereinigungsprozess veränderten die Lebensbedingungen und die Alltagsverhältnisse der Ostdeutschen. Der Systemumbruch wurde zum gesellschaftlichen Umbruch und war für die Lebensverläufe der Romanfiguren sehr bedeutsam. Er wirkte sich auf das (Familien-) Leben der Menschen aus, denn der Zusammenschluss mit Westdeutschland beeinflusste Form und Verlauf ihre Lebensführung, Wertvorstellung und Lebensziele.
Dies betrifft die Romanfigur Kurt insofern, dass die außeruniversitären Forschungseinrichtungen wegen ihrer zu großen Staatsnähe überprüft wurden und für die Universitäten eine „Selbstreinigung“ angesagt war. Eine Arbeitsgruppe von Wissenschaftlern untersuchte die frühere Staatsnähe von DDR-Intellektuellen und sprach Ausgrenzungen aus politischen Gründen aus. Es kam zur Auflösung von Wissenschaftsbereichen in den Akademien, lediglich 12 % der Wissenschaftler wurden weiter beschäftigt.218 „Die ostdeutsche Bevölkerung gar nahm es ohne Bedauern hin, dass die Intelligenz der DDR abserviert wurde.“219
Kurt wird in der Folge der Wiedervereinigung von einer anerkannten gesellschaftlichen Führungsfigur zum Wendeverlierer, er verliert seine Stellung, sein Institut wird aufgelöst.
S. 358
Sie verstand ja, dass es ihn aufregte. Er kämpfte gegen die, wie es neuerdings hieß: “Abwicklung“ seines Instituts. Ständig war er unterwegs. Fuhr nach Berlin, öfter als früher, sogar in Moskau war er noch einmal gewesen, weil irgendein Archiv plötzlich zugänglich wa…
Die Familie ist besonderen Belastungen ausgesetzt, Alexander arbeitet nun im Westen, es kommt zu Streit und Spannungen und zu Interessenkollisionen einzelner Familienmitglieder:
Die Älteren, in diesem Fall Kurt, zeigen Unsicherheit und eine Unlust auf Veränderungen: S. 366
- Was hier geschieht, ist der Ausverkauf der DDR, sagte Kur…
- Die DDR war pleite, hörte sie Sascha sage…
S. 369
- Du hast überhaupt keine Ahnung, was Kapitalismus bedeutet…
- Der Kapitalismus mordet, schrie Kur…
Bei Irina kommt die Angst vor Entwurzelung hinzu, Unsicherheit und Perspektivlosigkeit machten sich breit.
Charlottes Haus wird an die früheren Besitzer zurückgegeben:
S. 365
Nein, natürlich hatte Irina sie nicht im Haus haben wollen. Aber sie ins Pflegeheim abzuschieben erschien ihr brutal,…
und bei Irina besteht die gleiche Gefahr.
S. 358f
Und wenn sie jetzt noch das Haus verloren, dann gute Nacht. Selbst wenn man sie nach der „Rückübertragung“ - auch eine der Wörter, die mit der Wende gekommen waren - weiter hier wohnen ließe, würden sie die Miete auf Dauer kaum zahlen könne…
Die Familie hat finanzielle Probleme:
S. 352
… wenn man schon morgens mit einem unguten Gefühl im Bauch zum Briefkasten ging und die Post zuerst daraufhin überprüfte, ob ein gerichtliches Schreiben dabei war. Dumm, ja natürlich! Dumm war es gewesen, das Haus nicht zu kaufen. . wozu, wenn man irgendwelche hundertzwanzig Mark Miete zahlt…
Dabei war noch nicht einmal heraus, wie viel Rente Kurt nun, nach der Umstellung bekommen würde. von ihrer eigenen Rente ganz zu schweigen. Plötzlich sollte sie irgendwelche Arbeitsnachweise aus Slawa bringen: Was für eine Bürokratie!. Auch ihre Zusatzrente würde sie vermutlich nicht mehr bekommen (die DDR hatte ihr eine Rente als sogenannte Verfolgte des Naziregimes zuerkannt, als Ersatz für dieEhrenrente, die sie als „Kriegsveteranin“ in der Sowjetunion bekommen hätte): Kaum anzunehmen, dass die westdeutschen Behörden sie dafür belohnen würden, dass sie als Gefreite der Roten Armee gegen Deutschland gekämpft hatt…
Markus lebt bei seiner Mutter, zusammen mit deren neuem Mann:
S. 373
Klaus, der neuerdings versuchte, auf Vater zu mache…
Er beginnt eine Ausbildung.
S. 380
Er hatte Klaus niemals drum gebeten, ihm eine Lehrstelle als Kommunikationselektroniker zu besorgen (eigentlich wäre er gern Tierpfleger geworden, und wenn das nicht möglich war, weil es angeblich keine offenen Lehrstellen gab, wäre er am liebsten Koch geworden, da gab es offene Lehrstellen, aber nein: Kommunikationselektroniker…
…und füllt seine Freizeit mit Discobesuchen, Drogen und Videospielen.
S. 371
Dann öffnete er die nur notdürftig mit einer Schraube befestigte Seitenwand seines Tower-PC, drückte die Karte in den entsprechenden Steckplatz., bootete den Computer und spielte probehalber eine Runde DOOM: Wahnsinn! Das Röcheln der Monster war so echt, dass man Angst beka…
S. 375
Zeppelin schob eine Ecstasy rüber. Markus bezahlte gleich und spülte sie mit einer großen Cola runter..Dann verlor er die Frau, tanzte eine Weile allein, trank ein Bier. Fing wieder an zu tanzen, hatte Augensex mit einer zerrissenen Strumpfhose, mit schwarzen Zombieauge…
S. 376
Auf einmal hatte jemand noch Dope dabe…
Er führt ein desorientiertes Leben:
S. 371
Er feuerte seine Dreckwäsche ins Bad, stürmte hoch in sein Zimmer und packt die Soundkarte aus, die er im Computerladen in Cottbus gekauft hatte…
S. 374f
Kurz vor Mitternacht kamen sie am Bunker an, Zeppelin kannte die Türsteher. sie stiegen die Treppe hinab. Schon hier war die Musik laut. Der typische säuerliche, rauchige, modrige, versifte Kellergeruch schlug ihm entgegen, so penetrant, dass Markus nicht einatmen mochte, aber als sich die Stahltür öffnete, droschen die Techno-Bässe auf seinen Körper ein wie eine riesige, unsichtbare Faust, und es gab keinen Geruch mehr.Zeppelin schob eine Ecstasy rüber…
hatte Augensex mit einer zerrissenen Strumpfhose.Dann fand er die Schmutzigblonde mit den Sporttitten wieder, sie verständigten sich mit den Augen auf was trinken, und irgendwann später, nachdem jeder von ihnen zwei Black Russian getrunken hatte, knutschten sie in einem Gang rechts vom Klo…
S. 379
Es stellte sich heraus, dass wieder mal ein Brief von seiner Telekom gekommen war. Das Übliche: Fehltage, schlechte Noten, aber allmählich brannte die Sach…
Ohne überzeugende berufliche oder menschliche Perspektive, unglücklich und weder an politischen, sozialen oder andere existentiellen Fragen interessiert, gerät er in Gefahr, in ein der Kriminalität nahes Milieu zu geraten.
S. 380
… und nachdem sie eine Weile geschrien hatte (Inhalt uninteressant), holte sie aus und knallte mit einer übertriebenen Bewegung ein winziges Plastiktütchen auf den Tisch: Dope. Gras…
- Wenn du nicht sofort umkehrst, Markus, dann müssen wir irgendwan…
- O mann, sagte Marku…
- Du hörst jetzt zu, schrie Mudde…
Aus dem heutigen Blickwinkel betrachtet muss man aber sagen, dass sich letztendlich durch das Ende des totalitären Systems die Lebensumstände der meisten DDR-Bürger verbesserten und neue Freiheiten entstanden.
7.3.5 Abwanderung und Ausreise
Seit 1961 gab es Flüchtende und Übersiedler in der DDR und alle wünschten sich ein Leben ohne Mangel, in Wohlstand, Demokratie und Freiheit. Als seit 1984 den Rentnern der Umzug zu Kindern oder Verwandten gestattet wurde, gab es gleichzeitig eine steile Zunahme an jüngeren Menschen und Familien, die die DDR verließen.
„Wer flüchtete, dachte in längeren Zeiträumen. Er verließ, wie er annahm, derzeit nicht zu verändernde Verhältnisse.“ 220
Nachdem der Reiseverkehr zwischen der DDR und dem westlichen Ausland gelockert worden war, umfasste er ca. 6 Mio. Besucher in die Bundesrepublik, ca. 3,5 Mio. aus der Bundesrepublik in die DDR, dies trug mit zur Destabilisierung bei und ging über in die späteren Botschaftsbesetzungen.221 Anfang der achtziger Jahre kam es zur Massenbewegung, in der Zigtausende ausreisten; allein 1989 wurden 50 000 Genehmigungen erstritten, dies und die anschließende Massenflucht von Flüchtlingen über Ungarn, die im Zug durch die DDR gen Westen fuhren, zeigte, wie viele Menschen zu diesem Zeitpunkt bereits keine Hoffnung mehr auf Besserung hatten.
Die weltpolitischen Veränderungen versuchte das DDR-Regime zu verdrängen: S. 68f
- Wirklich kein einziges Wort, sagte Kurt. Keine Silbe über Ungarn, kein Wort über Flüchtlinge, nichts über die Botschaft in Pra…
Da aber niemand mit dem Untergang der DDR rechnete, verließ auch Eugen Ruge noch kurz vor dem Ende der DDR mit einem Ausreiseantrag sein Heimatland und war „richtig sauer“ als ein Jahr später die Öffnung der Mauer für alle bekannt wurde.
Im Roman verübt sein alter ego Sascha Republikflucht, er glaubt Mitte der 80er Jahre, also kurz vor dem Mauerfall nicht mehr an eine politische oder wirtschaftliche Verbesserung, ihm erscheinen die Erwartungen, sozialen Wertvorstellungen und scheinbaren Gewissheiten der Eltern illusorisch und fragwürdig. Sie hatten, so war seine Meinung, ideologische Scheuklappen.
S. 74
- Was ist denn, wo ist e…
- In Gießen, sagte Kurt leis…
Leitgebend für Saschas/Ruges Entscheidung in den Westen zu gehen, war, dass er dort eine größere Möglichkeit zur künstlerischen Entwicklung hatte, ohne staatliche Vorgaben erfüllen zu müssen. Als junger Literat mit einem Drang zur Veröffentlichung gibt es für ihn in der DDR nur eingeschränkte Möglichkeiten, seine Einsichten und Erfahrungen mitzuteilen oder sich unbeeinflusst zu äußern. Hinzu kam, dass ihm die Mentalität der Aufbaugeneration widerstrebte und er, anders als sie, zum Sozialismus einen eher gleichgültigen bzw. nichtsozialistischen Standpunkt hatte und gar kein Interesse daran, Traditionen zu wahren oder sich mit den Idealen der Vätergeneration auseinander zu setzen.
Er stellte einen Ausreiseantrag, das hieß im Amtsdeutsch der DDR: einen „rechtswidrigen Übersiedlungsversuch“ zu unternehmen, und nach einiger Wartezeit, die von „sofort“ bis zu zehn Jahre reichte, wurde diesem stattgegeben.222
Damit bricht Sascha aus der Reihe der Angepassten aus und muss mit der Reaktion der Umwelt leben: Neid, Bewunderung und Ablehnung schlagen ihm entgegen.
Er verlässt seine Heimat und nimmt in Kauf, die Eltern auf unabsehbarer Zeit nicht mehr wiederzusehen und sie eventuell auch in berufliche Schwierigkeiten zu stürzen.
Durch seine Flucht in den Westen schlägt er sich zwar auf die Seite der politischen Sieger, vermag aber weder im neuen kulturellen noch im politischen Umfeld Fuß zu fassen oder eine seinem Vater vergleichbare Stellung zu erlangen.
Irina ist verzweifelt:
S. 75
- Sascha ist weg, schrie sie. Tot, verstehst du, to…
- Irina, sagte Kurt auf Deutsch, du kannst doch nicht so etwas sagen! Zu Nadjeshda Iwanowa sagte er auf Russisc…
- Sascha ist nicht tot, Irina meint, dass er sehr weit weg ist. Dass er nicht mehr kommen wir…
- Aber zu Besuch, sagte Nadjeshda Iwanow…
- Nein, sagte Kurt, auch nicht zu Besuc…
S. 324
Nun fehlte nur noch, dass Kurt sie, um ihre Verzweiflung zu mildern, vorsichtig daran erinnerte, dass auch sie, da sie bereits über sechzig, also im Rentenalter war, das Recht hatte, ihren Sohn im Westen zu besuche…
Mein Sohn hat mich verratten, hieß die Formel, in der ihre Enttäuschung ihren endgültigen Ausdruck fan…
Da sich Wiederholungen bis in Alexanders Leben im Jahr 2001 durchziehen, deuten sie auch eine Skepsis im Hinblick auf die politischen Möglichkeiten unter den Bedingungen des Westens an.
8. Stadträumliche Situierung der Familienromane
Wo du weg willst, wenn du älter wirst und zurückwillst, wenn du alt bist, das ist Heimat. (deutsches Sprichwor…
Alle drei Romane sind lokal verankert und haben charakterliche Örtlichkeiten einer Stadt, in der die Roman-Familie und der Autor selber beheimatet sind. Allein über Thomas Mann und Lübeck und seinen Ferienaufenthalt in Nidden gibt es bereits unzählige Bücher. Dahinter liegt der Gedanke, dass „bestimmte Orte, an denen Menschen gewohnt und gearbeitet haben, wie ein Wurzelgeflecht ihren Denkweisen zugrunde liegen.“223
8.1 Lübeck
„Es gibt eine Charakterverbindung zwischen Ort und Person.“224 Diese ist im Falle von Thomas Mann und Lübeck offen und greifbar und in diesem Roman nachlesbar: Die Familie und die Firma Buddenbrook sind Teil der Geschichte Lübecks - Lübeck zeigt uns die Strömungen und Tendenzen der jeweiligen Zeit!
Zentraler Wohnsitz und Schauplatz von Thomas Manns Roman ist eine bei Travemünde gelegene Hafen- und Handelsstadt, mit giebeligen und winkeligen Straßen (S. 659), die zwar nie als Lübeck bezeichnet wird, jedoch mit seinem öffentlichen und geschäftlichen, bürgerlichen Leben auf die Heimatstadt des Dichters hindeutet.
Lübeck zählte 1835 24000 Einwohner, das gesamte Staatsgebiet lediglich 40000 und die Überschaubarkeit des kleinen Staatswesens führte zu keinerlei großen Veränderungen oder revolutionären Spannungen in den Verhältnissen, man pflegte die althergebrachten Konventionen und Verhältnisse. Die „freie und Hansestadt“ (S. 56) spiegelt ein Milieu von tradierten Werten des Konservativismus’ und der Solidität, das Leben ist geprägt von Tradition.
Wie bedeutsam Thomas Mann die Beziehung zu seiner Heimatstadt damals empfand, zeigte sein Brief 1903 an Martha Hartmann: „Eine Stadt, über die man ein elfhundert Seiten starkes Buch schreibt, kann einem ja im Grunde nicht gleichgültig sein.“225 Lübeck war für Thomas Mann eine „persönliche Lebensform und -stimmung und -haltung“226, und er verwahrte sich 1913 dagegen, dass er zu seiner Heimatstadt ein schlechtes Verhältnis habe; dieser Vorwurf war ihm nämlich von seinem Onkel Friedrich Mann gemacht worden, der ihn in dem Lübeckischen Anzeiger vom 28.10.1913 als „Nestbeschmutzer „bezeichnete. „Was mich ärgert, ist die Vorstellung als stünde ich mit der Vaterstadt auf dem schlechtesten Fuße.“227
Th. Mann trat stets als ein Lübecker Bürger auf, dem die Reflexion seiner Bürgerlichkeit als Künstler und die Abgrenzung von Künstler und Bürger ein bedeutsames Thema in seinen Werken und Reden war.
Eine große Anzahl der städtebaulichen Elemente Lübecks finden sich im Roman:
Giebelhäuser, Öllampen und eine Straße, die abschüssig zur Trave führte, vermitteln das Bild einer verschlafenen ruhigen Kleinstadt.
S. 155
Diese grauen Giebel waren das Alte, Gewohnte und Überlieferte, das sie wieder aufgenommen und in dem sie nun wieder leben sollt…
So sieht es Tony Buddenbrook.
Der Klavierlehrer Hannos, Herr Pfühl wohnt in einem.
S. 503
geräumigen alten Giebelhaus mit vielen kühlen Gängen und Winkel…
Thomas Buddenbrook beschreibt die Stadt seiner Jugend als eine gemütliche aber auch unansehnliche Stadt:
S. 360
„Sie wissen besser als ich, wie es damals bei uns aussah. Die Straßen ohne Trottoirs und zwischen den Pflastersteinen fußhoher Graswuchs und die Häuser mit Vorbauten und Beischlägen und Bänken.…
Auswärtige Gäste besichtigten die Sehenswürdigkeiten der Stadt, die mittelalterlich unversehrt waren: das enge Burgtor, durch das Tony B. hindurchfährt, die alte Stadtmauer mit den halb verfallenen Türmen, die Katharinenkirche, all das wirkt malerisch-romantisch. Pastor Tiburtius aus Riga verweilt länger bei den Buddenbrooks:
S. 283
Es vergingen acht Tage, und noch immer hatte er diese oder jene Sehenswürdigkeit, den Totentanz und das Apostel-Uhrwerk in der Marienkirche, das Rathaus, die „Schiffergesellschaft“ oder die Sonne mit den beweglichen Augen im Dom nicht besuch…
Herr Permaneder bekommt eine Stadtführung von Thomas Buddenbrook persönlich:
S. 335
Trotz allen geschäftlichen und städtischen Pflichten nahm er sich Zeit, ihn in der Stadt umherzuführen, ihm alle mittelalterlichen Sehenswürdigkeiten, die Kirchen, die Tore, die Brunnen, den Markt, das Rathaus, die „Schiffergesellschaft“zu zeigen, …
Dem Senat waren so manche Ausgaben zur Erhaltung von Baudenkmälern zu teuer, so dass sich ein verwahrloster Anblick bot.
Darüber spricht Thomas Buddenbrook mit dem Barbier, wenn er sagt:
S. 360
„.Und unsere Bauten aus dem Mittelalter waren durch Anbauten verhäßlicht und bröckelten nur so herunter, denn die einzelnen Leute hatten wohl Geld und niemand hungerte, aber der Staat hatte gar nichts und wurstelte so weiter . und an Reparaturen war nicht zu denken…
Restaurierungen setzten in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts am Holstentor, am Rathaus und an den Kirchen ein.228
Mittelpunkt der Stadt war und ist noch immer die im Inneren und im Äußeren imponierende St. Marienkirche, sie erlangte ihre Größe und Bedeutsamkeit bereits 1839 nach einer Restaurierung.
Für ihren Wiederaufbau spendete Thomas Mann nach dem Krieg Geld, in ihr findet Hanno seinen Rückzug in die Musik:
S. 503
Manchmal auch, am Sonntag, durfte der kleine Buddenbrook dem Gottesdienst in der Marienkirche droben an der Orgel beiwohnen . Hoch über der Gemeinde, noch über Pastor Pringsheim auf seiner Kanzel saßen die Beiden inmitten des Brausens der gewaltigen Klangmassen, die sie gemeinsam entfesselten und beherrschten, denn mit glückseligem Eifer und Stolz durfte Hanno seinem Lehrer manchmal beim Handhaben der Register behilflich sei…
Regierungssitz der Stadt Lübeck war das mit vielfältigen Stilelementen bestückte und Ehrfurcht gebietende alte Rathaus. Dort tagte der Senat zweimal wöchentlich. An diesen Tagen gab es Beflaggungen, Wachen und eine Sperrung der Straße für den Wagenverkehr.
Dies und der „Marktplatz“ spielen bei der Senatorenwahl eine Rolle, Tony wartet dort auf die Bekanntmachung des Ergebnisses.
S. 413
In der Breitenstraße vor dem Rathaus mit seiner durchbrochenen Glasurziegel-Fassade, seinen spitzen Türmen und Türmchen, die gegen den grauweißlichen Himmel stehen, seinem auf vorgeschobenen Säulen ruhenden gedeckten Treppenaufgang, seinen spitzen Arkaden, die den Durchblick auf den Marktplatz und seinen Brunnen gewähren, vorm Rathaus drängen sich mittags um 1 Uhr die Leut…
Der „Lübecker Hafen“, in dem Güter von Schiffen gelöscht werden, wird Hanno durch seinen Vater bekannt gemacht, statt der Salzspeicher spricht der Roman von „Getreidespeichern“. Das Löschen und Laden der Segelschiffe erfolgte zur damaligen Zeit von Trägerkompagnien, speziellen Hafenarbeitern, ab 1866 von Kränen. Als Baggerarbeiten eine Vertiefung der Trave schufen, konnten ab den 1850er Jahren auch Dampfschiffe in den Hafen einlaufen. Thomas Buddenbrook führt seinen Sohn in die Kaufmanns-Tätigkeit am Hafen ein:
S. 625
… er nahm ihn mit sich auf Geschäftsgänge, zum Hafen hinunter und ließ ihn dabei stehen, wenn er am Quai mit den Lösch-Arbeitern in einem Gemisch von Dänisch und Plattdeutsch plauderte, in den kleinen, finsteren Speicherncomptoiren mit den Geschäftsführern konferierte oder draußen den Männern einen Befehl erteilte, die mit hohlen und langgezogenen Rufen die Kornsäcke zu Boden hinauswarfen. Für Thomas Buddenbrook selbst war dieses Stück Welt am Hafen, zwischen Schiffen, Schuppen und Speichern, wo es nach Butter, Fischen, Wasser, Teer und geöltem Eisen roch, von Klein auf der liebste und interessanteste Aufenthalt gewesen;.Wie hießen nun die Dampfer, die mit Kopenhagen verkehrte…
Die „Fischstraße“ ist eine gute Adresse, in ihr wohnt der Tapezierer Jacobs, den Tony mit der Einrichtung des Hauses beauftragt.
S. 297
… unterdessen aber sollte Antonie, zusammen mit dem Tapezierer aus der Fischstraße, das hübsche kleine Haus in der Breitenstraße bereit mache…
Die Buddenbrooks reisen, so lesen wir, nach Travemünde oder nach Hamburg mit der sog. „Fensterchaise“, einer Pferdekutsche, für die man damals einen Vertrag mit einem Mietkutscher abschloss.229 Der Verkehr über Land erfolgte von 1838 an über Oldesloe nach Hamburg, die Reisedauer betrug sieben Stunden und kostete einen Preis von sieben Mark. Bereits 1851 gab es dreimal die Woche Bus-Reiseverbindungen nach Hamburg oder Travemünde, bis dann 1865 eine direkte Eisenbahnverbindung mit Hamburg entstand, die, nach langwierigen Verhandlungen mit Dänemark, den Land-und Postverkehr erleichterte und mit der die Industriealisierung begann.
Erwähnung finden im Roman die gesellschaftlich-sozialen Verhältnisse Lübecks.
Es existierte in Lübeck eine große Kluft zwischen Besitzenden und Nicht-Besitzenden: Die 10% Bedürftigen lebten in Kellerwohnungen oder in anderen engen Wohnverhältnissen und erhielten Zuwendungen durch Sammlungen privater und öffentlicher Wohltätigkeitsanstalten.
Bei der Weihnachtsfeier im Hause zeigt die Konsulin Buddenbrook ihnen gegenüber ihre Mildtätigkeit:
S. 530
…, hinaus auf den Korridor, wo scheu und verlegen einige fremde alte Leutchen umher standen, Hausarme, die ebenfalls an der Bescherung teilnehmen sollten…
Diese Tradition wird im Hause von Thomas und Gerda Buddenbrook nicht mehr fortgesetzt:
S. 607
Es fehlte der Chor der „Hausarmen“, die in der Mengstraße Schuhzeug und wollene Sachen in Empfang genommen hatten, …
Ein Waisenhaus am Domfriedhof war das Zuhause von Knaben und Mädchen, die ihre Schulstunden dort absolvierten und nach der Konfirmation mit einem kleinen Guthaben entlassen wurden.
Für die Altersversorgung mittelloser Mädchen aus alteingesessenen und verdienten Familien existierte das St.-Johannis-Jungfrauenkloster, in dem ca. 30 Konventualinnen mit eigener Haushaltung und Dienstmädchen still und vornehm-zurückgezogen leben konnten.
Klothilde wird in dieses Kloster aufgenommen und Thomas Buddenbrook bezeichnet sie als „ein wenig exklusiv“:
S. 541
Klothilde war weitaus die Glücklichste von allen an diesem Abend, … Sie war in das „Johanniskloster“ aufgenommen worden. Der Senator hatte ihr die Aufnahme unter der Hand im Verwaltungsrat erwirkt, obgleich gewisse Herren heimlich über Nepotismus gemurrt hatten. Man unterhielt sich über diese dankenswerte Institution, die den adeligen Damenklöstern in Mecklenburg, Dobberthien und Ribnitz, entsprach, und die würdige Altersversorgung mittelloser Mädchen aus verdienter und alteingesessener Familie bezweckte. Der armen Klothilde war nun zu einer kleinen aber sicheren Rente verholfen, die sich mit den Jahren steigern würde, und, für ihr Alter, wenn sie in die höchste Klasse aufgerückt sein würde, sogar zu einer friedlichen und reinlichen Wohnen im Kloster selbs…
Ende der 1860er Jahre siedelten sich immer mehr Familien in den Vorstädten Lübecks an. Tony mietet eine helle Etage am Lindenplatz, und auch Gerda zieht nach dem Tod des Senators in eine kleine Villa vor dem Burgtor.
S. 607
Man gedachte der seligen Mutter, sprach über den Hausverkauf, über die helle Etage, die Frau Permaneder vorm Holstentore in einem freundlichen Hause angesichts der Anlagen des „Lindenplatzes“ gemietet hatte…
S. 698
Herr Kistenmaker besorgte auch den Ankauf des neuen Hauses, einer angenehmen kleinen Villa, die vielleicht ein wenig zu teuer erstanden wurde, die aber, vorm Burgtore an einer alten Kastanien-Allee gelegen und von einem hübschen Zier- und Nutzgarten umgeben, den Wünschen Gerda Buddenbrooks entsprac…
Lübeck als Stadt war ein Ort, der den Menschen Sicherheit gab für die Entwicklung einer Persönlichkeit, aber auch zugleich als beengend empfunden werden konnte. Hanno Buddenbrook ist das literarische Beispiel dafür, dass eine Künstlerpersönlichkeit versucht, aus den Normen und sozialen Verpflichtungen, aus verwandtschaftlichen Bindungen und den Erwartungen der bürgerlichen Welt ihrer Heimatstadt auszubrechen. Auch Christian Buddenbrook ist jemand, der der individuellen Einengung durch Ausbruch aus der bürgerlichen Gemeinschaft versucht zu entfliehen.
8.2 Wien
Wien, die Hauptstadt Österreichs, ist in Arno Geigers Roman die Heimat der Familie Sterk, für Peter der Ort der Kriegserinnerung, der in verschiedenen Kapiteln durch Straßen und Parks charakterisiert wird.
Beginnen wir mit Historie Wiens, als das Bürgertum seine Bedeutung gewinnt. Überschneidungen zwischen der Historie Wiens als Haupt- und Regierungsstadt und der ganz Österreichs sind hierbei unausweichlich ( siehe: Historie Österreich).
Nach der Französischen Revolution artikulierten auch angesehene österreichische Bürger zusammen mit prominenten Persönlichkeiten neue politische Gedanken und bildeten 1794 in Wien einen Diskussionskreis um demokratisches Gedankengut. („die Jakobinerverschwörung“). Die Politik reagierte: Es kam zu einer harten Verurteilung und einem Verbot des Wiener Vereinslebens, der „geheimen Gesellschaft“.
Von 1796/97 an bedrohte der junge Napoleon Österreich und eroberte acht Jahre später Wien.
Nach den Napoleonischen Kriegen ließ die Ansiedlung von Industrieansiedlungen ein Industrieproletariat entstehen, dessen Lage sich durch die Technisierung und den technischen Fortschritt mehr und mehr verschärfte. Hilfe kam durch die privaten Wohltätigkeitsvereine aus dem Bürgertum.
Diese sozialen Probleme brachten eine Polarisierung in der Gesellschaft mit sich, „in der der Kleinbürger zum Ideal erhoben worden war.“230 Bürgerliche Gesinnung spiegelte sich in einem Heim und in einem bescheidenen Wohlstand, und noch heute zeugen spätklassizistische Häuser von der damaligen Gesellschaftsschicht der bürgerlichen Handwerksmeister und Fabrikanten.
Die Zeit des Vormärz, die politische Periode zwischen dem Wiener Kongress (1814/1815) und der Revolution 1848 prägte Wiens Ruf als Weltstadt der Musik und machte diese zu einem wichtigem Bestandteil des dortigen Lebens.
Das Sturmjahr 1848 begann in Wien mit einer spontan entstandenen Bewegung unterschiedlicher Bevölkerungsschichten, es kam zu Massendemonstrationen von Wiener Arbeitern, ausgelöst durch Lohnkürzungen. Die Garde stoppte sie in der Wiener Innenstadt, es gab Verletzte und Todesopfer.
Bürger bewaffneten sich zunächst mit dem Ziel einer Verfassung, in der ein allgemeines und gleiches Wahlrecht fixiert werden sollte. Doch schon bald wandte sich das besitzende Bürgertum gegen eine Radikalisierung. Arbeiterschaft und Angehörige des Handwerks, traditionsmäßig zunftgebunden, kämpften jeweils für ihre eigenen Interessen. Daraufhin bereitete die Reaktion ein Eingreifen vor.
Der Wiener Oktoberaufstand 1848, oft auch „Wiener Oktoberrevolution“ genannt, war die letzte Erhebung der österreichischen Revolution. Als am 6. Oktober 1848 von Wien aus kaiserlich österreichische Truppen gegen das aufständische Ungarn ziehen sollten, versuchten die mit den Ungarn sympathisierenden Wiener Arbeiter, Studenten und meuternde Truppen den Abmarsch zu verhindern. Es kam zu Straßenkämpfen. Kriegsminister Graf Theodor von Latour wurde von der Menge gelyncht. Der Hof floh mit Kaiser Ferdinand am 7. Oktober. Im Verlauf der Kämpfe gelang es den Wiener Bürgern, Studenten und Arbeitern, die Hauptstadt in ihre Gewalt zu bringen.
Aber die Revolutionäre konnten sich nur kurze Zeit halten. Am 23. Oktober wurde Wien von konterrevolutionären Truppen eingeschlossen. Am 26. Oktober begann das österreichische und kroatische Militär mit der Beschießung Wiens. Nach einer Woche wurde Wien gegen den heftigen, aber aussichtslosen Widerstand der Wiener Bevölkerung von den kaiserlichen Truppen wieder eingenommen und die innere Stadt am 31. Oktober erstürmt.
Das Gesicht Wiens veränderte sich. Ab 1857 kam es zu einem Bauboom und zu architektonischen Veränderungen des Stadtbildes, und Eingemeindungen ließen Wien nicht nur flächen- sondern auch bevölkerungsmäßig wachsen.
Privatkapital mit einer entsprechend liberalen Auffassung machte die Stadt zu einer Metropole, städteplanerisch vom Kaiser umgesetzt. Man organisierte die Energieversorgung und den Verkehr und begann die Anlage der Ringstraße mit den bedeutendsten öffentlichen repräsentativen Bauten und Palais für Großindustrielle, Bankiers und Angehörige des Herrscherhauses. Die Stadt erhielt ihre typische Prägung und Bedeutung als kulturelles Zentrum der Monarchie.
Das Theater wurde für die höfische Aristokratie und das literarisch interessierte Bürgertum besonders interessant, Wien als Haupt- und Residenzstaat hatte dabei eine Vorreiterrolle mit dem Burgtheater als führendem deutschsprachigen Schauspielhaus, neben dem Kärntner-Tor-Theater und den Vorstadt-Theatern.
Es bildete sich ein kreatives Milieu mit revoltierenden, modernen Künstlern in der Malerei (Klimt), der Musik (Schönberg) und in der Literatur (Schnitzler), das sich von der traditionellen klassischen Kunst abwandte.
Ein ausgeprägter Denkmalskult mit Helden der Vergangenheit zeigte sich auf dem Heldenplatz in Wien.
Im südlichen Wiental und im Nordwesten ließ ein vermögendes Bürgertum unter Hinzuziehung von namhaften Architekten Villenvororte entstehen, und die Innenstadt entwickelte sich mit Geschäftshäusern und Zentralstellen der Industrie zur City.
Avantgardismus in den Künsten und ebenso in der Architektur überwanden am Ende des 19. Jahrhunderts den Historismus. Hier muss man Otto Wagner in den 1890er Jahren als den einflussreichsten Architekten Wiens als bahnbrechend ansehen.231
Wir lesen bei Arno Geiger über Wiens Sehenswürdigkeiten beim Spaziergang Ingrids mit den Kindern:
S. 257
Eigentümlich geduckt sind die Gebäude von Schönbrunn diesmal hingestellt, dick und voll. Das Gelb der Fassaden wirkt gebleicht vom niedergedrückten Schornsteinrauch, nach dem die Luft schmeckt. Die Alleen sind fast menschenleer, die Hecken aufgepackt mit Schneehauben, und die kahlen, schmutzigen Laubbäume stehen hart gezeichnet im weißgrauen Licht … Man hört Böllerschießen und Musik aus der Gegen des Tiergartens …
Merkantilisches Gedankengut aus deutschen Staaten des Reichs beeinflusste von nun an die Wirtschaftspolitik Wiens: Landwirtschaftsgesellschaften lieferten die theoretische Kenntnisse über neue Techniken zur Verbesserung von Land-, Forst- und Viehwirtschaft und wirtschaftliche Maßnahmen zum Ausbau des Verkehrsnetzes; die industrielle Produktion von Konsum- und Luxusgütern ließ Fabriken entstehen. Besonders erfolgreiche Unternehmer kamen in den Genuss von Nobilitierungen.
Politisch hatte seit Ende des 19. Jahrhunderts die Sozialdemokratie mit etlichen Jugend- und Frauenorganisationen in Wien große Bedeutung gewonnen. Sie stellten das Wahlrecht und die sozialen Probleme in den Mittelpunkt; ebenso aber erreichten Antisemiten, die sich gegen das jüdische Großbürgertum wandten, zunehmend die Wiener Wählerschichten.
Die Zuwanderung von Tschechen führte zur Zunahme der Bevölkerung. Sie stammten zumeist aus der unterprivilegierten Schicht, arbeiteten als Dienstmädchen und Tagelöhner, bezogen ihre Tageszeitungen in tschechischer Sprache und hatten eigene Parteien und Vereine.
Juden aus Ungarn und Polen, ebenfalls der Unterschicht zugehörig, sympathisierten mit der Sozialdemokratie und stärkten sie. Es entstand die zionistische Bewegung in Kreisen des Wiener Judentums. Führender Kopf war Theodor Herzl, ein Journalist aus Wien; er verfasste 1896 die Schrift „Der Judenstaat“ als Grundlage für einen theoretischen Zionismus.
Deutschnationale sahen die Überfremdung als ein Problem und griffen insbesondere das starke Engagement der Juden im Pressewesen („Judenpresse“) an.
Als Kaiser Franz Joseph 1916 starb, endete eine entscheidende Epoche in Wien.
Ab 1918 gab es in der Ersten Republik Österreichs eine Neuorientierung in der Stadtverwaltung: Die ersten Neuwahlen nach Einführung des allgemeinen Wahlrechts brachten den Sozialdemokraten die absolute Mehrheit, Bürgermeister war Jakob Reumann.
1922 wurde Wien zu einem selbständigen Bundesland, und die dadurch gewonnene Steuerhoheit ermöglichte der sozialdemokratischen Mehrheit Reformen durchzuführen: Fürsorgewesen und Wohnungsbau hatten Priorität, Abgaben auf Luxus schufen neue Einnahmen.
Und obwohl die Angst vor der „roten Gefahr“ immer wieder geschürt wurde, entwickelte sich das „rote Wien“ zur „Weltstadt des sozialen Gewissens“: Im Bereich des Gesundheitswesens und der Schulreform gab es soziale Fortschritte und man realisierte ein kommunales Wohnungsbauprogramm mit weitläufigen Wohnblöcken, -anlagen, reicher Begrünung und einer Abkehr von den Mietskasernen.
Am 1. Mai 1920 trat das „Hausgehilfinnengesetz“ in Kraft, das Arbeits- und Urlaubszeit, Kündigung, Verpflegung und Unterkunft regelte. Der Begriff „Hausgehilfin“, statt der des „Dienstmädchens“ entsprach nun mehr dem Selbstverständnis der jungen Frauen, die im Dienst waren und sollte das Bild des Hausherrn vom Gutsherrentum befreien.
Bis Anfang der 30er Jahre verschlechterte sich wie anderswo auch die wirtschaftliche Lage in Wien, und das bisherige Sozialprogramm konnte nicht wie bisher durchgeführt werden, u.a. weil der Verteilungsschlüssel für den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern zu Ungunsten Wiens erfolgte.
Es gelang nun der NSDAP 15 Mandate im Gemeinderat Wiens zu erlangen, und als ab Frühjahr 1933 Bundeskanzler Dollfuß mit Hilfe eines Kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes von 1917 regierte, war „das ,Rote Wien’ und die Wiener Arbeiterschaft (...) zu den letzten Verteidigern der Demokratie in Österreich geworden.“232 Die sozialdemokratische Stadtregierung wurde abgelöst, militärische, bürgerliche und katholische Traditionen, wie z.B. die katholische Soziallehre, wieder aufgegriffen und die Fürsorge den privaten und konfessionellen Aktivitäten überlassen. Die Regierung änderte die Steuerpolitik zugunsten der Oberschichten. Von jetzt an nannte sich die Gemeindevertretung „Bürgerschaft“.
1938 nach der „Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich“ wurde Bürgermeister Schmitz in Schutzhaft genommen, eingesetzt wurde der Nationalsozialist Ing. Hermann Neubacher. Er „säuberte“ die Beamtenschaft zu Gunsten von Parteigenossen und stellte Juden außer Dienst. Am 14. März erschien Adolf Hitler aus Propagandazwecken für die Volksabstimmung am 10. April in Wien. Hitler hatte zwar aus seinen Wiener Jugendjahren noch Ressentiments der Stadt gegenüber, trotzdem sollte nun ein „Aufbauprogramm“ greifen.
Wien ging gegen Juden mit Plünderungen, Misshandlungen und anderen Übergriffen vor und trieb sie so in die Emigration. Wem dies nicht gelang, dem stand die Deportation in Vernichtungslagern bevor. Gleichschaltung erfolgte in allen Bereichen, indem man missliebige Kräfte ausschaltete, auch wenn dadurch viel schöpferisches Potentials verloren ging.
Die sog. „Arisierung“ richtete sich gegen jüdische Unternehmen und hatte das Ziel, jüdisches in nicht jüdisches Eigentum zu überführen.
(AG)
Richards Erlebnisse während der Nazi- Herrschaft werden im Kapitel von 1938 erzählt. Die Familie erlebt eine Unruhe in der Stadt, ihr Familienleben ist aber nicht wesentlich von der Politik geprägt. Richards Haltung ist durch vorsichtiges Lavieren233 geprägt. Als seine jüdischen Nachbarn wegziehen müssen, profitiert er von deren Entrechtung und kauft das Bienenhaus als beschlagnahmtes Judengut.
Der Reichsgau Wien war nun ein staatlicher Verwaltungsbezirk und eine Selbstverwaltungskörperschaft. Der Reichsstatthalter stand an der Spitze der Stadt, der Bürgermeister fungierte als eine Art Stadtrat und „Ratsherren“ lösten die „Bürgerschaft“ ab.
Während des Krieges war Wien den Luftangriffen Englands und Amerikas ausgesetzt, Industrie- und Wohnbezirke fielen in Schutt und Asche, Lebensmittel wurden gehortet und die Preise stiegen.
Im März 1945 erreichten aus Ungarn heranrückende Sowjettruppen Wien und es begann eine regelrechte Schlacht, angefeuert von der Propaganda der Nationalsozialisten, die sich die Angst der Menschen vor der Zukunft zunutze machten und auf den Straßen plakatierten: Bolschewismus ist Sklaverei, Vergewaltigung, Massenmord, Vernichtung. Wehrt euch! Kampf bis zum Sieg! Kapitulation Niemals!234 Die Menschen sollten ihr Äußerstes geben, um das Überleben von Volk, Staat und Regime zu retten.
(AG)
Das Kapitel „Weißer Sonntag 1945“ veranschaulicht diese historische Situation.
Peter erlebt im Volkssturm den Kampf um Wien:
S. 102ff
Wien ist Frontstadt. Beim Hochsteigen aus dem dritten Keller ist von Maschinengewehrfeuer nichts mehr zu hören. Hinter dem Fähnleinführer drückt sich Peter durch den Hausgang Richtung Straße, er tritt möglichst vorsichtig auf, um mit den schiefen Holzsohlen seiner Goiseserer nicht allzuviel Lärm zu machen. Doch die Bolschewisten haben sich zurückgezogen. Rotarmist und Kinderwagen liegen nicht mehr in der durch eine Blutlache markierten Stelle, und auch die Brotziegel haben die Bolschewisten mitgenomme…
Viele Wiener wohnten in den Kellern ihrer Wohnhäuser, weil sie sich dort vor den Artilleriegeschossen sicher fühlten. Sie befürchteten einen Kampf um Haus und Straße, doch es kam anders. Die Sowjetführung nahm Wien rasch und zügig von Westen her ein und machte die Unterlegenheit der Deutschen offensichtlich, auch wenn das Führerhauptquartier einen siegreichen Abwehrkampf befahl und Panzerdivisionen in die Stadt verlegte. „Einheiten von Wehrmacht, SS und Volkssturm benutzten Eckhäuser und Stadtbahnstationen als Abwehrstellungen.“235
S. 102ff
Auf klappernden Holzsohlen, eine Panzerfaust über der Schulter, rennt der fünfzehnjährige Peter Erlach über die Straße und verschwindet in einer bizarr aufragenden Eckhaus-Ruine …
Chaos regierte in der Stadt: Es kam zu Plünderungen:
S. 106
Der Mann, ein älterer Herr, ist in Unterhosen, seine schwarzen, verwaschenen Drillichhosen hat er dabei, nur sind sie unten verknotet und offenbar mit Mehl gefüllt. Diesen aufgeblasenen, aufgeblähten, wasserlleichenähnlichen Torso zerrt der Mann schnaufend und fluchend, aber mit dem Eifer des Glücklichen über den Gehsteig in Richtung der Bube…
NS-Funktionäre, die sich nicht mehr am Kampf beteiligen wollten, flüchteten, die Feuerwehr floh aus der Stadt und ließ ausgebrochene Brände ungelöscht zurück. Trotzdem rief Gauleiter Baldur von Schirach noch am 9. April zum Kampf bis zum letzten Mann auf, setzt sich selber aber ab.
Deutsche Verbände zogen sich hinter den Donaukanal zurück, sprengten Brücken und überließen den Rotarmisten das Innere Wiens. Da diese einen Hinterhalt befürchteten, drangen sie langsam von Haus zu Haus und Häuserblock zu Häuserblock vor, unterstützt durch Bombardements sowjetischer Tiefflieger und Panzergefechte.
S. 108
Von Südwesten trommelt der Feind schon den ganzen Tag mit allen Batterien über die Buben hinweg in die Radialstraßen zum ersten Bezirk hinei…
S.113
Der Panzer macht einen Satz nach vorn. Einen Augenblick später detonieren die Mine und die Handgranate in einem einzigen betäubenden Knall, der zwischen den Häusern widerhallt. Der Motor des Panzers heult auf, das Gefährt wendet sich nach rechts und rattert die Straße hinunter in den schwarzen Qualm des abgeschossenen T 34 hinein. …
Hoch oben das Rumoren eines Flugzeuges in dem von dünnen Gewölk überzogenen Himmel, auch dieses Geräusch bis zur Irrealität gedämpf…
Obwohl die meisten Österreicher sich nach einem Ende des Schreckens sehnten, waren fanatische Nationalsozialisten bereit, Verräter (und Plünderer) gnadenlos zu erschießen. S. 106
- Die sollen ihn erschießen, schnauzt der Fähnleinführer: Du siehst doch, was das für einer is…
- Man könnte ihm in die Hosen hineinschießen, schlägt Peter vor zur Wiedergutmachung dafür, dass er den Plünderer vor den Russen warnen wollt…
Am 6. April war der Generalangriff von der Roten Armee eröffnet worden, am 10. April folgte die Eroberung der Stadt, am 12. April drängten die Sowjettruppen deutsche Verbände vom Donaukanal ab und am 14. April verließen die letzten deutschen Truppen, die noch das Nordufer der Donau gehalten hatten, das Stadtgebiet. Ein großes Schrecknis für die Wiener: Der Stephansdom fiel einem Brand zum Opfer.
S.115
Seine gelegentlichen Blicke zurück auf die Stadt, von der man nicht viel wiederfinden wird, wenn der Krieg noch eine Weile mit der momentanen Wut voranschreite…
Dass die Stadt keineswegs deshalb rücksichtsvoll und gebäudeschonend erobert werde, weil Österreich das erste Opfer der Hitlerschen Aggression war …
Das Fazit: In 52 Luftangriffen starben 8000 Menschen, 21000 Gebäude wurden zerstört, eine Wiener Judengemeinde existierte nicht mehr und viele der an Hitlers
Gewaltherrschaft Beteiligten entgingen der gerechten Bestrafung durch Selbstmord, aus Angst zur Verantwortung gezogen zu werden. „Die Rückkehr zur Demokratie, zu geordneten Verhältnissen musste in unerreichbarer Ferne erscheinen.“ 236
Doch rasch bildete sich eine Zivilverwaltung. Über die Neuorganisation und Maßnahmen, um Österreichs Wiederaufbau zu sichern, berieten jetzt führende Funktionäre aus den jahrelang verbotenen Parteien, aus denen nun die Parteien SPÖ und ÖVP als neugegründete politische Organisationen hervorgingen. Generalleutnant Blagodatow forderte einen Bürgermeister von Seiten der früheren demokratischen Parteien. Auf Vorschlag der Sozialdemokraten wurde es der ehemalige k.k. Oberst Theodor Körner, und nun organisierte man nach dem Prinzip der alten Verfassung die Stadtverwaltung neu.
Doch ohne Zustimmung der Besatzungsmacht konnten die Probleme der Versorgung und des Wohnraums nicht angegangen werden. Bereits 1944 hatten die Alliierten die Teilung Wiens entschieden und besiegelten diese am 9. Juli 1945 in der Unterzeichnung des Alliierten Zonenabkommens. Oberste Behörde der Besatzungsmacht war der Alliierte Rat, ihm war die interalliierte Kommandantur als eigentliche Regierungsbehörde unterstellt, und ihr mussten alle Gesetze und Verordnungen vorgelegt werden.
Bei den Gemeinderatswahlen im November 1945 erhielt die SPÖ die absolute Mehrheit, die KPÖ bekam 6 Mandate und aus Gründen der Diplomatie das Kulturressort zugesprochen.
Die Nachkriegsjahre in Wien waren geprägt von einer schwierigen Wirtschaftslage: Schwarzhandel, Hamsterfahrten und eine hohe Kriminalität verbreiteten sich, und das Wohnungsproblem vergrößerte sich, weil die Besatzungsmächte eine große Anzahl von Villen und Wohnungen beanspruchten. Die Sozialdemokratie Wiens stellte den sozialen Wohnungsbau in den Mittelpunkt ihres Programms, durch ihn schuf sie Arbeitsplätze und stärkte den Aufbau der Wirtschaft.
Bis in die 50er Jahre erfolgte eine Verbesserung der Lebensumstände.
Richard sinnt über seine Teilhabe an der Entwicklung Wiens nach, als er in den Ruhestand geschickt wird:
S. 201
Er hat für die Arbeit gelebt, Wochen ohne Sonn- und Feiertage, in denen er politisch für das Privatleben der Leute eintrat, während sich bei ihm zu Hause die Niederlagen summierten mit dem Effekt, dass er sich weiter in Richtung Ministerium zurückzog. Dort hat er seit 1948 alles im Rahmen seiner Möglichkeiten gemeistert. Noch in diesem Jahr wird die letzte Gaslaterne in Wien erlöschen, nahezu wöchentlich weiht irgendwo ein Pfarrer ein Transformatorenhäuschen ein. Er, Dr. Richard Sterk, der Römer, hat Turbinenhallen bauen lassen groß wie Opernhäuser. Er hat mitgeholfen, den Platz zu schaffen, den der Wohlstand benötigt, um sich auszubreite…
Die sog. „Österreichfrage“ löste man 1955: Vom 2. bis um 12. Mai tagten die Botschafter erfolgreich im Gebäude des Alliierten Rats am Wiener Schwarzenbergplatz, die Außenminister fixierten den Vertragsabschluss am 14. Mai, die Unterzeichnung des Dokuments folgte am 15. Mai im Marmorsaal des Belvederes.
S. 23
Wegen eines eitrigen Backenzahns waren 1955 die Feiern zur Unterzeichnung des Staatsvertrags für Richard ins Wasser gefallen. Er fehlt auf sämtlichen offiziellen Fotos und in allen Filme…
S. 145
Ich verhandle nicht jahrelang mit den Sowjets, damit meine Tochter in der Zwischenzeit den Verstand verlier…
Die letzten Besatzungstruppen zogen am 25. Oktober 1955 ab, und man feierte die Deklaration der österreichischen Neutralität mit einer großen Festkundgebung im Wiener Konzerthaus mit Delegationen aus allen Bundesländern. Wien war nun wieder die Hauptstadt eines freien und demokratischen Österreichs, und man unterstrich dies mit der Eröffnung von Staatsoper und Burgtheater.
Politisch herrschte von nun an lange Zeit in Wien die „Rathauskoalition“ zwischen SPÖ und ÖVP, die dazu führte, dass Wien als Bundeshauptstadt akzeptiert wurde. Die nun folgende Historie Wiens ist eng verbunden mit der des Staates Österreichs und im dementsprechenden Kapitel nachzulesen.
8.3 Ost -Berlin
Ruges Roman spielt in Ost-Berlin. Der Schriftsteller ist in Babelsberg groß geworden und schreibt von einem Ort „Neuendorf“, ein „augenzwinkerndes Changieren“ zwischen Kleinmachnow, wo er zur Schule ging und Babelsberg.237 Die Wohnung lag in einem zweistöckigen Haus in der Domstraße und hatte eine stattliche Größe von 164 qm. Die Miete war mit 200 Mark zwar sehr hoch, doch seine Mutter entschied, es zu bewohnen. Das eigentliche Haus aus dem Roman, in das seine Mutter so viel Kreativität steckte, ist das Ferienhaus an der Ostsee, ein kleines Haus mit Schilfdach. Eugen Ruge hat es nach der Wende gekauft.
S. 55
Es war die Stille eines abgeschnittenen Ortes, der seit über einem Vierteljahrhundert im Windschatten der Grenzanlagen vor sich hin dämmerte, ohne Durchgangsverkehr, ohne Baulärm, ohne moderne Gartengerät…
S. 31
Sie gingen den Fuchsbau entlang, vorbei an den Nachbarhäuser…
S. 305…
Neundorf, Am Fuchsbau sieben, sagte Kurt und erwartete die Frage, wo das sei: Neuendorf? Fuchsba…
Berlin bzw. die Geschicke Ost-Berlins waren in der Zeit Eugen Ruges eng verbunden mit der Sowjetunion (heute noch sichtbar im Treptower Ehrenmal, bei dem ein zwölf Meter großer Rotarmist ein Kind auf dem Arm hält und ein Hakenkreuz zertritt).
Bereits kurz vor Ende des 2.Weltkriegs 1944 gab es einen Entwurf, der Berlin in Sektoren teilte: Der sowjetische Sektor sollte acht Stadtbezirke umfassen: Pankow, Prenzlauer Berg, Mitte, Weißensee, Friedrichshain, Lichtenberg, Treptow und Köpenick.
Walter Ulbricht prägte das (architektonische Gesicht) der Stadt. Mit Kommunisten, Sozialdemokraten und Nazigegnern bildete er die „Gruppe Ulbricht“. 1946 erfolgte die Zwangsvereinigung von Kommunisten und Sozialdemokraten zur SED, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, deren Kommandozentrale in Ost-Berlin blieb, mit den zentralen Institutionen der Macht, den Ministerien und Behörden.
Am 7. Oktober 1949 verkündete der Deutsche Volksrat die Gründung der DDR. Die Abgeordneten kamen im ehemaligen Gebäude des Reichsluftfahrtministeriums zusammen und wählten Wilhelm Pieck zum Präsidenten der DDR.
Westdeutschland hatte beschlossen, rein deklamatorisch, dass Berlin die Hauptstadt Deutschlands sein sollte. Man ging von einem Groß-Berlin aus, doch schon in kürzester Zeit sprach man in beiden Teilen Deutschlands von Ostberlin/Ost-Berlin bzw. Westberlin/ West-Berlin, mit oder ohne Bindestrich.
Die Zerstörung durch die Bombardierungen und die unzähligen Luftangriffe waren in der Nachkriegszeit allenthalben noch zu sehen.
S. 54
Dann Berlin. Eine abgebrochene Brücke. Zerschossene Fassaden. Dort ein zerbombtes Haus, das Innenleben entblößt: Schlafzimmer, Küche, Bad. Ein zerbrochener Spiegel. Fast glaubte sie, noch die Zahnputzbecher zu erkennen. Der Zug rollte an dem Gebäude vorbei - langsam wie auf einer Stadtrundfahrt. Fast bedauerte Charlotte die Bewohner dieses Landes. Was für ein Aufwan…
Die Versorgung normalisierte sich erst 1948 nach der Blockade: Die erste Verkaufsstelle der HO (Handelsorganisation) wurde im November dieses Jahres in der Frankfurter Allee eröffnet, es folgten weitere neben den teils privaten oder staatlichen Läden, den Verkaufsstellen der Konsum-Genossenschaft und den eröffneten Selbstbedienungsläden.
Das eigentliche Zentrum Berlins lag/liegt hinter dem Brandenburger Tor mit dem überdimensionierten sechsspurigen geschichtsträchtigen Boulevard „Unter den Linden“ und rund um den Alexanderplatz. Freiflächen östlich und südlich davon machten in den Anfängen der DDR den Eindruck einer Einöde, dazwischen standen einige Gebäude, die den Luftkrieg überstanden haben.238
Der Platz war nach den Häuserabrissen und der Verlegung von Straßenzügen viermal so groß wie vor dem Krieg.
In der Friedrichstraße fehlten Häuser, Gras wuchs auf den freien Grundstücken, Baracken mit kleinen Läden oder Lagerräumen klemmten dazwischen. Lücken machten die Straße hell. Hinter dem S-Bahnhof erstreckte sich eine große Brache mit nur einem einzelnen Kiosk, der Blumen verkaufte.239
Berlin sollte als Hauptstadt der DDR eine politische, wirtschaftliche und geistig-kulturelle Sonderstellung haben und das „Schaufenster einer blühenden und fortschrittlichen Gesellschaft werden.“240 So entstand in der Karl-Marx-Allee eine Flaniermeile mit einem reichhaltigen Warenangebot: Es gab Karl-Marx-Buchhandlungen, Bekleidungsgeschäfte, Elektrowaren. „Die sozialistische Welt schien in dieser Straße in Ordnung zu sein.“241 Großzügige Straßenzüge waren ideal für Massenaufmärsche.
Das 1951 in Leben gerufene Nationale Aufbauprogramm, das jedermann aufforderte, drei Prozent des Monatseinkommens ein Jahr lang auf ein Aufbausparbuch zu zahlen, hatte das von der Parteiführung verfügte Ziel, den Ausbau der Stalinallee im Osten der Stadt zu finanzieren. Baustellen entstanden allerorten, neue Stadtteile versprachen moderne Wohnungen.
Ab Januar 1954 richtete die Handelsorganisation (HO) Nachtlokale mit verlängerten Öffnungszeiten in fast allen Stadtbezirken ein, in denen Künstler und Kabarettisten auftraten.
Als Ausflugsziele der Ost-Berliner dienten die Seen im Osten der Stadt mit ihren Ausflugslokalen, ebenso waren das Strandbad Müggelsee, der Tierpark und der Weiße See mit seinen Milchhäuschen und Ruderbooten oder der Orankesee mit seinem Ostseeflair in der näheren Umgebung ein Erholungsort der Hauptstadtbewohner.242
Auffälligster Arbeitsort war das Gaswerk Dimitroffstraße mit seinen markanten Gasometern, das Mitte der 80er Jahre gesprengt und demontiert wurde - es war durch Gaslieferungen aus der Sowjetunion entbehrlich geworden.
Über die Sektorengrenze kamen bis zum Mauerbau Besucher zum Einkauf aus dem Westen, weil der Wechselkurs günstig war. Ostberliner dagegen gingen im Westen arbeiten, weil die hohen Stundenlöhne lockten, z.B. Putzkolonnen für die Büros und Privatwohnungen, ebenso besuchten Schüler westliche Konfessionsschulen.
Als 1960 die Anziehungskraft West-Berlins viele DDR-Bürger zur Abwanderung bewegte, wurde der politische Druck groß und man entschied sich, dies mit Gewalt zu unterbinden: durch Stacheldraht und den Bau der Mauer. Das Zentrum der Stadt Berlin bildete nun auch den Rand und machte „die Grenze fast überall präsent [..], wenngleich sie mit den Jahren den Blicken immer weiter entzogen war. Jedenfalls von der Ostseite her.“243
Das erste Passierscheinabkommen wurde im Dezember 1963 unterzeichnet und ermöglichte West-Berlinern den Besuch der Verwandten über die Feiertage, es folgten weitere. Ab diesem Zeitpunkt gab es in den Stadtbezirken an der Mauer eine enorme Dichte an Kontroll- und Überwachungsinstanzen. Die Mauer wurde ein wichtiger Imageträger der Metropole Berlin.244
Wohnraum musste her: Die SED Führung entschied sich für großflächige Lösungen im Zentrum und „dafür nahm sie auch den Abriss von intakten Gebäuden in Kauf.“245 Wohnhäuser gruppierte man um hohe repräsentative Gebäude, es entstanden Stätten der Bildung, der Kultur und des gehobenen Konsums. Spezifisch für den DDR-Architekturstil waren große Wandmosaike und Kunst am Bau. Ein „Haus des Lehrers“, das zwischen 1961 und 1964 errichtet wurde, ist ein Beispiel für die entstehende industrielle Bauweise mit ihren Glas- und Aluminiumteilen und einem hohen Wandfries aus Keramikelementen.
Den Straßenzug Unter den Linden erweiterte man in den 60er Jahren zu einem Platz, das sechsgeschossige Interhotel dort war für ausländische Gäste gedacht. 1966 eröffnete das Lindencorso mit gastronomischen Einrichtungen, z.B. dem legendären Szenecafe „Espresso“, der Treffpunkt der (Lebens)Künstler und Intellektuellen Unter den Linden, Ecke Friedrichstraße. In dessen Umkreis befanden sich die Universität mit ihren Instituten und Buchhandlungen.
Ein besonderes Bauprogramm begann rund um den Alexanderplatz, der zwanzig Jahre später in den schicksalhaften Tagen im Oktober 1989 im Mittelpunkt der großen Demonstrationen und des politischen Umbruchs stehen sollte. Das eigentliche Zentrum legte man still, riss vieles ab, darum herum entstanden Großbauten wie das CentrumWarenhaus, das Hotel Stadt Berlin. „Der neue Alex wurde eine Utopie aus Glas, Stahl und Beton, ein Stadtraum für Großinszenierungen, wo der Einzelne in der Masse unterging.“246 Die dortige Weltzeituhr galt als ein beliebter Punkt für Verabredungen.
S. 304
-Wo gehen wir eigentlich hin, frage Sascha. Sie standen jetzt vor der Weltzeituhr. In New York war es halb eins, in Rio halb vier. Ringsum ein paar verfrorene Gestalten, die sich leichtsinnigerweise trotz der Kälte hier verabredet hatten: war ein beliebter Treffpunkt, die Weltzeituhr, als spürte man hier etwas von der großen, weiten Wel…
Berlin-Karlshorst war Sperrgebiet, dort beanspruchten die sowjetische Armee und der KGB ein großes Areal für sich, quasi das Regierungsviertel für die Sowjetische Besatzungszone (SBZ).
In den 50er Jahren kam das Ministerium für Staatssicherheit der DDR hinzu. „Zahlreiche deutsche Neu-Karlshorster arbeiteten in staatlichen oder staatsnahen Einrichtungen und lebten im Einklang mit den gesellschaftlichen Verhältnissen in der DDR. Für sie gehörte die ,deutsch-sowjetische Freundschaft’ zum Stadtteilleben dazu.“247 Die Lebensqualität war hoch, die Events auf der Trabrennbahn zogen viele Ausflügler an, Schrebergärten blieben trotz mancher Abrisse eine prägende Erscheinung in diesem Stadtviertel und machten Karlshorst zu einer „glücklichen Insel im Grünen“.248
Im Buch gibt Kurt anlässlich einer Sitzung im Institut seinen Eindruck von Berlin in den 60er Jahren wieder:
S. 177
Von der Friedrichstraße aus waren es nur noch fünf Minuten zu Fuß. Das Institut lag schräg gegenüber der Universität in der Clara-Zetkin-Straße, eine ehemalige Mädchenschule, gebaut in der Gründerzeit, Sandsteinfassade, von Kohlenruß mit den Jahren geschwärzt und noch immer, auch zwanzig Jahre danach, gezeichnet von Einschusslöchern aus den letzten Kriegstage…
Treffpunkte der sog. „Gammler“ war der Bahnhof Lichtenberg zwischen den Bahnsteigen, der Stadt stets ein Dorn im Auge; die „Mokka-Milch-Bar“ in der Karl-Marx-Allee galt als ein bekannter Versammlungsort der Jugend.
„Die aus dem Prenzlauer Berg waren stolz auf ihren Wasserturm, die Gasometer und den kleinen Friedhof hinter der Schule(...), die aus Friedrichshain, die prahlten mit dem Bunkerberg und der Knochenrodelbahn im Winter. Was war das schon im Vergleich zum Fernsehturm?“ 249 Zum 20. Jahrestag der DDR nahm der Fernsehturm seinen Betrieb auf. Er war im Vergleich zum konkurrierenden Funkturm in West-Berlin, wesentlich höher, ja, mit seinen 368 Metern das höchste Gebäude Deutschlands. Auf ihn mit seiner glänzenden Kugel und dem Restaurant können Besucher seit 1969 hoch fahren. 250
Seit 1960 residierte der Ministerrat der DDR im Alten Stadthaus am Molkenmarkt, ehemals ein mittelalterlicher Markt, nun durch eine vierspurige Durchfahrtstraße entstellt. Ein wichtiger Ort, denn dort unterzeichneten Vertreter Westdeutschlands und der DDR den Grundlagenvertrag 1972, der die Beziehungen zwischen beiden Ländern regeln sollte. Büros von ARD und ZDF nahmen ihren Betrieb auf, westliche Journalisten akkreditierten sich im Ostteil. Um am Ost-West-Verkehr zu verdienen, eröffnete man Intershops am Bahnhof Friedrichstraße. Als ab dem Jahre 1974 die DDR- Bürger ausländische Währungen besitzen durften, schossen in der ganzen Republik diese Wellblech-Container aus dem Boden, der größte mit mehreren Stockwerken war der im Hotel Metropol in der Ost-Berliner Friedrichstraße. In ihm gab es unzählige Statusartikel, z.B. die beliebten Levis Jeans, zu kaufen.
Das Stadtbild der Potsdamer Altstadt in den 70er Jahren beschreibt Eugen Ruge aus Alexanders Sicht:
S. 221
Aber es genügte, wenige Schritte von der Hauptachse abzuweichen, und man befand sich in einer ganz normalen, das heißt verfallenen Straße mit ursprünglich hübschen, zweistöckigen Wohnhäusern, deren Fassaden nun grau und schwarz und von aus löcherigen Dachrinnen tropfenden Regenwasser gescheckt waren. Hier und da konnte man im Putz, sofern vorhanden, sogar noch Einschüsse aus den letzten Kriegstagen erkennen…
Ein wichtiges Großereignis waren die X. Weltfestspiele in Ost-Berlin 1973, zu dem westliche und östliche Jugend-Gruppen sich trafen, miteinander diskutierten und feierten. Partei und Staatssicherheit bereiteten sich langfristig vor, die Doppelstrategie war höchstmögliche Sicherheit und Kontrolle bei Wahrung des Scheins von Weltoffenheit - und diese ging auf.251 Die Eröffnungsfeier fand im Stadion der Weltjugend, ehemals Walter- Ulbricht-Stadion, statt,
Nach Ulbrichts Ablösung durch Honecker änderte sich die Baupolitik. Die Imagekampagne des Staates, 1976 als Beschluss auf dem IX. Parteitag manifestiert, beinhaltete städtebauliche Maßnahmen wie den Bau des Palasts der Republik, das Sport- und Erholungszentrum in der Landsberger Allee, Plattenbausiedlungen und die privilegierte Versorgung mit Nahrungs- und Konsumgütern.252 Der „Palast der Republik“: ein 180 m langer Kolossalbau mit 8000qm bronzefarbenen Glasscheiben, einem großen Saal, dem Plenarsaal der DDR-Volkskammer, mit Theater, Restaurants und Cafés, er bot Freizeitmöglichkeiten für die ganze Familie.253 Der Abriss erfolgte zwischen 2006 und 2008, für ihn hat man das alte Berliner Schloss und das heutige Humboldt- Forum errichtet. Der Wohnungsbau und die Bedürfnisse der Menschen standen von jetzt an im Vordergrund.
Stadtbezirke spiegeln Lebensentwürfe wieder wie „Jahresringe der Stadtentwicklung“ 254: in der Innenstadt Mietshäuser aus der Zeit um 1900, der Industrielandschaft folgten städtische Villen von 1900 in Karlshorst, Köpenick und Friedrichshagen, dann kamen Kiefernwälder, Vorstadtsiedlungen mit Einfamilienhäusern und Gärten, nicht weit davon Wälder und Seen, am Dämeritzsee begehrte Wassergrundstücke und die Laubengegend mit vielen Kanälen.
Städtebaulich gesehen gab es sehr unterschiedliche Milieustrukturen und es fanden sich durchaus Intellektuelle Lebensstile im mondänen Pankow, im idyllischen Köpenick und in den Luxusplattenbauten der Innenstadt. 255.
Das Wohnungsproblem war wie in der ganzen DDR auch in Berlin stets das Thema Nr. 1. Im Nordosten von Berlin entstand im Rahmen des „komplexen Wohnungsbauprogramm“ von 1977 das neue Wohngebiet in Marzahn, als „Wohnen in der Platte“ bekannt: große Wohnensembles mit neuen Plattenbauten und moderner Grundausstattung stellten für manche Bewohner eine wesentliche Verbesserung ihrer bisherigen Wohnsituation im Altbau dar. 256 Die Infrastruktur beinhaltete Kinderkrippen, Schule, Kaufhalle und Poliklinik, alles fußläufig zu erreichen, Schnellstraßen durchzogen das Gebiet. Gleiches geschah im benachbarten Hohenschönhausen. Wer so nicht leben wollte, versuchte durch Tauschaktionen, in ein schönes Altbauviertel in Weißensee oder Pankow zu kommen.
Ein ganz besonderes Lebensgefühl repräsentierte der Prenzlauer Berg:257 kein Arbeiterviertel, stattdessen ein Ort mit maroden Gründerzeitfassaden. Dorthin zog ein gemischtes Publikum: Studenten, junge Familien, Künstler. Der Verfall machte es zum Szeneviertel, man zog in leerstehende Ladenwohnungen, die nicht zu vermieten waren und besetzte Altbauwohnungen; durch die Anmeldung bei der Polizei und eine dreimonatige Mietzahlung bei der KWV folgte dann die Legalisierung. Prenzlauer Berg stand für eine Subkultur, deren Anführer Sascha Anderson war, und wurde bald zum Mythos. Alexander wohnt dort nach der Trennung von seiner Frau:
S. 290
Haus Nummer 16 schien unbewohnt zu sein. Falsche Adresse? Die Tür stand offen. Kurt passierte einen ruinösen Hausflur. An der Decke die Reste von Blumenreliefs. Dornröschenschla…
Uralte Schilder: Hausieren verboten…
Kurt betrat eine leere Wohnung. Er nahm kaum Einzelheiten wahr - es gab kaum Einzelheiten. Ein brutal kahler Flu…
- Hast du eine Zuweisung oder so was? Sascha lachte, schüttelte den Kop…
- Und wie kommst du hier rein? Woher hast du den Schlüsse…
- Ich hab ein neues Schloss eingesetz…
- Du willst sagen, du bis hier eingebroche…
- Vater, die Bude steht leer. Da kümmert sich kein Mensch dru…
In den 80er Jahren regte sich Widerstand in der Bevölkerung: Man forderte eine behutsamere Umgestaltung und Erneuerung mit der Rückbesinnung auf die Geschichte und der Erhaltung des baulichen Erbes. Die Ost-Berliner sensibilisierten sich für ihr historisch gewachsenes Umfeld, für verborgene Zeugnisse der eigenen Geschichte, wie z.B. Orte des jüdischen Lebens, Spuren der Arbeiterkultur, traditionelle Orte großstädtischen Vergnügens und der reichen Industriegeschichte ihrer Stadt.
Alte Stadtviertel wurden saniert, es entstanden kleine Kaffeehäuser in den Altstadthäusern, einen hohen Bekanntheitsgrad hatte die Milchbar und die „Mokkabar“.
Es gab in Ost-Berlin der 80er Jahre mehr als 1200 gastronomische Einrichtungen, teils staatlich, teils privat geführte Bars und Tanzlokale, wo strenge Etikette herrschte: So musste der Herr Krawatte tragen.258
Eine „neue Gemütlichkeit“ entwickelte sich in der historisch wieder errichteten Husemannstraße in Prenzlauer Berg . Man sanierte das Viertel am Akonaplatz und eröffnete kleine Läden, historische Kneipen und das Museum „Arbeiterleben um 1900“.
Ein großes Projekt war die „Sonderbaumaßnahme“ Nikolaiviertel zum 750. Jubiläum der Gründung Berlins, ein finanzieller Kraftakt: Rehistorisierung von Wohnungen und ein Altstadtviertel mit Gaststätten, Kaffeehäusern und kleinen Läden machten das Viertel nun zum Touristenziel. Berlins ältestes Gotteshaus, die Nikolaikirche, wurde als ein staatliches Museum wiedererrichtet.
Nicht alle waren begeistert: Die Ausgaben sorgten für Unmut in der DDR. Wieder einmal wurde Berlin zum scheinbaren Überfluss-Viertel, um nach außen repräsentabel zu wirken. In der Provinz dagegen fühlte man sich vernachlässigt.
Ost-Berlin zog nun junge Leute an. Es hatte das Image der Szenestadt, die Versorgung und die Einkaufsmöglichkeiten waren besser, Löhne und Gehälter höher als im Rest der Republik und es gab ein attraktives Kulturangebot.
Viele alte Kirchen in den Altbauvierteln Berlins waren, auch wenn sie der Renovierung bedurften, Orte, in denen sich Predigt, Musik und politische Kultur vollzogen. Bekannt wurden einige davon durch Oppositionsveranstaltungen Ende der 1980er Jahre: die Erlöserkirche in Berlin-Lichtenberg, die Samariterkirche im Bezirk Friedrichshain oder die Zionskirche in Berlin-Mitte. Die Gethsemanekirche im Prenzlauer Berg war das Zentrum der demokratischen Bewegung, dort hielt man Mahnwachen ab, Mitglieder lagerten auf Matratzen vor dem Altar und begannen mit Hungerstreiks.
S. 273
- Aber ihr kommt doch heute Abend zur Friedensandacht, sagte Klau…
- Mal sehen, ob wirs schaffen, sagte Mudde…
- Das ist aber schade, rief Klaus ihnen hinterher. Gerade heut…
In der Silvesternacht zogen Ostberliner stets zum 78 m hohen Bunkerberg im Volkspark Friedrichshain, benannt nach dem dortigen geschützten Bunker, den man mit Bauschutt aufgeschüttet hatte und von wo man einen weiten Blick über Berlin hatte. Im Winter bot sich auf diesem künstlichen Hügel die Gelegenheit zu rodeln.
Ost-Berlin war auch Industriestadt - das erlebte man im Industriebezirk Oberschönweide - dort hatte in den Hallen der Vorkriegszeit die Planwirtschaft Einzug gehalten259, Werksuhren an den Hauptverkehrskreuzungen erinnerten stets daran.
Überall sichtbar waren die Kleingärten der Ost-Berliner. Sie dienten der Versorgung der Bevölkerung mit Obst und Gemüse. Ihre Bedeutung wurde politisch unterstrichen, als das SED System die Vorzüge der Kleingartenkultur nach dem „Erlahmen des revolutionären
Elans und der Etablierung des Systems“ erkannte.260 Seit 1963 gab es in den Schulen der DDR das Unterrichtsfach Schulgarten.
Eine Art propagandistischer Leuchtturm für den Breiten- und Freizeitsport wurde das 1981 errichtete Sport- und Erholungszentrum in Berlin-Friedrichshain, „die damals größte und modernste Freizeitsporteinrichtung Europas“. 261 Der Eintrittspreis war hoch subventioniert und erschwinglich, so dass jedermann Turnhallen, Spaßbad, Saunen, Tischtennishallen nutzen konnte.
„Die heutige Fast-Ruine und der bevorstehende Abriss werden von vielen nicht nur als schmerzlicher Verlust empfunden, sondern sogar, wie schon beim Palast der Republik, als Teil von Bestrebungen gewertet, die positiven Erinnerungen an das Leben in der DDR für immer auszulöschen.“262
Nach der Maueröffnung konnte man über den früheren Checkpoint gehen, der Grenzübergang Chausseestraße war offen, Mauer, Militärparaden Volkspolizisten waren verschwunden.
„Ost-Berlin ging ein ins Reich der Mythen, Legenden, Erzählungen, Anekdoten und Verklärungen.“263 Heute gilt Berlin als die Metropole der unbegrenzten Möglichkeiten und der grenzenlosen Freiheit.
Architektonische Relikte der ehemaligen DDR-Hauptstadt sind noch überall in der Stadt zu finden.
9. Das Haus als bürgerliche Wohnstätte - Standort und Wohnkultur
Wer auf die Welt kommt, baut ein neues Hau…
Er geht und lässt es einem zweite…
der wird sich's anders zubereiten, und niemand baut es au…
Johann Wolfgang von Goet…
Quelle: J.W. v. Goethe, Gedichte, west-östlicher Divan, Buch der Sprüc…
Vom Land über die Stadt zum Haus - alle drei Örtlichkeiten sind in unseren Familienromanen konkretisiert und haben Einfluss auf Leben und Wirken der Familienmitglieder.
Das eigene Haus hatte im Bürgertum eine große Relevanz. Es war ein Synonym für Besitz und Eigentum und für eine bürgerliche Familie zwingend erforderlich.
In den Jahrhunderten zuvor sprach man von einem „Haus“, wenn es sich um das Eigentum der Familie handelte, implizierte aber gleichzeitig damit Familienangehörige aus mehreren Generationen und das engere Personal, das dort wohnte. In einem patriarchalisch-hierarchischen Verhältnis zeigte sich die Denk- und Lebensweise des „ganzen Hauses“ .
Der Kulturwissenschaftler Wilhelm Heinrich Riehl, Professor für Kulturgeschichte in München von 1854 bis1892, verband die „ganze Familie“ mit dem „ganzen Haus“ und bewertete dies sehr positiv:
„Die moderne Zeit kennt leider fast nur noch die „Familie“, nicht mehr das „Haus“, den freundlichen, gemütlichen Begriff des ganzen Hauses, welches nicht bloß die natürlichen Familienmitglieder, sondern auch alle jene freiwilligen Genossen und Mitarbeiter der Familie in sich schließt, die man vor Alters mit dem Wort „Ingesinde“ umfaßte. In dem „ganzen Hause“ wird der Segen der Familie auch auf ganze Gruppen sonst familienloser Leute erstreckt, sie werden hineingezogen, wie durch Adoption, in das sittliche Verhältnis der Autorität und Pietät.“264
9.1 Bürgerliches Wohnen im 19. Jahrhundert bei den Buddenbrooks
Eine gewisse Ähnlichkeit dazu findet sich im Roman von Thomas Buddenbrook: Er beginnt mit der Einweihung des Hauses, einem Bürgerhaus, in dessen Innenräumen ein Großteil des Romans spielt. Es ist nicht mehr der Verband des „ganzen Hauses“, jedoch sind Familie und Firma räumlich nahe, die Comptoirräumlichkeiten sind im Untergeschoss des Wohnhauses, durch dessen Diele die Transportwagen passieren können. Die Angestellten, das Gesinde, sitzen nicht mit der Familie an einem Tisch, die Familie bleibt unter sich, bis auf das Kindermädchen Ida Jungmann, das quasi zur Familie gehört.
In einer Kaufmannsfamilie des 19. Jh. waren Hausbesitz und der Sinn für Häuslichkeit selbstverständlich. Es existierte eine enge Verflechtung von Arbeiten und Wohnen - ebenfalls bei Ärzten und Juristen, Freiberuflern und Pfarrern - der Arbeitsplatz war im Wohnhaus integriert und das Verhältnis zum Dienstpersonal aufgrund eines lang bestehender Arbeitsverhältnisses stark persönlich geprägt.
Stets zeigte sich in der Wahl des Hauses und der Ausstattung der Zimmer, allgemein im Wohnstil, das Selbstverständnis des Bürgertums, seine materielle Situation und die jeweilige gesellschaftliche Konvention. Man orientierte sich stadtnah, in großzügigen Vorstadthäusern, wie Thomas Buddenbrook, oder -Villen wie die der Sterks bei Arno Geiger. In Lübeck entwickelte sich ebenso wie in Wien eine soziale Segregation bürgerlicher Wohnquartiere, „man wohnte“ in einer bürgerlichen Straße mit Statussymbolik: Lage, Größe und Art des Hauses sagten etwa über den sozialen Status der Familie aus und spiegelten das Selbstbild der jeweiligen Familie wider.
Zu Beginn des Buddenbrooks-Romans erfolgt der Umzug der Familie aus einem „kleinen Haus in der Alfstraße“, einem typischen Händlerhaus am Hafen, das eingeengt von Nachbarhäuschen und von hohen Grenzmauern umschlossen war, in ein Haus der ersten Adresse Lübecks in der Mengstraße, Es liegt in der Nähe der St. Marienkirche und führt abschüssig zur Trave hinunter. Der eigentliche Wohntrakt befindet sich im angeschlossenen zweistöckigen Seitenflügel, hinter dem Hof schließt sich der Garten mit dem Gartenhaus an, ein Gartenzimmer gehört zum neuen Stil, man wohnt im Sommer „auf dem Garten“, ein Speicher begrenzt einen zweiten Hof.
Dieses Haus ist weitaus herrschaftlicher und größer zugeschnitten als das bisherige, Durchgangszimmer verschwanden, Zimmer werden separat vom Flur aus erschlossen, so dass eine Unabhängigkeit und Abschirmung und ein Schutz der Intimsphäre des Einzelnen entsteht. Dies gab auch Anlass zur Kritik: Riehl war der Auffassung, dass die Spezialisierung der Zimmer für die einzelnen Familienangehörigen und die immer seltener werdenden Gemeinschaftszimmer die Familie zerstörten.265
S. 10
Man saß im „Landschaftszimmer“, im ersten Stock des weitläufigen alten Hauses in der Mengstraße, das die Firma Johann Buddenbrook vor einiger Zeit käuflich erworben hatte und das die Familie noch nicht lange bewohnt…
Durch eine Glastür, den Fenstern gegenüber, blickte man in das Halbdunkel einer Säulenhalle hinaus, während sich linker Hand vom Eintretenden die hohe, weiße Flügeltür zum Speisesaale befan…
S. 37
Rechts führte die Treppe in den zweiten Stock hinaus, wo die Schlafzimmer des Konsuls und seiner Familie lagen; aber auch an der linken Seite des Vorplatzes befand sich noch eine Reihe von Räumen. Die Herren schritten rauchend eine breite Treppe mit dem weißlackierten, durchbrochenen Holzgeländer hinunte…
„Dies Zwischengeschoss ist noch drei Zimmer tief,“ erklärte er, „das Frühstückszimmer das Schlafzimmer meiner Eltern und ein wenig genutzter Raum nach dem Garten hinaus, ein schmaler Gang läuft als Korridor nebenher…
Im Rückgebäude, über einen zweiten Hof zu erreichen, ist im ersten Stock der Billardsaal untergebracht:
S. 38
… woselbst der Konsul seinen Gästen die weiße Tür zum Billardsaal öffnet…
In diesem Wohn- und Geschäftshaus gibt es keine Trennung zwischen Privat- und Erwerbssphäre, und wie bereits im Mittelalter ist die Diele ein Arbeits- und Durchgangsraum. Arbeitssphäre und Wohnbereich berühren sich, typisch für das Haus eines frühbürgerlichen Großkaufmanns; Diele, Comptoirräumlichkeiten, finden sich im Erdgeschoss, auf der Haupttreppe gelangt man in das o.g. erste Stockwerk mit seinen Wohn- und Repräsentationsräumen. Der „wirtschaftliche Unterbau“ wird durch den „kulturellen Überbau“ ergänzt.266
Konsul Buddenbrook informiert bei der Einweihung seine Gäste darüber:
S. 37f
„.Ja, sehen Sie, die Diele wird von den Transportwagen passiert, sie fahren dann durch das ganze Grundstück bis zur Beckergrube.…
Die weite, hallende Diele, drunten, war mit großen, viereckigen Steinfliesen gepflastert. Bei der Windfangtüre sowohl wie am anderen Ende lagen Comptoirräumlichkeiten…
… Dort führten schlüpfrige Stufen in eine kelleriges Gewölbe mit Lehmboden hinab, das als Speicher benutzt wurde, und von dessen höchsten Boden ein Tau zum Hinaufwinden der Kornsäcke herabhin…
S. 156
Drei mächtige Transportwagen schoben sich soeben dicht hintereinander durch die Haustür, hoch bepackt mit vollen Kornsäcken, auf denen in breiten schwarzen Buchstaben die Firma „Johann Buddenbrook“ zu lesen war. Mit schwerfällig widerhallendem Gepolter schwankten sie über die große Diele und die flachen Stufen zum Hofe hinunte…
Im Laufe des 19.Jahrhundert änderte sich der Wohnstil: Familien- und Produktionsbereich teilten sich, es entstanden reine Wohnhäuser ohne Zimmer für das Personal oder für entferntere Verwandte. Das wesentliche strukturelle Merkmal der bürgerlichen Wohnkultur wurde die Dreiteilung in Wirtschaftsbereich (Hof, Küche, Waschhaus), repräsentativen Wohnbereich (Empfangs- und Gesellschaftsräume) und Schlafbereich.
Anstelle der Gemeinschaft im „ganzen Haus“ , die sich im Wohnzimmer abgespielt hatte, kam es nun zur Vereinzelung mit Zimmern für Personen und für bestimmte Zwecke (Arbeits- Kinderzimmer etc.)267; um den Familienzusammenhalt und die Gemeinschaft aber weiterhin zu stärken, führte man Familientage ein.
Der Roman zeigt in diesem Zusammenhang, wie sehr der Bürger vom Drang nach Aufstieg beherrscht war und unter dem gesellschaftlichen Zwang stand, ein großes Haus zu führen. Bei einem beruflichen Karrieresprung fand als Aufstiegsindiz der Umzug der Bürger in ein größeres Haus und in eine bessere Wohngegend statt. Der biographische Bezug zu Thomas Mann ist an dieser Stelle unübersehbar: Johann Siegmund Mann jun. kaufte ein Haus 1841, 1863 übernahm sein Sohn Thomas Johann Heinrich Mann das Geschäft mit Sitz in der Mengstraße, verlegte den Geschäftssitz 1883 in die Beckergrube 52, in das große Haus im Neorenaissance-Stil, wo Thomas Mann und seine Geschwister die Jugend verbrachten. Die Tante von Thomas Mann blieb im Wohnhaus in der Mengstraße, die Kontorräume wurden vermietet.
Thomas Buddenbrook baut 1864 ein reines Wohnhaus und separierte die Erwerbsarbeit von der Familie. Dass er individuelle Einflussmöglichkeiten auf die Planung des Hauses hat und sich die Beauftragung des Architekten leisten kann, zeigt seinen hohen materiellen Standard.
Er adaptiert eine dem Adel ähnliche Wohnform mit einer ganzen Zimmerflucht von Bade- und Schlafzimmer, Kinderzimmer, Speise-, Wohnzimmer, einem luxuriösen Salon und einem Saal mit einer ungeheuren Parkettfläche und hohen weinrot verhangenen Fenstern, die auf den Garten hinausblicken (S. 473), einem Rauchzimmer mit angrenzendem Kabinett (S. 471) und einem Musikzimmer für Gerda (S. 421) - alles ein Zentrum von familiärer Intimität und Privatheit. Dies neue Haus ist repräsentativ von der Schwester Tony im Stil des zweiten Rokoko mit Pseudo-Renaissanceschmuck eingerichtet worden, u.a. mit schweren Samtportieren und niedrigen Sofas von dem Rot der Portieren.
S. 424f
Herr Voigt übernahm den Bau, und bald schon konnte man Donnerstags im Familienkreise seinen sauberen Riß entrollen und die Fassade im voraus schauen: ein prächtiger Rohbau mit SandsteinKaryatiden, die den Erker trugen,…
… denn auch seine Comptoirs gedachte der Senator in die Fischergrube zu verlegen …
S. 426
… wo über ihr das kolossale Treppenhaus sich auftat, dieses Treppenhaus, das im ersten Stockwerk von der Fortsetzung des gußeisernen Treppengeländers gebildet ward, in der Höhe der zweiten Etage aber zu einer weiten Säulengalerie in Weiß und Gold wurde, während von der schwindelnden Höhe des „einfallenden Lichts“ ein mächtiger, goldblanker Lustre herniederschwebt…
S. 427
Sie passierten den rückwärts gelegenen steinernen Flur, indem sie die Küche zur Rechten ließen, und traten durch eine Glastür über zwei Stufen in den zierlichen und duftenden Blumengarten hinaus … der von hohen, lilafarbenen Iris umstandene Springbrunnen sandte seinen Strahl mit friedlichem Plätschern dem dunklen Himmel entgege…
S. 493
Beim Aufgang zur zweiten Etage bildete der Korridor ein Knie, um sich nun in der Richtung der Saal-Länge bis zur Gesindetreppe hinzuziehen, bei der sich ein Nebeneingang zum Saale befand. Der Treppe zum zweiten Stock gegenüber war die Öffnung zum Schacht der Winde, mit der die Speisen aus der Küche heraufbefördert wurden, und dabei stand, an der Wand, ein größerer Tisch, an welchem das Folgemädchen Silberzeug zu putzen pflegt…
Man muss bedenken, dass dieses Haus für die Kleinfamilie von Thomas, Gerda und Hanno zu einer Zeit des wirtschaftlichen Umschwungs entsteht. Die Geschäfte der Firma laufen immer schlechter, was in der Fehlspekulation bzgl. der Pöppenrader Ernte gipfelt, so dass sich in der fehlenden Einbindung der Familie in den Produktionsprozess auch eine Flucht Thomas’ vor der Berufssphäre ausdrücken kann.
Hageström hat nach seinem wirtschaftlichen Erfolg den Wunsch, das großbürgerliche Haus der Buddenbrooks zu kaufen.
S. 600
Die Leute sind emporgekommen, ihre Familie wächst,. Aber es fehlt ihnen etwas, etwas Äußerliches, worauf sie bislang mit Überlegenheit und Vorurteilslosigkeit verzichtet haben ..Die historische Weihe, sozusagen, das Legitime. Sie scheinen jetzt Appetit danach bekommen zu haben, und sie verschaffen sich etwas davon, indem sie ein Haus beziehen wie dieses hie…
S. 602
„Raum! Mehr Raum!“ sagte er. „Mein Haus in der Sandstraße. Sie glauben es nicht, gnädige Frau, und Sie, Herr Senator. Es wird uns effektiv zu eng, wir können uns manchmal nicht mehr darin rühren…
Der räumliche Bereich der Wohnung selber als das Zentrum des menschlichen Familienlebens wandelte sich seit dem Mittelalter im baulich-räumlichen Bereich und veränderte das häusliche und soziale Zusammenleben.
„Das Wohnen war in einem langen Wandlungsprozeß zu einem von der Erwerbsarbeit und dem Bereich der Öffentlichkeit separierten Verhaltensbereich geworden, der so etwas wie eine ,kulturelle Eigendynamik' entwickelt hatte - eine Eigendynamik, die sich im Assoziationsfeld der Begriffe ,behaglich' und ,gemütlich' bewegte und die das Wohnen einem Wertesystem unterstellt hatte, das scheinbar abgehoben von der Alltagswirklichkeit war.“268
Im Biedermeier noch standen die sachliche Zweckmäßigkeit und nüchterne Strenge im Vordergrund.269 Verschwendung widersprach dem bürgerlichen Ethos des Sparens, als Bürger wandte man sich gegen die Verschwendungssucht und die Unmoral, die am Hof und beim Adel zu sehen war und stand den aufklärerischen Ideen positiv gegenüber -
Werte wie Sparsamkeit, Fleiß, Rechtlichkeit und Biederkeit wurden hoch geschätzt und Schlichtheit im Wohnstil betont. Typisch und zentral in der Wohnung war für diese Zeit ein Tisch, um den sich die Familie in mehreren Generationen versammelte, die Fenster von duftigen weißen Musselinvorhängen umrahmt und ein Nähtisch für die Frau des Hauses mit Schubladen mit vielen Utensilien.
Dieser Biedermeiergeschmack zeigt sich später noch im massigen Buffet und im mächtigen Sofa.
Mit dem Anwachsen der bürgerlichen Schichten und dem Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft bildete sich eine ganz besondere bürgerliche Wohnkultur heraus. Soziale Distinktion und der gesellschaftliche Rang der Familie spiegelte sich in der Eleganz und Distinguiertheit der Einrichtung, steinerne Vortreppen beeindruckten bereits beim Eintreten und führten den Besucher zunächst in den Flur, von dem prächtige Treppenhäuser in den oberen Bereich führten.
Das Haus teilte sich in einen Bereich der Rekreation und einen der Repräsentation: Bei Gesellschaften, in denen stets nur die eigene Bezugsgruppe eingeladen wurde, machte man die prunkvoll ausgestatteten Salons, Herren-, Speise- und Wohnzimmer den Gästen zugänglich. Diese Räume zum Feiern und für Familienfeste wiesen zur Straße, während man den Privaträumen der Rekreation den hinteren Bereich zuwies.
Man schuf sich als Voraussetzung einer bürgerlichen Kultur „die Trennung der Lebensbereiche, der Familie von Arbeit und der Öffentlichkeit, die Aufteilung der körperlichen und der kulturellen Funktion auf zweckmäßig bestimmte und eingerichtete Räume, die Vergegenständlichung von Bildung und Besitz in repräsentativen und sinnlichen Eigentum, Stabilität und Identifikation eines Rückzugs- und Distanzbereichs, lange müßige Verweildauer in einer arbeitsfreien Sphäre.“270
Bürgerlich-standesgemäß zu wohnen bedeutete im Laufe des 19. Jahrhunderts ein Herrenzimmer, ein vom Wohnzimmer getrenntes Speisezimmer, getrennte Schlafzimmer für Sohn und Tochter zu haben, so dass sich jeder zurückziehen und man Initimität wahren konnte.
Die Separierung von Küche, Arbeits- Wohn, Ess- und Schlafräumen bildete individuelle Sphären für Kinder und Eltern und bedeutete eine „Privatisierung der Kernfamilie“271, die dazu führte, dass sich die Familie eine Privatheit schaffte, in der das Kind einen „mutterfernen“ Bereich ohne elterliche Kontrolle hatte, immer mit der Möglichkeit der Nähe zur mütterlichen Bezugsperson.
Dienstboten hatten nur auf Verlangen Zutritt, dafür sorgten die Klingelzüge in allen Zimmern, die eine Verbindung zum Dienstbotenbereich im Souterrain, in der Nähe der Wasch- und Mangelkammer, hatten. Dem Personal standen eigene winzige Räume zur Verfügung, oft nicht abgeschlossen. Ihr Wirkungsbereich, Küche und Wirtschaftsräume, wurde an den Rand der Wohnung und in den Keller verbannt, damit die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten für Gäste und Hausherrn unsichtbar blieben. Sie dienten dem Personal als Essbereich und als Aufenthaltsraum, bei den Buddenbrooks befanden sich unweit davon die Mädchenkammern:
S. 37
… während die Küche, aus der noch immer der säuerliche Geruch der Chalottensauce hervordrang, mit dem Weg zu den Kellern links von der Treppe lag. Ihr gegenüber, in beträchtlicher Höhe, sprangen seltsame, plumpe aber reinlich lackierte Holzgelasse aus der Wand hervor, die Mädchenkammern, die nur durch eine Art freiliegender, gerader Stieg von der Diele aus zu erreichen ware…
Durch eine hohe Glastür trat man über einige ganz flache, befahrbare Stufen in den Hof hinaus, an dem linkerseits sich das kleine Waschhaus befan…
Tony Grünlichs Villa bei Eimsbüttel besitzt in der oberen Etage Schlaf-, Bade-, Ankleide- und Dienerschaftszimmer (S. 171)
Betrachten wir nun genauer die einzelnen Zimmer dieser Zeit im Haus einer bürgerlichen Familie, wie die der Buddenbrooks:
Da ist zunächst der Salon: der große und repräsentative Gesellschafts- und Empfangsraum im Haus, für Besucher und den Austausch geschäftlicher Angelegenheiten und für den eher distanzierten Kontakt. Der Wandschmuck war je nach Besitzer differenziert: ein repräsentatives Ölgemälde im Salon oder patriotische Darstellungen.
Familie Grünlich blickt von ihrem Holz getäfelten Speisezimmer in diesen Raum:
S. 196
An der entgegengesetzten Seite gestatteten halb zurückgeschlagene grüne Tuchportieren den Durchblick in den braunseidenen Salon und auf eine hohe Glastü…
Im Wohnzimmer fand der familiäre Austausch statt272, es zeigte den künstlerischen Geschmack und die geistigen Intentionen der Eigentümer. In üppiger Größe demonstrierte er mit seiner eleganten Ausstattung eine Zurschaustellung des Lebensstandards und den Wunsch „nach einem Ort des verpflichtungsfreien, entspannten Beisammenseins in der Intimgemeinschaft der Familie.“273 Es befindet sich im Haus von Thomas Buddenbrook im oberen Stockwerk:
S. 299
Ein behagliches Wohnzimmer in grauem Tuche war da, nur durch Portieren getrennt von einem schmalen Salon mit grüngesteiften Rips-Fauteuils und einem Erke…
Ein bedeutsames Möbelstück war der Sekretär, bei den Buddenbrooks im Speisezimmer. Er entstand aufgrund des steigenden Bildungsdrangs der Bürger und war wichtig für geschäftliche und private Korrespondenz oder Einladungen und, wie bei den Buddenbrooks, für Familienpapiere gedacht.
S. 50
Um 9 Uhr, eines Sonntag morgens, saß der Konsul im Frühstückszimmer vor dem großen, braunen Sekretär, der am Fenster stand und dessen gewölbter Deckel vermittelst eines witzigen Mechanismus zurückgeschoben war. Eine dicke Ledermappe, gefüllt mit Papieren, lag vor ihm…
Das Herrenzimmer mit seinen schweren dunklen Prunkmöbeln spiegelte die strikte Rollendifferenzierung des Bürgertums wieder. Porträts von Landesfürsten und antike Szenen offenbarten den Bildungsstand und verzierten dieses Zimmer.
Während sich die männlichen Gäste mit dem Herrn des Hauses nach dem Essen dorthin zurückzogen, plauderten die Damen im Gartenzimmer bzw. im Salon. Dort durfte ein heller Platz zum Handarbeiten für die Damen nicht fehlen.
Im Landschaftszimmer, in dem bürgerliche Familien Gäste empfingen und Gesellschaften gaben, zeigten die Tapeten künstlerisch-dekorative Wirkung mit Bildmotiven aus dem bäuerlichen Milieu des 18.Jh., die Arbeit der Schäfer und Weinbauern idyllisierend, die in ihrem Status ähnlich wie die Blumenhändlerin oder der Student Morton im Roman, im Laufe der Generationen als dem Standes- und Wertebewusstsein einer bürgerlichen Familie gegenüber nicht adäquat angesehen wurden.274
S. 10
Die starken und elastischen Tapeten, die von den Mauern durch einen leeren Raum getrennt waren, zeigten umfangreiche Landschaften. Idylle im Geschmack des 18. Jahrhunderts, mit fröhlichen Winzern, emsigen Ackersleuten, nett bebänderten Schäferinnen, die reinliche Lämmer am Rande spiegelnden Wassers im Schoße hielten oder sich mit zärtlichen Schäfern küsste…
Das Schlafzimmer mit neuen Schlafmöbeln wie einem schlichten Bett, Toilettentisch und Waschgarnituren aus Porzellan trennte den Schlafbereich vom Wohnbereich ab, Dies kam der strengen bürgerlichen Sexualmoral entgegen und war ein Indikator für das neue Scham- und Peinlichkejtsgefühl innerhalb der bürgerlichen Familie.275
S. 299
Dann gingen sie ins Schlafzimmer hinübe…
Es lag zur rechten Hand am Korridor, mit geblümten Gardinen und mächtigen Mahagoni-Betten. Tony aber ging zu der kleinen, durchbrochenen Pforte dort hinten, drückte die Klinke und legte den Zugang zu einer Wendeltreppe frei, deren Windungen ins Souterrain hinabführten: ins Badezimmer und die Mädchenkammer…
Bedeutung erlangt für Thomas mit den Jahren das Kabinett, in dem er viele Stunden verbringt:
S. 613
Eine Tür, die in ein anderes Zimmer zu führen schien, verschloss die geräumige Nische, die in eine Wand des Ankleide-Kabinetts eingemauert war, und in der an langen Reihen von Haken, über gebogene Holzleisten ausgespannt, die Jackets, Smokings, ..hinge…
Kindern räumte man einen Wohnbereich mit eigenen Möbeln und Spielgelegenheiten ein, dies stets in der Nähe des Kindermädchens, denn zu ihm hatten die Kinder oftmals eine engere Bindung und Freundschaft als zur Mutter, die sich durch ihre repräsentierende Rolle von ihnen distanzierte. Der Eigenbereich der Kinder diente dem Schlafen, Spielen und Schularbeiten machen und war ein kombiniertes Schlaf- und Spielzimmer, in dem man Kindern die Möglichkeit gab, Kind sein zu dürfen, sie aber gleichzeitig von dem nach Ruhe und Erholung suchenden Vater fern hielt.276 Kinderzimmerbilder suchte man speziell unter dem Gesichtspunkt aus, dass sie eine Langzeitwirkung hatten und pädagogisch wertvoll waren, z.B. Motive mit moralisierenden Themen.277
Hannos Kinderzimmer im neuen Haus von Thomas Buddenbrook ist ein kleines.
S. 703
Schülerzimmer, kalt und kahl, mit seiner Sixtinischen Madonna als Kupferstich über dem Bette, seinem Ausziehtisch in der Mitte, seinem unordentlich, vollgepfropften Bücherbord, einem steifbeinigen Mahagoni-Pult, dem Harmonium, und dem schmalen Waschtis…
In der Mitte des Zimmers befindet sich ein großer Ausziehtisch (S. 460)
Die „Gleichheit“, die die Bürger in der Französischen Revolution gefordert hatten, trat mit Verspätung in der Wohnkultur hervor und führte zu einer Anpassung aristokratischer Einrichtung an den bürgerlichen Geschmack.278 Die oberste Gesellschaftsschicht wirkte als Vorbild und insbesondere die Repräsentationsräume, in denen gesellschaftliches Leben stattfand, wiesen auf eine Feudalisierung hin und rückten mit ihrer teuren Möblierung und seidenen Tapeten in die Nähe des Adels.
Die Archäologie des 18. Jahrhunderts hatte die Vergangenheit wiederentdeckt und faszinierte die Menschen derart, dass das Prinzip der Nachahmung zu einem Eklektizismus und zur Anhäufung von Stilen führte. Aufgrund der entdeckten Ausgrabungen wie Pompeji, fand der „goût antique“ großen Zuspruch und beeinflusste die Innenausstattungen. Neuerworbener Wohlstand und Macht hießen, dass die Wohnungseinrichtung nicht mehr behaglich sein durfte, Neo-Stile waren von großer Bedeutung. Man kopierte Stilarten der Vergangenheit und adaptierte fremden Geschmack, z.B. hatte die Neo-Gotik eine Vorliebe für Türme, burgenartige Hausfassaden und für die Romantisierung des Hausinneren. Der Charakter des Neo-Rokoko zwischen 1840 und 1860 zeigte sich in schwungvollen Ballustraden und in der Freude an Kurven und Wülsten, an Plüsch und Schwulst.
Der Gründerzeit-Stil ist charakterisiert durch ein verschnörkeltes, teures Interieur mit Ornamenten, luxuriösem Ambiente und teurem Wandschmuck, der Wohlsituiertheit präsentierte.
Gehobene Kreise bevorzugten statt des heimischen Buchenholzes das dunkle Mahagoniholz aus Übersee.
Äußerlichkeiten wurden betont und hatten fast musealen Charakter: So liebte man Wandbespannungen aus Samt und Seide und textile Zutaten wie Quasten und Bordüren. Als Motive im Wandschmuck dominierten Historien- und Genremalerei, Landschaften, dazu mythologische Themen, um die höhere Schulbildung anzusprechen.279
In Ess- und Speisezimmern sah man Gemälde mit Motiven, die Genuss und Vergnügen widerspiegelten, wie z.B. Blumen, Früchte, Musik, Wein, Gesang.
1760 setzte der Stil des Klassizismus in Deutschland ein.280 Er entsprach der reservierten Haltung des nördlichen Deutschlands, wo er die bevorzugte Stilrichtung wurde, und betonte die Ideale der Griechen: „Edle Einfalt und stille Größe“. Das Bürgertum in Deutschland bevorzugte diesen Stil mit seiner symmetrischen Strenge, den Ornamenten und Reliefs in der Raumkunst, die Wände wurden mit antiken Motiven bemalt.
Sämtliche Zimmer strahlten Kühle aus, man bevorzugte die Farbe Weiß wegen des farblichen Vorbilds der Bauten im Altertum, so zu sehen im Speisesaal der Buddenbrooks, in dem gemalte Göttinnen eine aristokratische Selbststilisierung demonstrieren und den Geist des französischen Klassizismus widerspiegeln, vermittelt durch den deutschdänischen Architekten und Designer Joseph Christian Lillie nach Lübeck.
S. 10
Aus dem himmelblauen Hintergrund der Tapeten traten zwischen schlanken Säulen weiße Götterbilder fast plastisch hervor.über dem massigen Büffett, dem Landschaftszimmer gegenüber, hing ein umfangreiches Gemälde, ein italienischer Golf, dessen blaudunstiger Ton in dieser Beleuchtung außerordentlich wirksam wa…
Beim Mobiliar entfernte man Betten aus den Gesellschaftsräumen, denn nun empfing man Gäste im Salon oder im Wohnzimmer. Kleines Mobiliar, wie z.B. Blumentische und Kommoden mit Halbsäulen und Bronzebeschlägen kamen in Mode: S. 10
Außer den regelmäßig an den Wänden verteilten, steifen Armstühlen gab es nur noch einen kleinen Nähtisch am Fenster, und, dem Sofa gegenüber, einen zerbrechlichen Luxus-Sekretär, bedeckt mit Nippe…
Die Repräsentation der Ära Napoleons entwickelte pompöse Dekorationen im Empirestil: klotziges und gewollt-großartiges Mobiliar wie im neuen Haus von Thomas Buddenbrook. S. 299
Es lag das Speisezimmer daran, mit einem schweren runden Tisch, auf dem der Samowar kochte, und dunkelroten, damastartigen Tapeten, an denen geschnitzte Nußholzstühle mit Rohrsitzen und ein massives Buffet stande…
Die Farbe Gold, Bücher- und Kleiderschränke mit Säulen, griechische Tempel und antike Motive - solch eine Monumentalität der Wohnweise sollte Macht und Reichtum widerspiegeln, so wie die Einrichtung im Haus des Konsuls Johann Buddenbrook, und ließ eine distinguierte Atmosphäre entstehen. Reichtum und Prestige zeigen sich in der bürgerlich-luxuriösen Ausstattung der Zimmer, so dass der Weinhändler Köppen ausruft: „.Diese Weitläufigkeit, diese Noblesse...“(S. 21) S. 10
Die starken und elastischen Tapeten, die von den Mauern durch einen leeren Raum getrennt waren, zeigten umfangreiche Landschaften, zartfarbig wie der dünneTeppich…
Im Verhältnis zu der Größe des Zimmers waren die Möbel nicht zahlreich. Der runde Tisch mit den dünnen, geraden und leicht mit Gold ornamentierten Beinen stand nicht vor dem Sofa, sondern an der entgegengesetzten Wand, dem kleinen Harmonium gegenübe…
Von Biedermeier war nichts mehr zu spüren, im Gegenteil, aufwendige Einrichtungen zeigten gestiegen Wohnkomfort und die Relevanz, den Prestigewert zu betonen. Häuslicher Luxus wird zum Wohnstil mit Statussymbolen: S. 16
Herr Hoffstede bewunderte am Sekretär ein prachtvolles Tintenfaß aus Sevres-Porzellan in Gestalt eines schwarz gefleckten Jagdhund…
S. 20
Die schweren roten Fenstervorhänge waren geschlossen, und in jedem Winkel des Zimmers brannten auf einem hohen vergoldeten Kandelaber acht Kerzen, abgesehen von denen, die in silbernen Armleuchtern auf der Tafel stande…
Heute verachtet man die Wohnkultur der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus ästhetischer Sicht und bewertet sie als stillos.
Das Haus war im Bürgertum aber nicht nur Sinnbild des Repräsentationsbedürfnisses, sondern auch ein Symbol der Familie und affektiv hoch besetzt: In ihm zeigte die Familie ihre Einheit und Kontinuität. Sie fand hier ein räumliches und atmosphärisches Refugium gegenüber der modernen Welt mit all ihren Entfremdungstendenzen, eine schützende und abschließende Hülle für die Privatsphäre, einen Ort, in dessen Räumen sich Familiengeschichte abspielte und der Geborgenheit und Liebe versprach.281 Tony Buddenbrooks Trauer beim Verkauf ihres Elternhauses drückt dies aus:
S. 358
Ich wusste einen Ort, einen sicheren Hafen, sozusagen, wo ich zu Hause und geborgen war, wohin ich mich flüchten konnte, vor allem Ungemach des Lebens. ,Mutter‘, sagte ich, dürfen wir zu dir ziehen?' ,Ja, Kinder, kommt'. Als wir klein waren und Kriegen' spielten, Tom, da gab es immer ein ,Mal‘, ein abgegrenztes Fleckchen, wohin man laufen konnte, wenn man in Not und Bedrängnis war, und wo man nicht abgeschlagen werden durfte, sondern in Frieden ausruhen konnte. Mutters Haus, dies Haus hier war mein ,Mal‘ im Leben, To…
Ihr Bruder dagegen argumentiert weniger gefühlsbetont, sondern wirtschaftlich-rational: S. 358
„Ich weiß es ja, liebe Tony, ich weiß es ja Alles! Aber wollen wir nun nicht ein wenig vernünftig sein? Die gute Mutter ist dahin.Es ist unsinnig geworden, dies Haus als totes Kapital zu behalten. ich muss das wissen, nicht wahr?…
S. 600
Um aber auf das Haus zurückzukommen, so hat ja das alte längst kaum noch eine tatsächliche Bedeutung für die Familie, sondern die ist allmählich ganz auf das meine übergegangen. …
In allen Romanen hat das Haus seine Bedeutung als Familiendomizil in seiner sozialen Kontinuität, Räume scheinen „in ihrer Materialität wie Trägersubstanzen von Personen und Geschehnissen, die längst vergangen sind, und für uns die Zeit in unsere Gegenwart zu tragen.“282 Das Haus beschwört Erinnerungen und ist ein Zeugnis der Vergangenheit, die wiederum ein Pfeiler der Gegenwart wird. „Erinnerungsräume“283 als Orte der verschiedenen Generationen zeigen jeweils das Verbindende, in dem jeder ein Teil einer größeren Einheit ist.
Familien wie die Buddenbrooks lebten in diesem Eigentum über mehrere Generationen hinweg und so ist es nicht verwunderlich, dass in bürgerlichen Kindheitserinnerungen - und solche finden wir in den Familienromanen - das Haus stets eine große Rolle spielt. Man erinnert sich positiv an eine bürgerliche Haus-Kindheit und sieht dies nur selten bis gar nicht als Einschluss und Einschnürung.284
9.2 Die Villa der Familie Sterk in Wien
In Geigers Roman wird uns eine ganz spezielles Gebäude vorgestellt: die Villa.
Sie war eine adlige Wohnform und Symbol des Großbürgertums, galt als Zeichen für wirtschaftlichen Erfolg und war durch Romane und Unterhaltungsillustrierten wie „Die Gartenlaube“ zum Traum des kleinen und größeren Bürgertums geworden
In den Gründerjahren entstanden Villengebiete in größerer Entfernung zu Industrie und Proletariat. Ihre Bauweise war straßenorientiert, der Vorgarten reduziert und der Hauptgarten hinter dem Haus. Es gab weite und ausladende Villen, aber auch Häuser mit Grundstücksgrößen von 600 bis 1000 qm.
Um 1900 war die städtische Villa zur „Standardwohnform“ des gehobenen und vermögenden Bürgertums geworden, und es galt in Österreich und Deutschland als modern, in einer Villa zu leben.285
Das reiche Großbürgertum in Wien, bestehend aus hohen Beamten, wohlhabenden Geschäftsleuten, Gelehrten und namhaften Künstlern, schuf ab ca. 1870 Repräsentationsgebäude, die sog. Ringstraßen-Architektur, ihr Merkmal waren Prunkfassaden, monumentale Portale und ein aristokratischer Wohnstil.
Die Villa in Hietzing in Wien ist Kernstück von Philipps Erbe und ein Bindeglied zwischen den Generationen der letzten siebzig Jahre. Die Großeltern hatten sie von ihren Vorfahren übernommen, sie ist ein Symbol der Vergangenheit.
S. 71
Und er? Er hat gesagt, jetzt wird geheiratet. Ein großes Haus. Das war vorhande…
Sie liegt
S. 12
… in dieser befremdlich heilen Gegend aus Villen und unbegangenen Bürgersteige…
Mauern und hohe Hecken schirmen das Gebäude ab und zeigen das Bedürfnis der bürgerlichen Villenbesitzer nach Abkapselung der Familie. Wie in den bürgerlichen Schichten verbreitet, wohnt die Familie mit dem Haushaltspersonal zusammen.
S. 283
Seine Runde entlang der Gartenmauer beginnt er neuerdings im Norde…
Schon die geschwungene Vortreppe ins Haus hat herrschaftlichen und repräsentativen Charakter.
Dort stand in den Anfangsjahren ein Schutzengel, der jedoch durch „vandalierende Jugendliche“ (S. 359) abhanden gekommen war. Der Verlust zeigt den Wandel der Zeit, die Vergänglichkeit und die Veränderung sowohl im Zeitgeist als auch im Geschmack.
Die Kanonenkugel am Geländer verbindet das Leben der Familienmitglieder; ihre Bedeutung und Herkunft stellen ein Familiengeheimnis dar - ein unentbehrliches Motiv in Familienromanen.
S. 51
Auch eine Kanonenkugel hat das Anrecht auf ein Schicksal, das nicht zwangsläufig ereignisreich ist, zum Beispiel, dass sie nie zum Einsatz kam, nie etwas anderes als getragen oder gerollt wurde und schließlich als Zierstück in einem großbürgerlichen Stiegenhaus endet…
Im Inneren der Villa findet sich eine Anzahl von Räumen:
S. 8
Dann stemmt er sich hoch und tritt durch die offenstehende Tür in den Flur, vom Flur ins Stiegenhaus, das im Verhältnis zu dem, was als herkömmlich gelten kann, mit einer viel zu breiten Treppe ausgestattet ist.
S. 12
… die teppichbelegte Trep…
S. 212
… macht Ingrid am Absatz kehrt und biegt ins Nähzimmer ein, vom Nähzimmer ins Herrenzimmer, vom Herrenzimmer ins Speisezimmer und von dort in die Verand…
S. 364
Von dort biegt sie ins Wohnzimmer …
dann geht sie die Kellertreppe hinunter …
S. 217
Sie setzen den Rundgang fort. Anfänglich ist Ingrid auch im oberen Stockwerk wählerisch. Das ändert sich, als die Kinderzimmer an der Reihe sin…
S. 209
Sie saßen in der Küche …
S. 193
Er geht nach oben ins Bad und öffnet die Wasserhähn…
Haus und Inventar der Eheleute Sterk sind Indikator für ein bestimmtes Wohnverhalten, sie weisen auf Wohlstand hin und repräsentieren einen hohen sozialen Status und Reichtum. Sie lassen die bürgerliche Kultur auferstehen: Die stilvolle Einrichtung zeigt die repräsentativen Absichten des Hausbesitzers in der vergangenen Zeit.
Wir lesen von krummbeinigen Kommoden mit bauchigen Lampen darauf, den Bücherschränken mit den teilweise verglasten Türen, hinter denen sich drapierte Vorhänge fälteln, den Biedermeierschränken und von geschnitzten Holzfassungen umlaufenden Sofas. In den letzten Kriegswochen hatte Richard aus Furcht vor den Plünderungen der Russen Schränke und Betten sogar verleimt und damit unverrückbar gemacht S. 210
- Alt und gediegen: Für mich sind das Werte, sagte e…
S. 211f
Bei der spanischen Eichentruhe …
Als typisches Interieur steht eine Pendeluhr im Wohnzimmer. Sie ist Symbol für die häusliche Ordnung des Wohnens und wird in einem abendlichen Ritual von Richard aufgezogen.
S. 212
Er schaut beiläufig auf die Pendeluhr und nimmt sich vor, sie am Abend aufzuziehen, sie schlägt schon sehr schwac…
Aktuell (2001) nicht mehr intakt, stellt sie ein Symbol der abgelaufenen vergangenen Zeit dar. Philipp setzt sie nicht wieder in Funktion und verweigert sich damit symbolisch, die Familiengeschichte zu ,öffnen‘.
S. 8
Johanna geht auf die Pendeluhr zu, die über dem Schreibtisch hängt. Die Zeiger stehen auf zwanzig vor sieben. Sie lauscht vergeblich auf ein Ticken und fragt dann, ob die Uhr noch funktionier…
- Die Antwort wird dich überraschen. Keine Ahnun…
In ihrer Klein- und Kernfamilie haben Ingrid und Peter in ihrem Haus typische bürgerliche Strukturelemente übernommen: Es gibt Individualräume für die Kinder und Eltern, die Kellerräume enthalten Freizeiträumlichkeiten.
S. 249
Nachdem Peter sich beleidigt in den Keller verzogen hat, legt sie sich langgestreckt und mit spitz angewinkelten Ellbogen zurück auf die Couch …
S. 253
Sie kehrt in der gebotenen Schnelle ins Wohnzimmer zurück …
S. 255
Da sieht sie Philipp mit seinem Matchbox-Traktor auf dem oberen Treppenabsatz sitzen …
S. 272
Inzwischen ist es halb sieben, und sie hört die Kinder nach wie vor herumlaufen. Ihre kleinen trappelnden Schritt, die den Lampenschirm zum Erzittern bringen, wenn sie einander von einem Zimmer ins andere jage…
Die Villa, ein Symbol der gemeinsamen familiären Geschichte, bot jeder Generation ein Zuhause, bis nach fast 60 Jahren Alma dort nur noch allein lebt. Bereits für die Tochter Ingrid war sie jedoch kein Ort der Geborgenheit oder der Erinnerungen, sondern nur ein „Haus“ in materieller Sicht.
S. 214
- Bloß ein Glück, dass ich hin und wieder hier bin, dann sehe ich, dass es nur ein Haus ist, nicht mehr. Nur ein Haus mit Garte…
Der Zahn der Zeit hat das Gebäude äußerlich beschädigt, es hat seinen alten Glanz verloren, ist vernachlässigt und sanierungsbedürftig. So wie in den anderen Romanen verfällt das Haus, d a s Symbol der Familie, und dieser Verfall spiegelt das Altern der sie bewohnenden Menschen wieder.
S.366
Alma denkt, hoffentlich gibt es nicht wie beim letzten starken Regen kleine Bäche in der Veranda, das hätte noch gefehlt. Sie hatte drei Sachverständige im Haus, und keiner wusste eine wirkliche Lösung ohne einen Umbau im großen Stil. Aber für wen? Für mich? Für mich lohnt es sich nicht, die paar Jahre, die ich noch lebe, wird es schon halten, dann sollen sich andere drum kümmern … Seither befürchtet Alma, dass es eines Tages wirklich ganz arg werden wird. Ansonsten, das ist ihre Meinung, soll das Haus ausdienen, mehr wird nicht mehr verlang…
S. 7
Schon bei seiner Ankunft am Samstag war ihm aufgefallen, dass am Fenster unter dem westseitigen Giebel der Glaseinsatz fehlt. Dort fliegen regelmäßig Tauben aus und ei…
Alma vererbt Philipp als „Strafe“ das Haus, wohl ahnend, dass eine finanzielle Erbschaft für ihn einfacher zu verwalten wäre und er sich darüber eher freuen würde.
S. 354
… ich habe mir überlegt, ob ich ihm ein Zimmer bei uns in Hietzing anbieten soll, er kann auch zwei haben oder drei, da besteht kein Mangel, was hältst du davon, dass er irgendwann zur Strafe das Haus kriegt …
Fast scheint ihr Wunsch in Erfüllung zu gehen, denn Philipp spielt mit dem Gedanken, eine untergegangene Kultur in der Villa zu dokumentieren:
S. 52
Und in alle Zimmer würde er Schreibtische stellen, in jedes Zimmer einen Schreibtisch, für jede Person auf dem Klassenfoto einen Schreibtisc…
S. 136
Er findet sogar den Mut, die Nachtkommode der Großmutter zu öffnen, die vollgestopft ist mit Papierkram. Er zieht die Schubfächer mit einer gewissen Gleichgültigkeit heraus und doch im Bewusstsein, dass er hier einer Möglichkeit gegenübersteht, vom Fleck zu komme…
Er verbindet jedoch zu viele unangenehme Erinnerungen mit diesem Haus:
S. 226
Selbst die unangenehmen Erinnerungen, die hartnäckig hinter den Fenstern lauern …
Mit Almas Tod scheint das Gebäude endgültig seine Funktion verloren zu haben. Philipp entsorgt die Vergangenheit in Abfallcontainern und wünscht sich das Haus „ausgeputzt, ausgewaschen..“
S. 52
Es müsste schön sein, wenn das Haus leer wäre und nicht nur leer, sondern ausgeputzt, ausgewaschen, ausgekratzt, alle Fenster offe…
Während der Säuberung des Hauses wählt er als Aufenthaltsort die Vortreppe des Hauses und nur selten einen Innenraum - ein Zeichen für die Abkehr von der Familientradition.
S.50
Den ganzen Vormittag bringt Philipp nichts zustande. Mit den Ellbogen auf den Knien sitzt er auf der Vortreppe …
9.3 Die Wohnsituation in der DDR: Geschosswohnung und bürgerlicher Besitz
Die DDR hatte sich zum Ziel gesetzt, menschenwürdige Verhältnisse durch wohnungspolitische Anstrengungen für a l l e Bürger zu schaffen. Dies geschah durch die Einführung der Planwirtschaft im Wohnungsbau, mit ihr sollte die gerechte Verteilung des Wohnraums nach sozialen Gesichtspunkten erfolgen und die Förderung von Baugenossenschaften und der Wohnungsneubau aus staatlichen Mitteln finanziert werden.286 Bauherr war die Staatsmacht, und sie allein bestimmte das städtebauliche und architektonische Bild der Städte.
Das Ziel war die Beseitigung sozialer Unterschiede in der Wohnungsgröße bei Familien unterschiedlicher Klassen - wenn auch die Ausstattung diese oftmals weiterhin widerspiegelte - und eine soziale Durchmischung der Wohngebiete.287
Die „gerechte Verteilung des Wohnraums“ (Art. 37 der Verfassung der DDR) vollzog man durch die Umwandlung eines großen Teils der Wohnungen in volkseigene und genossenschaftliche Wohnungen. Die Wohnungsvergabe erfolgte von der Abteilung Wohnwirtschaft in Kreisen und Städten. Meist meldeten Bewohner Leerstände, um dann vielleicht selber davon zu profitieren. Die Vergabenormen besagten, dass jeder Erwachsene, aber nicht jedes Kind, einen eigenen Wohnraum haben sollte. Es gab bevorzugte Bevölkerungsgruppen bei der Zuteilung von Wohnraum, wie z.B. Familien, Kämpfer gegen den Faschismus, Lehrer, Erzieher, Hochschulabsolventen und ehemalige länger dienende Angehörige der bewaffneten Organe.
Der zentralistisch projektierte Wohnungsbau der DDR hatte strikte Normvorgaben und jedes einzelne DDR-Wohnungsbauprogramm zeigte sich in den jeweiligen typischen Wohnformen.
Man finanzierte den Wohnungsbau und die Wohnungserhaltung, indem man Mittel aus den produzierenden Bereichen der DDR-Volkswirtschaft, aus Maschinenbau, Elektroindustrie und Energiewirtschaft abzweigte. Jedoch erschwerten Materialknappheit in diesen Industrien und mangelnde finanzielle Ressourcen die Durchführung mancher Wohnungsbauprogramme und gaben durch die Vernachlässigung der Sanierung alter Bauten ganze Stadtteile dem Verfall preis.
Es war eine politisch-ideologische Frage, welche Bauwerke aus früheren Epochen erhalten bzw. wiederaufgebaut wurden und welche nicht. Altstädte galten als Ausdruck kapitalistischer Lebensweise und bürgerlicher Lebensart und von dieser hatten sich, so war die Auffassung, sozialistische Städte zu unterscheiden. Die Wohnungspolitik verachtete historisch Gewachsenes und Individuelles, riss alte Gebäude als Überbleibsel der Klassengesellschaft rigoros ab, ließ Wohnquartiere aus dem 19. Jh. verfallen und pflegte nur selten die Tradition. Denkmalschutz und der Wert von alten Stadtkernen wurde erst erkannt, als man merkte, dass in den Plattensiedlungen ein behagliches Umfeld mit Geschäften und Gastronomie fehlte.
Der Eigenheimbau wurde vernachlässigt, viele Eigenheimbesitzer erhielten nur nach Bittgängen geringe Mengen an benötigten Material für ihre Häuser. Primär waren jederzeit zunächst die Bedürfnisse der politischen Organe, für die man gigantische Fassaden und Repräsentationsbauten baute.
Eigentümer verschenkten sogar (Miets)häuser an die KWV, die Kommunale Wohnungsverwaltung, die sie zu niedrigem Preis an Privatpersonen vermietete. Der Boden von Häusern blieb stets Eigentum des Volkes, der Besitzer erhielt das Recht für die dauerhafte Nutzung.
In den 50er Jahre orientierte man sich in der DDR noch an der bürgerlichen Architektur, dem Baustil der Gründerzeit mit seinem repräsentativen Charakter. Es wurden PalastWohnhäuser für die Arbeiter- und Bauernmacht errichtet, die in ihrer Repräsentativität die Gebäude des bürgerlichen Zeitalters in Ausstattung und Architektur übertrumpfen sollten - im Sinne der Umkehr der Besitzverhältnisse bewohnten Arbeiter nun Prachtbauten.
Wilhelms und Charlottes Haus, in dem die Feierlichkeiten für Wilhelms Geburtstag stattfinden, war ursprünglich ein schönes Haus, das einen großbürgerlichen Lebensstil ermöglichte: eine Villa am Steinweg mit Turmzimmer, Diensboteneingang, Wintergarten.: S. 78
Sie wohnten im Steinweg. Unten wohnten Omi und Wilhelm. Oben wohnten sie: Mama und Papa und e…
S. 328
Das Haus kam allmählich näher. Man sah schon, hoch oben zwischen den herbstlichen Baumkronen, das Turmzimmer mit seinen halbrunden Fenstern und seinen Zinnen … und auch wenn der Turm im Grunde den Gipfel einer gewaltigen Geschmacksverirrung darstellte (das ganze Haus war ein ziemlich übler, eklektizistischer Bau - ein neureicher Nazi hatte sich hier noch in den letzten Kriegstagen einen Traum verwirklicht), konnte Kurt nicht leugnen, dass er das kleine Turmzimmerchen immer gemocht hatte. ..die massive Tür, die vergitterten kleinen Flurfenster, die das Haus endgültig zu einer Festung machten…
S. 120
Im Haus war es still. Charlotte ging durch die Tür zum ehemaligen Dienstboteneingang….durch die Doppeltür zum ehemaligen Weinkeller war Grummeln und Lachen zu höre…
S. 151
Das Haus von Charlotte und Wilhelm war ein schönes Haus. Das kleine Türmchen, das auf der einen Dachseite herausragte, gab ihm sogar etwas von einer Kirche.Der Eingang lag beinah zu ebener Erde, besonders dieser Umstand kam Nadjeshda Iwanowna herrschaftlich vor, man brauchte nur eine Stufe zu nehmen, dann stand man vor einer doppelt geflügelten Tür aus massivem Holz, mit Schnitzereien sogar und zwei goldenen Fischköpfe…
S. 152
Zuerst betrat man einen kleinen Vorraum, von hier führte eine Glastür in den geräumigen Flur, es gab sogar eine Nische für die Garderobe, die genau wie die Haustür aussah, aus Holz und geschnitz…
S. 119
Im Wintergarten war es gut. Der Zimmerspringbrunnen brummt…
S. 277
Als er eine gute Stunde später vor dem Haus seiner Urgroßeltern stand, erinnerte er sich auch wieder an die Messingtürklopfer an der Haustür. Sie hatten die Form von chinesischen Drache…
Wilhelm schaffte die Dienstbotenklingeln ab, weil sie gegen seine proletarische Ehre verstießen.
S. 400
Aber sie durfte sich die Kehle wund schreien, wenn Lisbeth wieder irgendwo im Haus herumstreunte. Das verstieß nicht gegen seine proletarische Ehr…
Dieses Haus wird, wie in allen Familienromanen, zum Symbol für den Verfall und in diesem Roman für das Scheitern einer sozialen Ordnung, ein Sinnbild für Menschen und ihre Gesellschaft. Es wirkt in späteren Jahren mit seinen ausgestopften Tieren bedrückend und düster - wie ein Relikt aus einer vergangen Zeit und ähnelt damit den Gästen.288 Zerfall und Zerstörung der Villa schreiten im Verlauf des Romans voran: Treppen führen ins Nichts, der Terrassenhang bricht ein. Renovierungs- und Umbaumaßnahmen entstellen das Haus und schränken die Funktionalität ein, so dass es zum Schluss nicht mehr bewohnbar ist. (Ein Bild für den sozialistischen Staat DDR)
Charlotte bewohnt zum Ende hin kleine Rückzugsräume, in die Wilhelm sie verdrängt hat. S. 286
… nur der kleine Springbrunnen war außer Betrieb, und wenn man sich ganz herüber lehnte, sah man, dass das Parkett vor der Tür, die auf die Terrasse hinausführte, von einem Wasserschaden aufgequollen war, ja dass sogar Bretter fehlten. Schade, dachte Markus, nicht um den Fußboden, sondern um die schönen Sachen, die ihm plötzlich ziemlich vernachlässigt vorkame…
S. 393
Oder das Bad. Alles kaputt. Alles hatte er aufgehämmert mit dem Elektrohammer. Weil er eine Fußbodenentwässerung hatte einbauen müsse…
Oder seine Terrassenaktion... Jetzt lief das Regenwasser in den Wintergarten. Der Fußboden hatte sich aufgelöst. Die Tür zur Terrasse war aufgequollen, die Scheibe geborste…
S. 390
Kurz erwog sie, sich ins Turmzimmer zurückzuziehen, für einen Augenblick zur Besinnung zu kommen. Es war der einzige Raum, der ihr in diesem Haus geblieben war. Aber die vierundvierzig Stufen bis dort oben schreckten si…
Die Reparatur des Ausziehtischs ist ein Beispiel für Wilhelms unsinnige und inkompetente Bautätigkeit und führt letztlich zum Zusammenbruch.
S. 200f
-Hammer und Nägel, sagte Wilhelm. Du weißt doch, wo’s steht. Mählich ging in den Keller und kam wieder mit einem Hammer und Nägeln. Wilhelm hob das Mittelteil auf, maß mit Daumen und Zeigefinger den Abstand zum Rahmen. Dort setzte er den Nagel …
S.245
Dann krachte irgendwas im Nebenraum. Kurt sah zu, wie die Leute aufstanden und nach drüben strömten - einzig Markus kam, entgegen dem Strom, von drüber herüber und fragte, was denn passiert sei…
Kurt goss sich noch einen Goldrand ein und ging ins andere Zimmer. Beiläufig registrierte er, dass das Buffet zusammengebrochen wa…
Kurt, Irina und Sascha bewohnen als eine Familie, die der Intelligenz angehört, eine bürgerliche Villa mit Veranda und einem großen Garten; in ihm steht ein Apfelbaum und in ihm züchtet Irina Rosen. Die Adresse wird genannt: Am Fuchsbau 7.
Irina verwandte viel Zeit und Liebe für die Gestaltung ihrer Wohnung bzw. ihres Hauses, baute es nach ihrem Geschmack mit Kreativität um.
S.257
Wie hatte sie damals, als sie frisch aus Russland kam, Charlottes Haus bewundert! Und jetzt bewunderte Charlotte ihr Haus. Und manchmal, wenn Irina durch die Räume ging und ihr Werk betrachtete, war sie, ehrlich gesagt, selbst erstaunt, wie gut ihr alles gelungen wa…
Es ist durch die Renovierungsmaßnahmen mit dem bürgerlichen Bau Charlottes vergleichbar.
S. 165f
Es hatte ihm Angst gemacht, wenn Irina einfach irgendwelche Wände einreißen ließ, wenn er die Rohre und Leitungen sah, die da heraushingen, dieses ganze Zeug, da ja irgendwie wieder in die Wände hineinmusste. Er hatte, auch das war vorgekommen, Türen knallend das Haus verlassen, sooft er mitbekam, dass Irina Unsummen ausgab, weil es unbedingt diese Tür, dieses Holz, dieses Rot sein musst…
Es war ein herrliches, ein wunderbares Schlafzimmer. Im Grunde ganz schlicht: Nur das Bett stand darin.. Der Teppichboden war weiß, weiß auch die Wände, nur die Wand an der Stirnseite des Bettes war kaminro…
Sie legte großen Wert auf eine stilvolle Einrichtung:
S. 17f
… schöne alte Vitrine,. Telefontisch,. alte Uh…
2001 ist der an Demenz erkrankte Kurt noch der einzige Bewohner, und das Haus ist dem Verfall preisgegeben und damit ein Spiegelbild der Familie:
S. 8
… hier schien die Zeit stillzustehen: eine schmale Straße mit Linden. Kopfsteingepflasterte Bürgersteige, von Wurzeln verbeult. Morsche Zäune und Feuerwanzen. Tief in den Gärten, hinter hohem Gras, die toten Fenster von Villen, über deren Rückübertragung in fernen Anwaltskanzleien gestritten wurd…
Eins der wenigen Häuser hier, die noch bewohnt waren: Am Fuchsbau sieben. Moos auf dem Dach. Risse in der Fassade. Die Holunderbüsche berührten schon die Veranda. Und der Apfelbaum, den Kurt immer eigenhändig beschnitten hatte, wuchs kreuz und quer in den Himmel, ein einziges Gewir…
In den späteren Jahren ihrer Existenz gestaltete die DDR Wohnraum nach den Idealen des sozialistischen Humanismus, d.h. in der Realität: das sozialistische Einheits- und Nützlichkeitsdenken förderte eintönige und gesichtslose Neubauviertel, die die Menschen glücklich machen sollten.
Es entstanden Wohnungsbautypen wie der serielle Typ der Plattenbauweise, die zwar die Wohnbedürfnisse der Menschen erfüllten, aber Konformität ausstrahlten und dieAnspruchslosigkeit der Bewohner einforderten.289 Solche Betonburgen mit ihren breiten Straßen und den genormten Rechtecken prägten die Stadtzentren und hatten den Status einer staatlich bereitgestellten Infrastruktur.
All diese Gebäude boten weder die Möglichkeit des Rückzug ins Private, so wie ein Eigenheim es tat, noch konnte man dort individuelle Interessen und Neigungen wie in einem Altbau ausleben.
Vorrang hatte die Geschosswohnung, für Rückzugsmöglichkeiten gab es den Kleingarten und das Wochenendhaus.290 Familien gestalteten ihren Garten individuell, in ihm besaß man die Freiheit, die Zeit nach eigenen Vorstellungen zu verbringen. Gartenarbeit wurde zu einem zentralen Freizeitinhalt der DDR Bürger und im Vergleich zur Bundesrepublik hatten Menschen in der DDR weitaus öfter einen Kleingarten oder ,Datschen‘.
Noch in den 50er Jahren war solch ein Kleingarten als ein Relikt des Kapitalismus angesehen worden: die Bourgeoisie hätte Interesse, dem Proletariat Rekreationsmöglichkeiten zu geben, damit der eigene Profit gesteigert wurde, so hieß es. Gärtnern galt als kleinbürgerlich und der Kleingärtner als jemand, dem das politische Bewusstsein und der Klassenstandpunkt fehlte.291
Diese Wertung änderte sich in den 60er Jahren, nun stand der ideelle Aspekt des Kleingartens im Vordergrund: Der DDR-„Kleinbürger“ sah den Garten als etwas Eigenes und unterschied sich in nichts vom Bürgerstreben.
„Die Transformation bürgerlicher Werte und Normen ins kleinbürgerliche Milieu, wofür das DDR-spezifische Kleingärtnerwesen exemplarisch steht, bedeutet eine Entbürgerlichung der Gesellschaft.“292 Dies findet Eingang in den Roman:
Irinas Garten ist ihr Refugium, den sie, so wie das gesamte Haus nach ihrem Geschmack angelegt hatte.
S. 72
- Dann geh in den Garten, sagte Irina, und schneide die Rosen a…
S. 28
Blieb kurz am Küchenfenster stehen, warf einen Blick in den Garten, suchte, als sei er ihr wenigstens diese Sekunde des Andenkens schuldig, im hohen goldenen Gras die Stelle, wo Baba Nadja einst stundenlang in gebückter Haltung gestanden und ihre Gurkenbeete besorgt hatt…
S.. 172
Nachdem Günther gegangen war, zog Kurt seine Arbeitsklamotten an und ging in den Garten. Das Wetter war gut, und gutes Wetter musste man irgendwie nutzen. Er holte die Harke heraus, aber es war kaum Laub da, also überlegte er, ob er irgendetwas beschneiden könnte. Aber er war sich nicht sicher, die Knospen kamen bereits, womöglich war es zu spät zum Beschneiden. Und obwohl er den Gedanken ans Beschneiden schon wieder aufgegeben hatte, suchte er noch eine Weile die Gartenschere, ohne sie allerdings zu finden. Stattdessen fand er ein paar Tulpenzwiebeln und beschloss, sie einzupflanzen. Eine Zeitlang ging er im Garten herum und schaute nach einem geeigneten Platz, konnte sich aber für keinen entscheiden …
In den 70er Jahren wurde Wohnraum knapp und kommunale Wohnungsämter mussten, bevor sie „Zulassungsscheine“ an Wohnungssuchende verteilten, den Anspruch von Antragstellern auf eine Wohnung prüfen. Chancen für eine Zuweisung hatten primär SEDFunktionäre, Künstler und Prominente. Um als Normalbürger einen Anspruch auf eine Zwei-Zimmer-Wohnung zu haben, war eine Verheiratung erforderlich.
Die Sozialpolitik der SED bezog ihr Wohnungsbauprogramm insbesondere auf Arbeiter und junge Eheleute. Für sie wurde der Wohnungsbezug mit dem eigenen abgeschlossenen Wohnbereich zum Status bei der Familiengründung. „Der Kampf um eine Wohnung wird zum Synonym, eine Familie gründen und eigene Lebensvorstellungen umsetzen zu können.“293 Nicht Klassen- und Schichtzugehörigkeit bestimmten die Wohnbedingungen sondern die Personen- und Kinderzahl.
Für Familien entwickelte die Deutsche Bauakademie bis 1972 eine Wohnungsbauserie, das Plattenbausystem, bei dem die meist gebaute Wohnung 3 Zimmer mit max. 66 qm besaß und für die sozialistische Kleinfamilie mit zwei Kindern bestimmt war; das Kinderzimmer für zwei Kinder hatte 10qm. Diese monotonen und gleichförmigen Wohnverhältnisse sollten zwar gleiche Wohnbedingungen schaffen, wurden jedoch von vielen der Bewohner als unzumutbar angesehen.294 Sicherlich ist der Mittelpunkt des alltäglichen Familienlebens die Wohnung, sei es zur Erziehung, zum Leben oder zur Pflege. Für die Gestaltung des Familienlebens jedoch ist es weitaus vorteilhafter, in Wohneigentum oder in einem eigenem Haus mit offener Bauweise und Spielräumen für die Kinder zu wohnen und nicht in einförmigen Betonburgen.
Jedes Wohnviertel hat Auswirkungen auf das Sozialverhalten und die sozialen Beziehungen der dort lebenden Menschen und auch die Lebensbedingungen der Familie Umnitzer und ihre Sozialisationsleistungen sind beeinflusst von der Ausstattung und dem Umfeld der Wohnung.
Saschas Familie ist mit ihrem Bildungs- und Qualifikationsniveau der Gruppe der Intelligenz zugehörig, und dies zeigt sich in den Wohnverhältnissen.
Kurts und Irinas Haus in Neuendorf liegt unweit von Charlottes und Wilhelms Haus und unterscheidet sich von der Plattenbauweise bzw. von den heruntergekommenen Wohnhäusern in den Altbauvierteln Ost-Berlins.
Die Eigentumsstruktur war 1989: volkseigen 41%, genossenschaftlich 17%, privates Eigentum: 42%.295 und auch Familie Umnitzer hatte das Haus wie die meisten DDR- Bürger angemietet, da die Mietkosten extrem niedrig waren.
S. 352
Dumm war es gewesen, das Haus nicht zu kaufen. Andererseits: Wer weiß, ob die Kommunale Wohnungsverwaltung das Haus überhaupt verkauft hätte? Hätte sie fragen sollen? Niemand hatte gefragt. Alle Häuser in der Umgebung hatten der Kommunalen Wohnungsverwaltung gehört, und kein Mensch (außer diesem merkwürdigen Harry Zenk) war auf die Idee gekommen, das Haus, in dem er wohnte, auch noch zu kaufen. Wozu, wenn man irgendwelche hundertzwanzig Mark Miete bezahlt…
In einer Mehrzahl der Häuser und Wohnungen bestand im Laufe der Jahrzehnte ein dringender Sanierungsbedarf, sie entsprachen nicht mehr dem normalen Wohnstandard. Schäden waren nicht ausgebessert worden, weil man die Mietpreise der Wohnungen auf Vorkriegsniveau eingefroren hatte. Da die Kommunale Wohnungsverwaltung kaum Renovierungen und Schadenbehebungen durchführte, verfiel die Altbausubstanz gesamter Stadtviertel, viele Mietwohnungen und Häuser galten als unbewohnbar und gesundheitsgefährdend.
Diese Umstände werden durch die Beschreibung von Christinas Wohnung illustriert:
S. 221
Er [Alexander] trottete hinterher, schnupperte den wohl bekannten Hausflurgeruch (halb Schimmel, halb Katzenpisse), betrachtete andächtig das halbrunde Emaillebecken im oberen Flur, an dem sie ihr Wasser entnahmen, folgte Christina auf der krummen, knarrenden Treppe zum Dachboden, aus dem, vermittels zweier Lehmfachwerkwände, ein paar Kubikmeter herausgetrennt worden waren: das Mansardenzimme…
Nach seiner Trennung von Melitta quartiert sich Alexander illegal in einem leer stehenden Haus im Prenzlauer Berg ein, das ebenfalls in einem desolaten Zustand ist: S. 290
An der Decke die Reste von Blumenreliefs. Dornröschenschlaf.Abgerissene, aufgebrochene Briefkästen. Die Tür stand sperrangelweit offen, ließ sich nicht schließen, weil eine dicke Eisschicht auf dem Fußboden die Schwelle blockierte: Rohrbruch, dachte Kurt, das Wort dieses Winter…
Eigeninitiative und Selbsthilfe von Eigentümern wurden Hindernisse in den Weg gelegt und führten nur selten zum Erfolg.296 Sie versuchten, genauso wie die Mieter, z.B. Irina Umnitzer, in genossenschaftlichen und staatlichen Wohnungen, mit Kraft, Geld und Erfindungsreichtum, ,ihre‘ Wohnung zu renovieren und in einen guten Zustand zu bringen, führten Malerarbeiten, bauliche Veränderungen, Renovierungen, Modernisierungen durch, mit und ohne Genehmigung der Wohnungsverwaltung.297
Dass Geld bei der Sanierung und Renovierung der Häuser und Wohnungen für die Bewohner eine geringere Rolle spielte als vielmehr Beziehungen zu Personen, die mit Hilfe von Tricks und Kenntnissen Material beschaffen konnten, erfahren wir im Roman: Versorgungsprobleme z.B. bei Brettern oder Dachpappe verhindern die systematische Renovierung bzw. den Ausbau der eigenen Häuser, es mangelte schlichtweg an Handwerkern und Baumaterialien. Doch Irina besorgt die benötigten Materialien und Möbel pragmatisch und wie für die DDR typisch halb-legal.
S.17f
… schöne alte Vitrine.Irinas wunderbares, zeitlebens wackliges Telefontischchen,.Und auch die große schwedische Wand (wieso eigentlich schwedische Wand?…
Nach der Wende hat sie Angst vor dem Verlust des Hauses, ihrem Zuhause, dem einzigen, was ihr geblieben ist.
Unsicherheiten entstehen wegen der Überführung des Wohnungssektors in die Marktwirtschaft. Nun musste das gesamte Leben und die Vorstellung von Wohnen revidiert werden. Irina fühlt sich hilflos in den neuen Bedingungen.
S. 358f
Und wenn sie jetzt noch das Haus verloren, dann gute Nach…
In diesem Roman ist das Haus eine Metapher für die Familiengeschichte und ein Beispiel für den Verfall und den Untergang der Familie Umnitzer. In ihm spiegeln sich sowohl Krankheit und Alkoholismus als auch der politische Untergang des Regimes.
Einen Kontrast dazu bildet Melittas Haus: ein schönes Haus in Großkrienitz, das Markus’ Mutter, eine Wendegewinnerin, sehr billig erworben hat.
S. 372
Das Komische dabei: Plötzlich hatte sich die Gropiusstadt, die Markus einst aus der Ferne bewundert hatte, als eine eher prollige Gegend entpuppt, während Großkrienitz ein nobler Berliner Vorort geworden war, und das Haus, das Muddel irgendwann billig für Ost-Geld gekauft hatte, hatte sich als Hauptgewinn erwiesen. Als Klaus hier eingezogen war, hatten sie es komplett renovieren lassen, mit Gründach und allen Schikanen. Geld spielte keine Roll…
Markus bewohnt es mit seiner Mutter und deren neuem Mann. Sein Stiefvater vertritt als Politiker westliche Werte, die Mutter passt sich ihrem neuen Mann an. Stil und Ausstattung der Wohnung sind aufgrund des Bildungs- und Qualifikationsniveaus der Familie teuer, bewirken aber bei Markus keine Zufriedenheit:
S. 373
Klaus war nämlich auf einmal Politiker und saß im Bundestag - Pfarrer Klaus, der in der Kirche von Großkrienitz mit Blaupapier durchgepauste Gedichte verteilt hatte.. Und Muddel verdiente noch dazu, hatte sich einen silbergrauen Audi gekauft.. Für all das konnte Markus nicht das Geringste. Auch hatte er persönlich gar nichts davon, dass seine Alten plötzlich Geld hatte…
In der Biographie des Verfassers spielt das (Ferien)Haus der Eltern in Hiddensee eine bedeutende Rolle: Es war in den 70er Jahren mit organisierten Schwarzmarktmaterialien in Form von Tauschaktionen (Holz, Zement, Glas) von seinen Eltern selber errichtet worden . Als Sohn nahm er es später in Besitz und lebt heute dort. Es ist für ihn ein Symbol der Familiengeschichte und seiner Identität, es ist eins von dem Wenigen, was Eugen Ruge von seiner Familie geblieben ist.
10. Bürgertum und Bürgerlichkeit im „langen 19. Jahrhundert“
Die Tugend adelt mehr als das Geblü…
(Sprichwor…
Familienroman-Familien sind zumeist im Bürgertum verankert, doch was bedeutet dies konkret? Was versteht man unter den Begriffen „Bürgertum“, „Bürgerlichkeit“ und bürgerlichem Denken/Verhalten, die bereits öfters fielen?
Gerade in der heutigen Zeit ist das Thema der „Bürgerlichkeit“ in unserem Sprachgebrauch nicht mehr weg zu denken: Da reklamiert eine Partei wie die AfD für sich, das Bürgertum zu vertreten, dem gegenüber bescheinigen andere dieser Partei eine antibürgerliche Haltung, weil Bürgertum Rechtsstaatlichkeit, Menschen- und Bürgerechte und die Freiheit von Diskriminierung bedeute und autoritäres und völkisches Denken dem Bürgertum widerspräche.298 Dem konservativen CDU-Politiker/Vorsitzende Friedrich Merz sprechen die Wähler heute Biss und Ehrgeiz zu, doch dieser hatte für eben diese Tugenden in Teenager-Jahren rein gar nichts übrig, seine „Verbürgerlichung" sei eingetreten, als er das erste Mal Vater wurde.299 Dies impliziert, dass Bürgerlichkeit also etwas mit einer moralischen Haltung zu tun haben muss.
Deshalb zunächst zur Bedeutung der Begriffe ,Bürger’, Bürgertum’ und ,Bürgerlichkeit'. Hierbei finden die konkreten Werte und Lebensformen des Bürgertums kurz Erwähnung, werden aber später noch ausführlich anhand der Romane analysiert.
Etymologisch leitet sich der Begriff ,Bürger‘ von dem althochdeutschen Wort ,purgari‘ bzw. mittelhochdeutsch ,burg^re‘ ab, was ,Burgbewohner‘ bedeutete. In der Antike implizierte der Begriff „Bürger“ in den griechischen Städten rund um die Ägäis die aktive Teilhabe am politischen Leben einer ,polis'. Gleiches galt für den ,Civis romanus', den römischen Bürger. Ein kleiner Teil der Stadtbewohner besaß das Bürgerrecht, am Gemeinwesen, der ,polis', teilzunehmen und somit wichtige Entscheidungen zu treffen. Es waren erwachsene Männer, die Haus und Grund in der Stadt besaßen und Steuern bezahlten, um so die Deckung der Kosten für die Stadtverwaltung mitzutragen.
Heute bezeichnet man mit dem Begriff ,Bürger‘ im Deutschen sowohl den Staatsbürger (,citoyen‘) als auch den Angehörigen des Bürgertums.300
Das deutschsprachige Bürgertum bildete sich seit dem 11. Jahrhundert in den Städten heraus. Der Ursprung der Sozial- und Kulturkategorie lag im Stadtbürgertum, das sich im späten Mittelalter von der weltlichen und geistlichen Herrschaft emanzipierte.
Von der mittelalterlichen Ständeordnung herkommend, meinte man mit dem „Bürger“ den ratsfähigen Stadtbewohner, der in den Bürgerverband aufgenommen wurde und der das Bürgerrecht hatte. Das Bürgerrecht, ein ständisches Recht und durch Geburt erworben, war ein Rechtsstatus und berechtigte zu selbständiger Erwerbstätigkeit und Mitwirkung an der städtischen Selbstverwaltung. Die aktive Teilhabe an der Verwaltung der Stadt begrenzte sich demnach auf den Kreis der privilegierten Bürger.
Das Bürgerrecht unterstellte den Bürger einer besonderen Gerichtsbarkeit und implizierte die Steuerpflicht.301 Es fußte auf Besitz und Bildung und setzte beim Mann geordnete wirtschaftliche Verhältnisse, ein gesichertes Einkommen und Funktionen in Gewerbe und Handel voraus. Kaufleute und Handwerker gehörten zur breiten Masse der Stadtbürger, von denen sich wiederum die patrizialen Eliten, vermögende Kaufmannsfamilien, abschlossen. Nicht zu den Bürgern zählten Handwerksgesellen, Tagelöhner und Gesinde. Eine Voraussetzung für den Erwerb des städtischen Bürgerrechts war in vielen Städten und Gemeindeordnungen die Selbständigkeit, Arbeitern verwehrte man das Bürgerrecht, da sie als unselbständig galten. Preußen band das Bürgerrecht noch 1853 sowohl an Hausbesitz, was als ein Zeichen wirtschaftlicher Selbständigkeit galt, und an einen selbständigen Betrieb und steuerlicher Mindestleistung. Zum Erwerb des Bürgerrechts forderten die politischen Eliten in den Städten ein Bürgerrechtsgeld.
„Bürger zu sein, das hieß [ursprünglich]: gesicherte Nahrung’, Schutz des Einkommens durch die jeweilige Korporation, auch Fürsorge durch sie bei Alter und Krankheit und plötzlicher Not, hieß Mitbestimmung bei der Gestaltung des Lebensraumes, hieß auf Herkommen beruhende Ordnung in diesem Raum und […] Sicherheit in den Mauern der Stadt und unter dem Schutz des städtischen Rechts.“302
Als in vielen Städten im 19. Jahrhundert das Klassenwahlrecht eingeführt wurde, trat die Bedeutung des Bürgerrechts zurück, sicherte aber weiterhin die Hegemonie des Bürgertums in der Bürgerschaft.303 Im Vordergrund steht bei den nun folgenden näheren Ausführungen die Entwicklung des deutschen Bürgertums; in Ländern mit vergleichbarer Gesellschaftsstruktur, wie z.B. in Österreich, verlief diese ähnlich.
Die Begriffe „bürgerlich“, „bürgerliche Gesellschaft“, „Bürgerlichkeit“, entstanden im 18. Jahrhundert, stellten Gegenentwürfe zum absolutistischen Staat, zum damaligen Status quo dar und waren gekoppelt an die Idee der Fortschrittlichkeit und der Vernunft.
In den Städten des 18. Jh. wurde das Gemeinwesen von einer breiten Schicht selbständiger Existenzen gleichberechtigt getragen: Die Stadtbürger - sie stellten einen Stand dar, der seine wirtschaftlichen, moralischen und kulturellen Lebensformen verteidigte und die lokale Identität im Zuge der Staats- und Nationbildung behielt. Seine Lebensart überdauerte Jahrhunderte! Dieses neue Stadtbürgertum bestand vorwiegend aus staatlichen Amtsträgern, Beamten und Juristen, protestantischen Pfarrern, Gelehrten und Ärzten.
Als das eigentliche ,bürgerliche Zeitalter’ gilt das 19. Jahrhundert. In ihm machte das Bürgertum zwar lediglich drei bis fünf Prozent der Gesellschaft aus, entfaltete dafür aber eine überaus große Wirkung.304 Es ist die soziale Formation, die im ,langen 19. Jahrhundert’ die Führung in der gesellschaftlichen Entwicklung übernahm, sich von Adel, Bauern, Klerus und Unterschicht abhob und die Gesamtheit der „Mittelklassen“ umfasste. Thomas Manns Roman gilt nicht nur als eine Schilderung über den Bedeutungsverlust der Familie, mehr noch als „ein Stück Seelengeschichte des europäischen Bürgertums“.305
Eine Definition nach Merkmalen von Beruf und Einkommen dieser Bevölkerungsschicht ist schwer zu geben, denn das Bürgertum war keine homogene soziale Schicht, sondern eine „Statusgruppe“, die sich durch ähnlichen Lebensstil und Werthaltungen und einem soziokulturellen Zusammenhalt definierte.306
Ganz unterschiedliche Berufsgruppen zählten zu ihm: Lehrer, Kaufleute, Richter, Pfarrer, Beamte, Unternehmer., die alle eines gemeinsam hatten: Sie wollten ihren ökonomischen, politischen und sozialen Einfluss erweitern und empfanden es als ungerecht, dass die Geburt und nicht der persönliche Einsatz die gesellschaftliche Position bestimmte. Das Bürgertum lief Sturm gegen die Privilegien der Geburt, gegen Standesgrenzen und obrigkeitsstaatliche Unterdrückung, und es ist jene Schicht von vorindustriellen Unternehmern, Kaufleuen, Beamten, die ihre gesellschaftliche Stellung ihrer Leistung und Initiative verdanken. Diese beiden Prinzipien wollten sie im Unterschied zum geburtsständischen aristokratischen Prinzip des Adels zu Hauptprinzipien einer neuen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ordnung erheben!
In der Abgrenzung zum Adel und zur unteren sozialen Schicht sahen sie sich als „Mittelstand“, der die Entwicklung der Gesellschaft zur bürgerlichen Gesellschaft vorantrieb, mit dem Bewusstsein, dass der Mensch „nicht in seinem Stand[.] aufgehe und [.] die Gleichberechtigung aller in Staat und Gesellschaft das Ziel sein müsse.“307 Die bürgerliche Idee der Freiheit und die Gleichheitsforderung war es, die sich Bedeutung schaffte und die an der bisherigen hierarchischen feudalen Ordnung rüttelte. Jeder war nach Meinung des Bürgertums „seines Glückes Schmied“, indem er seine Fähigkeiten, die wiederum durch Erziehung und Unterricht entwickelt wurden, und sein individuelles Engagement einsetzte. An die Stelle der geburtsständischen Privilegien und des klerikalen Einflusses standen für ihn die individuelle Freiheit, Gleichheit und ,materielle und intellektuelle Selbständigkeit’. Soziale Aufstiegsmobilität war möglich für den, der Besitz und Bildung erwarb!
Das politische Verständnis des Begriffs „Bürgerlichkeit“ umfasst als zentrale Werte neben dem liberalen Moment, d.h. den Entfaltungsmöglichkeiten des Einzelnen, dessen Individualität und die Bereitschaft, sich als Bürger aktiv zu betätigen, also eine soziale Komponente. Der Bürger erfuhr sich in Relation zu anderen und hatte das Ziel, eine höhere und kulturelle Lebensqualität zu erreichen.308
Eine Gemeinsamkeit aller Bürger war die wirtschaftliche Selbständigkeit, sei es die des Wirtschaftsbürgers und gewerblich selbständigen Kaufmanns in der Gruppe des Handels-/ Wirtschaftsbürgertums oder der des Bildungsbürgertums, d.h. der Akademiker wie z.B. Ärzte, Apotheker und Rechtsanwälte und des Kleinbürgertums - doch es gab schon früh ein wachsendes wirtschaftliches Gefälle zwischen dem Wirtschaftsbürgertum und dem Bildungsbürgertum (Beamten).
(TM)
Zur „Gesellschaft“ zählten in Lübeck die Kaufmannsfamilien und Großkaufleute, Gelehrte, Juristen, Theologen, Ärzte und die Professoren vom Katharineum. Man distanzierte sich vom Mittelstand und von der Geldbourgeoisie a la Hagenström, Neureiche, die frei von Tradition und Pietät Entscheidungen trafen. Der Roman zeigt aber, dass ihnen die Zukunft gehört.
Das politische Organ des Bürgertums war die Bürgerschaft, die auf Einfluss und Mitbestimmung und auf Auflösung der ständischen Gesellschaft drängte, mit dem Ziel einer bürgerlichen Gesellschaft. Die Stadt wurde für die Bürger zum Modell für die Verfassung des Gesamtstaates, und in ihr nahmen sie zunächst Einfluss.309
Eigentum und Sittlichkeit waren die Schwerpunkte in der Idee bzw. Utopie von einer bürgerlichen Gesellschaft. Die Aufklärung als die wichtigste Grundströmung des politischphilosophischen Denkens des 18. Jahrhunderts und deren Vertreter John Locke und Immanuel Kant sahen die Vernunft und nicht Gewohnheiten und Vorurteile als Primat für die Organisation von Gesellschaft und Staat und forderten einen Diskurs und einen öffentlichen Austausch der Individuen untereinander.
Rationale Gesichtspunkte wie Übersichtlichkeit und Funktionalität galten als entscheidend bei der Umgestaltung des Staates und fanden auch Gehör bei den Monarchen Friedrich II in Preußen und Josef II in Österreich. Als Konsequenz daraus schafften sie die Folter ab und setzten die allgemeine Schulpflicht und die Reduzierung der kirchlichen Macht durch.
Eine entscheidende Grundlage der bürgerlichen Gesellschaft war die Leistungskonkurrenz (Marktwirtschaft). So wie man die Beseitigung der Rechte des Adels bei der Besetzung von leitenden Stellen in Regierung und Verwaltung forderte, verlangten Bürger eine Reformierung der Steuerbefreiung oder der Rechte in der Ausübung der mit adeligen Gütern verbundenen Gerichts-, Jagd- und Patronatsrechte. In der Utopie der bürgerlichen Gesellschaft ist es der politisch mündige Bürger, der durch Besitz und Bildung qualifiziert ist, die Verantwortung zu tragen und im Parlament und in den Vertretungskörperschaften mitzuwirken. An die Stelle des Fürstenstaates sollte die konstitutionelle Monarchie bzw. die Republik als Regierungsform treten.
Weitere Kennzeichen der „Bürgerlichen Gesellschaft“ waren Menschen- und Bürgerrechte wie z.B. Meinungs- und Pressefreiheit und das Recht auf Eigentum. Und immer wieder: Die individuelle Leistung statt der Herkunft sollte entscheiden über die Lebenschancen; nicht der Geburtsstand sondern das Ansehen, das der Bürger sich kraft seiner individuellen Leistung, Bildung und Tugend bei den Mitbürgern erworben hat.310
„Ganz generell tendiert man heute eher dahin, die nicht unmaßgebliche Rolle des Bürgertums für den Prozess der Modernisierung in Deutschland zu betonen ...“ 311
Die Verbreitung der Ideen der bürgerlichen Mittelstandsgesellschaft erfolgte vor Beginn der Industrialisierung und die neuen Kommunikationsformen wie Zeitungen, Lesegesellschaften, Briefkultur und Bildungsreisen halfen sie weiterzugeben. Das Bürgertum wurde zum Träger der Demokratisierung und die „amerikanische Verfassungsgebung (... )der erste welthistorisch sichtbare Erfolg.“312
Die bürgerliche Epoche war zwar durchdrungen von den Idealen Freiheit und Gleichheit, schuf jedoch auch gleichzeitig gesellschaftliche Grenzen, denn Freiheit assoziierte Gedankenfreiheit, Gleichheit meinte Gleichheit unter Gleichen und reproduzierte soziale Grenzen und Ausgrenzungsmechanismen.313 Man hielt sich am Althergebrachten, was z.B. die Rolle der Frau betraf und sah lediglich die Männer als Träger der bürgerlichen Rechte und der geforderten Freiheiten.
Die Anerkennung der bürgerlichen Mentalität und ihrer Tugenden erfolgte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Es begannen, sich zivilgesellschaftliche Strukturen durch Vereine, Gesellschaften, z.B. die Freimaurer zu formen, in denen die Bürger auf gleicher Ebene als Privatmensch, nicht als Repräsentant eines Standes miteinander umgingen und ihre Gedanken und vernünftige Argumente austauschten; vor allem akademisch Gebildete trugen diese Netzwerke.
Es entstand eine sog. bürgerliche Kultur, und um an ihr teilzunehmen, musste man Voraussetzungen erfüllen, z.B. in der aufklärerisch-humanistischen Bildungstradition stehen und ein regelmäßiges Einkommen beziehen, dies war ( s.o.) möglich bei selbständiger Tätigkeit und in beamteter Stellung.
Im Laufe des 19. Jahrhunderts hatten sich zwar formal die Forderungen der „bürgerlichen Revolution“ wie rechtliche Freiheit und Gleichheit für alle Staatsbürger und soziale Aufstiegschancen bei individuellen Leistungen entsprechend durchgesetzt, aber da auf eine völlige Entmachtung des Adels verzichtet worden war, erleichterte der prestigeträchtige Adelstitel weiterhin die Erlangung hoher Positionen.
(TM)
Der Grafensohn Kai im Roman ist ein Beispiel für die Integration adliger Kinder in das staatliche Schulsystem im Laufe des 19. Jahrhunderts, mit der die Notwendigkeit für den Adel einherging einen Beruf zu erwerben.
Waren die Bürger zunächst „Gegenfiguren“ zum Adel, änderte sich dies im Verlauf des 19. Jahrhunderts.314 Letztendlich beeinflusste der Adel mit seiner politischen Macht und seiner attraktiven Kultur das Großbürgertum so stark, dass es den Lebensstil des Adels, wie z.B. Dienerschaft, die Delegierung der Kindererziehung, die differenzierte geschlechterbezogene Ausbildung und die Differenzierung von erbenden bzw. nicht- erbenden Söhnen übernahm.315
Man kopierte den aufwendigen Lebensstil und ließ Neubauten in prächtiger Größe entstehen, um die Stellung und das Ansehen als Bürgers in der Stadt zu demonstrieren. Auftreten und soziale Verhaltensweisen veränderten sich und bedeuteten eine soziale Abgrenzung nach unten: So zu sehen bei den standesbewussten Bürgern in ihren Umgangsformen, der Wahl der Ehefrau, in ihrem Benehmen, in der Kleidung und der Zahl der Dienstboten.
(TM)
Thomas Buddenbrook ist das Beispiel eines Bürgers, der adlige Standards übernimmt, um damit eine „standesgemäße“ und wirkungsvolle/repräsentative Lebensführung zu dokumentieren. Die Repräsentation seines hohen sozialen Status’ zeigt er durch teure elegante Kleidung und Prachtentfaltung in seinem Haus, das eine Imitation adliger Wohnkultur wird.
Die Bezüge zur Realität im fiktiven Roman ergänzen die von der Geschichte und Soziologie entwickelten Komponenten: Die bei den Buddenbrooks zu findende literarische Bürgerlichkeit „[verhält] sich prinzipiell idealtypisch (.) zur Bürgerlichkeit tatsächlich vorfindbarer oder aus außenliterarischen Quellen erhobener Verhältnisse.“316 Hier wird Literatur zu einem Spiegel der Zeitgeschichte und zeigt Ausdrucksformen einer bürgerlichen Lebenshaltung und dem, was als „bürgerlich“ zu gelten hatte. Es ist uns möglich, ein lebhaftes Bild vom Alltag des 19. Jh. im Bürgertum oder im Vergleich dazu vom 20. Jahrhundert zu gewinnen, wenn innere Impulse und Reaktionen der Figuren erzählt und uns Bilder vom bürgerlichen Leben vermittelt werden. Fakt aber ist: Dichtung perspekiviert Wirklichkeit immer anders als ein historischer Text!
Th. Mann zeigt in seinem Werk die historische Wirklichkeit des 18. und 19. Jahrhunderts (Johann der Ältere wurde 1765 geboren, Einsatz des Romans 1835, Todesjahr Hannos 1877) und war selber überrascht, dass seine persönliche Geschichte „das Nationale getroffen“ hat.317 Der Autor selber deutete den Roman als Beispiel für den Niedergang des Bürgertums in Deutschland, „.tatsächlich ist das 19. Jh, in dem der Roman spielt, für das Bürgertum nicht eine Zeit des Niedergangs, sondern gerade des Aufstiegs gewesen. Die Verfallsstimmung der Buddenbrooks ist rein autobiographischer Natur und nicht auf die Situation des Bürgertums allgemein übertragbar.318
Für Thomas Mann selber bedeutete Bürgerlichkeit eine geistige humanitäre Idee und Lebensform; so spricht er in seiner Rede zur 700-Jahr-Feier der Stadt Lübeck („Lübeck als geistige Lebensform“) von bürgerlichen Werten wie Pflichterfüllung, Askese, Ordnung, Recht und Fleiß, auf die er sich als Künstler hat stützen können und die ihm als Gerüst dienten für sein Leben. „.ihre [Bürger; Anm. der Verfasserin] Art von Heldentum, die modern-heroische Lebensform und -haltung, den überbürdeten und übertrainierten am ,Rande der Erschöpfung arbeitenden' Leistungsethiker. und hier ist meine seelische Berührung.mit dem Typen des neuen Bürgers. Ich habe ihn niemals real, als politischwirtschaftliche Erscheinung, gestaltet .Aber das Dichterische, das schien mir immer das Symbolische zu sein.“319
10.1 Das Wirtschaftsbürgertum
Laut dem Allgemeinen Preußischen Landrecht (ALR) existierte ein höherer und ein niederer Bürgerstand, ausschlaggebend für die Zugehörigkeit waren Vermögen und Bildung (Universitätsbildung). Zum höheren Bürgerstand zählte man Beamte, Künstler, Kaufleute und Unternehmer; im Unterschied dazu gab es die Kleinbürger, zu denen Handwerksmeister, Kaufleute und Gastwirte zählten, und es gab noch die sog. Großbürger.
Generell unterschied man zwischen den Wirtschafts- und den Bildungsbürgern: Besitzer und Direktoren großer Wirtschaftsunternehmen und Bürger, die sich auf wirtschaftliche Tätigkeiten konzentrierten, gehörten zum Besitz-/Wirtschaftsbürgertum. Eine Anzahl davon kam aus dem kaufmännischen Milieu und hatte ein Netzwerk der gegenseitige Hilfe und des Nutzens aufgebaut. Wissenschaftlich-akademisch ausgebildete Lehrer, Professoren, Ärzte und Juristen zählten zum Bildungsbürgertum, Juden galten als integriertes Element im Bildungsbürgertum.
Sowohl Bildungs- als auch Wirtschaftsbürgertum gewichteten die individuelle Leistung und schätzten regelmäßige Arbeit, Hochkultur, Bildung und Wissenschaft. Durch ihre bürgerliche Lebensführung mit dem Hochhalten des Familienideals transportierten sie das bürgerliche Milieu in die nächste Generation.
Im Zuge des 19. Jahrhunderts entwickelten sich beide Varianten auseinander, das Wirtschaftsbürgertum unterschied sich aufgrund seines Lebensstils und seiner materiellen Grundlagen immer mehr vom Bildungsbürgertum und distanzierte sich von ihm. Die Einheit innerhalb des Bürgertums ging verloren und es entwickelte sich eine eklatante Kluft innerhalb des Bürgertums hinsichtlich Einkommen und wirtschaftlicher Stellung.
Als die Industriealisierung Mitte des 18. Jahrhunderts in Großbritannien begann und sich bis Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland verbreitete, verbesserten sich die Verkehrsbedingungen und die Infrastruktur; Eisenbahn, Dampfschiff und der Telegraph kräftigten den Fernhandel und ließen kleinbürgerliche Besitz- und Erwerbsklassen entstehen. Insbesondere (Groß-)Kaufleute, Händler und Produzenten spezialisierten sich auf bestimmte Produktgruppen und gründeten Großbetriebe mit lohnabhängigen Arbeitskräften. Im Zuge davon lösten sich ständische Strukturen immer mehr auf und es entwickelte sich die kapitalistische Wirtschaft.
(TM)
Die Firma Buddenbrook war ein Familienunternehmen, das im Erbgang von einer Generation auf die nächste überging. Schon vom jugendlichen Alter an wird die Unternehmensnachfolge geplant und ein Sohn systematisch auf die Übernahme der Verantwortung vorbereitet.
Der für das 19. Jahrhundert typische Paternalismus umfasst in der Familienfirma bei den Buddenbrooks eine enge Verbindung von (Unternehmer-)Familie und Betrieb, mit einem persönlichen Kontakt zwischen Inhaber und Belegschaft und einer besonderen Treue der Arbeiter zu ihrer Firma. Demonstrativ spricht Thomas B. den heimischen Dialekt mit den Arbeitern, die langjährigen Mitarbeiter in der Firma, wie z.B. der Prokurist Friedrich Wilhelm Marcus, bleiben auch nach dem Tod des Konsuls Johann B. der Firma und ihrem neuen Chef loyal verbunden:
S. 254
„.Mein seliger Mann hat in seinen letztwillligen Verfügungen den Wunsch ausgesprochen, Sie möchten nach seinem Heimgang Ihre treue, bewährte Kraft nicht länger als fremder Mitarbeiter, sondern als Teilhaber in den Dienst der Firma stellen.“ „Gewiss, allerdings, Frau Konsulin“, sprach Herr Marcus. „.Ich weiß vor Gott und den Menschen nichts Besseres zu tun, als Ihre und Ihres Sohnes Offerte dankbarst zu acceptieren…
Familie Buddenbrook ist mit ihrem Besitz und ihrem Ansehen 1835, zu Beginn des Romans, eine angesehene bürgerliche Familie, im damals gängig werdenden Verständnis des Wortes, nämlich Angehörige der besitzenden Schicht’. Zur Einweihung des Hauses erscheinen Mitglieder des Besitz- und Bildungsbürgertums, die zu den tonangebenden, gesellschaftlich führenden Familien der Stadt gehören und deren Söhne und Töchter, ihr Verhalten und ihre Karriere aufmerksam registriert werden.
Der gemäßigte Liberalismus des Bürgertums in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte noch die Vorstellung von einer sich verbreitenden Mittelschicht, einer Verbürgerlichung der Gesellschaft mit erweiterten Bürgerrechten und einem sozialen Ausgleich. Voraussetzung waren Freiheit (Möglichkeit der Selbstbestimmung) und Gleichheit, von denen man Wohlstand und Gerechtigkeit erwartete320, denn Armut und Not hatten aus bürgerlicher Sicht ihre Ursache stets im persönlichen Versagen.
Die Wirtschaft, so war die Auffassung, sollte sich frei ohne willkürliche staatliche Intervention entwickeln, und zum Idealbild des Unternehmers gehörte eine bürgerliche Lebensführung, Selbstdisziplin und Verzicht auf egoistische Befriedigung privater Wünsche.
Gewerbefreiheit, Freihandel und der Ausbau des Zollvereins verhalfen vielen Bürgern zu geschäftlichem Erfolg und machten sie damit zu typischen Vertretern der städtischen Honoratiorenschicht.321
Die Interessen zwischen dem Bürgertum als soziale Schicht - und als eine solche erkannte und bekannte sie sich - und dem Volk waren unterschiedlich. Das nationalliberal gesinnte Wirtschaftsbürgertum, der Teil des Bürgertums, der selbständiger gewerblicher Arbeit nachging, sah sich immer mehr den Angriffen von den wirtschaftlich Abhängigen ausgesetzt. Der wirtschaftliche und soziale Strukturwandel führte in der modernen Industrie- und Verkehrswirtschaft zur Ausbildung großer sozialer Unterschiede und zu negativen Folgen für die Arbeiter. Es kam zu Arbeitslosigkeit und Pauperisierung, und die Schere zwischen arm und reich, zwischen gebildet und ungebildet, öffnete sich immer mehr. Erntekrisen und Bevölkerungswachstum führten zur Massenarmut, die nicht individuell verschuldet war.
Angesichts der Entstehung der industriellen Lohnarbeiterschaft und des Massenpauperismus ab den 1840er Jahren war der Gedanke einer Verbürgerlichung der Gesellschaft eine utopische Hoffnung.322,,..mit dem Vordringen der bürgerlichen Marktwirtschaft und Marktgesellschaft, mit dem Kauf menschlicher Arbeitskraft als Ware, die auf vielfältigen Arbeitsmärkten erworben werden kann, [ist] eine deprimierende Abhängigkeit und menschliche Degradierung verbunden.“323
Im Zuge der Industrialisierung und der damit sich entwickelnden sozialen Ungleichheit erhielt das Wort „bürgerlich“ nun eine eher exklusive anti-proletarische Dimension324 Im Kaiserreich wuchs die Zahl der großen Unternehmen und damit der Wirtschaftsbürger, die eine akademische Bildung in naturwissenschaftlichen Fächern besaßen, und während man das Bürgertum nicht als eigene Klasse bezeichnen konnte, war die Bourgeoisie mit ihren Unternehmern und Arbeitgebern durchaus eine solche.325
Großeigentümer und Industrielle in Industrie und Handel, die „Bourgeoisie“, verdrängten das mittlere Bürgertum und lösten durch den fortschreitenden Differenzierungsprozess und der Arbeitsteilung „die innere, lebensweltlich fundierte, von der Ähnlichkeit der Lebensaufgaben sich herleitende Einheit der bürgerlichen Familie und mit ihr zugleich der bürgerlichen Gesellschaft mehr und mehr auf.“326 „Der Aufstieg der Marktwirtschaft, die anti-ständischen Gesetzesformen wie auch der Siegeszug des zunehmend zentralisierend modernen Staates höhlten ihre ständische Exklusivität aus und zerstörten am Ende ihre Identität.“327
Der Idee der „klassenlosen Bürgergesellschaft“ wurde ein Ende gesetzt. Die Kluft zwischen der Masse der Handwerksmeister und Kleinhändler einerseits und den Großkaufleuten und Industriellen andererseits vergrößerte sich immer mehr. Bürger und bürgerliche Familien behaupteten nur dann ihren sozialen Status, wenn sie die neuen Rollen und Funktionen übernehmen konnten und zu Unternehmern wurden.
Die Regierung der drei Jahrzehnte vor dem 1. Weltkrieg begünstigte das Wirtschaftswachstum. Der Begriff „Bürger“ bezog sich von nun auf die mit Großbesitz und Macht ausgestattete Bourgeoisie und ein einflussreiches Bildungsbürgertum.
„Innovationsfreudige Söhne aus der oft industriefeindlichen Welt des traditionellen, handelskapitalistisch orientierten Stadtbürgertums stellen vielleicht die Hälfte oder sogar eine knappe Mehrheit und zehren vom „sozialen Kapital“ der Familienressource. Die anderen sind Homines novi, imponierende Persönlichkeiten wie Melissen und Hansemann.“328
10.2 Das Bildungsbürgertum
Das Bildungsbürgertum sah Bildung als ein hohes Gut und als ein Gebiet, auf dem man sich dem Adel überlegen fühlte. Bildung, das hieß, sich „aktiv das Wissen, die Fähigkeiten und die Erfahrungen anzueignen, die bei der Entwicklung zu einer gereiften und aufgeklärten ,Persönlichkeit’ als förderlich und notwendig angesehen wurden.“329 Man versuchte, einen Abstieg in eine andere Klassenlage zu verhindern und mit ökonomischen und sozialem Kapital auch einem weniger begabten Sohn eine bürgerliche Karriere vermitteln.
Zu den „gebildeten Klassen“ zählten die Akademiker, alle verband der gemeinsame Bildungsgang über das humanistische Gymnasium, reformiert durch Wilhelm von Humboldt.
Das Bildungsbürgertums war heterogen und bestand aus Akademikern in staatlichen Diensten, wie z.B. Lehrer und Pfarrer, Professoren, Gymnasiallehrer, sie waren durch erworbene Bildungspatente zur Berufslaufbahn in Staat, Kirche und Militärdienst berechtigt und hatten so die Chance des sozialen Aufstiegs bzw. des Statuserhalts.330 „Ohne die akademisch gebildeten Beamten wäre das Bildungsbürgertum vor allem bis in die 1860er und 70er Jahre [..] erheblich schwächer gewesen [.]“331
Ärzte und Juristen zählten ebenfalls zum Bildungsbürgertum, beide durch Professionalierungstendenzen ihres Berufs von einer wissenschaftlich-akademischen Ausbildung geprägt und im zeitgenössischen Verständnis „selbstständig“. Sie waren trotz evtl. fester Anstellung professionell autonom. Distanzen zwischen Juristen, Theologen, Medizinern und Lehrern gab es aber durch ihren differenten Status von Beginn an.
Als ein Aufsteigerberuf für Angehörige aus der Mittelschicht galt der Beruf des Pfarrers, er gehörte wegen seines wissenschaftlichen Studiums zur akademischen Elite und leistete „in ihrer kulturprotestantischen Variante.dabei einen besonderen Beitrag zum bürgerlichen Wertekanon“.332
11. Das Bürgertum im 20. Jahrhundert - bürgerliche Lebensform im Wandel und das Fortleben bildungsbürgerlicher Traditionen
11.1 Der Niedergang der bürgerlichen Denk- und Lebensformen zu Beginn des 20. Jahrhunderts
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts trugen politische, gesellschaftliche und kulturelle Faktoren trugen dazu bei, dass sich die Bedeutung des Bürgertums und seiner Denk- und Lebensformen marginalisierte und es seine ehemals tragende Funktion verlor.
Eingesetzt hatte der Zerfall des Bürgertums als Sozialform im Ersten Weltkrieg, als das Individuum in die größere Gemeinschaft der Deutschen einschmolz und der Wunsch nach einem gesellschaftlichen Aufbruch erkennbar wurde. Statt der Bürgerlichkeit wurde von jetzt an das Nationale zum Kernpunkt der Politik, der Einzelne ordnete sich in das eine Einheit präsentierende Gesamtgefüge ein.333
Im Bürgertum herrschte grundsätzlich die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Aufgrund der Tatsache, dass ein freier Zusammenschluss bürgerlicher Individuen nun nicht mehr möglich war, belegte man den Begriff „Gesellschaft“ negativ, den der „Gemeinschaft“ aber positiv. Diese erlebte das Bürgertum bei Kriegsausbruch, als aus einer zerrissenen Gesellschaft eine „Volksgemeinschaft“ wurde. Statt des Begriffs „Klasse“ verwendeten Bürger den positiven Gegenbegriff „Stand“, Stände implizierten nicht die Spaltung der Gesellschaft.
Als im November 1918 der Kaiser abdankte und der monarchische Fürstenstaat ein Ende hatte, entstand eine Verfassung, die grundlegende bürgerliche Prinzipien hatte, wie Gewaltenteilung, Wahlberechtigung für alle erwachsenen Männer und Frauen, Unabhängigkeit der Rechtsprechung, all das war in der Weimarer Verfassung grundgelegt. Das Bürgertum aber begrüßte es ganz und gar nicht freudig, es hatte Angst vor einer bolschewistischen Revolution wie in Russland.
Den Versailler Vertrag mit seinen Forderungen der Gebietsabtretungen und den Reparationszahlungen sah man als Demütigung an, und die Geldentwertung sowie die großen Summen für die Reparationszahlungen wirkten sich auf die Verteilung von Einkommen und Vermögen aus: Die Bürger trafen dauerhafte Verluste ihrer Vermögensanlagen, die nun an Wert verloren, und sahen sich materiell und sozial bedroht.
Viele der Bildungsbürger, wie z.B. Akademiker im öffentlichen Dienst und Beamte, mussten Einkommenseinbußen in Kauf nehmen und weil die steigenden Rohstoff- und Halbwarenpreise ihre Gewinne reduzierten, gab es auch unter den Wirtschaftsbürgern nur wenige „Inflationsgewinner“.334 Zwar bildete für viele das Familienvermögen den Rückhalt für ein standesgemäßes Leben, doch mancher war gezwungen, Dienstpersonal zu entlassen und seinen Konsum so weit einzuschränken, dass ein bürgerlicher Lebensstil aufgeben werden musste.
Von dem ursprünglichen Ziel, einer ständeübergreifenden und individualistischen, auf die Fähigkeiten des Einzelnen basierenden Gesellschaft, war nichts geblieben. Der „soziale Volksstaat“ stellte Privilegien in Frage, die der monarchistische Staat dem Bürgertum durch gehobene Positionen und „Bildungserbrechte“ der Kinder (privilegierter Schulbesuch) reserviert hatte und in der Wohltätigkeit, einer wichtigen Distinktion der Bürger, arbeitete nun die organisierte Arbeiterschaft mit.
Die Weimarer Republik schrieb die grundsätzliche Gleichberechtigung der Frau vor, und damit öffneten sich bis in die 30er Jahre Universitäten und akademische Berufe für die Frauen. Der Frauenanteil an den Hochschulen stieg und das bürgerliche Bild von der alleinigen Aufgabe der Frau in ihrer Mutter- und Hausfrauenrolle wurde obsolet.
(AG)
Alma erlebt diese Zeit als junge Frau, Richard erinnert sich 1938:
S. 70
Dass sie vor neun Jahren, als sie einander kennenlernten, behauptete, eine moderne Frau zu sein, und dass sie zum Argwohn seines Vaters das Haar schon damals kurz trug … Ob sie wohl manchmal ihrem Studium nachtrauer…
Sie selber hat die verpassten Möglichkeiten durch den Abbruch ihres Studiums nicht vergessen:
S. 358f
Richards Hand, seine Fingernägel, vor allem die Fingernägel - sie sehen aus wie von den Leichenhänden im „Handkurs“ zu Beginn des Studiums. Das Studium. Das sie nie beendet ha…
Die Angehörigen der jüngeren Generation wollten prinzipiell anti-bürgerlich sein, für sie war die Zeit der bürgerlichen Prosperität beendet. Die bündische Jugend und auch die äußersten Rechten lehnten das Bürgertum ab, wohingegen in der bürgerlichen Weimarer Führungselite noch die Werthaltung der wilhelminischen Gesellschaft zum Ausdruck kam.
Als Gegenkultur zur bürgerlichen Gesellschaft entwickelte sich eine heroisch-militärische Kultur. Der Verein als eine für das Bürgertum typische kulturelle Organisationsform trat in den Hintergrund, verschiedene Bünde (Dürerbund, Reichshammerbund) bzw. die Ring- Bewegung/Zirkelbildung mit den ritualisierten Einbindungen der Mitglieder nahmen ihre Stelle ein.335All dies waren Verbände der bürgerlichen Reformbewegung, zielten auf eine anti-modernistische Subkultur, denunzierten die Herrschaft des Kapitals als jüdisch und waren gegen die Urbanisierung und Vermassung, gegen die Verrohung der Sitten und für den Beibehalt der nationalen kulturellen Tradition.336
Durch die Demokratisierung des Kommunalrechts kamen die Interessen der breiten Mehrheit der städtischen Bevölkerung zum Tragen. Und so kam es, dass bei den Kommunalwahlen 1919 viele stadtbürgerliche Honoratioren nicht wiedergewählt wurden, auch wenn Bürgerlisten unter den bürgerlichen Parteien das Bestreben zeigten, parteiübergreifend bei Sachfragen zusammenzuarbeiten und politische Gegensätze der Parteien dem nicht mehr im Wege stehen sollten.
Von nun an gab es für den Bürger in der Stadtverwaltung die Möglichkeit, seinen Bürgersinn unter Beweis zu stellen, und nicht wie bisher in Vereinen, Verbänden und in der Kirche, denn grundsätzlich fühlte er sich grundsätzlich dem Gemeinwohl verpflichtet.
Bei der sich nun anschließenden Darstellung der Ursachen für den Niedergang der bürgerlichen Denk- und Lebensform beziehe ich mich in erster Linie auf die Arbeit P. Kondylis „Der Niedergang der bürgerlichen Denk- und Lebensform“.
Das Bürgertum war unter der Prämisse der individuellen Meinungsfreiheit und Toleranz aufgetreten und wollte mit Pragmatismus und Rationalismus dem Wohle und Fortschritt der Gesellschaft dienen.337 Arbeitsethos und Berufsethik sahen den Beruf als bedeutsam für die Verwirklichung des Menschen an, Regelmäßigkeit im Tagesablauf, feste Gewohnheiten und Prinzipien galten als die Kernstücke bürgerlicher Normen. Die Arbeit in der Industrie jedoch zerlegte sich in Arbeitsteilung und in Arbeitsschritte und war eine ganz andere als die bürgerliche Arbeitsvorstellung vom handwerklichen Ideal des einheitlichen Produkts. Statt Familienunternehmen entstanden Konzerne, für die das Fachspezialistentum wichtig waren.
Der Verfall der bürgerlichen Lebensform gründete sich auf der Industrialisierung, der Entfaltung der Massendemokratie und der Verdrängung des bürgerlichen Liberalismus. Im politischen Bereich fand eine Umstrukturierung der Parteien zur Herausbildung politischer Massenorganisationen statt. Dadurch verloren die gehobenen bürgerlichen Elemente an Gewicht und der Honoratiorenverband wurde abgelöst von einer politischen Laufbahn der Parteimitglieder.
Im Bürgertum herrschte eine konservative Angst vor der Einebnung der sozialen Unterschiede und dem Untergang des Individuums in der Masse.
Das liberale Denken sah den Einzelnen als öffentliche Person mit Rechten und Chancen, die industrielle Massenproduktion machte den Menschen jedoch zum Konsumenten, das schlug sich in den Kulturformen nieder:
Merkmale der Massendemokratie gingen mit Massenproduktion in der Industrie, Massenkonsum und einer eigenen Lebensform und Mentalität einher, aus ihren Augen wurde von nun an die Welt betrachtet: Die Überwindung der Güterknappheit und der Überfluss bestimmten das Leben der Menschen und kurzfristige spontane Bestrebungen lösten langfristige Ziele ab. Es entstand ein anderer Menschentyp als der des Bürgers mit seinem puritanischen Habitus, und die bürgerlichen Werte verloren in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts immer mehr an politisch-moralischer Glaubwürdigkeit.
Eine mediale und urbane Massenkultur, wie die Entstehung des Kinos, auf Zerstreuung und Unterhaltung ausgerichtet, markierte vor dem 1. Weltkrieg das Ende der bürgerlichen Kultur.338Der Kinofilm bezog alle Schichten ein, war massendemokratisch, und hatte somit kein spezielles bürgerliches Publikum mehr wie das bürgerliche Theater.
Filme verbreiteten antibürgerliche und nichtbürgerliche Werte, die die Dominanz der bürgerlichen Kultur aushöhlten und „eine Grundlage der klassenübergreifenden Kulturformen des 20. Jahrhunderts“ bildeten.339 Das Lesen als privilegierte Praxis bürgerlicher Eliten wurde in den Hintergrund gedrängt.340
Das Bildungsbürgertum kritisierte diese „Unkultur“ der Massen, insbesondere die Entstehung des Kinopublikums, erkannte aber schon bald, dass aufgrund der wirtschaftlichen, technischen und naturwissenschaftlichen Entwicklung die klassische Kultur und die neuhumanistische Bildung keine Relevanz mehr haben konnten. Der Vorbildcharakter der klassischen, bildungsbürgerlichen Kultur zerfiel, statt Bildung gab es Unterhaltung und Zerstreuung ohne geistigen Wert - und das entsprach ganz und gar nicht der bisherigen bildungsbürgerlichen Vorstellung von Kultur, die die gesellschaftliche Pflicht und die Vernunft in den Mittelpunkt gestellt hatte.341
Stets propagierte das Bürgertum die freie Entfaltung der Kultur von Künstlern und Literaten und schuf so eine Kultur der Vielfalt und Autonomie. In dieser Vielfalt gab es aber auch durchaus Künstler, die die bürgerliche Auffassung von Harmonie und Geschmack und Stil ablehnten. Durch sie kam es zu einer Ablösung der bürgerlich synthetischharmonisierenden Denkfigur, die das Schöne an das Wahre und Gute band und Kunst eingebettet sah in die Gesellschaft und ihren Normen. Stattdessen entwickelte sich eine analytisch-kombinatorische Denkfigur im Bereich der geistigen Produktion mit dem Kult der modernen Technik, der Betonung des Urtümlichen im Gegensatz zur Macht des Geldes und mit einer Moral, die ganz und gar nicht der bürgerlichen entsprach.
Kunst hatte keine soziale oder didaktische Aufgabe mehr, sondern war ein freies Spiel.
Künstler stellten die Rationalitätsansprüche der bürgerlichen Wissenschaft ebenso in Frage wie das bürgerliche Menschenbild, angesagt waren das Dämonische, Irrationale, Triebhafte und Morbide, (Surrealismus, Dadaismus, Futuristen, Dekadenz.) das Schockierende wurde als wertvoll angesehen. Der Bürger war in den Augen dieser Künstler ein macht- und geldbesessener Bourgeois, den bürgerlichen Werten setzten sie
Hedonismus und Muße, Zynismus und Spontanität, dem bürgerlichen Realismus die transzendente Ebene entgegen.
Die literarisch-künstlerische Moderne und Avantgarde mit ihren antibürgerlichen Grundeinstellungen und Leitideen stellte das bürgerliche Menschenbild in Frage. Statt Harmonie und Geschmack stand Schockierendes, Irrationales und Triebhaftes nun im Mittelpunkt der Kultur von Kunst und Künstlern (Surrealismus, Dekadenz, Futuristen). In der Dichtung wurde das Triviale und Hässliche zum Thema, Triebe und Leidenschaften, z.B. in der naturalistischen Schilderung, man negierte das bürgerliche Menschenbild und die bürgerlichen Konventionen und stellte die Institution der Familie in Frage.
In den Künsten ging der bürgerliche Ernst verloren, ja: Kunst im bürgerlichen Sinne wurde abgeschafft.
Die Sprachwissenschaft betrachtete Sprache als System von phonetischen Elementen und löste mit dem analytisch-kombinatorischen Denkstil das bürgerliche Verständnis ab, das Sprache mit ihrem geschichtlichen und psychologischen Inhalt verbunden hatte.
In der Dichtung zeigte sich dies durch die Zertrümmerung der Syntax, der Montagetechnik und des Bewusstseinsstroms, der die äußere durch die innere Zeit ersetzte. Die Automatisierung des einzelnen Wortes, Montagetechnik, Assoziatives und Spontanes zertrümmerten die Syntax.
(AG)
Diese Kunst des Schreibens zeigt sich bei Philipp:
Er experimentiert mit der Organisation des Textes, mit Fiktion und Wirklichkeit; Erfindung und Spiel liegen im Text für ihn eng beieinander. „Die Personen werden in vagen Umrissen skizziert, es handelt sich also dabei eher um das, was man die subjektiven Faktoren nennen darf, denn um feste Individualitäten mit gleich erkennbaren Zügen.“342 Philipp experimentiert mit der Bedeutung des Assoziativen und Spontanen ohne handwerkliche Selbstzucht.
S. 54f
Kaise…
So hat man sich ein Gewitter über einem meiner Kronländer vorzustelle…
Stanislaus Baptist…
Über Austerlitz, wo kaiserliche Hoheit von Gottes Gnaden König von Böhmen sin…
Kaise…
Was allseits bekannt is…
Stanislaus Baptis…
Verzeihung, Majestät. Dort beliebte am 22. Juli dieses Jahres ein heftigs Gewitter niederzugehe…
Obwohl er Freude an diesen Entwürfen hat, ist Philipp unsicher, ob sie ihm weiterhelfe…
Vielleicht sind es ja doch nur Spinnereien, die sich auf nichts gründen, eine Art von bizarrem Wassertreten, nicht gänzlich passiv, aber auch nicht sonderlich produktiv. Oder destrukti…
In der Malerei erfolgte die Verdrängung der harmonisierten und idealisierten Darstellung des Menschen durch antibürgerliche Menschentypen: Im Naturalismus mit der Darstellung des industriellen Lebens und im Impressionismus mit der des exotischen, edlen Wilden ohne Bindung an sittliche Konventionen. Die Expressionisten räumten dem Gefühl durch die Farbe Priorität ein, die Kubisten zergliederten mit analytischer Absicht die Form in ihre geometrischen Bestandteile. Man stellte den Menschen nicht mehr in der Harmonie von Vernunft, sondern mit seinen Trieben jenseits von Gut und Böse in extremen Situationen dar, mit all seinen Leidenschaften - ganz und gar nicht das, was das Bürgertum ursprünglich für seine Kunstauffassung reklamierte.
Gegenstand und Bedeutung, wie sie im Bürgertum in engem Zusammenhang standen, wurden in der abstrakten Malerei entkoppelt, Kunst sollte keine Nachahmung der Natur sein, stattdessen machte man Gegenstände der Konsumwelt zu Kunstgegenständen.
Die Musik löste sich vom romantisch-sentimentalen Geist des Bürgertums, nicht Schönheit sondern die Form standen im Mittelpunkt, Kompositionen waren analytisch-kombinatorisch ohne symmetrisches Rhythmusempfinden.
In der Architektur gab es von nun an die Verbindung mit der Industrie und Technik, dem Schönheitsideal der Bürger setzte man die Funktion entgegen. Das bürgerliche Haus hatte mit seiner ästhetischen Form und Eleganz, der prunkhaften Einrichtung und den dekorativen Ornamenten der Repräsentation gedient und bürgerlichen Individualismus widergespiegelt. Dies musste dem Serienbau weichen, der die Funktion in den Mittelpunkt stellte - und damit war die Idee des Hauses als Träger und als Verankerung von Familientradition zerstört.
Die Soziologie als junge Wissenschaft verdrängte die Geschichtswissenschaft und leugnete mit ihrem Relativismus der Werte eine absolut gültige Moral und die Wahrheit als Reinform, soziale Interessen mit Machtansprüchen, Weltbilder und Werte als Ideologeme waren der Kern ihrer Untersuchungen.
Die bürgerliche Vernunftanthropologie mit einer festen Werteskala und ideologischethischer Orientierung musste einem Wertepluralismus Platz machen, statt der Kardinaltugenden des Bürgers waren von nun an Selbstverwirklichung, die Beschäftigung mit sich selbst und der Wunsch nach Selbstbestätigung und Anerkennung anzutreffen - ein massendemokratischer Individualismus.
(AG)
Philipps Hauptbeschäftigung ist es, sich sinnierend und fantasievoll mit sich, seiner Umgebung und seinen Träumen auseinanderzusetzen:
S. 50f
Den ganzen Vormittag bringt Philipp nichts zustande…
Nachmittags lungert er eine Weile mit einem belegtem Brot in der Diele herum. … Nicht, dass seine Moral sonderlich gut oder seine Lust sonderlich groß wäre. Er kommt über die erste Stufe nicht hinaus. Lange steht er am unteren Treppenabsatz und versucht, sich weniger miserabel zu fühle…
Statt des humanistischen Bildungsideals mit seinem Allgemeinwissen, das im Zusammenhang mit der Vervollkommnung der Persönlichkeit stand, entwickelten sich technisch-naturwissenschaftliche Schul- und Studiengänge mit dem Schwerpunkt auf Spezialisierung - das Bürgertum beklagte all dies und kritisierte es vergebens als „Verflachung“ .
Die soziale Rolle der Familie erfuhr ebenfalls im Zuge der Atomisierung der Gesellschaft und der Individualisierung eine Abschwächung, denn eine fortschreitende Arbeitsteilung forderte Mobilität und ließ nur ein Minimum an menschlichen Bindungen bestehen. Der Status der Jugend dominierte den Vorteil von Erfahrung und Alter, Energie und schnelle Anpassungsfähigkeit im Arbeitsprozess wurden verlangt. Die allgemeinen Umgangsformen veränderten sich.
11.2 Das Bürgertum im Nationalsozialismus
Eine komplette Abkehr von den bürgerlichen Wertideen und der politischen Bürgerlichkeit erfolgte nach dem Zusammenbruch der Weimarer Republik. Die nationalsozialistische Herrschaft und die Verbrechen dieser Zeit waren Folge „der Zerstörung der Weimarer Republik und der sie tragenden bürgerlichen Wertideen“.343 Der Erfolg der NSDAP, die sich als Protestpartei profilierte, hatte unterschiedliche Ursachen, u.a. war er die Folge einer Auflösung der bürgerlichen Parteien und der Rechtswendung der bürgerlichen Wähler. Diese hatten das aufgezwungene „System“ Weimar abgelehnt und sahen den Parteienstaat als Ursache für die Unregierbarkeit von Land und Kommunen und, ganz wichtig, für ihren eigenen drohenden sozialen Abstieg.
Weil alle sozialen Grundlagen von Bürgerlichkeit bzgl. deren Lebensform und Wertvorstellungen verschwanden, brachte man dem Nationalsozialismus weniger Vorbehalte entgegen.
Hitler verstärkte den Zerfall der Bürgerlichkeit durch die Zerstörung der Familie als Sozialisationsraum.
(AG)
Peter sucht eine Ersatz-Familie in den Jugendorganisationen der NSDAP.
Die NSDAP wurde für das Bürgertum attraktiv, denn sie stand für etwas, was für den Bürger von Bedeutung war: das Privateigentum.
Unternehmer, Ärzte oder sonstige Bildungs- und Wirtschaftsbürger fanden sich bereit zur Kooperation und Mitarbeit.344 Ihnen kam Hitler mit der Schaffung des Berufsbeamtentums entgegen.Bürger versuchten nun, in diesem Bereich Einfluss zu gewinnen: Das Bildungsbürgertum erlebte in der nationalsozialistischen Zeit im öffentlichen Dienst und in den staatlichen Militär- und Zivilverwaltungen zahlreiche Chancen des Aufstiegs, der Arztstand genoss eine Aufwertung. Größere und kleinere Gewerbetreibende profitierten vom Konjunkturaufschwung, Unternehmer und Kaufleute von der „Arisierung“ jüdischer Firmen und Geschäfte - insofern war die Zeit der NS-Herrschaft für Wirtschafts- und Bildungsbürgertum eine Zeit der Prosperität.
(AG)
Richard Sterk ist das Beispiel eines Bürgers, der zwar offen Vorbehalte gegenüber der NSDAP zeigt, aber nicht den Bruch mit dem Regime um jeden Preis herausfordert, er bleibt vorsichtig und damit unbehelligt.
S. 26
Richard musste nie für die Jahre vor 1945 Rechenschaft ablegen, als es um seine Karriere gin…
Die Idee des Kollektivs bzw. einer Volksgemeinschaft löste als neue Orientierung die Idee der bürgerlichen Freiheit ab. Der totalitäre Nationalsozialismus sah das Volk nicht als eine Summe der Individuen sondern als Volksgemeinschaft, dies war aber für den Bürger, der sich als Teil eines Ganzen sah, durchaus akzeptabel und attraktiv. Befehl und Gehorsam statt des rationalen Arguments und das Führerprinzip, das keine Bindung an ein Gesetz vorsah, ließen bürgerlichen Individualismus und das, was die bürgerliche Bewegung im 19. Jahrhundert errungen hatte, zur Makulatur werden.345 In den Städten herrschte das „Führerprinzip“: Parteigänger der Nationalsozialisten wurden 1933 von Gauleitern als neue Bürgermeister eingesetzt, und während die ehrenamtlichen Gemeinderäte beratende Funktion hatten, besaß der Bürgermeister die alleinige Verantwortung. Die Zahl der Studierenden sank durch den Ausschluss der Juden und die Reduzierung des Frauenanteils.
Von den Idealen der „Bürgerliche Gesellschaft“ blieb nichts, die liberalen Freiheitsrechte wurden verraten und die demokratischen Gleichheitsrechte durch Parteiloyalität ersetzt. Und damit war der bürgerliche Gesellschaftsentwurf einer von den Bürgern selbst verwalteten Stadt verschwunden.
Eine kritische Abneigung gegenüber der NSDAP war aber lediglich bei den Bildungsbürgern der älteren Generation vorhanden, die akademische Jugend hatte die bürgerliche „Normalität“ und Solidität bereits nicht mehr erfahren.346. Im Gegenteil, eine antibürgerliche Jugendbewegung äußerte Kritik am Bürgertum, ähnlich der NSDAP: Der Bürger galt ihnen als dekadenter, nur an das eigene Wohl denkende Moralist mit antiquierten Umgangsformen, sie kritisierte das Standesdenken und den Materialismus und begeisterten sich stattdessen für das Einfache und Gesunde, für die Natur.
11.3 Das Bürgertum nach 1945 in Westdeutschland und in Österreich
Nach der NS-Zeit und der Vertreibung und Ermordung jüdischer Bürger/innen war dem Bürgertum mit der Vernichtung ihrer Kultur die Seele genommen, eine bürgerliche Lebensführung war mangels materieller Basis zunächst niemandem möglich.347 Eine „Entbürgerlichung“ vollzog sich insbesondere bei den Wirtschafts- und Bildungsbürgern und bei mittelständischen Existenzen, die als Flüchtlinge in den Westen flohen. Sie hatten ihren Besitz in der Heimat zurücklassen müssen und trotz Lastenausgleich fristeten sie nun ein wenig bürgerliches Leben. Erst in den 50er Jahren konnten sie durch die gute konjunkturelle Lage wieder in einem bürgerlichen Beruf Fuß fassen.
Es existierte zwar nach 1945 und existiert bis heute k e i n e erkennbare Sozialformation Bürgertum mehr, das eine gesellschaftliche und politische Führungsrolle übernehmen will, jedoch waren bürgerliche Kräfte bereits nach 1945 bestrebt, die politische Neuordnung als Restituierung der eigenen Stellung im Bildungswesen, im ökonomischen Bereich und auf dem Gebiet des Beamtenrechts zu übernehmen.348 Sie propagierten das Leitbild politischer Bürgerlichkeit und passten es der neuen Zeit an: Das politische Engagement im demokratisch-parlamentarischen Rechtsstaat wurde die Norm. „.das zeitgemäß revidierte Projekt der bürgerlichen Gesellschaft’ [übte], ohne dass immer explizit von ihm die Rede war, ebenfalls eine neue Attraktionskraft aus.“349
Zur Erinnerung: Die Utopie der „Bürgerlichen Gesellschaft“, im späten 18. Jahrhundert entworfen, sollte eine Vereinigung von Individuen sein, die sich durch Besitz und Bildung auszeichneten, politisch und wirtschaftlich handlungsfähig und von staatlichen Übergriffen befreit waren und sich für das Gemeinwohl einsetzten. Ein Rechtsstaat hatte die Bürger zu schützen und die Menschenrechte zu garantieren.
Das obere Wirtschaftsbürgertum konsolidierte sich nach 1945 und schon bald tauchten auch bildungsbürgerliche Formationen auf, die sich berufsbezogen formierten und ihre Interessen vertraten. Sie etablieren sich im marktwirtschaftlich-kapitalistischen System mit seinen sozialpartnerschaftlichen Strukturen; anders als in der DDR, wo Bürgern der Weg zur Universität versperrt wurde und die Entnazifizierung den Verwaltungs- und Justizapparat gründlich säuberte.
11.3.1 Restauration in den 50er Jahren
In der Zeit des Wirtschaftswunders und der konsumorientierten Wohlstandsgesellschaft fand in den 50er Jahren eine Ausbreitung einer habituellen Bürgerlichkeit statt, verbunden mit dem Wunsch, endlich Normalität nach der Zeit der NS-Kriegsverbrechen zu erleben: Der Einzelne zeigte zupackende Tüchtigkeit, das Wirtschaftswunder und Erfolg verdrängten die Erinnerung.
Damalige positive Wertungen sahen den Bürger als einen „anständigen Menschen, der sein Auskommen hat, sparsam und solide lebt“.350
Traditionelle Normen und Praktiken, Leitbilder bürgerlicher Lebensführung erlebten in den 50er Jahren in Westdeutschland und in Österreich eine Renaissance, bürgerliche Normalität und traditionelle bürgerliche Wertevermittlung fanden ihre Verbreitung.
Typisch dafür war die Rückbesinnung auf die Bedeutung der Familie mit der bürgerliche Vorstellung. Für sie war die Tradierung der familientragenden Frauenrolle essentiell.
In einer Radiosendung „Das Diakonische Jahr“ im Bayerischen Rundfunk hieß es 1954: „Haben unsere jungen Frauen die rechten Berufe, also solche, die es ihnen ermöglichen, die von Gott in sie gelegten mütterlichen reichen Gaben zu entfalten? Der Ehemann braucht [.] mehr als nur eine ausgezeichnete Sekretärin oder eine perfekte Köchin, auch mehr als eine weltgewandte Akademikerin. Er verlangt nach einem mütterlichen Menschen, der auch dann nicht verzagt, wenn Leid, Krankheit und Siechtum ins Haus kommen.“ 351 Die Aufgaben als Mutter und Hausfrau waren die vorrangigen Aufgaben einer Frau, diese Vorstellungen wurden vom Staat geteilt. Berufsfrauen galten dagegen als familienentfemdet, wurden verantwortlich gemacht für den Verlust der Beziehungen innerhalb der Familie.
Mütter wollten und sollten sich um ihr Kind kümmern und es nicht in fremde Hände geben.
Zur gleichen Zeit vermittelte die Kirche die ihr eigene strenge Sexualmoral.352
Eine Veränderung des Denkens begann in den späten 50er Jahren, als bürgerliche Liberalität statt Konservativismus und Autorität nach Meinung einer neuen Generation aus dem akademisch gebildetem Bürgertum die Gesellschaft prägen sollten.
11.3.2 Das Bürgertum in den 60er und 70er Jahren - Kritik und Protest
Mit dem Wirtschaftswachstum entwickelte sich eine Wohlstandsgesellschaft bzw. Mittelstandsgesellschaft, in der die Klassenunterschiede gedämpft und Trennlinien, die einst das Bürgertum von unten abschirmten, durchlässiger wurden.
Die Studentenbewegung verstand sich als antibürgerliche Protestbewegung und bekämpfte das Bürgerliche in Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Habermas, ein philosophischer Vordenker der damaligen Bewegung, kritisierte die bürgerliche Ideologie wegen ihres Rückzugs ins Private und der fehlenden Möglichkeit, Solidarität zwischen Gruppen oder Individuen zu schaffen.353
Diese Aufbruch- und Protestbewegung in den 60er Jahren gilt als „antibürgerliche“ Revolte: Studenten und Gymnasiasten provozierten durch Missachtung bürgerlicher Kleiderstandards und Benimmregeln, durch freie Sexualität und eine Ablehnung der tradierten Geschlechterordnung. Statt Erfolg und Leistung propagierte sie Selbstverwirklichung und antiautoritäre Erziehung. Ingrids Äußerungen im Gespräch mit ihrem Vater spiegeln dies wider:
S. 210
- Alt und gediegen: Für mich sind das Werte, sagte e…
Und Ingrid lapida…
- Für mich nich…
Er sieht das Etikett, das er gerade verpasst bekommen hat, als wäre es ihm mit Spucke auf die Stirn geklebt: Spießig - unflexibel - gestrig. Nicht alt, sondern veraltet. … Denn dass ihr sein Leben insgesamt gegen den Strich geht, hat sie ihm oft genug spüren lasse…
Es fand ein Wertewandel statt: die charakteristischen bürgerlichen Pflicht-Werte wurden abgelöst von den Erlebniswerten. Eine neue Generation von akademisch gebildeten Bürgern propagierte bürgerliche Liberalität statt Konservativismus, und eine neue Frauenbewegung seit Ende der 60er Jahre formulierte deutlich das Recht auf mütterliche Erwerbstätigkeit. In den 70er Jahren erhielten Frauen die rechtliche, ökonomische und soziale Gleichstellung. Für sie entschied von nun an die individuelle Leistung und ihr eigener berufliche Erfolg, welchen bürgerlichen Status sie einnahmen.
Heirat und Mutterschaft waren kein Grund zur Berufsaufgabe mehr, sondern sollten mit Berufstätigkeit vereinbart werden, z.B. bei Ingrid 1970.
(AG):
S. 237ff
Sie putzt gerade die Zähne, als das Telefon sein Klingeln gegen die Metallspinde wirft. Es ist Schwester Bärbel, die wissen will, ob es Ingrid gutgeht. Ingrid rennt rüber und hilft Blut abnehme…
… die momentane Mann-Kinder-Berufstätigkeit…
Also weiter zum Konsum, einkaufen, sehr kursorisch, Hauptsache viel ..Dann die nächst eilige Angelegenheit: Die Weihnachtsfilme zum Entwickeln bringen …
Ingrid legt sich auf die Couch …
Mit einer Zigarette zwischen den Lippen wäscht Ingrid einen Teil des Geschirrs ab. …
Ingrid stürzt sich ins Kochen …
Durch die soziale Öffnung in der höheren Bildung kam es zu einer „verbürgerlichten“ Aufstiegsgesellschaft. Der materielle Lebensstandard und der damit einhergehende Wohlstand führte zu einer Verbürgerlichung der Arbeiter und einfachen Angestellten, die nun ihrerseits das Leistungsdenken und die Lebensformen, Verhaltensweisen, Eigentumsorientierung und ein bürgerliches Familienbild mit dem allein verdienenden Ehemann übernahmen. 354 Wohlhabende bürgerliche Studenten sahen als geistige Vorreiter die Gründung einer Familie nicht mehr länger als unhinterfragtes Lebensziel bürgerlicher Existenz.355 Kinder- und Ehelosigkeit wurden zu einer Option der Lebensgestaltung, wie das Beispiel von Philipp zeigt:
S. 14
… (sie hält ihn für nett, aber harmlos und hat sich deswegen schon einmal für einen anderen entschieden…
S. 94
Bei der Gelegenheit fällt ihm auch wieder ein, dass er sich schon seit längerem wundert, wie selbstverständlich er sich vor einigen Jahren damit abgefunden hat, Nummer zwei zu sein, wie anstandslos er sich seit Johannas Heirat mit der stundenweisen Liebe begnügt und wie restlos er es für erwiesen hält, dass Johanna ihn mehr liebt als Franz …
S. 390
Er wird … über die Liebe nachdenke…
11.3.3 Bürgerliches Selbstverständnis seit den 80er Jahren und bürgerliche Traditionen heute
Wie steht es mit der Existenz des Bürgertums Ende des 20. Jahrhunderts und Anfang des 21. Jahrhunderts?
Der Begriff „Bürger“ ist heute wieder, anders als in den Jahren der Weimarer Republik und in den 70er Jahren, populär und bindet bestimmte politische Erwartungen an sich.356 Waren die Begriffe „bürgerlich“, „bürgerliche Gesellschaft“, „Bürgerlichkeit“ im 18. Jahrhundert Gegenentwürfe zum absolutistischen Staat und zum damaligen Status quo, gekoppelt an die Ideen der Fortschrittlichkeit und Vernunft, greift der heutige Staatsbürger auf den Begriff ,Bürger‘ zurück, um die Zugehörigkeit zu einem Staatswesen deutlich zu machen.
Antibürgerlichkeit ist selten zu finden, der Begriff „Bürger“ ist heute politisch-ideologisch konnotiert und findet positive Verwendung: Sei es, wenn es um „Bürgerinitiativen“ geht, in denen mündige Bürger ihre freie Meinung äußern und sich politisch einsetzen, oder wenn die „bürgerliche Kultur“ von kritischen Intellektuellen z.B. in der Wohnkultur wieder entdeckt und gelebt wird.
Die heutige „Zivilgesellschaft“ beinhaltet ein aktives politisches Engagement der Bürger, Bürgerinitiativen und Vereine werden zu Orten der demokratischen Meinungs- und Willensbildung, damit verbunden sind von Bürgern frei getragene sozialkaritative und kulturelle Einrichtungen und Stiftungen.
Auch der Begriff „Bürgertum“ existiert noch, er ist ein Sammelbegriff für bestimmte Erwerbsklassen. Mit der Universalisierung des Bürgerbegriffs im Begriff des „Staatsbürgers“ ging das Bürgertum in die „Arbeitnehmergesellschaft“ ein.357
Die Auffassung, ob ein Bürgertum denn heute noch existiert, ist geteilt:
Die einen sprechen zwar vom Untergang des Bürgertums in der Entfaltung der industriellen Gesellschaft, dem damit einhergehenden Frauenwahlrecht und einer parlamentarischen Regierungsweise - gleichzeitig kann aber auch von einerbürgerlichenGesellschaft oder Zivilgesellschaft gesprochen werden, „deren weibliche wie männliche Mitglieder unter einer bestimmten Verfassung leben, die die wirtschaftliche und politische Grundordnung regelt und einen kulturellen Standard definiert.“ 358 Eine Diffusion des Bürgerlichen ist im Zusammenhang zu sehen mit der zunehmenden Rolle der „Massen“ als Konsumenten. Der Konsumbürger als der neue Typus der modernen westlichen Gesellschaft unterscheidet sich vom Bildungs- und Wirtschaftsbürger, denn er stellt den Verbrauch und den Verzehr in den Mittelpunkt .359 Der Markt verheißt ihm Gleichheit und Freiheit, und ist es nicht die neue Einkaufsform mit der Freiheit der Wahl und dem Treffen der eigenständigen Entscheidung in der Fülle der Waren, die hier dem Selbstbild des mündigen Bürgers entspricht? Wer Geld besitzt, hat die freie Entscheidung es auszugeben. Durch diese Orientierung auf die individuelle Bereicherung veränderten sich Beziehungen zwischen Kindern und Eltern, Jungen und Alten, traditionelle Werte werden durch ökonomische Werte ersetzt und anders als der Bürger des 19. Jh. lässt der Konsumbürger oftmals gesellschaftliches Engagement und soziale Verantwortung vermissen .
Die Massenkultur mit ihrer Konsumorientierung, entstanden in der Zeit der Weimarer Republik, ist das neue gesellschaftliche Ideal und orientiert sich an der „Leistung des Einzelnen, am privaten Erfolgsstreben und an der Teilhabe am Massenkonsum.“360 Andererseits beobachtet man eine Expansion bürgerlicher Positionen: „.. von einer Abschwächung des bürgerlichen Selbstverständnisses hinsichtlich Leistung und Arbeitsethos [kann] in der Wirtschaftselite keine Rede sein.“361 „Bürgerlichkeit“ meint dabei Kulturpraktiken, Werthaltungen und Prinzipien, die aus dem Bürgertum des 19. Jahrhunderts stammen und die Zeit bis heute überdauert haben.
Auch wenn sich der deutsche „Bürger“ des 20. Jahrhunderts in seinem Lebensgefühl von seinen Vorfahren im 19. Jahrhundert unterscheidet - ein Fortbestehen von Einzelelementen der Bürgerlichkeit ist seit 1945 zu verzeichnen - doch kann man nicht von einer bürgerlichen Gesellschaft im Sinne des 19. Jahrhunderts sprechen.362
Das politische Verständnis des Begriffs „Bürgerlichkeit“ umfasst als zentralen Wert zunächst das liberale Moment, d.h. die Entfaltungsmöglichkeiten des Einzelnen und dessen Individualität. Hinzu kommt das Moment der Bereitschaft, sich als Bürger aktiv zu betätigen und die soziale Komponente, eine höhere und kulturelle Lebensqualität als andere Bevölkerungsteile zu haben und sich als Bürger in Relation zu anderen zu erfahren.363 So zeigte sich Bürgerlichkeit in den 80er Jahren (Bürgerinitiativen/ Friedensbewegung) als ein Protest sich verantwortlich fühlender Bürger in Protestbewegungen und gemeinsamen Aktionen. Sie beriefen sich auf das Element der politischen Partizipation und Mitverantwortung, indem sie an Menschlichkeit und die Verantwortung der Politiker für das Überleben der Menschheit appellierten.364
„Das Bürgertum, durch Bildung geprägt, ist als Klasse untergegangen, ja als Lebensform aber in dem […] Leben mit der Kunst, haben wir seinen Lebensentwurf übernommen und verallgemeinert. Der moderne Umgang mit Kunst als Teil der Lebenserfüllung ist Erbe des Bürgertums, wir sind seine Erben.“ 365 Bürgerliche Kultur scheint heute weiterhin wirkungsmächtig und attraktiv und gibt Männern und Frauen Orientierung in den vielen existierenden Lebensstilen, für die Ausbildung individueller Anlagen und bei der Lösung von Sinnfragen.366
Der genaue Blick auf die Familienromane wird zeigen, inwiefern Bürgerlichkeit heute in den Familien noch anzutreffen ist und ob man von einer partiellen Wiederbelebung bürgerlicher Traditionen sprechen kann.
12. Bürgertum in der DDR
Gab es die o.g. Arten des Bürgertums auch in der DDR? Die DDR definierte sich als ein Arbeiter- und Bauernstaat und damit als anti-bürgerlich und wollte wirtschafts- und bildungsbürgerlichen Kreisen keinen Raum mehr gegeben. Durch die Enteignung von Konzernen und Junkern sollte, so war das Ziel, ein Friedensstaat entstehen und die Ursache für Kriege und Expansion beseitigt werden.367
„Bürgerlich“ meinte im Sozialismus keine soziale Zugehörigkeit sondern eine politische Gesinnung, die sich gegen den sozialistischen Staat richtete; bürgerlich’ zu sein, hieß, eine individualistische, subjektzentrierte und fortschrittsfeindliche Einstellung zu haben. Das war nicht im Sinne des Sozialismus. Bürgerliche Verhaltensweisen galten als kritische/systemkritische Äußerungen und Verhaltensformen. Bürgerliche Symbolik im Äußeren hieß Andersartigkeit in der Kleidung und im Habitus und zeigte darin bereits ein Aufbegehren gegenüber dem Staatswesen der DDR.
(ER)
Sascha ist ein Beispiel hierfür:
S. 172f
Als er das Haus betrat, drang aus Saschas Zimmer laute Musik: Beatmusik, die er neuerdings hörte…
- Ist bloß Bio, teilte Sascha mit, währender mit einem kleinen silbernen Kreuz spielte, das er an einem Kettchen um den Hals tru…
- Nanu, sagte Kurt, bist du jetzt christlic…
- Nee, belehrte ihn Sascha. Ist ein Gammlerkreuz. Das Wort kannte Kurt aus dem Fernsehen - aus dem Westfernsehen. Dort war neuerdings öfter von Gammlern die Rede: langhaarige Gestalten, die Kurt irgendwie mit dieser neuen Musik in Verbindung brachte und die, so viel war klar, Arbeit grundsätzlich ablehnte…
Als Gegenentwurf dazu galt die sozialistische Persönlichkeit: Der pflichtbewusste und disziplinierte Werktätige, der Einsatz und Loyalität dem Staat gegenüber zeigt und durch Leistung und politisches Engagement aufsteigt.368
Im Zuge der Konstituierung des Arbeiter- und Bauernstaates schaltete die SED die bürgerlichen Eliten aus und ersetzte sie durch neue. „Eine gewisse Elitenkontinuität hat es offenkundig nur anfangs gegeben, und einen adäquaten Ersatz für die alte bürgerliche Funktions- und Wertelite zu schaffen, ist der SED später nur partiell gelungen.“369
12.1 Wirtschaftsbürgertum in der DDR
Innerhalb der DDR gab es einen synonymen Gebrauch der Begriffe Bürgertum/ Bourgeoisie bzw. Bürger/Kapitalist/Imperialist.370 Begründet liegt dies im Marxismus, der das Bürgertum in Abgrenzung zur Arbeiterklasse definiert: Der Besitz an Produktionsmitteln als Kriterium der Klasse des Wirtschafts- und Finanzbürgertums machte sie zur ausbeutenden „Bourgeoisie“, der herrschenden Klasse in der kapitalistischen Gesellschaft.371 Anders als das Bildungsbürgertum, das „weitestgehend aus dem Blick [geriet], da die marxistische Klassentheorie hierfür keine nähere Bestimmung vorsah.“372
Weitgehend positiv bewertete man in der DDR dagegen das Bürgertum des 18. Jahrhunderts, das sich vom Adel emanzipierte, innovativ wirkte und gesellschaftstreibend eine neue bürgerliche Gesellschaft zu etablieren gesucht hatte. Im Laufe der Geschichte verlor es jedoch seinen progressiven Charakter und seine humanistischen Ideale und wurde zur herrschenden Ausbeuterklasse und war damit, so glaubte man in der DDR, verantwortlich für das Heraufkommen des Dritten Reichs.373
Da auch das Besitzbürgertum, bestehend aus Handwerkern, Selbständigen und Kleinhändlern, in den Augen der DDR eine Stütze Hitlers war, veränderte man die Eigentumsordnung rigoros: Man zerstörte die Privatwirtschaft und baute mit Enteignungsaktionen ab 1946 den volkseigenen Sektor aus (VEB-Volkseigene Betriebe), verstaatlichte Betriebe und band diese mit Halb- bis Zweijahresplänen in die zentrale Planwirtschaft ein. „Auf diese Weise wurde auf lange Sicht der Traditionsstrang wirtschaftsbürgerlicher und selbständiger wirtschaftlicher Existenz abgeschnitten.374
Indem man die Landwirtschaft kollektivierte und das Bankwesen und größeren Privatbesitzes abschaffte, ließ man alte Hierarchien, ererbtes Prestige und privilegierte Klassen verschwinden und verwandelte das Besitz- und Bildungsbürgertum in die sog . „sozialistische Intelligenz“ um, die nun vom Staat abhängig war.
Ohne Mithilfe der alten Fachkräfte jedoch, meist bürgerlicher Herkunft, war der Staat aber nicht aufzubauen und die „Intelligenzpolitik“ zeigt, wie dieser ideologische Klassenfeind gleichzeitig ein notwendiger Bündnispartner für die SED wurde.
Doch es gab durchaus Gruppen in der DDR, die die Traditionen des Bürgertums fortsetzten und Äquivalente zum Bürgertum darstellten, wenn auch von einem Weiterbestehen wirtschaftsbürgerlicher Gruppen im rudimentär fortlebenden selbständigen Kleinbürgertum nicht die Rede sein kann. Handwerker und kleine Unternehmer, die begehrte Mangelwaren produzierten, entwickelten im Laufe der Jahre eine Art Mittelstand, der zwar steuerlich durch die SED hoch veranlagt wurde, aber trotzdem ein weitaus höheres Einkommen hatte als Arbeiter und Angestellte. Die Erzeugnisse dieser Betriebe fanden guten Absatz und warfen Gewinne ab, doch schon bald galten auch diese „Unternehmer“ als Kapitalisten, deren Lebensstil nicht zur sozialistischen Gesellschaft passte und die sich am wirtschaftlichen Aufschwung bereicherten. So beschloss man 1972 deren Verstaatlichung375 und ein weiterer florierender Sektor, der gut funktionierte, wurde vernichtet.376
Die ehemaligen Besitzer machte man als wirtschaftliche Führungsschicht zu Leitern der Kombinate und zum Teil einer herrschenden Elite, die mit Funktionären der FDGB und Vertretern des Staats zusammenarbeitete.
Diese Art der Politik lehnten Menschen aus der Oberschicht oder dem Bürgertum, aus freien Berufen und Christen moralisch und politisch ab, wohingegen Menschen aus dem Arbeiter- und Bauernmilieu Chancen für sich entdeckten und mit dem sozialistischen Staat sympathisierten. Das erstaunt nicht weiter: Körperliche Arbeit mit „Lohn“ wurde gegenüber geistiger und leitender Arbeit mit „Gehalt“ um einiges besser bezahlt, eine Reinigungskraft im Schichtdienst verdiente mehr als ein Abteilungsleiter mit Hochschulabschluss, ein Kellner mit seinem Trinkgeld mehr als das Doppelte des Direktors.377
Was folgte war die Diskriminierung der ideologischen und gesellschaftlichen „Klassenfeinde“, d.h. der Christen, der politischen Gegner und eben der Angehörigen der „Bourgeoisie“:.Man verdrängte Menschen aus dem großbürgerlichen Milieu aus ihren Berufspositionen, diskriminierte sie in der Schule, verwehrte ihnen eine höhere Schulausbildung und ein Studium, so dass wohlhabende akademische Eltern sich für die Flucht in den Westen entschieden, insgesamt 3 Mio. Ostdeutsche.
Durch all diese politischen Maßnahmen und den Exodus des Mittelstandes und der Oberschicht vollzog sich eine „Entbürgerlichung“ und eine Homogenisierung der Bevölkerung378 Das Lebensgefühl der bürgerlichen Gesellschaft, das sich durch Maßstäbe wie Erfolg, gute Wohnadresse und Reichtum auszeichnete, gab es in der DDR nicht mehr. Ökonomische Selbständigkeit, Unternehmergeist und kommunale Selbstverwaltung waren nicht mehr präsent, ebenso wenig die bürgerlichen Strukturprinzipien wie der Markt, privates Eigentum und Individualrechte. Aufsteiger wurden belächelt und es hielt sich niemand für gescheitert, wenn er weder Wohlstand noch Exklusivität vorweisen konnte. Es gab keine Konkurrenz und keinen Kampf um Jobs und Stipendien.
In der DDR hatte, anders als in den westlichen Industriestaaten, die arbeitende Klasse ein höheres Ansehen als Akademiker. Personen aus der Arbeiterklasse besaßen große Berufschancen, auch ohne Bildungsqualifikationen und besonderem Fachwissen, und bis in die 80er Jahren waren Funktionärs- und Managerposten in einer großen Zahl von Personen aus dem Arbeitermilieu besetzt.
(ER)
Bei der (Vor)kriegs-Generation war ein besonders großes Identitätsgefühl der Arbeiter vorhanden, nicht selten kam es zwischen dem gebildeten Mittelstand und den weniger talentierten und weniger eloquenten Funktionären und den Massenorganisationen zu Spannungen.
Der Roman zeigt uns die Abneigung und die Vorbehalte der Arbeiter- und Bauernschicht Gebildeten gegenüber im Verhältnis von Wilhelm und Kurt:
S. 196
Natürlich konnte er den Ausziehtisch ausziehen. Schließlich hatte er Metallarbeiter gelernt. Was hatte Alexander gelernt? Was war der eigentlich? Nichts. Jedenfalls fiel Wilhelm nichts ein, was Alexander sein könnte. Außer unzuverlässig und arrogant. Noch nicht einmal in der Partei war der Ker…
S. 204
Er ließ das Glas öffnen (von Mählich - Kurt kriegte es sowieso nicht auf mit seinen Intellektuellenfingern…
Wilhelm als Arbeiter besitzt ein grenzenloses Selbstbewusstsein und stellt den Wert der geistigen Tätigkeit in Frage. Die führende Rolle der ökonomisch abgesicherten Arbeiter, die die SED ihm zubilligte, gibt ihm soziale Anerkennung (ER) S. 196
Natürlich konnte er den Ausziehtisch ausziehen. Schließlich hatte er Metallarbeiter gelernt. Was hatte Alexander gelernt? Was war der eigentlich? Nichts. Jedenfalls fiel Wilhelm nichts ein, was Alexander sein könnte. Außer unzuverlässig und arrogant. Noch nicht einmal in der Partei war der Ker…
S. 204
Er ließ das Glas öffnen (von Mählich - Kurt kriegte es sowieso nicht auf mit seinen Intellektuellenfingern…
Wilhelm gibt das Bild des selbstgerechten Funktionärs ab.
S. 202
Westemigrant! bis heute kränkte es ihn. Auch er wäre lieber in Moskau geblieben. Aber die Partei hatte ihn nach Deutschland geschickt und er hatte getan, was die Partei von ihm verlangte. Sein Leben lang hatte er getan, was die Partei von ihm verlangte, und dann: Westemigran…
S. 203
Die Sondermanns. Deren Sohn im Gefängnis saß: wegen versuchter Republikfluch…
- Euch kenn ich nicht, sagte Wilhel…
S. 207
Wilhelm öffnete kurz die Augen: Kurt, wer sonst! Du bist selbst so ein Tschow, dachte Wilhelm. Defätist. die ganze Familie! Irina mal ausgenommen, die war ja wenigstens im Krieg gewesen. Aber Kurt? Kurt hatte währenddessen im Lager gesesse…
12.2 Bildungsbürgertum in der DDR
Bereits nac h dem Krieg im Jahre 1945 wurde der sog. „Kulturbund“ in Berlin gegründet, dessen Mitglied Johannes R. Becher ihn zu einem Forum der Emigranten und der Daheimgebliebenen machte. In ihm sollte die Intelligenz, die zumeist eine geistige Bindung zur bürgerlichen Welt hatte, für die kulturelle Erneuerung Deutschlands gewonnen werden.
Schon bald machten sich in ihm während des beginnenden Kalten Krieges politische Gegensätze bemerkbar. Die Stadt Berlin fiel auseinander und es kam 1947 zur Gründung der „Gesellschaft zum Studium der Kultur der Sowjetunion“. Sie ersetzte das Zusammenfinden der Deutschen, das der deutschbetonte Kulturbund noch angestrebt hatte, durch das Gebot der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Der deutsche Intellektuelle musste sich nun entweder für die östliche oder für die westliche Seite entscheiden.379
Als deutlich wurde, dass im Bereich der sowjetischen Besatzungszone eine sozialistische Wirtschaftsweise angestrebt wurde, mit einer Enteignung der Banken, Fabriken und Ländereien, setzte eine Wanderbewegung der Intelligenz Richtung Westen ein. In weit geringerem Maße kamen Intellektuelle aus der Bundesrepublik und dem Ausland in die neu entstehende DDR; diejenigen, die kamen, sympathisierten mit einer sozialistischen Gesellschaft und verbanden Hoffnungen mit dem sozialistischen System, manche sahen sich ihr gegenüber auch politisch verpflichtet.
Das Bildungsbürgertum mit seinem technischem Sachverstand war für das erfolgreiche Funktionieren der DDR als moderner Industriestaat sehr wichtig, und um diese „sozialistische Intelligenz“ für sich zu gewinnen, kam es 1949 zu einer Verordnung, die für sie Bevorzugung und Privilegien bereit hielt: Professoren, Ingenieure, Schriftsteller und Wissenschaftler sollten Sonderzuwendungen bekommen. Ihnen wurde Baumaterial bereitgestellt für die Instandsetzung ihrer zerstörten Wohnungen. Man unterstützte sie beim Bau von Eigenheimen, gewährte ihnen hohe Pensionen und eine niedrigere Einkommenssteuer. Damit eine Intelligenzfeindlichkeit der Arbeiterschaft gar nicht erst aufkam, begründete man diese Verordnungen ideologisch.380 (ER)
Im Roman findet sich das bildungsbürgerliche Milieu in der sozialistischen Intelligenz der Familie Umnitzer wieder: Kurt ist ein Teil der Intelligenz, Wissenschaftler und Literat.
S. 177
Was für Kurt zählte, waren geschriebene Seiten, und in dieser Hinsicht - was die Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen betraf - hielt er den unangefochtenen Rekor…
Für die Wirtschaft war ein Bildungsbürgertum, das über unternehmerischen und wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Sachverstand verfügte, unverzichtbar: Lehrer, Ärzte, Naturwissenschaftler und Ingenieure waren ebenso wie qualifizierte Arbeiter von Bedeutung, auch wenn sie sich in ihrem Ansehen, Lebensstil und ihrem Verhältnis zum Staat von dem der Arbeiterklasse unterschieden. Im Bildungsbürgertum konnte sich eine bürgerliche Lebenswelt durch pragmatische Zugeständnisse erhalten.381 Günter Wirth schildert, wie sich in Potsdam das Bildungsbürgertums seine Kontinuitäten bewahrte und sich Formen einer Gegenöffentlichkeit innerhalb der DDR-Gesellschaft in Form von Debattierclubs und literarischen Salons in bürgerlichen Privathaushalten herausbildeten.
Schauen wir uns die Berufsgruppen des Bildungsbürgertums und in der DDR genauer an: Für die Veränderung der Ideologie von einer bürgerlichen zur kommunistischen waren zunächst Lehrer und Juristen von besonders großer Bedeutung. Da viele Lehrer Mitglied in der NSDAP gewesen waren, folgte eine rasche Ausbildung junger Männer zur Entwicklung einer neuen politisch unbelasteten Lehrerschaft mit einem veränderten jungen Altersprofil. Sie beeinflussten in den folgenden Jahrzehnten die Schülergenerationen in deren Einstellungen und Überzeugungen .
Bei Richtern und Juristen, die vom NS-Regime indoktriniert worden waren, gab es keinerlei Kontinuität wie in der Bundesrepublik, sondern einen drastischen Personalwechsel. Das Rechtssystem erlebt einen politischen Missbrauch, die Juristen der DDR wurden zu loyalen Dienern ihres Staates.
Bildungsbürgerliche Traditionsmilieus waren auch bei Medizinern und Theologen anzutreffen und hielten sich hartnäckig. Dort war der Anteil ehemaliger Nationalsozialisten zwar hoch, aber da man auf das medizinische Wissen in der DDR angewiesen war, gestaltete man ihre Arbeitsbedingungen und ihr Gehalt großzügig. Ihre Kinder jedoch setzte man Diskrimierungen aus und hielt sie von der Universität fern. Aus diesem Grund siedelten viele Ärzte mit ihren Familien in den Westen über, wo die Arbeitsbedingungen besser waren, ihre Kinder keine Benachteiligung erfuhren und höhere Bildungschancen hatten.382
Studenten hatten in den 50er Jahren noch traditionell eine konservativ-bürgerliche Subkultur und die, die nun aus dem Arbeiter- und Bauernmilieu in diese peer-groups kamen, ließen sich leicht von den bürgerlichen Umgangsformen und Normen beeinflussen, so dass manches an bürgerlichen Distinktionen aufrecht erhalten blieb. Die Hochschullehrerschaft war erst Ende der 60er Jahre so weit verändert, dass es in diesem Bereich keine belastete politische Vergangenheit mehr gab.
Die DDR verfügte bis zu ihrem Ende ebenso wie die Bundesrepublik über unterschiedliche Sozialmilieus. Diese zeigten sich im kulturellen Lebensstil und der elterlichen Beeinflussung bzgl.der schulischen Laufbahn383, und damit gab es weiterhin ein Bildungsprivileg des Bürgertums. Obwohl die kapitalistische „Bourgeoisie“ verschwand und man eine Nivellierung der sozialen Unterschiede erreichte,384 blieb unter der sozialistischen Intelligenz, die als „soziale Schicht der berufsmäßig Geistesschaffenden“ definiert wurde385, der Rest einer bürgerlichen Variante und eines bürgerlichen Milieus bestehen.
In der akademischen Elite der DDR waren Milieu und Lebensstil traditionell bürgerlich, ebenfalls bei politisch engagierten Mitgliedern.386 Die Staatsführung selbst rezeptierte bürgerliche Anstandsregeln und orientierte sich bei der Konzeption der sozialistischen Leitbilder an bürgerlichen Werten und Verhaltensnormen.387 Man wertete bürgerliche Normen und Praktiken positiv, im Sinne als einen Dienst für die Gesellschaft, und auch die protestantische Leistungs- und Arbeitsethik war weiterhin in der DDR vertreten.
(ER)
Als Sascha in einem verfallenen Abrissviertel wohnt und ein freibestimmtes Leben führen möchte, wünscht sich sein Vater, dass er vorgeprägte Lebensmuster im Sinne des Bürgertums lebt.
S. 293
- Melitta sagt, du willst dich scheiden lasse…
- Ihr wart bei Melitt…
- Melitta war bei u…
- Wir haben dir abgeraten, Hals über Kopf zu heiraten, eine Frau, die du kaum kennst. wir haben dir abgeraten, ein Kind in die Welt zu setzen mit zweiundzwanzi…
S. 296
- Und eins sage ich dir: Wenn das rauskommt, dass du dort eingebrochen bist . Das ist kriminell, ist dir das klar? Dann ist dein Studium beende…
S. 299
- Hast du deine Diplomarbeit ferti…
- Ich schreibe meine Diplomarbeit nicht ferti…
- Sag mal, drehst du jetzt vollkommen durch? Sascha schwie…
- Du kannst doch nicht hinschmeißen, so kurz vorm Schluss. Was willst du denn machen ohne Diplom? Auf’n Bau gehen oder was…
Ein besonders illustres Beispiel für die Weiterführung und die Rezeption bürgerlicher Distinktionen ist die Jagd: Sie wurde von den sozial aufsteigenden DDR Politikern mit Begeisterung praktiziert, in Anlehnung an den Adel.
Eine Angleichung der Klassen erfolgte u.a. durch immaterielle Belohnungen, Ehrungen und Medaillen und durch die o.g. geringe Differenz im Gehalt zwischen Akademikern und Mitgliedern der Arbeiterklasse. Arbeiter- und Bauernkinder in der DDR erhielten alle erdenkliche Förderungen mit Stipendien, Wohnheimplätzen oder Büchern. Sie sollten nach bildungsbürgerlichen Maßstäben in den Hochschulen und Universitäten lernen und dabei ihrer Klasse verbunden bleiben. Dann aber, wenn sie aufstiegen, kam es nicht selten vor, dass man sie als Intellektuelle misstrauisch beobachtete und kontrollierte.388 Doch es existierten weiterhin Klassenunterschiede, so dass unterschiedliche Ausgangspositionen und soziale Unterschiede die Entwicklung der Menschen beeinflussten.
Erst in den späteren Jahren nach der Realisierung des Wohnungsbauprogramms lebten Arbeiter und Akademiker in identischen Wohnblocks, vorher jedoch, auch wenn nur wenige Wohnungen in Privatbesitz waren, bewohnten, wie bereits erwähnt, Mitglieder der sozialistischen Intelligenz (Bürgertum), wie Familie Umnitzer, Villen oder Etagenwohnungen der Gründerzeit.
In der Person von Charlotte werden Aspekte von Bürgerlichkeit und bürgerliche Kultur und deren Integration in die Gesellschaft DDR thematisiert. Sie konstituiert bürgerliche Restbestände der DDR-Gesellschaft.
Charlotte, die lediglich vier Jahre die Haushaltsschule besucht hatte und Wilhelm, ein gelernter Schlosser, waren in Mexiko an Wohlstand und Annehmlichkeiten, z.B. Hauspersonal gewöhnt. Charlotte wird durch die Partei beruflich und intellektuell gefördert und Institutsdirektorin. Aus diesem Grunde steht sie dem Sozialismus aufgeschlossen gegenüber, weist aber im privaten Umfeld Aspekte einer bürgerlichen Lebensweise auf. Davon zeugen das große, offene Haus und die Selbstverständlichkeit, Dienstpersonal zu beschäftigen. Ein gewisser Dünkel ist bei ihr erkennbar.
S. 129
Um zehn kam Lisbeth. Wie immer pflegte Lisbeth alle Fragen, auch die geklärten, fünfmal zu stellen.Nein, Lisbeth, es wird nicht staubgesaugt, wenn ich im Haus bin...Ja, heute Wäsch…
S. 400
Niemals, dachte Charlotte, hätte sie dieser Frau das Du anbieten dürfen. Kein Respekt, kein gar nicht…
Kurt und Irina gehören in der DDR-Gesellschaft zu den Bessersituierten und sind mit Privilegien ausgestattet aufgrund von Kurts Tätigkeit als Geschichtswissenschaftler und Schriftsteller. Seine berufliche Position bedeutete in der DDR eine Besserstellung, und auch Sascha gehört zu dieser privilegierten Gesellschaftsschicht, dem Bildungsbürgertum. Niemand zeigt von ihnen aber Klassenbewusstsein oder definiert sich über diese Zugehörigkeit und seiner Herkunft.
S. 21
… einer der produktivsten Historiker der DDR“ hatte es geheißen. Für diesen Meter hatte Kurt Orden und Auszeichnungen, aber auch Rüffel und einmal sogar eine Rüge von der Partei erhalte…
S. 161f
Fünfunddreißig war er gewesen, als er zurückkam, und auch wenn er - als eine Art Wiedergutmachung - sofort eine Stelle an der Akademie der Wissenschaften bekam (also an der „richtigen“ Akademie, wie Kurt gern betonte, um den Unterschied zur Neuendorfer Akademie deutlich zu machen), war der Neubeginn alles andere als leicht gewese…
… konnte er nicht leugnen, Genugtuung empfunden zu haben über die Hochachtung, die man ihm nun, nach zehn Jahren, plötzlich in diese Land entgegenbrachte: dem Exsträfling, dem „auf ewig Verdammten…
Erwähnenswert als Gruppe im bürgerlichen Milieu sind die Christen. Obwohl sich ihre Zugehörigkeit verringerte und sie mit politischen Angriffen rechnen mussten, spielten sie stets eine Rolle in der DDR. Geistliche bildeten einen Rest von bürgerlicher Gesellschaft, und sowohl in der katholischen Minderheit als auch in der evangelischen Kirche blieb ein konfessionelles Milieu bestehen. Als es zumindest am Anfang noch eine große Zahl von Mitgliedern gab, blieben Struktur und Eigentum intakt. Das Bildungsbürgertum war mehrheitlich protestantisch geprägt und hatte mit Hauskreisen seine Form bürgerlicher Geselligkeit.
12.2.1 Der Marxismus im Denken der „sozialistischen Intelligenz“
Die „Intelligenz“ einer Gesellschaft hat die Aufgabe „kritische Einsicht“ zu zeigen und ihre Autonomie zu wahren und sich nicht mit der Politik zu verbinden,389 sie soll gegen das Herdendenken angehen und eine kritische Stellung zur Macht haben.390 In der DDR jedoch hatte die sog. „sozialistische Intelligenz“ auf der weltanschaulichen Grundlage des Marxismus dem Arbeiter zu dienen und sich nach ihm auszurichten.
Anders als der offizielle Marxismus hatten sich Wissenschaftler und Intellektuelle in der DDR nach der Aufdeckung der Verbrechen Stalins zwar vom Stalinismus losgesagt, aber statt nun auch dem offiziellen Marxismus einer radikalen Kritik zu unterziehen, um so den Weg zum wahren Marxismus im gesellschaftlichen Raum zu ebnen, akzeptierte man eine Einheit von Politik und Wissenschaft und diffamierte jegliche Kritik an der Person von Karl Marx und seiner Lehre.
Die Eigentumsfrage als Kernpunkt des Marxismus brachte in der DDR eine Neuregelung des Eigentums bzw. eine Vergesellschaftung der Produktionsmittel. Sie sollte nach Auffassung der Intellektuellen ein neues Bewusstsein schaffen, in der Realität aber betrachteten die Arbeiter Volkseigentum anders als Privateigentum und nahmen das Eigentum an den Produktionsmitteln nie richtig an.
Kurt spricht die Polarisierung von Reichtum auf der einen und Elend auf der anderen Seite in der Welt an und verurteilt das Gewinnstreben auf der Grundlage des Privateigentums. Er sieht den Sieg des Kapitalismus als Niederlage der Menschheit, die ein humanes Zusammenleben anstreben sollte. Die Überlegenheit ihrer, der kommunistischmarxistischen Weltanschauung zeigt sich nach Ansicht der intellektuellen Marxisten (Kurt) darin, dass der Besitz als Wurzel allen Übels beseitigt wird.
S. 369
- Der Kapitalismus mordet, schrie Kurt. Der Kapitalismus vergiftet! Der Kapitalismus frisst diese Erde auf…
- Ja, die Kinder in Afrika, brüllte Kurt. Was ist daran komisch…
Eine Positionierung des Schriftstellers durch Affirmation, nicht durch Opposition, war bei DDR-Schriftstellern eine Voraussetzung ihrer Tätigkeit, und auch Kurt hat sich angesichts der Regulierung des Wissenschaftsbetriebs nach den Vorgaben der Partei zu richten und systemkonform zu leben.
Er gehört zur Intelligenz, die sich zum Sozialismus bekennt und führt das Leben eines freischaffenden Gelehrten mit festem Gehalt - gefordert wurde dafür vom Staat ideologische Unterwerfung und formale Disziplin. Rolle und Funktion des Schriftstellers war es, die gesellschaftlichen Verhältnisse abzubilden und zu gestalten und so einen Beitrag zur historischen Entwicklung zu leisten.
Die Suspendierung eines kritischen Mitarbeiters Kurts wird zur Sprache gebracht, bei der Kurt ein ungutes Gefühl hat:
S. 178f
Hier geschah das, was Kurt seit langem, genauer gesagt, seit der Ablösung Chruschtschows (aber eigentlich auch schon vor der Ablösung Chrutschows), befürchtet hatte, Anzeichen hatte es schließlich genug gegeben, nur dass diese Anzeichen keine Anzeichen gewesen waren, begriff Kurt jetzt, sondern die Sache selbst: Das Plenum, auf dem man kritische Schriftsteller niedergemacht hatte, die Absetzung des Kulturministers, der Bruch mit Havemann, das war es, es war da
Wie groß die Bedeutung des persönlichen Eigentums in Wirklichkeit ist, zeigt die Niederlage des Sozialismus. Doch auch nach der Wende scheuten sich die Intellektuellen vor der Abrechnung mit dem Marxismus und seinen Vertretern, um nicht als „Wendehals“ zu gelten.391 Einige Anhänger des offiziellen Marxismus sahen ihre Ideologie aber bereits zu diesem Zeitpunkt als zu dogmatisch an, bei anderen war Selbstreflexion angesagt. Sie überprüften ihre theoretischen Grundlagen der Weltanschauung, und nicht selten führte es bei manchem zu Resignation und Ratlosigkeit, bis hin zum Nichtpublizieren und Nichtschreiben.392
Mit dem Einzug der „bürgerlichen Freiheit“ wurde der „real“ existierende Sozialismus, der ja eigentlich, so betonte man, noch nicht der eigentlichen Utopie entsprochen hatte, aufgegeben.
Die Aufbau-Generation, zu der Wilhelm gehört, fühlte sich dem Marxismus bis zum Ende der DDR verbunden, ihr Leben und ihr Lebenswerk waren von ihm geprägt,
S. 201
Das Problem sind die Tschows, verstehst du: Tschow-Tsschow. Mählich nickte sehr langsam. Wilhelm schlug z…
- Emporkömmlinge, sagte er. Er schlug zu…
- Defätisten.Er hielt einen Augenblick inne und sagt:
- Früher wussten wir, was man mit denen tu.
Im Unterschied zu ihm und zur Generation seines eigenen Vaters ist Sascha ein Vertreter der neuen Generation:
S. 367
- Du hast vierzig Jahre lang geschwiegen, schrie Sascha. Vierzig Jahre lang hast du es nicht gewagt, über deine großartigen sowjetischen Erfahrungen zu berichte…
- Was hast du denn getan! Jetzt schrie auch Kurt: Wo waren denn deine Heldentate!
- Scheiße, schrie Sascha zurück. Scheiß auf eine Gesellschaft, die Helden brauch
- Scheiß auf eine Gesellschaft, in der zwei Milliarden Menschen hungern, schrie Kurt
12.2.2 Geschichtswissenschaft(ler) in der DDR
Eine tragende Rolle innerhalb der Intelligenz bzw. des Bildungsbürgertums kam in der DDR den Geschichtswissenschaftlern, wie Kurt Umnitzer, zu.
Nach 1945 sah sich die Bundesrepublik als Nachfolgestaat des Deutschen Reichs und bekannte sich zu der gesamten deutschen Geschichte, anders die DDR: Sie verstand sich als Staat, der keinerlei Verantwortung für den Nationalsozialismus trug und der „auf den ,besseren‘ Traditionen der deutschen Geschichte gegründet war.“393
Bei diesem Verständnis kam der Geschichtswissenschaft eine enorme Bedeutung, ja, nach der Staatsgründung 1949 hatte sie d i e zentrale Rolle für den geistigen Aufbau des Staatswesens. Der „Kulturbund“ deklarierte als Richtlinie für die Geschichtswissenschaft die Befreiung von imperialistischen und reaktionären Einflüssen394 und die sowjetische Geschichtswissenschaft als Vorbild. Wissenschaftliche Betätigung wurde mit sowjetmarxistischer Parteilichkeit betrieben und die Geschichte nach marxistischleninistischen Schema neu bewertet, d.h., man räumte den Arbeitern und nicht dem Bürgertum, den Adligen und Königen den wichtigsten Platz in der Geschichte ein.
In den westlichen Besatzungszonen dagegen gab es nach 1945 weiterhin die Wissenschaftstradition des Historismus, d.h. Geschichtswissenschaft auf der Grundlage von Positivismus und Historismus, die, nach Ansicht der Marxisten die Interessen der Ausbeuterklassen vertrat, und der sie deshalb die wissenschaftliche Bedeutung absprachen.
Nach Ansicht der Marxisten betrieben nur sie selber Wissenschaft im Sinne des Wissens, indem sie wichtige Epochen und Persönlichkeiten marxistisch-leninistisch interpretierten. Ausgangspunkt der Deutung war dabei stets der Klassenkampf mit der Fokussierung auf die ausgebeuteten Klassen. Der bildungsbürgerlichen Wertschätzung historischen Wissens, der Heimat-, Orts- und Familiengeschichte oder der Biographie fehlte es nach Meinung des dialektischen Materialismus an Ideologie.
Zunächst wurde noch die Fiktion eines Miteinanders beider Wissenschaften aufrecht gehalten, doch schon bald beseitigte man die bisherige bürgerliche’ Wissenschaft an den Universitäten und ersetzte sie durch die fortschrittliche Wissenschaft des Marxismus- Leninismus'.395 Die Politik verlangte offiziell eine Anpassung der Geschichtswissenschaft an den Historischen und Dialektischen Materialismus und kritisierte das bisherige Selbstverständnis der Fachdisziplin Geschichtswissenschaft als zu ,bürgerlich’. Geschichte galt als eine Geschichte der Klassen.396 Historische Erkenntnis war mit den Mitteln des Dialektischen und Historischen Materialismus als der einzigen geltenden wissenschaftlichen Theorie zu begründen und die historische Forschung entsprechend methodologisch zu regeln.397
Als es 1948 zur Abgrenzung der SBZ von den westlichen Besatzungszonen kam, flohen bürgerliche Geschichtswissenschaftler in den Westen. Von da an griffen personalpolitische Maßnahmen an den Universitäten, und die endgültige Durchsetzung des sowjetischen Geschichtsbildes konnte erfolgen.398
Geschichtswissenschaft hatte von da an eine ideologisch-politische Konzeption und war parteilich bzw. legitimatorisch und nicht mehr der Objektivität verpflichtet wie im Westen.
Weil die DDR für die Wissenschaft den historischen Fortschritt verkörperte, traten Geschichte und Geschichtswissenschaft in den Dienst der DDR und ihrer Staatspartei. Die Parteiführung entschied über die Art und Weise der Geschichtsdarstellung. „Die Geschichtswissenschaft ist bedingungslos in den Dienst von Partei und Staat gestellt. Der Historiker ist in erster Linie Propagandist... Das Streben nach Wahrheit der Erkenntnis ist gebunden an die Doktrin der Partei.“399
Weg von der Wissenschaftlichkeit, hin zum Dienst der Partei, hieß es von jetzt an, orientiert an der kommunistischen SED. Stets beteuerte die Wissenschaft ihre Solidarität mit der Partei400 und nicht selten betrieben Funktionäre, die im Dienste der Staatspartei standen, selbst Geschichtswissenschaft.
S. 297
Kurt musste plötzlich an das Parteilehrjahr heute Nachmittag denken, eine dämliche Pflichtveranstaltung, die, obwohl sie ,Parteilehrjahr‘ hieß, einmal im Monat durchgeführt wurde. Thema heute: Theorie und Praxis der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft…
Es gab keine freie wissenschaftliche Betätigung. Geschichtswissenschaftler explizierten auf dem Fundament des Anti-Faschismus den Historischen Materialismus, hatten die Ideologie auszulegen und zu bestätigen, am Klassenkampf teilzunehmen, was bedeutete, sie hatten eine Kampffunktion inne.401 Auf diese Art konnte man sozialistisches Geschichtsbewusstsein durch den Einfluss der marxistisch-leninistisch-ideologischen, sprich klassenbewussten Darlegung geschichtlicher Prozesse, verbreiten. Alexander durchschaut diese Form der Wissenschaft als verlogen und einseitig:
S. 21
Diese angebliche Forschung, dieses ganze halbwahren und halbherzige Zeug, das Kurt da über die Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung zusammengehämmert hatte - das alles, so hatte Alexander geglaubt, würde mit der Wende hinweggespült, und nichts von Kurts sogenannten Werk würde bleibe.
Wissenschaftliche Arbeit sollte helfen, das neue Deutschland des „wirklichen Friedens, der ehrlichen Arbeit, der sozialen Ordnung und der echten, wahren Menschlichkeit“ zu errichten und damit 402 den bisherigen Höhepunkt deutscher Geschichte.403 DDR-Historiker verwendeten geschichtliches Wissen praktisch-politisch. Sie gaben die Realität und die Geschichte ideologisch verzerrt, marxistisch-leninistisch interpretiert, wieder und nahmen die Geschichte unter dem Gesichtspunkt der Klasseninteressen und des Klassenkampfes in den Dienst, ohne dass sich jemand gegen diese Verengung des Geschichtsbildes zur Wehr setzen konnte.
S. 299f
- Weiß ich nicht, sagte Sascha. Aber ich weiß, was ich nicht will. Ich will nicht ein Leben lang lügen müssen
- So ein Quatsch, sagte Kurt. Willst du sagen, ich lüge mein Leben lang? Sascha schwieg.
- Du hast dir dein Studium selbst ausgesucht, sagte Kurt. Niemand hat dich gezwungen, Geschichte zu studieren, im Gegentei…
- Du hast mir abgeraten, ich weiß…
- Du, schrie Sascha und zeigte mit dem Finger auf Kurt, du rätst mir ab, Geschichte zu studieren, und bist selber Historiker! Wer ist hier verrück?
Die Geschichtsauffassung in sozialistischen Ländern war auf Zukunft hin entworfen, und die SED setzte zukünftige Perioden mit dem Anspruch fest, dass eine höhere Entwicklungsstufe zum Sozialismus/Kommunismus erreicht würde. „Die Politik der SED gab damit gleichsam das Ziel und den ,Sinn der Geschichte’ vor.“ 404
Die Konsolidierung der marxistisch-leninistischen Geschichtswissenschaft erfolgte bis 1960. Ab den 70er Jahren war sie durch den Dialog mit der Partei unter erweiterten Freiräumen geprägt und nutzte den Marxismus für ihr Fach, ohne ihn aber als ein starres System zu empfinden.405 Erst in den 80er Jahren erfolgte ein Übergang von einerselektivenInterpretation zu einerintegralenDarstellung der deutschen Geschichte.
Geschichtswissenschaftler wie Kurt helfen nicht, die aktuellen Ereignisse 1989 einzuordnen oder bewerten zu können. Die Entwicklungen im Land hätte er früher erkennen und beanstanden und auf eine Reformierung hinarbeiten müssen.
S. 358
Er kämpfte gegen die, wie es neuerdings hieß „Abwicklung“ seines Institut…
S. 366
Ich verstehe das nicht, sagte Sascha, du hast doch selber ständig darüber geredet, dass der Sozialismus am Ende ist. Waren das bloß Worte.. Ich rede hier nicht von der DDR, sondern vom Sozialismus, von einem wahren, demokratischen Sozialismus!…Es gibt keinen demokratischen Sozialismus, hörte sie Sascha sagen. Darauf Kurts Stimme: Der Sozialismus ist seinem Wesen nach demokratisch, weil diejenigen, die produzieren, selber über die Produktio…
In seinem letzten Buch, nach der Wende geschrieben, offenbart Kurt seine Erlebnisse im Gulag, zu spät, um noch von großem Interesse für die Öffentlichkeit zu sein.
S. 22
Aber dann hatte sich Kurt noch einmal auf seinen katastrophalen Stuhl gesetzt, mit schon fast achtzig, und hatte klammheimlich sein letztes Buch zusammengehämmert. Und obwohl dieses Buch kein Welterfolg geworden war - ja, zwanzig Jahre früher wäre ein Buch, in dem ein deutscher Kommunist seine Jahre im Gulag beschrieb, möglicherweise ein Welterfolg geworden (nur war Kurt zu feige gewesen, es zu schreiben!) -, aber auch wenn es kein Welterfolg geworden war, so war es doch, ob man wollte oder nicht, ein wichtiges, ein einzigartiges, eine „bleibendes“ Buch…
13. Bürgerliche Normen und Kultur
Edel sei der Mensch, hilfreich und gu…
Johann Wolfgang von Goet…
In den bisherigen Ausführungen wurden bereits des Öfteren die für das bürgerliche Selbstverständnis entscheidenen Werte und Distinktionen angedeutet, Im folgenden Kapitel werden sie nun im Einzelnen genauer betrachtet und analysiert; letztendlich mit der Fragestellung, inwieweit sie heute nach zweihundert Jahren noch bestehen, sei es in ähnlicher oder anderer Form. Die Romane dienen als Grundlage der Untersuchung.
Das Bürgertum des 19. Jahrhunderts entwickelte sich in einer Zeit, als der Adel und der Klerus an Einfluss verloren: Der Adel musste seinen exklusiven Anspruch aus der Ständeordnung und das damit verbundene Eigentum aufgeben und sich seinen gesellschaftlichen Platz und sein wirtschaftliches Auskommen suchen, die Religion wurde zu einem privaten Sinnangebot.406
In Abgrenzung zum Adel und dessen Konzentration auf Äußerlichkeit und Konventionen entwickelte das Bürgertum den Kult der „inneren Werte“ als ihr Lebensideal: U.a. das Vermeiden von Verschwendung und das Halten einer „Mitte“, Intimität und Luxus hatten sich nur noch im „häuslichen Comforts“ zu spiegeln.407
Seit dem Scheitern der Revolution 1848/49 definierte sich das Bildungs- und Besitzbürgertum als eine eigene soziale Schicht mit materiellen Ressourcen - und dies stellten gutes Essen und guter Wein ebenso unter Beweis wie repräsentative Räume, Dienstboten, Umgangsformen, Kleidung, Körperhaltung. Die Beherrschung bestimmter Geschmacksstandards wurde wichtig, um das soziale Ansehen nicht zu verlieren. Bürgerliche Tugenden und Umgangsformen festigten den sozialen Zusammenhalt ebenso wie bestimmte Normen und distanzierten die Bürger sozial von anderen Gruppen.
So heterogen das Bürgertum von seiner Bildung und wirtschaftlichen Bedeutung war, so bekam es seine Bedeutung und seinen Erfolg durch den Aufbau einer Wertegemeinschaft mit orientierenden Leitlinien und identitätsstiftenden Verhaltensmustern. Die Mittellinie der Mäßigkeit definierte sämtliche Wertbegriffe der Bürger, wie Ordnung, Fleiß und Sparsamkeit, und ihre gleichzeitige materielle Sicherheit machte ein maßvolles komfortables Leben möglich.
(TM)
Wie wichtig frühe Kindheitserfahrungen bei der Übermittlung solch bürgerlicher Normen und Verhaltensweisen zwischen den Generationen waren, erlebt Tony in ihren Großeltern Kröger, ein Modell, das ihren Status und eine entsprechende Rolle illustriert.
S. 59
Zum Sommer, im Mai vielleicht schon, oder im Juni, zog Tony Buddenbrook immer zu den Großeltern vors Burgtor hinaus, und zwar mit heller Freud…
Es lebte sich gut dort draußen im Freien, in der luxuriös eingerichteten Villa mit weitläufigen Nebengebäuden, Dienerschaftswohnungen und Remisen und dem ungeheuren Obst-, Gemüse und Blumengarten, der sich schräg abfallend bis zur Trave hinunterzog. Die Krögers lebten auf großem Fuße, und obgleich ein Unterschied bestand zwischen diesem blitzblanken Reichtum und dem soliden, wenn auch ein wenig schwerfälligen Wohlstand in Tonys Elternhaus, so war es augenfällig, dass bei den Großeltern alles immer noch um zwei Grade prächtiger war als zu Hause; und das machte Eindruck auf die junge Demoiselle Buddenbrook.
Die soziale Kontrolle in der Bürgergesellschaft sanktionierte Regelverstöße mit einer Verringerung des Ansehens, gerade deshalb wurde großen Wert auf bürgerliche Regeln gelegt. Hatte jemand diese Regeln nicht internalisiert, galt er als ein Aufsteiger, als „ungebildet“ und „neureich“. Im Buddenbrooks-Roman fällt diese Rolle Hagenström zu: Man betrachtet ihn als kulturlosen Emporkömmling:
S. 60
… Herr Hagenström, dessen Familie noch nicht lange am Orte ansässig war, hatte eine junge Frankfurterin geheiratet, eine Dame mit außerordentlich dickem schwarzen Haar und den größten Brillanten der Stadt an den Ohren …
Herr Hagenström.… war, davon abgesehen, trotz seiner Rührigkeit als Mitglied von Ausschüssen, Kollegien, Verwaltungsräten und dergleichen nicht sonderlich beliebt.… Konsul Buddenbrook sagte von ihm: „Hinrich Hagenström ist aufdringlich mit seinen Schwierigkeiten… Er muss es geradezu auf mich persönlich abgesehen haben; wo er kann, behindert er mich…“
S. 409f
Kein Zweifel, Hermann Hageström hatte Anhänger und Bewunderer. Sein Eifer in öffentlichen Angelegenheiten, die frappierende Schnelligkeit, mit der die Firma Strunck&Hagenström emporgeblüht war und sich entfaltet hatte, des Konsuls luxuriöse Lebensführung, das Haus, das er führte, und die Gänseleberpastete, die er frühstückte, verfehlten nicht, ihren Eindruck zu machen. …Übrigens hatte er in dieses sein Haus noch vor kurzem, gelegentlich einer seiner größeren Abendgesellschaften eine ans Stadttheater engagierte Sängerin geladen, hatte sie nach Tische vor seinen Gästen… singen lassen, und die Dame aufs glänzendste honorier.
S. 668
„Gegen einen Haufen Mist kann man nicht anstinken“, sagte Konsul Döhlmann mit einer so geflissentlich ordinären Aussprache,…
Und damit meinte er Hagenström.
Die gesellschaftliche Wertschätzung formte das Selbstgefühl: Weil der Bürger vom Urteil der Leute abhängig war, orientierte er sich in seinem Sozialverhalten nach außen, d.h. der gute Ruf musste stets bewahrt werden, um den Verlust des Ansehens zu vermeiden. Vertretern des Bürgertums wuchs Repräsentativität zu, die für die Umwelt zu einer wichtigen Richtschnur wurde - man präsentierte hierbei stets den eigenen Erfolg und die eigene Stellung.
Im Laufe der Jahrzehnte nahm die Annäherung zwischen Adel und Bürgertum zu: Der Bürger strebte nach einem Titel, fuhr mit der Equipage; gleichzeitig eignete sich der Adel bürgerliche Leistungs- und Verhaltensnormen an. Insbesondere im Erwerb eines Adelsprädikats und Ordens konnte man die Feudalisierung des Bürgertums erkennen und wie sehr es den aristokratischen Habitus übernahm.408
Zu Armgard von Schilling, der Tochter eines Landadligen, schaut Tony Buddenbrook voll Bewunderung empor:
S. 86
Diese Armgard hatte vom ersten Augenblick an den größten Eindruck auf Tony gemacht und zwar als das erste adelige Mädchen, mit dem sie in Berührung kam. Von Schilling zu heißen, welch ein Glück!
In Lübeck gab es relativ wenig Adlige, dafür eine kleine Schicht von Großbürgern und alteingesessenen bürgerlichen Familien mit großem Einfluss. Sie und die besser gestellten Kaufleute, zu denen die Buddenbrooks gehörten, bilden die Oberschicht. Morten Schwarzkopf betrachtet sie als eine Art Adel: S. 138
„… Sie haben Sympathie für die Adligen…soll ich ihnen sagen, warum? Weil Sie selbst eine Adlige sind!. Ihr Vater ist ein großer Herr und Die sind eine Prinzess…
Fam. Buddenbrook steht an der Spitze der Lübecker Hierarchie und fühlt sich privilegiert, Tonys Familienstolz ist Ausdruck eines fast aristokratischen Standesbewusstseins.
Gotthold Buddenbrook, der Sohn des Konsuls aus dessen erster Ehe, hat nur einen „Laden geheiratet“ und wird deshalb von der Familie enterbt.
S. 18f
„Er gibt nicht nach, der Junge. Er kapriziert sich auf diese Entschädigungssumme für den Anteil am Hause…
„Es ist seine Schuld, dies traurige Verhältnis! Urteilen Sie selbst! Warum konnte er nicht vernünftig sein! Warum musste er diese Demoiselle Stüwing heiraten und den … Laden…“
Die Umgangsformen der vornehmen Welt des Adels, französischer Geschmack und frz. Bildung hatten für den deutschen Bürger Anziehungskraft: Buddenbrooks zeigen dieses aristokratische Bewusstsein in der frz. Konversation und in der Ausstattung ihrer Repräsentationsräume.
Insbesondere Thomas und Gerda Buddenbrook bevorzugen einen neuen und fremden Lebensstil mit Souper, Champagner und Hausbällen, man lebt nun anders als früher bei Johann Buddenbrook.
Das Bürgertum setzte im 19. Jahrhundert Verhaltensnormen und -maßstäbe, die schichtübergreifend akzeptiert und nachgeahmt wurden und bis in die heutige Zeit noch gelten.
Nach unten hin absorbierte der Arbeiter die bürgerlichen Tugenden und erhielt eine Orientierungshilfe zur Verbürgerlichung, bei ihm koppelten sich Bildung und Sozialkarriere zum höheren Sozialstatus. Und ebenso spürte mancher Unternehmer die Kraft der bildungsbürgerlichen Tradition.
Romane geben ein „umfassende[s] Bild der Weltzustände“ schrieb 1857 F. Th. Vischer.409 Dies spiegelt sich in den von mir untersuchten Romanen in Hinblick auf den Einfluss des Bürgertums und der bürgerlichen Merkmale, die in den Romanfamilien noch oder vielleicht auch nicht mehr vertreten sind, und in den Romanhelden als Vertreter des Klein- und Großbürgertums mit alten bzw. neuen aktuellen Normen, Einstellungen und Denkweisen.
Im Folgenden werden die Werte und Tugenden des Bürgertums, ihre Leitideen und Handlungsoptionen auf ihr Vorhandensein in den Romanen hin genauer untersucht und hinterfragt, ob und inwiefern Bürgerlichkeit mit ihren individualistischen Interessen und Zielen nicht ebenfalls in der DDR anzutreffen war,410 Denn auch in der Roman-Familie von Eugen Ruge findet sich eine Hochschätzung der für das Bürgertum typischen Werte und Verhaltensweisen aus dem privaten Bereich.
13.1 Arbeit und Selbstständigkeit in der bürgerlichen Lebensführung - das Leistungsethos des Bürgertums
Zur Mentalität des Bürgertums gehörte es, Vertrauen in die eigene persönliche Entwicklung zu haben411 und entscheidend dafür war: Arbeit und Leistung.
Arbeit galt als eine Pflicht, die nicht in Frage gestellt wurde und basierte auf einer religiös orientierten Arbeitsethik in Anlehnung an die protestantische Leistungsethik von Max Weber.412
Der Unterschied zwischen dem Norden und Süden Deutschlands, den nüchternen und fleißigen Protestanten und den vermeintlich trägen und ehrgeizlosen Katholiken im Süden spricht Tony bei ihrem Aufenthalt in München an: (TM)
S. 387f
Akklimatisieren? Nein, bei Leuten ohne Würde, Moral, Ehrgeiz, Vornehmheit und Strenge., bei Leuten , die zu gleicher Zeit träge und leichtsinnig, dickblütig und oberflächlich sind. bei solchen Leuten kann ich nicht akklimatisiere…
Ich bin von hier, aus diesem Hause, wo es etwas gilt, wo man sich regt und Ziele hat, dorthin gekommen, zu Permaneder, der sich mit meiner Mitgift zur Ruhe gesetzt hat…ha, es war echt, es war wahrhaftig kennzeichnend, aber das war auch das einzige Erfreuliche dara…
Dass das Bürgertum in Deutschland überhaupt eine solch immense Bedeutung gewann, liegt in seinem wirtschaftlichem Gewicht und seiner ,gelassenen Selbstsicherheit’ - die aber auch durch ökonomische und politische Veränderungen schwanken konnte.413 Leistungsfähigkeit schloss Sensibilität aus, denn: Empfindsame Menschen haben, so Campe in seinem damaligen Buch „Väterlichen Rath für meine Tochter“ einen Unwillen und eine Unfähigkeit zum Arbeiten, sind auf sich selbst bezogen und gehen keiner nützlichen Tätigkeit nach.
Zur bürgerlichen Lebensform gehörte die regelmäßige Arbeit. Sie bestimmte das Leben zum Nutzen von Familie und Gesellschaft, und durch sie strebte der Bürger als Individuum nach persönlicher Erfüllung. Arbeit war, in Abgrenzung zum unnützen Müßiggang, eine bewusste und schöpferische Tätigkeit und es galt die Maxime, wirtschaftliches Glück und beruflichen Erfolg durch persönliche Leistungs- und Einsatzbereitschaft zu erlangen: „Die bürgerlich verstandene Arbeit verleiht dem Leben Gleichmaß und Wiederholung, wie sie ihrerseits, um vonstatten zu gehen und Erfolg zu zeitigen, Regelmäßigkeit voraussetzt. Müßiggang wird verurteilt, das Leben ist geprägt durch äußere und innere Ordnung, die ebenfalls zu den Tugenden gehört, zu letzteren gehören Gedanken und Neigungen“.414 Nur wer sich im Berufsleben bewährte, legte mit seiner wirtschaftlichen und intellektuellen Leistung die Basis für eine gehobene soziale Position. Die individuelle Leistung, verbunden mit regelmäßiger Arbeit, führte zu sozialem Ansehen und politischen Einfluss. Sie wurde dem an Geburtsprivilegien orientierten und als dekadent eingestuften Adel entgegengesetzt.
Wie im ursprünglichen Handwerk war berufliche Selbständigkeit ein ganz entscheidendes Prinzip im Bürgertum. Hinzu traten die eigene Qualifikation, die individuelle Leistung. [Lothar Gall weist an der Familie Bassermann aus dem Raum Mannheim, einer Familie mit vielen Parallelen zu den Buddenbrooks, die im 20. Jahrhundert sogar Kontakte zu Thomas Mann pflegte, nach, wie groß für diese Gewerbe Treibenden die Bedeutung der Beweglichkeit war: Jede Generation suchte Erfahrungen aufs neue in der Fremde, z.B. Amsterdam), in der ähnliche Ordnungen im wirtschaftlich-sozialen und politischen Bereich herrschten und wo Tüchtigkeit und das Sich- Einstellen auf Anforderungen gefragt waren, um sich gegen Konkurrenz durchzusetzen.415]
Materielle Fundierung hatte für die Selbständigkeit eine große Bedeutung, ökonomische Selbständigkeit schloss materielle Unabhängigkeit ein. Man löste sich von ständischen und korporativen Bindungen und stellte sich auf eine eigene materielle Lebensgrundlage. Selbständigkeit in geistig-moralischer Hinsicht implizierte Persönlichkeitsbildung, d.h. die Entwicklung einen unabhängigen Geistes und geistige Unabhängigkeit vom Urteil anderer Personen. (Frauen und Dienstboten galten deshalb per se als nicht-selbständig.) (TM)
Johann Buddenbrook ist bereits Großkaufmann mit internationalen Beziehungen,416 nachzulesen in der ledern eingebundenen Familienchronik:
S. 36
Wiederum Einer, der schon Johann geheißen, als Kaufmann zu Rostock verblieben, und wie schließlich, am Ende und nach manchem Jahr, des Konsuls Großvater hierher gekommen sei und die Getreidefirma gegründet hab…
Der alte Buddenbrook vertritt eine traditionelle Berufsauffassung und zieht Zufriedenheit aus seiner gewissenhaften Erfüllung seiner Geschäfte,
S.46ff
Was seid ihr eigentlich für eine Kompanei, ihr jungen Leute, - wie? Den Kopf voll christlicher und phantastischer Flausen, und … Idealismus…
Nun! als Geschäftsmann weiß ich, was faux-frais sind,…
Eine Familie muss einig sein, muss Zusammenhalten, Vater, sonst klopft das Übel an die Tür…
„Flausen, Jean! Possen!.…
Eine Ausbildung des Sohnes erfolgte im Wirtschaftsbürgertum stets in Hinblick auf die Festigung der „Firma“, war der Vater Kaufmann, wurde es nach einer theoretischen Ausbildung in Hausunterricht bzw. Schule (Gelehrtenschule, Gymnasium) und der praktischen kaufmännischen Ausbildung auch der Sohn. „Ein fester Beruf, aktive Teilnahme am wirtschaftlichen, am geschäftlichen Leben, ein über bloße Hobbys hinausgehendes sachliches Lebensziel - das gehörte sich für einen Bürger einfach, auch wenn er es materiell nicht nötig hatte.“ 417
Es herrschte im Gegensatz zu heute kein Selbstbestimmungsrecht der Jugendlichen,418 die Übernahme des väterlichen Berufs war zwingend.
Thomas Buddenbrook erfüllt die Berufsarbeit mit einem rastlosen Getriebe, hierin unterscheidet er sich von seinen Vorfahren:
S. 470
Zeit seines Lebens hatte er sich den Leuten als tätiger Mann präsentiert; aber soweit er mit Recht dafür galt - war er es nicht, mit seinem gern citierten Goetheschen Wahl- und Wahrspruch - aus bewusster Überlegung gewesen? Er hatte ehemals Erfolge zu verzeichnen gehabt. aber waren sie nicht aus dem Enthusiasmus, der Schwungkraft hervorgegangen, die er der Reflexion verdankte? Und da er nun daniederla…
ob sein Vater, sein Großvater, sein Urgroßvater die Pöppenrader Ernte auf dem Halm gekauft haben würden? Gleichviel!. Aber dass sie praktische Menschen gewesen, dass sie es voller, ganzer, stärker, unbefangener, natürlicher gewesen waren, als er, das war es, was feststand…
Die Moralbegriffe der spätbürgerlichen Gesellschaft zeigen sich im Roman: Bürgertugend zielte auf Gelderwerb, Eigeninitiative und Verantwortung.
Der Wahlspruch der Buddenbrooks spiegelt die „Lust“ an der Arbeit wider, hier wird die Pflicht zur Neigung:
S. 482
„Mein Sohn, sey mit Lust bei den Geschäften am Tage, aber mache nur solche, daß wir bey nacht ruhig schlafen können…
S. 266f
Die Geschäfte hatten nach dem Tode des Konsuls ihren ununterbrochenen und soliden Gang genommen. Aber bald wurde bemerkbar, dass, seitdem Thomas Buddenbrook die Zügel in Händen hielt, ein genialerer, frischerer und unternehmenderer Geist den Betrieb beherrschte. Hie und da ward etwas gewag…
Herrn Marcus’ Einfluss bildete das retardierende Moment im Gang der Geschäfte. „Die Beiden ergänzen sich“, sagten die Chefs der größeren Häuser zueinande…
Ähnliches dazu finden wir in den modernen Familienromanen:
(AG)
Für Richard Sterk ist die Erfüllung der Berufspflicht ein bedeutender Teil seines Lebens. S.200
… bereut er nicht, soviel Kraft und Zeit in die Parteiarbeit gesteckt zu haben. Vielleicht ist irgendwohin ein Samen gefallen, vielleicht kommt seine Auffassung von der fundamentalen Verpflichtung eines öffentlichen Mandats in einigen Jahren wieder in Mod…
… entweder er bleib am Ball oder er kommt nicht wiede…
Zu einem bürgerlichen Auskommen gehörte stets ein überdurchschnittlich gutes Einkommen mit der Anstellung mindestens eines Dienstmädchens, somit blieb genügend Zeit für ein Familienleben in Muße.
(AG)
S.66
… wozu bin ich ein reicher Mann, notfalls ziehe ich mich in die Vorstadt zurück, um hier die Geborgenheit der Familie zu genieße…
Im geregelten Tagesablauf einer bürgerlichen Lebensform nahm die berufliche Arbeitszeit einen großen Teil des Tages.
(TM)
S. 304
Thomas Buddenbrook nahm das erste Frühstück in seinem hübschen Speisezimmer fast immer allein,. Der Konsul begab sich dann sofort in die Mengstraße, wo die Comptoirs der Firma verblieben waren, nahm das zweite Frühstück im Zwischengeschoss gemeinsam mit seiner Mutter, Christian und Ida Jungmann und traf mit Gerda erst wieder um 4 Uhr beim Mittagessen zusamme…
S. 357
Gleich morgens um acht Uhr, sobald er das Bett verlassen hatte, über die Wendeltreppe hinter der kleinen Pforte ins Souterrain hinabgestiegen war, ein Bad genommen und seinen Schlafrock wieder angelegt hatte, begann Konsul Buddenbrook sich mit öffentlichen Dingen zu beschäftige…
(AG)
Richard Sterks Tätigkeit mit ihren auswärtigen Aufenthalten erfordert viel Zeit:
S. 76
Im ersten Moment, als ihm seine Dienstreise in den Sinn kommt, ist er drauf und dran zu behaupten, dass er sich das Nickerchen redlich verdient hab…
S. 193
- Schon zurück? Ich staun…
- Ausnahmsweis…
- So kenn ich dich gar nich…
Es stimmt, eigentlich ist es undenkbar, dass er sieben Wochen vor einer Nationalratswahl, und sei’s am Samstag, nur kurz aus dem Haus geh…
Die Uhr ist für ihn ein Symbol der häuslichen Ordnung im Tagesablauf:
S. 212
Er schaut beiläufig auf die Pendeluhr und nimmt sich vor, sie am Abend aufzuziehen…
(ER)
Kurt Umnitzers Arbeitstag hat ebenfalls eine klare zeitliche Struktur:
S. 20
Sieben Seiten täglich, das war seine „Norm“, aber es kam auch vor, dass er zum Mittagessen verkündete: Zwölf Seiten heute! Oder: Fünfzehn! Eine komplette Spalte seiner schwedischen Wand hatte er auf diese Weise zusammengehämmert, ein Meter mal drei Meter fünfzig, alles voll mit dem Zeu…
In allen drei Romanen arbeiten Männer zu Hause ohne räumliche Abgrenzung:
(TM)
Bei den Buddenbrooks ist das Arbeitscontor zunächst im Haus, es gibt keine räumliche Trennung von Familie und Arbeit.
S. 37
Bei der Windfangtüre sowohl wie am anderen Ende lagen Comptoirräumlichkeite…
(AG)
Peter trennt seine Berufswelt nicht vom Familienleben, er lässt im Keller Einblicke in seine Tätigkeit zu. (Ingrid ist zwar gedanklich bei der Arbeit, schottet sich aber davon ab, wenn sie bei der Familie ist.)
S.252
… als würde Peter im Keller etwas versäumen. ..Ingrid nimmt es ihm übe…
- Was baut er da unten? fragt sie schar…
- Ein Modell der Opernkreuzung, sagt Philipp na…
(ER)
Auch Kurt arbeitet quasi selbständig mit eigener Zeiteinteilung in seinem Arbeitszimmer:
S. 18f
… im Gegensatz zum totalrenovierten Wohnzimmer war in Kurts Zimmer noch alles, und zwar auf gespenstische Weise, beim Alte…
Der Schreibtisch stand schräg vor dem Fenster - vierzig Jahre lang war er nach jeder Renovierung wieder genau in die Druckstellen imTeppich gestellt worden. Ebenso die Sitzecke mit Kurts großem Sessel. Und auch die große schwedische Wand (wieso eigentlich schwedische Wand?) stand wie eh und je. Die Bretter bogen sich unter der Last der Bücher.das aufklappbare, ramponierte Schachbrett mit den Figuren, die irgendein namenloser Gulag-Häftling irgendwann einmal geschnitzt hatt…
S. 20
Seltsam, wie winzig Kurs Schreibtisch war. an diesem Tischlein hatte Kurt sein Werk verfasst. Hier hatte er gesessen, in einer medizinisch schwer bedenklichen Sitzhaltung, auf einem Stuhl, der eine ergonomische Katastrophe war, . und im Viereinhalb-Finger-System auf seiner Schreibmaschine herumgehämmert, tack-tack-tack-tack, Papa arbeitet! Sieben Seiten täglich, das war seine „Norm“, aber es kam auch vor, dass er zum Mittagessen verkündete: Zwölf Seiten heute! Oder: Fünfzehn! Eine komplette Spalte seiner schwedischen Wand hatte er auf diese Weise zusammengehämmert, ein Meter mal drei Meter fünfzig, alles voll mit dem zeu…
Dadurch, dass das Bürgertum die Herrschaft über die Schule und das Bildungssystem besaß, konnten seine Kulturnormen, in diesem Fall das Arbeitsethos in Verbindung mit Disziplin, Selbst-und Fremddisziplinierung und Willenskraft, an die nächste Generation vermittelt werden und zur Verbürgerlichung der Schichten beitragen.
Im Kaufmannsstand selber waren die Erziehungsmuster entsprechend: Es gab die Erziehung zu Selbständigkeit, Leistung und dynamischer Handlungsbereitschaft; Ehrbarkeit bzw. geschäftliche Solidität galten als die hervorstechenden Tugenden.419 (TM)
Verinnerlicht haben dies alle Buddenbrooks, Thomas aber setzt sich beim Aufkauf der Pöppenrader Ernte auf dem Halme darüber hinweg und scheitert in Folge dessen.
S. 475
Er durchdachte das Ganze noch einmal, ..sah die gelbreife Ernte von Pöppenrade im Winde schwanken, phantasierte von dem allgemeinen Aufschwung der Firma, der diesem Coup folgen würde, verwarf zornig alle Bedenken, schüttelte seine Hand und sagte: „Ich werde es tun…
S. 494
… seine halb geschlossenen Augen verschleierten sich mit einem müden und fast gebrochenen Ausdruck, und mit schwerem Kopfnicken wandte er sich zur Seit…
Zeichen von Schwäche galten als leistungsfremd und durften von den Männern nicht gezeigt werden,Thomas Buddenbrooks reflektiert diesbezüglich über sich und sein Selbstbild:
S. 470
War er ein praktischer Mensch oder ein zärtlicher Träume…
… Aber er war zu scharfsinnig und ehrlich, als dass er sich nicht schließlich die Wahrheit hätte gestehen müssen, dass er ein Gemisch von Beiden se…
Thomas B. als Bürgervater ist bemüht, seinem Sohn die Leidenschaft und den Stolz für den Kaufmannsberuf (statt dessen Last!) vorzuleben. Er nimmt ihn mit auf seinen Kontrollgängen, um ihn teilhaben zu lassen an der väterlichen Berufswelt.
S. 625
Er fing an, ihn ein wenig in das Bereich seiner zukünftigen Tätigkeit einzuführen, er nahm ihn mit sich auf Geschäftsgänge zum Hafen hinunter und ließ ihn dabei stehen, wenn er am Quai mit den Lösch-Arbeitern in einem Gemisch von Dänisch und Plattdeutsch plauderte,…
Hanno unternimmt zwar Kraftanstrengungen, das Joch der Schule abzuschütteln und es seinem Vater recht zu machen, erkennt aber gleichzeitig, wie sehr der Umgang mit den Kunden diesen erschöpft.
S. 627
Aber der kleine Johann sah mehr, als er sehen sollte. Er sah nicht nur die sichere Liebenswürdigkeit, die sein Vater auf Alle wirken ließ, er sah auch - sah es mit einem seltsamen, quälenden Scharfblick - wie furchtbar schwer sie zu machen war, wie sein Vater nach jeder Visite wortkarger und bleicher, mit geschlossenen Augen, deren Lider sich gerötet hatten, in der Wagenecke lehnt…
Der Leistungsdruck vermindert Hannos Leistungsbereitschaft, wenn er versagt, folgen harte Sanktionen und Missachtung:
S. 510f
Während des Beisammenseins in den Pausen etwa, beim Wechseln des Geschirrs, war es seine Pflicht, sich ein wenig mit dem Jungen zu beschäftigen, ihn ein bisschen zu prüfen, seinen praktischen Sinn für Tatsachen herauszufordern. Wieviel Einwohner besaß die Stadt? Welche Straßen führten von der Trave zur oberen Stadt hinaus? Wie hießen die zum Geschäft gehörigen Speicher? Frisch und schlagfertig hergesagt! - Aber Hanno schwieg. Nicht aus Trotz gegen seinen Vater, nicht um ihn wehe zu tun. Aber die Einwohner, die Straßen und selbst die Speicher, die ihm unter gewöhnlichen Umstanden unendlich gleichgültig waren, flößten ihm, zum Gegenstand eines Examens erhoben, einen verzweifelten Widerwillen ein. ..“Genug!“ rief der Senator zornig. „Schweig! Ich will gar nichts mehr hören!. Du darfst stumm und dumm vor dich hinbrüten dein Lebtag…
Im 20. Jahrhundert erfuhren die Arbeit und der Beruf durch den Konkurrenzgedanken im Kapitalismus eine Aufwertung. Der Ort der Tätigkeit entfernte sich immer mehr von der Familie, wodurch das Arbeitsgebiet des Vaters eine Hochstilisierung erlebte.
(AG)
Ein Beispiel dafür ist Richad Sterk, dessen Beruf ihm innerhalb und außerhalb der Familie ein immenses Ansehen verschafft.
S. 166
Schatz, ich denke da an einen Spruch von Papa, dass man immer bestrebt sein soll, sich über den Durchschnitt zu halten, und das nicht nur in moralischer Hinsicht, er hat es, glaube ich, auch während des Krieges so gehalten, und wie weit man damit kommt, kann man an seiner jetzigen Position sehe…
S. 143
Papa omnipotens. Was aus seinem Mund kommt, ist Dikta…
S. 84
- Sie könnten sich auch dazu entschließen, Ihre Ansichten zu korrigieren. Sie sind ein talentierter Man…
- Mit Hinblick auf Ihre Begabung hätten Sie guten Grund daz…
Selbständigkeit erfuhr einen Wandel; es entstanden neue Formen der Selbständigkeit und des Erwerbs, die zwar nicht selbständig im alten Sinne waren, aber trotzdem eine leitende Tätigkeit umfassten, und es entwickelten sich die Angestelltenexistenzen, die einen großen Teil der Gesellschaft ausmachen. Bis heute ist Selbständigkeit aber stets verknüpft mit einer gewissen Freiheit und einem angesehenen sozialen Status.420 (AG)
Das Familienstammhaus der Sterks weist die beschriebene bürgerliche Werthaltung in der nächsten Generation ebenfalls auf:
So hat die Vorstellung von Leistungsbereitschaft im Beruf und in der Familie von Ingrid eine starke Affinität zu den o.g. bürgerlich-liberalen Leistungsvorstellungen. Ihre in der Herkunftsfamilie gelernten Werte wurden internalisiert bzgl. Arbeitsmotivation, Leistung, Sauberkeit, Ordnung im Haus, Karrierestreben, Bereitschaft zur Eigeninitiative - all das beeinflusst ihr berufliches und privates Verhalten und Denken.
In ihrem Gespräch mit Peter zum Anfang ihrer Beziehung macht sie dies deutlich.
S. 167f
Aber bitte, bitte, geh im Wintersemester zurück über deine Bücher, wirst sehen, das kommt dich auch billiger … Vielleicht kannst du am Ende mit einer Prüfung abschließen, das wär das allerhöchst…
… wer soll das finanzieren, wo alles immer teurer wird? Soviel Nachhilfe kannst du gar nicht geben. Die Studiererei bringt dich ja nicht um, wirst sehen, und du bekommst am Ende als Belohnung mic…
S. 170
… aber du musst jetzt mit eiserner Energie arbeiten und wirklich versuchen, Papa einen Beweis deiner Tüchtigkeit zu liefer…
Sie selber realisiert das bürgerliche Leben, indem sie ihre akademische Ausbildung verfolgt und mit dem Studium der Medizin den sozialen Aufstieg anvisiert.
S. 245
- Wozu hätte ich dann so lange studiert, wenn ich die Ausbildung nicht nutzen würde. Du hast doch gewusst, dass du eine angehende Ärztin heirates…
Peters Leistungsvorstellung dagegen entspricht anfangs nicht dem bürgerlichen Denken. Seine wirtschaftlichen Verhältnisse sind ungeklärt, er studiert unregelmäßig, das Fotografieren im Tiergarten bringt nur einen geringen Nebenverdienst. Peter arbeitet insofern selbständig, dass er selbst kreierte Spiele verkauft, die aber keine Existenzgrundlage darstellen. Hinzu kommt noch eine Krankheit seinerseits, die verhindert, dass er wenigstens das Weihnachtsgeschäft als guten Verdienst hat. Später steht der Staatsvertrag bevor, der wiederum dazu führt, dass die Spielpläne von Peters Spiel mit den Grenzen aktualisiert werden müssen
S. 148
… wenn man sein Studium seit Jahren nicht weiterbringe und auch sonst nichts vorzuweisen habe außer Schulde…
S. 167
… und es darf einfach nicht sein, dass du noch so eine Verlegenheitsarbeit hast, bloß um Geld zu verjuxe…
Nach dem Tod Ingrids erlebt Peter einen beruflichen Aufstieg, ist ein erfolgreicher Entwickler einer Knotenlehre, die Kreuzungen analysiert und Sicherheit und Funktion einer Kreuzung erklärt. Diese Arbeit beherrscht er, er ist kompetent und hat sich damit internationale Reputation erworben.
S. 307
Als Entwickler einer allgemeinen Knotenlehre hat er sich internationale Reputation erworben durch den bloßen Hinweis auf Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein müssten. Dass man Kreuzungen als aktive, katalysatorische Verteilersysteme zu verstehen hat. …
Seinen Kindern demonstriert er dies auf dem Weg in den Urlaub, mit dem Wunsch nach Respekt und Achtung - beides bleibt aber aus.
S. 306
- Jetzt könnt ihr euren Vater mal zehn Minuten bei der Arbeit zusehen. bitte um gebührende Aufmerksamkeit. Er sagt es, als sei es als Scherz gemeint, und in der Tat hat er keine Hoffnung, dass die Blicke seiner Kinder voller Bewunderung auf ihm ruhen werden, vor allem bei Sissi macht er sich nichts vor. Er gesteht sich ein, wieviel ihm ihre Anerkennung bedeuten würde. Wieviel. Er gesteht es sich ein, ist aber vorsichtig genug, sich nichts anmerken zu lasse…
Sein Aufstieg ist nicht zuletzt damit zu erklären, dass sich in Westdeutschland und Österreich seit Kriegsende eine positive Haltung der Betriebe Vätern gegenüber etablierte, das Einkommen verheirateter Männer stieg nach der Familiengründung im Zuge der Vaterschaft.
Das gab es in der DDR nicht.421
Peters Sohn Philipp zeichnet sich dagegen durch Träumerei und Passivität aus, S. 50
Den ganzen Vormittag bringt Philipp nichts zustande. …
Nachmittags lungert er eine Weile mit einem belegten Brot in der Diele herum. Er kann sich aber nicht dazu durchringen, nochmals in den Dachboden hinauszusteigen, um dort die Tauben zu vertreiben. Die Tauben, die ihn demoralisieren und ihm jede Lust an der Arbeit nehmen. nicht dass seine Moral sonderlich gut oder seine Lust sonderlich groß wär…
S. 325
- Was soll ich denn jetzt deiner Meinung nach tun? fragt er die Katze. … ,Auch Nichtstun kann die Dinge zum Eskalieren bringen.…
Dann wiederum überfällt ihn ein regelrechte Tätigkeitsdrang: Ein Baum für das Richtfest wird abgesägt, ein Fahrrad repariert:
S. 375
Er kämpft sich zur westlichen Mauer durch, dort versucht er, eine hüfthohe Fichte auszureißen, was ihm aber nicht gelingt, er schürft sich nur die Hände auf. Weil er Steinwald nicht um die Axt bitten will, holt er aus dem Keller einen stumpfen Fuchsschwanz, der beim Sägen ständig steckenbleibt, so dass Philipp sich mehrmals fast das Handgelenk bricht. Er sägt wie ein Verrückter und ist nahe an einem Muskelkrampf, da lässt sich der Stamm endlich breche…
S. 333
Philipp repariert Johannas Fahrrad. Er stellt es auf den Kopf ..repariert (er) die Schäden am Fahrrad sehr gewissenhaft. Er wechselt die Bremsklötze, die Glühbirne des Rücklichts, verbessert die Position des Dynamos, fixiert die Lenkstange, zieht ein paar Schrauben an und ölt alles, was zu ölen ist. Er arbeitet sehr konzentriert, so dass er bereits nach anderthalb Stunden fertig ist. Zu früh für sein Empfinden, weshalb er auch sein Fahrrad wäscht…
(ER)
In der DDR wurde die Arbeit ebenfalls hochgeschätzt. Wilhelm als Arbeiter hat ein grenzenloses Selbstbewusstsein. Die herausragende Bedeutung, die die SED ihm als Arbeiter zubilligt, gibt ihm soziale Anerkennung und eine ökonomische Absicherung.
S. 196
Natürlich konnte er den Ausziehtisch ausziehen. Schließlich hatte er Metallarbeiter gelernt. Was hatte Alexander gelernt? Was war der eigentlich? Nichts. Jedenfalls fiel Wilhelm nichts ein, was Alexander sein könnte. Außer unzuverlässig und arrogant. Noch nicht einmal in der Partei war der Ker…
Was mit den Selbständigen aus dem Besitz- und Wirtschaftsbürgertum in der DDR geschah, ist bekannt: Die Beseitigung der Privatwirtschaft erfolgte durch die Enteignung oder Verstaatlichung der kleineren und größeren Betriebe, die noch in privater Hand waren. Für Selbständige war ab 1948 die wirtschaftliche Existenz unmöglich geworden. Falls sich die Bürger nicht für die Abwanderung in den Westen entschieden, wurden sie in die VEBs eingebunden.
Die Rolle der Erwerbsarbeit war für die Realität und das Selbstverständnis der DDR- Gesellschaft stets wichtig. Die Beschäftigten hatten eine starke Stellung, denn es gab chronischen Arbeitskräftemangels. Eine Kündigung war praktisch unmöglich und regionale Arbeitsmobilität gering. Man wies zentralistisch die Arbeitskräfte den Betrieben zu, wo sie im Arbeitskollektiv durch ein langfristiges Beschäftigungsverhältnis ein identitätsstiftendes Zugehörigkeitsgefühl entwickelten.
Häufige Lieferengpässe und Koordinationsmängel forderten von den Beschäftigten zwar Flexibilität, doch menschliche Wärme und Kollektiverfahrung glichen dies aus, und weil es keinerlei Leistungsdruck und Konkurrenz gab, verbanden sich Tauschbeziehungen im Arbeitskollektiv mit Hilfsbereitschaft. So entstanden im Betrieb soziale Beziehungen.
(ER)
In der Familie Umnitzer lesen wir von betriebssozialen Beziehungen zwischen den Arbeitskollegen und ihren Familien, die bis zu Hilfeleistungen und persönlicher Nähe jenseits der Arbeit reichten.
S. 167f
Beim Frühstück eröffnete ihm Irina, dass sie heute noch einmal losmüsse: Gojkovic komme, der jugoslawische Schauspieler, der in dem Indianerfilm, den die DEFA drehen wollte, die Hauptrolle spielte. Seit Irina - er wusste im Grunde gar nicht, als was - bei der DEFA arbeitete, kam es öfter vor, dass sie ihn in dieser Weise enttäuschte. angeblich war es eine Halbtagsstelle, aber in Wirklichkeit arbeitete sie oft bis in die Nacht oder am Wochenende.Ja, natürlich hatte auch Irina ein Recht zu arbeiten. Wenngleich es eine höchst seltsame Arbeit war, mit irgendwelchen Schauspielern im Gästehaus der DEFA zu sitzen und Wodka zu saufen. Oder mit dem Indianer durch die Gegen zu fahre…
S. 244f
… drei bekam der Autoschlosser!; einen der Buchhändler; und zwei schließlich eine ehemalige Kollegin, aus deren väterlichen Kleingarten jene getrockneten Aprikosen stammten, außerdem Quitten und dickschalige Winterbirne…
Im Sozialismus stand Planerfüllung vor Eigeninitiative und Kreativität. Da Letzteres unerwünscht war, kam es zum inneren Rückzug der Beschäftigten von der Arbeit, man schonte die eigenen Kräfte, wehrte Verantwortung ab, und häufig machte sich der Schlendrian breit.422 Statt eigene Initiative zu entwickeln, hatte man hohe Erwartungen an den Staat.423
Als es dann ab einem bestimmten Zeitpunkt einen Mangel an Arbeitskräften mit geringerer Qualifikation gab, entstanden Disproportionen bei der Bezahlung: Produktionsarbeiter verdienten irgendwann mehr als Mitarbeiter mit Hoch- und Fachschulabschluss. Die Folge waren fehlende Leistungsmotivation und Arbeitsdisziplin.424
Mit Hilfe von hunderten verschiedenen Auszeichnungen, Orden, Ehrennadeln und Preisen, Medaillen und Urkunden versuchte man, die Arbeitskraft zu steigern, die Bevölkerung zu disziplinieren und die Identifikation mit dem Staats und der Ideologie zu festigen, man verteilte Sach- und Geldprämien, verschenkte Reisen und Kuraufenthalte und gestaltete zur Übergabe zahlreiche Festakte.425
Die Figuren im Roman zeigen, dass aber nicht nur die marxistisch-leninistische Theorie der Arbeit und die Arbeitsideologie mit der Ausrichtung der Arbeit als politischgesellschaftliche Aufgabe ohne die individuell-protestantischen Leistungsethik eine wichtige Rolle bei der Arbeit spielte, sondern auch immer noch die im Bürgertum gesetzten individuellen Glücksansprüche und der Individualismus.426
Der Erwerb von Eigentum für das Haus und Irinas Verschönerungsaktionen mit Mitteln aus dem Westen sind hier ein Beispiel.
Mangelnde Beschäftigungsperspektiven in der Heimat lassen Sascha als Künstler und Intellektuellen nach Westdeutschland ziehen. Er besitzt Mobilität, ist jung und ungebunden.
S. 26
Klar, dass die zwölf Jahre vor der Wende ihm unverhältnismäßig länger erschienen als die zwölf Jahre danach. 1977 - das war eine Ewigkeit! 1989 dagegen - ein Rutsch, eine Straßenbahnfahrt. Dabei war doch einiges passiert, ode…
Er war abgehauen und wieder zurückgekehrt (wenn auch das Land, in das er zurückkehrte, verschwunden war). Er hatte einen ordentlich bezahlten Job bei einem Kampfkunst-Magazin angenommen (und wieder gekündigt). Hatte Schulden gemacht (und wieder zurückgezahlt). Hatte ein Filmprojekt angezettelt (vergiss es)Er hatte zehn oder zwölf oder fünfzehn Theaterstücke inszeniert (an immer unbedeutenderen Theatern). War in Spanien, Italien, Holland, Amerika, Schweden, Ägypten gewesen (aber nicht in Mexico)…
Erwerbs- und Berufsverläufe änderten sich durch die Wende:
„Die Wiedervereinigung erzwang eine Umorientierung von einer hoch selektiven, politisch privilegierten Karriere zum Überleben in einem offenen Arbeitsmarkt, der eine hohe Flexibilität im Hinblick auf Arbeitsorte und Arbeitszeiten erzwingt.“ 427
Während Sascha, seiner ehemalige Frau und ihrem Ehemann die Umorientierung gelingt, steht Markus vor Anpassungsproblemen.
S. 379
Es stellte sich heraus, dass wieder mal ein Brief von seiner Telekom gekommen war. Das Übliche: Fehltage, schlechte Noten, aber allmählich brannte die Sache und wie dankbar er ihm se…
müsse, dass Klaus ihm die Lehrstelle besorgt hätte, blablabla. Er hatte Klaus niemals darum gebeten, ihm eine Lehrstelle als Kommunikationselektroniker zu besorgen (eigentlich wäre er gern Tierpfleger geworden, und wenn das nicht möglich war, weil es angeblich keine offenen Lehrstellen gab, wäre er am liebsten Koch geworden, da gab es offene Lehrstellen, aber nein: Kommunikationselektronike…
Seine Mutter und ihr Partner beschreiten durch pragmatisches Zielbewusstsein und Anstrengung den erfolgreichen Karrierepfad und ergreifen die Chancen, die sich ihnen durch die Wiedervereinigung bieten.
13.2 Kleidung und Reinlichkeit
Arbeit und Beruf verlangten einen Dresscode, der Kleidung zu einem sozialen Distinktionsmedium und zu einem Mittel der Selbstdarstellung und der Abgrenzung macht. Sie symbolisiert für den arbeitenden Bürger Status und Position und demonstriert, wie sehr Bürgerlichkeit ein Kulturmodell und einen sozial und kulturell geformten Habitus darstellt, der sich in mentalen Einstellungen zeigte: Die äußere Haltung sollte die innere Haltung des Bürgers widerspiegeln. Die „umgangsförmliche Erscheinung“ war an das „Sein“ zurückgebunden, so dass die beobachtbare Haltung und das äußere Erscheinungsbild zum Maßstab empfundener Werte oder gegebener Charaktermerkmale wurden.428
Es gab Regeln angemessener bürgerlicher Kleidung.429 Stets sollte das äußere Erscheinungsbild des Bürgers geprägt sein durch die Auswahl einer Kleidung, die Gediegenheit in Material und Verarbeitung zeigte. Unsauberkeit und Schlampigkeit in der Kleidung waren verpönt.
(TM)
So wird die Skepsis von Seiten des Kindermädchens bei der Begegnung Hannos mit dem jungen verarmten Grafen verständlich:
S. 516
… nur mit einem von ihnen verknüpfte ihn, und zwar seit den ersten Schultagen, ein festes Band, und das war ein Kind von vornehmer Herkunft, aber gänzlich verwahrlostem Äußeren, ein Graf Mölln mit dem Vornamen Ka…
Es war ein Junge von Hannos Statur, aber nicht wie dieser, mit einem dänischen Matrosenhabit, sondern mit einem ärmlichen Anzug von unbestimmter Farbe bekleidet, an dem hie und da ein Knopf fehlte, und der am Gesäß einen großen Flicken zeigte. Seine Hände, die aus den zu kurzen Ärmeln hervorsahen, erschienen imprägniert mit Staub und Erde und von unveränderlich hellgrauer Farbe. der Kopf, welcher vernachlässigt, ungekämmt und nicht sehr reinlich..wa…
Mode war nach Auffassung des Bürgertums der Weiblichkeit verhaftet, und modische Eleganz beim Mann demonstrierte Unmännlichkeit und qualifizierte ihn ab, wohingegen Bürgerfrauen sich der wandelnden Mode unterwarfen und durch ihre Kleidung ihren Status repräsentierten: Nur sie trugen Korsetts, Männer schnürten sich nicht mehr, weil sie dadurch ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt hätten und des demonstrativen Müßiggangs verdächtigt worden wären.
(TM)
Die älteren Männer der Buddenbrook-Familie kleiden sich ihrem Geschmack entsprechend.
Der alte Konsul trägt noch die Mode seiner Jugend:
S. 8
Sein, rundes, rosig überhauchtes und wohlmeinendes Gesicht, wurde von schneeweiß gepuderten Haar eingerahmt, und etwas wie ein ganz leise angedeutetes Zöpflein fiel auf den breiten Kragen seines mausgrauen Rockes hinab. ..nur auf den Tressenbesatz zwischen den Knöpfen und den großen Taschen hatte er verzichtet, aber niemals im Leben hatte er lange Beinkleider getragen. Sein Kinn ruhte breit, doppelt und mit einem Ausdruck von Behaglichkeit auf dem weißen SpitzenJabo…
Herr Lebrecht Kröger wird als ein a la mode-Kavalier beschrieben:
S. 17
Lebrecht Kröger., eine große, distinguierte Erscheinung, trug noch leicht gepudertes Haar, war aber modisch gekleidet. An seiner Sammetweste blitzten zwei Reihen von Edelsteinknöpfe…
Ästhetische Grundregeln und Geschmack betonten in der Frauenmode Vielgestaltigkeit und Buntheit, so zu lesen bei Konsulin Elisabeth Buddenbrook: S. 9
Ihr kurzes Mieder mit hochgepufften Ärmeln, an das sich ein enger Rock aus duftiger, hellgeblümter Seide schloss, ließ einen Hals von vollendeter Schönheit frei, geschmückt mit einem Atlasband, an dem eine Komposition von großen Brillanten flimmert…
Aufgenähte Atlasstreifen stellten dabei Insignien bürgerlichen Lebens da. Derlei „Objekte“ dienten dazu, die Zugehörigkeit zu einer Gruppe zu demonstrieren und spezielle Werte und Lebensorientierungen zum Ausdruck zu bringen. „Alle Objekte, die am Körper im weitesten Sinne befestigt werden können und so zusammen mit ihm erblickt werden, können als Identitätssymbole dienen“.430
Tony empfängt ihren Vater in einem der ernsthaften Situation angemessenen Outfit:
S. 210
Sie sah wohl, hübsch und ernsthaft aus und trug ein hellgraues, auf der Brust und an den Handgelenken mit Spitzen besetztes Kleid mit Glockenärmeln, stark geschweiftem Reifrock nach neuester Mode und einer kleinen Brillantspange am Halsverschlus…
Ein besonderes Kleidungsstück besitzt sie gleich mehrfach, den Schlafrock:
S. 197
Tony war im Schlafrock; sie schwärmte fürSchlafröcke. Nichts erschien ihr vornehmer, als ein elegantesNegligé,... Sie besaß drei dieser schmiegsamen und zarten Kleidungsstücke, bei deren Herstellung mehr Geschmack, Raffinement und Phantasie entfaltet werden kann, als bei einer Balltoilette. Heute aber trug sie das dunkelrote Morgenkleid, dessen Farbe genau mit dem Tone der Tapete über der Holztäfelung übereinstimmte und dessen großgeblümter Stoff, weicher als Watte, überall mit einem Sprühregen ganz winziger Glasperlchen von der selben Färbung durchwirkt war. Eine gerade und dichte Reihe von roten Sammetschleifen lief vom Halsverschluss bis zum Saume hinunte…
Die ältere Mme. Antoinette Buddenbrook, geborene Duchamps, wählt ihrem Alter entsprechend, unauffällige, Einfachheit und Bescheidenheit ausdrückende Garderobe: S. 8
Sie war eine korpulente Damen mit dicken weißen Locken über den Ohren, einem schwarz und hellgrau gestreiften Kleide ohne Schmuc…
Die Männermode dagegen war uniform, nüchtern und unauffällig, ja man kann behaupten, sie war durch uniformierte Farblosigkeit und Strenge geprägt, ganz anders als beim Adel. Für die Männer wandelte sich in der Kleidung die Farbe in die Richtung des unauffälligen Graus, es drückte Unempfindlichkeit und männliche Würde aus und stand im Gegensatz zur bunten unmännlichen Kleidung. Man favorisierte entsprechend der bürgerlichen Moral einfache, vernünftige und praktische Kleidung.431 Der dreiteilige Anzug mit Hose, Jackett und Weste, genannt Sakko, wegen des sackartigen Schnitts, prägte das Bild des Mannes. Der demonstrative Repräsentationsstil des Adels mit Perücken, Puder, Reifröcken, Schuhen mit hohen Absätzen entsprach ganz und gar nicht mehr dem bürgerlichen Männlichkeitsideal und verschwand. Nichts deutete mehr auf die Betonung der Geschlechtlichkeit hin. Eine sexuelle Schamgrenze tabuisierte den Körper des Mannes. Statt Kniehosen und sichtbare Strümpfe trugen die Männer Beinkleider, die durch eine geschlossene Jacke diskret den Hosenschlitz verdeckten, so wie Konsul Jean Buddenbrook
S. 9
Der Konsul beugte sich mit einer etwas nervösen Bewegung im Sessel vornüber. Er trug einen zimmetfarbenen Rock mit breiten Aufschlägen und keulenförmigen Ärmeln, die sich erst unterhalb des Gelenkes eng um die Hand schlossen. Seine anschließenden Beinkleider bestanden aus einem weißen, waschbaren Stoff waren an den Außenseiten mit schwarzen Streifen versehen. Um die steifen Vatermörder, in die sich sein Kinn schmiegte, war die seidene Krawatte gebunden, die dich und breit den ganzen Ausschnitt der buntfarbigen Weste ausfüllt…
Herr Grünlich kleidet sich stets überaus sorgfältig:
S. 219
Er trug einen ähnlichen schwarzen, faltigen, soliden Leibrock, ähnlich erbsenfarbene Beinkleider, wie diejenigen, in denen er einstmals in der Mengstraße seine ersten Visiten gemach…
Auf dem Kopf betonte der Hut bzw. Zylinder die Eleganz und Geometrie des Aussehens. Er wurde zum bedeutsamen Kleidungsstück des Bürgers. Der gezogene Hut des Mannes galt als Geste der Ehrerbietung und hatte seinen Ursprung in der militärischen Grußsitte. Den Bürgern galt er als Ritual in der Begegnung prinzipiell Gleicher innerhalb des Standes: das Abnehmen dieser Kopfbedeckung galt als Höflichkeitsbezeugung. Zusammen mit dem Spazierstock gehörte er zum Habit des Bürgers und signalisierte Würde und eine männliche Macht:
S. 164
Thomas Buddenbrook ging die Mengstraße hinunter bis zum „Fünfhausen“. Er vermied es, oben herum durch die Breitestraße zu gehen, um nicht der vielen Bekannten wegen beständig den Hut in der Hand tragen zu müsse…
Die bayerische Variante trägt Herr Permaneder bei seinem Antrittsbesuch in Lübeck: S. 325
In der einen seiner kurzen, weißen und fetten Hände hielt der Herr seinen Stock, in der anderen ein grünes Tyrolerhütchen, geschmückt mit einem Gemsbar…
D a s äußere Kennzeichen des Reinlichkeit liebenden Bürgers waren weiße Accessoires: Häubchen und Umhänge bei Frauen, Kragen und Halstücher beim Mann, ebenso wie weiße Hemden mit auswechselbaren Ärmeln, Manschetten. Die dominierende Farbe Weiß wurde zum Symbol des Guten und Reinlichen und galt als soziale Abgrenzung zu der körperlich arbeitenden Bevölkerung. Bei der Frau deutete dies auf Häuslichkeit hin und der Mann zeichnete sich mit dieser Farbe als beruflich erfolgreicher Geschäftsmann aus, der einer sauberen Büro- Schreibtischtätigkeit nachging. Der weiße Kragen des Mannes fand sich im sog. „Vatermörder“, (wie bei Konsul Jean Buddenbrook, s.o.), dessen Kragen die Männer, schmerzte, aber ein wichtiges Zeichen dafür war, dass man geistige und nicht körperliche Arbeit verrichtete!
(TM)
Thomas Buddenbrook neigt in seiner Kleidung zum Feinen und Aristokratischen:
S. 294
Man wusste, besonders der Tuchhändler Benthien wusste es, dass er nicht nur seine sämtlichen feinen und neumodischen Kleidungsstücke - und er besaß deren ungewöhnlich viele:Pardessus,Röcke, Hüte, Westen, Beinkleider und Cravatten - ja auch seine Wäsche aus Hamburg bezo…
Seine Reinlichkeit nimmt mit den Jahren pathologische Züge an:
S. 294
Man wusste sogar, dass er tagtäglich, manchmal sogar zweimal am Tage, das Hemd wechselte und sich das Taschentuch und denà la NapoléonIII. ausgezogenen Schnurrbart parfümier…
Das Tragen von Unterkleidung (Unterhose, -hemden) und baumwollenen Schnupftüchern setzte sich durch432, als mit dem Aufschwung der Textilindustrie, bedingt durch die Aufhebung der Handelsbeschränkungen, Baumwollstoffe massenhaft Verbreitung fanden.
Die Alltagskleidung der Kinder (z.b. die Schulkleidung) unterschied sich von ihrer Kleidung am Sonn- und Festtag:
(TM)
S. 14
„. Diese beiden jungen Leute“, und er wies auf Tom und Christian, die in blauen Kitteln mit Ledergürteln bei ihm stande…
Hanno ist in der Schule mit einem „dänischen Matrosenhabit“ (S. 516) bekleidet, er.
S. 7…
… zog die dicke, wollige Winterjacke an, setzte den Hut auf. und stürzte die Treppe hinunte…
Bei der Feier der Hauseinweihung und zu Weihnachten wurden Tony und die kleine Elisabeth fein gemacht:
S. 7
Und die kleine Antonie, achtjährig und zartgebaut, in einem Kleidchen aus ganz leichter, changierenderSeide.
S. 532
Was die kleine Elisabeth betraf, so war es unmöglich, über ihren Gemütszustand zu urteilen. In einem Kleidchen, an dessen reichlicher Garnitur mit Atlasstreifen man Frau Permaneders Geschmack erkannte, saß das Kind auf dem Arm seiner Bonn…
(AG)
Reinlichkeit der Kleidung ist auch im 20. Jahrhundert ein Zeichen von innerer Ordnung und bei Geschäftsleuten, in diesem Fall bei Peter, ein Hinweis für Seriosität. Das macht Ingrid ihm klar, als sie ihm ihre Vorstellung von einer gemeinsamen Zukunft anschaulich darstellt:
S. 169
So verschwitzte Wäsche und Kleider, das ist wirklich etwas Hässliches und kann sehr abstoßend und geschäftsschädigend sein, ein schöner Schlamperdatsch, von dem ist keine ordentliche Arbeit zu erwarten.. Deine Fußsohlen sehen ja manchmal aus, als ob du durch den Schornstein gekommen wärs…
Peter vernachlässigt seine Kleidung aus zeitlichen und finanziellen Gründen, wechselt Berufskleidung mit unansehnlicher Alltagskleidung:
S. 1…
Sie riecht das Öl an seinen Händen. Das kommt daher, dass er immer an der Tankstelle mit dem Öllumpen seine Schuhe putz…
S. 1…
… und Peter, mit weiterhin verrutschter Mine, steckt in Alltagskleidern, in durchhängenden Jeans . und in dem unansehnlichen Arbeitskittel, der er von seiner ältesten Schwester zum letzten Weihnachten geschenkt bekommen ha…
Der Hut bleibt für Richard im Jahre 1955, der Zeit der Restauration und der Verhandlung zum Staatsvertrag, ebenfalls noch ein bedeutsames bürgerliches Utensil: S. 151
Richard holt sich seinen Hut, vergewissert sich vor dem Spiegel, dass der Hut gerade sitz…
Alma kleidet sich im Stil ihrer Zeit 1938 weiblich-modisch:
S. 69
Alma räkelt sich bäuchlings auf ihrer Liege, in einem weißen Sommerkleid mit blauen Punkten und Puffärmel…
In den letzten Jahrzehnten zeigen sich Identität und soziale Gruppenzugehörigkeit zwar weiterhin in der Kleidung und in Symbolen, aber mehr noch in der Gestaltung des eigenen Lebensstils, durch den gesamten Konsum bzw. der Wahl persönlicher Objekte und einer idealistischen bzw. materialistischen Lebensorientierung.433
(AG) ..
Ingrid richtet sich 1962 in ihrem Äußeren nach der aktuellen Mode - und die provozierte entsprechend der damaligen Zeit des Auf- und Umbruchs mit Lederjacken und kurzen Kleidern:
S. 207
Ingrid steigt aus, in kniehohen Lederstiefeln, einem kurzen, hellroten Kleid mit Plisseefalten und einer glatten schwarzen Lederjack…
Von Philipp erfahren wir, dass er sich eine besondere Arbeitskleidung wünscht, um sich von den Arbeitern in seinem Status abzusetzen:
S. 13…
Auf die Frage, ob er ebenfalls Gummistiefel brauche, antwortet e…
- Gelbe, Größe 4…
die Arbeiter steigen aus, und Steinwald beklagt sich in vorwurfsvollen Ton, dass sie im ersten Baumarkt keine gelben Gummistiefeln erhalten und so über eine Stunde verloren hätten…
von Steinwald und Atamanov in ihren dunkelgrauen Stiefeln flankiert, würde er anhand der gelben Stiefel leicht als hochstehende Persönlichkeit erkennbar sei…
(ER)
In Ruges Roman sind es die Frauen, deren Kleidung ihre Identität widerspiegelt.
Charlotte stellt ihre Garderobe anlässlich der Rückkehr nach Deutschland wie folgt zusammen:
S. 44
… außerdem in reichlichem Umfang Kleidung, von der sie glaubten, dass sie sowohl dem Klima als auch ihrem neuen gesellschaftlichen Status entsprach. Statt heller, luftiger Sommersachen probierte Charlotte nun hochgeschlossene Blusen und dezente Kostüme in verschiednen Grautöne…
Sie geniert sich wegen eines bürgerlichen Requisits und beseitigt ihr damenhaftes Outfit:
S. 49, 50, 52
Allmählich dämmerte Charlotte, dass der Hut mit dem schwarzen Halbschleier, den sie extra für die Rückkehr gekauft hatte, eine Fehlentscheidung gewesen wa…
Charlotte schämt sich. Für ihren Hutschleie…
Sie stand auf, nahm den Hut ab. Spülte den Mund aus. Betrachtete sich im Spiegel. Idiotin. Holte die Nagelschere aus ihrer Handtasche und trennte den Halbschleier von ihrem Hut a…
Saschas ehemalige Frau Melitta verändert den Stil ihrer Kleidung im Laufe der Jahre und damit ihre Erscheinung, je nach Lebensorientierung/-stil:
S. 251ff
Allerdings waren die flachen, gurkenähnlichen Schuhe, die die Neue trug, ohnehin kaum von Hauspantoffeln zu unterscheiden…
… während Irina.über die Kleidung der Neuen nachdachte: über den langen braunen Cordrock, die braunen Wollstrumpfhosen - und was trug sie da obenherum? Irgendetwas Unförmiges, Unfarbenes. Und wieso, wenn sie schon kurze Beine hatte, trug sie nicht wenigstens hohe Schuh…
S. 269
… normalerweise lief sie den ganzen Tag im karierten Hemd rum (am liebsten von Jürgen - solange es Jürgen noch gegeben hatte), und jetzt: Stöckelschuhe…
S. 337f
… wirklich knallkurzer Rock. sie trug gemusterte Stümpf…
Irina:
S. 63
… sodass sie beschloss, nicht das lange Rückenfreie anzuziehen, wie im letzten Jahr, sondern, obschon weniger festlich, den ozeangrünen Rock, der eigentlich ein bisschen kurz war für ihr Alte…
Saschas Kleidung in der besetzten Wohnung während seiner beruflichen Krise drückt seine Protesthaltung aus:
S. 291
Er trug eine grässlichen, auffällig geflickten blauen Pullove…
Auf seiner Reise in Mexiko erwirbt er die typisch bürgerliche Kopfbedeckung:
S. 100
Alexander kauft einen Hut. Er hat, weiß er, schon immer einen Hut kaufen wollen.Er kauft den Hut, weil er sich mit Hut gefällt. Er kauft den Hut, um gegen die ihm anerzogenen Prinzipien zu verstoßen. Er kauft ihn, um gegen seinen Vater zu verstoßen. Er kauft ihn, um gegen sein ganzes Leben zu verstoßen, in dem er keinen Hut trug.Er lässt sich treiben. Jetzt erst gehört er wirklich dazu. Jetzt, mit dem Hut, ist er einer von ihne…
S. 105
Setzt seinen neuen Hut auf. . Er sieht älter aus, als er ist. Er sieht gefährlicher aus, als er is…
Über Wilhelms bürgerlichen Aufzug sagt Nadjeshda Iwanowna:
S. 143
Wilhelm, beinahe wie achtzig, und immer im Anzug, wie ein Minister sah er aus und sprach auch so, mit Bedeutung, merkte man gleic…
Saschas spätere Partnerin Catrin passt sich dem bürgerlichen Dresscode des Westens an. Die ,ostige’ Kleidung der DDR sah man nach der Wende als unfein-billig und proletarisch an:
S. 360
Irina hatte Catrin zum letzten Mal im Sommer gesehen, und sie erinnerte sich jetzt, dass ihr schon damals eine Wandlung aufgefallen war: Aus der immer irgendwie sperrig aussehenden, billig zurechtgemachten Frau war auf einmal so etwas wie eine Erscheinung geworden. Ob es an den Westklamotten lag (sie trug ein klassisches dunkles Kostüm). - Catrin sah plötzlich aus wie die Frauen in den Kataloge…
Neben der Kleidung war eine bestimmte Reinlichkeitsnorm das Erkennungszeichen des Bürgers: Die Ablehnung von Schmutz und die Vermeidung des Kontaktes mit dem Unreinen markierten die bürgerliche Existenz.
Als durch die medizinische Forschung Bakterien entdeckt und gleichzeitig der Schutz vor Gesundheitsgefahren bekannt gemacht wurde, gewannen Körperpflege und -hygiene in der Gesellschaft der Bürger eine große Bedeutung, und es kam zu einer Etablierung einer neuen Reinlichkeit. Sie bezog sich sowohl auf die Reinlichkeit im Haus als auch auf die Körperpflege. Ersteres oblag der Frau und stand im Zusammenhang mit ihrer sexuellen Attraktivität, denn eine unreinliche Ehefrau, die Unordnung und Schmutz im Haushalt duldete, so war die Auffassung, reduzierte auch die emotionale Bindung zu ihrem Partner.434
Im Bereich der Körperpflege entsprachen die Verhaltensmuster des Adels mit seiner bloß äußerlichen Sauberkeit nicht mehr dem Reinlichkeitsideal der Bürger. Die Reinigung der gesamten Körperoberfläche wurde für ihn zur wichtigsten Verhaltensnorm und ein Bestandteil der bürgerlichen Leistungsethik, denn Hygiene diente der Gesundheit, die wiederum war eine Voraussetzung für individuelle Leistung und Arbeitsfähigkeit.435 (TM)
Johann Buddenbrook ist noch der Zeit und Mode des 18. Jahrhundert verhaftet, als ein entsprechender Geruch als ein Merkmal der Sauberkeit galt; man wählte Parfum zur Parfümierung des Körpers und Puder in der wasserlosen Pflege als Reinigungsmittel, z.B. bei der Trockenwäsche der Haare mit Puder und der anschließenden Parfümierung gegen Austrocknung und zur Entfettung des Haares. Im 19. Jahrhundert stellte es nur noch ein Relikt der früheren ständischen Ordnung dar, ebenso wie das Tragen von Perücken.
S. 8
Sein rundes, rosig überhauchtes und wohlmeinendes Gesicht, ..., wurde von schneeweiß gepudertem Haar eingerahmt …
Reinlichkeit wurde zu einem Zeichen für Tugend und Ehrbarkeit, und die Verknüpfung von Gesundheit und Moral kam besonders in der Erziehung zur Reinlichkeit zum Ausdruck. Es gab den Begriff der„doppelten Reinlichkeit“: Sie umfasste den inneren und äußeren Menschen und sah die körperliche Verfassung des Menschen als ein Spiegelbild des Charakters. Für den Bürger galten ein reinlicher Körper und reinliche Kleidung als Zeichen bürgerlicher Lebenshaltung und Tugend.436 „Der Schluss von dem Äußerlichen auf das Innerliche ist uns so natürlich“, schrieb Johann Heinrich Campe.437
In der Konsequenz hieß das: Reinlichkeit ist ein „Stück Selbstbeherrschung“, „ein Stück der Herrschaft, die der Geist über das seelische und leibliche Leben führt“.438
(TM)
Thomas Buddenbrook hat, so wie jeder Bürger, nur eine geringe Toleranz gegenüber schlechten Körpergerüchen und neigt dazu, seinen Körper durch Wasser und Seife oftmals am Tag zu deodorieren. Er intensiviert seine persönliche Hygiene durch häufigen Hemdwechsel.
Das von ihm in der Zeit des wirtschaftlichen ökonomischen Stillstands der Firma entwickelte krankhafte Bedürfnis nach Reinigung und Kleidungswechsel ist ein Versuch, „das Vergängliche zu konservieren und die Zeit stillzustellen.“439
S. 418f
Das, was man Thomas Buddenbrooks „Eitelkeit“ nannte, die Sorgfalt, die er seinem Äußeren zuwandte, der Luxus, den er mit seiner Toilette betrieb, war in Wirklichkeit etwas gründlich Anderes. Es war ursprünglich um nicht mehr, als das Bestreben eines Menschen der Aktion, sich vom Kopf bis zur Zehe stets jener Korrektheit und Intaktheit bewusst zu sein, die Haltung gibt. … Wenn das Merkwürdige zu beobachten war, dass gleichzeitig seine „Eitelkeit“, das heißt dieses Bedürfnis, sich körperlich zu erquicken, zu erneuern, mehrere Male am Tag die Kleidung zu wechseln, sich wieder herzustellen und morgenfrisch zu machen, in auffälliger Weise zunahm, so bedeutete das, obgleich Thomas Buddenbrook kaum 37 Jahre zählte, ganz einfach ein Nachlassen seiner Spannkraft, eine raschere Abnützbarkei…
Der Geruch galt als das essenzielles Kennzeichen für (fehlende) Sauberkeit. Schmutz besaß einen schlechten Geruch und musste als gesundheitsschädlich gelten, deshalb war für die Mediziner ihre „Nase ein wichtiges Instrument“, 440
Mitglieder sozialer Schichten grenzten sich durch einen gemeinsamen Geruch voneinander ab:
„Der Schmutz ist über den Zusammenhang von Krankheit und Hygiene hinaus eine Störung geordneter sozialer Beziehungen.“441
Wasser war früher ein angstbesetztes Element und bedeutete für die oberen Schichten eine Bedrohung des Lebens, nur Mitglieder der Unterschicht praktizierten vormals Ganzkörperbäder im Wasser. Nun aber wurde es von den bürgerlichen Ärzten als Mittel zur körperlichen Sauberkeit angesehen. Sie verordneten Schwimmen im kalten Wasser zur Förderung der Hautreinigung und kalte Bäder zur Abhärtung, was insbesondere der Jugend Kraft geben, der Minderung des Geschlechtstriebes und Weichlichkeit und Schwächlichkeit des Stadtbürgertums vorbeugen sollte.442 (TM)
Hanno bekommt dies wegen seiner schwachen gesundheitlichen Konstitution angeordnet: S. 624
„Baden! Schwimmen!“ hatte Doktor Langhals gesagt. „Der Junge muss baden und schwimmen!“ Und der Senator war vollständig damit einverstanden gewese…
Das Reinlichkeitsverhalten des Bürgertum ließ den Wasserbedarf eklatant ansteigen. Es verbreiteten sich „Wasserclosetts“, die wiederum ein Kanalisationsproblem entstehen ließen: Große Mengen an Abwasser wurden in die offenen Rinnsteine gepumpt und ergossen sich in die Straße. Dadurch wiederum waren die Städte gezwungen, den Ausbau der städtischer Wasserleitungen zu fördern.443 (TM)
So entleert der Barbier Benthien sein Schaumgefäß nach dem Rasieren des Senators schlichtweg auf das Pflaster. (S. 361)
Der Ort, an dem Thomas Budddenbrook den tödlichen Schlaganfall erlitt, steht im Widerspruch zur Reinlichkeitsethik und zum Reinlichkeitsverhalten der Bürger und stellt ein Ekel hervorrufendes Erlebnis dar, was Gerdas Reaktion bestätigt.
S. 681
„Wie er aussah“,. „als sie ihn brachten! Sein ganzes Leben lang hat man nicht ein Staubfäserchen an ihm sehen dürfen. Es ist ein Hohn und eine Niedertracht, dass das Letzte so kommen muss.…
Auch die Seeluft galt als Mittel der Reinigung und der Pflege der Gesundheit. In den Kurbädern am Meer stand das Wasser als Heilmittel im Mittelpunkt. Mit Trinkkuren und Bädern förderte es Geselligkeit und gleichzeitig Gesundheitspflege, wie z.B. in Travemünde, dem Erholungsort der Familie Buddenbrook: S. 662
Im Herbst sagte Doktor Langhals, indem er seine schönen Augen spielen ließ wie eine Frau: „Die Nerven, Herr Senator, an Allem sind bloß die Nerven schuld. und hie und da lässt auch die Blutzirkulation ein wenig zu wünschen übrig. Darf ich mir einen Ratschlag erlauben? Sie sollten sich dieses Jahr noch ein bisschen ausspannen! Diese paar Seeluft-Sonntage im Sommer haben natürlich nicht viel vermocht. Wir haben Ende September, Travemünde ist noch in Betrieb, es ist noch nicht vollständig entvölkert. Fahren Sie hin, Herr Senator, und setzen Sie sich noch ein wenig an den Strand. Vierzehn Tage oder drei Wochen reparieren schon Manches…
Bürgerliche Ärzte legten den Fokus in ihren Behandlungen auf den Zusammenhang von Haut und Arbeit und auf die Bedeutung des Schwitzens, das alles Unreinliche ausschwämmen sollte.
Der Wechsel der Kleidung und deren Beschaffenheit wurde zu einem wichtigen Thema, ebenso die Art der Kleidung, die idealerweise Beweglichkeit fördern und nicht mehr wie bei den Aristokraten zuschnüren sollte (s.o.). Mediziner rieten zum täglichen Wechsel des Hemdes bei anstrengender Tätigkeit.444
Thomas Mann beschreibt in seinem Roman Szenen der Körperhygiene und der individuellen Körperreinigung: Das Duschbad, das sich Mitte des 19. Jahrhunderts etablierte, findet Erwähnung:
S. 357
Gleichmorgens um acht Uhr, sobald er das Bett verlassen hatte, über die Wendeltreppe hinter der kleinen Pforte ins Souterrain hinabgestiegen war, ein Bad genommen und seinen Schlafrock wieder angelegt hatte, begann Konsul Buddenbrook sich mit öffentlichen Dingen zu beschäftigen.Der Ort der Körperpflegeriten war das Schlafzimmer. In dessen Privatsphäre zog man sich zur verborgenen Reinigung zurück, ein Ort des Intimen, vor dem man Abstand wahrte.
Der hygienische Lebensstil des Bürgertums wurde durch Gesundheitsreformen von Sozialpolitikern, medizinische Volksaufklärung, Pastoralmedizin und mit Hilfe der technischen Wasserversorgung auf die gesamte Stadtbevölkerung ausgedehnt und verbindlich. Man übernahm die bürgerliche Tugend der Reinlichkeit und transportierte auf diese Art einen weiteren Wert des Bürgertums von oben nach unten. Hierbei ist die Rolle der Ärzte nicht zu unterschätzen, denn sie propagierten die Reinlichkeitsnormen und trugen zur „Befreiung von den Zwängen der ständischen Gesellschaft und Disziplinierung der Unterschichten bei.“445
Reinlichkeit entwickelte sich im Wertesystem aller sozialen Gruppen in unserer Gesellschaft und wurde zu einer Grundnorm in Bezug auf Körper, Kleidung und Umgebung.
(AG)
Die Reinigung gehört zu Richards morgentlichem Ritual:
S. 142f
Er dreht den Wasserhahn auf und wäscht sich die Hände.…
Er wäscht sich prustend und stöhnend das Gesicht. . Anschließend hält er seinen Kamm unter Wasser und bringt die Haare in Ordnun…
Das Bad, von dem der Autor ausführlich erzählt, dient Richard zur Entspannung. Er geht dabei den Gedanken nach und sinniert über die Ungerechtigkeiten, die ihm widerfahren sind.
S. 193
-Entspann dich, fordert Alma mit unerschütterlicher Regelmäßigkeit.…
Er geht nach oben ins Bad und öffnet die Wasserhähne. Er wartet, bis heißes Wasser in den Rohren ist, dann verschließt er den Abfluss, nimmt die Flasche mit dem Schaum aus dem Schrank und gießt mit der Verschlusskappe etwas von der tiefgrünen Flüssigkeit in die Wanne. Bis die Wanne vollgelaufen ist, hat er zehn Minuten Zei…
S. 198ff
Mit schlaff am Körper liegenden Armen und geöffneten Beinen liegt Richard im heißen Wasser …
Mit auf- und zuklappenden Beinen erzeugt er Wellen, schaut diesen Wellen bei ihren Bewegungen zu und fragt sich dabei, ob die Zeit tatsächlich arbeitet …
Die Wellen laufen immer wieder in der Mitte der Wanne aufeinander zu, Bauch und Wannenrand, hin und zurück, Havarie. Richard gleitet mit dem Oberkörper tiefer ins Wasser, die Knie seiner abgewinkelten Bein stoßen jetzt als Inseln hervor, sein Kopf taucht unter, mit geschlossenen Augen, die Nasenflügel zwischen zwei Fingern. …
Richard steht in der Wanne auf und duscht sich ab, mit einer gewissen Genugtuung, das er gerade eine weitere Ungerechtigkeit in seinem Leben ausgemacht ha…
Ingrid ist als Mutter darauf bedacht, ihren Kindern - auch spielerisch - die Bedeutung der Sauberkeit für ihre Gesundheit anzuerziehen, so wie es die Mutter bei ihr und Otto wiederum praktiziert hat:
S. 263
Sie seift den Kindern die Köpfe und spült ihnen das feine, leichte Haar, wie es schon ihre eigene Mutter gemacht hat, als Ingrid und Otto gemeinsam in der Wanne saße…
… überredet sie die beiden zu einem Wettbewerb, wer länger untertauchen kann. … Sie wiederholen das Spiel mehrmals. Einmal rufen die Kinder etwas unter Wasser, hinterher wollen sie wissen, ob Ingrid verstanden hat, was. … die Kinder müssen ihre Geschlechtsteile wasche…
Philipp dient das gemeinsame Baden mit Johanna dagegen weniger der Körperhygiene als der sexuellen Stimulierung:
S. 92ff
Bei Johannas nächstem Besuch ist immerhin das Badezimmer so weit entrümpelt, dass sie trotz der zahlreichen gebrochenen Fliesen und der darauf niederregnenden Dispersionsflocken zu Philipp in die Wanne steigt ..Johanna lässt heißes Wasser nachrinnen. Es fließt über die gelblichen Kalkschlieren unterhalb des Hans, bis Philipp die Röte ins Gesicht steigt. ..Sie schlägt mit den Händen auf die Wasseroberfläche und verspritzt das Badewasser hemmungslos in Philipps Gesicht und bis zur Tür. Dann lässt sie nochmals Wasser nachrinnen. Der Badeschaum ist größtenteils in sich zusammengefallen, die wenigen Reste bilden Ringe, um die aus dem Wasser ragenden Körperteile.…
Kurz darauf duschen sie sich a…
(ER)
In Eugen Ruges Roman findet die Bedeutung der Körperhygiene beim dementen Vater Erwähnung. Der Pflegedienst und der Sohn unterstützen Kurt bei der Reinigung:
S. 15f
- Na, dann wechseln wir mal die Windel. Kurt tapste ins Bad.. .nachdem Alexander seinen Vater geduscht, ins Bett gebracht und den Badfußboden gewischt hatte, war sein Kaffee kal…
13.3. Der Bürger in der politischen und sozialen Verantwortung als Amtsträger
Der Bürgerbegriff des 19. Jahrhunderts enthielt eine individuelle und eine gesellschaftliche Komponente, einerseits betont er die Entwicklung der eigenen Individualität, andererseits fordert er den Zusammenschluss gleichgesinnter Individuen zu Gruppen und freien Vereinen. Dies impliziert eine sozial bestimmte Rollenerwartung und ein sozial akzeptiertes Ausmaß an Individualität - Konformität und Persönlichkeit als Pole des bürgerlichen Lebens.446 Die „Polarität von persönlicher Freiheit und Verpflichtung auf das Gemeinwohl machte das bürgerliche Strukturprinzip von Individualität und Vergesellschaftung aus.“447 „Gemeinschaft“ galt als eine Notwendigkeit, sie gab einerseits stützenden Halt. konnte aber gleichzeitig auch eine Einengung darstellen.
Es war ein wesentliches Element des bürgerlichen Wertekanons, im Zusammenhang mit eigenverantwortlichem Handeln und der freien Selbstbestimmung, auch am öffentlichen Gemeinwesen teilzuhaben. Diese Partizipation am bürgerlichen Gemeinwesen im Dienst am Staat war an zwei Bedingungen geknüpft:
1. geistige Unabhängigkeit
2. materielle Unabhängigkeit.
Beides war entscheidend, um als Bürger sich unabhängig vom Einfluss anderer eine eigene Meinung bilden zu können und öffentliches Handeln danach auszurichten.448 Viele der öffentlichen Ämter, gerade in den Reichs- und Handelsstädten wurden von Handel treibenden Bürger auf ehrenamtlicher Basis als Honoratioren übernommen, was das Beispiel von Johann Buddenbrook des Jüngeren und des Senators Thomas Buddenbrook zeigt. In den Bürgervertretungen saßen Kaufleute wie sie und wohlhabende Handwerksmeister. „Im Sozialprofil der kommunalen Mandatsträger kommt wiederum zum Vorschein, dass die Stadtverwaltung auch nach den Reformen vor allem Angelegenheit des gewerblichen Bürgertums war.“449
Im Vordergrund stand das Ziel nach einer Ausweitung der politischen Mitwirkung. Politik hatte durch ein gutes Gemeinwesen zu verhindern, dass private Interessen oder Despotie, Korruption und Verschwörung im städtischen Gemeinwesen eine Gefahr darstellten. Dies sollte eine Partizipation der Bürger, ihre Wachsamkeit und Tugend verhindern.450
Männer der Amtsträgerschaft, so war die Auffassung, waren in der Lage, das Gemeinwohl der Stadt zu fördern, wenn sie in selbständigen Verhältnissen lebten und wirtschaftlich durch sicheres Vermögen und Einkommen unabhängig waren. Aufgrund ihrer Bildung konnten sie, so war die Auffassung, selbständig Urteile fassen. „Selbstverwaltung wurde gerade von den liberalen Parteien als überparteiliche, vernunftgeleitete Erörterung von Sachproblemen verstanden.“451 Um politische Glaubwürdigkeit bei Wahlen zu haben, reichte zunächst die Persönlichkeit des Kandidaten aus.
(TM)
Familie Buddenbrook gehört zur stadtbürgerlichen Elite durch ihren Wohlstand, ihre Selbständigkeit, ihre Heiratskreise und ihre Lebensform. Thomas B. versteht sich als gebildeter Bürger und geht in kulturell-sprachlicher Distanz zum Volk. Die habituellen
Vorbilder des Konsuls liegen demnach zwar außerhalb des kleinstädtischen Wirkungskreises, gleichzeitig aber fand er eine zufriedene Genügsamkeit darin, in dieser Kleinstadt Lübeck Einfluss zu haben, darüber sinnt er nach in einer fiktiven Ansprache an seinen Onkel Gotthold:
S. 276
Aber Alles ist bloß ein Gleichnis auf Erden, Onkel Gotthold! Wusstest du nicht, dass man auch in einer kleinen Stadt ein großer Mann sein kann? Dass man ein Cäsar sein kann an einem mäßigen Handelsplatz an der Ostse…
Zum bürgerlich-liberalen Prinzip gehörte bürgerliche Selbstverwaltung mit gleichzeitiger Gemeinwohlbindung. Ein Strukturmerkmal war die Selbstorganisation der Gesellschaft durch von Menschen gebildete und aufgelöste freiwillige Gemeinschaften zu politischen Zwecken.452 Der Bürger, durch die Gemeinde mit dem Staat verbunden, fühlte sich als Individuum dem Gemeinwohl insbesondere durch ein Ehrenamt in der städtischen Selbstverwaltung und eine politische Tätigkeit in Ämtern im Bereich der kommunalen Vertretungen verpflichtet. Das Ziel war die Gründung der bürgerlichen Gesellschaft, und diese besaß als Strukturprinzip die Eigenverantwortlichkeit und Selbstorganisation zur Regulierung der städtischen Lokalpolitik.
Lösungen sozialer Probleme sah man im bürgerlichen Selbstverständnis individualistisch: Nicht staatliche Hilfen, sondern das im Mittelpunkt stehende Individuum mit seiner individuellen Verantwortung sollte sich durch Bildung bzw. Aus- und Weiterbildung und Selbsthilfe, beides zielte auf die Selbstständigkeit des Einzelnen, aus problematischen Situationen befreien.
Eine große Anzahl der Bürger engagierte sich in der Stadt für sozial-karitative Zwecke, um Armut und Not zu lindern. In den protestantischen Städten bildeten sich Lokalvereine der Inneren Mission, sie verbanden soziale Fürsorge mit religiöser Erziehung. Bürgerliche Frauen engagierten sich persönlich und finanziell, da die Fürsorge für die Armen per se dem weiblichen Geschlechtscharakter entsprach. Direkt kam der Bürger selten mit den Armen in Kontakt. Beamte und Stadtverordnete saßen in den Vorstädten der Wohltätigkeitsvereine und sorgten mit Hilfe höherer Geldsummen, gespendet von wohlhabenden Bürgern, für die Finanzquelle.
Viele der öffentlichen Ämter, gerade in den Reichs- und Handelsstädten, wurden von Handel treibenden Bürgern auf ehrenamtlicher Basis als Honoratioren übernommen, was das Beispiel von Johann Buddenbrook des Jüngeren und des Senators Thomas Buddenbrook zeigt.
In den Bürgervertretungen saßen Kaufleute wie sie und wohlhabende Handwerksmeister. „Im Sozialprofil der kommunalen Mandatsträger kommt wiederum zum Vorschein, dass die Stadtverwaltung auch nach den Reformen vor allem Angelegenheit des gewerblichen Bürgertums war.“453
Kinder und Ehefrauen nahmen keinen direkten Anteil am politischen Leben des Mannes, für sie lief der Alltag in den üblichen Bahnen, anderes stand im Vordergrund. Mann hatte die Tendenz, Politik von den Kindern und Frauen fern zu halten, Politik wurde aus deren Erfahrungsbereich gestrichen, Gespräche über das politische Tagesgeschehen mehr oder minder verbannt.
(TM)
S. 29
Die Damen waren dem Disput nicht lange gefolg…
Bei Familie Buddenbrook funktioniert dies bis zum Tag der Revolution, als Frau Buddenbrook der aufmüpfigen revoltierenden Dienerschaft begegnet.
S. 175
Trina, die Köchin Trina, ein Mädchen, das bislang nur Treue und Biedersinn an den Tag gelegt hatte, war plötzlich zu unverhüllter Empörung übergegangen, dieser ewig blutige Mensch musste die Entwicklung ihrer politischen Ansichten in der nachteiligsten Weise beeinflusst haben. …
„Warten sie man bloß, Fru Konsulin, da duert nu nich mehr lang, denn kommt ne annere Ordnung in die Saak, denn sitt ick doar up’m Sofa in’ sieden Kleed, und Sei bedeinen mich, denn.“ Selbstverständlich war ihr sofort gekündigt worde…
Zunächst hatte die bürgerlich-liberale Bewegung im 19.Jahrhundert keine Partei mit festem Programm und fester Organisation, sondern war eine „Honoratiorengesellschaft“, d.h. Personen, männliche Bürger, waren in unbesoldeten Ehrenämtern politisch aktiv: „Wenn politische Meinungsbildungprozesse wenig formalisiert waren, Gruppenbildungen sich durch einen geringen Organisationsgrad auszeichneten, die Interaktion geprägt war durch face-to-face Beziehungen, dann kann man von einer Honoratiorenstruktur sprechen.“454
Bis in die 80er Jahr des 19. Jahrhunderts besaß diese liberale Honoratiorengesellschaft in den Gemeinden und Städten keine feste Organisation, stattdessen bildeten informelle Beziehungen und Vereine die Basis.
Die Blütezeit der Honoratiorenverwaltung war nach der Mitte des 19. Jh., eine liberale Phase mit den Prinzipien von Marktregulierung und freier genossenschaftlicher Selbsthilfe, privatwirtschaftlichen Initiativen und freien Zusammenschlüssen von Bürgern.455 Ein überschaubarer Kreis von Honoratioren, die aus Unternehmer- und bedeutenden Kaufmannsfamilien kamen, (Bildungsbürger hielten sich von der Kommunalpolitik fern) hatte die aktive Entscheidungs- und Gestaltungsmacht im Stadtparlament und konnte dank ihrer Position in der Bürgerschaftsvertretung ein entscheidendes Wort mitreden.
Im Liberalismus definierten sich bürgerliche Individuen mit den von ihnen postulierten politischen Werten, die stets bezogen waren auf die Freiheit des Einzelnen und den wirtschaftlich selbständigen Bürger. Die Ziele ihres bürgerlichen Handelns galten dem Gemeinwohl und dem Eigeninteresse. Als ansässige Gewerbetreibende und Hausbesitzer hatten sie großes Interesse daran, an der kommunalen Selbstverantwortung teilzunehmen und bei kommunalpolitischen Entscheidungen, wie z.B. den Haushaltsberatungen und der Festsetzung der Steuern und Abgaben mitzubestimmen. Stadtplanerische Entscheidungen, Infrastrukturprojekte, wie Verkehrsanbindungen für Transport, Strom- und Verkehrswesen, Handel und städtische Bauvorhaben, als auch die Eröffnung von kulturellen Gebäuden, konnten ebenso wie die Vergabe von Aufträgen von Wirtschaftsbürgern, wenn man im Rathaus präsent war, mitentschieden werden.
Städtische /kommunale Selbstverwaltung geschah somit durch die Interessenpolitik bürgerlicher Honoratioren, wirtschaftlich unabhängigen selbständigen Bürgern, „Männer[n], die für die Politik leben konnten, ohne von ihr leben zu müssen.“ 456 Aktionen von Seiten der gewählten Honoratioren waren appellativ, nicht demonstrativ, und direkt an die Autorität gerichtet. Mobilisierung bedeutete für die liberal denkenden Bürger eine agitatorische Beeinflussung der Öffentlichkeit durch Reden, Versammlungen und Flugblätter.
„Aus der Teilhabe am Bürgerrecht ergab sich nur bedingt eine Beteiligung an der politischen Macht. In der Mehrzahl der Städte blieb die Politik im engeren Sinne die Domäne einiger weniger Familien, die ein effizientes Netzwerk aufgebaut hatten, gewoben aus Verwandtschaft und Freundschaft, gestützt von gemeinsamen Interessen.“457 (TM)
Manchem Bürger bleibt dieses ehrwürdige Amt verwehrt:
S. 408
Der alte Kaufmann Kurz in der Beckergrube, der bei jeder Wahl drei oder vier Stimmen erhält, wird wiederum am Wahltage bebend in seiner Wohnung sitzen und des Rufes harren; aber er wird auch diesmal nicht gewählt werden, er wird fortfahren mit einer Miene voll Biedersinn und Selbstzufriedenheit, das Trottoir mit seinem Spazierstock zu stoßen, und er wird sich mit diesem heimlichen Grame ins Grab legen, nicht Senator geworden zu sein…
Th. Mann beschreibt Lübeck mit seiner patrizischen Verfassung als eine Hansestadt mit der verkrusteten Struktur einer oligarchischen Stadtherrschaft.458 Die Kaufleute um Th. Buddenbrook treten in einer ständischen Sonderposition auf. Spezielle politische Aktivitäten und Tätigkeiten werden konkret nicht genannt, (anders bei Kellers „Grünen Heinrich“, d e m Bürger-Roman schlechthin, in dem ein Streitfall um den Bau einer Straße geschildert wird mitsamt der Diskussion und den Problemlösungsmöglichkeiten verschiedener interessierter Bürger.) (TM)
Die Wahl Thomas Buddenbrooks in den Senat gibt uns ein Bild von der Stadtpolitik Lübecks:
S. 410f
Hie und da aber konnte Frau Permaneder sich trotzdem nicht entbrechen, ein wenig mit ihrer Kenntnis der Staatsverfassung zu prunken. Sie sprach dann von Wahlkammern, Wahlbürgern und Stimmzetteln, erwog alle denkbaren Eventualitäten, citierte wörtlich und ohne Anstoß den feierlichen Eid, der von den Wählern zu leisten ist, erzählte von der „freimütigen Besprechung“, die verfassungsmäßig von den einzelnen Wahlkammern über alle diejenigen vorgenommen wird, deren Namen auf der Kandidatenliste stehe…
S. 413
Jede im Senate erledigte Stelle muss binnen vier Wochen wiederbesetzt werd…
In Lübeck kannte man bis in die 50er Jahre des 19. Jahrhunderts in der Bürgerschaft keine eigentlichen politischen Parteien. Vertreter der Nationalliberalen, der Fortschrittspartei oder der Sozialdemokraten gab es erst nach der Reichsgründung.
Für das passive Wahlrecht galt eine höhere Vermögensforderung als für das aktive, Thomas B. war demnach wohlhabender als andere Wähler.
S. 409
Keine Zweifel, Hermann Hagenström hatte Anhänger und Bewunderer. ..Das neuartige und damit Reizvolle seiner Persönlichkeit war das, was ihn auszeichnete und ihm in den Augen vieler eine führende Stellung gab, war der liberale und tolerante Grundzug seines Wesens.…
Er war nicht der Mann, in der Bürgerschaft die Bewilligung größerer Geldsummen zur Restaurierung und Erhaltung der mittelalterlichen Denkmäler zu befürworten.…
Das Prestige Thomas Buddenbrooks war anderer Art. Er war nicht nur er selbst, man ehrte in ihm noch die unvergessenen Persönlichkeiten seines Vaters, Großvaters und Urgroßvaters u…
abgesehen von seinen eigenen geschäftlichen und öffentlichen Erfolgen war er der Träger eines hundertjährigen Bürgerruhmes. . und was ihn auszeichnete, war ein selbst unter seinen gelehrten Mitbürgern ganz ungewöhnlicher Grad formaler Bildun…
Die geringe Größe Lübecks brachte es mit sich, dass die Bevölkerung mit regem Interesse an den Wahlen und Entscheidungen des Senats und der Bürgerschaft teilnahm. Dies spiegelt sich bei der Senatorenwahl wider, zu der das Volk vor das Rathaus geströmt war, um die Entscheidung zu vernehmen.
S. 413
In der Breitenstraße, vor dem Rathause . drängen sich mittags um 1 Uhr die Leute. Sie stehen unentwegt in dem schmutzig-wässerigen Schnee der Straße. Denn dort, hinter jenem Portale, im Ratssaale, mit seinen vierzehn im Halbkreise stehen Armsesseln, erwartet noch zu dieser Stunde die aus Mitgliedern des Senats und der Bürgschaft bestehende Wahlversammlung die Vorschläge der Wahlkammern.…
Gott gebe, dass nun wenigstens die allgemeine Wahl durch geheime Abstimmung mittelst Stimmzettel eine unbedingte Stimmenmehrheit ergibt.…
Es sind Leute aus allen Volksklassen, die hier stehen und warten…
Zeitungen waren die geistige Nahrung und wurden für die Informationsbeschaffung genutzt. In Lübeck gab es bis Ende der 40er Jahre mit den „Lübeckischen Anzeigen“ ein Anzeigenblatt und die seit 1835 von der „Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit“ herausgegebenen „Neuen Lübeckischen Blätter“. 459 In den Bürgerhäusern wählte man Hamburger und Bremer Zeitungen zur Information.
Auch Thomas B. begegnet uns als politisch belesener und informierter Bürger:
S. 450
Er hatte die Berliner Börsenzeitung vor sich ausgebreitet und las,…
Anders als eine Partei boten Vereine als Art Basisdemokratie dem Bürger die Möglichkeit, durch spezielle Zwecksetzungen und für ein punktuell umgrenztes Ziel zeitlich begrenzt aktiv zu sein. Man engagierte sich in einer Vielzahl von Vereinen und knüpfte so Netzwerke einer liberal-bürgerlichen Bewegung. Die Netzwerke von Liberalen und Demokraten überlappten sich bisweilen, letztere waren eher im populären Vereinswesen bei den Sängern und Turnern vertreten.
Es gab Bezirksvereine, die lokale Interessen sammelten und gegenüber der Stadt vertraten, Unterstützungsvereine wie z.B. Konsumvereine, die kleinbürgerliche
Handwerker an sich banden, weiterhin gesellige Vereine, in denen verschiedene politische und gesellschaftliche Kreise vereint waren.
Eine Partei benötigte stets Mitglieder für unterschiedliche Ziele und erwartete parteikonforme Meinungen. Anders im Verein: Dort erlebte der Bürger nicht die Strenge eines Parteiapparates, sondern fühlte seine individuelle Persönlichkeit in der Gemeinschaft eingebettet. Vereine, in denen das persönliche Gespräch entscheidend war, waren eine konkrete Ausprägung der als bürgerlich gedachten Eigenschaften wie der freien Selbstbestimmung, der individuellen Entfaltung und des eigenverantwortlichen Handelns.460
Ein Beispiel für einen Verein mit einem punktuell umgrenzten Ziel ist der 1863 in Preußen gegründete „Verein zur Wahrung der verfassungsmäßigen Preßfreiheit in Preußen.“ Durch den Eintritt demonstrierte man den Protest gegen die Politik Bismarcks. Dauerhaftes Vereinsleben fand dort jedoch nur so lange statt, bis der Verein nach dem Erreichen seines Zieles aufgelöst wurde.461
Städtische Politik als Honoratiorenherrschaft galt bis zum Ende des 19. Jahrhunderts für die führenden wirtschafts- und bildungsbürgerlichen Schichten als erstrebenswert,462 doch bereits seit den 1870er Jahren nahmen gut organisierte Wirtschaftsverbände Einfluss auf politische Entscheidungen in den Parlamenten und unterstützten ihnen nahestehende Politiker und Parteien durch Spenden.
„Die frühe Geschichte des Liberalismus lässt sich auch schreiben als ein Versuch, Prinzipien kommunaler Gesellschaftsordnung auf staatliche Anforderungen zu übertragen.“463 Zwischen 1860 und 1880 formte sich die bürgerlich-liberale Bewegung zu einer politischen Bewegung mit dem zentralen gemeinsamen Wert von Staat und Nation und dem Ziel eines Nationalstaates ohne Änderung des politischen Systems und mit der Bindung an die Obrigkeit.
Politisches Denken basierte im Bürgertum auf dem „klassischen Republikanismus“, die konstitutionelle Monarchie galt als Inbegriff des modernen Staates. Die Beschränkung des Souveräns sollte diesen zur Achtung von Recht und politischer Freiheit zwingen.464
Nach der Gründung des Nationalstaates 1871 war das große Ziel der Liberalen erreicht und das Bürgertum verlor seinen zentralen Wahlprogrammpunkt. Seine Grundprinzipien der Bürgerlichen Gesellschaft wurden mit der Reichsgründung verwirklicht, wie z.B. die Einräumung von Freiheitsrechten für den Einzelnen, formale Gleichheit vor dem Gesetz, Gewaltenteilung und Beschränkung der Macht des Monarchen und ein auf freiem Eigentum und Gewerbefreiheit basierendes Wirtschaftssystem.
In den 80er Jahren entstanden dauerhafte Parteivereine mit überlokalen festen Organisationsstrukturen. Sie wollten in den vorhandenen Institutionen und im Parlament die eigene Position stärken.465
Das Ende der liberalen Hegemonie hatte zwei Ursachen: Sie stand im Zusammenhang mit der Bildung der katholischen Partei, des „Zentrums“, die sich nach der Beschneidung der kirchlichen Befugnisse formierte. Weiterhin gab es nun eine in Arbeitervereinen organisierte Arbeiterschaft, die zur SPD wurde. Diese vergrößerte ihre Erfolge durch die Erweiterung des Wahlrechts, während sich der Einfluss des Bürgertums reduzierte, weil solch eine milieuhafte Geschlossenheit wie im politischen Katholizismus und in der Arbeiterbewegung im bürgerlich-protestantischen Liberalismus nicht vorhanden war.
Die Sozialpolitik Bismarcks ließ sich nicht mit den Prinzipien der Selbsthilfe und Eigenverantwortung der Liberalen verbinden, und seit der Jahrhundertwende setzte sich auch im „Freisinn“ die Erkenntnis durch, dass die sozialen Problemlagen der Industriegesellschaft [soziale Frage] nicht mit den Rezepten des Vormärz zu lösen waren.466 Der liberale Honoratiorenstil tat sich schwer mit der Anpassung an die Massenpolitik. Das gebildete und besitzende Bürgertum präsentierte sich im Auftreten und Redestil anders als die politischen Mandatsträger, die nun als „Berufspolitiker“ auftraten und nicht mehr geistig und materiell unabhängig waren.
Gemeinsam blieb den Liberalen als ideelle Gemeinsamkeit das „Nationalgefühl“; „bürgerlich“ und „national“ zu sein wurde nun zum Synonym für die liberalen und konservativen Parteien. Ihre soziale Basis bildeten die liberalen Wähler mit den idealtypischen Eigenschaften der Mandatsträger, der Freiberufler, der Beamten und der selbständig wirtschaftenden Bürger. Letzteres war für die Organisation und das Selbstverständnis des Liberalismus prägend.467 (AG)
Richard Sterk ist das Beispiel eines Bürgers in politischer Verantwortung:
Nach dem Anschluss 1938 zieht er sich in die stille Opposition zurück, betätigte sich nach dem Krieg aktiv und wird ein politisch wichtiger Mann in den Verhandlungen mit den russischen Besatzern. (Alma kritisiert ihn später, dass er den jungen Menschen die Beteiligung am Aufbau verwehrte. S. 349:Für die Jungen war kein Platz.) S. 142
Von den stockenden Verhandlungen um den Staatsvertrag, die sich ausgerechnet an Artikel 35 und den Schürfrechten auf den Erdölfeldern entlang der March sprießen, ist er hochgradig nervös.Für ihn sind Verantwortungsgefühl und politisches Engagement eine identitätsstiftende Aufgabe. Er widmet sich ihr mit dem Ziel der individuellen demokratischen Freiheit.
In der Zusammenarbeit und der Auseinandersetzung mit den Siegermächten zeigt Richard das Zentralmotiv des Bürgerlichen im 19. Jahrhundert: die Selbstverantwortung. Das Bürgertum stellt sich den politischen Herausforderungen aufgrund ihres wichtigsten Guts, der Bildung.468 Richard sieht seinen bürgerlichen Auftrag darin, nach dem erlebten Zusammenbruch am politischen und gesellschaftlichen Neubau mitzuwirken. Er hat unmittelbare administrative Verantwortung und gilt als ein bürgerlicher Intellektueller, der sich nach 1945 bereit findet, die (demokratische) Erneuerung bürgernah in gesellschaftlicher Loyalität mitzugestalten.
S. 198
Von politischem Charme und der Höhe der Zeit faseln, aber nicht wahrhaben wollen, dass die wichtigsten Grundlagen im Leben Verantwortungsgefühl, Sorgfalt und Respekt sin…
Auch die junge Genration zeigt bürgerliches Engagement: Philipp wurde von Alma im Fernsehen gesehen, als er auf der Straße politischen Protest zeigte und sich bei einer lokalen Demonstration engagiert:
S. 100
Johanna will unbedingt am Aufmarsch teilnehmen und besteht darauf, dass sie beide die Räder nehmen, aus Protest gegen den Beschluss der Verkehrsbetriebe, neuerdings auch am 1. Mai normalen Betrieb zu fahren. Sie argumentiert, wenn schon kein Schwein mehr die Fasten einhalte, müsse man wenigstens bereit sein, sich an sozialistischen Feiertagen etwas Bewegung zu verschaffen. … und während des Aufmarsches präsentiert Philipp seine Nelke im Knopfloch … Unterdessen frischt er jene Lieder auf, die ihm sein Vater, der Angeber, beigebracht hat, damit Philipp auf Schulausflügen etwas beizusteuern habe (so sein Vater): Avanti Popolo! Vorwärts und nicht vergesse…
13.4 Politische Aktivität in der DDR
An dieser Stelle muss ein Blick auf den historischen Hintergrund von Eugen Ruges Roman geworfen werden.
Politisches Engagement, Mitbestimmung und Meinungsfreiheit gab es bei den Menschen der DDR in zweierlei Hinsicht:
1. In „Eingaben“: Die Bürger veröffentlichten Meinungen, Stimmen und Beschwerden und zeigten damit ihre aktiv Beteiligung an der Innenpolitik. Man wandte sich in Anliegen der Wohnsituation oder das Gesundheitswesen betreffend an die Volksvertretungen, diese bearbeiteten sie, fanden aber nur selten eine zufriedenstellende Lösung.469
2. Mit dem politischen Engagement durch die Mitgliedschaft in der Partei: Damit bekannte man sich eindeutig zur Ideologie und zur Praxis der SED-Herrschaft.470 Es gab neben den höchsten Organen, wie z.B. dem Zentralkomitee (ZK), Parteigruppen wie Grundorganisationen (GO) mit Ressortsleitern für Betriebe und Brigaden und Wohnparteiorganisationen (WPO), die territorial strukturiert waren und in der sich auch nicht- berufstätige Parteimitglieder organisierten.
Während Funktionäre der Basis an der Ausübung von Macht beteiligt waren, hatten andere DDR-Bürger Ehrenämter in Organisationen inne.
Parteimitgliedschaft wurde wichtig für den sozialen und beruflichen Aufstieg, für Privilegien und für die Ausbildungs- und Berufschancen der eigenen Kinder. Es war von der „führenden Rolle der Partei“ die Rede und gab damit Mitgliedern das Gefühl, zu einem auserwählten Kreis zu gehören. Einer strengen Hierarchie der Parteiinstanzen unterstanden sowohl die Polizei, das Militär, die Massenorganisationen und sämtliche Gremien.
Im Leben von Wilhelm hat die Partei zu jeder Zeit eine bedeutende Rolle gespielt, bis ins hohe Alter ist er überzeugt von der Ideologie des Kommunismus (Parteilied S. 208: „Die Partei hat immer recht.“)
S. 198
Ich bin siebzig Jahre in der Parte…
S. 202
Aber die Partei hatte ihn nach Deutschland geschickt, und er hatte getan, was die Partei von ihm verlangte. Sein Leben lang hatte er getan, was die Partei von ihm verlangt…
Für jemanden aus dem Arbeiter- und Bauernmilieu war es leicht, in die Machtstruktur der Politik aufzusteigen, denn eben diese soziale Herkunft galt als wichtiges Kriterien, obgleich in den späteren Jahren in den Bezirken auch höher qualifizierte und ausgebildete Männer in Führungspositionen gelangten.
Wilhelm hat es ohne eine höhere Qualifikation zu einer angesehen Position in der DDR gebracht:
S. 122f
… wahrscheinlich wäre Wilhelm nach seinem Scheitern als Verwaltungsdirektor der Akademie for die Hunde gegangen, wenn sie nicht selbst zur Bezirksleitung gerannt und die Genossen angefleht hätte, Wilhelm irgendeine wenigstens ehrenamtliche Aufgabe zu übernehme…
Sie selbst hatte ihn ermutigt, den Posten des Wohnbezirksparteisekretärs zu übernehmen, sie hatte ihm eingeredet, dass dies eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe sein - das Problem war nur, dass Wilhelm diese inzwischen selbst glaubte. Und, was noch schlimmer war: Die anderen glaubten es offenbar auch!.Aber was macht Wilhelm? Hielt irgendwelche geheimen Versammlungen ab, da unten in seiner Zentrale, plante irgendwelche „Operationen“. Zu den letzten Kommunalwahlen hatte er eine motorisierte Einsatzstaffel organisiert, um diejenigen, die am frühen Nachmittag noch nicht gewählt hatten, Agitatoren auf den Hals zu schicken. Seine neueste Idee: die Lokomotive für Kub…
Charlotte dagegen gelingt nicht der erwünschte Aufstieg, auch wenn die Mitgliedschaft in der SED eine günstige Voraussetzung für die Verbesserung ihrer beruflichen Position ist. S.115
Sie als Autodidakt solle sich nicht noch in fremde Fachgebiete einmischen - Harry Zenk auf der großen Leitungssitzung vor einem halben Jah…
S. 121
Nein, sie war natürlich nicht Institutsdirektorin. Zu ihrem Bedauern hatte man die Institute in „Sektionen“ umgetauft, sodass sie sich nun, weniger klangvoll, nur noch „Sektionsleiterin“ nannte, aber das änderte nichts an der Sache: Sie war berufstätig, sie arbeitete wie ein Pferd, sie bekleidete einen wichtigen Posten an jener Akademie, an der die künftigen Diplomaten der DDR ausgebildet wurde…
Parteimitglieder hatten einen großen Zeitaufwand für die Parteiarbeit zu leisten. Sie waren verpflichtet, an Parteiversammlungen teilzunehmen und wenn es zu einer Amtsübernahme kam, bedeutete dies stets auch, dass ein späterer Rücktritt persönliche und berufliche Konsequenzen haben würde.
Es gab diejenigen, die Entscheidungen trafen, nicht selten in einem diktatorischen Stil, der Untergebene einschüchterte, und diejenigen, die für die Durchführung zuständig waren.
S. 171
Mit wachsenden Unbehagen hörte er sich an, wie Günther vom Fortgang der Sache berichtete, welcher, kurz gesagt, darin bestand, dass die Abteilung Wissenschaft des Zentralkomitees der SED eine harte Bestrafung des Genossen Rohde forderte, welche morgen, am Montag, auf der Parteiversammlung beschlossen werden sollt…
S. 178
Anders als Günther sprach der Genosse Ernst flüssig, beinahe eloquent, mit dünner, aber durchdringender Stimme, die sich, wenn er etwas hervorheben wollte, einschmeichelnd senkte. während er von den revisionistischen und opportunistischen Kräften sprach innerhalb derer, so der Genosse Ernst, der Hauptfeind zu suchen sei, und bei dem Wort ,Hauptfeind‘ senkte sich seine Stimme, und Kurt entdeckte Paul Rohde, der offenbar schon die ganze Zeit in unmittelbarer Nähe des Präsidiumstisches gesessen hatte, grau, geschrumpft, den Blick ins Leere gerichtet, erledigt, dachte Kur…
Das Arbeitspensum der Elite war immens und die Unterordnung unter der Parteidisziplin total, so dass ein normales Familienleben zu führen kaum möglich war. Als Dank für ihre Aktivität wohnten die Mitglieder der Machtelite bis 1960 in geräumigen alten Villen mit Gärten und besaßen Privilegien in jeglicher Form.
Auch Wilhelm und Charlotte ziehen, so wie die arrivierten Politiker später, in die gesicherte exklusive Waldsiedlung nördlich von Berlin mit Dienstpersonal und anderen Privilegien.
Die Mehrzahl der Familienmitglieder im Roman hatte (in den Anfangsjahren) ein ungebrochenes Verhältnis zur DDR, trat der SED bei oder sympathisierte mit ihr.
Die ältere Generation, als Verfolgte des Nazi-Regimes hatte besondere Privilegien, die Aktivität im öffentlich sozialistischen Leben und die sozialistische Gemeinschaft standen für sie im Mittelpunkt. Für die jüngere Generation gewannen Familie und Freundschaft, häusliche Geselligkeit und Bildungsinteressen an Bedeutung.
Kurt ist als ein Opfer des Krieges im Gulag interniert gewesen, wo man seinen Bruder ermordete, und wird dann in der DDR zu einem bedeutenden Historiker.
Als promovierter Geschichtswissenschaftler sympathisiert er mit der Politik, trotz einer gewissen Kritik und Vorbehalte gegenüber dem Regime. Die spricht er zwar auch seiner Mutter gegenüber an, als sie ihm die Rezension zu einem Buch im ,Neuen Deutschland’ zu lesen empfiehlt, rebelliert jedoch nicht, hat sich aber auch nie als Parteisekretär verpflichten lassen: S. 170
Auch Kurt hatte man angesprochen, aber er hatte - selbstverständlich - abgelehn…
S. 1…
Hier versuchen Leute, einen härteren Kurs durchzusetze…
Es geht hier um Richtungskämpfe. Es geht hier um Reform oder Stillstand, Demokratisierung oder Rückkehr zum Stalinismu…
Beim letzten Geburtstag Wilhelms zeigt sich, wie historisch überholt Auftreten, Verhalten und die politischen Ansichten waren: Für Wilhelm wird ein Selbstbetrug inszeniert und eine DDR vorgegaukelt, die zwar in der Krise geraten ist, aber noch besteht, die Gäste werden hier zur Komparserie. „Wenn nichts klappte in der DDR, so doch die Inszenierung.“ 471 S.278
- Kein Wort! Ist das klar? Ihre Stimme klang wieder durchdringend und schar…
- Kein Wort über Ungarn! Kein Wort über irgendwas! Das muss hundertprozentig klappen! Ist das kla…
- Alles klar, sagte Muddel. Die Urgroßmutter beugte sich vor, flüsterte jetzt beinah…
- Er verträgt das nicht meh…
S. 340ff
Wahrscheinlich, dachte Kurt, notgedrungen mitklatschend, war keinem der Klatschenden klar, was er da eigentlich beklatschte. Nichts in der Rede entsprach im Grunde der Wahrheit.Alles Lüge, dachte Kurt, immer weiter klatschen…
14. Die Bedeutung von Religion und Kirche im Bürgertum
„Wer Wissenschaft und Kunst besitzt, hat auch Religion; wer jene beiden nicht besitzt, der habe Religion.…
Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 183…
Quelle: J.W.v. Goethe,Gedichte, Nachlese. Zahme Xenien,, Kap 914.1 Frömmigkeit und Religiosität im protestantischen Bürgertum des 19. Jahrhunder…
14.1 Frömmigkeit und Religiosität im protestantischen Bürgertum des 19. Jahrhunderts
Das lange 19. Jahrhundert war für die Kirche, die bisher in Schulen, Politik und Verwaltung allgegenwärtig gewesen war, ein Jahrhundert, in dem sie ihren Einfluss verlor und Entkirchlichung einen qualitativen Strukturwandel der Gesellschaftsordnung insgesamt darstellte.
Die Gründe dafür lagen in der wachsende Bedeutung der Naturwissenschaft, der Aufklärung und der damit einhergehende Kirchenkritik; aber auch der soziale Strukturwandel und die Entwicklung neuer Unterhaltungsformen leisteten dazu ihren Beitrag.
Das religiöse Leben änderte sich: Grundprinzipien des Lebens wurden ab der Mitte des 19. Jahrhunderts nicht mehr säkular, sondern bürgerlich-zivil geregelt, z.b. bei der Einführung der Zivilehe.
In der Gesellschaft, insbesondere im Bürgertum, kam es zur Zurückdrängung religiöser Lebensmuster und zu einer zunehmenden Distanzierung vom kirchlichen Leben. Die Urbanisierung brachte Anonymität und einen geringeren Kontakt zum Pfarrer mit sich, so dass die Masse der Bevölkerung außerhalb des kirchlichen Lebens stand und lediglich ein kleiner Kreis von traditonsverbundenen Christen ein Engagement in der Kirchengemeinde zeigte. Viele fanden dort keine geistige und soziale Heimat mehr, sondern sahen in ihr lediglich einen Dienstleistungsbetrieb für kirchliche Riten.
Der Bürger entfremdete sich von der Religion und ihrem moralischen Gehalt. Während der materielle Wohlstand wuchs und Wissenschaftsgläubigkeit, Materialismus und Technik an Bedeutung gewannen, verringerte sich der Glaube an Wunder, an den persönlichen Gott und die biblische Schöpfungsidee. Gottes Allgegenwart wurde zurückgedrängt, man entdeckte für immer mehr Phänomene natürliche Gesetze, und für das Handeln der Menschen wurden eher soziale Bedingungen als ein Eingriff Gottes als Ursache angesehen. Als Beispiel hierfür wäre folgendes zu nennen: Deutete man im 18. Jahrhundert die Liebe theologisch als Gottesliebe, als Liebe von und zu Gott, wird um die Jahrhundertwende die Liebe zwischen Mann und Frau anthropologisch aus sich selbst erklärt, Gott ist im damaligen „Brockhaus“ von 1845 nicht mehr Ursprung der Liebe.472 Die Aufgabe der Religiosität war es, den Zwiespalt zwischen Glauben und Wissen zu überwinden, jedoch zeigte sich der Rückgang traditioneller kirchlicher Sitten insbesondere im Gottesdienstbesuch: Lediglich 23% der Bürgerfamilien praktizierten ihn regelmäßig473 und Daten zum Abendmahlsbesuch weisen auch dessen Reduzierung nach, ausgehend von den Großstädten bis in die Kleinstädte.
Dahingegen wurden Taufe und Konfirmation bei den meisten Familien noch gefeiert, man stellte dabei aber die familiale Gastfreundschaft in den Mittelpunkt und weniger den religiösen Gehalt.
(TM)
S. 395
Taufe!. Taufe in der Breitenstraße…
Denn dort im Saale, vor einem als Altar verkleideten, mit Blumen geschmückten Tischchen, hinter dem, in schwarzem Ornat und schneeweißer, gestärkter, mühlsteinartiger Halskrause, ein junger Geistlicher spricht, hält eine reich in Rot und Gold gekleidete, große, stämmige, sorgfältig genährte Person ein kleines, unter Spitzen und Atlasschleifen verschwindendes Etwas auf ihren schwellenden Armen. ein Erb…
Die Geistlichkeit schloss sich der o.g. Entwicklung an: Sie bot selber in der Umbruchszeit des 19. Jh. religiöse sozial-politische Erklärungen und Deutungen der Wirklichkeit an und versuchte, rational zu analysieren und Perspektiven zu entwickeln. „Ihr Denken und Handeln war dabei von einer kulturellen Leitidee geprägt, die von der grundlegenden Kulturbedeutung des Christentums und namentlich des Protestantismus für die Gestaltung der modernen Welt ausging.“ 474
Verschiedene Frömmigkeitstypen und die wachsende Indifferenz des Bürgertums zu Religion und Kirche zeigen sich im Roman der Buddenbrooks. Die Generation von Konsul Jean Buddenbrook und seiner Frau praktiziert noch säkularisierte und subjektivistische Frömmigkeit, gebunden an Konfession und Milieu. Sie neigt, wie generell das typische Stadtbürgertum, eher zur konservativen Frömmigkeit und traditionellen Kirchlichkeit. Diese kirchlich-religiösen Momente treten in der nachfolgenden Generation in den Hintergrund, private Glaubensüberzeugungen und eine Individualisierung des Glaubens, wie bei Thomas Buddenbrook, gewinnen im männlichen Großbürgertum an Bedeutung.475.
Im Konfirmandenunterricht übten sich die Jugendlichen noch in der Einübung kirchlicher Dogmen und Riten und deren Übersetzung in die eigenen Erfahrungswelt.476 Doch galt es als ein Privileg insbesondere der männlichen Jugend, die durch ihre höhere Bildung religionskritisch erzogen wurde, sich mit der Religion auseinanderzusetzen, wohingegen die weibliche Religiosität und Frömmigkeit das Resultat einer fehlenden höheren Bildung darstellte und säkular-konfessionalistisch geprägt war.
Die Lebensform des Bürgertums richtete sich auf eine humane Sittlichkeit und nicht nur mehr auf kirchliche Frömmigkeit. Die religiöse Ausrichtung des Bürgertums erhöhte und sakralisierte die Werte von Bildung, Selbständigkeit und Liebe. Hilfsbereitschaft und
Solidarität, beides gleichermaßen ethische und christliche Normen, sollten das alltägliche Handeln der Menschen steuern.
Das Religiöse ist bei den Buddenbrooks Ideologie und „kulturbestimmendes Element“.477 Bei ihnen besteht ein Zusammenhang zwischen Religion und Lebensführung. Eine tiefe Religiosität, geleitet durch ein kirchlich-religiöses Ethos, prägt ihre Geschäftsauffassung und tägliche Lebensführung.
(TM)
S. 99
„Genug“, beschloss der Konsul, „er ist ein christlicher, tüchtiger, tätiger und feingebildeter Mann,.“ „Ein christlicher und achtbarer Mensch“,sagte die Konsulin über Herrn Grünlich d.h., dass er Ordnung und eine gute Buchhaltung hat, Hinweise auf Gott und das Transzendente fehlen jedoch.
Die Familienmitglieder sind, wie das Bürgertum insgesamt, den christlichen Traditionen im Sinne de Luthertums verpflichtet. Diese Form der Religiosität vertritt bürgerliche Werte im Einklang mit bestimmten Tugenden und einem Handeln, das gewissenhaft und von Selbstverantwortlichkeit geprägt war.
Eine tiefe Religiosität erfüllt Jean Buddenbrooks Geschäftsauffassung und Lebensführung, und obwohl eine Veräußerlichung im Glauben erkennbar ist, zeigt sich seine Eingebundenheit in die Religion, wenn er Fragen und Antworten im Katechismus sucht.
S. 51
Ach, wo ist doch ein solcher Gott, wie du bist, du Herr Zebaoth, der du hilft in allen Nöten und Gefahren und uns lehrst deinen Willen recht zu erkennen, damit wir dich fürchten und in deinem Willen und Geboten treu mögen erfunden werde…
S. 56
„Mein Sohn, sey mit Lust bey den Geschäften am Tage, aber mache nur solche, dass wir bey Nacht ruhig schlafen können…
Einer religiösen familiären Tradition im Elternhaus kam größte Bedeutung zu: Religiöse Erziehung und eine christliche Lebensführung mit sonntäglichem Gottesdienst und Gebet waren ein wesentliches Orientierungsmuster.
(TM)
Sowohl zu Beginn des Romans als auch am Ende finden sich Bezüge zum Katechismus und zum Schöpfergott bzw. zum Glaubensbekenntnis mit Auferstehung und Tod. Dies belegt, „dass Mann von Anfang an die Absicht hatte, seine Romanhandlung zwischen der Schöpfung und den letzten Dingen verlaufen zu lassen.“478
Das Familienoberhaupt, der Großvater Buddenbrook, mokiert sich in der ersten Szene des Romans mit einem gewissen selbstgefälligen Humor über den Katechismus, und den darin zu lesenden christlichen Unterweisungen, zu die er seine Enkelin Tony befragt, zum Missfallen seines Sohnes:
S. 8 ff
Er lachte vor Vergnügen, sich über den Katechismus moquieren zu können und hatte wahrscheinlich nur zu diesem zwecke das kleine Examen vorgenommen. Er erkundigte sich nach Tonys Acker und Vieh, fragte, wieviel sie für den Sack Weizen näh…
„Aber Vater, Sie belustigen sich wieder einmal über das Heiligste!…
Am Schluss des Romans stehen die Glaubenszweifel, die den Menschen befallen beim allzu frühen und unbegreiflichen Tod von nahe stehenden Personen und der Trost im Glauben:
S. 758
„Es gibt ein Wiedersehen“, sagte Friederike Buddenbrook, wobei sie die Hände fest im Schoß zusammenlegte, …
„Ja, so sagt man. Ach, es gibt Stunden, Friederike, wo es kein Trost ist, Gott strafe mich, wo man irre wird an der Gerechtigkeit, an der Güte. an Alle…
Die Heilige Schrift war ein Teil des bürgerlichen Bildungskanons und dessen Reflexionskultur, man las sie als Privatlektüre und empfing aus ihr Anstöße für sein Denken und Handeln.
(TM)
In der Familienchronik werden Riten aufgezählt, und es wird geschwelgt in der Rede zu Gott.
S. 52
Ich habe meiner jüngsten Tochter eine Police von 150 Courant-Talern ausgeschrieben. Führe du sie, ach Herr! auf deinen Wegen, und schenke du ihr ein reines Herz, auf dass sie einstmals eingehe in die Wohnung des ewigen Friedens. Denn wir wissen wohl, wie schwer es ist, von ganzer Seele zu glauben, .“ Nach drei Seiten schrieb der Konsul ein „Amen“, allein die Feder glitt weiter, . sie schrieb von der köstlichen Quelle, die den müden Wandersmann labt, von des Seligmachers heiligen, bluttriefenden Wunden, vom engen und vom breiten Wege und von Gottes Herrlichkei…
Die Verpflichtung zur standesgemäßen Heirat Tonys mit Grünlich untermauert der Pfarrer in seiner Sonntagspredigt mit einem biblischen Zitat:
S. 113
Eines Sonntags, als sie mit den Eltern und Geschwistern in der Marienkirche saß, redete Pastor Kölling in starken Worten über den Text, der da besagt, dass das Weib Vater und Mutter verlassen und dem Manne nachfolgen sol…
Man kann diese Familie im konfessionellen Milieu der Kirchentreuen einordnen, das die Pfarrer gerne und oft aufsuchten, denn hier war noch traditionelle Frömmigkeit anzutreffen, dort hingen Erwerbsleben und christliche Sittenlehre zusammen.
Die Konfessionen selber grenzten sich voneinander ab: Der Protestantismus war bürgerlicher als der Katholizismus, orientierte sich mit seinem Wertekanon mehr an Bildung und Wissenschaft und sprach das liberale Bürgerideal an, während der Katholizismus das Bauern- und Kleinbürgertum als anzusprechende Sozialfigur hatte.479 Tony fallen die Unterschiede in den Konfessionen bei ihrem Aufenthalt in München ins Auge: (TM)
S. 307
und dann dieser Katholicismus; ich hasse ihn, wie Ihr wisst, ich halte gar nichts davon…
„. Oben auf dem Brunnen“, las sie weiter, „den ich von meinem Fenster aus sehen kann, steht eine Maria, und manchmal wird er bekränzt und dann knieen dort Leute aus dem Volke mit Rosenkränzen und beten, was ja recht hübsch aussieht, aber es steht geschrieben: Gehe in dein Kämmerlein…
Im protestantisch geprägten Teil des deutschsprachigen Territoriums im Norden brachte man die Eigenschaften des Bürgers wie Selbstdisziplin, Mäßigkeit, Leistungsbereitschaft, Rationalität und Aufstiegsstreben mit der protestantischen Leistungsethik Max Webers in Verbindung.480 Mit ihrer sinnstiftenden Funktion und Orientierungsmacht hatte die protestantische Religion eine besondere Kulturbedeutung: „Die bürgerlichen Gemeinsamkeiten bestanden in der Akzeptanz von Bildung, Wissenschaft, bürgerlicher Selbständigkeit und Kulturfortschritt, die mit den positiven Grundlagen der Religion und vor allem der Akzeptanz der Kirche als der eigentlichen Trägerin der Kultur zur Vermittlung gebracht werden sollten.“ 481
Der lutherische Arbeitsbegriff beinhaltete die Weisung, an den irdischen Besitz nicht sein Herz zu hängen.482 Es wird als Gottes Fügung und Ordnung angesehen, in einen sozialen Stand hineingeboren zu werden. Eine Änderung, sprich ein Aufstieg, sollte nicht angestrebt werden, stattdessen hat der Einzelne zufrieden zu sein mit der bestehenden Ordnung und sich in Selbstbescheidung zu fügen.
(TM)
Die Zufriedenheit von Tony und ihrem Großvater beruht auf ihrem ständischen Selbstgefühl.
S. 64
… Das alles aber tat Tony Buddenbrook, und zwar, wie es schien, mit völlig gutem Gewissen. Denn wurde ihr von Seiten irgend eines Gequälten eine Drohung zuteil, so musste man sehen, wie sie. ein halb entrüstetes, halb moquantes „Pa“! hervorstieß, als wollte sie sagen: „Wage es nur, mit etwas anhaben zu wollen! Ich bin Konsul Buddenbrooks Tochter, wenn du es vielleicht nicht weißt.“ Sie ging in der Stadt wie eine kleine Königin umher, die sich das gute Recht vorbehält, freundlich oder grausam zu sein, je nach Geschmack und Laun…
Sind Weltanschauung und ethische Normen des Bürgers aber tatsächlich in den Bereich der Religion einzuordnen? So mancher erkennt mit dem Aufkommen des Bürgertums auch eine Formalisierung des Begriffs von Religion und eine ,Entleerung‘, ja: eine ,Zersetzung‘ der Religion und kritisiert, dass Religion für viele nur noch eine äußere Form und nicht mehr einen ernsthaften Glauben darstellte.483 Bürgerliche Religion habe zwischen Leben und Gott getrennt und so den Realitätsbezug der christlichen Religion zerstört.484 Das Bürgertum, das bereits als spätmittelalterliches Stadtbürgertum in der Warenproduktion und im Warenhandel tätig war, zeigte immer eine Mentalität des ruhelosen Schaffens- und Machtwillens - wie Thomas Buddenbrook in maßloser Aktivität und Unruhe lebt und weder in dem ständischen Selbstverständnis seiner Vorfahren noch in deren religiösen Glauben ruht. Eigentum und Arbeit galten stets als bürgerliche Prinzipien und dazu gehörten persönliche Bereicherung, Konkurrenzindividualismus und das Recht der Persönlichkeit, sind das aber Werte des Christentums?
Im Roman gibt es durchaus Belege für diese Sichtweise von Religion:
- In der Familienchronik wird mit Gott gesprochen, gebetet für die Lieben, meditiert. Der Hinweis auf die Police am Anfang und die Erleichterung zum Schluss beim „Amen“,(s.o.) zeigt, „dass der fromme Aufschwung zwar für subjektive Wahrhaftigkeit zeugt, aber gleichwohl fest integriert sei in dem Geschäft und den täglichen Dienst.“485
- Bendix Grünlich zeigt durch seine vorgeschobenen Frömmigkeit und christlichen Redensarten, wie wenig seine scheinbare Frömmigkeit mit seiner Lebensart und Mentalität zu tun hat. Kein wahres Wort ist in der frommen Rede des Bankrotteurs, die religiöse Sprache soll die Familie Buddenbrook beeindrucken und für sich einnehmen.
S. 95
“.In der Tat, wenn in allen Familien ein Geist herrschte wie in dieser, so stünde es besser um die Welt. Hier findet man Gottesglaube, Mildherzigkeit, innige Frömmigkeit, kurz, die wahre Christlichkeit, die mein Ideal ist;…
Thomas Mann, dem die Verbindung von Kirche und Politik, Macht und Geistlichkeit stets suspekt war, karikiert auf diese Art die frommen Bräuche unfrommer Bürger:
- Als Tony Budddenbrook den Lutherischen Katechismus memoriert, wird dem Hochpathetischen durch ihren Großvater die Feierlichkeit genommen. (s.o.)
- Der alte Buddenbrook, der es zu Erfolg und bürgerlicher Bonität gebracht hat, lässt nach dem Tischgebet Gott, Firma und gute Gesellschaft als eine lübische Trinität wohlleben.486
Im liberalen gebildeten Bürgertum, dem Thomas Buddenbrook zuzuordnen ist, war eine „moralisch orientierte kirchenferne bis kirchenkritisch bürgerliche Form von Religiosität“487 anzutreffen, man war religiös und zugleich religionskritisch, d.h.man schloss sich der Kirchen- und Religionskritik an, indem man den traditionellen Dogmen und dem Glauben an Wunder und der Schöpfungsgeschichte misstraute und sich gegen die Enge der christlichen Moralvorstellungen und die Unglaubwürdigkeit der kirchlichen Vertreter richtete. In dieser Schicht der Gebildeten und in breiteren Bevölkerungsschichten fand die o.g. Entfremdung von der Kirche statt, dort blieb man zwar religiös, übte jedoch die Religion weniger im regelmäßigen Kirchenbesuch als individuell aus, das meint die subjektive Seite der Religion: „Religiosität“ oder „Frömmigkeit“ 488, ein von Friedrich Schleiermacher definiertes subjektzentriertes „Gefühl der schlechthinnigen Abhängigkeit“ von etwas Höherem, als subjektive Erfahrung des Göttlichen, unabhängig vom konkreten Inhalt.489 Das Bedürfnis nach Einheit und Transzendenz war es, das den damaligen Bürger umtrieb und mit dem er sich beschäftigte. Alles, was den Menschen seine Göttlichkeit spüren ließ und Vervollkommnung verhieß, nahm für ihn Heilscharakter an und wurde sakralisiert, z.B. Kunst, Natur, Arbeit, Ehe.
(TM)
Für Thomas Buddenbrook sind Arbeit und der Erfolg zwar seine Lebensorientierung, gleichzeitig ist in ihm aber ein individuelle religiöse Sehnsucht vorhanden. Er sucht Antworten auf unirdische transzendentale Fragen, wie die nach seinem Verhältnis zum Tod, den letzten Dingen und nach Wegweiser für sein Leben. Dem Glauben seiner Vorfahren steht er fern:
S. 652
Der Buchstabenglaube, das schwärmerische Bibel-Christentum, das sein Vater mit einem sehr praktischen Geschäftssinn zu verbinden gewusst, und das später auch seine Mutter übernommen hatte, war ihm immer fremd gewesen.. Sein Lebtag vielmehr hatte er den ersten und letzten Dingen die weltmännische Skepsis seines Großvaters entgegengebrach…
Seine Religiosität ist gelöst von den theologischen Dogmen. Er empfindet Zuneigung zum Katholizismus, die seine Mutter ihm zum Vorwurf macht, und trägt sich mit dem Gedanken der Konversion. Dies bewegt ihn aber nicht zu einem verstärkten religiösen Studium und hilft ihm auch in keiner Form weiter.
S. 307
Ich weiß, dass du in Frankreich und Italien eine gewissen Sympathie für die Päpstliche Kirche gefasst hast, aber das ist nicht Religiosität bei dir, Tom, sondern etwas anderes, und ich verstehe auch, was; aber obgleich wir duldsam sein sollen, ist Spielerei und Liebhaberei in diesen Dingen in hohem Grade strafbar; und ich muss Gott bitten, dass er dir und deiner Gerda - denn ich weiß, sie gehört ebenfalls nicht gerade zu den Gefesteten, mit den Jahren den nötigen Ernst darin gibt.…
Ein Offenbarungserlebnis durch die Lektüre Schopenhauers sollte zum Religionsersatz werden, und ihn die Individualität als Hindernis und den Tod als Erlösung und Befreiung erkennen lassen. Die religiöse Frage bei Thomas Buddenbrook und bei dem Autoren Thomas Mann lässt sich formulieren: „Welche Macht ist stärker als der Tod und kann man der Herrschaft des Todes über die Gedanken Widerstand leisten? Welcher Sinn hält angesichts des Wissens des Menschen um seinen eigenen Tod stand?“ 490 Thomas Mann glaubte an die Ewigkeit, an ein Weiterleben nach dem Irdischen, und auch der Buddenbrook-Roman endet mit diesem, fast als Sicherheit scheinenden Glauben: S. 759
„Es ist so!“ sagte sie mit ihrer ganzen Kraft und blickte alle herausfordernd a…
Das Erschließungs-, Offenbarungserlebnis bietet Thomas Buddenbrook letztendlich keine Handlungsorientierung und bleibt folgenlos. Sein Geist kann dies theologisch- methaphysische Denken nur begrenzt nachvollziehen, und nach dem einmaligen spirituellen nächtlichen Erleben Gottes und der Ewigkeit, bricht er die religiöse Suche ab und greift auf die religiösen Begriffe und Bilder aus seinen Kindertagen zurück.
Die weltliche Bildung und die sich verbreitende bürgerliche Konzert- und Museumskultur wird den folgenden Generationen zu einem Ersatz für religiöses Leben. Die Aktivität in Vereinen, der Besuch von kulturellen Veranstaltungen, Ausflüge und Spaziergänge, Kunst, Kunstgenuss, Berufswelt und Politik nahmen die Zeit in Anspruch, die man früher dem kirchlichen Besuch gewidmet hatte.491
Hannos Ersatzreligion und Lebenshilfe ist die Musik:
S. 747ff
Er setzte sich und begann eine seiner Phantasien. . Und nun begannen bewegte Gänge, ein rastloses Kommen und Gehen von Synkopen, suchend, irrend und von Aufschreien zerrissen, wie als sei eine Seele von Unruhe über das, was sie vernommen und was doch nicht verstummen wollte. Mit einer Art von Kirchenschluss endete er…
Es lag etwas Brutales und Stumpfsinniges und zugleich etwas asketisch Religiöses, etwas wie Glaube und Selbstaufgabe in dem fanatischen Kultus dieses Nichts, dieses Stücks Melodi…
„..dem Rückgang traditioneller kirchlicher Sitten wie dem regelmäßigen Kirchen- und Abendmahlsbesuch steht seither die Belebung neuer religiöser Riten und Gewohnheiten gegenüber: Etwa die feierliche Ausgestaltung des Weihnachtsfestes, die vermehrte Lektüre religiöser Schriften, die Mitarbeit in religiösen Vereinen...“ 492 (TM)
Die Erzählung vom Heiligen Abend im Hause Buddenbrook, aus der Perspektive von Hanno, beschreibt das Empfinden von Glück und seligem Schmerz, das diese Feier in den Familienangehörigen auslöst. „Vierzig Seiten lang schwelgt Thomas Mann beim Zelebrieren der bürgerlichen Festlichkeit, die ihm von Kindheit an Spaß gemacht haben wird.“ 493
S. 530
In der Tat, das weihevolle Programm, das der verstorbene Konsul für die Feierlichkeit festgesetzt hatte, musste aufrecht gehalten werden, und das Gefühl ihrer Verantwortung für den würdigen Verlauf des Abends, der von der Stimmung einer tiefen, ernsten und inbrünstigen Fröhlichkeit erfüllt sein musste, trieb sie(die Konsulin)rastlos hin und her - von der Säulenhalle, wo schon die Maien-Chorknaben sich versammelten, in den Esssaal, … hinaus auf den Korridor, … und wieder ins Landschaftszimmer, …
14.2 Glaubensrichtungen in der protestantischen Kirche des 19. Jh
Die unterschiedlichen Frömmigkeitstypen im Protestantismus der damaligen Zeit korrelierten mit verschiedenen Glaubensrichtungen. Der liberale Protestantismus war an den Bedürfnissen der bürgerlichen Gesellschaft orientiert und gab dem bürgerlichen Leben Impulse. Religiosität war geprägt von einer subjektiven Glaubenserkenntnis und der Individualisierung des religiösen Lebens.
Das liberalprotestantische Kulturideal implizierte ein protestantisches Geschichtsbild: Durch die Reformation habe eine neue Zeit mit modernen Werthaltungen wie Aufklärung, der Bildung und bürgerlicher Freiheit begonnen, auf der Grundlage von Toleranz, Humanität und geistiger Freiheit, die, so war man der Auffassung, der Unfreiheit, Unkultur und Intoleranz des Katholizismus gegenüber standen.
Liberale Pfarrer zeigten Offenheit gegenüber Bildung und Wissenschaft, akzeptierten den Wunsch nach religiöser Autonomie, nach Bildung, Emanzipation und einem subjektivem Glauben. Sie unterstützten Bibelkritik und Wissenschafts- und Gewissensfreiheit, weil sich erst darin sich die Freiheits- und Selbständigkeitserklärung des Bürgers dokumentierte. Der Geistliche sah sich als Lehrer von Religion und Bildung und nicht mehr als göttlich eingesetzt mit einem klerikalen Sonderethos.494
Die Allgemeinbildung des Pfarrers erhielt einen hohen Stellenwert: Als Repräsentant eines christlichen Lebens sollten bei ihm Beruf und Person deckungsgleich sein. Er hatte seine Aufgabe als Vermittler der biblischen Wahrheit, als Berater, Freund und Seelsorger der Gemeinde im kirchlichen, gemeindezentrierten und geistlichen Bereich zu sehen.
Die Kulturträgertheorie der Protestanten war zwar von einem liberalen bürgerlichen Selbstverständnis geprägt, enthielt aber auch „Elemente eines die Liberalität der bürgerlichen Gesellschaft von innen aushöhlenden Wertekanons: eine latente bis offene religiöse Intoleranz.“.495
So war das Verhältnis der verschiedenen Konfessionen nie ganz spannungsfrei, bürgerliche protestantische Frömmigkeit zeigte eine „fast aggressive Art der Diffamierung anderer Frömmigkeitsstile“.496 Man war dem Katholizismus gegenüber negativ eingestellt und sah als liberaler Protestant eine Überlegenheit des Protestantismus in kultureller und sozialer und ökonomischer Sicht. Der Katholizismus galt als eine Verdummung des Volkes, als unbürgerlich und rückschrittlich. Man warf ihm Wissenschafts- und Modernitätsfeindlichkeit vor, sah in ihm eine Ablehnung der Freiheit des Geistes und des Gewissens, denn Rom schrieb vor, was man glauben und lehren sollte. Der Katholizismus, so war die Auffassung, begreife das Christentum als „Kirche und Frömmigkeit“, der Protestantismus aber sehe das Christentum als „religiös beseelte Sittlichkeit“.497 (TM)
Antikatholische Ressentiments vernimmt man bei der Konsulin, die es gut heißt, dass Tony „an dem Glauben ihrer Väter festhält und die unevangelischen Schnurrpfeiferein verabscheut.“ (S. 307))
Thomas B. dagegen empfindet Sympathie für den römischen Glauben, wie man im Gespräch mit seiner todkranken Mutter erkennt:
S. 560
„Thomas“, sagte die Konsulin jetzt mit behutsamer Stimme, um den Hustenreiz nicht wieder zu entfesseln, „glaube mir, du erregst Anstoß mit deiner beständigen Protektion der Katholischen gegenüber den schwarzen Protestantischen…
„.Ich bin überzeugt, dass die Grauen Schwestern treuer, hingebender, aufopferungsfähiger sind, als die Schwarzen. Diese Protestantinnen, das ist nicht das Wahre. Das will sich Alles bei erster Gelegenheit verheiraten. Kurzum, sie sind irdisch, egoistisch, ordinär. Die Grauen sind degagierter, ja, ganz sicher, sie stehen dem Himmel näher.…
Tony Buddenbrook erlebte eine Form des Katholizismus in München, der sie erzürnte:
S. 307
„Oben auf dem Brunnen. steht eine Maria, und manchmal wird er bekränzt, und dann knieen dort Leute aus dem Volk mit Rosenkränzen und bete…
Aber stell dir vor, Mama, gestern fuhr in der Theatinerstraße irgend ein höherer Kirchenmann in seiner Kutsche an mir vorüber, vielleicht war es er Erzbischof, ein älterer Herr - genug, und dieser Herr wirft mir aus dem Fenster ein paar Augen zu wie ein Gardeleutenant!…
Recht gab den liberalen Protestanten in gewisser Weise das unübersehbare „katholische Bildungsdefizit“ im Bereich der höheren Bildung im 19. Jahrhundert, denn nur eine geringe Quote der Katholiken besuchte die höhere Schule.498
Eine kulturelle Differenz zum Katholizismus zeigte sich im Verhältnis zur Nation. Der römische Katholizismus stand nach Meinung der protestantischen Geistlichkeit konträr zur deutschen Kultur, er war übernational und grenzte „sich gegen das bürgerliche Zeitalter und seine Repräsentation in Nationalstaat und Wissenschaft ab [.], um als kirchliche Macht und als kirchlicher Geist sich selbst zu finden.“499
Andererseits empfanden nicht wenige Protestanten dem Katholizismus gegenüber Bedrohungsängste, denn anders als bei ihnen wurde dort der Nachwuchs an Pfarrern und Kirchenbeamten durch Anstalten, wie z.B. Knabenkonvikte, gesichert.
Viele Dienstmädchen stammten aus dem ländlichen Milieu, waren Teil der katholischen Population, durch sie hörten die Kinder andere Formen der religiösen Praxis 500und wundersame Geschichten.
(TM)
Letzteres trifft auch auf Ida Jungmann zu, Tochter eines Gasthofbesitzers in Westpreußen, das Kindermädchen der Buddenbrooks ist:
S.11
„Wenn es ein warmer Schlag ist“, sprach Tony und nickte bei jedem Wort mit dem Kopfe, „so schlägt der Blitz ein. Wenn es aber ein kalter Schlag ist, so schlägt der Donner ein!…
Herr Buddenbrook aber war böse auf diese Weisheit, er verlangte durchaus zu wissen, wer dem Kinde diese Stupidität beigebracht hab…
In Lübeck selber genossen die reformierte Gemeinde und die Lutheraner gleiche bürgerliche Rechte. Die 200 Gläubige umfassende katholische Gemeinde feierte in einer kleiner Kapelle in dem alten Vikariatshaus Kapitelstr. 7 ihren Gottesdienst, spielte in der Stadt aber keine Rolle. Die Schwestern, die bei Buddenbrooks mit der Krankenpflege betraut werden, gab es erst seit 1874 in Lübeck.
Der Roman weist auf die Konkurrenz in der Gemeindeseelsorge und am Krankenbett zwischen den Konfessionen hin. Der Pastor hat Vorbehalte gegenüber der Ordensfrau:
S. 564
Auch Pastor Pringsheim erschien, streifte Schwester Leandra mit einem kalten Blick und betete mit modulierender Stimme am Bette der Konsuli…
Im Zuge neuer Klostergründungen im 19. Jahrhundert traten bürgerliche Frauen in weibliche Orden und Kongregationen ein.
(TM)
Klothilde war mit Einfluss des Senators in „Johanniskloster“ aufgenommen worden. Diese Institution bezweckte:
S. 541
,. die würdige Altersversorgung mittelloser Mädchen aus verdienter und alteingesessener Familie.…
Rente und Wohnung waren damit für sie gesicher…
Neben dem liberalen Protestantismus prägten das Neuluthertum, der Pietismus und Erweckungsbewegungen seit den 1840er Jahren das kirchliche und pastorale Milieu. In ihnen erfuhr das Pfarramt eine Resakralisierung. Diese Pastoren waren bekenntnistreu und hatten ihre Aufgabe in der Spendung der Sakramente und der Verkündigung des Wortes. Bildung und wissenschaftliche Kompetenz wertete man im Vergleich zur Weihe ab,501 betonte dagegen die Amtswürde und pastorale Weihe, das äußerliche Auftreten und den Habitus, z.B. in der berufsständischen Kleiderordnung. Ihre wichtigsten Eigenschaften hatten Bescheidenheit, Demut und die Zurücknahme der eigenen Person zu sein. Als Botschafter Gottes war den Geistlichen die Vergnügungskultur verpönt, und anders als ihre liberalen Kollegen reduzierten sie ihre geselligen Kontakte zum Bürgertum. Einer Mitgliedschaft in Vereinen des gehobenen Bürgertums standen sie kritisch gegenüber, da sie die seelsorgerliche Distanz einhalten wollten.502 Insbesondere pietistische Geistliche sahen sich als herausgehobene Sondergruppe, vermieden soziale oder kulturelle Kontakte und verkehrten nur in Häusern von kirchentreuen Kaufmannsfamilien, wie den Buddenbrooks.503
Das individualistische Religionsverständnis in der Familie Buddenbrook hat seine Wurzeln im Pietismus, eine auf Askese und Leistung zielende Lehre504 laut der jeder Mensch durch sein persönliches Gefühl Gott erfahren kann. Zu einem pietistischen Leben gehörten regelmäßige Mittag- und Abendgebet und ein großes frommes Engagement wie es in der Familie Buddenbrook praktiziert wurde.
(TM)
Jean, der mit intensiver Herzensfrömmigkeit spricht und schreibt, lebt einen individuellen und expressiv pietistischen Glauben. Je älter der Konsul wird, desto intensiver entwickelt sich sein kirchliches Leben in neopietistisch geprägter Frömmigkeit.505
Gründlich mahnt er mit einem Verweis auf eine Änderung dessen Verhaltens und Denkens:
S. 230
„.Beten Sie…
S. 225
… Fassen Sie sich und suchen Sie Trost und Kraft bei Gott.…
In Anlehnung an die einfache Frömmigkeit des Frühchristentums entstanden private familiäre Andachtsgruppen, in die eine religiöse Lektüre eingebunden wurde.
Bei den Buddenbrooks findet sich die Sitte der Hausandacht mit der Lektüre biblischer und erbaulicher Texte und den religiösen Praktiken des Betens, Singens und des Vorlesens aus der Bibel und aus Andachtsbüchern.
S. 241
… denn des Konsuls fromme Neigungen traten in dem Grade, in welchem er betagt und kränklich wurde, immer stärker hervor, und seitdem die Konsulin alterte, begann auch sie an dieser Geistesrichtung Geschmack zu finden. Die Tischgebete waren stets im Buddenbrook’schen Hause üblich gewesen; jetzt aber bestand seit längerer Zeit das Gesetz, dass sich morgens und abends die Familie gemeinsam mit den Dienstboten im Frühstückszimmer versammelte, um aus dem Munde des Hausherrn einen Bibelabschnitt zu vernehmen. Außerdem mehrten die Besuche von Pastoren und Missionaren sich von Jahr zu Jahr. und aus allen Teilen des Vaterlandes kamen gelegentlich schwarzgekleidete und langhaarige Herren herbei, um ein paar Tage zu verweilen. gottgefällige Gespräch…
Religion wird zu einer Familienreligion; Gottesdienste, kirchliche Feste wie Taufen, Trauungen und Beerdigungen verlegte man in das eigene Haus und versammelte Familie und Personal zu einer kleinen Gemeinde, in der der Hausvater das göttliche Wort verkündet. Die so veränderte, gefühlvolle Stimmung im Haus brachte Trost und Erbauung und sollte die Kinder zu Moral und guten Umgangsformen erziehen.
Pietistisch geprägte Geistliche haben private Kontakte zum Haus der Familie Buddenbrook und praktizieren gemeinsam mit ihnen die Religion:
S. 280
Sie (Tony Buddenbrook) war nicht glücklich, sie empfand Langeweile und ärgerte sich über die Pastoren und Missionare, deren Besuche nach dem Tod des Konsuls sich vielleicht noch vermehrt hatten und die nach Tonys Meinung allzu sehr das Regiment führten und allzu viel Geld bekame…
Gemeinnützigkeit zeigte sich bei pietistischen Gläubigen durch ihren Dienst am Armen, an Waisen und Kranken. Diese Hilfe durch milde Gaben an Hilfsbedürftige und Handarbeiten für die Mission waren im Bürgertum selbstverständlich und wurden als bürgerlichmenschlich und nicht als religiöse Tugend betrachtet.
S. 278f
Die Konsulin aber verlangte weit mehr noch von sich als von ihren Kindern. Sie richtete zum Beispiel eine Sonntagsschule ein. Am Sonntag Vormittag klingelten lauter kleine VolksschulMädchen in der Mengstraße.Auch begründete sie den „Jerusalemabend“. Einmal wöchentlich saßen an der langausgezogenen Tafel im Esssaale … Damen, lasen sich geistliche Lieder und Abhandlungen vor und fertigten Handarbeiten an, die am Ende des Jahres in einem Basare verkauft wurden, und deren Erlös zu Missionszwecken nach Jerusalem geschickt war…
In Lübeck waren sowohl die pietistische Frömmigkeit der Familie Buddenbrook als auch die eher liberalprotestantische Haltung von Thomas Buddenbrook verbreitet, der ...
S. 653
… ganz erfüllt war von dem ernsten, bis zur Selbstpeinigung strengen und unerbittlichen Verantwortungsgefühl des echten und leidenschaftlichen Protestanten. Nein, dem Höchsten und Letzten gegenüber gab es keinen Beistand von außen, keine Vermittlung, Absolution, Betäubung und Tröstung! Ganz einsam, selbständig und aus eigener Kraft musste man in heißer und emsiger Arbeit, ehe es zu spät war, das Rätsel entwirren und sich klare Bereitschaft erringen, oder in Verzweiflung dahinfahre…
Oberste kirchliche Behörde in Lübeck war der Senat. Der Gottesdienst bestand aus eine dreiviertelstündige Predigt. Das Niveau der Predigten soll höhere Schichten vom Kirchenbesuch ferngehalten haben.506 Nach Beendigung der Predigt verließen oftmals viele Gläubige die Kirche, so dass, so erzählt man sich, der damalige Pastor Funk die Kirchentüren zu Beginn der Predigt kurzerhand abschließen ließ und erst während des Schlussliedes wieder öffnete.
14.3 Feminisierung der Religion - Die Religion wird weiblich
Bereits seit dem 18. Jahrhundert wurde Religion der weiblichen Sphäre zugerechnet,507 da Frauen stärker als die Männer mit der Religion verbunden waren und als empfänglicher für Religiöses galten als die eher der Rationalität zugeneigten Männer. Religiosität, so die Meinung, war ein Teil des weiblichen Charakters 508 und die „Uranlage des weiblichen Lebens und die Mutter aller weiblichen Tugenden“.509
Religion an sich hatte einen geschlechtsspezifischen Einfluss auf die Sozialisation von Frauen, dies unterstreichen die moralischen Gebote der Nächstenliebe, Demut, Bescheidenheit und Duldsamkeit. Der Einfluss der kirchlichen Autoritäten wie die des Pfarrers war für sie prägend, verkörperte er doch zusammen mit dem männlichen Gottesbild die patriarchalische Ausrichtung der christlichen Kirchen.
Frauen trugen ihre Religiosität in den familiären Innenraum und waren für die Ausformung des bürgerlichen Familienlebens zuständig. Sie prägten mit religiösem Glauben die Moral und Sitte in der Familie und sozialisierten die junge Generation in religiöser Hinsicht.
Auch wenn Frauen seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert die Mehrheit bildeten (und bilden) beim Kirchen- und Abendmahlsbesuch und religiöse Riten pflegten, waren protestantische Männer aus dem großbürgerlichen Milieu nicht unbedingt weniger religiös als die Frauen, hielten nur eher Abstand von den religiösen Pflichten wegen ihrer außenhäuslichen Beschäftigung.510 (TM)
Bei Thomas Mann zeigt sich das Stereotyp der frommen Frau in der Konsulin, aber auch bei Jean wird ein tiefer Glaube sichtbar, wenn er z.B. die Glücksfälle in seinem Leben auf Gottes Wirken zurückführt und religiöse Feste in der Familie lebt:
S. 52f
… und sich wieder einmal dankbar der Erkenntnis zu freuen, wie immer und in aller Gefahr Gottes Hand ihn sichtbar gesegne…
… Und nun höre: Gott der Allmächtige segnete die Mittel und half ihm wieder zur vollkommenen Gesundhei…
S. 89
… denn der Konsul hielt darauf, dass das heilige Christfest mit Weihe, Glanz und Stimmung begangen war…
Regelmäßig nahmen Frauen mit ihren Familien an der Messe teil und vollzogen in der Gemeinschaft der Gläubigen eine Rückbesinnung und ein Nachdenken über sich selbst, eine Art Selbstprüfung. Die Predigt bot Trost, Erbauung, Möglichkeit zur Reflexion über Fragen der Moral, sie hinterfragte und bot Deutungen an, lud insbesondere Frauen, die ja eigentlich sonst auf das Fühlen und Tun beschränkt waren, zur intellektuellen Auseinandersetzung mit moralischen und zwischenmenschlichen Fragen ein.
Die Predigt findet in der Familie Buddenbrook große Beachtung, den Worten von der Kanzel wurde Aufmerksamkeit geschenkt: (TM)
S. 113
Eines sonntags, als sie (Tony) mit den Eltern und Geschwistern in der Marienkirche saß, redete Pastor Kölling in starken Worten über den Text, der da besagt, dass das Weib Vater und Mutter verlasen und dem Manne nachfolgen soll, …
Den Geistlichen wurde nunmehr stärker bewusst, welch wichtige Trägergruppe die Frauen in der Kirche waren. Sie integrierten sie durch Partizipation und eröffneten ihnen neue Tätigkeiten, durch die sie sich selbst verwirklichen konnten und Anerkennung in der Gemeinschaft mit Gleichgesinnten fanden.
Frauenvereine widmeten sich der allgemein Wohlfahrtspflege, halfen Menschen, die in Folge des Krieges in Not geraten waren, versorgten verwundete oder kranke Soldaten.
Nicht selten inspirierten diese Angebote Frauen zur Sakralisierung des häuslichen Raums, so dass es zur „Familiarisierung der Religion“ kam, z.B. in der Feier des
Weihnachtsfestes, in Gebetsstunden und häuslichen Abendmahlsfeiern.511 Damit wurde die Frau zur Bewahrerin der christlichen Kultur, zur christlichen Kulturträgerin.
(TM)
Das religiöse Engagement der Konsulin verstärkt sich nach dem Tod des Ehemannes: S. 277
Todesfälle pflegen eine dem Himmlischen zugewandte Stimmung hervorzubringen und Niemand wunderte sich, aus dem Munde der Konsulin Buddenbrook nach dem Dahinscheiden des Gatten diese oder jene hochreligiöse Wendung zu vernehmen, die man früher nicht an ihr gewohnt gewesen wa…
Bald zeigte es sich, . dass sie schon in den letzten Jahren seines Lebens, und zwar seit sie alterte, mit seinen geistlichen Neigungen sympathisiert hatt…
Sie strebte danach, das weitläufige Haus mit dem Geiste des Heimgegangenen zu erfüllen, mit dem milden und christlichen Ernst, der eine vornehme Herzensheiterkeit nicht ausschloss. Die Morgen- und Abendandachten wurden in ausgedehnteren Umfange fortgesetzt. Die Familie versammelte sich im Eßsaale, während das Dienstpersonal in der Säulenhalle stand, und die Konsulin oder Clara verlasen aus der großen Familienbibel mit den ungeheuren Lettern einen Abschnitt, worauf man aus dem Gesangbuch ein paar Verse zum Harmonium sang . Auch trat oft an die Stelle der Bibel eines der Predigt- und Erbauungsbücher. Psalter, Weihestunden, Morgenkläng…
Jerusalem-Abende und häusliche Morgenandachten machten die Familie zu einer religiösen Gegenwelt. Der Sonntagsunterricht als Katechismus-Unterweisung beweist, welche Bedeutung der Pietismus den Frauen zusprach, und wie sehr er sie insbesondere durch ihre Empfänglichkeit für religiöses Empfinden aufwertete.
Im Katholizismus gründete man als Gegenbewegung zur allgemeinen Säkularisation Frauenkongregationen. Sie unterschieden sich von den Klöstern insofern, dass sie es unverheirateten Frauen erlaubten, in der Kranken- und Armenpflege und im Schulwesen aktiv zu werden. Bei der Aufnahme in solch eine Kongregation spielte das finanzielle Vermögen und die berufliche Qualifikation eine nicht geringe Rolle. War man erst einmal Mitglied, befreite solch ein Eintritt von materiellen Nöten und ermöglichte es, einen geregelten Alltag mit Arbeits- und Ruhezeiten und qualifizierten Tätigkeiten zu verleben.
14.4 Pfarrer im 19. Jahrhundert
In dem protestantischen landesherrlichen Kirchenregiment unterstanden die Pfarrer dem Landesherrn, dem Träger der obersten Kirchengewalt. Bis ins 18. Jahrhundert waren sog. Patronatsherren für die Berufung des Pfarrers und für die Finanzierung und rechtliche Ausgestaltung des Pfarramtes zuständig.512
Es bestand ein ,Pfarrzwang’, d.h., dass Amtshandlungen, wie z.B. Trauungen, Taufen, Konfirmationen und Begräbnisse nur von dem Pfarrer der eigenen Pfarrei durchgeführt werden durften und die entfallenden Gebühren, deren Höhe das Landrecht festlegte, den Geistlichen als direkte Entlohnung einen Teil ihres Einkommens sicherten. Daneben traten zur Aufbesserung des Gehalts Zinserträge aus Pfarrkapitalien, Pfründesystem und verpachteter Grundbesitz, Religions- und Hebräisch-Unterricht an öffentlichen Lehranstalten - und dennoch stellte die Pfarrerschaft bzgl. Einkommen und Lebenshaltung die schlechteste materielle Lage im gehobenen Bürgertum.
Ein neues Besoldungssystem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts führte zur Neuordnung der Einkommensverhältnisse und veränderte die soziale Lage der Pfarrer. Es löste die Geistlichen aus lokalen und regionalen Abhängigkeiten. War ihr Verdienst zuvor an Pfarrpfründe gekoppelt und mit eigener Bewirtschaftung und Einnahme von Gebühren für Amtshandlungen verbunden gewesen, erfolgte nun eine materielle Besserstellung und die Pastoren zählten ökonomisch gesehen zu den privilegierten Schichten.
14.4.1 Herkunft und Verbürgerlichung
Galten Geistliche nun als eine exklusive Gruppe im 19. Jahrhundert? Gab es eine Vergesellschaftung mit anderen Schichten?
Das Denken und Handeln der Menschen werden vom Beruf und vom kulturellen Milieu bestimmt, in dem sie leben. Dies beweisen auch die Geistlichen in der Zeit des Bürgertums. Nachdem sie sich aus ständischen Strukturmustern und den feudalen Abhängigkeitsverhältnissen der Vergangenheit gelöst hatten, erfolgte ihre eigene Verbürgerlichung.513
Die bisherige Selbstrekrutierung in der Pfarrerschaft nahm im 19. Jahrhundert ab. Die Herkunft eines Geistlichen erfolgte nicht mehr nur aus Pfarrfamilien, sondern aus anderen bürgerlichen/kleinbürgerlichen Berufen, z.B. dem der Handwerker, der Gastwirte und der kleinen Beamten oder aus dem staats- und kirchennahen Milieu, in dem die Väter im Staats- und Kirchendienst beschäftigt waren und deren politische Haltung von Staatsnähe geprägt war. Ein akademischer Bildungsanspruch bestimmte die Sozialmentalität der Pfarrer.
Der Beruf des Pfarrers galt als d i e Aufstiegsmöglichkeit in das gehobene Bürgertum. Geistliche stellten im frühen 19. Jahrhunderts dort einen selbstbewussten Teil mit sozialem Einfluss dar, sie akzeptierten bürgerliche Werte und Lebensformen, orientierten sich im Denken und Handeln an bürgerlichen Ordnungsvorstellungen und waren in den regionalen Traditionen verhaftet. Damit wurden sie sozial als auch kulturell zu einem wichtigen Teil des gebildeten Bürgertums, ja, umfassten zeitweise ein Drittel der akademisch Gebildeten. 514
Mit ihrer höheren Schulbildung verkörperten sie als Träger des idealistischen und neuhumanistischen Bildungsideals und mit ihrem akademischen Studium - einschließlich theoretischer und praktischer Ausbildung - mit ihrem vorbildlichen christlichen Lebenswandel den Typ des christlichen Bildungsbürgers. Man erwartete von ihnen, dass sie am kulturellen und gesellschaftlichen Leben des gehobenen Bürgertums teilnahmen und die gesellschaftlichen Umgangsformen beherrschten.
Verhalten und Lebenswandel mussten ihrem Amt entsprechend würdig sein.515 Ihr Ziel war eine bürgerliche Lebensführung mit entsprechender Wohnungseinrichtung und Kleidung, mit großem Interesse an der Bildung der Kinder, insbesondere der Söhne. Auf keinen Fall sollten Geistliche ,verbauern‘.516
Pfarrer in Stadtpfarrstellen zählten sich gesellschaftlich und aufgrund ihrer Bildung und ihres Beamtenstatus per se zu der gebildeten lokalen Honoratiorenschaft und richteten ihr Geselligkeitsverhalten danach aus. Mit Gleichgesinnten und mit der gebildeten und besitzenden Oberschicht verkehrte man standesgemäß ohne pastorale Distanz, war wie sie wohlsituiert und ein Repräsentant des bürgerlich-mittelständischen Lebensstils. Das regionale Umfeld und die Tradition in der jeweiligen Landeskirche prägten die Lebenswelt der Pfarrer und ihr religiöses Milieu. Sie versammelten sich mit den Bürgern zu Konzerten und Familienfeiern, unterrichteten an den Volks- und höheren Schulen Religion und kamen in den bürgerlichen Geselligkeitsvereinen, im „Casino“ oder in den „Logen“, mit der städtischen Oberschicht zusammen. Ihr religiöses und vereinspolitisches Engagement ließ sie zu einem Teil der bürgerlichen Gesellschaft werden, und so konnte durchaus von einer Verbürgerlichung und Integration in bürgerliche Sozial- und Berufsstrukturen gesprochen werden.
(TM)
Konfessionell vereint mit bürgerlicher Kultur zeigten sich Pfarrer in Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft vor Ort und integrierten sich in die bürgerliche Lebenswelt.
Im Roman ist der hiesige Pastor zu Gast bei den Buddenbrooks: S. 16
Mehrmals hatte die Glocke durchs ganze Haus gegellt. Pastor Wunderlich langte an, ein untersetzter alter Herr in langem, schwarzen Rock mit gepudertem Haar und einem weißen, behaglich lustigen Gesich…
Der Stadtpfarrer zählte sich zur lokalen Honoratiorenschaft, übte kein pastorale Distanz und ist als Gesellschafter und auf Festen bei führenden Familien eingeladen. Kirchliche Bindung und kirchliches Milieu sind hier ein entscheidendes Kriterium geselliger Kontakte. S. 16ff
Mehrmals hatte die Glocke durchs ganze Haus gegellt. Pastor Wunderlich langte an,…
… und suchte mit den Augen seine Mutter, die als eine der letzten, an der Seite Pastor Wunderlichs die Schwelle überschreiten wollt…
Eloquent weiß er die Tafel zu unterhalten:
S.23f
Es wurde der Fisch herumgereicht, und während Pastor Wunderlich sich mit Vorsicht bediente, sagte e…
„Diese fröhliche Gegenwart ist immerhin nicht so ganz selbstverständlich.…
Aber der Pastor, der wusste, dass sie es nicht liebte, von diesem für sie ein wenig peinlichen Vorfall selbst zu berichten, begann statt ihrer noch einmal mit der alten kleinen Geschichte, auf welche die Kinder gern zum hundertsten Male gehorcht hätten,…
Das spätrationalistische Amtsverständnis betonte bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts die wissenschaftliche Bildung und bürgerliche Kultur des Pfarrers. Er hatte sich in erster Linie durch Allgemeinbildung und theologische Schulung auszuzeichnen und nicht durch seine äußerliche Amtsweihe.
Nicht selten engagierten sich Pfarrer politisch und waren, weil sie sich nicht nur auf die Kirche beschränkt sahen und wie viele männlichen Bürger gesellschaftliche Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen wollten, sowohl als staatstragende Kraft als auch in der Opposition zu finden. Sie arbeiteten in bürgerlichen Kulturvereinen und in Institutionen der kommunalen Selbstverwaltung mit und engagierten sich als Person im Amt des Vorsitzenden oder Schriftführers in kirchennahen Vereinen und Verbänden, auch jenseits der amtskirchlichen Strukturen. Damit bestimmten sie die kulturelle, soziale und politische Ausrichtung des protestantischen Vereinswesens. Als Beispiel sei der Verein der „Inneren Mission“, genannt, gegründet durch Johann Wichern: Er übernahm um die Jahrhundertmitte sozialkaritative Aufgaben in Vereinen und und Anstalten und half aus dem Geist des Evangeliums und im Sinne der bürgerlichen Ordnungsidee, eine Antwort auf Probleme der bürgerlichen Gesellschaft zu geben.517 Wicherns Ziel war es, dass christliche Vereine sich um kirchenferne Menschen der unteren sozialen Schichten kümmerten: eine Aufgabe zur „Rettung der bürgerlichen Welt“ und zur „Erhaltung des gesunden bürgerlichen Lebens“. Aus dem Geist des Christentums und mit Nächstenliebe versuchte man, soziale Probleme mit sozialer Mildtätigkeit und karitativer Fürsorge zu lösen. Von einem religiös-sittlichen Kulturkonzept durchdrungen fand durch diese gesellschaftlich organisierte innere Missionsarbeit von Bürgern und Pfarrern ein wichtiger Beitrag zur Bewältigung sozialer Not statt.518
Im Heiratsverhalten zeigten Pfarrer zunächst eine starke Binnenverflechtung. Ein Großteil von ihnen heiratete Pfarrertöchter, wenn auch in manchen Pfarramtsratgebern aufgrund der schlechten Besoldung eine Geldheirat in das Besitzbürgertum empfohlen wurde, um zu Wohlstand zu gelangen.519 Frauen mit Orts- und Heimatbindung, Engagement in Kirche und Gemeinde galten als besonders geeignet als Pfarrfrau.
Im Laufe des 19.Jahrhunderts schätzte man bald ebenfalls von Seiten des kirchlich gebundenen protestantischen Wirtschaftsbürgertums solch eine Verheiratung, weil man der Auffassung war, dass das Pfarrhaus den Töchtern soziale Sicherheit gab. Diese Verflechtungen mit gehobenen bürgerlichen Schichten führte zu einer Statussicherung und einer stärkeren Verbürgerlichung von Pfarrern520, gleichzeitig aber auch zu einer einflussreichen Stellung der Religion in der modernen Gesellschaft der damaligen Zeit.
(TM)
Tony wird von Pastoren umworben:
S. 282
Tränen-Trieschke aus Berlin, der diesen Beinamen führte, weil er allsonntäglich einmal inmitten seiner Predigt an geeigneter Stelle zu weinen begann, … verliebte sich bei dieser Gelegenheit in Tony, nicht etwa in ihre unsterbliche Seele, o nein, sondern in ihre Oberlippe, ihr starkes Haar, ihre hübschen Augen und ihre blühende Gestal…
Ihre Schwester Clara heiratet Pastor Tiburtius, wobei ihr Vermögen als Frau aus dem besitzenden Bürgertum dem Geistlichen zufließt und ein standesgemäßes Leben und die Deckung von Studienschulden ermöglicht. Clara erscheint als die ideale Pfarrfrau: Sie ist gottesfürchtig, stellt sich in den Dienst des Mannes, besitzt klassisch-mittelständische Tugenden (Ordnung, Sauberkeit) und tauscht sich geistig-religiös mit ihrem Mann aus. Die Konsulin gibt ihr Einverständnis zur Heirat:
S. 285
Keinen der skeptischen, rotspontrinkenden und jovialen Kaufherren ihrer Umgebung, wohl aber einen Geistlichen konnte sie sich an der Seite des ernsten und gottesfürchtigen Mädchens vorstelle…
Im Unterschied zu den beschriebenen bei den bürgerlichen Familien verkehrenden Geistlichen gab es seit dem Ende des 18. Jahrhunderts auch eine orthodoxe Position: Sie wies dem Geistlichen eine herausgehobene Stellung in der Gemeinde zu. Als ein Mittler des Heils erhielt er in seinem Amt das göttliche Mandat von Christus, und diese Amtsgabe, als besondere religiöse Qualität, trennte ihn von der Gemeinde. Das Amt des Pfarrers mit seinen sakramentalen und kultisch-liturgischen Elementen wurde aufgewertet, die persönliche Gläubigkeit der Pfarrer und ihr priesterliches Charisma traten in der Vordergrund. Diese Pfarrer sahen sich in ihrer klerikalen Sonderrolle in sozialer Distanz zu der bürgerlichen Gesellschaft und der bürgerlichen Berufswelt, hatten einen anderen Lebensstil, andere Kleidung und Sprache. In Folge ließen die geselligen Sozialkontakte zwischen Pfarrerschaft und Bürgertum nach. Diese Pfarrer bezogen sich auf ihre Berufsgruppe und vermieden Kontakt zu den bürgerlichen Geselligkeitsvereinen und Casino-Gesellschaften.
Bei orthodoxen Priestern überwog die Furcht vor der Relativierung des christlichen Glaubens und vor einem Werterelativismus, ihrer Meinung nach ein Grund für die Entkirchlichung der Gebildeten, für die wiederum, ihrer Auffassung nach, der religionskritische und entchristliche Geist der humanistischen Gymnasien verantwortlich war. Mit der Distanz zur Bildungstradition des Idealismus und Neuhumanismus und gleichsam mit einer Bildungs- und Wissenschaftsfeindlichkeit kam es zur Verstärkung des Subjektiven und des Gemüts. Es entwickelte sich die sog. Erweckungsbewegung, in deren Gebetsgruppen viele dieser Geistliche ihre Hilfe anboten.521
14.4.2. Der Ausbildungsweg zum Pfarrer
Attraktiv war der Beruf eines Pfarrers allemal, denn er versprach eine beamtenähnliche Karriere mit guten Anstellungschancen und hohe soziale Sicherheit. In erster Linie entscheidend für die Berufswahl des Pfarrers sollte aber stets eine persönliche Glaubenserfahrung sein, für die neopietistische Theologen im frühen 19. Jahrhundert den Nachweis der Bekehrung verlangten.522
Als Wortreligion beinhaltete der Protestantismus seit der Reformation eine Auseinandersetzung mit Gottes Wort in der Bibel, und um diese übersetzen und auslegen zu können, waren Kenntnisse der Geschichte, des NT und des AT und der alten Sprachen erforderlich. Aus diesem Grund erhöhte man die Ausbildungsstandards für Geistliche durch eine staatliche Normierung und machte den Zugang zum theologischen Berufsstand mit einer philologischen Bildung und der Reifeprüfung am Gymnasium verbindlich. Dadurch wurde die im (Bildungs)Bürgertum am humanistischen Gymnasium vermittelte philologische Bildung in der Auseinandersetzung mit der klassischen deutschen und antiken Literatur (ohne dass sie einen instrumentellen Bezug für das Bildungsbürgertum hatte), nun auch bedeutsam für die Pfarrerschaft. Auf diese Art entstanden für sie bereits auf dem Gymnasium gesellschaftliche Bindungen mit anderen Gruppen des Bildungsbürgertums, die zu einem sozialen Kapital für das spätere Leben wurden.
Man setzte ein dreijähriges Theologiestudium fest und verschärfte die Prüfungen: Hebräischkenntnisse wurden ebenso zur Voraussetzung für das Bestehen der Prüfung wie die religionswissenschaftliche Erforschung der Bibel.
Studiumgebühren mussten zwar auch für ein Theologiestudium gezahlt werden, diese waren aber aufgrund der vielen Stipendien und Freitische niedriger als für andere akademische Ausbildungen, wie z.B. die des Arztes oder des Juristen.
Die universitäre Berufsausbildung mit reglementiertem Hochschulzugang, Studienverlauf und Abschlussprüfung definierte von nun an den sozialen Status und die soziale Distinktion der Pfarrer und integrierte sie ins Bildungsbürgertum.523
Das für die bürgerliche Gesellschaft entscheidende Leistungsprinzip setzte sich bei den Geistlichen mit ihrer Akademisierung und der Verwissenschaftlichung ihrer Ausbildung durch.
Stets entschied die Landeskirche über den Ort einer Anstellung als Pfarrer; meistens war dies wegen der Kenntnis der regionalen Traditionen, Sitten und Gebräuche und der besonderen Mundart in den Herkunftsprovinzen der Geistlichen. Die Pfarrer hatten sich den Entscheidungen der Landeskirche unterzuordnen. Die Eingebundenheit in die einheitliche Landeskirche mit bürokratischen Strukturen trug mit dazu bei, dass sie wie Staatsbeamte angesehen wurden, obrigkeitliche Aufgaben erfüllten und der Pfarrberuf als ein staatsnaher bürgerlicher Bildungsberuf galt.
Viele Pfarrer arbeiteten nach dem Abgang von der Universität zunächst als Hauslehrer in der bürgerlichen Oberschicht und lehrten in Abhängigkeit vom Arbeitgeber, oftmals mit einer sehr großen Arbeitsbelastung. Dort lernten sie dann die für gebildete und respektierte Pfarrer unerlässlichen guten Umgangsformen und ein sicheres Auftreten in der Gesellschaft: Pastor Wunderlich, zu Gast bei den Buddenbrooks, stellt einen Beweis für die Internalisierung bürgerlicher Normen dar, er parliert, ist geistreich und beherrscht die Regeln des guten Umgangs bei Tisch.
Andere Pfarrer wiederum wurden als Lehrer an Schulen angestellt: (TM)
S. 713
Er hatte ehemals Prediger werden wollen, war dann jedoch durch seine Neigung zum Stottern wie durch seinen Hang zu weltlichem Wohlleben bestimmt worden, sich lieber der Pädagogik zuzuwende…
Als Geistlicher im Pfarramt wurde vom Pastor stets eine Identität von Person und Beruf erwartet, war dies der Fall, zollte man ihm und seiner geistlichen Arbeit gegenüber in gläubigen Kreisen Anerkennung und Hochachtung, (TM)
Die diskrete Zurückhaltung bei einer nicht ganz eindeutigen literarischen Darbietung anlässlich der Hauseinweihung der Buddenbrooks zeugt davon:
S. 41
Pastor Wunderlich aber war an ein Fenster getreten und kicherte, der Bewegung seine Schultern nach zu urteilen, still vor sich hi…
Die Stellung des Pastors in der Gemeinde war eine patriarchalische. Sie resultierte aus der persönlichen Kenntnis der Gemeindemitglieder, die im Verlauf ihres Lebens seine Betreuung erfahren haben, wie eben jener Pastor Wunderlich, der das Leben der Buddenbrook’schen Familienmitglieder begleitet.
14.4.3 Geistlichkeit im Familienroman „Buddenbrooks“
Im Roman von Thomas Mann rühren die distanziert-ironischen Schilderungen bürgerlicher Religiosität und insbesondere der Geistlichen aus den autobiographischen Erfahrungen von Thomas Mann in seiner Jugend im protestantischen Milieu in Lübeck.
Th. Mann verspottet die Verweltlichung und das Komplizentum zwischen Kirche und Bürgertum und zeichnet auch anhand der Geistlichen, die in steigendem Maße auf die Äußerlichkeiten der Religion konzentriert sind, letztendlich eine „Verfallsgeschichte“.
Pastoren im Roman waren, da keine Pensionierung von Geistlichen vorgesehen war, meist bejahrte Männer. Sie verweilen im Haus der Konsulin und dürfen dort „gottgefällige Gespräche...“ erwarten. Ihnen zur Seite stehende examinierte Kanditaten verdingen sich als (Haus)lehrer bis sie eine Anstellung (meist durch den Todesfall eines Geistlichen) bekamen.
Folgende Geistliche sind den Generationen der Buddenbrooks zur Seite gestellt:
- Pastor Wunderlich: Mit gepudertem Haar, rundem wohlmeinenden behaglich lustigen Gesicht ist er Teil der bürgerlichen Honoratiorengesellschaft. Er beherrscht den Plauderton und ist den Freuden des Lebens nicht abgeneigt.
Bereits in der Anfangsszene bei der Hauseinweihung zeigt sich die Kirche in Person des Pastors zwanglos eingebunden: Er spricht keinen Haussegen sondern einen Toast aus.
Er ist ebenso unpathetisch wie Johann Buddenbrook der Vernunftreligion zugewandt und lehnt Aberglaube, Dummheit und „fromme Geldgier“ ab, beide trennen Geschäft von religiöser Moral.
- Pastor Kölling: Ein Gefährte des jüngeren Johann Buddenbrook, er ist ein robuster Mann mit derber Redeweise, der von der Kanzel „poltern“ kann. Seine geistliche Macht weitet sich aus auf den weltlichen Bereich, zu hören in der Predigt im Gottesdienst von St. Marien, als er Tony „mit starken Worten“ beeinflusst, Grünlich zu heiraten und dabei seine „Vorliebe für rabiate Ausdrucksweisen missbraucht.“ 524. Er unterstützt Jeans Bestreben nach der guten Partie für Tony, spricht von der Kanzel ein Machtwort und verhindert die individuelle Lebensgestaltung von Tony durch religiös-christliche Argumente.
In Pastor Kölling lässt Thomas Mann den seit 1829 an St. Marien wirkenden Pastor Johann Ägidius Ludwig Funk auferstehen. Dessen Predigten waren in Lübeck populär: Redegewaltig und unerschrocken wetterte er gegen den herrschenden Zeitgeist und trat für die Erneuerung des häuslichen familiären Lebens ein. Die Familie des Großvaters von Th. Mann im Haus Mengstraße war mit ihm befreundet.
- Pastor Pringsheim, der in Mimik, im Duktus der Rede und im Habitus zwischen Verklärung und Weltlichkeit wechselt, stellt eine Persiflage auf Paul Friedrich Ranke dar. Dieser hatte die Familie Mann in Lübeck als „verrottet“ bezeichnet, Thomas Mann überträgt diese Äußerung auf die Familie Buddenbrook.
- Pastor Mathias, Tränen-Tritschke, mit Pferdebacken und vielen Kindern, zeigt ein ganz und gar nicht vorbildhaftes Verhalten eines geistlichen Herren, stellt Tony nach und ist eine Verkörperung des Antiklerikalismus525; ebenso wie
- Sievert Tiberius, der Erbschleicher.
- Oberlehrer Ballerstedt ist ein Beispiel für den Einfluss der Kirche in der Schule, sein Stottern und die Liebe zum Lebensgenuss ließen ihn den Beruf des Lehrers (statt des Predigers) ergreifen, wobei seine Pädagogik und Bewertung ebenso fragwürdig sind wie sein Unterricht: Die Benotung des Sohnes von Kaufmann Kaßbau erfolgt durch die unsinnige Frage, ob Jesus links oder rechts um den See Genezareth gepilgert ist.
14.5 Religion im Familienroman des 20. Jahrhunderts
In den neuen Familienromanen findet sich so gut wie kein Hinweis auf Religiosität. Eine Vakanz der Religion in den modernen (Familien)Romanen ist auffällig, aber erklärbar:
Kirchen als Glaubens- und Sozialsysteme verloren seit Mitte des 19. Jahrhunderts an Bedeutung. Als Beispiel dafür sei die Zivilstandsgesetzgebung von 1874 genannt, die die kirchliche Trauung relativierte, aber auch der Gegensatz zwischen Kirche einerseits und Wirtschaft, Naturwissenschaft und Technik spielt eine wichtige Rolle. Der politische Liberalismus distanzierte die bürgerliche Oberschicht von der Kirche526 und bewirkte, dass das Wirtschaftsbürgertum sich in Beruf und Geschäft immer weniger vom kirchlichreligiösen Ethos leiten ließ.
Im Laufe des 20. Jahrhunderts verstärkte sich die Entkirchlichung und der Rückgang traditioneller kirchlicher Sitten. Wir leben in einer Zeit der modernen Religionslosigkeit, in der eine regelmäßige Teilnahme am kirchlichen Leben an Bedeutung verloren hat, auch wenn die formale Zugehörigkeit des überwiegenden Teils der Bevölkerung erhalten blieb.
Eine weitere Herausforderung für die Kirche bedeutet die veränderte Form der kirchenpolitischen Mitsprache von Laien innerhalb der Milieus und deren neues Selbstverständnis.
Glaube und Kirche und die berufliche und gesellschaftliche Rolle der Pastoren haben keine Relevanz mehr im österreichischen Roman von Arno Geiger.
(AG)
Alma, die das gesamte 20. Jahrhundert repräsentiert, zeigt eine wie auch immer artikulierte Kirchenferne und repräsentiert die Mehrheit der österreichischen Frauen: Religiöse Werte wie der Glaube an Gott sind für die Mehrheit der Österreicher von geringerer Bedeutung, nur noch 37% der Frauen sehen den Glauben als wichtig an.527 S. 369f
Sie fragt sich, warum man der abenteuerlichen Idee von Gott und dem ewigen Leben mehr Wahrscheinlichkeit zuspricht als der sehr viel einfacher, wenn auch nicht leichter zu denkenden Variante, dass es mit dem Tod aus und vorbei ist und dass (wir) nicht wieder auf die Füße zu fallen, und noch zum Tod hin das sich Klammern an die durch nichts bestärkte Hoffnung, dass es ewig so weitergehen wir…
Nicht einmal beim Tod ihrer Kinder ist Alma bereit, in der Religion Trost zu suchen:
S. 38
Vor allem ist Almas Bereitschaft, Dinge vor allem deshalb zu glauben, weil sich darin Trost finden lässt, eher gering. Wäre ja auch blödsinni…
Die mehrmals im Roman erwähnte Schutzengelfigur im Garten geht auf Richards Mutter zurück und dient dekorativen Zwecken. Sie wird von Jugendlichen zerstört, ein Zeichen für die fehlende Religiosität under mangelnden Achtung vor religiösen Zeichen:
S.67
Gleich wird der Kinderwagen auf Höhe der Schutzengelfigur, die Richards Mutter während des Krieges dort aufstellen ließ, den Garten erreichen …
S. 359
… sie springt auf das Sandsteinpodest, das ihr Lieblingsplatz ist, seit vandalierende Jugendliche die Schutzengelskulptur heruntergestoßen und ihr zum Gaudium beide Flügel abgebrochen habe…
Postmaterialistische Werte, die Relativierung von Normen und die Liberalisierung- und Emanzipationsbewegung in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts machten eventuelle Vorschriften der Kirche immer unbedeutender: Es verschwand der prinzipielle Anspruch auf die Dauerhaftigkeit einer ehelichen Beziehung, wie sie die Kirche vorschrieb, die Sexualität wurde durch moderne Verhütungsmittel von der Familiengründung entkoppelt, der Wunsch nach Selbstverwirklichung in Beruf und Freizeit führte zu Selbständigkeit und Unabhängigkeit der Frauen und einem neuen nicht mehr kirchlich-religiös geprägten Geschlechterverhältnis.
Lediglich die Rituale der in der Kindheit stattfindenden Sakramente finden noch Interesse: S. 303f
Deutlich vor Augen steht Peter auf Philipps Erstkommunion. Das war seltsam. Wenn er nicht wüsste, dass es so war, würde er nicht glauben, dass er seinerzeit Sprüche klopfte wie: - Mein Sohn trägt kein Mascher…
Und Ingrid sagt…
- Wenn dir die Erstkommunion auf die Nerven geht, ist das deine Sache, und jetzt hältst du dich besser zurüc…
„Heute. sind es in erster Linie ,Liebe‘ und ,Arbeit‘, die als säkulare oder Quasi-Religionen einen weltimmanenten Transzendenzbezug herstellen und den objektiven Sinnverlust wie auch die metaphysische Ungewissheit auszugleichen helfen.“528
(AG)
Ingrid und Peter erleben zunächst ihre Liebe zueinander und zu den Kindern:
S. 262
… schwingt Peter sich zu dem Bekenntnis auf, dass er sich ein Leben ohne sie drei nicht vorstellen könn…
S. 259
Sie denkt: Das einzig Gute, was dabei herausgekommen ist, sind die Kinde…
und später ihre Arbeit als Sinn im Leben:
S. 272
Sie liebt ihren Beruf. Es ist der Beruf, den sie haben wollt…
Da generell kirchliches Leben für einen großen Teil der Bevölkerung mit der Industriealisierung und der Säkularisierung unwichtig wurde, erlebte auch der Pfarrberuf einen immer stärkeren Bedeutungsverlust und veränderte das soziale Selbstverständnis des Pfarrers: Er wurde zum Verwaltungsbeamten, der aufgrund zeitlicher Belastung und des neuen beamtenähnlichen, neutralen Berufsverständnisses nur noch geringe soziale Kontakte zum gebildeten Bürgertum hatte.529 Seitdem verzeichnet man eine Entfremdung der gebildeten Bevölkerungsschicht von der Kirche.
„Der Beruf des Pfarrers erleidet einen Funktionsverlust. Je weiter. nun die Zeit fortschreitet und je vollkommener die Industriegesellschaft sich etabliert, desto deutlicher scheint zu werden, dass da für das Amt des Pfarrers kein rechter, jedenfalls kein selbstverständlicher Platz vorgesehen ist.“530 In unserer leistungsorientierten Gesellschaft wirkt ein Berufsstand ohne messbare Leistung, wie der des Pfarrers, fremdartig.
Und dennoch - es gelten weiterhin die Prinzipien der Christlichkeit. Religiöse Erziehung findet statt, zwar nicht mehr in form von kirchlichen Ritualen, aber im Rahmen einer christlichen Tradition, in der die Inhalte der 10 Gebote vom Respekt vor den Eltern, von Wahrhaftigkeit und Nächstenliebe weitergegeben werden, nicht zuletzt davon erzählt der DDR-Familienroman.
14.5.1 Religion und religiöses Leben in der DDR
In der DDR existierte nach dem Vorbild der UDSSR die religionskritische Utopie. Diese besagte, dass durch die Aufhebung der Entfremdung in einem kommunistischen Reich die Religion untergehen wird. In dieser Utopie galt der Sozialismus als das „Reich der Freiheit“, bezogen auf das Freisein von ökonomischen Zwängen. Mit dem Gemeineigentum an Produktionsmitteln war die Basis für soziale Gleichheit und Gerechtigkeit geschaffen, verbunden mit der staatsbürgerlichen Freiheit und Gleichheit. Diese Ideologie basierte auf der Grundlage des dialektischen Materialismus und war atheistisch - doch „allein durch ihre Existenz untergruben die Kirchen das ideologische Wahrheitsmonopol“.531
Bereits 1952 beschloss die SED, „dass der Aufbau des Sozialismus eine Intensivierung des Klassenkampfes verlange, weshalb man gegenüber der Kirche nicht mehr neutral sein könne. Insbesondere die Jugendarbeit in der evangelischen jungen Gemeinde stand wegen Westkontakten im Verdacht, staatsfeindlich gesinnt und aktiv zu sein.“ 532
Durch diverse Maßnahmen, z.B. Verhöre von Seiten der Schuldirektoren oder dem Verweis von christlichen Jugendlichen von den Oberschulen, versuchte die SED junge Christen zum Austritt aus der Gemeinde und zum Eintritt in die FDJ zu bewegen, eine Mitgliedschaft in beiden Organisationen war nicht möglich.
Laut Verfassung bestand zwar das Recht der Freiheit einer Religionsausübung, aber im Laufe der Zeit gelang es, christlich-religiöse Werte und Traditionen auf ein Minimum zu reduzieren, weil sich die Säkularisierung unter dem Einfluss der sozialistischen Politik immer mehr verstärkte. Ein entscheidender Schritt war die Einführung der atheistischen Jugendweihe und des Fachs Bürgerkunde, das von nun an den Religionsunterricht ersetzte, und eine Militarisierung der Gesellschaft. 1962 kam es zur Einführung der allgemeinen Wehrpflicht. Für die wenigen „Verweigerer“ gab es als Ersatzdienst den Einsatz bei den „Bausoldaten“, doch wer sich diesen zuteilen ließ, musste mit Schikanen während der Dienstzeit rechnen und damit, später eine Außenseiterrolle einzunehmen. „Auf ein Studium brauchte er nicht mehr zu hoffen und überall, wo es sich anzustellen galt, hatte er sich ganz hinten einzureihen.“533
Der Wehrdienst wurde von den Jugendlichen (Sascha) hingenommen, auch wenn oftmals die politische oder ideologische Lebenshaltung dazu fehlte. Bei den jungen Männern waren eher negative Erwartungen und Einstellung zum Wehrdienst verbreitet, sie hatten Ängste, an die Grenze zu müssen und Furcht vor der körperlichen Anstrengung, der Schikane und der Unterdrückung.
(ER)
S. 218
… Alexander zusammen mit Kalle Schmidt, dem die Hände zitterten, und Behringer, der schon mehrmals auf der Stube hatte verlauten lasse…
- Wenn die Arschlöcher mir wirklich an die Grenze lassen, hau ick ab…
Alexander war es ein Rätsel, wie er das durchhalten sollte, er wusste nicht einmal, wie er bis Weihnachten durchhalten sollt…
Andererseits gab es bei diesen jungen Menschen die Hoffnung auf den leichteren Erhalt eines Studienplatz nach dem Wehrdienst. So passten sich die meisten an, leisteten ihren Wehrdienst und lebten danach das normale Leben eines Zivilisten.
Kirchen und Pfarrer hatten bis zur Wende eine besondere Stellung und Bedeutung in der DDR. Der Pfarrer galt bis in die 60er Jahre als Repräsentant der kultivierten christlichen Lebensführung und wurde als Persönlichkeit und Seelsorger geachtet. Die Kirche drängte man zwar in den Bereich des Privaten, da der Staat allein auf die Lebensbereiche des Menschen Anspruch nehmen sollte, aber dies gelang nur begrenzt. Sie vermittelte in Gottesdiensten, Gesprächskreisen und der „Christenlehre“ weiterhin Sinndeutungen und Wertorientierungen, und diese ordneten sich nicht der Staatsideologie unter, z.B. der Glauben an eine höhere Macht.
Konfessionszugehörigkeit und Religiosität/Glaube an Gott korrelierten in der DDR: Nur 13,1% der evangelischen Christen glaubten n i c h t an eine höhere Macht.534
Traditionell war Ostdeutschland protestantischen Glaubens, die katholische Kirche hatte lediglich einen Anteil von 6,1% der Bevölkerung und stellte keinen Gegner für die sozialistische Partei dar, anders als in Polen. In der evangelischen Kirche gab es unterschiedliche Haltungen, die von der Loyalität mit dem SED-System bis zur Unterstützung von Oppositionsgruppen reichten. Man zeichnete sich durch eine Mittelstandsorientierung aus, d.h. kleinbürgerliche, kleinbäuerliche Handwerker, Angestellte, deren Kollektivierung erzwungen war und protestantische Flüchtlinge aus den Ostgebieten machten ein Gros der Kirche aus.535 In der Tradition der lutherischen Gewissensentscheidung lebte so manche protestantischen Familie in der geistigen Unabhängigkeit weiter, und hatte daran Anteil, dass sich in den 80er Jahren eine Opposition zum Staat im Freiraum der Kirche entwickeln konnte.
Bereits bevor 1969 der BE (der Bund der Evangelischen Kirche in der DDR) gegründet wurde, bildete die evangelische Kirche eine wichtige Integrationsklammer zwischen den beiden deutschen Gesellschaften. Westliche Landeskirchen hatten Partnerkirchen im Osten, es gab regelmäßige Besuche bei den Synoden oder sonstigen wichtigen kirchlichen Veranstaltungen und eine Anzahl von Partnerschaftsbeziehungen auf verschiedenen Ebenen. Ökonomische Unterstützungen von westlicher Seite bestanden aus dem Transfer von Warenlieferungen, Hilfen beim Aufbau zerstörter Kirchen und bei der Errichtung neuer kirchlicher Gebäude und Gemeindezentren, in der Jugendarbeit und bei der Besoldung kirchlicher Mitarbeiter - all das akzeptierte der DDR-Staat aufgrund seiner eigenen finanziellen Zwänge.
Eine Ähnlichkeit mit dem protestantischen Deutschland zeigte sich darin, dass auch in der DDR Frauen eine stärkere Kirchenbindung hatten als Männer, jedoch in den kirchlichen Repräsentationsorganen und in der Pfarrerschaft unterrepräsentiert waren.
Kirchen waren und sind als religiöse Institutionen moralische Anstalten, die Werte vermitteln.
BEK-Theologen neigten dazu, politische Probleme in einer moralisierenden Perspektive zu thematisieren, äußerten Kritik am Individualismus, an Konkurrenz, Leistungsdenken, Konsumismus, an der Sinnleere des Lebens in der kapitalistischen Massengesellschaft und bekannten sich zum Fortschritt der kirchlichen Vergesellschaftung in der DDR und deren Gemeinschaftlichkeit. „Die bürgerliche Privatisierung des Religiösen sei abgelöst worden durch eine weltoffene, sozial verantwortliche Kirchlichkeit... in der ,Zeugnis- und Dienstgemeinschaft’...“536. Man unterstützte den real existierenden Sozialismus und sah die sozialen Menschenrechte in der DDR, anders als in Westdeutschland, trotz der
Beseitigung der individuellen Freiheitsrechte verwirklicht. Viele der ostdeutschen Religionswissenschaftler waren der Auffassung, der gemeinsame sozialistische Aufbau habe Vorrang vor den individuellen Rechten.
In der Realität kam es dennoch seit den 50er Jahren zur Konfrontation zwischen Staat und Kirche, explizit als kommunistische Bildungsprinzipien in der politischen Machtausübung durchgesetzt wurden und man in der Jungen Gemeinde propagandistische Mittel und im Erziehungsbereich antikirchliche Sanktionen aufbot und 1958 die Jugendweihe einführte. Dies hatte zur Folge, dass der Mitgliederbestand der evangelischen Kirche auf 25%, der der katholischen auf 4-5% zurückging. Es begann eine Erosion der kirchlichen Gemeinden.
Innerhalb weniger Jahrzehnte wurde aus der protestantischen Volkskirche durch den drastischen Mitgliederschwund eine Minderheitskirche. Die von der SED erwartete Entfremdung der Jugend von der Kirche spiegelte sich dann mit den Jahren im zahlenmäßigen Rückgang der Gottesdienstbesucher, der Taufen und der kirchlichen Eheschließungen und im Anstieg der Zahl der Kirchenaustritte wider. Dieser drastische Schwund der Gläubigen ist sowohl der Benachteiligung der Christen in Schule und Beruf geschuldet als auch der ideologischen Stigmatisierung von Religion als überflüssiges und schädliches Relikt der Klassengesellschaft - nicht zu vergessen, spielte aber ebenso die Modernisierung der Gesellschaft mit ihrem wissenschaftlich-technischen Fortschritt eine Rolle. In der Kirche verbliebene Familien sprachen sich mit anderen kirchlichen Familien ab, bildeten Gemeinschaften und meldeten ihre Kinder an derselben Schule an, damit sie einander beistehen konnten, wenn Lehrer beginnen würden, sie aufgrund ihrer Religion auszugrenzen.537
Insbesondere in der Intelligenz vollzog sich die Abkehr von Religion und Kirche konsequenter als in anderen gesellschaftlichen Schichten, denn sie war per se kirchenkritischer.538
(ER)
Kurt ist hierfür ein Beispiel:
S. 303
Einen Augenblick überlegte Kurt, ob er das Thema „Gott“ ansprechen sollte - aber wozu? Und wie? Sollte er Sascha allen Ernstes fragen, ob er an Gott glaube? Schon das Wort klang, wenn man tatsächlich Gott meinte, nach Irrsin…
Mitgliedschaft in der Kirche wurde zu einer bewussten persönlichen Entscheidung und Kirchenzugehörigkeit damit immer unwahrscheinlicher, denn wenn die Teilnahme am kirchlichen Leben allein zum Gegenstand der individuellen Entscheidung wird, verschlechtern sich generell die Tradierungmöglichkeiten christlicher Lebensformen. Glaube ist stets das Ergebnis eines Bildungs- und Sozialisationsprozesses, bei dem Eltern, Kirche und Freunde eine wichtige Bedeutung spielen. In der DDR vermittelte aber niemand christliche Werte und auch eine religiöse Sozialisationsfunktion durch die Familie wurde nicht gesellschaftlich gestützt.
(ER)
Die Roman-Familie Umnitzer ist konfessionslos. Es gab in ihr durch die sozialistische Gesellschaftsstruktur kein christliches familiales Leben, und Sascha wird ebensowenig wie sein Sohn religiös sozialisiert, der sich in der Wende-Zeit abfällig über die Gebetsriten der Eltern äußert.
5. 85 (Sascha)
-Omi, aber in Wirklichkeit gibt’s keinen Got…
-In Wirklichkeit gibt’s keinen Gott, sagte Omi und erzählte, wie die Götter die fünfte Welt gründete…
S. 276 (Markus)
… aber er fand die Friedensandachten einfach grausam, dieses Alle-an-den-Händen-fassen-und zusammen-Singen, das ganze Getu…
S. 373
… und Muddel fand sowieso alles richtig, am liebsten hätte sie ihn, Markus, auch gezwungen, sonntags zur Kirche zu gehen, was sich jedoch mit Hinweis auf die im Grundgesetz garantierte Glaubensfreiheit vermeiden lie…
Allein die Großmutter praktiziert den russischen Glauben:
S. 150f
Dass sie Kirchen abgerissen haben, das war eine Schand…
Vielleicht, dass sie doch noch einmal zur Kirche ging, also zur orthodoxen, ein Stück konnte man mit der Straßenbahn fahren, und eine Kerze stiften für Sascha, auch wenn er nicht daran glaubte, vielleicht half es ja trotzdem, dass er endlich zur Ruhe kam, der Junge, oder sie gab mal was für die Kollekte, wenn’s daran lag. Geld hatte sie schließlic…
Man thematisierte Religiosität in anderer Weise: Religiöse Erziehung fand indirekt im Rahmen einer christlichen Tradition statt, indem man die Prinzipien der Christlichkeit mit den Inhalten der 10 Gebote weitergab und Werte wie der Respekt vor den Eltern, Wahrhaftigkeit, Nächstenliebe, Für-das-Gute-Dasein, Ehrlichkeit, Pflichterfüllung vorlebte und in subjektiver Entscheidung übernahm. Eine christliche Lebensführung mit der entsprechenden Traditionswahrung verlor zwar an Bedeutung, wurde aber abgelöst von einer subjektiven Innerlichkeit und einer Lebensführung nach den christlichen Werten.
Der Sinn des Lebens, so war es in den Büchern für die Jugend der DDR zu lesen, bestand darin, „für Fortschritt, Wahrheit, Gerechtigkeit zu kämpfen, gegen Ausbeutung, Unterdrückung und Lüge.“539 (ER)
In der Trauerrede zu Irinas Beerdigung hören wir davon.
S. 384
Dir waren die Menschen willkommen, an deine Tür klopften wir.Nausikaa nannte ich dich, sagte die Frau am Rednerpult.die Frau, aus antiker Zeit zu uns herübergekommen.von Kriegszügen, Verbannung, Völkerwanderung, diese Frau, die unlebbares Leben lebbar macht.dazu gehörtest du Irina. Das konntest du.Dein Tisch war ein Kunstwerk.Dein Tisch, die Gäste auffordernd, sich zu setzen, zu rede…
Die in der Kirche verbleibenden Mitglieder empfanden ein Verbundenheitsgefühl zu ihrer Kirche, ihre Bereitschaft zur Mitarbeit war aber dennoch nur etwa so groß bzw. gering wie im Westen.540 Die Kirchen bildeten kleine private Zirkel zur geistigen Auseinandersetzung, und repräsentierten das intellektuelle Sprachrohr bildungsbürgerlicher Kräfte.541
Die Gemeinde war für viele ein Ort des freien Geistes, eine Öffnung in der geschlossenen Gesellschaft des Sozialismus. Hier konnten Fragen und Themen diskutiert werden, die sonst tabu waren. Jugendlichen, die nicht politikkonform waren, hier stellte man kirchliche Räume zur Verfügung, ohne dass es einen staatlichen Einfluss gab. Der Bau der Mauer ließ die Parole „Wir schießen nicht auf Brüder“ laut werden. Sie fand viel Beifall bei den Christen, doch ließ der Staat allgemein, so auch hier, wenig Spielraum für Proteste, diskriminierte sie öffentlich. So konnten lsie nur noch im oben beschriebenen kirchlichen Milieu Zuflucht finden.
Die Observation der Kirche und der nicht staatlich gelenkten Gruppen machte aus Pfarrhäusern eine Alternativkultur, die zum Ausgangspunkt eines Dissidentenmilieus wurde, das mit den Jahren an Attraktivität gewann und für den Umbruch 1989 wesentliche Bedeutung hatte.542 Seit den späten 70er Jahren wanderten Gruppen von neuen sozialen Bewegungen mit Themen wie Ökologie und Frieden in die Kirche ein, wuchsen zu Umwelt- und Friedensgruppen an, verstärkten damit die Pluralisierung des DDR- Protestantismus und bewirkten eine politische Mobilisierung und Modernisierung der Kirche.
Bildungsstand und Kirchennähe korrelierten: So gehörten vor allem sozial-engagierte, politisch-motivierte und gebildete Jugendliche dazu, die den DDR-Verhältnissen kritisch gegenüber standen und sie verbessern wollten.543 Die Mehrheit der Bevölkerung war ihnen gegenüber negativ eingestellt. Intellektuelle vermissten den theoretischen dialektischen Anspruch, andere sahen in ihnen Wichtigtuer, die in den Westen wollten.544
In den 80er Jahren entspannte sich im Zuge der Liberalisierung des gesellschaftlichen Klimas das Verhältnis von Kirche und Staat. Die Evangelische Kirche bewegte sich jetzt, um eine Ausgrenzung zu vermeiden, in der Zone zwischen Anpassung, Kooperation und Widerstand. In ihr fanden oppositionelle Gruppen und regimekritische Künstler ihren Platz, gleichermaßen stellte sie für politisch motivierte, junge Menschen mit Interesse an Religion und Kirche eine politisch-ideologische Alternative dar. Nicht zuletzt wuchs in diesem Jahrzehnt so wie in Westdeutschland das Interesse an Gebet und Spiritualität bzw. an einem individuellen Frömmigkeitsstil.
(ER)
Diese Zeit hat auch in Saschas Leben ihre Wirkung gezeigt:
Auf seiner Reise ergibt sich mit zwei Schweizerinnen ein Gespräch über die aztekische Religion, und die Frage einer religiösen Erkenntnis bzw. Erlösung. Die beiden jungen Frauen sind in dieser Thematik von einer unbestimmten Toleranz geprägt:
Alles, was den beiden Schweizer Frauen so leicht und gleich (un)bedeutend erscheint, ist für Alexander bedeutungsgefüllt, aber er spricht es nicht aus. Sein spirituelles Erlebnis, in dem ihm Gott nahe schien, ist dem religiösen Erweckungserlebnis von Thomas Buddenbrook nicht unähnlich, erstreckt sich aber anders als im Buddenbrooks-Roman über mehrere Tage. Es kommt ihm auf seiner Reise in den Sinn: S. 237f
Erstaunlich, wie leicht ihnen das alles über die Lippen ging, wie mühelos uns selbstverständlich sie das alles zusammenbrachten, wie luftig, wie schwerelos diese neue Weltreligion wa…
Er erinnert sich an eine religiöse Erfahrung oder Transzendenzerfahrung im Winter 1979, als er sich mit seinem Vater traf. Er erinnert sich jedoch an seine Erfahrung des Unaussprechlichen: an seine eigene, schwierige, verrückte, gewaltsame Begegnung mit ebenjenem, damals, in diesem Winter, dem Jahrhundertwinter . Er versuchte sich zu erinnern: an den Moment, als es - ja, was eigentlich? - ihn berührte oder sich ihm zuwandte oder sich zu erkennen gab? Er weiß es nicht mehr.und er erinnert sich an das Danach, an ein Gefühl der Erlösung, der Einsicht. Körperchemie? Heller Wahnsinn? Oder der Moment der Erleuchtung? Tagelang war er danach mit dem Lächeln eines Verzückten durch die Straßen gegangen, jede rostige Laterne war ihm wie ein Wunderwerk erschienen.hatte Glücksgefühle ausgelöst, und in den Augen der Kinder, die ihm, dem Lächelnden, ungehemmt ins Gesicht schauten, hatte er es mehr als einmal gesehen: das, wofür ihm, dem atheistisch Erzogenen, kein Wort zur Verfügung stand. Soll er lernen, die Botschaft endlich anzuerkennen? Den Namen zu nennen, der den beiden Schweizerinnen so leicht über die Lippen geh…
Man darf aber in diesem Zusammenhang eins nicht vergessen: Stieg auch die Zahl der Getauften insbesondere bei jungen Erwachsenen an, gab es andererseits viele Jugendliche, die nicht politisch-kirchlich aktiv waren, sich aus der Gesellschaft zurückzogen und lediglich ihre materielle Situation zu verbessern suchten. Kirchlichkeit dagegen war stets verbunden mit unkonventionellen Lebensstilen und Einstellungen, wie z.B. an einer geringeren Orientierung am Konsum und der Bedeutung von Gleichaltrigengruppen bei der Vermittlung religiöser Inhalte.
In den 80er Jahren existierte in der Kirche bekanntermaßen ein bedeutender Raum für regimekritische Debatten, die letztendlich 1989 zur „Protestantischen Revolution“ führten.545 Aus der Diskussion um die Erhaltung des Friedens entwickelte sich eine Bürgerbewegung als eigenständige politische Kraft, keine Bewegung der Jugend, sondern der 30-40Jährigen, die aus den o.g. kirchlichen Friedens- und Umweltgruppen kamen und christlich geprägt waren. Die Kirche engagierte sich bereits aus ihrer christlichen Mission heraus für die Erhaltung des Friedens 546 und ihre Aktion ,Schwerter zu Pflugscharen’ von 1981/82 löste eine auch in der Öffentlichkeit zwar wahrgenommene aber von der Mehrheit der DDR Bürger nicht ernst genommene Oppositionsbewegung aus.
Unterschiedliche Gruppen trafen in dieser Zeit in Kirchenräumen aufeinander: Manche wollten die DDR in eine gerechte und humane Gesellschaft mit sozialistischer Prägung verwandeln, hatten reformsozialistische Gedanken eines demokratischen Kommunismus, andere waren illusionslos und glaubten an keine Veränderung im Sozialismus, sie wollten die Konsumgesellschaft des Westens, um sich die eigenen Wünsche zu erfüllen. Zunächst bildete sich eine kleine Opposition, der es noch an prominenten Künstlern, Schriftstellern oder Wissenschaftlern fehlte, denn es war so: Wer dort aktiv war, zahlte einen hohen Preis, indem er auf bürgerliche Normalität, auf berufliche Karriere und familiäre Unbeschwertheit verzichtete.547 Trotzdem entwickelte sich diese mehr Demokratie fordernde Bewegung als politische Kraft, von der aus sich die Bürger immer weniger vom Staat bevormunden und drangsalieren ließen. Die Machtübernahme von Michail Gorbatschow vermehrte die Mitglieder dieses politischen Milieus, das nun Glasnost und Perestroika für die DDR forderte. Auch wenn niemand die Forderung nach Abschaffung der DDR stellte, man wünschte sich eine Änderung der SED-Diktatur mit sozialistischen Idealen.
Die friedliche Revolution von 1989 war dann vermehrt getragen von protestantischen Pfarrhäusern, die sich eine Distanz zum Regime und eine Eigenständigkeit bewahrt hatten. Ihnen schlossen sich mehrere Alterskohorten von in der DDR Geborenen an, keine Bürger im politischen Sinn, aber alle mit dem Gefühl, eingesperrt und zu kurz gekommen zu sein. Es war im Sinne des Projekts der bürgerlichen Gesellschaft eine Demonstrationsbewegung für bürgerliche Werte wie Individualität, Partizipation, Freiheit.548 Diese Menschen hatten die politische Vision einer bürgerlichen Gesellschaft, wenn ihnen auch das Ideal bürgerlicher Existenz und deren Kultur- und Gesellschaftsformen fremd war.
Zu ihnen gehört Klaus, ein Pfarrer, der Friedensandachten organisiert: (ER)
S. 276
- Klaus ist nicht gegen die DDR, sagte Muddel. Klaus ist für eine bessere DDR, mit mehr Demokrati…
- Und warum ist er dann Pfarre…
- Warum denn nicht, sagte Muddel. Jeder kann sich einsetzen für mehr Demokratie. Als Pfarrer kann er zum Beispiel Friedensandachten organisieren. Markus hatte keine Lust, das Thema fortzusetzen, er spürte schon, wie Muddel ihn wieder überzeugen wollte, aber er fand die Friedensandachten einfach grausam, dieses Alle-an-den-Händen-fassen-und zusammen-Singen, das ganze Getue, und hinterher pennten alle bei ihnen auf dem Grundstück, soffen sich einen an und pissten in die Tomaten: für eine bessere DDR. Wie das gehen sollte, blieb sowieso ein Rätsel.Als sich die DDR-Führung einer Änderung verschloss, kam es zu Unmut in der Bevölkerung. Gleichzeitig brachte dies den alternativen Gruppierungen noch mehr Zulauf, denn es war allein die Kirche, die in dieser Zeit Freiräume bot, um eigene Wünsche und Ziele zu diskutieren.
(ER)
Ein Beispiel dafür ist Melitta, Saschas frühere Partnerin, die Mutter seines Sohnes: Bereits früher gehört sie, ihrer Kleidung nach, einer alternativen Bewegung an:
S.251
Allerdings waren die flachen, gurkenähnlichen Schuhe, die die Neue trug, ohnehin kaum von Hauspantoffeln zu unterscheide…
S. 253
… über den langen braunen Cordrock, die braunen Wollstrumpfhosen - und was trug sie da eigentlich obenherum? Etwas Unförmiges, Unfarbenes. Und wieso, wenn sie schon kurze Beine hatte, trug sie nicht wenigstens hohe Schuh…
Später besucht sie dann die Treffen in der kirchlichen Gemeinde und begegnet ihrem späteren Ehemann. Er ist Teil der protestantischen Revolution in der DDR, in der Pfarrer, Gebete und Kerzen eine tragende Rolle spielten (auch wenn zu dieser Zeit nur 19% der Ostdeutschen evangelisch, 9% katholisch und die Mehrheit konfessionslos war 549).
S. 273
Schon von weitem hörte er das Probengeklimper, das aus der Kirche kam, er brauchte nicht aufzuschauen, um zu wissen, wen Muddel grüßt…
- Nanu, rief Klaus. Wohin soll es denn gehe…
Klaus war der Pfarrer…
- Aber ihr kommt doch heute Abend zur Friedensandacht, sagte Klau…
Melitte verkörpert den Teil ostdeutscher Frauen, für die das Engagement in der christlichen Kirche mit einer höheren Stabilität in der Partnerschaft verbunden ist, wohingegen konfessionslose Frauen ein größeres Trennungsrisiko haben.550 Nach der Heirat mit Klaus, dem evangelischen Pfarrer, ist der Bezug zur Kirche und die Besonderheit des Sonntags als Familientag existentiell:
S. 376
… wo er am Sonntagmittag in seinem Zimmer aufwachte, genauer gesagt, geweckt wurde, nämlich von Muddel, die gerade vom Gottesdienst kam.…
Kaum vermeiden ließ sich dagegen der anschließende „Familientag“, mal schön zusammen kochen, solche Sachen, oder, ganz übel, Ausstellung zusammen besuchen…
14.5.2 Der Kommunismus und die Partei als Erlösungsorgan und Religionsersatz
„Da in der DDR der Kommunismus und mit ihm auch der Sozialismus zur neuen Religion erhoben worden war, brauchte es auch Rituale. Deshalb versuchte man verschiedene Lebensabschnitte festlich voneinander zu trennen.“ 551 Das erste Bekenntnis zum Sozialismus wurde von den Eltern bei der Namensweihe geleistet, die dabei versprachen, ihr Kind zur sozialistischen Persönlichkeit zu erziehen. Diese Namenseihe, die nie wirklich etabliert war und auch zum Ende der DDR hin kaum noch praktiziert wurde, hatten die Betriebe auszurichten, „die hatten darauf wenig Lust. Es kostete Geld und band Arbeitskraft. Manchmal mussten die Betriebe von höherer Instanz zu ihrem sozialistischen Glück gezwungen werden“.552 Dagegen kam das zweite Bekenntnis, die Jugendweihe, einer Notwendigkeit gleich: Das Kind legte es selber mit 14 Jahren, in der 8. Klasse ab und wurde damit in die Welt der Erwachsenen aufgenommen. Sie gelobten, sich „mit ganzer Kraft für die große und edle Sache des Sozialismus einzusetzen“. Wer die Jugendweihe nicht empfing, musste mit Demütigungen und Sanktionen rechnen und durfte kein Abitur machen. Weiterhin gab es die sozialistische Heirat und eine im Namen der neuen Staatsreligion abgehaltene Totenfeier.
Statt einer kirchlich-religiösen Glaubensform anzugehören, stellte für überzeugte Sozialisten/Kommunisten die Partei eine Erlösungsreligion mit Glaubenssätzen, Geboten, Kirchenvätern, Häretikern und einer allmächtigen Inquisition dar. Sie war für viele Menschen Familie, Heimat und Gemeinschaft und betonte die Wichtigkeit des Einzelnen. Besonders für die ältere Generation galt sie als der Körper einer transzendentalen Erlösungsidee.553
Wilhelm singt die Partei-Hymne, in der dies zum Ausdruck kommt:
„Die Partei, die Partei, die hat immer Recht.
Sie hat uns alles gegeben, Sonne und Wind, und sie geizte nie,
und wo sie war, war das Leben,
und was wir sind, sind wir durch sie.
Sie hat uns niemals verlassen,
und wenn die Welt fast erfror, war uns warm.
Uns führte die Mutter der Massen, es trug uns ihr mächtiger Arm...
Sank uns im Kampf einmal der Mut, so hat sie uns leis nur gestreichelt: Zagt nicht! - und gleich war uns gut.“
Diese Partei war in der DDR die SED. Parteimitgliedschaft führte zum Erfolg, denn allein sie entschied über Stellenbesetzungen und eine höhere Position in der Wirtschaft, in Wissenschaft und Kultur.
(ER)
Kurt dagegen zweifelt diese parteiliche Wahrheit an:
S. 343
Die Wahrheit ist nicht etwas, das die Partei besitzt und an die Bevölkerung als eine Art Almosen austeiltIm Grunde, dacht er, war es die kürzeste Formel für das gesamte Elend. Im Grunde genommen, dachte er, war es die Rechtfertigung allen Unrechts, das im Namen der „Sache“ begangen worden war, die Verhöhnung von Millionen Unschuldigen, auf deren Knochen dieser Sozialismus errichtet worden war: die berühmte Parteihymne, die irgendein Waschlappen von Dichter (war es Becher oder war es Fürnberg?) sich zu dichten nicht entblödet hatt…
Ein Eintritt in diese Partei begann mit einem Antrag, der von einer übergeordneten Leitung geprüft wurde. Entschied diese positiv über die Aufnahme, begann im Anschluss die Kandidatenzeit, in der sich der Kandidat in der gesellschaftlichen und beruflichen Arbeit bewähren musste. Die Herkunft spielte insofern eine Rolle, da 75% der Mitglieder aus der Arbeiter- und Bauernschicht kommen sollten.
Der feierliche Akt der endgültigen Aufnahme war ein Verhör über Familienangelegenheiten und ideologische Abweichungen. Man durfte vor der Partei keine Geheimnisse haben, ideologische Sünden mussten bei Befragungen vor der höheren Leitung der Partei ,gebeichtet’ werden. Genossen hatten einen unbescholtenen Lebenswandel zu führen, und nicht selten verhandelte man Vorfälle aus dem Privatleben vor der Parteiversammlung. Es galt der Grundsatz, dass ein Genosse stets Rechenschaft ablegen musste554, und so war es nicht verwunderlich, dass es zu regelrechten Tribunalen und Hexenprozessen in Anwesenheit von Mitgliedern übergeordneter Leitungsgremien kommen konnte.
Ein Netz von Überwachungsorganen übte in verschiedenen Formen Kontrolle aus. Kollegen, Nachbarn und Freunde halfen als Schnüffler und Zuträger mit bei der Kontrolle und Denunziation von Bürgern, die sich Übertretungen oder Abirrungen zu schulde kommen ließen, und trugen so zur Zerstörung von Leben bei.
Als Folge davon versuchte jeder im Alltag, nicht negativ aufzufallen.
Im Buch von Ruge lesen wir von einem Vorfall, in dem der Genosse Rohde aus der Partei ausgeschlossen, fristlos entlassen wird und damit erledigt ist. (S. 171/179)
Um unehrliche Elemente auszuschließen, fanden Parteisäuberungen dieser Art des öfteren statt, und kam es dann letztendlich zum Parteiausschluss, bedeutete das eine schwere Stigmatisierung für die betreffende Person: Sie wurde aus der Gemeinschaft ausgestoßen, verlor den Arbeitsplatz und wurde dienstlich degradiert und ins soziale Abseits abgeschoben.
In der Gesellschaft der DDR spielte in diesem Zusammenhang die Staatssicherheit eine besondere Rolle, 1975 gab es 180 000 aktive IM, sie lieferten als Spitzel Informationen über das Sozialverhalten und die politische Meinung der Bürger an die Obrigkeit.555
Die Führung der SED war rein patriarchalisch strukturiert, ohne Besetzung durch eine Frau - eine Parallele zur religiösen kirchlichen Gemeinschaft. Bei insgesamt elf Parteitagen und drei Parteikonferenzen in den 40 Jahren der DDR trafen sich die Mitglieder mit viel Pomp, Aufwand und Ritualen im Palast der Republik.
Die Macht lag im Zentralkomitee (ZK) als dem höchstem Organ der SED, das sich aus Mitgliedern mit vollem Stimmrecht und Kandidaten mit Beraterstatus zusammensetzte, darunter die Vorsitzenden der Massenorganisationen und hohe Offiziere; alle mussten mindestens sechs Jahre Mitglied in der Partei sein.
Das ZK wiederum wählte das mächtige Politbüro, das alle wichtigen Fragen entschied. Dies ernannte wiederum die Zentrale Parteikommission (ZPKK), die für die Untersuchung und Bestrafung von Parteifeinden und Parteimitgliedern zuständig war und Fälle von Korruption untersuchte
Eine Transparenz ihrer Handlungen war bei der SED Führung nicht zu finden, stattdessen gab es eine Geheimhaltung in allen parteilichen Organisationen. Wer Wissen haben sollte, das wurde streng hierarchisch geregelt, Funktionäre auf mittleren Ebenen bekamen nur gefiltertes Material zugeteilt.
Wie liefen die „Wahlen“ ab? In Wählerversammlungen stellten sich die Kandidaten vor, Wahlbenachrichtigungskarten wurden von im Ort bekannten Mitgliedern der Wahlkommission ausgeteilt. Bei der Gelegenheit konnten Bürger auf örtliche Probleme aufmerksam machen. Im Wahllokal ging man zur Urne und warf den Zettel hinein. Dies ereignete sich sogar noch im Mai 1989. „Die Mischung aus Angst, Gleichgültigkeit und politischer Indoktrination erklärt das Verhalten nur teilweise. Es bleibt ein irrationaler Rest, ein im Menschen offenbar tiefverwurzeltes Streben nach Einklang mit den Herrschenden, eine Freude an der Unterwerfung und der kollektiven Demütigung von Außenseitern.“556 (ER)
Im Buch drängt Wilhelm seine Mitbürger mit Drohungen zur Wahl:
S. 1…
Zu den letzten Kommunalwahlen hatte er eine mobilisierte Einsatzstaffel organisiert, um denjenigen, die am frühen Nachmittag immer noch nicht gewählt hatten, Agitatoren auf den Hals zu schicken: Den ganzen Rasen hatten diese Trottel zerfahre…
S. 93
- Aber Achim Schliepner ist dumm. Der sagt, dass Amerika das größte Land der Welt is…
- Aha, sagte Wilhelm, interessan…
Und zu Omi sagte e…
- Und gewählt haben die auch wieder nicht, die Schliepners. Aber die kriegen wir auch noch dra…
Neben der SED existierten zwar noch die sog. Blockparteien, wie die CDU, die sich der Kirchenfeindlichkeit und dem Atheismus der SED widersetzte, sich aber dennoch stets zur DDR bekannte. 1990 stand sie dann an der Seite Helmut Kohls, und das honorierten die Wähler.
Die ,Bibel‘ für die Parteimitglieder war das ,Neue Deutschland’, das Zentralorgan der SED und dessen Stimme; ein trockenes Staatsblatt, das auf die Exil-Zeitung in Mexiko zurückging und bereits damals von Charlotte als eine Vereinigung von Partei und Presse erkannt wird:
(ER)
S. 36
Aber auch Charlotte fühlte sich zur Teilnahme verpflichtet. Die Redaktionssitzung war einmal die Woche, und man wusste nicht recht, ob sie nicht gleichzeitig auch Parteiversammlung war. Je kleiner die Gruppe wurde, desto mehr vermischte sich alles: Parteizelle, Redaktionskomitee, Geschäftsführun…
Für Wilhelm als treuen und langjährigen Kommunisten stellte das ,Neue Deutschland’ bis zu seinem Tod die einzige Lektüre dar, aus ihr bezieht er sein politisches Wissen und seine politische Meinung, gelesenen Artikel werden von ihm ausgestrichen:
S. 38
Am Wochenende las Wilhelm, wie stets, das ,Neue Deutschland', das immer im Packen und mit vierzehntägiger Verspätung aus Deutschland kam. Da er weder Spanisch noch Englisch konnte, war das ND sein einziger Lesestoff. Er las jede Zeile …
Zu Ehren seiner 70jährigen Parteimitgliedschaft und seines 90. Geburtstag findet sich im ND ein Zeitungsartikel:
S. 189
Es war Sonntag. Am Sonntag gab es keine ND. Früher hatte es auch am Sonntag ND gegeben, aber das hatten sie abgeschafft. Schlamasse…
,Ein Leben für die Arbeiterklasse!'. … Darunter ein Bild, auf dem ein Mann mit kahlem Schädel und großen Ohren zuversichtlich in die Zukunft blickt…
Auch Kurt hat als kommunistischer Schriftsteller und Historiker in der DDR im ND Artikel veröffentlicht:
S. 302
… und die Tatsache, dass dort hin und wider Gedanken von ihm durch eine Druckerpresse gingen, erfreute ihn irgendwie, auch wenn seine Artikel im ND, um die er meist anlässlich irgendwelcher historischer Jubiläen gebeten wurde, bestimmt nicht zu seinen wissenschaftlichen Glanzstücken gehörte…
Allerorts herrschte Zensur: in den Artikeln der Zeitung wie bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die von den Instanzen der Kultur und Wissenschaft genehmigt werden mussten. Entscheidungsträger verhielten sich oft eher vorsichtig, wenn es um die Genehmigung von ideologisch nicht ganz einwandfreien Texten ging.
In der Klasseneinteilung der Autoren und Bücher standen die proletarisch-revolutionären, historisch-progressiven Bücher an erster Stelle. Sie wurden verbreitet, wohingegen man Bücher und Autoren mit „bürgerlicher Ideologie“ nicht förderte (wie z.B. Gustav Freytag) und mit dem Verdikt „Bürgerlichkeit“ abwertete.
Es galt als ein Kriminaldelikt, „staatsfeindliche“ Literatur zu veröffentlichen, und erst in den 80er Jahren sollte es Lockerungen innerhalb der Zensur geben.557 (ER)
Charlottes Buchrezension ist ein Beispiel dafür, wie literarische und wissenschaftliche Neuerscheinungen in der DDR der ideologischen Prüfung unterlagen: Werke der (Welt)Literatur enthielten pädagogisch und ideologisch gefärbte Vor- und Nachworte und lieferten damit politisch-ideologische Einschätzungen, nicht politikkonforme Literatur und Autoren wurden politisch und moralisch abgewertet.
S. 126f
Ihr Haupteinwand war jedoch politischer Art. Das Buch war negativ. Defätistisch. Es zog den Leser in dunkle Sphären hinunter, machte ihn passiv und kleindieses Buch eignet sich nicht, um die Jugend zu einer weltzugewandten, humanistischen Haltung zu erziehen.Es eignet sich nicht, um den Glauben an den Fortschritt der Menschheit und den Sieg des Sozialismus zu fördern und deswegen gehört es nicht in die Regale der Buchläden unserer Republi…
Die „allmächtige“ Partei zeigte bereits mehrere Jahre vor der Wende eine schleichende politische Ohnmacht. Das Volk machte sie für die offensichtlich fehlende Planerfüllung, den wirtschaftlichen Niedergang, die schlechte Versorgung und die verfallenen Innenstädte allein verantwortlich und verlangte Partizipation.
Der Artikel 27 der Verfassung der DDR billigte dem Bürger zwar das Recht zu, „den Grundsätzen dieser Verfassung gemäß seine Meinung frei und öffentlich zu äußern“, doch kritisches Denken wurde geahndet und so blieb als Möglichkeit der Meinungsäußerung allein der politische Witz. Er signalisierte eine Distanz zum System und war ein Gradmesser für die politische Stimmung im Land. In ihm konnte man Fehler im System aufspießen und man konnte sicher sein, dass Anspielungen von der Öffentlichkeit zumeist erkannt wurden.
Im Roman wird die aztekische Kultur mit ihrem Machtanspruch des Staates und einer Religion, die das Gesellschaftsideal repräsentiert, in Bezug gesetzt zum Sozialismus. Beide Kulturen zerbrechen trotz ihrer totalen Verfügungsgewalt über den Menschen.
Auf S. 45 warnt Adrian Charlotte:
„Der Kommunismus, Charlotte, ist wie der Glaube der alten Azteken: er frisst Blut…
Die religiöse Statue Coatlicue, die aztekische Totengöttin, steht für den Kommunismus: Sie wirkt auf den Menschen anziehend, verlangt aber Opfer.
S. 39f
Schon lange hatte Adrian ihr die Kolossalstatue der Coatlecue zeigen wollen. Er hatte ihr oft von der aztekischen Erdgöttin erzählt und sie kannte bereits ein Foto: eine grausige Figur: Ihr Gesicht war auf merkwürdige Weise aus zwei im Profil zu sehenden Schlangenköpfen zusammengesetzt, sodass ein Auge und zwei Zähne einer Schlange gehörten.Sie hatte eine mannshohe Statue erwartet. Vorsichtig wanderte ihr Blick hinaus in vier Meter Höhe. Sie schloss die Augen, wandte sich a…
Charlotte spricht mit Alexander über die aztekische Religion:
S. 85f
Das letzte Mal hatte sie erzählt, wie die Azteken durch die Wüste gewandert waren. Heute fanden sie die verlassene Stadt, und weil niemand dort wohnte, glauben die Azteken, hier seien die Götter zu Hause, und nannten die Stadt: Teotihuacan - der Ort, wo man Gott wir…
Es findet sich eine rechtfertigende Aussage, die auf die Erlösungsfigur Jesus Christus anspielt.
S. 86
… und die Götter versammelten sich, um zu beraten, und sie kamen zu dem Schluss: Nur wenn einer von ihnen sich opferte, würde es eine neu Sonne gebe…
Einer musste sich opfern, damit das Leben der anderen weitergeht. Vielleicht zeigt sich hierin ein Versuch der Verdrängung, eine Angst vor der Wahrheit oder ein Rechtfertigungsversuch.
Erst in der Nacht von Wilhelms Tod gibt Charlotte ihre Distanzhaltung auf und lässt die Statue in ihrer ganzen Wucht auf sich einwirken. Sie erinnert sich an Adrian und die aztekische Göttin, in deren Kette aus menschlichen Herzen sie in ihrer Vorstellung auch das Herz ihres ermordeten Sohnes Werner zu erkennen glaubt.
S. 406
Nun war Adrian wieder da, lächelte. Berührte sie sanft, drehte sie um - und Charlotte spürte, wie sich ihre Nackenhaare aufrichteten: Coatlicue, Göttin des Lebens, des Todes. Coatlicue mit dem Zwei-Schlangen-Gesicht. Mit ihrer Kette aus ausgerissenen Herzen. Und eins davon, dieses dort, wusste sie, war Werner…
15. Bildung als bürgerlich-kulturelle Praxis
Der Mensch ist, was er als Mensch sein soll, erst durch Bildun…
(Georg Wilhelm Friedrich Hege…
Die nachfolgenden Erläuterungen betreffen eine Kerntugend des Bürgertums: die Bildung. Wirtschafts- und Bildungsbürgertum vereinte in ihrem Entwurf einer Bürgerlichen Gesellschaft ein Konzept der Bildung, in dem Wissen und Können, Leistung und Verdienst des Einzelnen die bisherige Privilegierung des Adels ersetzte.
Während Pestalozzis Bildungsprogramm Schul- und Volksbildung als Menschenbildung umfasste, reduzierte sich das Bildungsverständnis des Bürgertums nicht nur auf Erziehung, sondern wurde „zur Angelegenheit der weltlichen Vernunft“.558
Bildung wurde als ein permanenten Prozess der Selbstverkommnung betrachtet.559 Es galt die Grundannahme: Der Mensch entwickelt sich zur gebildeten Persönlichkeit, wenn er seine Potenziale und Talente ausschöpfte. Bildung meinte demnach nicht das Auswendiglernen von Wissen, sondern zielte auf eine immerwährende Entwicklung des Einzelnen, auf die Ausbildung individueller Fähigkeiten und die Ausformung der inneren Werte. So entsprach z.B. eine Reise, die dem Menschen neue Erfahrungen vermittelte, dem Bildungsziel, eine bürgerliche Persönlichkeit zu werden.
Bildung meinte die „Zivilisierung“ des Selbst und hieß, eine „bürgerliche“ Balance zu entwickeln in der Freisetzung von Emotionen und ihrer inneren und äußeren Kontrolle und Beherrschung.560. Der Bürger lehnte sich an die Aufklärung an und war im Bund mit der Ratio, sie bestimmte die bürgerliche Mentalität und das hieß: die Affekte waren zu beherrschen.
(TM)
Thomas B. wird als ein Mensch wahrgenommen, für den die affektive Beherrschung von großer Wichtigkeit ist, seiner Schwester gegenüber verliert er kurzzeitig die Contenance wegen des Ernteaufkaufs von Herrn von Maiboom:
S. 477
Seiner Schwester, Frau Permaneder, aber verriet sich Thomas an einem Donnerstag Abend auf der Straße, als sie sich mit einer Anspielung auf die Ernte von ihm verabschiedete, durch einen einzigen kurzen Händedruck, dem er hastig und leise die Worte hinzufügte: „Ach, Tony, ich wollte, ich hätte schon wieder verkauft!“ Dann wandte er sich, jäh abbrechend zum Gehen.Dieser plötzliche Händedruck hatte etwas von ausbrechender Verzweiflung, dieses geflüsterte Wort so viel von lange verhaltener Angst gehabt…
Als aber Tony bei der nächsten Gelegenheit versucht habe, auf die Sache zurückzukommen, hatte er sich in desto ablehnenderes Schweigen gehüllt, voll Scham über die Schwäche, mit der er sich einen Augenblick hatte gehen lassen, voll Erbitterung über seine Untauglichkeit, dies Unternehmen vor sich selbst zu verantworte…
Man kann durchaus sagen, dass für den Bürger eine Bildungspflicht bestand. Langeweile und Müßiggang lehnte er ab, als Kerntugenden der Bildung galten Arbeitsfleiß, Leistungsorientierung und Pflichtbewusstsein - eine Affinität zu den protestantischen Werten, die Thomas Buddenbrook lebt:
S. 418
Die Anforderungen aber wuchsen, die er selbst und die Leute an seine Begabung und seine Kräfte stellten. Er war mit privaten und öffentlichen Pflichten überhäuft. Bei der „Ratssetzung“, der Verteilung der Ämter an die Mitglieder des Senates, war ihm als Hauptressort das Steuerwesen zugefallen. Aber auch Eisenbahn-,Zoll- und andere staatliche Geschäfte nahmen ihn in Anspruch, und in tausend Sitzungen von Verwaltungs- und Aufsichtsräten, in denen ihm seit seiner Wahl das Präsidium zufiel, bedurfte es seiner Umsich…
Funktionale und ästhetische Bildung sollten als ein elitäres Qualifkations- und Unterscheidungsmerkmal den Einzelnen zu einem nützlichen Glied der bürgerlichen Gesellschaft machen, Gemeinnützigkeit hatte das Verhalten zu prägen und als Kaufmann hieß dies, die Tugenden des Fleißes und der Redlichkeit, aber auch der Sparsamkeit vorzuleben.
(TM)
Jean Buddenbrook rechnet seiner Frau die Ausgaben und Einnahmen der Firma vor, um sie über die Verhältnisse aufzuklären:
S. 78f
Jedoch. wir dürfen damit nicht allzu unvorsichtig rechnen. Ich weiß, dass dein Vater ziemlich peinliche Verluste gehabt hat . ich meinerseits verlasse mich in der Hauptsache darauf, dass der Herr mir meine Arbeitskraft erhalten wir…
15.1 Geschlechtscharaktere
In Bildung u n d Erziehung bzw. in der Sozialisation gab es in der bürgerlichen Zeit eine weibliche und männliche Variante. Sie unterschieden sich extrem von einander und hatten ihre Grundlage in der damaligen Auffassung vom Geschlechtscharakter, in dessen Folge sich die Entwicklung von Jungen und Mädchen spaltete: Erstere gingen frühzeitig aus dem Haus, Letztere blieben dem Haus verhaftet, um ihre Rolle als Hausfrau und Mutter einzuüben.
In der Bildung galt der „Geschlechtscharakter“ von Mann und Frau als die „Entfaltung der Menschlichkeit schlechthin“.561
Aufgrund der biologischen Unterschiede im Zeugungsprozess und den körperlichen Differenzen sah man die dichotomischen „Geschlechtscharaktere“ als von der Natur gegeben und polar.562
Dem Mann schrieb man Eigenschaften der Aktivität, Kraft, Energie, Mut und Tapferkeit, d.h. kriegerisch-aktive Eigenschaften und Vernunftorientiertheit zu, demgegenüber galten als weibliche Merkmale die Sanftheit, Emotionalität, Passivität, Schönheit, Bescheidenheit, Hingebung und Fürsorglichkeit.563 Für ihn ergaben sich Geschlechtsspezifika:im Bereich desTuns(Selbständigkeit, Zielgerichtetheit, Durchsetzungsvermögen) und derRationalität(Geist, Verstand, Denken, Vernunft), für die Frau: im Bereich desSeins(Abhängigkeit, Liebe, Güte) und derEmotionalität(Gefühl, Religiosität, Verstehen) mit denTugendender Schamhaftigkeit, Liebenswürdigkeit, des Taktgefühls, der Anmut und Schönheit.564
(TM)
Tony ist das Beispiel einer sehr emotionalen Frau, die ihre Gefühle freimütig äußert:
S. 609
… ,und hie und da führte ihr Weg sie notwendig an den rasch aufs Vorteilhafteste vermieteten Läden und Schaufenstern des Rückgebäudes oder der ehrwürdigen Giebelfassade andererseits vorüber, … dann aber begann Frau Permaneder-Buddenbrook auf offener Straße und angesichts noch so vieler Menschen einfach laut zu weine…
Lediglich als es um ihre Gefühle und ihre Liebe zu Morten geht, ordnet sie sich der Familienehre und dem Willen ihrer Eltern unter:
S. 158
Gerade als Glied in der Kette war sie von hoher und verantwortungsvoller Bedeutung., - berufen, mit Tat und Entschluss an der Geschichte ihrer Familie mitzuarbeite…
Rousseau als der meist gelesene Pädagoge des bürgerlichen Zeitalters war der Auffassung, dass biologische Unterschiede sich auf die Geistesanlagen auswirken, d.h. dass z.B. die Werke des Geistes das Fassungsvermögen der Frauen übersteigen und man ihnen deshalb eher praktische Pflichten zuordnen sollte.565 In seinem Roman „Emile“ bekommt die Romanfigur eine Gefährtin mit Komplementärfunktion zur Hauptperson: Sophie. Sie ist der Entwurf der Weiblichkeit, wobei die Wesensdefinition zur Bestimmung wurde und mit dem Bild der Frau im bürgerlichen Haushalt konform ging.566
Die Geschlechtscharaktere sind für Rousseau eine Entwicklung zur Vollkommenheit, Mann und Frau streben nach den ihnen von der Natur vorgegeben Zielen.567 Auch für Rousseau war es zentral, dass die Frau Mutter wurde und Mutterliebe praktizierte, wie seine Romanheldin Julie, deren Handeln von „mütterlicher Zärtlichkeit“ und „wachsamster Aufmerksamkeit“ und Sanftmut geprägt ist.568
Eine andere Form der weiblichen Macht erkennt Rousseau in den Reizen und der Attraktivität der Frau. Sie führen den Mann einerseits zu Aktivität und Stärke; andererseits kann die Frau durch Verführung, als eine indirekte Aktion, ihren Willen erreichen.569
Das Temperament der Frau sei ausschweifend und exzessiv und folglich sei es wichtig, sie zu Scham und Schamhaftigkeit zu erziehen, mit dem Zweck, das Begehren des Mannes zu steigern und gleichzeitig das eigene Begehren zu verhüllen.570 Das Frauenbild in der zeitgenössischen Gesellschaft war dazu ein Gegenbild: Frauen zeigten durchaus Koketterie und Geziertheit.571 (TM)
Zwischen den Brüdern und ihrer Schwester Tony hat es bei den gemeinsamen Spielen keinen geschlechtsspezifischen Unterschied gegeben, eine Trennung der Kinder aufgrund des Geschlechtscharakters ist zunächst in jungen Jahren nicht zu erkennen.
S. 63
Sie war ein ziemlich keckes Geschöpf, das mit seiner Ausgelassenheit seinen Eltern, in Besonderen dem Konsul, manche Sorge bereitete…
Sie kletterte, gemeinsam mit Thomas, in den Speichern an der Trave zwischen den Mengen von Hafer und Weizen umher, die auf den Böden ausgebreitet waren,…
Als typisch weibliche Eigenschaft galt die Konzentrationsunfähigkeit und das Bedürfnis nach Anschaulichkeit, was nach damaliger Sicht den intellektuellen Mangel der Mädchen deutlich machte.572 (TM)
Tony aber besitzt als Kind:
S. 63
… ein intelligentes Köpfchen [.], das flink in der Schule erlernte, was man begehrt…
In späteren Jahren aber offenbart sie intellektuellen Mangel und hält auf kindliche Weise an den Traditionen in ihrer Familie fest, obwohl die Gegenwart sich verändert. Ihre immer gleiche Kleidung, ihre Weltsicht, die aus der Wiederholung von Mortons Zitaten besteht, all das weist darauf hin, dass es Lernzuwachs oder politisches Interesse nicht gegeben zu haben scheint.
S. 352
Glauben sie zum Beispiel, dass ich ganz kurze Zeit vor meiner Verlobung auch nur gewusst hätte, dass vier Jahre früher die Bundesgesetze über die Universitäten und die Presse erneuert worden seinen? Schöne Gesetze übrigens!…
Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde die Unterschiedlichkeit der Charaktere von Mann und Frau eine von der Wissenschaft untermauerte Auffassung, z.B. fundierten Philosophie (Kant, Humboldt) und Psychologie die Definition des weiblichen Wesens durch Ehe und Familie. So war in Meyers Conversations-Lexikon von 1848 zu lesen: „Entsprechend dem mehr universellen Charakter im Weibe, ist die Empfindung in ihm vorherrschend - das Weib ist mehr fühlendes Wesen; beim Mann herrscht hingegen wegen seiner größeren
Individualität, die Reaktion vor - er ist mehr denkendes Wesen... “ 573 Rousseau identifizierte ebenfalls charakteristische weibliche Eigenarten und ordnete sie als geschlechtsspezifische Qualitäten ein, z.B. das Schamgefühl, die Fähigkeit zur Unterordnung, die Sanftmut und die Koketterie.574
Fichte sieht im Zusammenhang mit den Geschlechtscharakteren die Frau als unfähig an, eigene Triebe und Bedürfnisse zu entwickeln, weiblicher Ungehorsam sei undenkbar, da die Frau keine eigenen Bedürfnisse habe.575
Campe schreibt in seinem Buch „Rath für meine Tochter“ 1789: Es sei „übereinstimmender Wille der Natur und der menschlichen Gesellschaft, daß der Mann des Weibes Beschützer und Oberhaupt, das Weib hingegen die sich ihm anschmiegende, sich an ihn haltende und stützende treue, dankbare und folgsame Gefährtin und Gehilfin seines Lebens sein sollte.“ Pädagogische Literatur vermittelte diese neue Rollendefinition des kindlichen, männlichen und weiblichen Sozialcharakters und nur einige wenige Pädagoginnen wie Karoline Rudolph hinterfragten die Gebundenheit von Charaktereigenschaften, wie z.B. Sanftmut und Liebenswürdigkeit an das Geschlecht und die daraus folgender ungleiche Behandlung der Geschlechter.576
Die Mehrheit sah die Frau als ein Kind an, dem Urteil des Mannes ausgesetzt und von den Bedürfnissen des Mannes abhängig.
(TM)
So tituliert auch Thomas seine Schwester, als sie im Alter einer erwachsenen jungen Frau ist und verheiratet, als „Kind“.
S. 552
„Oh, Kind, was für Torheiten…
Und obwohl das Bürgertum sonst die Gleichheit der Menschen, unabhängig von Stand und Geburt forderte - bei der Gleichheitsforderung war die Rolle der Frau von jeglichen Emanzipationsgedanken ausgenommen. Deren „Eigenwille“ musste man beugen, deshalb war das wichtigste Erziehungsziel: Unterwürfigkeit und Bescheidenheit.
Anders sah es beim Knaben aus. Wegen seiner zukünftigen gesellschaftlichen Stellung erwartete man von ihm Durchsetzungsvermögen und Selbstsicherheit und richtete die Erziehung in Schule und Familie infolgedessen daraufhin aus. Jungen wurde in ihrer Kindheit die Freiheit zum Spielen gegeben, es galt, Verweichlichung zu vermeiden und wichtige Charakterzüge wie Draufgängertum, Mut und Selbständigkeit im Spiel zu entwickeln.
J. Glatz schreibt dazu in seinem Erbauungsbuch für Töchter aus den gebildeten Ständen: Das männliche Geschlecht „... soll besonders im öffentlichen Leben außer dem Hause thätig seyen, die Angelegenheiten des Staates im Großen und Kleinen ins Auge fassen und mit betreiben helfen, die Ordnung, Ruhe und Sicherheit in der bürgerlichen Gesellschaft aufrecht erhalten, den Schwächeren Schutz gewähren und Beystand leisten, und durch Entschlossenheit, Muth, Festigkeit und Kraft sich auszeichnen, und auf den Gang der Dinge in der Welt einwirken.“
„Eine ganz andere Bestimmung hat dagegen das weibliche Geschlecht, das man in mancher Hinsicht nicht ohne Grund, dasschwächerezu nennen pflegt. Dieses soll bescheidener, geräuschloser, weniger bemerkt, und fast nur innerhalb der engen Grenzen des häuslichen Lebens walten, sich auch den geringfügigsten Arbeiten und Beschäftigungen unterziehen, auf so manche Zerstreuungen und Vergnügungen, so wie auf so manche Vorrechte des männlichen Geschlechts Verzicht thun, und nicht durch Muth und Kraft, sondern vielmehr durch Geduld, Gefügigkeit, Sanftmuth zärtliche Liebe, Freundlichkeit und eine reizende Anmut seines Wesens und Benehmens für sich gewinnen und gleichsam herrschen.“577
Die Definition und Ausdifferenzierung der Geschlechtscharaktere führte dann letztendlich für die Frau zu ihren Aufgaben in Haus und Familie - Mütterlichkeit erhielt im Bürgertum infolge des Sonderstatuts der Kindheit ein großes Gewicht - während der Mann die Rolle des Vormunds im Hause inne hatte und als Bürger direkt für den Staat wirkte. Riehl: „ Wird man der Familie gerecht, wird man den Frauen gerecht, denn der Herd des Hauses ist ja der Altar, darauf sie ihr verschwiegenes und doch so entscheidendes Wirken für Gesellschaft und Staat niedergelegt haben.“578 Häuslichkeit, Fleiß und Reinlichkeit verfestigten die neue bürgerliche Familienform.
Diese Vorstellung einer natürlichen Ordnung zwischen den Geschlechtern sorgte für die gesellschaftlich bedingte Rollenverteilung, in der die Frau darauf verzichtete, eine eigenständige und selbständige Persönlichkeit zu entwickeln. Zunächst waren es ihre Eltern, und später die eigene Familie, die ihre Aufopferung forderten.
Die Ausformung der Geschlechtscharaktere war/ist typischerweise in sämtlichen bürgerlichen Gesellschaften anderer Nationalitäten, wie z.B. auch in Österreich anzutreffen, sie findet sich in Geigers Roman und verliert erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts an Bedeutung.
15.2 Bildung in der Schule des 19. Jahrhunderts
Um den männlichen Bürgern Bildung zu vermitteln, kam der Schule eine besondere Bedeutung zu.
Als 1763 die allgemeine Schulpflicht in Preußen eingeführt wurde, verschwand das Hauslehrersystem und es bürgerte sich ein, die Jungen möglichst frühzeitig nach der Volks- oder Bürgerschule zum (Real)Gymnasium zu schicken.
Mit dem Prozess der Entwicklung der ,neuen’ Familie entwickelte sich die staatliche Schule, die einen geregelten Schulbesuch voraussetzte und einen Teil der Erziehung und Bildung übernahm.579 Es begann die Verschulung der Kindheit. Schule wird zu einem wichtigen Faktor der Lebensgestaltung, denn sie vermittelt einerseits gesellschaftliche Tugenden, ermöglicht aber auch über die Leistung eine Bildungskarriere.
In der Theorie hatte bereits die Aufklärung diesen bildungspolitischen Anspruch formuliert, realisiert wurde er im 19. Jahrhundert mit der Gründung des neuzeitlichen Bildungswesens. Es war W.v. Humboldt, der die entscheidenden Weichen in der Schulreform des 19. Jahrhunderts stellte und der für die „Bildungsschule“, für die Idee des humanistischen Gymnasiums und der allgemeinbildenden Schule steht. In seinen Plänen forderte Humboldt die Stadien des Elementarunterrichts, Schulunterrichts (Mathematik, Sprach-, Geschichtsunterricht) und Universitätsunterrichts (Einsicht in die reine Wissenschaft) in einem vertikal gestuften System - durchgesetzt hat sich eine horizontale Gliederung.
Grundlage von Humboldts Theorie der Bildung war die Menschlichkeit des Menschen, also das, was den Menschen als Menschen ausmacht, und gerade das sollte vermittelt werden. Sprachen wie Latein und Griechisch hatten hierbei eine führende Rolle zu spielen, denn in der Sprache zeigt sich die Menschheit.580
Die allgemeine „Bildung“, nicht die Befähigung zu einem Beruf oder einem Amt, wurden zum Thema bei Literaten und Philosophen. „Diese allgemeine Bildung ist für Humboldt wie für Schiller geradezu dadurch definiert, dass sie sich der unmittelbaren Verwertung und der ökonomischen Nutzung entzieht und sich nicht auf die ’rohe’, sinnliche Natur begrenzt.“ 581 Konnten sich bei Schiller die wahre Natur und die Bestimmung des Menschen in der Kunst verwirklichen, realisiert Humboldt ein bildungspolitisches Konzept des allgemeinen Bildungswesens, in dem jeder „eine vollständige Menschenbildung“ erhalten soll.
Der Lehrplan bestimmte ab 1816 das Gymnasium zur „Schule des Staates und der Gebildeten“ und definierte einen hohen Standard der Erwartungen. Es sollte die allgemeine höhere Bildung anhand eines wissenschaftlich klassischen Bildungskanon vermitteln, mit dem Lernziel der Lern- und Studierfähigkeit. In den Lehrplänen, die sich je nach Region unterschieden und lokal nicht identisch waren, forderte man die Vermittlung historischer, philologischer und mathematisch-naturwissenschaftlicher Themen, ebenso das wissenschaftspropädeutische Arbeiten und das Erlernen der Sprachen Griechisch und Latein. Die Naturwissenschaft als die führende Wissenschaft prägte das bürgerliche Selbstverständnis. Verwertbare Kenntnisse und Fertigkeiten genossenen am Gymnasium nur eine geringe Wertschätzung, denn Denken, das auf Nützlichkeit und Wirtschaftlichkeit ausgerichtet war, galt nicht als Kultur im eigentlichen Sinn, sondern als oberflächliche „Zivilisation“.
Die Einrichtung des Bildungswesens verband sich mit der Qualifizierung des Lehrerstandes, der Einrichtung des „examen pro facultate docendi“ 1810, das nun Maßstab für die Ausbildung der Lehrer war und den Zugang von anderen Ausbildungsgängen, z.B. dem der Theologen, für den Lehrerberuf nicht mehr möglich machte. Man traf organisatorische Maßnahmen wie die Festlegung der Lehrerausbildung, der -besoldung, der Prüfungen und der Schulverwaltung zur Etablierung von Leitinstitutionen im Bildungswesen. Lehrer und Oberlehrer besuchten Ausbildungsstätten (Seminare), die ein auf ihren Status gezieltes Ausbildungsprogramm anboten, und grenzten sich durch ihr Expertentum von dem Erziehertum der niederen Lehrer ab.582 Nichtsdestotrotz oblag allen die „Menschenbildung“ der männlichen Schüler, so dass das Verhältnis zwischen Eltern bzw. Schülern und den Lehrern von Gehorsam, Achtung und Dankbarkeit geprägt war, man ihre Autorität anerkannte, auch wenn die soziale und finanzielle Stellung der Lehrer im Vergleich mit anderen akademischen Berufsgruppen schlecht blieb.
(TM)
Im Roman von Thomas Mann lesen wir, wie Schule sich veränderte. In der Zeit von Thomas und Christian Buddenbrook herrschte ein anderer Geist als zur Zeit Hannos:
S. 66
In der Tat, die vortrefflichen Gelehrten, die unter der freundlichen Herrschaft eines humanen, tabakschnupfenden alten Direktors in den Gewölben der alten Schule - einer ehemaligen Klosterschule - ihres Amtes walteten, waren harmlose und gutmütige Leute, einig in der Ansicht, dass Wissenschaft und Heiterkeit einander nicht ausschlössen, und bestrebt, mit Wohlwollen und Behagen zu Werke zu gehe…
Das Schulleben wurde für die Schüler in den höheren Anstalten strenger, man stellte hohe Erwartungen und beurteilte bzw. kontrollierte sowohl das Sozialverhalten als auch die intellektuelle Leistung. Riehls „Geist des Respekts vor der Autorität“ hat sich in Hannos Schule entwickelt, man begegnet dem Direktor mit Demut und Gehorsam. Im Kaiserreich war die Allmacht der Lehrer und ihre Tyrannei besonders ausgeprägt.
S. 722
Dieser Direktor Wulicke war ein furchtbarer Mann. Er war der Nachfolger des jovialen und menschenfreundlichen alten Herrn, unter dessen Regierung Hannos Vater und Onkel studiert hatten … und mit ihm war ein anderer, ein neuer Geist in die alter Schule eingezogen. Wo ehemals die klassische Bildung als ein heiterer Selbstzweck gegolten hat, den man mit Ruhe, Muße und fröhliche Idealismus verfolgte, da waren nun die Begriffe Autorität, Pflicht, Macht, Dienst,Carrièrezu höchster Würde gelangt, und der „kategorische Imperativ unseres Philosophen Kant“ war das Banne…
Der Charakter eines Mannes wurde nach seinem Wissen und Können, nach der sachlichen Qualität seiner Taten und seiner Kompetenz beurteilt. In der Schule unterstützte man die Entwicklung der Männlichkeit durch Förderung und Forderung von Selbstbehauptung und Disziplin, Leistung und Gehorsam. Insbesondere Disziplin galt als ein Erziehungsziel, das auf die Rolle als Mann und Vater mit der dazugehörigen Bestimmungsgewalt in der Familie vorbereitete.
Aufklärungspädagogen diagnostizierten dennoch eine „weibische Weichlichkeit“ in der Jugend, die sich durch Passivität, Feigheit, Kränklichkeit und Abhängigkeit von anderen äußerte.583 Infolgedessen förderte man die Entwicklung der aggressiv-militanten Züge durch bildungspolitische Maßnahmen in Form von körperlicher Abhärtung und sportlichen Ehrgeiz, beides Insignien der Männlichkeit. Philantropen betonten die Relevanz des sportlichen Wettbewerbs: Die Schnelligkeit und Kraft im Unterricht der Jungen, gepaart mit Unbeschwertheit und Freiheit, stärkten Durchsetzungsvermögen und Selbstsicherheit. Rousseaus Erziehungsvorschläge schlossen sich dem an, er forderte, man solle sich körperlich abhärten, schwimmen und baden und damit körperliche Unbeweglichkeit verhindern584, um den Körper leistungsfähig zu halten. Eine allzu verzärtelnde Erziehung könne zu einer dekadenten Moral führen.585
Das Militär und die von Turnvater Friedrich Ludwig Jahn gegründete Turnbewegung für junge Männer gaben als Männlichkeitsideale Willensstärke, Tatkraft und Wehrfähigkeit vor, priesen die Beherrschung des eigenen Körpers durch die turnerische Bewegung und kritisierten Weichlichkeit und Willensschwäche, welche man mit Faulheit und Feigheit gleichsetzte. Die Überwindung von Angst durch die Stärkung des Körpers und durch Entsagung erfolgte bei Fahrten und Wanderungen. Es vermittelte Selbstgefühl und Selbstvertrauen, den Körper in seiner Gewalt zu haben.
Turnen war ein beliebter Sport der Bürger, denn es förderte die hohen Tugenden der Zucht, Ordnung, Disziplin, Kraft und Entschlossenheit und wirkte zurück auf Charakter und Körper.586 In den Anfängen herrschte in der Turnerbewegung die Vorstellung von der Egalität der Turner vor, man rekrutierte Mitglieder aus allen Schichten und stellte die Menschenbildung in den Mittelpunkt: Der „wahre“ Mann galt als höchster Ausdruck dieser Menschlichkeit. In den 60er Jahren erfolgte dann eine Proletarisierung der Vereine, Vorbehalte gegenüber dem Männlichkeitsbild der Turner wurden laut. Ein Zuviel an Waghalsigkeit, Derbheit und kraftvolle Energie ließen die Bürger auf Distanz gehen, stattdessen war nun ein gezähmter Mut gefragt.587 (TM) S. 622
Da waren zum Beispiel, geleitet von dem Turnlehrer Herrn Fritsche, die Turnspiele, die zur Sommerszeit allwöchentlich draußen auf dem „Burgfelde“ veranstaltet wurden und der männlichen Jugend der Stadt Gelegenheit gaben, Mut, Kraft, Gewandtheit und Geistesgegenwart zu zeigen und zu pflege…
Die Hierarchie der Jungen in Hannos Klasse beruht auf körperliche Überlegenheit. darauf, über andere Kontrolle und Herrschaft zu haben und erfolgreich zu sein.588 Die HageströmSöhne zeigen das traditionelle Geschlechtsrollenstereotyp des Konkurrierens und Kräftemessens:
S. 622
Da waren die beiden Söhne des Konsuls Hagenströms, vierzehn- und zwölfjährig, zwei Prachtkerle, dick, stark und übermütig, die in den Gehölzen der Umgegend regelrechte Faustduelle veranstalteten, die besten Turner der Schule waren…
Solch eine Leistungs- und Wettbewerbsorientierung ist bei Hanno nicht anzutreffen.
Dessen Verhalten ist für andere ein Verstoß gegen das Männlichkeitsbild. Seine Kraftlosigkeit und Erschöpfung stigmatisieren ihn als unmännlichen Schwächling, und körperliche Schwäche ist gleichbedeutend mit wirtschaftlichem Bankrott.
S. 622ff
Aber zum Zorne seines Vaters legte Hanno nichts als Widerwillen gegen solche gesunden Unterhaltungen an den Ta…
Was aber hauptsächlich Hanno veranlasste, sich vom Baden sowohl, wie vom Schlittschuhlaufen und von den „Turnspielen“ sobald es nur immer anging fernzuhalten, war der Umstand, dass die beiden Söhne des Konsuls Hagenströms, es auf ihn abgesehen hatten und, obgleich sie doch in dem Hauses seiner Großmutter wohnten, keine Gelegenheit versäumten, ihn mit ihrer Stärke zu demütigen und zu quälen. Sie kniffen und verhöhnten ihn bei den „Turnspielen“, stießen ihn in den Schneekericht auf der Eisbahn, sie kamen im Schwimmbassin mit bedrohlichen Lauten durch das Wasser auf ihn z…
S. 652f
Aber es war nicht nur dies; es war nicht mehr allein die Sorge um die Zukunft seines Sohnes und seines Hauses, unter der er lit…
Und Thomas Buddenbrook wandte sich enttäuscht und hoffnungslos von seinem einzigen Sohne ab, in dem er stark und verjüngt fortzuleben gehofft hatt…
Thomas Mann selber hasste, wie sein Alter Ego Hanno, die Schule und litt ebenso unter den Anforderungen, die sie an ihn stellte. Er flüchtete in den Schlaf.589
Der Besuch eines Gymnasiums galt im Bürgertum als ein Statussymbol. Er stärkte ihr Selbstbewusstsein und grenzte sie zu anderen sozialen Klassen ab. Durch ihn verfügten die in einem bürgerlichen Elternhaus aufgewachsenen jungen Menschen über einen Kanon von Bildungswissen.
„Der Bildungsbegriff ist […] nicht nur die Leitideologie des Bildungssystems und die Legitimationsformel für die Unterscheidung von Bildungskarrieren, er gibt auch den Hintergrund, vor dem sich bürgerliches Selbstbewusstsein bei den intellektuellen Berufen in Deutschland ausbildet.“ 590 Akademisch gebildete Bürger wie Ärzte, Anwälte, Ingenieure, evangelische Pfarrer, Lehrer und Staatsbeamte erhielten Einfluss und Ansehen eben durch ihre höhere gymnasiale Schulbildung und ihren akademischen Abschluss.
(TM)
S. 65
Christian, welcher Gymnasiast wa…
S. 611
Bürgermeister aber konnte Thomas Buddenbrook nicht werden, denn er war Kaufmann und nicht Gelehrter, er hatte kein Gymnasium absolviert, war nicht Jurist und überhaupt nicht akademisch ausgebildet. … er verwandt nicht den Ärger darüber, dass das Fehlen der ordnungsmäßigen Qualifikationen es ihm unmöglich machte, in dem kleinen Reich, in das er hineingeboren, die erste Stelle einzunehmen. „Wie dumm sind wir gewesen“, sagte er zu seinem Freunde und Bewunderer Stephan Kistenmaker - aber mit dem „wir“ meinte er nur sich allein-, „dass wir so früh ins Comptoir gelaufen sind und nicht lieber die Schule beendigt haben…
Das deutsche Bildungssystem war mehrheitlich staatlich und nicht privat wie in England geprägt, ohne eine Hierarchie zwischen exklusiven und städtischen Schulen, und so wurde das Gymnasium als Träger der Werte von Bildung und Leistung zur Schulform, die die soziale Privilegiertheit der Bürgersöhne stärkte. Den Lehrstoff bestimmten die Kultusbehörden. Der Besuch der höheren Schule bis hin zum Abitur und ein anschließendes mehrjähriges Studium stellten aufgrund der Schulgelder und Studiengebühren einen hohen finanzieller Aufwand dar. Schon aus diesem Grund fehlte die soziale Öffnung, und es war nur wohlhabenden Wirtschafts- und Bildungsbürgern möglich, ihren Söhnen diese kostspielige Ausbildung zu finanzieren.
Das Bildungsbürgertum orientierte sich im 19. Jahrhundert am humanistischen Bildungsideal Humboldts591 und besuchte das humanistische Gymnasium und die Universität, das Wirtschaftsbürgertum aber, wie z.B. Kaufleute, wählte in der akademischen Ausbildung einen anderen Weg: Sie besuchten nicht das klassische Gymnasium, da die praktische Verwertbarkeit der Gymnasialbildung gering war, sondern eher nicht-gymnasiale Anstalten wie Bürgerschulen und Realschulen, die keine Berechtigung zum Abitur verliehen, Jean Buddenbrook sympathisiert mit ihnen: (TM) S. 96
Der Konsul sagt…
„Ich habe, im Gegensatz zu meinem seligen Vater, immer meine Einwände gehabt gegen diese fortwährende Beschäftigung der jungen Köpfe mit dem Griechischen und Lateinischen. Es gibt so viele ernste und wichtige Dinge, die zur Vorbereitung auf das praktische Leben nötig sind.“Anders als sein Vater: S. 28
„Praktische Ideale. na, ja.“ Der alte Buddenbrook spielte während einer Pause, die er seinen Kinnladen gönnte, mit seiner goldenen Dose. „Praktische Ideale. ne, ich in da gar nich für!“. „Da schießen nun die gewerblichen Anstalten und die technischen Anstalten und die Handelsschulen aus der Erde, und das Gymnasium und die klassische Bildung sind plötzlich Betisen, und alle Welt denkt an nichts, als Bergwerke. und Industrie. und Geldverdienen.“S. 65
Thomas, der seit seiner Geburt bereits zum Kaufmann und künftigen Inhaber der Firma bestimmt war und die realwissenschaftliche Abteilung der alten Schule mit den gotischen Gewölben besuchte, war ein kluger, regsamer und verständiger Mensc…
Für Hanno empfiehlt sich der Besuch der Realklassen:
S. 620
Aber die Firma verlangte einen Erben, und abgesehen hiervon glaubte er dem Kleinen eine Wohltat zu erweisen, wenn er ihn der unnötigen Mühen mit dem Griechischen überhob. Er war der Meinung, dass das Realpensum leichter zu bewältigen sei, und dass Hanno, mit seiner oft schwerfälligen Auffassung, seiner träumerischen Unaufmerksamkeit., in den Realklassen ohne Überanstrengung schneller und ehrenvoller vorwärtskommen werd…
Oftmals gab es Auseinandersetzungen zwischen den realistischen und humanistischen Anstalten und den privilegierten gesellschaftlichen Gruppen: Man forderte die Gleichberechtigung und die Anerkennung des Abschlusses für ein (technisches) Studium an den Hochschulen. Dies erfolgte im Jahre 1859. Nun verlief der Weg einer wirtschaftsbürgerlichen Karriere über das Realgymnasium und die Technische Hochschule. 1898 gründete man die Handelshochschule, einen neuen Fachhochschultyp für Schüler mit Obersekundareife. Mit ihr begann die Akademisierung der Kaufleute.
Auf dem Hintergrund des Buddenbrooks-Romans der Blick nach Lübeck: Diese Stadt hatte 1860 44 Schulen. Bürgerkinder wie Thomas und Heinrich und Adlige aus Holstein und Mecklenburg besuchten das Gymnasium Katharineum, dessen Professoren ein hohes Ansehen genossen und über ein gutes Gehalt verfügten.
Für ,höhere Töchter’ gab es Privatschulen, die meist mit einem Pensionat verbunden waren, wie Sesemi Weichbrodts Institut am Brink.
Bis 1848 existierten Armenschulen und die Sonntagsschule für die Kinder, die wochentags in der Fabrik arbeiten mussten. Um die Jahrhundertmitte erfolgte der Ausbau der Realklassen.
Weiterhin gab es das 1807 von der ,Gemeinnützigen Gesellschaft’ eingerichtete Lehrerseminar, es bildete Lehrer aus und trug nicht zuletzt zum größeren Ansehen des Lehrerstandes bei.
Diese Gemeinschaft bemühte sich, das Interesse für Sport und Leibesübungen wachzuhalten und pflegte den Ruder- und Schwimmsport. 1855 gründete man die ,Turnerschaft‘, die alle Schichten ansprach.
Des Weiteren bestand noch die „Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit“, in der der Gelehrten- und Kaufmannsstand vertreten war, und geistige Anregungen zur Gründung von Schulen und Anstalten gab.
Im 20. Jahrhundert modernisierte sich die Bildungspolitik als um 1900 die Realgymnasien und Oberrealschulen den Gymnasien gleichgestellt wurden und ein Zugang zu den Universitäten nun auch für diese Schüler möglich wurde. Nicht wenige der Abiturienten kamen von jetzt an aus dem gewerblichen und kleinbürgerlichen Bürgertum und demonstrierten, dass Erziehung und Bildung und nicht ständische Vorzüge Qualifikationskriterien geworden waren.Von nun an entschied die überprüfbare Leistungsfähigkeit über die Karriere und das Prestige. Das bedeutete für den Adel, dass die Konkurrenz um begehrte privilegierte Positionen zunahm.
15.3 Das Bildungswesen für Mädchen im 19. Jahrhundert
Was wir bisher über den Schulbesuch und Schulformen gelesen haben, bezog sich nicht auf alle Bürgerkinder, lediglich auf die Bürgersöhne. Das Bildungswesen für Mädchen war dagegen bis weit ins 18. Jahrhundert vernachlässigt und Mädchen nur begrenzte Bildungsmöglichkeiten eigeräumt worden.
Bereits bei der Geburt empfing man Mädchen mit Geringschätzung und Unsicherheit, während die Geburt eines Knaben die Eltern ehrte. Diese Missachtung setzte sich im Laufe des Lebens592 in Vorurteilen gegenüber der Frau fort, zu lesen in zahlreichen pädagogischen und populär-wissenschaftlichen Schriften des 19. Jahrhunderts.
Die Schule kam ihrer Aufgabe nach, bei den Mädchen das Pflichtgefühl zur Erfüllung häuslicher Aufgaben zu wecken.
Eine Ausbildung der Bürgertochter bestand zunächst aus Privatunterricht, einem Einzelunterricht, das war methodisch, pädagogisch und inhaltlich schon deshalb unzureichend, da er den Wetteifer fehlen ließ.593
Er reduzierte sich auf den privaten familiären Bereich, meist erteilt durch Gouvernanten ohne pädagogische Vorbildung. „Das Mädchen indes soll der Regel nach seine ganze Jugendzeit bis dahin, wo ein Mann es zu seiner Lebensgefährtin wählt, im Schoße der Familie verweilen. Es braucht die Klugheit der Welt nicht, weil seine Bestimmung die Welt nicht ist, sondern das Haus...“594
Von 1794 an verpflichtete das Allgemeine Landrecht den Schulbesuch für Mädchen in der Elementarbildung, die allgemeine Schulpflicht führte Preußen im Jahre 1825 ein.
War es vor Beginn des 19. Jahrhunderts der adlige Stand, der seine Töchter in höheren Mädchenschulen in modernen Sprachen (Französisch) und musisch-künstlerischen Fächern, Handarbeit, Allgemeinbildung und Haushaltsführung unterrichten ließ, so besuchten in den ersten Jahrzehnten des 19. Jh. immer mehr Mädchen auch aus bürgerlichen Kreisen ebensolche Schulen. Bürgerliche Eltern verlangten, einem ähnlichen Status und elitären Denken entsprechend, ihre Töchter auszubilden.
(TM)
Tony Buddenbrook besucht den Elementarunterricht:
S. 60
Tony blieb ein bisschen stehen, um auf ihre Nachbarin Julchen Hagenström zu warten, mit der sie den Schulweg zurückzulegen pflegt…
Damit etablierten sich private Höhere Töchterschulen und ein Pensionswesen mit Bildungscharakter. Ein Mädchenpensionat, das seine Exklusivität durch ein hohes Schulgeld bewahrte und die Mädchen ,von Stand’ vom einfachen Volk separierte, durchliefen etwa 10% der Bürgertöchter.595 Diese Schulen erteilten keine Zulassung zum Hochschulstudium. Sie dienten eher dazu, den Mädchen einen eleganten Schliff zu geben als der wirklichen Fortbildung. Dem Unterricht an diesen Schulen fehlte es an Ernsthaftigkeit und Zielstrebigkeit. Er hatte den Charakter eines Zeitvertreibs, denn letztendlich galt eine Berufsausbildung für Mädchen als nicht standesgemäß und keine der Schülerinnen strebte einen Beruf an.
(TM)
Tony besucht ein solches Mädchenpensionat. Ein ähnliches gab es in Lübeck und wurde von einer ebenso kleinen und verwachsenen Frau wie Sesemi Weichbrodt geführt, Julia Mann, die Mutter von Thomas Mann, besuchte sie als Mädchen. Dort gab es Interne und Externe (S. 84):
S.79
„Toni geben wir in Pension, und zwar zu Fräulein Weichbrodt“, sagte Konsul Buddenbroo…
S. 85
Das hochgelegene Erdgeschoss des ziegelroten Vorstadthäuschens, das von einem nett gehaltenen Garten umgeben war, wurde von den Unterrichtsräumen und dem Speisezimmer eingenommen, während sich im oberen Stockwerk und auch im Bodenraum die Schlafzimmer befande…
Keine dieser Schulformen vermittelte jemals eine systematische Ausbildung, weil es dort keine standardisierten Bildungsgänge gab.596 Man unterstellte den Mädchen aufgrund ihrer Natur eine beschränkte Verstandesbildung und sah lediglich die Vermittlung von für die Zukunft nützlichem Wissen als eine Aufgabe der weiblichen Bildung: „Nun! Was fordert die Geistes-Bildung als wesentlich denn? Zuvörderst Uebung und Fertigkeit im Denken; im Beobachten, Vergleichen, Schließen, Folgern. Nicht so, dass das Denken der eigentliche Zweck wird; wie bei dem Manne, der irgend einer Wissenschaft sich geweihet hat. Sondern dass es immer nur Mittel bleibt, Mittel zur Erreichung praktischer Zwecke; deutlicher: Hilfsmittel für das Weib, nützlicher, edler, liebenswürdiger zu werden.“597 (TM)
Tony hat dieses Denken verinnerlicht und fordert Tom auf, für sie zu entscheiden:
S. 586
„. du musst für uns denken und handeln, denn Gerda und ich sind Weiber, . wir können dir nicht Wider pat halten, denn was wir vorbringen können, sind keine Gegengründe, sondern Sentiments, das liegt auf der Hand.…
„Rollenerwartungen und das Weiblichkeitsideal stellen die Grundlagen weiblicher Bildung dar.“ 598 D.h. Mädchenbildung war stets an der Rolle der Hausfrau und Mutter orientiert und antiintellektuell, bürgerliche Mädchen sollten „sittsam“ und „fleißig“ sein.
Um ihre gesellschaftlichen Aufgaben auch verantwortungsvoll zu erfüllen, war für die Mädchenerziehung das von Relevanz, was einen Bezug zu ihrer Pflichterfüllung als Mutter, Gattin und Hausfrau und daneben aber auch noch sozialen Nutzen hatte.599 Deshalb sollte das Ziel der Bildung sein, weibliche Charakterzüge auszuprägen und keine Belehrung in Wissenschaft und Kunst: „vernünftig, für ihre künftige Bestimmung zweckmäßig eingerichtet“, so dass der Unterricht „sie zwar in Wissenschaften weiter brächte, aber sie auch ihre weiblichen Arbeiten zugleich lehrte.“600 (TM)
Weinschenk erwartet eben dies von Erika Grünlich:
S. 452
„.Er verlangt von Erika, dass sie beständig heiter ist, beständig spricht und scherzt, denn wenn er abgearbeitet und verstimmt nach Hause kommt, sagt er, dann will er, dass seine Frau in in leichter und fröhlicher Weise unterhält, ihn amüsiert und aufheitert.; dazu, sagt er, sei die Frau auf der Welt…
Es fehlte der intellektuelle Unterricht im Bereich der Wissenschaft und die Einführung abstrakter Methoden wissenschaftlichen Denkens. Die Bildung der Mädchen erfolgte in den Fächern Heimatkunde, Geschichte, Muttersprache, Naturgeschichte und Religionsunterricht und war auf die Praktische Anwendung im Leben ausgerichtet und daher oberflächlich. Eine große Bedeutung kam der Erziehung zum Glauben und Gebet zu, denn damit wurde von Seiten der Frau Einfühlungsvermögen und Geduld in die Familien getragen.601
In der Zeit des 19. Jahrhunderts entstanden immer mehr solcher Institute, die die Mädchen im Hinblick auf ihre Stellung als zukünftige Gattin, Mutter und Hausfrau in moralischer Unterweisung vorbereiteten. Unter Ausgrenzung der Mathematik unterrichtete man zudem von nun an Bildungsinhalte in den Sprachen Französisch und Englisch, in der Literatur, der Textilgestaltung, dem Zeichnen und dem Gesang.
Die Befähigung zur sozialen Repräsentation und die kommunikative Kompetenz standen bei bürgerlichen Frauen im Vordergrund, schon deshalb förderte die Pensionatserziehung mit Sprachunterricht und regelmäßigen Konversationsstunden, insbesondere in der französischen Sprache, die sprachlich-kommunikative Selbstdarstellungsmöglichkeit der jungen Damen. Das Mädchen verließ als selbstsichere Dame die Schule und wusste sich in ihren Kreisen zu unterhalten und zu bewegen.
In der Mitte und zum Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Forderung nach einer Mädchenbildung laut, die nicht nur auf Nützlichkeit aus sein sollte, sondern eine individuelle Selbstbildung als Maßstab anlegte. Nicht wenige pädagogische Autoren verifizierten einen „Bildungsnotstand“ des weiblichen Geschlechts und klagten eine Verbesserung der Bildung ein. Mädchen sollten nun auch Chancen im außenhäuslichen Feld erhalten und ihre Fähigkeiten und Begabungen entwickeln können.602
So kam es 1908 zur Neuordnung des Mädchenschulwesens. Mädchen konnten von nun an auf das Lyzeum wechseln. Schule hatte von nun an nicht nur das Gemüt sondern auch den Verstand zu vertiefen: Man lehrte Mathematik unter Berücksichtigung anderer Naturwissenschaften und ergänzte ihn durch Unterricht in den Lebensaufgaben des häuslichen Lebens. Waren die Knabenschulen schwerpunktmäßig mathematischnaturwissenschaftlich ausgerichtet, hatten die Lehrpläne der Mädchenschulen ihren Schwerpunkt im neusprachlichen, musischen Bereich, (AG)
Alma, die Anfang des 20. Jahrhunderts aufwuchs, ist eine gebildete moderne Frau, der Hochkultur mächtig. Sie absolviert die Matura und besucht die Hochschule zum Studium der Medizin, ohne einen Abschluss - wegen ihrer Heirat und Schwangerschaft: S. 20
… Erinnerungen - an die Jahre, als sie in die Volksschule ging, wo auch den Kleinsten die Klassiker vorgelesen wurden: Die Menschen treiben aneinander vorbei, einer sieht nicht den Schmerz des anderen. Oder so ähnlic…
S. 196
In seiner Jugend hätte er nie zu hoffen gewagt, je einer Frau mit Bildung zu begegnen, die …
S. 70f
Ob sie wohl manchmal ihrem Studium nachtrauert: Und wenn doch? Ein bisschen vielleicht. Als sie schwanger wurde …
S. 258f
Richards Hand, seine Fingernägel, vor allem die Fingernägel - sie sehen aus wie von den Leichenhänden im „Handkurs“ zu Beginn des Studiums. Das Studium. Das sie nie beendet hat.Sie entsprach bereits in ihrem Äußeren ganz und gar nicht dem damaligen Frauenbild: S. 70
Dass sie vor neun Jahren, als sie einander kennenlernten, behauptete, eine moderne junge Frau zu sein, und dass sie zum Argwohn seines Vaters das Haar schon damals sehr kurz tru…
Bei der Familie von Sissi und Philipp zeigt sich eine geschlechtsneutrale Erziehung, weibliche Charakterzüge für eine Pflichterfüllung als Hausfrau und Mutter sind nicht mehr das Ziel der Erziehung und schulischen Bildung. Wildheit und Jungenhaftigkeit widersprechen nicht der Weiblichkeit, und der Besuch des Gymnasium und ein Studium sind für Tochter und Sohn Optionen:
S. 291
… eine Stunde nach dem verabredeten Termin, stopft Sissi ihre nasse Wäsche in eine Nylontasche und die Tasche in den ohne hin randvollen Kofferrau…
S. 353
…, sie ist Journalistin, Soziologin, wenn mich mein Gedächtnis nicht täusch…
S. 317
… und lässt die Kinder balgen, bis ihr Zorn von selbst erlahm…
S. 254
Ein Lärm, ein Durcheinander, Kinder, die sich gegenseitig die Türen zuhalte…
Sissi nutzt aus strategischen Gründen in bestimmten Situationen die Vorstellung von Geschlechtscharakteren, um sich zu entlasten und um sich um sich Arbeit zu ersparen und wird in dieser Hinsicht zum Vorbild für ihre Mutter Ingrid.
Nur zum Selbstschutz nimmt Sissi die Rolle einer Frau mit beschränktem Verstand an: S. 247f
Sissi hat längst begriffen, wie zuverlässig es funktioniert, wenn sie die Blonde spielt. Zweckdenken als Selbstschutz. Dummheit als Anwendung, als wäre Dummheit eine Form von Höflichkeit: ,Tut mir leid, aber das kann ich nicht. Da kenne ich mich nicht aus. Das ist mir nun wirklich zu schwer.' Ingrid muss diese Sätze automatisieren, …
Sissi verlässt bereits früh die eigene Familie und bleibt nicht ,in deren Schoß’.
Exkurs: Textiles Handarbeiten
Während von den Söhnen im Bürgertum schulische Leistungen erwartet wurden (Hannos mädchenhafte-weiche Art und seine wenig erfolgreichen Leistungen sind Anlass für familiäre Auseinandersetzungen), sollten Töchter die Arten von Beschäftigungen praktizieren, die Anmut, Heiterkeit, Geschicklichkeit fördern. In diesem Zusammenhang sah man das Handarbeiten als eine wichtige weibliche Tätigkeit an.
Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass in den proto-industriellem Familien des 18. Jahrhunderts die Erwerbsarbeit mehrheitlich aus Textilarbeiten bestand. Sie sicherte die Existenz und war lebensnotwendig, z.B. verpflichtete man für das Spinnen die weibliche Bevölkerung und brachte bereits den Kindern in den Familien der Unterschichten dazu die ersten Handgriffe bei.
Ein 1835 erschienenes Damenkonversationslexikon unterschied zwischen notwendigen und überflüssigen ,weiblichen Handarbeiten’, wobei sich im Verlauf der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Begriff ,weibliche (Hand)Arbeiten für TextilarbeitenjederArt’ durchgesetzt hatte: „Die hauptsächlichsten der ersten Kategorie, das Spinnen, Weben, Nähen und Stricken, sehen wir trotz ihres Nutzens als untergeordnete Beschäftigungen an. Sie sind die weiblichen Handwerke und der Nahrungszweig armer Leute geworden, Grund genug für die elegante Welt, sie gering zu achten und den dienenden Händen zu überlassen.“603
Standesgemäß betrieben Frauen des gehobenen Bürgertums eine besondere Handarbeit neben anderen musisch-kreativen Beschäftigungen wie Musizieren, Malen und französischer Konversation, und auch hier galt die textile Handarbeit der adligen Frauen als Vorbild. (z.B. forderte die Herzogin Helene von Orleans 1856 Hedwig von Bismarck auf, zum Tee eine Handarbeit mitzubringen.) Durch die feine’ Handarbeit erfüllte die bürgerliche Frau die gesellschaftliche Norm, dass die Freistellung von Lohnarbeit zwar ein klassenunterscheidendes Merkmal war und sie nicht außerhalb des Hauses tätig sein durfte, sie aber dennoch das beherrschende Prinzip des Lebens, Arbeit und Fleiß, zeigen sollte und sich nicht dem Müßiggang hingab.604 Textile Arbeiten entsprachen dieser Vorstellung. Vorteil dieser Tätigkeit war es, dass das Handarbeiten im (Still) Sitzen ausgeübt werden konnte, Genauigkeit, Regelmäßigkeit, sprich Disziplin, verlangte und sie das protestantische Leistungsethos durch eine nicht-körperliche, leichte Arbeit erfüllte, dem Status einer höheren Dame entsprechend.
(TM)
S. 75
Die Konsulin saß auf dem gelben Sofa neben ihrem Gatten, der, eine Cigarre im Munde, die Kursnotizen der städtischen Anzeigen überblickte. Sie beugte sich über eine Seiden-Stickerei und bewegte leichthin die Lippen, während sie mit der Nadel eine Reihe von Stichen zählte. Neben ihr, auf dem zierlichen Nähtisch mit Goldornamenten, brannten die sechs Kerzen eines Armleuchter…
S. 323
Zur selben Zeit saß die Konsulin im Landschaftszimmer und häkelte mit zwei großen hölzernen Nadeln einen Shawl, eine Decke, oder etwas Ähnliche…
Während der Mann im Produktionsprozess involviert war, konnte die Ehefrau bürgerliche Arbeitstugend unter Beweis stellen. „Die Funktion, ständige Arbeit trotz scheinbarer Muße zu demonstrieren, wurde den manuellen Textilarbeiten übertragen, denn künstlerische und textile Arbeiten kamen der Mentalität der Bürger besonders entgegen.“605
Es wurde zur gesellschaftlichen Konvention, dass Frauen der ,höheren Stände’ sich intensiv mit Nadel und Faden beschäftigten, diese Tätigkeit stand außerhalb mehrwertschaffender Arbeit und stellte eine pietistische Haltung unter Beweis, die den Genuss, die Zerstreuung und Zeitvergeudung ablehnte.606 (TM) S.606
Der Senator kehrte ins Landschaftszimmer zurück, woselbst Frau Permaneder, ohne sich anzulehnen und mit strenger Miene, an ihrem Fensterplatz saß, mit zwei großen Holznadeln an einem schwarzwollenen Röckchen für ihre Enkelin, die kleine Elisabeth, strickte …
Die Ergebnisse präsentieren die eigene Nützlichkeit und ganz nebenbei schuf Handarbeiten auch noch Gemütlichkeit und eine familiäre Atmosphäre607 - und fremde Einflüsse konnten, indem man etwas in den Händen hielt, wie eine Schutzmauer abgehalten werden.608
Insbesondere das Sticken nach farbigen Vorlagen in Kreuzsticktechnik mit Perle und Seide kam nach dem Stricken und Häkeln zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Mode und galt als eine wichtige ästhetische Beschäftigung. Die bürgerliche Frau produzierte nicht nur Arbeiten, die die Wohnung und Gebrauchsgegenstände verschönerten, auch ihre eigene Garderobe und die ihrer Tochter verzierte sie durch modische Attribute (Atlasstreifen!) die Prestige und Luxus ausdrückten und der Repräsentation dienten.
Anregungen und Vorschläge für das Besticken von Objekten, für Applikationen und Sofakissen fand sie in Musterbüchern, den Vorläufern der heutigen Mode- und Frauenzeitschriften.609 (TM) S. 538
Diejenigen Geschenke, die Frau Permaneder angefertigt oder dekoriert hatte, ein Arbeitsbeutel, ein Untersatz für Blattpflanzen, ein Fußkissen, waren mit großen Atlasschleifen gezier…
Textilarbeit vermittelte als unbezahlte Hausarbeit in der bürgerlichen Gesellschaft Sittsamkeit und Selbstzucht/Selbstbeherrschung und half, sexuelle Bedürfnisse zu unterdrücken. So wird von Mädchen in einer Lübecker Töchterschule berichtet, die in ein Holzgestell kamen, um die gerade Haltung zu fördern.610 Disziplin, einer der wichtigsten Werte im Bürgertum, wurde besonders im Bereich der weiblichen Sexualität und des Trieblebens anerzogen, denn bei der Handarbeit der Mädchen war ein diszipliniertes Sich- Beherrschen und Stillsitzen Voraussetzung, 611eine Parallele zur sportlich-militärischen Erziehung der männlichen Bürger. (TM) S. 177
Die kleine Clara, ein dunkelblondes Kind mit ziemlich strengen Augen, saß mit einer Strickerei vorm Nähtisch am Fenster während Klothilde, auf gleiche Weise beschäftigt, den Sofaplatz neben der Konsulin inne hatt…
Man praktizierte das Lesen, das eigentlich als unnütze Zeitverschwendung galt, und das Vorlesen während der textilen Arbeit, öfters in französischer Sprache, und gestattete so den Frauen die Verbindung von geistiger Lektüre und handwerklichem Arbeiten und die Beschäftigung und Kontrolle von Körper und Geist während eines mechanischen Arbeitens.612 Dadurch sollte verhindert werden, dass Handarbeiten zum Träumen verführte. 613 Gerade monotone Arbeit bot Gelegenheit, Gedanken und Ideen nachzuhängen, was von der Fröbel-Anhängerin Minna Pinoff 1867 als ein positiver Rückzugsbereich gedeutet wurde, der die geistigen Kräfte entfaltete,614, von bürgerlichen Eltern jedoch als Gefahr für ihre Töchter gesehen wurde, da Träume und Phantasien ihre Mädchen vielleicht zum Negativen hin hätten beeinflussen können.
Textilarbeiten gehörte zur geschlechtsspezifischen Sozialisation und stand für ein Zeichen der eigenen Nützlichkeit, andererseits war es auch Erholung, Pause von den alltäglichen Arbeiten und die Produktion einer Arbeit, die mit viel Zeitaufwand ohne finanziellen Mehrwert zu haben, andere erfreute. (TM) S. 606Der Senator kehrte ins Landschaftszimmer zurück, woselbst Frau Permaneder, ohne sich anzulehnen und mit strenger Miene, an ihrem Fensterplatz saß, mit zwei großen Holznadeln an einem schwarzwollenen Röckchen für ihre Enkelin, die kleine Elisabeth, strickt…
S. 616
Die Senatorin hielt ihr schönes weißes Gesicht über eine Seidenstickerei gebeugt. und Frau Permaneder, den Klemmer gänzlich schief und zweckwidrig auf der Nase, befestigte mit sorglichen Fingern eine große, wunderbar rote Atlasschleife an einem winzigen gelben Körbchen. Das wurde ein Geburtstagsgeschenk für irgend eine Bekannt…
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden noch viele ,höhere Töchter’ von der Mutter in der Familie erzogen. Sie vermittelte auch das textile Handarbeiten, später galt das Handarbeiten als ein wichtiger Teil des Lehrplans an den Töchterschulen und Mädchenpensionaten.
Die Einführung eines Handarbeitsunterrichts für Mädchen war in den öffentlichen Schulen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vollzogen.615
Die Relevanz des schulischen Textilunterrichts lag darin, Verhaltensdispositionen zu erwerben und nicht darin, Wissen an die Mädchen zu vermitteln. Er hatte, so wie die Handarbeit zu Hause, die Aufgabe, das weibliche Wesen zu sozialisieren, um Sinn für das familiäre, häusliche und stille Leben zu wecken. Es soll lehren, „nie müßig [zu] sitzen. Wer eine gute Hausfrau werden will, muss frühzeitig lernen, keine Minute müßig vorübergehen zu lassen, jede Stunde weise auszunützen.“ 616 Die entscheidende Sozialisationsfunktion war die Unterwerfung des Körpers unter die regelmäßige Bewegung nach klösterlichem Vorbild.617 So läge „in dem rein mechanischen dieser Dinge eine recht heilsame Vorbereitung für unzählige andere dieser Art, die der weibliche Beruf später fordert.“618 Der preußische Kultusminister Karl Otto v. Raumer schrieb in einem Buch über die Erziehung der Mädchen: „Stricken und Nähen muß jedes Mädchen erlernen.Über den Zeitpunkt, wo kleine Mädchen in Handarbeiten unterrichtet werden sollen, lässt sich nichts allgemeines bestimmen, weil sie sich sehr verschieden entwickeln; doch muß es allen eben so als unmöglich erscheinen, nicht nähen oder stricken, als nicht lesen zu lernen.“619 Verhaltensdispositionen wurden auch in Schulen, in denen arme Mädchen gemeinsam mit Mädchen aus wohlhabenden Familien unterrichtet wurden, vermittelt. Je nach sozialer Herkunft differenzierte man dort inhaltlich feinere und einfachere Handarbeiten: Für die zukünftigen Dienstmädchen gab es streng praktische Ausbildungsinhalte, wie das Ausbessern und Flicken der Kleidungsstücke, eben das, was für die ordentliche Führung des Haushalts erforderlich war, wie beim Kindermädchen Ida Jungmann bei den Buddenbrooks: (TM)
S. 337
Ida hatte sich zu ihr gesetzt, hatte ihre Nadel und den über die Stopfkugel gezogenen Strumpf wieder zur Hand genomme…
Die privaten Töchterschulen, in denen die Töchter mit gleichaltrigen Mädchen des gehobenen Bürgertums die für sie kurze Jugendzeit verbringen konnten, legten besonders großen Wert auf die Unterweisung in Textilarbeiten: Auch wenn die Unterrichtung im musischen und ästhetischen Bereich zur Erfüllung der Repräsentationsaufgaben an erster Stelle stand, nahm die Unterweisung in manuellen Arbeiten bis zur Hälfte der Unterrichtszeit ein. Dabei war die saubere und akkurate Ausführung, für die es ein langes Üben und großen Zeitaufwand brauchte, besonders wichtig. Diese Arbeit erforderte Disziplin und eine sehr gute Feinmotorik.
Privilegierte Eltern gaben den Lehrerinnen Vorgaben bzgl. Material, Muster und Produkt, und die Schule, abhängig von der Zufriedenheit der Eltern, akzeptierte dies. Ein Beispiel ist die Töchterschule in Lübeck, gegr. 1806, in der statt der ,geselligen Künste’ des Tanzens, Musizieren und Malens die Hälfte der Unterrichtszeit den Textilarbeiten galt.620
Man unterschied zwischen der Einzelunterweisung durch die Handarbeitslehrerinnen und dem Klassenunterrichts. Letzteres fand mehr Befürworter und setzte sich durch. In ihm zeigte die Lehrerin mit dem Rücken zu den Kindern im strengen Takt Befehle mit ausführender Bewegung, wie: Einstechen! Umschlagen! Durchziehen!, stets vom Leichten zum Schweren.621
Das Stricken war Grundlage der systematischen Mädchenerziehung. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als die Mädchen noch zu Hause unterrichtet wurden, vermittelten ebenfalls die Mütter diese Tätigkeit, später war in den Töchterschulen das Stricken von Strümpfen ein wesentlicher Teil des Unterrichts. So weiß man von einer Frau aus großbürgerlichem Haus, die in ihrer Kindheit dreimal in der Woche für zwei Stunden in die Strickstunde ging, um Strümpfe selber anzufertigen. An dem ersten Paar arbeitete sie drei Jahre lang.622
Stricken galt aber auch als eine Strafmaßnahme, bevor das Nähen und Sticken erlaubt wurde. So lernten in der Meierschen ,Bildungsanstalt für Töchter’ in Lübeck im Jahre 1825 drei bis sechs Jahre alte Mädchen Stricken und Lesen. Alle drei Monate mussten dort Strümpfe gestrickt werden, und in die nächste Klasse aufsteigen durfte nur, wer lesen und einen Strumpf stricken konnte.623 Ein Strickstrumpf hatte Hauptbestandteil des Mädchens und ihr Gefährte zu sein.624 Auch wenn viele Mädchen Unwillen und Langeweile empfanden, das Handarbeiten musste ausgeführt werden.
(AG)
Almas Mutter erhält noch Unterweisung in der damals typischen Mädchenerziehung und bekommt eine Unterweisung im Nähen:
S. 18
Manchmal erzählte sie von einer Nähmaschine mit Fußantrieb, auf der sie als Mädchen lernen durfte. Damals ein halbes Wunderding. Bis zuletzt holte Almas Mutter voller Stolz ein auf dieser Maschine genähtes Unterkleid hervor.…
(ER)
In Ruges DDR-Roman gehört es zu Nadesjeshda Iwanownas Tätigkeiten, Socken für Sascha zu stricken:
S. 139
Nadjeshda Iwanowna schnäuzte sich und nahm das Strickzeug zur Hand, das sie irgendwann heute morgen auf dem Kopfkissen abgelegt hatte, die Socken für Sascha, dann kriegte sie eben Kurt, eine Socke war schließlich schon fertig, bei der anderen arbeitete sie sich gerade an die Ferse heran, von Socken verstand sie was, hatte schon viele Socken gestrickt, die ersten so groß wie Eierwärmer, dreißig Jahre war das nun her…
Charlotte ist ebenfalls noch in diesem mädchenspezifische schulische Lehrfach unterwiesen worden:
S. 46
Was wäre sie heute, fragte sie sich, ohne die Partei? Kunststopfen und Bügeln hatte sie gelernt an der Haushaltsschul…
15.4 Der steinige Weg zur Bildungsberechtigung und Berufstätigkeit der Frau
Berufslosigkeit der Mädchen war im 19. Jahrhundert eine gesellschaftliche Norm, Ehe und die zukünftige Familie galten als der ihr angeborenen Beruf. „Auf stilles Leben hat die Natur in den Frauen alles angelegt. Ihre sanfte Stimmung fordert eine gewisse Entfernung von dem Geräusche und Gefühle der Welt, mehr Beschränkung auf sich selbst, auf wenige geliebte Menschen, auf enge und wohltuende Umgebungen; in der Stille findet sie die ihre angemessene Nahrung, und bleibt bewahrt vor den heftigen Erschütterungen und den empfindlichen Verletzungen, die in dem lauten Tumulte, in dem unruhigen Treiben und in dem blendeten Glanze der Welt schwer zu vermeiden sind. Stille ist das Element der zarten Gefühle und Neigungen des weiblichen Herzens.“625 Wir lesen in dem gleichen Text: „Das Weib wirkt in der Familie, für die Familie ,der Herd des Hauses ist ja der Altar, darauf sie ihr verschwiegenes und doch so entscheidendes Wirken für Gesellschaft und Staat niedergelegt haben.“626 „Die Tochter soll, noch weit entscheidender als der Sohn, möglichst lange in der elterlichen Familie gehalten werden, denn wenn sie auch nebenbei in die Schule geht, ihre Hochschule wird immer das elterliche Haus seyn.“627
Das Berufsleben dagegen mit seinem berechnenden und kühlen Umgang brachte der Frau, so war man überzeugt, nicht die innere Zufriedenheit wie es die Idylle des häuslichen Lebens tat. Als Frau soll sie eher „Quelle von Zufriedenheit für andere, und besonders für diejenigen (sein), die am nächsten mit ihm verbunden sind.“628 Demnach bedeutete eine Beteiligung und Mitbestimmung der Frau in öffentlichen Angelegenheiten eine Gefährdung des privaten Glücks.
Frauen stellten an sich selber die Forderung ,„daß immer alles seinen stillen geräuschlosen Gang gehen mußte, daß nirgends Wirtschaftslärm sich hörbar machte, nie durfte von anderen bemerkt werden, daß es viel zu tun gab.“629
Weiblicher Ungehorsam war in der Philosophie des 18. Jahrhunderts ein Ding der Unmöglichkeit: Existentiell verband das Mädchen zunächst die Abhängigkeit vom Vater, zu ihm war das Autoritätsgefälle extrem groß, größer als bei allen anderen Beziehungen, später dann hatte sie ihrem Ehemann gegenüber Gehorsam zu zeigen.
Kants Aussage: „räsoniert, soviel ihr wollt und worüber ihr wollt; aber gehorcht!“ zeigt, dass das Prinzip des Gehorsam auch mit dem Gebrauch der Vernunft einhergehen konnte.630 Das Eheverständnis des großen Philosophen spricht ebenso von der notwendigen Unterwerfung der Frau wie das von Joachim Heinrich Campe in seinem Buch „Väterlicher Rath für meine Tochter“; er sieht die Rolle der Tochter als natürliche Bestimmung, so dass sie: „in einer […] vielleicht gar etwas drückenden Abhängigkeit “ leben wird.631
(TM)
Bei Tony zeigt sich aber auch das Potential eigener Bedürfnisse und ein implizierter Ungehorsam dem Vater gegenüber, z.B. in ihrem Brief an den Vater:
S. 145
Er ist nicht reich, was wohl für Dich und Mama gewichtig ist, aber das muss ich Dir sagen, lieber Papa, so jung ich bin, aber das wird das Leben Manchen gelehrt haben, dass Reichtum allein nicht immer jeden glücklich mach…
Die Rigidität, mit der ihre Eltern sie auf die gesellschaftlich geforderte Bahn zwingen, verhindert ihre Individualisierung. Tony will das Ideal bürgerlicher Weiblichkeit verkörpern und ordnet sich den Wünschen der Eltern unter. Das Autoritätsverhältnis wird nicht verhandelt wie 100 Jahre später bei Ingrid, bei der der Vater ebenfalls eine solche Autorität beansprucht.
(TM)
Der Tochter bleibt das Recht auf Selbstverwirklichung verwehrt, sie ordnet den eigenen Willen dem der Familie unter. Die patriarchalische Ordnung zwingt Tony zur Fügsamkeit.
S. 164
„Adieu Papa.. Mein guter Papa!“ Und dann flüsterte sie ganz leise: „Bist du zufrieden mit mir?“ Der Konsul presste sie einen Augenblick wortlos an sich; …
Die oben beschriebene Charakterbestimmung der Frau diente zur Zementierung der Stellung der Frau und verhinderte die Realisierung jeglicher Emanzipationsforderungen: So wurde als Argument gegen eine Gymnasial- und Universitätsausbildung der Frau angeführt, diese gefährde die Mutterschaft, die der wahre Beruf der Frau sein solle und es fehle der Frau an Verstand, um diese Schulform erfolgreich zu besuchen.632 Eine Mittelschichtsfrau, die Geld verdiente, war „entweder ein unglückliches Opfer oder Rebellin“.633
Im Laufe des 19. Jahrhunderts, im Zuge der Industrialisierung, Proletarisierung und Verarmung weiter Teile der Bevölkerung jedoch wurde die Frau zu einem wichtigen Faktor im Wirtschaftsleben. Sie galt nicht mehr als der ruhende und Sicherheit gewährleistende Punkt in der Familie, sondern musste (und konnte) ihre eigene und die familiäre Existenz selbständig sichern.
Solch eine äußere Selbständigkeit ließ Forderungen nach innerer Unabhängigkeit laut werden. Vorreiter waren die USA: Dort gab es bereits früh im 19. Jahrhundert das Recht für Frauen auf Schul- und zur Hochschulbildung.
Die Frauenpolitik der liberalen bürgerlichen Männer, bestand zunächst darin, die außerhäusliche Aktivität/Arbeit fürunverheirateteerwachsene Frauen und deren statusadäquate Integration in die Berufswelt zu fördern. Damit sollte der Mittelstand von unterstützenden Aufwendungen für diese Frauen, die zumeist in den Haushalten der Verwandten lebten, entlastet werden.634 Weiterhin verband sich bei ihnen die Forderung nach Gleichberechtigung mit der Forderung nach Bewahrung der weiblichen Eigenart bzw. des weiblichen Charakters.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde die „Frauenfrage“ immer bedeutender. Die Bildungschancen für Mädchen erhöhten sich und es begann eine individuelle Förderung von Seiten des Elternhauses. Die Lebensphase zwischen Jugend und Ehe, fast zehn Jahre, sollte wirtschaftlich sinnvoll durch Erwerbsarbeit genutzt werden. Kam es dann später zu einer Heirat, bedeutete dies in vielen Berufen den Ausschluss, z.B. bei Lehrerinnen und Ärztinnen.635
Frauen sprachen sich u.a. in Deutschland für das Recht aus, über ihren Körper zu verfügen und wollten der vielfachen Mutterschaft eine bewusste Mutterschaft entgegen setzen. Wieder waren es die USA, aber auch die skandinavischen Länder, die eine Geburtenkontrolle in den folgenden Jahrzehnten tolerierten, anders als die Länder mit einer katholischen Weltanschauung.
Luise Otto war es, die ihrem Geschlecht und dessen Wunsch nach Teilnahme und Mitsprache und Verantwortung eine Stimme gab: Sie gründete 1865 den ADF (Allgemeinen Deutschen Frauenverein). Dieser forderte einen über das 14. Lebensjahr hinausgehenden Unterricht. Mädchen sollten nicht zu Puppen sondern zu verantwortungsvollen Gliedern des Volkes erzogen werden und man solle ihnen Unterricht in Zeitgeschichte geben, um Interesse für Gegenwartsfragen zu wecken. Das Ziel war die Bildungs- und Erwerbsberechtigung für bürgerliche Frauen. Frau wünschte selber Entscheidungsfreiheit und Handlungsfreiheit, eine ,elterliche‘ statt eine ,väterliche‘ Gewalt sollte gegenüber den Kindern greifen, eine weitere Forderung stellte die freie Verfügung über das erworbene eheliche Gut dar.
Beibehalten blieb die Vorstellung von den Geschlechtscharakteren: Forderungen nach bildungsmäßiger und politischer Gleichberechtigung begründete man stets mit der Verwirklichung von Humanität in der inhumanen Männerwelt.636
Eine Wesensverschiedenheit der Geschlechter zeige sich in der Mutterschaft und in der Sorge um Kinder und Ehemann und bestimme das weibliche Geschlecht. Der positiv konnotierte Begriff der „Mütterlichkeit“ wurde als ein wichtiger Teil der weiblichen Identität gesehen; erweitert auf soziale Hilfstätigkeit, der „Menschlichkeit“, galt er dem Kampf gegen Armut und Krankheit. Solch ein weiblicher Kultureinfluss wurde als überaus relevant für die Gesellschaft 637 und als ein Ausdruck des wachsenden Bewusstseins des eigenen fraulichen Wertes gesehen.
Clara Zetkin bewirkte 1892 mit ihrer Zeitschrift ,Gleichheit',dass die sozialdemokratische Partei die Gleichstellung der Frauen in ihr Programm aufnahm.
1900 hob man das Immatrikulationsverbort für Frauen auf, sie durften nun an den Universitäten studieren. Bis dahin hatte man noch neben den körperlichen psychische und moralische Argumente gegen ein Studium der Frauen ins Feld geführt, da man glaubte, sie seien wegen ihres Gefühlslebens zum wissenschaftlichen Studium nicht fähig und befürchtete, dass wissenschaftliches Arbeiten Frauen entweiblichen könnte .
Mit der Neuordnung des Mädchenschulwesens 1908 in Preußen, ein entscheidendes Indiz des sozialen Wandels, berechtigte das Abitur an den Mädchenschulen von nun an generell zum Studium an den Universitäten. Die institutionalisierte Mädchenbildung nahm moderne Gestalt an.
Zum Leitbild der Frau gehörte von nun beides: Familie und Beruf, sie bestimmten ihre Lebensweise.
15.5 Das Bildungswesen in der DDR
Nach der Kapitulation Deutschlands war es das Ziel der Siegermächte, der deutschen Bevölkerung ein neues politisch-ideologisches und vor allem ein demokratisches Bewusstsein durch Bildung vermitteln. Im Potsdamer Abkommen liest sich das folgendermaßen: „Das Erziehungswesen in Deutschland muss so überwacht werden, dass die nazistischen und militaristischen Lehren völlig entfernt und eine erfolgreiche Entwicklung der demokratischen Ideen möglich gemacht wird.“638
In der DDR wurde die Neugestaltung des Bildungswesens in dieser Hinsicht einerseits beeinflusst durch die antifaschistische Tradition, andererseits bezog man als Quelle die
Ideen von Pestalozzi, Fröbel, von Pädagogen der deutschen und internationalen Arbeiterbewegung wie Marx und Engels bis Liebknecht und Zetkin, sowjetische Pädagogik und das Bildungswesen der UDSSR mit in bildungspolitische Entscheidungen ein. Es war im Interesse der Sowjetunion, dass die Erziehung der Jugendlichen in der DDR staatlich gelenkt und politisch-ideologisch geprägt wurde.
„Lernen war definiert als Beitrag der Schüler zu Weltfrieden und Sozialismus.“639 Bereits in Kinderbüchern vermittelte man die Grundthesen der Lehre von Marx, Engels und Lenin, in späteren Jahren gab es das Fach Staatsbürgerkunde und die FDJ, die die Welt interpretierten und eine Anleitung zum politischen Handeln gaben. Die „Erziehung zum Frieden“ beinhaltete für junge Menschen eine vormilitärische Ausbildung, was die Erziehung zum Frieden ad absurdum und zu einem unreflektierten Gut-Böse-Schema in ihrem Denken führte.
Das Fach Wehrerziehung und Wehrkunde, in den Schulen obligatorisches Schulfach, gilt als solch ein Beispiel für die Militarisierung des gesellschaftlichen Lebens. In diesen Unterrichtsstunden wurden in den Klassen neun und zehn, ab 1981 auch in der elften Klasse, Schießübungen, Geländespiele, vergleichbar mit einer Werbeveranstaltung der NVA, geübt. Später im Studium begann jedes Studienjahr mit der „Roten Woche“ aus Politseminaren, es bestand Anwesenheitspflicht.
Die Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit der NS-Zeit, im Westen eher zögerlich betrieben, wurde in der SBZ energisch forciert, und da ein großer Teil der Lehrer aktive Mitglieder in der NSDAP gewesen waren und damit aus dem Schuldienst entlassen werden mussten, stellte man kurzerhand Neulehrer mit 2-3monatiger Ausbildung ein. Das hatte einen Mangel an Qualität zur Folge.
Anders als im Westen entwickelten sich in der SBZ radikale Reformen in der Bildungspolitik: Ein sozialistisches Einheitsschulsystem mit dem Primat der staatlichen Schulen wurde entworfen, die Grundschule umfasste nun acht Jahre, und im Anschluss daran folgte die vier Jahre dauernde Oberschule.
Die Schule besaß mit der zehnklassigen allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule im Mittelpunkt eine führende Rolle in der Erziehungsarbeit. Sie erzog gemäß der Ideologie der SED:
„Die sozialistische Schule ist durch ihr Erziehungsziel gekennzeichnet, eine Generation heranzubilden, die den Aufbau des Sozialismus vollenden wird. Grundlage der gesamten Bildungs- und Erziehungsarbeit … ist der Marxismus-Leninismus...“ 640 Lehrer wurden hier zu Vermittlern des sozialistischen Weltbildes.
1965 verabschiedete man das bis zum Ende der DDR gültige „Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem“, es legte die Einrichtungen von Krippen und Kindergärten in der Vorschulerziehung, die zehnjährige polytechnische Oberschule, die erweiterte Oberschule, die zur Hochschulreife führte, Ingenieur- und Fachschulen, Universitäten und Hochschulen und Einrichtungen der Weiterbildung in Betrieben der
Industrie, Landwirtschaft und Verwaltungen, etc fest.641 Alle Kinder und Jugendlichen konnten eine zehn Jahre umfassende Oberschulbildung erwerben. Wer nicht bis zum Abitur die Schule besuchte, erhielt eine Berufsausbildung.
Die „Allgemeinbildende zehnklassige polytechnische Oberschule“ implizierte einen Tag in der Woche „in der Produktion“. Ende der 50er Jahre kam die polytechnische Bildung hinzu, die den Jugendlichen Einblicke und Kenntnisse in Technik und Produktion vermittelte und damit die Lebenswelt der Eltern von Arbeiter- und Bauernkindern zum Bildungsgut werden ließ.
Schule hatte nun die Aufgabe, auf das Berufsleben vorzubereiten, womit die technischnaturwissenschaftlichen Fächer in den Mittelpunkt rückten.
Alexander ist das einzige Familienmitglied der Roman-Familie Umnitzer, das vollständig in dem Bildungs- und Erziehungssystem der DDR sozialisiert wird bzw. aufwächst.
S. 164
Er würde sich mehr um den Jungen kümmern, beschloss Kurt. Sein Russisch wurde immer stockender. Auch seine Leistungen in der Schule ließen zu wünschen übrig, kürzlich hatte er eine Drei mit nach Hause gebracht: eine Drei! … Eine Drei, fand Kurt, fiel schon in den Bereich des Unanständige…
Die Entscheidung für einen Beruf wurde früher als in Westdeutschland getroffen, ebenso früh erfolgte der Eintritt ins Erwerbsleben.642
Wissenschaftlich interessierte Schüler gingen auf die Erweiterte Oberschule (EOS), wo sie das Abitur nach dem 12. Schuljahr ablegten. Danach waren die Wege zum Studium für motivierte und intelligente Jugendliche offen.
Von Bedeutung war die Förderung der Benachteiligten, aber auch die „Überwältigung der Andersdenkenden“.643 Hinter der Forderung, „wissenschaftliche Weltanschauung“ in Schule und Universität zu pflegen, stand eine marxistisch-leninistische Indoktrination und Kirchenfeindlichkeit mit dem Ziel der Entkirchlichung und Entbürgerlichung der Oberschule. Man wollte den Einfluss des Bürgertums und der Kirche auf die Jugend systematisch unterbinden und damit Chancenungleichheiten überwinden, um „individuelle Lernvoraussetzungen jenseits von Besitz und Stand“ zu schaffen und „einen Weg zur demokratischen Erziehung der Jugend“ zu bieten.644 Rechte des Sozialmilieus im Bildungswesen wertete man als „Privilegien“ ab und versuchte sie zu verbannen, z.B. indem man eine Vorschulerziehung in das System der Volksbildung einbezog.
Ziel war der solide gebildete Facharbeiter mit Allgemeinbildung, der durch Weiterbildung Aufstiegschancen nutzte.645 Allgemeinbildung - was hieß das in der DDR? Sie meinte die Verbindung von wissenschaftlicher Grundbildung und politisch-ideologischer Erziehung646, inhaltlich verbunden mit dem Namen Humboldt und der klassischen deutschen Bildung. Die traditionellen Bildungsbereiche Muttersprache und Literatur, Mathematik, Naturwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften, Fremdsprachen, Kunst und Sport gehörten zum Kanon der allgemeinen Bildung, mit starker Gewichtung auf die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer, denn hierin sah man eine Verwurzelung im bürgerlich-humanistischen Gedankengut deutscher Vergangenheit.647
Der „Neue Mensch“ - das war einegebildetesozialistische Persönlichkeit, deshalb wurden Kultur, Kunst und Literatur von Seiten des Staates mit hoher Wertschätzung belegt: Man zielte darauf, Arbeiter durch Theaterabende, Museumsbesuche und mit Bibliotheken in den Betrieben an Kultur heranzuführen und bot ausgewählte Werke der deutschen Klassiker als hoch subventionierte Bücher für niedrige Preise an.
Zum sozialistischen Bildungssystems gehörte es, dass jeder Jugendlicher die Pflicht hatte, einen Beruf zu lernen und die zweijährige Berufsschule zu besuchen, sofern er nicht andere weiterführende Bildungseinrichtungen besuchte.
Die Schulabsolventen erlebten eine zentralistische Ausbildungs- und Arbeitsplatzlenkung mit einem anschließenden sicheren Arbeitsplatz und nicht zuletzt auch einem Leistungsprinzip:
Durch qualifizierte Lehrausbildungen erhielt man gesellschaftliche Anerkennung, konnte beruflich aufsteigen und hatte damit nur eine geringe soziale und ökonomische Distanz zu Akademikern.
So wie es keine freie Wahl des Ausbildungsplatzes gab, stand ebensowenig die Wahl des Studiums dem Einzelnen frei. Der Staat bestimmte durch die zentralistische Planung die Berufs- und Studienwahl mit und erließ Zugangsbeschränkungen für weiterführende Schulen und Hochschulen. Solch ein Eingriff in die schulische Ausbildung hatte das Ziel, soziale Milieus zu nivellieren. Kindern aus bürgerlich-intellektuellem Milieu wurde häufig kein direkter Zugang zum Studium ermöglicht, stattdessen legte man ihnen die Berufsausbildung mit Abitur nahe, um ihren Bezug zur sozialistischen Arbeitswelt zu stärken.648 Damit ließ sich der Hochschulzugang zum Selektions- und Disziplinierungsinstrument bei der Bewerbung nutzen649: Wer aus der Intelligenz stammte, hatte im Aufnahmeantrag für die Oberschule oder Universität ein „I“ für Intelligenz, ein „A“ gab es für jemanden aus der Arbeiterklasse - gefördert wurden beim Übergang zur Oberschule und für die Aufnahme eines Hochschulstudiums eher Arbeiter- und Bauernkinder. Ein Großteil dieser Studenten erhielt Stipendien, um die ökonomische Unabhängigkeit von den Eltern zu stärken und diese zu entlasten. In den 80er Jahren gewährte man den Schülern der 11. und 12. Klassen Ausbildungsbeihilfen unabhängig vom Einkommen der Eltern.
Alexander studiert ein Fach, das seiner Neigung entspricht:
S. 299f
- Du hast dir das Studium selbst ausgesucht, sagte Kurt. Niemand hat dich gezwungen, Geschichte zu studieren, im Gegenteil.…
- Du hast mir abgeraten, ich wei…
Systemtreue und Angepasste besaßen per se ein Bildungsprivileg in der DDR, und da nur 10 % eines Jahrgangs das Abitur machen durften, verlangte die Schulbehörde neben guten Zensuren auch die gesellschaftliche Tätigkeit und eine politische Position.
Kritiker an diesem Verfahren wertete man als imperialistisch und reaktionär ab und ließ ihnen keine Möglichkeit des Einflusses.
Ein Abbruch des Studiums galt als Verweigerung der Integration in die DDR. Alexander ist 1979 ein Verweigerer:
S. 299
- Ich schreibe meine Diplomarbeit nicht fertig…
- Aber ich weiß, was ich nicht will: Ich will nicht mein ganzes Leben lang lügen müsse…
- So ein Quatsch, sagte Kurt. Willst du sagen, ich lüge mein Leben lan…
- Sascha schwie…
Eine Karriere ist damit für ihn ausgeschlossen.
Seine Eltern hatten die Grundlagen für seine akademische Ausbildung gelegt. Kurt interveniert zu diesem Zeitpunkt. Er fordert Pflichtbewusstsein und ruft seinen Sohn zur Arbeit auf, Arbeit wird von ihm nicht mehr nur als Beitrag zur sozialistischen Gesellschaft verstanden, sondern als Sinnerfüllung für das Individuum.
Charlotte, Wilhelm und Kurt repräsentieren eine Aufstiegsgeschichte innerhalb einer sozialistischen Gesellschaft vom Arbeitermilieu in ein akademisches bzw. gesellschaftlich anerkanntes Milieu. Sie verkörpern die Überwindung des bürgerlichen Bildungsprivilegs durch die besondere Förderung als Kinder von Bauern und Arbeitern.
Aufstiegskriterien und Paradigmen des Handelns sind Bildungsanstrengungen (insbesondere bei Charlotte) und die grundsätzliche Orientierung am Sozialismus (insbesondere bei Wilhelm)
S. 46
In der Kommunistischen Partei hatte sie zum ersten mal Respekt und Anerkennung erfahren … erst die Kommunisten hatten ihre Talente erkannt, hatten ihre Fremdsprachenausbildung gefördert, hatten sie mit politischen Aufgaben betrau…
S. 189
Ein Leben für die Arbeiterklass…
… trat im Januar 1919 in die Kommunistische Partei Deutschlands ein …
S. 198
- Ich bin Metallarbeiter. Ich bin siebzig Jahre in der Parte…
Doch auch wenn es in der Theorie Bildungschancen nicht mehr nur für privilegierte und wohlhabende Familien gab, unterschieden sich die Kinder in ihrer jeweiligen Herkunft (Intelligenz, Bauern und Arbeiter), und trotz der formalen Bevorzugung der Arbeiter- und Bauernkinder verschafften Eltern mit höheren Bildungsressourcen weiterhin ihren Kindern Bildungsvorteile. Wer Eltern mit Abitur hatte, hatte eine fünfmal größere Chance auch das Abitur zu machen. Das Ziel der Gleichheit wurde in der DDR nicht erreicht, es entstanden soziale Ungleichheiten, neue Hierarchien der Macht und Ungleichheiten im Lebensstil und Konsum. Nicht das wirtschaftliche Kapital sondern die politische Macht hatte einen elitären Status.
Jedem Jugendlichen war aber auch klar, dass die längerfristige Verpflichtung von drei Jahren bei der NVA und ein system konform es Elternhaus den Besuch der EOS eher ermöglichten.650
Sascha muss noch in die NVA. Zwar ist er zunächst systemloyal, empfindet jedoch Widerwillen, in Uniform in der Öffentlichkeit aufzutreten. Militärdienst als Voraussetzung und Kompromiss- oder Einstiegsleistung für eine spätere berufliche Karriere, so die Erwartung seines Vaters, ist für ihn nicht akzeptabel.
Die Erwägung einer Selbstverstümmelung zeigt die Tiefe der Verunsicherung.
S. 210
Am vierten Tag hatten sie zum ersten Mal Politunterricht: Neofaschismus und Militarismus in der BR…
… Am siebten Tag standen sie im Gelände, Linie zu einem Glied …
Am fünfundzwanzigsten Tag war Vereidigung. Die Zeremonie fand auf irgendeinem Platz außerhalb der Kaserne statt. Reden, Fahnen, Pauken, Trompeten. Dann legten sie den Eid ab, den sie im Politunterricht hatten auswendig lernen müssen. Ihre Vorgesetzten gingen durch die Reihen und prüften, ob jeder den id auch tatsächlich sprac…
S. 219
Die Idee kam ihm in dem Augenblick, als der Offiziersschüler vergaß, seine Waffe auf Sicherheit zu überprüfen … Es waren nur Millimeter, die ihn vom Zustand dauernder Wehruntauglichkeit trennten, sein Daumen lag jetzt auf dem Abzug, es genügte eine Bodenwelle …
Mit dem Vereinigungsvertrag 1990 erkannte man die ostdeutschen Abschlüsse zwar an, reformierte aber das Schulsystem samt seinen Inhalten. Karrierechancen ergaben sich von nun an durch einen guten Schulabschluss, höhere Bildungsabschlüsse erhöhten die Erfolgswahrscheinlichkeit und berufliche Chancen.
Mit der Wende entfiel die Ausbildungs- und Arbeitsplatzgarantie, und es änderten sich die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt. Vor der Wende gab es keine beruflichen Zukunftsängste, von politischer Seite her war das Leben vorgezeichnet, nun musste mit der Vereinigung von der vorgegebenen Lebensplanung Abschied genommen werden.
Im Vergleich zu den Zeiten der DDR-Berufslenkung konnten die Ostdeutschen zwar nun das werden, was sie wollten, hatten aber nicht selten Probleme einen Ausbildungsplatz oder Beruf zu finden, der ihren Neigungen entsprach und sie zufrieden stellen konnte.
Markus kann seinen Berufswunsch nicht verwirklichen und hat Schwierigkeiten im Berufseinstieg:
S. 380
… (eigentlich wäre er gern Tierpfleger geworden, und wenn das nicht möglich war, weil es angeblich keine offenen Lehrstellen gab, wäre er am liebsten Koch geworden, da gab es offene Lehrstellen, aber nein: Kommunikationselektroniker…
Er wird mit seinem Scheitern konfrontiert, Beziehungen und Abhängigkeiten nagen am Selbstwertgefühl, dabei könnte die Familie ein Ort der Geborgenheit sein und die Folgen des Wandels abmildern. Sein Stiefvater vertritt bürgerliche Bildungsaspirationen und versucht Markus von einer nutzvollen Investition in eine höhere Bildung zu überzeugen.
5. 379f
- Es geht nicht darum, dass ich die diese Lehrstelle besorgt habe, sagte Klau…
- und wie dankbar er sein müsse, dass Klaus ihm die Lehrstelle besorgt hätte blablabla. …
- Wenn du nicht sofort umkehrst, Markus, dann müssen auch wir irgendwann …
- O Mann, sagte Marku…
- Du hörst jetzt zu, schrie Mudde…
- Der hat mir gar nicht zu sagen, der Wichser, schrie Markus zurüc…
Die Anpassung junger Menschen (wie Markus) an ein neues soziales, politisches und ökonomisches System war bei der Wiedervereinigung für sie ein doppelter Transformationsprozess. Sie erlebten die biologische und soziale Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen, es gab für sie neue Chancen und Freiheiten - aber der Umgang mit Freiheit stellte hohe Ansprüche an das Individuum: Freiheit bedeutete nun, eigene Entscheidungen zu treffen, und oft waren diese schwer zu realisieren oder bedeuteten durch die vielfältigen Wahlmöglichkeiten eine Überforderung. Die Einbettung in die kollektive Gemeinschaft von Familie und Gruppen war abgelöst worden von der individuell autonomen Lebenssteuerung und Eigenverantwortung und dies führte, wie der Roman zeigt, bei vielen Menschen der DDR zu erheblichen Orientierungsproblemen.
15.6 Non-verbale und verbale Verhaltenskultur/Kommunikation im Bürgertum
Mit dem Bürgertum ging eine Verhaltenskultur einher, die sehr von der des Adels abwich. Existierte im Adel eine ständische Ausbildung mit dem Ziel der Selbstrepräsentation (als Inhalte der höfischen Körperkultur standen das Fechten, Voltigieren, das Ballspiel und das Tanzen im Mittelpunkt) setzte die bürgerliche Körper- und Bewegungskultur dem affektorientierten Auftreten des Adels ein bürgerlich-natürliches, zweckmäßiges Verhalten entgegen, z.B. in der Erscheinung des Mannes - sie wurde schlichter und verlor an Eleganz, seine Körpersprache war von Zurückhaltung geprägt (z.B. imTanz) und das Äußere der Frau stand im Vordergrund.
Eine Verbeugung verstand der Bürger als Unterwerfungsgeste und symbolische Selbsterniedrigung und nahm sie aufgrund des bürgerlichen Emanzipationsideals und der beschworenen „Natürlichkeit“ zurück. „Im bürgerlichen Lebenskontext ist die Verbeugung keine ,produktive’ Umgangsform mehr, sondern museales und damit letztlich fremdes Ornament.“ 651 Nur besonders achtungswerten und hochgestellten Menschen gegenüber sollte beides noch gezeigt werden, oder als eine galante Geste bei der Frau, wobei man hier mit der Umkehrung der Machtverhältnisse in der Gesellschaft spielte.652
Weiterhin war beim Anstandsbesuch ein tadelloses Verhalten in der Verbeugung die Norm, wirkte aber als übertriebene Geste lächerlich, wie beim Besuch Herrn Grünlichs: (TM)
S. 93
Mit einem letzten, sehr langen Schritt trat er heran, indem er mit dem Oberkörper einen Halbkreis beschrieb und sich auf diese Weise vor Allen verbeugt…
Herr Grünlich hatte wiederum auf jeden Namen mit einer Verbeugung geantworte…
S. 97f
Herr Grünlich küsste der Konsulin die Hand, wartete eine Augenblick, dass auch Antonie ihm die ihrige reiche, was aber nicht geschah, beschrieb einen Halbkreis mit dem Oberkörper, trat einen großen Schritt zurück, verbeugte sich nochmals, setzte dann mit einem Schwunge und indem er das Haupt zurückwarf, seinen grauen Hut auf und schritt mit dem Konsul davo…
In der Verbeugung, dem ,Diener‘, des Buddenbrookschen Arbeiters zeigt sich die leibliche Unbeholfenheit und Tollpatschigkeit des einfachen Menschen und gleichzeitig die sprachliche Ungebildetheit und Zugehörigkeit zur unteren Schicht.
S. 400f
Er hat einen schwarzen Rock angezogen - es ist ein abgelegter des Konsuls - trägt aber Schmierstiefel mit Schäften und einen baumwollenen Shawl um den Hal…
„Ick bün man ,n armen Mann, mine Herrschaften, öäwer ick hew ,n empfindend Hart, un dat Glück un de Freud von min Herrn, …
… wi müssen all tau Moder warn, tau Moder. tau Moder.…
(ER)
Bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts waren der ,Diener‘ des Jungen und der ,Knicks‘ der Mädchen bei uns noch als Relikte des leiblichen ,compliments' des 18./19. Jahrhunderts erhalten.
Im Begrüßungszeremoniell reduzierte sich der non-verbale Anteil: Früher vollzog sich der Gruß mit großen ritualisierten, sprachlichen und körperlich-gestischem Aufwand und aufwendigem Begrüßungs-compliment, vereinfachte sich aber dann auf einen mündlichen und ungezwungen gesprochenen Gruß. Bürgerliche Kommunikation stellte Effizienz und Sachnutzen in den Vordergrund und redimensionierte Sprache zur kurzen Sachinformation und Höflichkeitsfloskel.
(TM)
S. 14
„Besten Dank“, sagte er (Herr Jean Jacques Hoffstede, der Poet der Stadt), nachdem er den Herren die Hände geschüttelt und vor den Damen - im besonderen vor der Konsulin, die er außerordentlich verehrte - ein paar seiner ausgesuchtesten compliments vollführt hatte, compliments, wie die neue Generation sie schlechterdings nicht mehr zustande brachte…
Das Kompliment heute umfasst eine schmeichelnde, dem Äußeren meist zugeordnete Äußerung .
(AG)
S. 345
Nach einer Weile lächelt er und sagt mühsa…
- Obach…
Eine Wendung, die Alma von früher kennt. Sie nimmt an, dass er damit ausdrücken will, sie gefalle ih…
- Bin ich hübsch? fragt si…
Er nick…
(ER)
Im DDR-Familienroman findet sich statt eines verbalen Kompliments das Lob:
S. 14
Egal, was Irina ihm vorgesetzt hatte. Er hatte es aufgegessen und gelobt - ausgezeichnet! Immer dasselbe Lob, immer dasselbe „Danke“ und „Ausgezeichnet…
Als Anrede setzte sich im Bürgertum in der Öffentlichkeit das „Sie“ und familiär das private „Du“ durch.653 (TM)
In der Familie Buddenbrook werden in der Generation von Jean Buddenbrook die Eltern aus Respektbezeugung gesiezt, zwischen Tom und seiner Mutter ist die Anrede bereits zum „Du“ übergegangen:
S. 43
„Ja, um zur Sache zu kommen“, fing er (Jean Buddenbrook)an, „so wollte ich Ihnen nicht nur Gute Nacht sagen, Papa, sonder…
S. 333
ehrlich gesagt, ich verspreche mir viel Vergnügen von diesem Hausbesuch. Du nicht auch?…
Die heutige Sprachnorm galt aber im Sozialismus/Kommunismus wegen der Aufhebung der Klassen und der Gleichwertigkeit der Berufe und der (Werk)tätigen nicht: Man duzte sich und sprach sich mit dem Vornamen an. (ER) S. 203
- Wer bist du? Frau Bäcker, die Gemüseverkäuferin. Harry Zenk, Rektor der Akademie: war noch nie zu seinem Geburtstag gekommen.Aha, der Genosse Krüger. Abschnittsbevollmächtigte…
- In Uniform hätte ich dich erkannt, Genosse. Bring das Gemüse zum Friedho…
S. 178
Nachdem Günther - steif und ganz ohne Augenverdrehen - die Versammlung eröffnet und den einzigen Tagesordnungspunkt verlesen hatte, übernahm der Genosse Ernst das Wor…
Ein überaus wichtiges Element war dem Bürger die sprachliche Bildung. Sie begann im Kindesalter, und wurde in der höheren Schulbildung weiter geführt, vor allem in der stark sprachlich geprägten humanistischen Ausbildung, wohingegen der Unterricht der niederen Stände eher handlungsnahen Unterricht umfasste.
(TM)
Thomas Buddenbrook belehrt und examiniert seinen Sohn in dieser Hinsicht:
S. 485
„Oh, mein Lieber, das ist nichts!“ rief der Senator. „Man hängt dort nicht am Klavier und faltet die Hände auf dem Bauche. Frei Stehen! Frei sprechen! Das ist das Erste. … Und nun den Kopf hoch. und die Arme ruhig hängen lassen…
„Einen Vortrag beginnt man mit einer Verbeugung, mein Sohn! Und dann viel lauter…
Das Kommunikations- und Gesprächsverhalten der Bürgerkinder zeigte eine hohe spezifisch bürgerliche Qualität und war der anderer Kindern aus den unteren Schichten überlegen. Wortschatz und Kommunikation spiegelten Normen, Werthaltungen und die Mentalität ihrer Sprachgemeinschaft wider, d.h. in der Art ihrer sprachlichen Kommunikation fand sich eine ihnen eigene soziale Selbstdarstellung. Sprache diente den bürgerlichen Kreisen als Standesrepräsentation, sie half, ihren „sozialen Status zu inszenieren“.654 In der Folgezeit orientierten sich an ihr andere soziale Schichten.
(TM)
S. 294
Und dann diese Citate aus Heine und anderen Dichtern, die er(Thomas Buddenbrook)manchmal bei den praktischsten Gelegenheiten, bei geschäftlichen und städtischen Fragen in seine Rede einfließen lie…
S. 476
Seine(Thomas Buddenbrook)Laune war vortrefflich in den nächsten Tagen.und(er)hielt in der Bürgerschaftssitzung vom 3. Juni über den langweiligsten Gegenstand von der Welt, über irgend eine Steuerfrage, eine so ausgezeichnete und witzige Rede, dass er in allen Stücken Recht beka…
Für Charlotte als „Autodidakt“ (S. 115) stellt die Sprache ein Mittel zum sozialen Aufstieg und Ausdruck ihres emanzipatorischen Bewusstseins dar. Ihr beruflicher Aufstieg beruht auf ihrem kompetenten Umgang mit Sprache:
S. 46f
… erst die Kommunisten hatten ihre Talente erkannt, hatten ihre Fremdsprachenausbildung gefördert, hatten sie mit politischen Aufgaben betrau…
S. 122
Sie war Sektionsleiterin an einer Akademie…
S. 37
… und in dem Artikel, den man ihr zum Korrekturlesen gab, übersah sie absichtlich Druckfehler, damit die Genossen in Berlin auch wahrnahmen, auf welches Niveau diese Zeitschrift gesunken war, seit man sie als Chefredakteurin abgelöst hatte. Wegen „Verstoßes gegen die Parteidisziplin…
- Kannst du bis Anfang Februar etwas für die Kulturseite liefer…
Radovans Stimm…
- Eineinhalb Normseiten, regionaler Bezu…
Charlotte nickte und kritzelte etwas in ihren Kalende…
Sie nutzt die Sprache, um ihre gesellschaftliche Stellung gegenüber Lisbeth, dem Dienstmädchen, zu unterstreichen:
S. 398
- Ach was, Plastebehälter sagte Charlotte. Das kommt alles auf den Mül…
- In den Mül…
- Auf den Müll, sagte Charlotte. Wir sprechen hier immer noch Deutsc…
S. 400
- Selbstverständlich, sagte Charlotte. Entschuldige! Ich hatte vergessen, dass du hier die Hausherrin bis…
und für Veröffentlichungen im „Neuen Deutschland“:
S. 125f
Mehr als eine Frage des guten Geschmacks. Wolfgang Koppes Roman „Mexikanische Nacht“ im Mitteldeutschen Verlag. Von Charlotte Powileit.Im Grund genommen handelte es sich um eine Rezension, aber da sie auch grundsätzliche Fragestellungen behandelte, hatte man Charlotte eine Halbseite eingeräumt: alle sechs Spalte…
dieses Buch eignete sich nicht, um die Jugend zu einer weltzugewandten, humanistischen Haltung zu erziehe…
Gegenüber ihrem Sohn Kurt spricht sie devot-kindlich und sucht damit bei ihm gewissermaßen Liebe und Anerkennung:
S. 135f
Nun, wie fandest du meinen Artikel, fragte Charlotte und setzte hinzu: Aber sei nicht so streng mit mi…
15.6.1. Der Sozialwert der bürgerlichen Sprache - Hochsprache und Dialekt
Sprache diente und dient bis heute der sozialen Abgrenzung und der sozialsemiotischen Stilisierung. Die standardsprachliche Norm ohne Sprach- und Grammatikfehler mit der richtigen Wortwahl und Aussprache (dem Kriterium der Korrektheit ) gilt sowohl für die Schriftsprachlichkeit als auch für die Standardsprache.
Das Bürgertum kritisierte am Adel die höfliche Floskelhaftigkeit und die fassadenhafte Konvention und wollte stattdessen ursprünglich eine einfache unbefangene und natürliche Geselligkeit pflegen. Im Laufe der Zeit jedoch entwickelte sich auch ihre ritualisierter Höflichkeit zunehmend zu einem vom Schein geprägten Umgang.
Sprachliche Flexibilität je nach Situation und Adressat war für den Bürger ein Zeichen für kommunikative Kompetenz.
(TM)
Bendix Grünlich wird diese Fähigkeit von den Buddenbrooks zunächst unterstellt:
S. 98
„. Er sagt alles nur, um sich herauszustreichen!“. „ er sagt dir, Mama und dir, Papa, nur, was ihr gern hört, um sich bei euch einzuschmeicheln…
„Das ist kein Vorwurf, Tony!“ sagte der Konsul streng. „Man befindet sich in fremder Gesellschaft, zeigt sich von seiner besten Seite, setzt seine Worte und sucht, zu gefallen - das ist klar…
Das gesteigerte Sprachbewusstsein der bürgerlichen Familie setzte die Beachtung des elaborierten Sprachcodes im kommunikativen familiären Umgang fest. Korrektes akzent- und dialektfreies Lautieren und Intonieren waren ebenso wichtig wie das grammatikalisch einwandfreie Sprechen.
In der Aussprache legte man die Norm der hochdeutschen Lautung als Maßstab an. Gesprochene Sprache galt nur dann als schön, wenn sie sich an dem Hochdeutschen orientierte. Deutlichkeit, ein nicht zu lautes Sprechen, sondern das vornehme Leise zeichneten bürgerliches Sprechen aus, oftmals durchsetzt mit französischen Vokabeln, um Weltläufigkeit und Vornehmheit zu demonstrieren: (TM)
S. 12
„Excusez, mon cher!. Mais c’est une folie! Du weißt,…
Lautes Sprechen galt als ein typisches Charakteristikum der niederen Klassen, ebenso wie das hastige Sprechen, im Unterschied dazu war das Sich-Zeit-Nehmen beim Sprechen für den Bürgern ein Zeichen der Muße und des Zeithabens.
(TM)
Vertieft im Gespräch über kaufmännische Themen weichen die Besucher der Budddenbrooks von der Hochsprache in den Dialekt aus:
S. 29
Man war bald bei den Geschäften und verfiel unwillkürlich mehr und mehr dabei in en Dialekt, in diese behaglich schwerfällige Ausdrucksweise, die kaufmännische Kürze sowohl wie wohlhabende Nachlässigkeit zu haben schie…
(AG)
Richard pflegt in Anbetracht seiner beruflichen Position als Minister einen elaborierten Code und hat einen differenzierten und präzisen Wortschatz, und dies sogar in den letzten Tagen seines Lebens, als die Alzheimererkrankung ihn bereits aller Erinnerung und seines Sprachvermögens beraubt hat:
S. 343
- Der Rechtsanwalt wird Unterlassung anmahnen. Für den Fall von Säumigkeit erfolgt binnen sechs Woch…
- Das will ich allen Mitgliedern des Hohen Hauses empfehle…
Peter ist in der Jugend und als junger Mann ähnlich einsilbig wie sein Sohn Philipp:
S. 160
… ein eigeninniges, stilles Gesicht,…
S. 271
Peter murmelt betreten, aber ohne zu widersprechen, vielleicht weil er die richtigen Worte nicht finde…
5. 297f
- Dein Bruder ist nicht so geizig mit Auskünften. Dem muss man nicht jedes Wort vom Mund abkaufe…
- Weil er nichts zu erzählen hat. …
- Na komm, Philipp, erzähl uns was, sagt Peter. …
- Still und in sich gekehrt lehnt der Bub seitlich an der Tü…
Als alleinerziehender Vater steht er bei seiner Tochter im Ruf, kommunikationsfreudig zu sein:
S. 296
Solange du dich selbst reden hörst, bist du glücklic…
Die Hierarchisierung von Standardsprache und Dialekt war ein Bestandteil der bürgerlichen Sprachkultur, wobei man den Dialekt sowohl negativ als auch positiv bewertete: Von den Befürwortern als kraftvoll und urtümlich, emotional positiv definiert, zeigt er seine Nähe zum Leben655, markiert aber ebenso sozial die Unterschicht.
Eine besondere Rolle kam dem süddeutschen Dialekt zu: Er galt als weniger vulgär und akzeptabel, als schön und angenehm.
Literatur zeigt oftmals die komische Irritationen hervorrufende Funktion des Dialekts: (TM)
Permaneders bayrischer Dialekt ist ein Beispiel für Ungekünsteltheit und Naturwüchsigkeit und wird von Thomas Buddenbrook sozialexotisch interpretiert und wertgeschätzt656: Biederkeit, Einfachheit, Ehrlichkeit, Nähe sind Attribute der bayerischen Mundart, ebenso zeigt er zwischenmenschliche Direktheit und Emotionen, Spontanität und Wärme:
S. 331ff
„Is dös a Hetz!“ oder: „Des san G’schichten!“.…
Solche Laute hatten diese Räume noch nicht vernommen,,. solche verdrossen behagliche Formlosigkeit des Benehmens war ihnen fremd.Der Konsul aber amüsierte sich ganz vortrefflic…
„Ja, lieber Gott, das ist süddeutsch!“ sagte der Konsu…
Tony schämt sich für den Dialekt Permaneders aus dem Grund, weil sie als ein Mädchen des Bürgertums in Hinblick auf das Ziel des sozialen Aufstiegs durch die Heirat, eine dialektfreie und prestigeträchtige Sprache zu sprechen hat. Die sprachliche Bildung gehörte neben angemessener Kleidung zu den adäquaten Umgangsformen und zeigt(e) intellektuelle Bildung, andererseits hat sie die Erfahrung mit Bendix Gründlich etwas anderes gelehrt:
S. 333
„.Weißt du, wie er dich eben da unten genannt hat? ,Ein lieber Kerl' - das sind seine Worte…
„Gut Tom, du erzählst mir dies.. Das aber weiß ich, und das möchte ich denn doch aussprechen, dass es in diesem Leben nicht darauf ankommt, wie etwas ausgesprochen und ausgedrückt wird, sondern wie es im Herzen gemeint und empfunden ist…
S. 339
„.mehrere Male ist es ganz einfach vorgekommen, dass er im Gespräche ,mir‘ statt ,mich‘ gesagt hat. Das tut man da unten, Ida. Aber hier sieht Mutter ihn von der Seite an, und Tom zieht die Augenbraue hoc…
Gegenüber Menschen aus dem Volk oder im Familienkreis konnte der Gebrauch des Dialekts akzeptiert werden - wenn der Sprecher des Hochdeutschen mächtig war.
Thomas Buddenbrook spricht mit den Arbeitern Platt, was seine situationsadäquate Sprachkompetenz und seine Leutseligkeit unter Beweis stellt, in anderen Situationen und mit sozial Gleichgestellten grenzt er sich von diesen sprachlich ab.
S. 190
„Corl Smolt!“ fing der Konsul wieder an, . „Nu red’ mal, Corl Smolt! Nu is Tiet! Ji heww hier den leewen langen Namiddag bröllt…
Sein Großvater benutzt das Plattdeutsche, vermischt mit Hochdeutsch und Französisch, noch völlig ungezwungen im Familienkreis, was Jahrzehnte später, als die Anerkennung des Standarddeutschen als Prestigesprache zunahm, nicht mehr üblich war.
S. 15
„,N Aap is hei!…
S. 20
„Bonappétit…
In der Gesellschaft spielte die Unterhaltungsfunktion humoristischer Äußerungen in Dialektform eine wichtige Rolle, sie dienten zur Auflockerung der Stimmung und der Erheiterung der Gäste.
S. 30
„Kischan, freet mi nich tau veel“ rief plötzlich der alte Buddenbrook, „Thilda, der schadt es nichts . packt ein wie söben Drescher, die Dirn…
(AG) ..
Die deutsche gesprochene Sprache in Österreich besitzt eine dialektgefärbte Lautung, im Roman lesen wir typisch Begriffe aus der Alpenrepublik u.a. im Gespräch bei Peter und seinen Kindern, zwischen Ingrid und Peter:
S. 289
Daszipftmich so a…
S. 294
Wahrlich, was für einTropf.
S. 304
Mein Sohn trägt keinMascherl.
S. 317
Du brauchst deinenGrantnicht an Philipp auslasse…
S. 163
Wo man ihn übers Haxl gehauen ha…
Von Dialekt spricht Richard hinsichtlich der Sprache des Dienstmädchens, das aus der sozialen Unterschicht stammt:
S. 68
… diese Verschrecktheit aus Heimweh und der Unfähigkeit zu einem halbwegs normalen Deutsc…
Das Dienstmädchen Frieda spricht im Weinviertel Dialekt (S. 76)
(ER)
Das geschlechtstypische Kriterium, dass für Frauen sich ihre Intellektualität in ihrer sprachlichen Bildung widerspiegelt, stellt Ruges Roman unter Beweis: Charlotte erreichte mit einem differenzierten Ausdruck in der Sprache den sozialen Aufstieg.
S. 46f
… während also Carl-Gustav als Künstler gescheitert und im Schwulenmilieu Berlins versackt war, kehrte sie, die nur vier Klassen der Haushaltsschule besucht hatte, heute nach Deutschland zurück, um ein Institut für Sprachen und Literatur zu übernehme…
Ihr Sohn Kurt hat das Sprachvermögen und die Eloquenz geerbt, Spachbewusstsein zeichnet ihn aus und sichert ihm beruflichen Erfolg und Ansehen.
Seine Beliebtheit im Freundeskreis beruht auf seiner Fähigkeit, jede Erzählung in eine Anekdote zu verwandeln:
S. 10
Eigentlich ein Witz, dachte Alexander, das Kurts Verfall ausgerechnet mit der Sprache begonnen hatte. Kurt, der Redner. Der große Erzähler. Wie er dagesessen hatte in seinem berühmten Sessel - Kurts Sessel! Wie alle an seinen Lippen hingen, wenn er seine Geschichten erzählte, der Herr Professor. Seine Anekdoten. Komisch aber auch: In Kurts Mund verwandelte sich alles in eine Anekdot…
S. 20f
An diesem Tischlein hatte Kurt sein Werk verfasst.Eine komplette Spalte seiner schwedischen Wand hatte er auf dieser Weise zusammengehämmert. „einer der produktivsten Historiker der DDR“, hatte es geheißen.Für diesen Meter hatte Kurt Orden und Auszeichnungen.erhalten. hatte einen Kleinkrieg um Formulierungen und Titel geführt, hatte aufgeben müssen oder hatte mit List und Zähigkeit Teilerfolgte erziel…
Irina Umnitzer spricht beharrlich ihren russischen Akzent, selbst als sie bereits 30 Jahre in der DDR lebt, und beweist damit, dass sich ihre sprachliche Identität nicht verändert hat. So emotional wie sie ist, so emotional spricht sie, selbst als sie schwer erkrankt:
S. 24
-Saschenka. Du.Musst.Komme…
Vier Worte aus dem Mund einer russischen Mutte…
S. 164
Ich maache dir Sigarjet…
S. 324
Mein Sohn hat mich verratten, hieß die Forme…
Ihr sprachliches Verhalten in Ruges DDR-Roman ist kein Ausdruck mangelnder intellektueller Fähigkeit, sondern zeigt ihren Unwillen, sich jeder Veränderung anzupassen. Dialektfehler, wie z.B. „Ihrsinn“ (S. 56) statt Irrsinn, „Imbärmarmeladde“ (S. 72) statt
Himbeermarmelade, „DäDÄÄrre“ (S. 72) statt DDR, lassen das Persönliche Irinas authentisch hervortreten.
Wilhelms ideologisch geprägte, völlig unbürgerliche Sprache ist gefühl- und oftmals rücksichtslos. Dieser Figur fehlt jede liebevolle und höfliche Äußerung.
S. 57
Irina erinnerte sich gut daran, wie er letztes Jahr in seinem Ohrensessel gesessen und - einem Kind gleich, das immer denselben Witz wiederholt - jeden Gratulanten mit demselben Satz abgewatscht hatt…
- Stell das Gemüse in den Blumentop…
S. 82
- Na, dann woll’n wir mal sehen, was ihr da angerichtet habt für ein’ Affenfraß, sagte Wilhelm und stolzierte in den Salo…
S. 203
- Bring das Gemüse zum Friedho…
Selbst sein Enkel wird als Kind beim Frühstück ideologisch überprüft:
5. 93f
- Ach ja, sagte Wilhelm, du warst doch gerade in der Sowjetunion. Erzähl doch mal! Plötzlich war Alexanders Kopf lee…
- Na was, sagte Wilhelm, redest du nicht mit einfachen Leute…
In der DDR wandelte sich im Laufe der Jahrzehnte die Sprache in ein umständliches Amtsdeutsch, das bis zur Unverständlichkeit verzerrt wurde, eine Sprache mit inflationär gebrauchten Abkürzungen - im Buch: ZK (S. 172), ND (S.189) - in der die einfachsten Dinge in mathematisch-ökonomischen Modellen vorgestellt wurden, was Rationalität und Tempo signalisieren sollte.657 Emotionale Sachverhalte konnte man damit in der DDR sprachlich nur schwer vermitteln.658 Englischsprachige Bezeichnungen, u.a. in der elektronischen Datenverarbeitung (statt Computer „Rechner“) und bürgerlich-elitär klingende Begriffe wie „Semester“ (Studienhalbjahr) und „Kommilitone“ (Mitstudenten) waren verpönt bzw. wurden untersagt.
(ER)
S. 121
Nein, sie war natürlich nicht Institutsdirektorin. zu ihrem Bedauern hatte man die Institute in „Sektionen“ umgetauft, sodass sie sich nun, weniger klangvoll, nur noch „Sektionsleiterin“nannt…
Markus fühlt sich als Vertreter einer Generation, die sich der DDR nicht mehr verbunden fühlt und grenzt sich sprachlich von den übrigen Generationen und von der Familientradition ab. Durch unbürgerliche Umgangs- und Vulgärsprache distanziert er sich von dem Stiefvater.
S. 274
- Scheiße Pisse mit Kotze, sagte Mark…
Sein einseitiges und unreifes Frauenbild kommt ebenfalls in drastisch herabsetzender Sprache zum Ausdruck.
S.374f
… und die unerreichbar fernen GoGos auf den Boxen, die ihre Haare herumwarfen und ihren Bauch kreisen ließen und ihren Arsch kreisen ließen und ihre Fotzen kreisen ließen und gefickt werden wollten und niemals, niemals, niemals gefickt werden würden, jedenfalls nicht von ih…
Dann fand er die Schmutzigblonde mit den Sporttitten wieder.fummelte auch ein bisschen zwischen ihren Beinen herum, aber mehr war bei ihr nicht dri…
15.6.2 Das Gespräch als Konversation
Von großer Bedeutung in der bürgerlichen Sprachkultur war der „vernünftige Discours“, er galt als entscheidend für das menschliche Miteinander. Nicht mehr der geburtsrechtliche Stand, den der Adel mit seiner Befehlsgewalt inne hatte, waren bedeutsam im Gespräch, sondern die Artikulationsfähigkeit und Überzeugungskraft, die Auseinandersetzung mit Argument und Gegenargument - das Gespräch mit seinen Formen und Inhalten und seinen Normen wurde zur zentralen Form des Miteinanders.
Bürgerliche Gesprächskultur, das heißt bis heute, folgende Regeln einzuhalten: Man nimmt sich Zeit, lässt einander ausreden, hört dabei zu und holt erst dann zur Gegenrede aus.659
Eine Analyse der damaligen Anstandsbücher unterstreicht die große Relevanz der Kommunikationssituationen, sei es in den neuen Berufen, die mit den wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen im 18. und 19. Jahrhundert entstanden, in den Salons oder in der Sprach- und Kommunikationskultur der Schule und der argumentativ auf Einsicht zielenden Erziehung.660
Konversation, ein der Bildung verwandter Begriff, galt als Hauptmerkmal einer Unterhaltung sozial höher stehender Personen und meinte ein geselliges Gespräch unter gebildeten Leuten, mit verschiedenen Themen und Inhalten, meist oberflächlicher Art. Es ermöglichte das Anknüpfen von Seiten der Gesprächspartner, diente aber im wesentlichen der Selbstdarstellung.
Rührung und Sentimentalität wurden im Laufe des 19. Jahrhunderts mehr und mehr den unteren Schichten zugesprochen und damit abqualifiziert, während es für die oberen Schichten als typisch galt, mit Standhaftigkeit, Beherrschung, Feingefühl und Takt zu parlieren. Affektkontrolle und die Dämpfung der Triebe sollte grobes verbales und non verbales Verhalten verhindern ,und stets sollte die Vernunft im Gespräch dominieren.
(TM)
In dieser Hinsicht ist auch Tonys Reaktion auf Permaneders unschickliches Verhalten und dem „Wort“ zu erklären :
S. 375f
Es war eine Balgerei gewesen, ein unerlaubter und unsittlicher Ringkampf zwischen der Köchin Babette und Herrn Permaneder. ..drinnen im Schlafzimmer aber hatte er sie gefunden: in halb sitzender halb liegender Haltung, auf dem Bette, wie sie unter verzweifeltem Schluchzen immer wieder das Wort „Schande“ wiederholt hatte. . Da aber war zum Schlusse, ein Wort ihr nachgeklungen, ein Wort seinerseits, ein Wort, das sie nicht wiederholen würde, das über ihre Lippen niemals kommen würde, ein Wort.ein Wor…
Tony selber ist ein „Geradeausmensch, direkt, offen, spricht jede Schwierigkeit, jede Verwunderung augenblicklich an. Sie ist und bleibt bis zum Ende die einzige Buddenbrook ohne Seelenverstopfung.“ 661 Das Zeigen von Gefühlen ist im Roman allein ihr Vorbehalten, sie gibt ihrer Trauer beim Tod der Mutter und ihres Bruder und ihrer Wehmut beim Verlust des elterlichen Hauses ungehindert Ausdruck:
S. 384
Schluchzen, ein langsames, schmerzliches Aufschluchzen unterbrach ihn. Frau Permaneders Hingebung an ihren Kummer war so groß, dass sie nicht einmal daran dachte, die Tränen zu trocknen, die über ihre Wangen ranne…
S. 685
Da warf sich Frau Permaneder an dem Bett in die Knie, drückte das Gesicht in die Steppdecke und weinte laut, gab sich rückhaltlos und ohne irgend etwas in sich zu dämpfen und zu unterdrücken, einem dieser erfrischenden Gefühlsausbrüche hin, die ihrer glücklichen Natur zu Gebote standen. Mit gänzlich nassem Gesicht, aber gestärkt, erleichtert und vollkommen im seelischen Gleichgewicht, erhob sie sic…
Ansonsten war Affektkontrolle nicht nur im Gespräch von großer Bedeutung, sie zeigte sich auch besonders in der geringen Rücksichtnahme auf die persönliche Gefühle bei der Eheschließung.
Es galt, stets die ,dehors zu wahren’, Gefühle zu zähmen.
S. 312
„Man entschädigt sich für seine auf dem Comptoirblock seßhaft verbrachten Tage nicht nur mit schweren Weinen und schweren Gerichten. Aber ein dicker Mantel von biederer Solidität bedeckte diese Entschädigungen, und wenn es Konsul Buddenbrooks erstes Gesetz war ,die dehors zu wahren', so zeigte er sich in dieser Beziehung durchdrungen von der Weltanschauung seiner Mitbürger.…
Wie sehr man Feingefühl und Takt als eine gefällige äußere Form förderte, liest sich im Roman beim Einweihungsessen, als Herr Hoffstede seine poetischen Verse deklamiert und der Gastgeberin schmeichelt:
S. 32
„Gelegentlich der freundschaftlichen Teilnahme an dem frohen Einweihungsfeste des neuerworbenen Hauses mit der Familie Buddenbrook. Oktober 183…
Hochverehrte! - Nicht versäumen darf es mein bescheiden Lied, Euch zu nah’n in diesen Räumen, Die der Himmel Euch beschied…
Konversation und gesellschaftliche Unterhaltung bedeuteten eine Öffnung der Familie nach außen und fanden im „Gesellschaftszimmer“ statt, dem Repräsentationsraum des Hauses und dem Statussymbol der bürgerlichen Schichten. Die Einrichtung demonstrierte mit feinen Möbeln, Kunstgegenständen und Bücherschrank Bildung und Kultur und vermied zu viel Privatheit.
Der öffentliche und formelle Charakter eines Gesprächs zeigte sich bei Visiten und Anstandsbesuchen, hierbei hatte die höfliche Geste Ritualcharakter. Es bestand ein Wissen um die Verpflichtung zu Besuchen und um die zeitlichen Abstände der Besuche, um die angemessene Toilette und Uhrzeit, und es gab Regeln und Vorschriften zu Verhaltensanweisungen im Umgang mit Visitenkarten und Sitzordnung.662 Man durfte durchaus auf eigene Initiative und ohne Einladung eine Visite machen, dabei war es aber umso wichtiger sich adäquat zu verhalten.
(TM)
Grünlich versucht bei seinem Konvenienzbesuch, sich in die Familie mit der heiratsfähigen Tochter Tony einzuführen. Die sprachlichen Formulierungen zeigen Einleitungsfloskeln zur Gesprächseröffnung. Da die Visite kurz ist, darf das Gespräch nicht ins Stocken geraten. Elegant wird das Gespräch gelenkt, es folgt eigenen Gesetzmäßigkeiten, und nur Angenehmes wird gesagt. Wichtig ist auch hier eine individuelle Selbstdarstellung im Gespräch.
S. 93
„Ich störe, ich trete in einen Familienkreis“, sprach er mit weicher Stimme und feiner Zurückhaltung. „Man hat gute Bücher zur Hand genommen, man plaudert. Ich muss um Verzeihung bitten…
„Sie sind willkommen, mein werter Herr Grünlich!“ sagte der Konsul, der sich, wie seine beiden Söhne erhoben hatte und dem Gaste die Hand drückte. Ich freue mich, Sie auch außerhalb des Comptoirs und im Kreise meiner Familie begrüßen zu können…
… “Rastlose Tätigkeit ist für mich Lebensbedingung…
Herr Grünlich lobte die vornehme Anlage des Hauses, er lobte die ganze Stadt überhaupt, er lobte auch die Cigarre des Konsul…
Geselligkeit und das Sich-amüsieren spielten im Gespräch eine große Rolle, und hatte ein Gast ein geselliges Talent, sah man dies als eine besondere soziale Leistung an. Die Phrase des „Sich-amüsiert-Habens“ bei außerhäuslichen Geselligkeiten ist als ein Lob von bürgerlichen Frauen zu verstehen.663 (TM) S. 615
Wenn er, das Weinglas zur Hand, am Tisch stand und mit liebenswürdigem Mienenspiele, gefälligen Gesten und geschickt vorgebrachten Redewendungen, welche einschlugen und beifällige Heiterkeit entfesselten, einen Toast ausbrachte, so konnte er trotz seiner Blässe als der Thomas Buddenbrook von ehedem erscheine…
Innerhalb der Familie, im Freundes- und Bekanntenkreis findet bei den Buddenbrooks nur ein geringer Austausch über weltanschauliche, soziale oder politische Fragen statt, als jedoch Hausfreunde eingeladen sind, beginnen die Herren an der Tafel einen Disput über Napoleon, die französische Besetzung und die Befreiungskriege, die Anwesenheit und Bedrohung durch französische Truppen, Schulformen und Bildung. (S. 28f)
Frauen übten der geschlechtsspezifischen Konvention wegen Zurückhaltung, wenn es um Politik ging, und da es ihnen einfach an Kenntnissen darüber fehlte, wendeten sie sich ,weiblichen’ Themen zu.
Tony bekommt politisch-soziales Wissen durch Gespräche mit Morten vermittelt, das sie bis ins hohe Alter bei passender Gelegenheit äußert.
S. 352
Glauben Sie zum Beispiel, dass ich ganz kurze zeit vor meiner Verlobung auch nur gewusst hätte, dass vier Jahre früher die Bundesgesetze über die Universitäten und die Presse erneuert worden seien? Schöne Gesetze übrigen…
(ER)
Im DDR-Familienroman dagegen besitzt Charlotte als kommunistisch denkende Frau durchaus politische Kenntnisse, die sie in ihren Artikeln und auch in Gedanken äußert. In Gesprächen und Sitzungen aber lässt sie diese nicht verlauten.
S. 37
Ihr „Verstoß gegen die Parteidisziplin“ hatte nämlich hauptsächlich darin bestanden, dass sie am 8. März, am Frauentag, eine Würdigung des neuen Gleichberechtigungsgesetzes der DDR gebracht hatt…
… aber Charlotte unterdrückte jeden Impuls, sich einzumischen oder einen Vorschlag zu machen.Familie Umnitzer tauscht sich bei den Mahlzeiten über gesellschaftlich-politische und weltanschauliche Fragen aus und nutzt Tischgespräche für politische, hitzige und emotionale Diskussionen.
S.253
Wenn nicht gerade das Fett in der Pfanne zischte oder eine Maschine ging, hörte sie die Stimmen aus dem Zimmer, meist die der Männer, zweimal Umnitzer - da kam so schnell keiner zu Wort, immer hatten sie sich etwas zu sagen, immer redeten sie sofort und laut aufeinander ein, hatten drängende Neuigkeiten auszutauschen, in diesem Fall, wie auch anders, über das BiermannKonzert in Köl…
(AG)
Richard nutzt Gespräche mit seiner Tochter dazu, ihr seinen Unwillen bzgl. der Beziehung mit Peter mitzuteilen:
5. 145ff
- Denn eins will ich nicht unerwähnt lassen:…
Richard lässt sich gerade über die Ungeklärtheit von Peters wirtschaftlichen Verhältnissen aus .Die im Alter geführten Unterhaltungen mit seiner Frau Alma beziehen sich auf die Hilfe bei gesundheitlichen Problemen und Verunsicherungen seinerseits: S. 24ff
Als er diesmal kam, hoffte Alma, dass die Epoche der Staatsvertrags-Zähne endlich vorbei sei. . Ich kann mit einem Termin rechnen? fragte Richar…
Wir lesen eine Konversation, die von Almas Seite her geprägt ist von Respekt und Achtung. Sie vermeidet Streit und Konflikte, wie bereits in der konfliktreichen Zeit von Ingrids Pubertät, obgleich Richard ihre Äußerungen abqualifiziert und ihr despektierlich über den Mund fährt.
S. 25
- So ein Quatsch. Ich finde, ich hätte mir wünschen dürfen, dass sie noch ein paar Jahre halten. Alma versucht ihm nüchtern und in kurzen Worten beizubringen, einerseits was es mit den Furchen …
- Trotzdem trugen ihr ihre Deutungen mitleidige Blicke, abschätzige Hand beweg ungen und gönnerhafte Repliken ein, die alle auf dasselbe hinausliefen, dass in ihrem Kopf nicht allzuviel los sein könn…
Das ist überhaupt so eine fixe Idee von ihm. Alles, was sie sagt, ist am Ende lächerlich oder banal oder überdreht. Davon versteht du nichts, hört sie dann meistens. Und dazu dieses siebengescheite Minister-Getue.…
Sie lenkt in ihrer ausgleichenden Art ein und ist um Entschärfung der Situation und Konfliktvermeidung bemüht, indem sie Ernsthaftes spielerisch und humorvoll aufgreift. So geben Themenverlagerung dem Gespräch eine neue Wendung und führen zu Entspannung.
S. 25ff
Sie reagiert gar nicht mehr darauf, denn jede Widerrede wird mit dem unweigerlichen Standardargument quittiert, dass sie (Alma) an Verfolgungswahn leide. …
- Von mir aus kannst du sie trotzdem gerne der Mission vermache…
- Dein Spott ist genau das, was mir fehlt. Gib sie mir zurück. …
- Warum kommst du zu mir, wenn dich meine Meinung nicht interessiert? …
- Gib sie mir zurück, du verstehst nichts davon. …
- Lass gut sein. Ich werde Dr. Wenzel anrufe…
Gespräche zwischen Ingrid und Peter werden in den Anfängen ihrer Beziehung von Ingrid dominiert, das Thema ist die wirtschaftliche Zukunft und die Berufsentwicklung Peters: S. 163ff
- Aber was mir im Moment wichtiger ist als Liebeserklärungen, die dir keine Mühe machen, das sind Antworten auf ein paar Fragen. …
- Also, Atemholen:.…
Peter ist ihr sprachlich unterlegen:
S. 170
Und jetzt tief Luft holen, ausatmen, gut, zufrieden, sie ist zufrieden, wie geübt sie sich anhört mit ihrem Realitätssinn, schließlich, irgendwer muss kühlen Kopf bewahren, und warum ein Blatt vor den Mund nehmen, das fängt sie gar nicht erst an. Und Peter? Sieht aus, als hätte die Predigt gewirkt. Er hat gar nicht erst versucht, sie zu unterbrechen, hat nur dann und wann mit Duldermiene aufgeblickt... Er hantiert weiterhin stumm …
In der Krisenzeit ihrer Ehe finden Gespräche abends nach der Arbeit statt, sie beinhalten den fraglichen Fortbestand ihrer Ehe:
S. 271f
Er widmet sich eine Weile dem Fernseher, lacht sogar mehrmals, wie zweigeteilt, denn nachher, nachdem er eine Weile gewartet hat, richtet er sich auf und will darüber sprechen, wie es weitergeht.…
Ingrid reicht ihm verbal den einzigen Strohhalm, der zwischen ihren Fingern noch irgendwie Substanz ha…
- Es ist ein Erfolg, dass wir dieses Jahr überstanden haben. Das kommende kann eigentlich nur besser werde…
15.6.3 Der konversationelle Ablauf der Mahlzeit als ein Ritus im Familienleben
Gespräche in einer Familie werden zumeist beim täglichen gemeinsamen Essen geführt. Mahlzeiten waren/sind ein normaler Familienritus des Beisammenseins und somit die beste Gelegenheit, um sich zu unterhalten und das Essen zu einer „kommunikativen sozialen Veranstaltung“ zu machen.664 Die Familientischgespräche als soziale Veranstaltungen665 zeigen uns den sozialen Wandel der Familie und jeweils ganz unterschiedliche Kommunikationsformen, denn jede einzelne Familie kommuniziert in ihrem für sie typischen Stil.
So wie das gemeinsame Essen eine zentrale Gelegenheit ist, um die Identität familiärer Gemeinschaft zu zeigen666, hatten/haben Tischgespräche eine gemeinschaftsbildende Rolle, form(t)en die soziale Identität, sind/waren konstitutiv für die soziale Welt und für die soziale Orientierung.667
Es ist wichtig, Zeit für Gespräche zu investieren, nur so bleibt man eine lebendige Familie.668
Die bei Tisch stattfinden Gespräche variieren je nach (Roman)-Familie, der Verlauf der innerfamiliären Kommunikation spiegelt ihr Bild wieder und zeigt, wie groß der soziale Zusammenhalt und die Vertrautheit sind. „Am täglichen Gesprächsverhalten bei Tisch wird sichtbar, welche gemeinsamen Fertigkeiten die Mitglieder einer Familie ausgebildet haben, ihre Erfahrungen weiterzugeben und ihre Konflikte zu regeln.“669
Jeder einzelne nimmt im Tischgespräch seine Rolle wahr.
Die Romane sind ein Beispiel für historische Kontinuitäten und Diskontinuitäten in Bezug auf die Konversation und ihrer Themen und der Essensgewohnheiten bei Tisch.
Betrachten wir zunächst den Ablauf der Mahlzeit in der
- Familie Buddenbrook
Das täglich pünktlich eingenommene gemeinsame Essen war in der bürgerlichen Familie des 19. Jahrhunderts ein Ritual mit bestehenden Regeln und einer festen Sitzordnung verbunden. Man hielt sich an Tischsitten, eigene Zeremonien und einem bestimmten Verhaltenskodex
Ein Blick auf das Essen bei den Buddenbrooks zur Hauseinweihung, mit Anwesenden, die ein formales Band und eine soziale Übereinstimmung in Bezug auf die Welt und das Leben verbindet: Als Ort diente der Speisesaal im neu bezogenen Haus.
Beim Essen selbst kam es auf eine aufrechte Sitzhaltung und auf den untadeligen Umgang mit dem Besteck an. Das korrekte Zerkleinern der Nahrung und das Unterlassen von Geräuschen beim Essen galten als wichtige Regeln, die eingehalten werden mussten. S. 34
Die allgemeine Munterkeit hatte nun ihren Gipfel erreicht, und Herr Köppen verspürte das deutliche Bedürfnis, ein paar Knöpfe seiner Weste zu öffnen; aber das ging wohl leider nicht an, denn nicht einmal die alten Herren erlaubten sich dergleichen. Lebrecht Kröger saß noch genau so aufrecht an seinem Platze wie zu Beginn der Mahlzeit, Pastor Wunderlich blieb weiß und formgewandt, der alte Buddenbrook hatte sich zwar ein bisschen zurückgelegt, wahrte aber den feinsten Anstand, und nur Justus Kröger war offensichtlich ein wenig betrunke…
Die Aufgabe der Herren war es, das Gespräch mit einem Thema zu eröffnen; die Dame des Hauses sorgte dafür, dass bei Gesprächen ein steifer Ton vermieden und die gesellige Unterhaltung gefördert wurde. Sie steuerte die Konversation, war selber stets unauffällig und zurückhaltend an der Unterhaltung beteiligt. Mit Leichtigkeit wird ein Thema fallengelassen und ein neues Thema aufgenommen, zugleich liegt bei allem der gemeinsame Focus auf dem Essen im Austausch über die Speisen bzw. deren Qualität.
S. 21
Ein allgemeiner Stillstand des Gespräches trat ein und dauerte eine halbe Minute. …
S. 29
Das Gespräch floss in einen Gegenstand zusammen, als Jean Jaques Hoffstede auf sein Lieblingsthema zu sprechen kam, auf die italienische Reise, … Er erzählte von Venedig, Rom und den Vesuv, …
I. Kant gliederte die Konversation bei Tisch in drei Phasen: Erzählen-Räsonieren- Scherzen. Dies ist erkennbar in den Tischgesprächen der Familie Buddenbrook.670 Es zeigt sich eine Bevorzugung von Inhalten und Themen, die in Beziehung zu den Familienmitgliedern stehen, denn nur eine Gemeinsamkeit der Interessen und des Wissens garantiert stets den Fortgang des Gesprächs.671
Gesprächsthemen bei Tisch umfassten Belehrung, Erzählungen, Familiengeschichten, Zukunftspläne und die Berufswelt der jeweiligen Personen. Zum guten Ton der gehobenen Unterhaltung gehörte es einerseits, die Bereiche der Politik und Religion auszulassen. Sie hätten zu Auseinandersetzungen und Konflikten führen können, ebensowenig aber berührte man in der Runde die Privatsphäre der Familienmitglieder und ihre individuelle Intimität. Stattdessen sprach man lieber Erlebnisse des Tages an und über öffentliche Themen, bei denen sich die Gemüter nicht all zu sehr erhitzten, wechselte rasch und leicht, rekurierte auf Ereignisse, die in der jüngsten Vergangenheit lagen und bekannt waren.
Weitere Gesprächsthemen umfassten bildungsbürgerliche und arbeitsferne Bereiche, z.B. Reisen, Tagesneuigkeiten, kulturelle Themen, literarische Lektüre, Themen also, die Jedermann interessierten.
S. 30
… er sprach von der Villa Borghese, wo der verstorbenen Goethe einen Teil seines Faust geschrieben habe, er schwärmte von Renaissance-Brunnen, die Kühlung spendeten, von wohlbeschnittenen Alleen,…
Insbesondere Klatschgeschichten über Abwesende und Nicht-Familienmitglieder mach(t)en die Tischgemeinschaft zur Gesprächsgemeinschaft mit Gemeinschaftssinn, da sie aus der Sichtweise des Erzählenden das Verhalten Dritter mit dem eigenen bewerten und kontrastieren.672
S. 21
Traurig, dieses Sinken der Firma in den letzten zwanzig Jahren…
„Er war wie gelähmt“, sagte der Konsul…
„Aber ich glaube, dass Dietrich Ratenkamp sich notwendig und unvermeidlich mit Geelmaack verbinden musste, damit das Schicksal erfüllt würde…
Ziel der Tischgespräche war stets die gesellige Unterhaltung, man wollte sich amüsieren und legte den Schwerpunkt im Gespräch eher auf die gefällige sprachliche Form als auf die Behandlung von Themen.
Der Umgangston war durch Leichtigkeit geprägt, und man wählte Themen, die für jeden die Möglichkeit des Gesprächs boten; auf Darstellung eines beruflichen Spezialistentums und Selbstdarstellungen sollte dabei verzichtet werden.673 So ist z.B. das Erzählen von Anekdoten wie bei dem Buddenbrookschen Mahl als Rekurs auf vergangene Ereignisse ein Mittel der leichten und witzigen Unterhaltung. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf den primären Erzähler. Hier übernimmt der Pastor die Sprecherrolle, der als einziger die Geschichte miterlebt hat. Seine Rekonstruktion der Geschichte dient in diesem Fall der Erinnerungspflege, dem Vergnügen und der gemeinsamen Wertschätzung einer Person: der Konsulin. Es ist eine im Nachhinein heitere Begebenheit in einer schweren Zeit674 und trägt zur Unterhaltung und zum Amüsement bei, es überwiegt die spaßhafte Wiedergabe aus der gemeinsamen Geschichte (S. 23 - S. 26): Die Franzosen hatten Lübeck und das Buddenbrooksche Haus besetzt und machten sich über das Silberzeug der Familie her, Madame Buddenbrook wollte sich aus Verzweiflung in die Trave stürzen, um ihrem Leben ein Ende zu setzen. Sie begegnet Pastor Wunderlich, der sich in das Haus begibt und mit den Franzosen geschickt verhandelt und die Hausherrin als Landsfrau mit französischer Abstimmung vorstellt; daraufhin unterlassen die Franzosen ihr Treiben und ziehen ab.
In solchen Familien-Erinnerungs-Geschichten aus der Vergangenheit spiegelte sich das Gedächtnis einer Familie und insbesondere dann, wenn Gäste und Gastgeber sich an gemeinsame Ereignisse erinnern, wirken diese Erzählungen identitätsstiftend.
Nicht selten brachten schulische Ergebnisse und Wissensabfrage das Kind in den Gesprächen auf den Prüfstand, es musste sein Wissen unter Beweis stellen, so wie Tony in ihren Kenntnissen des Katechismus vom Großvater ,examiniert‘ wird:
S.…7f
Die Konsulin Buddenbrook, . warf einen Blick auf ihren Gatten, der in einem Armsessel bei ihr saß, und kam ihrer kleinen Tochter zu Hilfe, die der Großvater am Fenster auf den Knien hielt. „Tony!“, sagte sie, „ich glaube, dass mich Gott…
Und die kleine Antonie, . wiederholte noch einmal: „Was ist das“, sprach darauf langsam: „Ich glaube, dass mich Gott“, fügte, während ihr Gesicht sich aufklärte, rasch hinzu: „- geschaffen hat samt allen Kreaturen“,…
Ein Kontrast dazu sind Christians Gesprächsbeiträge, sie werden im Laufe der Jahre taktloser und peinlicher und zeigen, wie sehr die bürgerliche Ess- und Feierkultur der Familie erodiert:
S. 262f
Madame Grünlich lachte so ziemlich allein in der kleinen Tafelrunde; aber Christian fuhr mit umherwandernden Augen zu sprechen fort. Er sprach von englischen Cafe-Concert-Sängerinnen, er erzählte von einer Dame, die mit einer gepuderten Perücke aufgetreten se…
„Assez, Christian!“sagte die Konsulin. „Dies interessiert uns durchaus nicht…
„Ja“, sagte Tom, „ich verstehe recht wohl, was du meinst, Tony, Christian ist herzlich indiskret. Aber andererseits kann er auch in der Weise die Contenance verlieren, dass er selbst in das unangenehmste Ausplaudern gerät und sein Intimstes nach außen kehrt. Das mutet manchmal geradezu unheimlich an. Ist es nicht, wie wenn einer im Fieber spricht?…
Bei einem Gespräch zwischen Herren und Damen unterschied man ,zu männliche’ Themen (Jagderlebnisse, Politik) und andererseits ,zu weibliche' (Haushalt) Themen. Erst wenn eine Gesellschaft sich nach dem Aufheben der Tafel teilte, die Männer sich im rituellen Ablauf in das Rauchzimmer zurückzogen, die Damen bei Kaffee und Likör im Salon blieben, wurden diese geschlechtsbezogenen (hier: politischen) Themen besprochen.:675 S. 39
Dann aber begann man vom Zollverein zu spreche…
Unser System ist doch so einfach und praktisch, wie? Die Einklarierung auf Bürgereid…
Das Tischgespräch zwischen Tony und ihrem Mann Grünlich hat einen völlig anderen Inhalt und Verlauf. Es schildert einen verbalen Konflikt. Konflikte gehören zur Ehe und zum familiären Beisammensein, doch hier begleiten permanente Meinungsverschiedenheiten, den Lebensstil und die Geldausgaben betreffend, die Mahlzeit. Es entwickelt sich eine Diskussion, in deren Verlauf Tony die Anschuldigungen von Grünlich bzgl. ihres verschwenderischen Lebensstils zurückweist. Trotz allem wird während des Konflikts die Form gewahrt.
S. 198f
„Du machst dich ja lächerlich“, sagte sie nach einigem Stillschweigen, indem sie ersichtlich ein unterbrochenes Gespräch wieder auf nahm. „Hast du Gegengründe? Gib doch Gegengründe an!. Ich kann mich nicht immer um das Kind bekümmern…
„Du bist nicht kinderlieb, Antonie.“„Kinderlieb. kinderlieb. Es fehlt mir an Zeit!.“ „Und du? Du ruinierst mich.…
„Ja. Du ruinierst mich mit deiner Trägheit, deiner Sucht nach Bedienung und Aufwand…
Jede Familie ist durch eine asymmetrische Rollenverteilung geprägt, die abhängig ist vom Alter, Bildungsstand und der familieninternen Rolle, die jemand innehat. Das Gesprächsverhalten der Töchter und Söhne in der Familie ist geschlechtsspezifisch unterschieden, Alter und Geschwisterrangplatz entscheiden mit über die Art des Gesprächsverhaltens.
Für Bürgerkinder war das Erleben solcher Situationen wichtig, sie erfuhren durch die Gespräche der Erwachsenen Entscheidendes für ihr Selbstverständnis und ihr zukünftiges Bürgerleben bzw. ihr Verhalten als Bürger, erhielten Einblicke in Beruf, Schule und Haushalt.676
S. 31
„Thomas, mein Sohn, sei mal so gut“, sprach Johann Buddenbrook, und zog sein großes Schlüsselbund aus der Beinkleidtasche. „Im zweiten Keller rechts, das zweite Fach, hinter dem roten Bordeaux, zwei Bouteillen, du?“ Und Thomas, der sich auf solche Aufträge verstand, lief fort und kam wieder mit den ganz verstaubten und umsponnenen Flasche…
In diesem Zusammenhang gibt es auch Unterschiede zwischen den Familienmitgliedern in Hinblick auf die Häufigkeit der Beteiligung am Gespräch. Das Gesprächsverhalten unterscheidet sich je nach dem sozialen Status der Person - dem einen Familienmitglied kommt mehr, dem anderen weniger Anerkennung zu im Gespräch.
Im Gespräch der Geschwister dominiert stets Thomas, z.B. bei der Verteilung des Erbes nach dem Tod der Konsulin:
S. 573
Und Thomas fuhr fort. Er fing mit den größeren Gegenständen an und schrieb sich diejenigen zu, die er für sein Haus gebrauchen konnte:…
S. 583
„Lieber Gott, du weißt gut, Tom, dass du tun wirst, was du für richtig hältst, und dass wir Anderen dir unsere Zustimmung nicht lange versagen können…
Ebenso hängt die Etablierung eines Themas vom Sprecher und dessen sozialen Status ab. Die Position eines Familienmitglieds in der Familiengruppe wird darin deutlich, wer Themen anspricht, wer überhört wird, auf wen reagiert wird. Die Reaktion der anderen „ist entscheidend für die Selbstdarstellung und Selbstwahrnehmung der einzelnen Gesprächsteilnehmer“.677 Der älteste Buddenbrook bekommt Respekt bezeugt, auf ihn hört man:
S. 8
Alle hatten in sein Lachen eingestimmt, hauptsächlich aus Ehrerbietung gegen das Familienoberhaup…
Betrachten wir nun die modernen Familienromane hinsichtlich der Familienmahlzeiten und ihrer Konversation.
- Familie Sterck (AG)
In der Kindheit von Richard verläuft die Mahlzeit streng formell, eine korrekte Sitzhaltung und ein untadeliger Umgang mit dem Besteck sind noch gefordert:
S. 47
Ganz im Gegensatz zu Richard. Bei dem muss immer alles stabil und berechenbar sein, und er hat ein Leben lang Form und Förmlichkeit verwechselt, wie es ihm daheim am Mittagstische vorgelebt wurde: Die Ellbogen müssen an den Körper gedrückt und die Zeigefinger in Längsrichtung des Stiels an das Besteck angelegt sein, wobei die Spitzen des Bestecks nicht in die Höhe zeigen dürfe…
Davon ist in der nächsten Generation kaum noch etwas zu finden, und auch der konversationelle Verlauf der Gespräche steht zu dem o.g. beschriebenen im Kontrast.
Beim Tischgespräch während des Frühstücks bei Familie Richard, das uns Arno Geiger schildert, sind Alma, Richard und Tochter Ingrid anwesend. Sie befinden sich in der Küche am Küchentisch und nehmen sich wenig Zeit für das Gespräch, Richard ist auf dem Sprung zur Arbeit.
In dem Gespräch bzw. besser gesagt, dem Streitgespräch und Konfliktthema dreht es sich um Lebensführungs-Angelegenheiten und um richtiges Sozialverhalten.
S. 142
Willst du dich für gestern entschuldigen? Es wäre ein gutes Zeichen und spräche für dich, wenn du Fehler einsehen und dich entschuldigen könntes…
Der Familienstatus von Richard und die Abhängigkeit der Tochter von ihm sind bestimmend für den Gesprächsverlauf: Durch die dem Vater zugestandene Autorität und seine herausragende Stellung in der Familie will er erzieherischen Einfluss auf das Kind nehmen. Dadurch entsteht ein Ungleichgewicht der Beteiligten und ein kommunikatives Gefälle. Die Steuerung des Gesprächs liegt in seinen Händen. Als verantwortungsvoller Vater greift Richard zum Mittel der Belehrung und thematisiert seine Einstellungen und Erfahrungen.
S. 143f
Ich muss mich sehr über dich wundern. Einer Fünfzehnjährigen würde dein Verhalten besser anstehen als einer Neunzehnjährigen. Dass du dich nicht schäms…
… Ich will nur hoffen, dass die Vernunft bald wieder die Oberhand gewinn…
Sein Ton wird schärfer, so dass ein Konflikt unvermeidbar wird.
Von seiner Seite ist eine hohe emotionale Beteiligung zu erkennen und im Laufe des Gesprächs, das man eher als Kriegsführung bezeichnen sollte, verändern sich seine inhaltlichen und sachlichen Argumente zu Restriktionen Ingrid gegenüber.
S. 148
Richard lässt sich gerade über die Ungeklärtheit von Peters wirtschaftlichen Verhältnissen aus … Für um so unverantwortlicher hält er es, einem Mädchen, das sechs Jahre jünger ist, mit Heiratsgedanken das Herz schwer zu machen, wenn man sein Studium seit Jahren nicht weiterbringe und auch sonst nichts vorzuweisen habe außer Schulde…
S. 150
Und jetzt ist Schluss! … solange du die Beine unter meinem Tisch hast, tust du gefälligst, was ich sage. Haben wir uns verstande…
Die Beziehung zwischen Tochter und Vater ist spannungsreich und das Gespräch von latenten Aggressionen durchzogen. Individuelle Sichtweisen prallen aufeinander, es wird persönlich aneinander vorbeigeredet. Ingrid reagiert auf die Sätze ihres Vater mit Einwänden und Relativierungen, die seine Person betreffen, und da Alma zwecks einer Entschärfung nicht eingreift, gibt es auch keine Gesprächsverlagerungen, um die Eskalation des Konflikts zu verhindern.
S. 149
- Mama, es ist so ungerecht, dass er sich zwischen zwei Menschen stellt, die sich lieben. …
- So kannst du Mama in die Tasche stecken. Bei mir funktioniert der Trick nicht. …
- Das ist der Gipfel! So lasse ich nicht mit mir reden! Ich erwarte von dir, dass du dich ins familiäre Regelwerk einfügst, sonst setzt es Konsequenzen! Ist das kla…
- Auch Alma sucht nach etwas, was sie sagen könnte. Offenbar ohne Erfolg. Nach einigen Sekunden … haut Richard mit der Hand auf den Tisch, dass die Tassen springe…
Vor dem Abbruch des gemeinsamen Essens erwartet Richard von seiner Tochter ein Zugeständnis und die Versicherung, dass sie sich ins familiäre Regelwerk einordnet: S. 150
- Ob wir uns verstanden habe…
- Ja, sagt sie kleinlaut, nicht, weil sie eingeschüchtert ist, sondern in der Erkenntnis, dass ihre Vater alles andere nicht hören würde und dass sie es erst recht nicht zuwege bringt, ihn zu einer anderen Meinung zu bekehre…
- Dann kann ich mich darauf verlassen, dass du mir keine weiteren Dummheiten machst? … und so nickt sie …
In einem der späteren, seltenen Tischgespräche schneidet Richard Alma gegenüber ein sehr intimes persönliches Thema, an, das beide betrifft: Die Veränderung des Lebens durch das Altsein, die damit einhergehenden Krankheiten und der nahende Tod:
S.39
Mit einer Handgeste bittet Richard sie, sich zu ihm an den Tisch zu setzen. Er lässt die Hand ausgestreckt, bis er sicher ist, dass Alma seiner Bitte nachkommt. Sie schenkt sich ebenfalls eine Tasse Kaffee ein. Als Richard sich eine Zigarette anzündet, schließt sie sich auch darin an, weil es selten genug vorkommt, dass sie gemeinsam am Tisch sitzen und sich unterhalte…
S. 40
-Ich würde gerne wissen, wann das beginnt, dass man den Kopf nicht mehr rechts und nicht mehr links wenden kann. …
- Der Beginn ist schleichend, nehme ich a…
- Familie Erlach (AG)
Gespräche zwischen Ingrid und Peter zeigen in jungen Jahren und in ihrer Ehe ein kommunikatives Gefälle. Als Studentin dominiert bei Ingrid die ernsthaft urteilende und verurteilende Besprechung, wobei der Stil des sprachlichen Umgangs an ihren Vater erinnert, Peter hingegen kommuniziert nicht, sondern verstummt:
S. 168ff
Dir Geld geben ist wie Wasser in ein Schaff ohne Boden schütten, du weißt, Papa hat einmal daran gedacht, dir finanziell unter die Arme zu greifen, aber als er gesehen hat, dass vom Studieren keine Rede ist, war es nur konsequent, dass er davon wieder abgekommen ist. …
Hab du nur auch ein bisschen Geduld und mach es mir dadurch leichter, Peter, … aber du musst jetzt mit eiserner Energie arbeiten und wirklich versuchen, Papa einen Beweis deiner Tüchtigkeit liefer…
Später in ihrer Ehe gelingt es den Eheleuten nicht, die eigene Wirklichkeit zu kommunizieren, die Ereignisse und Gefühle des anderen zu kommentieren oder die Erfahrungen des anderen zu teilen. Die moderne Familie der heutigen Zeit ist partnerschaftlich, die Eheleute beanspruchen für sich beide den gleichen Status. Die Probleme und Angelegenheiten von Ingrid könnten zu einem familiären Gespräch werden, tun es aber nicht.
S. 246
In der Tat ist sie schon wieder sauer, kaum hat sie ein paar Worte mit Peter gewechselt. … Obwohl sie viel mehr leistet als er, erhält sie fast nie ein Kompliment, außer vielleicht, dass das Essen gut ist. … Es wird tunlichst alles vermieden, was daheim den Eindruck erwecken könnte, sie sei tüchtig oder gar begehrenswert. …
Wie war der Dienst, Ingri…
Das fragt nieman…
Da sie schon einmal dabei ist, teilt sie Peter mit, dass sie es zuwege gebracht hat, ihren nächsten Dienst von Sonntag auf Montag zu tauschen … Peter regt sich furchtbar auf, er habe sich für Montag soviel vorgenommen, er sei davon ausgegangen, Ingrid werde zu Hause sein …
Ob dann am Montag wenigstens etwas gekocht sei, fragt Peter. Das empfindet Ingrid erst recht als eine Frechhei…
Die soziale Bedeutung des Fernsehens hat zugenommen und behindert oftmals die interpersonellen Beziehungen in der Familie. Da es in der Familie Erlach einen Mangel an Gesprächsstoff zu geben scheint, wird Bezug genommen auf die Produktion ,Der Hofrat Geiger’, in der Ingrid als Kind mitspielte. Durch dieses Medienereignis, das wiederholt angeschaut wird, scheint es einen Vergemeinschaftungs-Effekt in der Familie zu geben - wenn auch nicht gerade in der erzählten Situation, in der Peter durch die Bohrmaschine Störungen im Fernsehbild verursacht:
S. 250
-Morgen muss der Pyjama gewaschen werden, sagt Ingri…
Sie hilft Philipp hinein, fordert ihn auf, mit nach unten zu kommen und sich im Fernsehen die Mama anzuschauen, wie sie als Mädchen in Schwarzweiß und im Schürzenkleid ausgesehen hat. Wie war eigentlich die Farbe? …
Philipp geht nach draußen und kommt mit Sissis orange getönter Skibrille zurück. Er schildert den Film in Farbe und äußert die Hoffnung, dass er die Mama, wenn sie ins Bild komme, mit Hilfe d…
Skibrille besser erkennen werden. Sissi verpasst Philipp einen Schlag auf den Kopf, er höre doch, dass die Mama fernsehen wolle …
Ein weiteres Beispiel für ein Tischgespräch findet sich auf S. 254, in der Küche anwesend sind Ingrid, Peter und die Kinder, doch Zeichen für familiären Zusammenhalt sucht man vergeblich:
Die Unterhaltung beim Essen ist normal und friedlich. Wenn nicht Sissi den Mund offen hat, sagt Ingrid belangloses Zeug über den Dienst, damit keine Stille entsteht, von der sie weiß, dass sie Philipp bedrückt. Ingrid hat die Beobachtung gemacht, wenn es am Tisch still ist, fängt Philipp an, mit dem Essen zu spielen. Hingegen isst er brav, wenn man Geschichten erzählt. …
Philipp isst brav … Ansonsten interessiert die Geschichte niemanden, wieso auc…
Philipp sag…
- Es wäre leichter, wenn das Essen nicht wär…
Für alle steht hier die Nahrungsaufnahme im Vordergrund. Es gibt zunächst einen gemeinsamen Beginn des Essens, ohne profane Segenswünsche. Eine Unterhaltung wird von der Mutter begonnen, um ihren Sohn zum Essen zu bewegen. Wir wissen: Es ist wichtig, Zeit für Gespräche zu investieren, um eine lebendige Familie zu sein678. Familie Erlach hingegen nimmt sich wenig Zeit, um miteinander zu reden. Als Themenquelle von Gesprächen findet sich explizit das Berufsfeld der Mutter, ansonsten teilt niemand Erlebnisse mit, auch wenn die Tochter offenbar verhältnismäßig oft inhaltsleere Äußerungen von sich gibt. Es erfolgt keine Verarbeitung außerfamiliärer Ereignisse durch ein Gespräch.
Ohne noch länger zu verweilen, stehen die Kinder und der Vater auf, verlassen die Küche, und damit ist das Tischgespräch beendet.
In der Zeitebene der Gegenwart lesen wir von einem gemeinsamen Essen und einem ,Gespräch‘, dem zwischen Philipp und den Arbeitern in der Küche. Hier steht ebenfalls die Nahrungsaufnahme im Vordergrund. Das Gespräch verläuft asymmetrisch, Philipp fühlt sich in einer vermeintlich schwächeren Postion als die Arbeiter und sucht Anschluss und Kontakt durch ein Tischgespräch. Von Seiten der Arbeiter fehlt jegliche Kommunikation.
S. 134
Es gibt Spaghetti. Philipp hat seinen Teller noch nicht geleert, da haben Steinwald und Atamanov schon die doppelte Menge verschlungen, im stillen erbost, dass Philipp sie zu der Mahlzeit überredet hat …
Trotzdem versucht Philipp, die beiden in ein Gespräch zu verwickeln. Steinwald, … , antwortet auf alles kurz angebunden, und Atamanov, wie schon die ganze Zeit, sagt gar nichts. Atamanov ist still, ruhig, zurückgezogen. Philipp kennt kaum seine Stimme. Also redet er ihn zweimal direkt an, und als Atamanov begreift, dass er gemeint ist, drückt er ein verlegenes „NIx viel Deutsch“ heraus. … Im nächsten Moment steht Steinwald auf und verschwindet in die Diele, wohin ihm Atamanov folg…
Werfen wir einen Blick auf den DDR-Roman von Eugen Ruge und der Konversation bei
- Familie Umnitzer (ER)
Galt es im Bürgertum des 19. Jahrhunderts im Tischgespräch als notwendig, politische und weltanschauliche Themen der Konflikte wegen zu meiden, lesen wir bei Familie
Umnitzer vom Austausch der Familienmitglieder über weltanschauliche, soziale und politische Fragen. Die Diskussionen darüber überwiegen familiäre Angelegenheiten, die eher im kleineren Kreise besprochen werden.
S. 223
… während er dem Tischgespräch lauschte, das zwischen verschiedenen Themen mäanderte und, ausgehend vom allgegenwärtigen Mangel in der DDR, in diesem Falle dem Mangel an Zwiebeln, auf die Erdölkrise im Westen kam (wo, Gott sei Dank, auch nicht alles klappte) und von dort über den Jom-Kippur-Krieg und die ehemaligen Nazis in Nassers Armee zum „Krieg der Geschlechter“ sprang (einem Film, der kürzlich im Westfernsehen gelaufen war), um dann doch wieder in die real existierende Welt zurückzuspringen … und schließlich … zu den unvermeidlichen Klagen über die Dummheit der Leser, zu irgendeinem politischen Handbuch, über das Christina und Kurt sich einvernehmlich amüsierten, weil der Name von Honeckers Vorgänger in der Neuauflage vollkommen eliminiert worden wa…
Die Aufgeschlossenheit für eine Diskussion politischer Ereignisse ist besonders in der Zeit der Wende ausgeprägt, da deren Nachwirkungen für jeden spürbar sind .
Beispiele sind die Tischgespräche in der Familie Umnitzer und bei Wilhelms 90. Geburtstag:
Im Tischgespräch zu Wilhelms 90. Geburtstag zeigt sich der Gastgeber Wilhelm als unverbesserlicher Verfechter des Stalinismus mit einer einfachen und ideologisch geprägten Sprache. Seine Bemerkungen sind unverblümt, direkt, rücksichtslos und oft beleidigend, auch und gerade gegenüber seiner Frau Charlotte. Er versucht erst gar nicht, über sein fehlendes Taktgefühl sprachlich hinwegzutäuschen. Diese direkte Ausdrucksweise wirkt auf die Parteigenossen proletarisch-authentisch und findet Anerkennung. Weder zu Parteigenossen noch zu seiner Frau oder den anderen Gästen spricht er höflich.
S. 285
- ..dir, lieber Genosse Powileit, den Vaterländischen Verdienstorden in Gold zu verleihe…
- Ich habe genug Blech im Karto…
S. 205
- Wenn ich tot bin, Markus, dann erbst du den Leguan dort im Rega…
- Cool, sagte das Kin…
- Oder nimm ihn am besten gleich mit, sagte Wilhel…
- Jetzt gleich, fragte das Kin…
- Nimm mit, sagte Wilhelm, mit mir geht es sowieso nicht mehr lang…
- Der Genosse Jühn ist leider persönlich verhindert, sagte der Stellvertrete…
- Aha, sagte Wilhelm. Ich bin auch persönlich verhinder…
Charlotte, die Zeit ihres Lebens einen kompetenten Umgang mit der Sprache zeigt und dadurch den sozialen Aufstieg erreicht, verliert in dieser Situation die Kontrolle über einen differenzierten Ausdruck und fordert direkt ein.
S. 330
- ..Aber ich drehe hier auch langsam durch. Ich kann bald nicht meh…
- .und bitte, Kurt, wenn du jetzt reingehst, kein Wort über irgendwelche Ereignisse. Du weißt schon: Ungarn, Prag. Und nichts über die Sowjetunio…
Ein bedeutsames Streitgespräch folgt wenige Jahre später am Weihnachtsfeste 1991: Sascha und Kurt streiten über den „Ausverkauf der DDR“, über die Unterscheidung von Sozialismus und DDR und die Verluste und Gewinne durch den Anschluss an Westdeutschland. 679Die Personen gehen nicht aufeinander ein, sondern reden aneinander vorbei.
In diesem Gespräch ist erkennbar, dass in der Familie keine Einigkeit mehr in den wichtigsten Dingen des Lebens herrscht und nur noch ein geringer Grad an Vergemeinschaftung besteht.
S. 366
- Was hier geschieht, ist der Ausverkauf der DDR, sagte Kur…
- Die DDR war pleite, hörte sie Sascha sagen, die hat sich selbst ausverkauft.Wenn die Gehälter hier eins zu eins, sagte Kurt, während Irina über zwei Drittel nachdachte, dann sind die Betriebe von heute auf morgen pleit…
Aber Sascha sagte: Wenn sie nicht eins zu eins gezahlt werden, dann gehen die Leute rübe…
- Es gibt keinen demokratischen Sozialismus, hörte sie Sascha sage…
Darauf Kurts Stimme. Der Sozialismus ist seinem Wesen nach demokratisch, weil diejenigen, die produzieren, selber über die Produktio…
Im Umgang und Stil des Miteinanderredens überwiegen Streit, Unnachgiebigkeit und eine hohe emotionale Beteiligung.
- Na, Gott sei Dank, dass du in deinem Scheißsozialismus über Alternativen nachdenken durftes…
- Du bist ja wirklich schon vollkommen korrumpiert, sagte Kur…
- Korrumpiert? Ich bin korrumpiert? Du hast vierzig Jahre lang geschwiegen, schrie Sasch…
Alexander stellt das Verhalten der Elterngeneration in Frage, hat er doch lange zuvor schon eine ideologische Bevormundung in der Kunst und Wissenschaft erlebt und seit mehreren Jahren die Staatsideologie hinterfragt.
Er sieht in der kapitalistischen Gesellschaft des Westens mehr Anreiz, materiell und künstlerisch. Die Aspekte Freiheit und Selbstentfaltung, Individualität und individuelle Lebensgestaltung aus dem bürgerlichen Wertekanon, sind für ihn dort eher zu finden als in der früheren DDR.
Kurts Ideologie dagegen ist weniger auf Besitz und Wohlstand und mehr auf immaterielle Werte fokussiert ( keine „hungernden Kinder“ ).
Die soziale Kommunikation scheitert, Kurt und sein Sohn Alexander verlieren die Beherrschung, S. 367
Was hast du denn getan! - Jetzt schrie auch Kurt: Wo waren denn deine Heldentate…
- Scheiße, schrie Sascha zurück. Scheiß auf eine Gesellschaft, die Helden brauch…
- Scheiß auf eine Gesellschaft, in der zwei Milliarden Menschen hungern, schrie Kur…
Bei Kurt ist solch eine Reaktion ungewöhnlich, da er in der Regel nicht emotional, sondern eine sachlich-vernünftige Ausdrucksweise wählt, wie z.B. in folgender Situation: S. 74f
- Nadjeshda Iwanowna, Sascha kommt heute nicht…
- Nadjeshda Iwanowna, setzen Sie sich bitte einen Augenblic…
S. 175
Stattdessen versuchte er es noch einmal „vernünftig…
- Ich habe dir immer erlaubt, sage Kurt, deine Musik zu hören - oder nicht? Sascha stocherte im Rotkoh…
- Oder nicht, wiederholte Kur…
- Ja, sagte Sasch…
- Aber wenn deine Begeisterung für diese Beatmusik dazu führt, dass du Gammler werden willst, dann muss ich sagen, dass deine Lehrer recht haben, wenn sie so was verbiete…
15.7 Die bildungsrelevante Bedeutung der Schrift- und Schreibkultur im Bürgertum
In bürgerlichen Kreisen existierte neben der o.g. Gesprächskultur eine private Schrift- und Schreibkultur, die ebenfalls eine spezielle bürgerlich-soziale Identität ausdrückte und inszenierte. Der Stil richtiger Sprache stand vor ihrem Inhalt, und ihn versuchte man zu perfektionieren. In diese Kulturform wurden die Kinder bereits in jungen Jahren eingeführt. Während Angehörige der unteren Schichten grammatikalisch und orthographisch keinen fehlerfreien Brief schreiben konnten, war für das Bürgerkind das Lesen und Schreiben ein hoher Wert. Briefe aus der Perspektive der Kinder unterstanden inhaltlich und sprachlich der elterlichen Kritik, die Länge eines Briefs zeigte Übung und Fertigkeit.
(TM)
Der Vater von Tony drückt die Bedeutung des geschriebenen Wortes folgendermaßen aus: S. 146
Das Eine aber, welches ich Dir mündlich schon oft zu verstehen gegeben, möchte ich Dir ins Gedächtnis zurückrufen,. Denn obgleich die mündliche Rede lebendiger und unmittelbarer wirken mag, so hat doch das geschriebene Wort den Vorzug, dass es mit Muße gewählt und gesetzt werden konnte, dass es feststeht und in dieser vom Schreibenden wohl erwogenen und berechneten Form und Stellung wieder und wieder gelesen werden und gleichmäßig wirken kan…
Man schrieb Briefe zu verschiedenen Gelegenheiten, so gehörten z.B. Weihnachts- und Neujahrsbriefe zu den sprachlichen Ritualen.
Die Schreibanlässe für das Briefeschreiben waren unterschiedlich: Meist sollte die ElternKind-Beziehung erhalten und stabilisiert werden, man schrieb Eltern und Großeltern aus der Distanz heraus, um Trennungen zu unterbrechen und den Kontakt aufrecht zu erhalten.
Tony schreibt ihrem Vater aus dem Urlaub in Travemünde, ihr Brief ist emotional:
S. 145
Lieber Pap…
O Gott, wie habe ich mich geärgert.Dir, dem besten Vater, kann ich es ja sagen, dass ich anderweitig gebunden bin an Jemanden, der mich liebt und den ich liebe, das es sich gar nicht sagen lässt. O Papa! Darüber könnte ich viele Bogen vollschreiben,…
Die vorwurfsvolle Antwort des Vaters betrifft keinesfalls eine grammatische Korrektheit, oder Fehler in sprachsystematischer Hinsicht, sondern eben diese Haltung:
S. 146
Dein Weg, wie mich dünkt, liegt seit längere Wochen klar und scharf abgegrenzt vor Dir, und Du müsstest nicht meine Tochter sein, nicht die Enkelin Deines in Gott ruhenden Großvaters und überhaupt nicht ein würdig Glied unserer Familie, wenn Du ernstlich im Sinne hättest, Du allein, mit Trotz und Flattersinn Deine eigenen, unordentlichen Pfade zu gehe…
Grünlichs Brief zeigt Umständlichkeit und Gestelztheit, er wählt den elaborierten Code:
S. 144
„Teuerste Demoiselle Buddenbroo…
Wie lange ist es her, dass Unterzeichneter das Angesicht des reizendsten Mädchens nicht mehr erblicken durfte? Diese so wenigen Zeylen sollen Ihnen sagen, dass dieses Angesicht nicht aufgehört hat, vor seinem geistigen Auge zu schweben. Endesunterfertigter erlaubt sich, Ihnen, teuerste Demoiselle, mitfolgenden Ring als Unterpfand seiner unsterblichen Zärtlichkeit hochachtungsvoll zu übersenden. …
(AG)
In Geigers Roman gibt es zwar innerhalb der Familien Korrespondenz, die Briefe selbst sind nicht wiedergegeben, über den Inhalt wird, wenn überhaupt, nur kurz etwas gesagt.
Alma hatte brieflichen Kontakt mit ihrer Tochter Ingrid, diese Briefe helfen ihr, die Erinnerung an ihre Tochter zu intensivieren, sind aber nicht mehr auffindbar.
S. 38
Alma hatte den Kontakt zu Ingrid wieder anschubsen wollen und immer gedacht, dass noch ausreichend Zeit bleibt. … Die Briefe fallen ihr wieder ein, die sie von Ingrid in ihren letzten Jahren erhalten hatte. … Alma fragt sich, wo sie die Briefe hingetan ha…
Richard hat Briefkontakt mit der engen Verwandten Nessi, seine Korrespondenz klärt Alma über ein Geheimnis auf:
S. 355
Aus der Korrespondenz zwischen Richard und Nessi, die sich in Richards Schreibtisch gefunden hat, geht hervor, dass er 1970 nicht nur mit seiner Verwandtschaft, sondern auch mit Christl Ziehrer in Gastein war. Alma würde seit Monaten gerne fragen, was? was? das würde sie doch gerne wissen, was ihn dazu bewegt hat, sie zu hintergehen und dabei seine Verwandtschaft ins Vertrauen zu ziehen, dieses scheinheilige Pac…
S. 360
Nach einer Weile wird es ihr zu bunt, und sie beschließt, der Gastein-Angelegenheit symbolisch ein Ende zu bereiten, indem sie Richards Korrespondenz mit Nessi in den Dachboden träg…
(ER)
Die Schreibanlässe der Briefe von Sascha und Kurt an ihre Frauen und Geliebten unterscheiden sich zwar, sind aber auch ein Teil bürgerlicher Schreibkultur. Sascha hatte die Briefe seines Vaters wiederentdeckt, als er das alte Schachspiel aufklappt:
S. 420
Anfangs hatte er geglaubt, es handle sich ausschließlich um Briefe Kurts an Irina. In Wirklichkeit sind es verschiedene Schriftstück. Zum einen sind es tatsächlich Briefe: einzelne, ausgewählte Briefe an Irina, aber auch welche von ihr, sowie Kurts Briefe an ihn, Alexander, von denen Kurt - typisch - eine Durchschlag aufbewahrt ha…
Kurts Brief an Irina ist tief emotional und lautet:
S. 27
„Liebste, allerliebste Irina!.Meine Sonne, mein Leben…
Nie hatte er eine Frau je so geschrieben. Was das altmodisch? Oder hatte Kurt Irina gelieb…
Sascha formuliert selber Briefe an Marion, als er in seiner Unterkunft im mexikanischen Dorf zur Ruhe gekommen ist. Die Formulierungen offenbaren tiefe Gefühle:
S. 409ff
Liebe Marion. In letzter Zeit passiert es häufig, dass ich an dich denke. Oft aus geringstem und, zugegeben, manchmal unbegreiflichen Anlass. Das du mir beim Anblick des Sonnenuntergangs einfällst, mag noch angehen. Aber warum fällst du mir ein beim Anblick eines blauen Sonnenschirms, wo du doch Blau nicht magst. Warum fällst du mir ein, wenn ein Vogelschwarm von einer Stromleitung auffliegt? Warum fällst du mir ein, wenn ich meine Hand auf den lauwarmen Sand lege…
Wie kann ich jetzt, wo mich die Krankheit erwischt hat, unter deine Decke kriechen wollen? Wie kann mir jetzt einfallen, Sehnsucht nach dir zu haben…
Ja, es ist tröstlich, so an dich denken zu können, und manchmal frage ich mich: Vielleicht genügt das? Einerseits tut es weh, dass ich, als du greifbar nah warst, so fahrlässig mit alledem umgegangen bin. Andererseits mache ich gerade die seltsame Erfahrung, dass man nicht unbedingt besitzen muss, was man lieb…
15.7.1 Bildung durch/mit Literatur
Eine Sphäre öffentlicher Kommunikation bildete sich im 18. Jahrhundert durch den Aufschwung des Buchhandels und der Veränderung des Lesestoffs. Der bestand nun nicht mehr zentral aus der Bibel und anderen Werken religiöser Erbauung, sondern umfasste auch weltliche Literatur.
Für die sich etablierende Literatur des Bürgertums waren Wertorientierung und die Aufwertung des Privaten entscheidend: ,Innerlichkeit‘ und/oder ,Empfindsamkeit‘ werden ebenso aufgegriffen wie die Sphäre des Privaten, die Familie wird zum Schauplatz in sentimentalen Romanen. Sie belehren den Bürger über ein zärtliches Miteinander, mit Autorität und Ordnung, in der man Gefühle und das Sich-Verzeihen-Können erlebt.680 Habituelle Werte wie Individualität, individuelle Bedürfnisse und Interessen, finden nun Eingang in die literarischen Werke.
Bereits in der Einweihungsszene zu Beginn des Romans ist die Kunst vertreten durch den Poeten der Stadt Jean Jacques Hoffstede, der ein Gedicht spricht.
S. 14
Herr Jean Jaques Hoffstede, der Poet der Stadt, der sicherlich auch für den heutigen Tag ein paar Reime in der Tasche hatte, war nicht viel jünger als Johann Buddenbrook, der Ältere,…
S. 32
Das Blatt, das er in den Händen hielt, war allerliebst kunterbunt, und von einem Oval, das auf der Außenseite von roten Blumen und vielen goldenen Schnörkeln gebildet ward, verlas er die Wort…
In den Bürgerhäusern fanden sich Bücher in großer Zahl. Gehobene bürgerliche Kreise besaßen anerkannt wertvolle Werke der Literatur, d.h. die Klassiker der „Schönen Literatur,“ die gelesen werden m u s s t e n. Es gehörte zum Habitus des gebildeten Bürgertums, verschlüsselte Lebensweisheiten aus der Literatur anzuzitieren.( Thomas Buddenbrook zitiert Heine!)
Meist dominierte die private Lektüre. Frauen galten als die typischen Romanleser. Romane, so glaubte man, ermöglichten es ihnen, aus der Alltagswelt zu entfliehen und durch die Identifikation mit den Helden das eigene Selbstwertgefühl zu steigern.
(TM)
Mit Mamsell Grundmann verschlang Tony den damals als obszön bezeichneten Roman ,Mimili’ von Claurens.
Tonys Lektüreinteressen beziehen sich auf E.T.A Hoffmann, als Herr Grünlich seine Aufwartung macht. (Morten bezeichnet E.T.A. Hoffmann geringschätzig als einen Schriftsteller „mehr für Damen“).
S. 91
Tony hatte den Kopf in beide Hände gestützt und las versunken in Hoffmanns „Serapionsbrüder…
S. 96
„Darf ich es wagen, mich nach Ihrer Lektüre zu erkundigen, Mademoiselle Antonie?“ fragte er lächeln…
Tony zog aus irgend einen Grunde die Brauen zusammen und antwortete ohne Herrn Grünlich anzublicke…
„Hoffmanns Serapionsbrüder…
„In der Tat! Dieser Schriftsteller hat Hervorragendes geleistet“, bemerkte er. …
Vermehrt wurden in der damaligen Zeit Manierenbücher publiziert. Mit diesen Sitten- und Höflichkeitslehren für Frauen und Mädchen gab man ihnen einen Leitfaden für ihre gesellschaftliche Rolle und für das, „was sich gehört“. Weiterhin entstand ein Markt für religiöse Literatur, Gebets-, Andachts- und Erbauungsbücher.
Für die bürgerlichen Männer diente Literatur als Auflockerung ihres Afffekthaushalts durch die „prägnant verdichtet artikulierten Gefühlslagen.“681 (TM)
Thomas Buddenbrook zeichnet sich durch Bildungsbeflissenheit und Belesenheit aus und findet eine Seelenverwandte in seiner Frau Gerda:
S. 288
… und in der Literatur verstanden wir uns durchau…
Seine literarischen Vorlieben betrachten die Mitbürger und auch sein Vater eher mit Befremden:
S. 294
Und dann diese Citate aus Heine und anderen Dichtern, die er manchmal bei den praktischsten Gelegenheiten, bei geschäftlichen oder städtischen Fragen in seine Rede einfließen lie…
S. 235
Er sprach ein mit spanischen Lauten untermischtes Französisch und setzte Jedermann durch seine Liebhaberei für gewissen moderne Schriftsteller satirischen und polemischen Charakters in Erstaune…
Hanno berühren Märchen zutiefst, er versetzt sich in die Figuren, teilt ihre Gefühle und trifft dabei auf Themen, die ihm Angst bereiten:
S. 463
„Sie stehen in seinem Lesebuch“, antwortete Fräulein Jungmann, „und darunter ist gedruckt ,Des Knaben Wunderhorn'. Sie sind kurios. Er hat sie in diesen Tagen lernen müssen, und über das mit dem Männlein hat er viel gesprochen. … Und heute Abend noch, als seine Mama ihm Gute Nacht sagte, bevor sie ins Konzert ging, hat er sie gefragt, ob er auch für das bucklige Männlein beten soll…
Zum Ende des 18. Jahrhunderts entstanden Lesegesellschaften. Sie legten den Schwerpunkt auf allgemeinbildende Literatur, Bildung und Nützlichkeit und blieben durch ihre hohen Mitgliedsbeiträge exklusiv. Später entwickelten sich daraus die ebenfalls vornehm gehaltenen Casino- und Museumsgesellschaften, welche der gesellschaftlichen Unterhaltung und der Vermittlung von kulturellen Kenntnissen dienten.682 (TM) S. 315
Konsul Buddenbrook kehrte aus der „Harmonie“, dem Lesezirkel für Herren, in dem er nach dem zweiten Frühstück eine Stunde verbracht hatte, in die Mengstraße zurüc…
Der ,Club‘ in dem Christian verkehrte, hieß ,Concordia‘, ein 1823 gegründeter geselliger Verein Lübecks für jüngere Kaufleute. Dort unterhält man sich mit Domino, Billard, Lektüre und Konversation.
S. 542
… als um halb 9 Uhr Christian aus dem Klub, ..zurückkehrt…
In Lübeck konkret fehlte zwar eine literarische Gesellschaft, da die Vorträge der ’Gemeinnützigen Gesellschaft’ sich eher nützlichen und praktischen Fragen zuwandten. Jedoch gab es bereits 1835 zwei Buchhandlungen, eine öffentliche Stadtbibliothek in den Räumen des Franziskanerklosters, allerlei Lesezirkel und wissenschaftliche Bibliotheken. Die Klassiker hatten ein hohes Ansehen in den Lesekränzchen der Stadt.
Lübecks Repräsentant der Literatur und Ehrenbürger der Vaterstadt Manns war Emanuel Geibel, bekannt durch sein Volkslied „Der Mai ist gekommen“. Er verherrlichte in seiner Poesie die Bürgertugenden.
Bedeutsam für Lübeck war die Germanistenversammlung von 1847, zu der Vertreter der deutschen Literatur wie die Gebrüder Grimm erschienen.
Für den Bürger war aber nicht nur das Buch, sondern eher noch die Zeitung ein wichtiger Lesestoff, so auch für Thomas Buddenbrook.
(TM)
S. 450
Er hatte die Berliner Börsen-Zeitung vor sich ausgebreitet und las, leicht über den Tisch gebeug…
Es erschienen sowohl regionale und überregionale Zeitungen im deutschsprachigen Raum und alle fanden ihre Zielgruppen. Sie lagen an öffentlichen Orten aus, wurden dort gelesen und im kleinen Kreis diskutiert.
In Zeitschriften druckte man literarische Werke für die bürgerliche Leserschaft und etablierte damit als literarische Form den Unterhaltungs- und Fortsetzungsroman.683 (AG)
Bildung, ein wesentliches Distinktionsmerkmal des Bürgertums, ist im modernen Familienroman ein wichtiges Element im familiären Leben, beinhaltet nun aber weit mehr als Konversation. Das Lesen von klassischer Literatur entschädigt Alma für mangelnde Kontakte.
Das Muster der Frau als Romanleserin findet sich auch im 20. Jahrhundert: Die Protagonistin Alma in Geigers Roman liest schöngeistige klassische Literatur.
Mehr noch als bei Hanno hat für sie die Bücherwelt eine große Bedeutung. Es ist Lebenshilfe und -bereicherung und Ausbruchmöglichkeit gleichzeitig. Literatur bietet ihr Identifizierung und Entlastung. In ihr findet sie die Möglichkeit, anderes zu erleben und Grenzerfahrungen zu machen. So wie die Frau im Bürgertum des 19. Jahrhunderts aufgrund des ausreichenden Einkommens des Mannes in der Familie den Raum für Muße, Bildung und Geborgenheit fand, widmet sich Alma in ihrer frühen Ehe dem Familienleben und der Erziehung der Kinder und findet dabei Zeit für Lektüre!
S. 69
Alma räkelt sich bäuchlings auf ihrer Liege ..Sie blättert in ihrem Buch einige Seiten nach vorne, um zu sehen, ob das Kapitel bald zu Ende ist, sie schließt das Buch und legt es in den Schatten unter ihrem Stuh…
Literatur und Alltag gehen in ihrem Denken Verbindungen ein, Lebenssituationen erinnern an Gelesenes und umgekehrt und setzen Gefühle frei, so wie Richard bereits in jungen Jahren vermutet:
S. 71
Ob sich diese Dinge im Almas Kopf mit dem Gelesen vermische…
S. 28
Sie dachte an gelbe Seerosen, die auf dem Wasser eines Zahnglases schwimmen, als kleine Idee für einen Roman, wie sie es um Ostern herum gelesen hatte, ganz nett, wirklich recht nett. Da war ein Glas mit dritten Zähnen von Wasserpflanzen überwachsen worden. Doch schon beim Lesen hatte Alma an Richard denken müssen, und auch während des Händewaschens sah sie einen Augenblick lang schleimige Algen, Muschelbewuchs und langsam sich setzenden Fischkot. Sie schüttelte vor sich selbst den Kopf. Br…
S. 360
Nachdem sie die Gardinen vom Fenster weggezogen hat, nimmt sie nochmals das Buch zur Hand, kommt auch gut voran, dreißig, vierzig Seiten, bis sie auf eine Stelle stößt, in der es ums Verzeihen geht (Ich trag keinem was nach. Verzeihen ist das Waschmittel des Universums, gegen das Verzeihen ist alles andre machtlos, na ja). Richards Besuch in Gastein drängt sich hartnäckig zwischen die Zeilen …
Richards Auffassung nach bietet Almas Romanlesen und die daraus resultierende Bildung keinen echten Mehrwert:
S. 201
Soll er wie Alma ein Buch ums andere lesen, um klüger zu werden, aber ohne die Möglichkeit, die neue Klugheit noch anwenden zu können? Es mutet ihn an wie Hoh…
Nachdem der Sohn im Krieg stirbt und die Tochter durch einen tragischen Unfall umkommt, bleibt Alma nur die Welt der Bücher, Lesen als Selbstverteidigung gegen Sinnlosigkeit und Chaos.
Ihre Lektüre spiegelt die Werte des Bürgertums wieder:
S. 194
- Was liest du? fragt e…
- Nachsomme…
- Von wem ist e…
- Stifte…
- Adalbert Stifter, ah…
- Es ist eine der Bücher, die wir von Löwys bekommen haben. Es steht ein Datum drin, Weihnachten 1920, und auch der Preis, 24 Krone…
- Ist das Buch spannen…
- Wenn man etwas für Seelen- und Landschaftsbilder übrig ha…
- Es heißt, die bedeutendste Landschaft ist das menschliche Gesicht. Gleich nach Österreich …
StiftersNachsommer ist ein Familienroman, der die Institution der Familie als unbedingt notwendig und relevant beschreibt, wichtiger als Kunst, Wissenschaft und Fortschritt. A. Stifter schrieb das Buch aus einer erzieherischen Absicht heraus, um eine große einfache sittliche Kraft „der elenden Verkommenheit gegenüber“ zu stellen.684 Jede Person des Buches zeichnet sich durch Pflichterfüllung, Gewissenhaftigkeit und innere Klarheit aus.685 Es soll ein Buch vom „Erdenglück“ sein, was das unmittelbare Glück umfasst, das sind das reine Gewissen, das wohlgeordnete Familienheil, und das mittelbare Glück, „die Natur, die Kunst und die Wissenschaft, Hand in Hand mit der Freundschaft und einigem geselligen Umgange.“ 686 In diesem Buch besteht noch „das ganze Haus“, gemeinsam isst die Familie des Protagonisten mit dem Hauspersonal 687. Aus Furcht vor der Autorität des Vaters ordnet sich die Mutter unter und „versah ihre Aufgaben im Haus emsig“.688
Die Kinder wurden in Stifters Romanfamilie entsprechend den Geschlechtscharakteren erzogen: die Tochter so, „dass sie einmal würdig in die Fußstapfen der Mutter treten könnte“, den Sohn bestimmt der Vater zum Wissenschaftler. 689 Deshalb verlässt dieser das Elternhaus und befriedigt seinen Wissens- und Forschungsdrang. Der Vater übt, wie bei den Bürgern üblich, im Rate der Stadt ein öffentliches Amt aus.
Alma lebt das Konzept dieser glücklichen Familie, auch als ihr Mann andere Interessen entwickelt und seine emotionale Bindung zu ihr nicht zur Treue reicht.
Weiterhin gehört Kellers RomanDer grüne Heinrichzu Almas Lektüre: Die Hauptfigur Heinrich Lee kann sich nicht integrieren, lebt bescheiden sein Leben, entsagt dem Familienleben und ähnelt damit Philipp. Es gibt in diesem Klassiker, ähnlich wie in Geigers Roman, Anspielungen auf Münchhausen oder Eichendorffs „Aus dem Leben eines Taugenichts“, die eine Affinität zu Philipp besitzen.
S. 369
Sie schiebt sich unter die schwere Decke, nimmt den Grünen Heinrich' vom Nachkästchen und richtet die Lampe so, dass der Lichtkegel genau auf die aufgeschlagenen Seiten fäll…
RothsRadetzkymarschist ebenfalls ein von Alma gelesener Roman: Dieses Buch stellt einen Familienroman und einen trauriger Abgesang auf die k.u.k. Monarchie dar. Es veranschaulicht wie der Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn verfällt und beschreibt anhand des wechselvollen Schicksals den Aufstieg und den Untergang von vier Generationen der Familie Trotta. Ihr Schicksal ist mit dem Untergang der Habsburger-Epoche verknüpft, deren Werte sich als historisch erwiesen und ihre Geltung verloren hatten. Es ist ein trauriges Buch und spiegelt Almas Befinden wieder. Sie spürt in diesem Meisterwerk der Literatur den Untergang ihrer Familie, vielleicht auch das Gesetz des Lebens und erfährt beim Lesen Lebenshilfe.
Peter erlebt auf der Flucht bei Kriegsende, wie seine Familie Bücher verbrennt. Es weist auf den Wunsch der Familie Erlach nach einem Neuanfang hin, mit der Vernichtung allen Beweismaterials will man einen Hinweis auf eine Sympathiesierung mit der Ideologie des Nationalsozialismus vermeiden:
S. 119
Im Vorgarten des Hauses wird ein Haufen Papier verbrannt. Onkel Johann fährt mit dem Laubrechen zwischen die glimmenden Bücher.
Als Vater betrachtet Peter Erlach es als eine familiäre Aufgabe, Kinder an gute Bücher heranzuführen und träumt von einem glücklichen Familienleben, zu dem Literatur dazugehört:
S. 302
Und er wünschte sich, dass sie wieder Familie wären und die Welt so schön wie in einem Album, und dass sie gemeinsam gute Bücher läsen und die Kinder stolz wären und gerne nach Hause käme…
15.7.2 Literatur und Kultur in der DDR
Bücher hatten in der DDR einen besonderen Stellenwert, nicht nur den eines Freizeitvergnügens, sie waren Lebenshilfe und geistige Nahrung und für den Staat eine Möglichkeit der Beeinflussung.
Von offizieller Seite wurden ideologische Vorgaben gesteckt. Schriftsteller hatten sie zu berücksichtigen und Literatur als Bezugnahme auf eine gesellschaftliche Utopie zu verstehen und sich danach auszurichten. Der staatlichen Lenkung und Kontrolle entsprechend sollte Literatur durch die Darstellung der sozialistischen Wirklichkeit bzw. der gesellschaftlichen Entwicklung zur Bewusstseins- und Persönlichkeitsbildung der Rezipienten beitragen.690 Schriftsteller in der DDR zu sein, hieß, „Vorturner, Volkserzieher, Clown, Seelenarzt, Guru und Alibi-Moralist“ und „Ingenieure der menschlichen Seelen“ zu sein.691 (ER)
Kurt ist Schriftsteller. Ihm geht es um sozialistische und humanitäre Ideale, Wilhelm und dessen Einstellung sieht er als Grund des Elends.
S. 341
Schlimmer jedoch als diese kleinen Halb wahrheiten waren die großen Weglassungen, schlimmer war das notorische Schweigen über Wilhelms Taten in den zwanziger Jahren: Damals ..war Wilhelm ein unbeirrter Verfechter der von der Sowjetunion verordneten „Einheitsfrontpolitik“ gewesen, welche die Führer der Sozialdemokratie als „Sozialfaschisten“ verunglimpft und sie sogar als das - im Vergleich zu den Nazis - schlimmere Übel dargestellt hatte. Eigentlich, dachte Kurt, immer noch klatschend, war Wilhelm - ganz objektiv betrachtet - persönlich mitverantwortlich, dass die linken Kräfte sich während der zwanziger Jahre gegenseitig zerrieben und der Faschismus in Deutschland am Ende siegreich gewesen wa…
Die Doktorarbeit war für ihn ein existentielles Vorhaben:
S. 328
… das Turmzimmer mit seinen halbrunden Fenstern und seinen Zinnen. Dort hatte er einst seine Dissertation getippt .. Hier hatte sein zweites - oder sein drittes? - Leben begonnen, und er erinnerte sich gern an die Stille über Neuendorf, wenn er morgens um halb sieben das Fenster aufgerissen und seine Schreibmaschine aufgestellt hatte, …
Nach der Wende beschließt er, ein Buch als kritische Bestandsaufnahme und Abrechnung über seine Zeit im Gulag zu schreiben:
S. 22
Aber dann hatte sich Kurt noch einmal auf seinen katastrophalen Stuhl gesetzt, mit fast schon achtzig, und hatte klammheimlich sein letztes Buch zusammengehämmert. Und obwohl dieses Buch kein Welterfolg geworden war., so war es doch, ob man wollte oder nicht, ein wichtiges, ein einzigartiges, ein „bleibendes“ Buc…
Wilhelm liest die Zeitung „Neues Deutschland“, das Zentralorgan der Partei. Sie„war nicht einfach eine Zeitung, sondern die tägliche Offenbarung der Gesetzmäßigkeit der Weltgeschichte.“692 Wilhelm liest diese bis zu seinem Tod - mit Andacht, es waren für ihn gewichtige Worte der Macht.
S. 38
Am Wochenende las Wilhelm, wie stets, das „Neue Deutschland“, das immer im Packen und mit vierzehntägiger Verspätung aus Deutschland kam. Da er weder Spanisch noch englisch konnte, war das ND seine einziger Lesestoff. Er las jede Zeile und war, mit Ausnahme von zweimal einer halben Stunde, die er mit dem Hund spazieren ging, bis zum späten Abend beschäftig…
5. 189f
Er marschierte zum Briefkasten, aber der Briefkasten war leer. Es war Sonntag. Am Sonntag gab es kein ND. Früher hatte es auch am Sonntag ND gegeben, aber das hatten sie abgeschafft. Schlamasse…
Charlotte kam: mit Wasserglas und Tablette…
- Ich habe zu tun, sagte Wilhelm und strich, um seiner Aussage Nachdruck zu verleihen, mit einem Rotstift den Artikel aus - wie er gewohnheitsmäßig alle Artikel ausstrich, die er gelesen hatte, damit er nichts zweimal la…
Charlotte liest und schreibt Rezensionen zu Romanen.
Um sich gegenüber einem Rivalen im Institut zu profilieren, verfasst sie für das Neue Deutschland eine Rezension zum Exilroman „Mexikanische Nacht“ eines BRD-Autors, die mit dem Verdikt endet, das Buch sei „defätistisch“ und „gehör[e] nicht in die Regale der Buchläden unserer Republik“ (S. 127).
Charlottes Rezension zeigt politische Differenzen zu Kurt, der ihr ein naives Verständnis der aktuellen politischen Lage in der Zeit kurz vor dem Mauerbau und der Kubakrise vorhält und ihr vorwirft, sich für einen härteren politischen Kurs und eine Rückkehr zum Stalinismus instrumentalisieren zu lassen.
Eine bildungsrelevante Bedeutung hatte in der DDR das Schachspiel, ein Spiel, das „aufgrund seiner Komplexität und Dynamik an der Schnittstelle von Kultur, Wissenschaft, Sport und Spiel eine besondere Stellung unter allen kulturellen Aktivitäten“ einnimmt.693 (ER)
Kurts Schachspiel hat eine spezielle Bedeutung, es ist ein Erinnerungsstück an die Zeit im Straflager:
S. 19
… das aufklappbare, ramponierte Schachbrett mit den Figuren, die irgendein namenloser GulagHäftling irgendwann einmal geschnitzt hat…
Kurt spielt es regelmäßig mit seinem Sohn, um dessen analytische Begabungen und das Gedächtnis zu schulen und um ihm die Fähigkeiten zu vermitteln, die dieses Spiel fördert: Geduld, Durchhaltevermögen und Entscheidungsfähigkeit.
S. 80
Später Schachspielen. Papa gab ihm zwei Türme vor, trotzdem gewann der imme…
- Morphy hat schon mit sechs Jahren gegen seinen Vater gewonnen, sagte sein Vater. Das war aber nicht so schlimm. Er war ja erst vier. Erst mal musste er fünf werden. Und dann hatte er immer noch Zeit. Sehr viel Zeit, um seinen Vater im Schach zu besiege…
Das Schachbrett seines Vaters bekommt auch für Alexander eine große Bedeutung: Er wird es mit nach Mexiko nehmen und es wird zu einem familiären Erinnerungssymbol, das ihm hilft, in Kontakt mit Fremden zu kommen:
S. 418
Dann wird er das zusammenklappbare Schachbrett seines Vaters unter den Arm klemmen und, trotz der Hitze jetzt ein wenig fröstelnd, zum Strand hinabsteige…
S. 423f
Nach der Schachpartie, die er nach dem siebzehnten Zug aufgegeben haben wird, wird er sich in die Hängematte vor seiner Zimmertür lege…
15.8 Hochkultur als Betätigungs- und Bildungsfeld des Bürgertums
In d e m Bürger-Roman „Soll und Haben“ von Gustav Freytag ist folgender Satz des Protagonisten Anton zu lesen, als er mit seinem Prinzipal nach Polen reist: „Sie (die Polen, Anmerk. I.MB) haben keinen Bürgerstand“, sagte Anton eifrig bestimmend. „Das heißt, sie haben keine Kultur“, fuhr der Kaufmann fort, „es ist merkwürdig, wie unfähig sie sind, den Stand, welcher Zivilisation und Fortschritt darstellt und welcher einen Haufen zerstreuter Ackerbauer zu einem Staate erhebt, aus sich heraus zu schaffen.“694
Dieser Satz unterstreicht die Wertvorstellungen und Überzeugungen des Bürgertums und wie sehr Kultur als ein Bildungsinhalt und Wert gesehen wurde, der alle bürgerlichen Gruppen verband, so heterogen das, was das Bürgertum ausmachte, auch war.
Kultur wurde ein identitätsstiftendes Merkmal und damit war verbunden „der Anspruch, Kunstsinn zu verbreiten, Musik und Kunst fest im bürgerlichen Alltag zu verankern und eine hohe ästhetische Bildung zur elementaren Grundlage bürgerlicher Selbstreflexion und Lebensführung werden zu lassen.“695
Der Weg der Menschenbildung, der Veränderung des Einzelnen zum neuen Menschen (des Bürgers) ging über den Umgang mit der Kultur und deren Ausübung - sie sollte helfen, die menschlichen Anlagen zu entwickeln. Damit wurden Theaterbesuch, Hausmusik, der Besuch eines Konzerts, das Lesen eines Romans zu kulturellen Praktiken der Bürger, durch die sie lernten, was Bürgerlichkeit bedeutete. „Kultur“ als Einheit im Prozess der Verbürgerlichung definierte gemeinsam mit Lebensführung, Mentalität und Wertungen das Bürgertum!696 Träger und Orientierungsinstanz der Kultur und deren Mentalität war das Bildungsbürgertum, das durch den Besuch des Gymnasiums die höhere Bildung vermittelt bekommen hatte.
Der Familie kam eine zentrale Rolle insofern zu, dass sie als Erziehungsraum die Grundlage für die Vermittlung der bürgerlichen Kultur schuf. Kinder und Jugendliche sollten zu einem kunstsinnigen und kunstverständigen Publikum herangebildet werden, zu deren bürgerlichen Alltag es gehörte, sich mit Kunst aktiv auseinanderzusetzen und sie einzuüben. Kunst war ästhetische Erziehung, die Freude am „Guten und Schönen“. Gerda weckt diese Freude bei Hanno:
S. 701
Es war Sonntag gewesen, und nachdem er sich mehrere Tage hinter einander von Herrn Brecht hatte maltraitieren lassen müssen, hatte er zur Belohnung seine Mutter ins Stadt-Theater begleiten dürfen, um den „Lohengrin“ zu höre…
Anders als „Mentalität“, die auf vage Werte und Normen des Einzelnen verweist697 zeigte sich die Kultur in dem Kulturbesitz (Kleidung, Schmuck, Besitz, Einrichtung) und dem -verhalten (Theater-, Museumsbesuch, Vereinsmitgliedschaft, Lesen von Literatur).
Man deklarierte bürgerliche Kultur als wichtig, ästhetisch und moralisch hoch stehend, auch wenn sie nicht unbedingt Alltagsrelevanz für den Einzelnen hatte. Die Teilung von Verstand und Gefühl, Beruf und Familie führte zur Trennung von Kunst und ernsthafter Arbeit - das Erleben von Kultur im Theater, im Konzert oder beim Besuch eines Museums stand im Gegensatz zum Alltag mit seiner Vernunft und Leistung. Kunst wurde zur Gegenwelt, diente der Erholung von den äußeren Geschäften und der Ablenkung, wurde zum dekorativen Zweck. Das bürgerliche Arbeitsethos beurteilte sie als nützlich und nicht als vergeudete Zeit.698„Die Kultur tritt an die Stelle von Kirche und Tradition, Nachbarschaft und Zunft und Autorität, sie gewinnt eine ganz neue Wichtigkeit, und damit einen dynamischen Charakter.“699
Je mehr das 19. Jahrhundert voranschritt, desto mehr entwickelte sich die „bürgerliche Kultur“: Literatur, Theater, Kunst wurden zur Domäne des Bürgertums und initiierten durch Zusammenschluss Gleichgesinnter kulturelles Leben. Diese Kultur sollte zur allgemeinen Kultur schlechthin werden700 und hatte nicht ausschließenden Charakter wie die vormalige „Adelskultur“, die, so die Auffassung, der Repräsentation diente und keine seelische Tiefe und Empfindsamkeit zeigte, wohingegen die Kultur des Klerus, so die Meinung des Bürgertums, nur in Erstarrung verharre. Künste, früher ein aristokratisches Privileg, wurden nun von einem breiteren Publikum genutzt und verbürgerlichten.
Ein besonders enges Verhältnis bestand zur Hochkultur: das klassische Repertoire in Literatur, Musik, Theater, bildender Kunst (und Architektur. )Ernste, gehobene Kunstwerke rangierten vor der modernen unterhaltenden Kunst. Die Bedeutung des Gefühls verlangte nach einer Kunst, die Gefühle ausdrückte. Das Wesen einer solchen Kunst wurde emphatisch. Der Künstler selber emanzipierte sich von Rollen und Ämtern und wurde zum „freien Künstler“, der als einsamer Außenseiter an der Gesellschaft leidet.701
Kunst und Ästhetik entwickelten sich zu einer Ersatzreligion, die „erlöst, versöhnt und tröstet.“702, sie werden zum „notwendige[n] Bestand der Durchdringung von Welt, Leben und Selbst, ein notwendiger Bestand der Entfaltung der menschlichen Freiheit und des gemeinsamen Ethos.“703
Man überhöhte und stilisierte Kunst zum Medium, um „Sinnfragen in der Alltagswelt formulierbar und vermittelbar zu machen.“704„Kunst ist Lebenshilfe, indem sie zur „Welt- und Lebensinterpretation und ein wesentliches Stück des Lebens selber [wird].“705 Der Künstler galt als Ersatzpriester: Er hatte die Frage nach den Sinn des Lebens, nach dem Wahren und Guten mithilfe der Kunstwerke zu beantworten.
Einem Bürger selber aber durfte Kunst nicht zum Bestreiten des Lebensunterhalts dienen. Genialität hatte die Gefahr des Außenseitertums, da es über die Normalität hinausging. So beschränkte man eigene Produktionen im künstlerischen Bereich auf die Familie und auf die bürgerliche Geselligkeit am Familienabend, bei denen stets deklamatorische und musikalische Elemente auf dem Programm standen.
(TM)
S. 36
Die sechs Herren hörten noch, als sie durch die Säulenhalle schritten, im Landschaftszimmer die ersten Flötentöne aufklingen, von der Konsulin auf dem Harmonium begleitet, die kleine, helle, graziöse Melodie, die sinnig durch die weiten Räume schwebt…
S. 509
Nie hatte er geglaubt, dass das Wesen der Musik seiner Familie so gänzlich fremd sei, wie es jetzt den Anschein gewann. Sein Großvater hatte gern ein wenig Flöte geblasen, und er selbst hatte immer mit Wohlgefallen auf hübsche Melodien, die entweder eine leichte Grazie oder einige beschauliche Wehmut oder eine Mutter stimmende Schwunghaftigkeit an den Tag legten, gelausch…
Christian Buddenbrook warnt seinen Neffen davor, sein Herz zu sehr an die Kunst zu hängen:
S. 539
Bist du schon mal im Theater gewesen? … Im Fidelio? Ja, das wird gut gegeben.. Hör mal, Kind, lass dir raten, hänge deine Gedanken nur nicht zu sehr an solche Sachen. Theater. und sowas. Das taugt nichts, glaube deinem Onkel. Ich habe mich auch immer viel zu sehr für diese Dinge interessiert, und darum ist auch nicht viel aus mir geworden…
Bei Hanno sieht sein Vater die Gefahr des Wirklichkeitsverlusts, eben gerade durch das Klavierspiel.
S. 508
Thomas Buddenbrook war in seinem Herzen nicht einverstanden mit dem Wesen und der Entwicklung des kleinen Johan…
Gerdas Geigenspiel hatte für Thomas bislang, . ,eine reizvolle Beigabe mehr zu ihrem eigenartigen Wesen bedeutet; jetzt aber, da er sehen musste, wie die Leidenschaft der Musik, die ihm fremd war, so früh schon, so von Anbeginn und von Grund aus sich auch seines Sohnes bemächtigte, wurde sie ihm zu einer feindlichen Macht, die sich zwischen ihn und das Kind stellte, aus dem seine Hoffnungen doch einen echten Buddenbrook, einen starken und praktisch gesinnten Mann mit kräftigen Trieben nach Außen, nach Macht und Eroberung machen wollte…
Der Zusammenhang von Bürgerlichkeit und Künstlerexistenz ist d a s Thema im Lebenswerk von Thomas Mann: Das zum Bürgertum gehörende Dilettieren in der Kunst war für ihn negativ besetzt, die , Bajazzo-Existenz’ bedeutete für ihn eine soziale Deklassierung. In seinen Büchern und Erzählungen spiegelt sich wider, wie sensible
Bürger diese Spannungen zwischen Normalität und Anderssein, Entfremdung und Beisichselbstsein, Leistungswelt und Chaos erleben und wie sehr sich die einsame Künstlerexistenz nach Alltäglichkeit und Gewöhnlichkeit sehnt.
Zum bürgerlichen Selbstverständnis gehörte nicht nur die Rezeption der Kunst, sondern auch die Förderung der Künste und Wissenschaften durch Spenden und Stiftungen. Man sah sich als Träger der Kultur und der allgemeinen rationalen und ästhetischen Bildung, die ja letztendlich zur Ausdehnung des Bürgerstatus auf die Glieder in der Gesellschaft führen sollte.706
Als wohlhabender Bürger finanzierte man Kunstbauten wie Theater, Museen und Konzertsäle. Das Mäzenatentum wurde zu einem dominanten Merkmal der Kultur, insbesondere der Musikkultur.
Die neuen Kommunikationsformen, wie Wochenschriften,Tageszeitungen, Romane, fanden durch die sich verbreitende Lesefähigkeit immer mehr Absatz und förderten den sozialen und kulturellen Wandel.
Am Ende war es die naturalistische Revolte, die sich gegen die bürgerliche Welt wandte und sich von deren Geschmack entfernte. Sie brachte eine Entfremdung zwischen Bürgern bzw. deren Kunstverständnis und den Künstlern selber: Bei Malern, Musikern und Literaten wuchs das Interesse, eigene Erfahrungen in die Kunst zu einzubringen. Bis 1900 hatte sich dann eine vollkommen andersartige Form der moderner Kunst durchgesetzt - wiederum mit Bürgern, die diese Modernität in der Kunst finanziell und ideell trugen.707
15.8.1 Bildung durch Musik
Bereits die Zeit vor dem 19. Jahrhundert war im deutschsprachigen Kulturraum geprägt von der Dominanz des Verstandes durch die aufkommenden Naturwissenschaften und der Verdrängung des mittelalterlichen Denkens, weiterhin von der Aufspaltung des Christentums und der Kenntnis von exotischen Moralvorstellungen und Sitten durch Reiseberichte der Missionare und Kaufleute.
In das entstehende geistige Vakuum verbreiteten sich nun von Holland und Nordwestdeutschland aus die moralischen Vorstellungen des Pietismus, der mit seiner Betonung des Innenlebens und einer Vertiefung der Gefühle und der „Empfindsamkeit“ die Künste, und insbesondere die Musik, veränderte.708
Der Schwerpunkt bürgerlicher Kultur lag in der Musik, sie besaß eine besondere Relevanz.709„Je stärker das Bürgertum zur wirtschaftlichen Macht strebte, um so mehr wurden das Musikhören und das Musikmachen […] zu einem gesellschaftlichen Bedürfnis.“710
Musik galt als das Medium der Gemütsbildung und diente der Verfeinerung der Sinne. Sie war Ausdruck der Gefühlslage und nahm Einfluss auf die unterbewussten Schichten des Menschen. Mehr als alle anderen Künste formte sie die Gefühle und das Innenleben der
Bürger, in ihr begegnete er seinen Empfindungen und verfeinerte durch sie das eigene bürgerliche Bewusstsein. Die Rezeption von Musik erfolgte nicht verstandesorientiert, sondern war ästhetisches Erleben.711
„Die Wertschätzung der Musik ging so weit, dass sie (. )im Bildungsbürgertum eine habituelle Veränderung des sozialen Verhaltens stimulierte.“712
„Musik präzise hören und lesen, wenigstens passabel spielen und in den Anfangsgründen der komponierenden „Gelehrtheit“ sich auskennen., das machte die Bildung des 18. und noch 19. Jahrhunderts aus.“713 Es gehörte fortan zum guten Ton, sich als gewerbe- und handeltreibender Bürger über Musik zu unterhalten oder in der Wohnung Kammermusik zu spielen.
(TM)
Ist Musik zunächst für die Familie Buddenbrooks angenehme Unterhaltung und Zerstreuung, wandelte sich dies mit dem Auftreten Gerda Arnoldsens. Thomas Buddenbrook, Teil des Wirtschaftsbürgertums mit bildungsbürgerlicher Ambition, öffnete sich zum Bildungs-/Kulturbürgertum durch seine Heirat.
Musik wurde in der Folgezeit nicht mehr nur als Tafelmusik nebenbei gehört, Gerda und ihr Vater initiieren und organisieren auf die Privatheit der Familie bezogene Privatkonzerte, mit im Repertoire: Mozart, Beethoven und aktuelle Komponisten.714 S. 288
Nach Tische ließ ich mich dem alten Herrn Arnoldsen präsentieren, … Später, im Salon, trug er mehrereKonzert-Piécenvor, und auch Gerda produzierte sich. Sie sah prachtvoll dabei aus, und obgleich ich keine Ahnung vom Violinspiel habe, so weiß ich, dass sie auf ihrem Instrument (einer echten Stradivari) zu singen verstand, dass einem beinahe die Tränen in die Augen trate…
Ich traf mit ihr noch gelegentlich eines Gartenfestes bei meinem Freunde Van Svindern zusammen, ich ward zu einer kleinen musikalischenSoiréebei Arnoldsens selbst gebeten, …
Gerda erhielt, typisch für die die damaligen Mädchen, in der Höheren Töchterschule neben den Kenntnissen in hausfraulichen Pflichten eine musikalische Ausbildung, oftmals erteilt von privaten Musiklehrern oder von bürgerlichen Frauen, die als Musiklehrerinnen ihr Honorar verdienten. Singen, Klavierspielen und Geigenunterricht gehörten hier mit zur Erziehung und erhöhten die Heiratschancen in den gehobenen Kreisen für eine „gute Partie“.715 Die Frau als Kulturträgerin pflegte in ihrer Familie Hausmusik und gab damit die musikalische Bildung in der häuslichen Erziehung ihrer Kinder weiter.
So wie Thomas Mann seine klavierspielende Mutter viele Jahre auf der Violine begleitet,716 wird auch Hanno von seiner Mutter und Herrn Pfühl im Klavierunterricht unterwiesen: (TM)
S. 502
„Sie übertreffen alle meine Erwartungen“, sagte sie gelegentlich zu Herrn Pfühl. „. Ihre Methode ist, wie mir scheint, eminent schöpferisch. Manchmal fängt er wahrhaftig schon mit Versuchen an, zu phantasieren…
Manchmal betrachte ich seine Augen. es liegt so vieles darin, aber seinen Mund hält er verschlossen. Später einmal im Leben, das vielleicht seinen Mund immer fester verschließen wird, muss er eine Möglichkeit haben, zu reden…
Man vermittelte in der Schule so viel musikalische Bildung wie für den Hausgebrauch nötig war. Die Beschäftigung mit den schönen Künsten wurde zwar geschätzt, aber nur solange sie nicht zum Beruf wurde.717 Der Dilettant/ die Dilettantin, damals noch kein negativ konnotierter Begriff mit pejorativer Bedeutung, galt als Liebhaber/in von Kunst, war im Bereich der Kunst und Literatur aktiv und beschäftigte sich mit der Musikkultur aus Vergnügen, „der Meister- und Kennerschaft entgegengesetzt, obgleich er/sie diese oft an Wärme übertrifft. Denn auch die Liebhaberei ist verschiedener Art, und es gibt geistvolle und geistlose.“ 718 Ein dilettierender Bürger strebte danach, seine individuellen Anlagen und Fähigkeiten seinem Vorbild nach zu entwickeln, musizierte oftmals auf hohem künstlerischem Niveau und hatte das Ziel, durch seine Kunst vollkommener zu werden. (TM) S. 296
… aber auch Gerda holte ihre Stradivari herbei, von der sie sich niemals trennte, und griff mit ihrer süßen Cantilene in seine Passagen ein, und sie spielten pompöse Duos, im Landschaftszimmer, beim Harmonium, an derselben Stelle, wo einstmals des Konsuls Großvater seine kleinen, sinnigen Melodien auf der Flöte geblasen hatt…
Ist Gerda Buddenbrook eine Künstlerin oder nur eine musizierende Frau aus der Bürgerschicht, die „pompöse Duos“ geigt? Sie ist auf jeden Fall ein Beispiel dafür, dass es nicht bei einer Halbbildung im musikalischen Bereich bleiben musste. Ihre Fähigkeiten überschritten den Hausgebrauch und führten zum Virtuosentum, von den Einheimischen misstrauisch beäugt, denn: „Freilich durfte der häuslichen Musikübung nicht gleich ein Zug befremdlichen Virtuosentums anhaften.“719
S. 303
Sie ist eine Künstlernatur, ein eigenartiges, rätselhaftes, entzückendes Geschöpf…
In Gerda Arnoldsen-Buddenbrook finden wir eine Kulturbürgerin par excellence, sie, die Künstlerin aus eigener Kraft und in eigener Verantwortung, ist der „wahre Bürger, der wirkliche Erbe des bürgerlichen Zeitalters, seine Vollendung.“720
Mit der Entwicklung des öffentlichen Konzertwesens nahm der Besuch von Opern und Konzerten nach der Arbeitszeit im Bildungsbürgertum einen wichtigen Raum ein.
Hanno erlebt den ersten Konzertbesuch als Beginn seiner Musik-Leidenschaft (Hören und Musizieren). Er nimmt die Musik in sein Repertoire auf und übt sie aktiv zu Hause auf dem Klavier, dem bürgerlichen Hausinstrument schlechthin. Dieses Individualinstrument, ohne Orchester zu spielen, führte allen die Kultur der Hausbewohner vor Augen und demonstrierte den erreichten bürgerlichen Status.721 (TM)
Mit Hilfe des Klavierspiels versucht sich Hanno von da an über das sonst freudlose Dasein hinweg zu helfen. Zu seinem Hauskonzert erscheinen die Familienangehörigen und erleben, wie er beseelt ist in seiner Darbietung und sich, ähnlich seiner Mutter, in eine autonome Welt versetzt, aus der sein Vater aufgrund fehlender Kenntnisse und mangelndem Verständnis, ausgeschlossen bleibt.
S. 506
… aber jetzt war die Hingebung an sein Werk, das, ach, nach zwei Minuten schon wieder zu Ende sein sollte, so groß in ihm, dass er in vollständiger Entrücktheit Alles um sich her vergessen hatte. Dies kleine melodische Gebilde war mehr harmonischer als Rhythmischer Natu…
Kulturelle Bildung im Bürgertum umfasste ein bestimmtes Wissen und war markiert durch den nationalen Gedanken: Die Beschäftigung mit den Dichtern und Komponisten der eigenen Nation machte den Bürger zum Träger der nationalen Kultur.722 Ein Beispiel dafür ist das Allgemeine Deutsche Sängerfest 1847 in Lübeck. Zu ihm kamen Teilnehmer aus ganz Deutschland und unterstrichen mit Musik und Umzügen die Einheit Deutschlands. (TM)
Dieser Enthusiasmus spiegelt sich im Roman wider:
S. 494ff
„O Bach! Sebastian Bach, verehrteste Frau!“ rief Herr Edmund Pfühl, Organist von Sankt Marien, der in großer Bewegung den Salon durchschritt, während Gerda lächelnd den Kopf in der Hand gestützt, am Flügel sa…
Ein Satz Haydn, einige Seiten Mozart, eine Sonate von Beethoven wurden durchgeführ…
Anfang der 70er Jahre begeisterten Wagner-Aufführungen die Bürger Lübecks, sogar ein Wagner-Verein wurde gegründet.
(TM)
Auch Gerda ist eine Anhängerin Wagners und steckt mit ihrer Begeisterung ihren Klavierlehrer an.
S. 497f
Dann jedoch, während Gerda, die Geige unterm Arm, neue Noten herbei suchte, geschah das Überraschende, dass Herr Pfühl, Edmund Pfühl, Organist an Sankt Marien, mit seinem freien Zwischenspiel allgemach in einen sehr seltsamen Stil hinüber glitt. eine Steigerung, eine Verschlingung, ein Übergang. und mit der Auflösung setzte im fortissimo die Violine ein. Das Meistersinger-Vorspiel zog vorübe…
Gerda Buddenbrook war eine leidenschaftliche Verehrerin der neuen Musi…
Bürgerliche Vereine als ein Beispiel bürgerlicher Selbstorganisation finanzierten und organisierten den gesamten Kunstbetrieb: Museen, Theater und Musikvereine dienten der musikalischen Unterweisung, der Musikförderung und der Musikverbreitung durch Herausgabe von fachspezifischen Zeitschriften. Man unterstützte Künstler und Musiker sowohl finanziell als auch ideell bei den Aufführungen ihrer Konzerte, so dass diese sich von fürstlichen Mäzenen emanzipieren konnten.723 In diesen Vereinen verband die gemeinsame Freude an der Kunst engagierte Bürger und Dilettanten. Man trat mit hohem Anspruch vor einer begrenzten bürgerlichen kunstverständigen Zuhörerzahl auf und präsentierte abwechslungsreiche klassische Programme wie z.B. Oratorien (anders als in den sonstigen bürgerlichen Vereinen waren in den Musikvereinen Frauen als Mitwirkende im Chor erwünscht) und Sinfonien - und wurde vom Publikum für ihre Bemühungen belohnt.
Größere Musikfeste hatten eine immense gemeinschaftsbildende Kraft, weil auf ihnen die gesellige Unterhaltung und der Diskurs über Musikerlebnisse eine zentrale Rolle spielten.
Ein Beispiel hierfür ist wieder Lübeck: Der Musikverein von Lübeck spielte mit seinen darin zusammengeschlossenen Orchestern auf Bällen und im Stadttheater. Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung fanden auf der Tribüne des Burgfeldes Konzerte und auf dem Markt Sängerfeste mit Liedertafeln statt, z.B. das Erste Norddeutsche Musikfest 1839 und das Sängerfest 1844. Das ,Norddeutsche Musikfest 1839 in Lübeck’, durch den verantwortlichen Musikverein organisiert, richtete Händel-Konzerte in der Marienkirche aus und galt als ein Beispiel bürgerlicher Selbstinszenierung mit professionellen Musikern und auswärtigen Dilettanten. Ein geselliges Rahmenprogramm, aufgestellt und verantwortet von Musikverein, „unterhielt mit Schifffahrt und Essen“.724
Ab den 1840er Jahren zeigte sich im Bau großer Konzerthäuser ein Wandel von der „Betätigungskultur“ zur „Darbietungskultur“.725 Theater und Konzertbauten trugen dem Repräsentationsbedürfnis der Bürger Rechnung, in ihnen fand er Erholung und Entspannung, in rezeptiver Konsumhaltung. Es folgte die Professionalisierung der Kunst. In deren Verlauf präsentierten Künstler aktuelle musikalische Strömungen und klassische traditionelle Werke, in extra für sie geschaffenen Kulturräumen. Dies hatte gleichzeitig den Rückzug des Dilettanten in die häusliche private Sphäre zur Folge und ließ die Begriffe Berufskünstlertum und Dilettantismus zu antinomischen Begriffen werden, „Dilettantismus“ war nun negativ konnotiert und pejoriert.726
Im Zuge der Massendemokratisierung Ende des 19. Jh. fand eine Kommerzialisierung des Musiklebens und eine Angleichung des Musikgeschmacks zwischen Bildungsbürgertum und Musikkonsumenten statt. Musik trat nun als Oppositionserscheinung zur bürgerlichen klassischen Musikkultur auf, wobei insbesondere der Unterhaltungscharakter der Musik eine stärkere Bewertung fand. Der ökonomischen Aspekt der Musikproduktion machte von jetzt an eine leichte und oberflächliche Konsumierbarkeit zur wichtigsten Rezeptionsgewohnheit.
„Die mediale Präsenz der Musik und die soziale Ausweitung des Musiklebens markierten Phänomene der kulturellen Moderne.“727 Schallplatten und die Musik im Radio schränkten die Monopolstellung der Konzert- und Opernhäuser als Ort des öffentlichen Musikkonsums ein und versorgten den privaten Bereich mit vielfältiger Musik und Gesang. Der Zugang zur Musik erweiterte und vereinfachte sich. Der Kulturtransfer zwischen Europa und den USA führte zu einer Angleichung des Musikgeschmacks und der Musikstile.
Auch wenn in der Gegenwart die allgemeine musikalische Bildung gering ist, das Bedürfnis nach emotionaler Identifikation, das die bürgerliche Musik aufgriff, ist weiterhin vorhanden und sucht sich in der neuen Musik einen Ersatz.
Alma spielt in ihrer Freizeit auf ihrem Instrument klassische Werke: (AG)
S. 43
Ehe sie die Arbeiten wiederaufnimmt, die sie am Vormittag nicht beenden konnte, spielt sie ein wenig auf der Querflöte. Sie ist gerade bei einem Stück von Bach, eine in F-dur gesetzte Triosonate, als Richard im Garten laut ihren Namen ruf…
… Sie unterbricht das Stück, wischt das Mundstück der Querflöte mit der Handinnenfläche ab, legt die Flöte auf den Steg des Notenständer…
S. 48
Im sanften Nachmittagslicht pfeift er etwas aus der Fledermaus vor sich hi…
(ER)
Charlotte, bürgerlich veranlagt, hört, anders als ihr Mann Wilhelm, ebenfalls Musik, mexikanische Musik von Jorge Negrete, dem damals populärsten mexikanischen Sänger. Die Lieder dieses Opernsängers und Schauspielstars berühren sie emotional und rufen Erinnerungen an die Zeit in Mexiko wach.
S. 83
Zum Abendbrot gab es Musik: aus dem Schallplattenspiele…
Wilhelm war gegen Mus…
- Du immer mit deinem Zeug, sagte e…
Aber er war der Einzige, der den Schallplattenspieler bedienen konnte. Deswegen bettelte die Om…
- Wilhelmchen, leg uns doch eine Schallplatte auf, Alexander hört so gern Jorge Negret…
Goldene Gräte.. Da es bei seinen Eltern keinen Plattenspieler gab, war Goldene Gräte im Grunde die einzige Musik, die er kannt…
Die aber dafür gu…
Alexander hört im Flugzeug klassische Musik und empfindet die Händel-Musik nach seiner Erkrankung bewegend. Sie geht ihm nahe und stößt Unbewusstes, und im Wissen um seine Krankheit, Gedanken an Leben und Vergänglichkeit, an.
S. 97
Er setzte die Schlafmaske auf, stöpselte seine Kopfhörer ein, schaltete die Programme durc…
Händel. Irgendeine dieser berühmten Arien: verhalten und von gefährlicher Melancholie. Vorsichtig hörte er hinein, jeden Augenblick bereit, die Musik abzuschalten, falls sie ihm zu nahe gin…
Was aber nicht der Fall war. Er lehnte sich zurück, lauschte verwundert dem überirdischen sound der Arie -, eigentlich nicht überirdisch, im Gegenteil. Ganz anders als Bach: irdisch, diesseitig. So diesseitig, dass es beinahe wehtat. Abschiedsschmerz, wusste er plötzlich. Der Blick auf die Welt im Bewusstsein ihrer Vergänglichkeit.. Und wie viel Zeit sich dieser Kerl ließ. Und wie einfach das alles war, wie kla…
Die mexikanische Musik, gespielt von mexikanischen Musikanten, ruft Erinnerungen an seine Oma Charlotte und an seine Kindheit wach, beschwingt ihn und lässt ihn glücklich und unbeschwert zurück.
S. 101
Dann ist Musik zu hören. Keine Trillerpfeifen, richtige Musik. Undeutlich noch, hin und wieder springt eine Geige oder Trompete hervor: Geige und Trompete! Die typisch mexikanische Instrumentierung, wie auf der Schellackplatte von Oma Charlotte. Seine Erregung nimmt zu, er beschleunigt den Schritt. Jetzt klingt es, als stimmt ein riesenhaftes Orchester die Instrumente. Sänger scheinen sich einzusingen.Der Platz ist voller Menschen, darunter, er glaubt, seinen Augen nicht zu trauen, in kleinen, an ihren jeweils einheitlichen Uniformen leicht erkennbaren Grüppchen, hunderte Musikanten: Kapellen, große und kleine..und sie alle machen Musik! Gleichzeitig!.Alexander geht umher, lauscht wie in in Trance, wandert von Kapelle zu Kapelle, sucht mit den Ohren seine Musi…
-México lindo,sagt Alexande…
Der Sänger sagt:S…
- Jorge Negrete, sagte Alexande…
Der Sänger sagt:Sí…
Das Lied ist zu Ende. Er merkt, dass ihm Tränen über die Wangen laufe…
Wer sagt, dass ich Krebs habe?.Hier bin ich. ich grüße dich, große Stadt. Ich grüße den Himmel. Die Bäume, die Löcher im Asphalt.Hätte er den Musikanten Geld geben müsse…
Dieser Verdacht ist das Einzige, was ihn, als er einschläft, ein wenig beunruhig…
Musikvereine haben bis in die Gegenwart hinein, ihre Bedeutung erhalten:
Sie fördern die musikalische Bildung und das Musizieren und demonstrieren, wie wichtig Musik in ihrer positiven Wirkung ist und wie sehr sie die Intelligenz und das Wahrnehmungsvermögen fördert. (Bereits im Grundschulbereich unterstützt das Projekt „Jedem Kind ein Instrument“ die Förderung der Kreativität der Kinder.) Musik bleibt in unserer Kultur bedeutsam, sie stellt Geselligkeit her und vertieft sie.
(AG)
Der gemeinsame Gesang auf der Fahrt in den Urlaub von Peter und seinen Kindern dient der Unterhaltung und der Ablenkung:
S. 298f
-Ihr könntet was singen. Na? Zur Hebung der allgemeinen Moral…
- Der Bub wagt sich vor, nichts Besonderes, klar, aber immerhin: Wann wird’s mal wieder richtig Somme…
15.8.2 Bildung durch Malerei
Neben den Musikvereinen entstanden im bürgerlichen Jahrhundert Kunstvereine, die den Kunsthandel für zeitgenössische Künstler durch Ausstellungen und Ankäufe verbreiteten. Ihr Anspruch war es, die künstlerische Freiheit zu schützen - entgegen den zentralen staatlichen Kunstinstitutionen und dem fürstlichen Mäzenatentum.
Nach dem gescheiterten Versuch der Nationalstaatsgründung war es ein künstlerischer Trend, Themen der nationalen Geschichte zu malen. Der sog. Historismus ließ Historiengemälde in gediegener detailgenauer Technik entstehen. Sie waren ganz nach dem Geschmack der Bürger, spiegelten sie doch die Werte Fleiß, Disziplin und Idealismus des Bürgertums wider und fanden aufgrund dessen viele bürgerliche Abnehmer.
(TM)
Im Landschaftszimmer der Familie Buddenbrook sind diese Motive erkennbar:
S. 10
Die starken und elastischen Tapeten, ., zeigten umfangreiche Landschaften, . Idylle im Geschmack des 18. Jahrhunderts, mit fröhlichen Winzern, emsigen Ackersleuten, nett bebänderten Schäferinnen, die reinliche Lämmer am Rande spiegelnden Wassers im Schoße hielten oder sich mit zärtlichen Schäfern küsste…
Hannos Kinderzimmerwände wirken dagegen achtlos dekoriert:
S. 460
Abgesehen von einem sehr großen schwarzgerahmten Stich, der über Fräulein Jungmanns Bett hing und Giacomo Meyerbeer, umgeben von den Gestalten seiner Opern, darstellte, gab es nur noch eine Anzahl von englischen Buntdrucken, die Kinder mit gelbem Haar und roten Babykleidern darstellten und mit Stecknadeln an der hellen Tapete befestigt ware…
Die typische bürgerliche Bildungsstätte war das Museum, in dem durch private Schenkungen eine große Anzahl von Sammlungen mittelalterlicher Kunstwerke und kirchlicher Kunstaltertümer eröffnet werden konnte. In Lübeck kaufte der 1838 gegründete Kunstverein Bilder, die ihre Präsentation in der Katharienkirche fanden und richtete gleichzeitig eine eigene Galerie ein mit erworbenen Bildern aus Privatsammlungen.
(ER)
Nach der Wende spielt in der Familie von Markus, zu dessen Leidwesen, diese Form der bürgerlichen Kultur eine Rolle im sonntäglichen Freizeitverhalten:
S. 375
Für all das konnte Markus nicht das Geringste. Auch hatte er persönlich gar nichts davon, dass seine Alten plötzlich Geld hatten. … Kaum vermeiden ließ sich dagegen der anschließende „Familientag“, mal schön zusammen kochen, solche Sachen, oder ganz übel, Ausstellung zusammen besuchen …
15.8.3 Das Theater als Bildungsstätte
Theater wurden im 19. Jahrhundert nicht von Staat und Kommunen, sondern von bürgerlichen Vereinen und Mäzenen initiiert. Sie entwickelten sich zu regelrechten Bildungstempeln und ließen einen Theater-Enthusiasmus entstehen. Ein Theaterbesuch gehörte zum bürgerlichen Leben einfach dazu. Man besuchte nicht nur Theateraufführungen, sondern hielt ebenso zu Hause Vorlesungen und Rezitationen ab, die den Charakter von Aufführungen besaßen.
Beispiele dafür gibt es in der Familie Buddenbrook durch Christian Buddenbrook: S. 539
Dann jedoch, nach einer Pause, während welcher in Betrachtung des Theaters sein knochiges und verfallenes Gesicht sich aufhellte, ließ er plötzlich eine Figur sich auf der Bühne vorwärts bewegen und sang mit hohl krächzender und tremolierender Stimme: „Ha, welch gräßliches Verbrechen!“ worauf er den Sessel des Harmoniums vor das Theater schob, sich setzte und eine Oper aufzuführen begann, indem er, singend und gestikulierend, abwechselnd die Bewegungen des Kapellmeisters und der agierenden Personen vollführt…
Selbst Kinder besaßen als beliebtes Spielzeug ein Puppentheater, ein Theater im Kleinen, zu dem Kulissen und Dekoration gehörten. Stücke und Theateraufführungen wurden so en miniature im Rollenspiel in den eigenen vier Wänden zur Unterhaltung der Familie in Szene gesetzt.
S. 536
Hanno war vollständig verwirrt. Bald nach dem Eintritt hatten seine fieberhaft suchenden Augen das Theater erblickt. ein Theater, das, wie es dort oben auf dem Tische prangte, von so extremer Größe und Breite erschien, wie er es sich vorzustellen niemals erkühnt hatt…
Hatte das Theater in den kleineren Städten oftmals den Ruf des Provinziellen und des Unmoralischen, präsentierten die Theater in den größeren Städten klassische Aufführungen auf durchaus hohem Niveau. Insbesondere nach dem Vormärz verdrängten klassische Schauspiele die früheren trivialen Luststücke einer mittelmäßigen laienhaften Theaterkultur aus dem Veranstaltungskanon.
Die Funktion des Theaters wurde zu der einer Ersatzreligion, sie sollte die Menschen läutern und vom Diesseits erlösen. In der Kunst erlebte der Bürge,„das ehrfurchtsvolle Erleben des genialen Dichters in der Aufführung“.728
Theater lagen zumeist zentral an bevorzugter Stelle der Stadt und stellten sich als Renommierobjekte dar. Sie sollten Bildung und den Rang von Stadt und Bürgertum widerspiegeln, wie z.B. das 1799 gebaute Theater in Lübeck. Es wurde im Zuge des wachsenden Reichtums der Städte von Wirtschaftsbürgern, Kaufleuten, Bankiers, Fabrikanten finanziell unterstützt und kontrolliert. Die Ende des 19. Jahrhunderts gebauten Logenränge ermöglichten es von da an der Oberschicht, sich von der Masse des Publikums fernzuhalten.
1858 stellte man in Lübeck, vom Senat subventioniert, das Casino-Theater mit 800 Sitzplätzen fertig, des Weiteren gab es das Sommertheater ,Tivoli’ mit einem leichteren Programm, später entstand ein noch volkstümlicheres dieser Art vor dem Mühlentor.
Im Roman „Buddenbrooks“ brachten die meisten Bürger dem Theater zunächst nur eine geringe Wertschätzung entgegen. Schauspielerinnen standen ebenso wie Sängerinnen außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft, wurden verachtet und auf die Stufe von Straßendirnen gestellt. Ihr Kostüm, für viel Geld von ihnen selber finanziert, lockte Kunden an, und diese bezahlten nicht selten die Schauspielerinnen hinter der Bühne für sexuelle Dienstleistungen.729
(TM) ..
Christian B. fühlt sich, sehr zum Ärger der Familie, besonders zur Theaterwelt hingezogen: S. 81
Vor allem jedoch war er ein eifriger Theaterliebhaber, versäumte keine Vorstellung und nahm persönliches Interesse an dem ausübenden Personal. Demoiselle Meyer-de la Grange war die letzte der jungen Künstlerinnen, die er in den vergangenen Jahren mit Brillanten ausgezeichnet hatt…
S. 261f
„Ich kann gar nicht sagen, wie gern ich im Theater bin! Schon das Wort Theater’ macht mich geradezu glücklich.Schon das Stimmen der Orchesterinstrumente! Ich würde ins Theater gehen, nur um das zu hören!. Besonders gern habe ich die Liebesscenen. Früher habe ich mich fortwährend gesehnt, einmal hinter die Coulissen zu kommen - ja, jetzt bin ich da ziemlich zu Hause, das kann ich sagen.…
In der späteren DDR wurde der bürgerlichen Existenz in Hinblick auf jegliche Form Kultureinrichtungen wie Theater und Museen kein Raum gegeben, stattdessen formten politisch gewünschte Vorgaben die Kultur, z.B. durch die Errichtung von Volksbühnen mit zeitnahen politischen Theaterstücken und Massenevents. Das Kulturleben fiel der sozialistischen Umgestaltung zum Opfer.
(ER)
Sascha, das Alter Ego von Eugen Ruge, wendet sich nach dem naturwissenschaftlichen Studium in der DDR der Theaterproduktion zu. Seine Auswanderung in den Westen hat das Ziel, in künstlerischer Freiheit inszenieren zu können: S. 26
Er hatte zehn oder zwölf oder fünfzehn Theaterstücke inszeniert (an immer unbedeutenderen Theater…
16. Reisen im 19. und 20. Jahrhundert
Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reise…
Johann Wolfgang von Goet…
Quelle: Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre, 1795/6 5. Buch, 2. Kap Briefzitat an Wilhe…
Eine Tätigkeit, die heute wie selbstverständlich zur Jahresplanung einer Familie gehört, ist das Reisen. In den Romanen wird deutlich, wie sehr das Erleben einer Reise sich sowohl nach dem historischen Kontext, dem sozio-kulturellen Milieu, den Motiven und den Funktionen der Reise richtet - diese sind für jede Romanfigur unterschiedlich.
In früheren Zeiten dominierte die städtische Oberschicht das Reisen, bestehend aus dem Wirtschaftsbürgertum, aus Kaufleuten, Bankiers und Fabrikanten, und dem Bildungsbürgertum, mit Professoren, Juristen und Ärzten. Eine Reise war für sie alle ein Statussymbol und Zeichen bürgerlicher Lebenshaltung. Man zeigte damit, dass man finanzielle und zeitliche Ressourcen hatte und beruflich so selbständig war, dass eine zeitlich längere Abwesenheit in Betracht kam. Reisen mehrte das soziale Prestige der Familie.
In einem bürgerlichen Lebenslauf war das Reisen in allen Lebensabschnitten zu finden. Bereits in der Kindheit und Jugend besuchte man für ein paar Wochen das Ostseebad und wusste sich dort unter Seinesgleichen, in der beruflichen Phase hatte das Reisen den Zweck der Bildung, und im Alter unternahm der männliche Bürger eine Erholungsreise, begleitet von Ehefrauen und Kindern. Mit zunehmendem Wohlstand wählte man meist einen mehrwöchigen Erholungsurlaub in die nähere Umgebung, auf eine Insel oder in einen Badeort an der deutschen Seeküste.
16.1 Die Bildungs- und Qualifikationsreise
Noch bis ins 17. Jahrhundert hinein herrschte Skepsis dem Reisen gegenüber, so dass mancher Fürst ein Verdikt gegen das Reisen erließ, da man durch Reisen Geld außer Landes führte - es wurde sogar die Überlegung laut, eine Reisesteuer zu schaffen - und Untugenden aus anderen Ländern nach Deutschland gebracht würden.730
Trendsetter für das Bürgertum in ihrem Reiseverhalten war auch hier die aristokratische Elite, die wiederum war durch das Reiseverhalten von König und Hof beeinflusst worden. Die sog. „Grand Tour“ des Adels führte ihn nach Italien, wo stets die soziale Selbstdarstellung auf internationaler Ebene im Vordergrund stand. Diese Reise war Bestandteil des adligen Erziehungsprogramms, zu dessen Inhalt das Lernen von Sprachen und die Ausbildung in Tanz, Reiten und Fechten zählte. (Der heutige Begriff des Tourismus hat noch in seinem Zentrum den Begriff der „Tour“.) Es galt als ein Zeichen aristokratischen Lebensstils und als Bereicherung, soziale und gewandte Umgangsformen im Ausland zu lernen und zu pflegen, ausländische Varianten kennenzulernen.
Zeitverzögert zur Reisetätigkeit des Adels wurde zum Ende des 18. Jahrhunderts das Reisen ein wesentlicher Bestandteil des bürgerlichen kulturellen Kanons und sprach ihm einen hohen Bildungswert in Kunst, Geschichte und Natur zu.
(TM)
Thomas und Gerdas Hochzeitsreise ist dafür ein Beispiel:
S. 297
Gerda und Thomas aber wurden sich einig über die Route durch Ober-Italien nach Florenz. Sie würden etwa zwei Monate abwesend sein…
Madame Grünlich reist mit ihrem Vater, als dessen Gesundheit Kur-Aufenthalte erforderlich macht und verbindet diese Aufenthalte mit Bildung und Unterhaltung:
S. 240
Man ging nach Obersalzbrunn, ., man machte von dort aus sogar eine so bildende wie unterhaltende Reise über Nürnberg nach München, durchs Salzburgische über Ischl nach Wien, über Prag, Dresden, Berlin nach Haus…
Frauen reisten nur selten allein, sie wurden, so wie in diesem Fall auf ihren Reisen begleitet von Eltern oder männlichen Verwandten.
S. 240
… und obgleich Madame Grünlich wegen einer nervösen Magenschwäche, die sich neuerdings bei ihr bemerkbar zu machen begann, in den Bädern gezwungen war, sich einer strengen Kur zu unterwerfen, empfand sie diese Reise als eine höchst erwünschte Abwechslung, denn sie verhehlte durchaus nicht, dass sie sich zu Hause ein wenig langweilt…
Längere Reisephasen aber gab es beinahe ausschließlich in männlichen Lebensläufen.
Die Erziehungsmaxime der Familientrennung forderte einen längeren Aufenthalt außerhalb der Familie, in der der junge Mann nicht auf die Hilfe der Eltern zurückgreifen konnte.
So wie die soziale Gruppe der Handwerker den Gesetzen ihrer Zunft folgte, indem sie ein Jahr in der Fremde zwecks Weiterbildung zur Erlangung der Meisterwürde verbrachten, um sich später als Meister niederzulassen, erwarben Bürgersöhne eine allgemeine Bildung nach dem Universitätsstudium. Entsprechend dem persönlichen Bildungsstreben des Bürgertums strebten die Jungen nach der Schulzeit aus der Familie hinaus. Die sog. Bildungsreise war Teil eines bürgerlichen Kulturprogramms und hing mit der späteren Vergabe der sozialen Chancen zusammen. An ihr waren Qualifikations- und Bewährungspostulate und Charakterbildung geknüpft.
Solch eine Reise war stets mit der beruflichen Ausbildung verknüpft und diente der individuellen und vor allem beruflichen Bildung. Bei einer mehrjährigen Ausbildung im Ausland sollten Geschäftsverbindungen geknüpft werden, und der junge Reisende war angehalten, wirtschaftliche Phänomene wie Bodenschätze und regionalspezifische Handelspraktiken oder Bedingungen des Warentransportes genau zu beobachten und sich einzuprägen und stets auch die Suche nach neuen Erwerbsmöglichkeiten zu sein und den finanziellen Gewinn im Blick zu haben.731 Neben der allgemeinen Bildung gab es auf diesen Reisen noch allerlei Vergnügen - schon aufgrund dessen bedeutete diese Zeit letztendlich für die Person oft eine intensive Reifephase. Erwachsen und mit gesteigertem Selbstbewusstsein kehrten die jungen Männer von der „Tour“ zurück.
(TM)
Thomas und auch Christian verbringen eine mehrjährige Berufszeit bei Geschäftsfreunden ihres Vaters, Thomas lernt bei dieser Fahrt seine zukünftige Frau Gerda kennen.
S. 237
Christian selbst bewies in seinen Briefen ein lebhaftes Wanderbedürfnis und bat eifrig um Erlaubnis, „drüben“, das heißt in Süd-Amerika, vielleicht in Chile, eine Stellung annehmen zu dürfe…
S.287
Von meiner Lehrzeit her aber wohlbekannt in der Stadt, war ich, obgleich viele Familien sich in den Seebädern befinden, auch gesellschaftlich sofort sehr lebhaft in Anspruch genommen. Zu Tische aber führte ich. habt Ihr Lust zu rate…
Fräulein Arnoldsen, Gerda Arnoldse…
Mit der Entwicklung des Verkehrswesens legten nach den Napoleonischen Kriegen immer mehr Menschen weitere Wege zurück. „In einer großen Hafen- und Handelsstadt wie Hamburg bedeutete dies, dass Kaufmänner mitunter mehrere Monate oder Jahre ihres Lebens in europäischen - in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts zunehmend auch im außereuropäischen - Ausland verbrachten.“732 Kaufmännische Lehrlinge gingen oftmals nach ihrer Lehre in der Heimatstadt in die Kontore der wirtschaftlichen Zentren Europas und lernten dort Handels- und Produktionsstätten kennen,733 um später zurückzukehren und mit dem eigenen Kaufmannsgeschäft zu beginnen. Zur Reisevorbereitung gehörte stets die Mitgabe von Empfehlungsschreiben für Geschäftsfreunde oder Bekannte der Kaufmannsfamilie:
(TM)
S. 172
Mr. Richardson (Threeneedle Steet) ist, wie Du weißt, ein naher Geschäftsfreund meines Hauses. Ich schätze mich glücklich, meine beiden Söhne in Firmen untergebracht zu haben, die mir freundschaftlichst verbunden sin…
Neben dem Ausbildungszweck der beruflichen Bildung ging es beim Reisen stets um die Bildung zum Individuum und um Horizonterweiterung (z.B. dem Kennenlernen fremder Völker und deren Sitten). Ähnlich Goethes „Lehr- und Wanderjahre“ sollte diese Zeit in der Ferne eine wichtige Schule zur Selbstfindung und zur Entfaltung eigener Anlagen sein, mit der Erfahrung von Weite und Vielfalt in der Natur und in fremder Gesellschaft.734 (TM)
Materielle und theoretische Transfers stehen im Mittelpunkt der Reise von Thomas und Christian. Durch Netzwerke und Kontakte konnten sie an der transnationalen und interkulturellen Kommunikation als auch am Wissenstransfer teilhaben.
Christian reist nach England:
S. 172
Ich habe über Deines Bruders Weiterreise über Ostende nach England noch keine Nachrichten, hoffe jedoch zu Gott, dass sie glücklich von statten gegangen sein wir…
Thomas nach Amsterdam:
S. 155
Jetzt steht es zum Beispiel fest, dass ich Anfang nächsten Jahres nach Amsterdam gehe. Papa hat eine Stelle für mich. bei van der Kellen&Comp…
Im Anschluss an das Reisen folgte bei vielen Söhnen aus den wirtschaftsbürgerlichen Familien die Übernahme des väterlichen Betrieb. Damit wurden sie den elterlichen Erwartungen gerecht, zeigten Respekt und Dankbarkeit. Mit dem Einstieg ins Berufsleben oder auch der Übernahme der heimischen Firma, evtl. durch den Tod des Vaters, erfolgte stets für den jungen Mann der Rückgang der Reisetätigkeit.
44% der Söhne von Kaufleuten aber gingen, so wie Christian Buddenbrook, ins künstlerische Fach735, auch wenn der Umgang mit Schauspielern und der Verkehr in Künstlerkreisen, wie erwähnt, wegen deren vermeintlich lockereren Moral als skandalös galt.736 (TM)
S. 313
Über sein Verhältnis zu einer Statistin vom Sommertheater zum Beispiel amüsierte sich die ganze Stadt, und Frau Stuht aus der Glockengießerstraße, dieselbe, die in den ersten Kreisen verkehrte, erzählte es jeder Dame, die es hören wollte, dass „Krischan“ wieder einmal mit der vom „Tivoli“ auf offener, hellichter Straße gesehen worden se…
S. 318
„Du machst dich lächerlich mit deinen Liebschaften, mit deinen Harlekiniaden..…
Christians Beispiel zeigt, wie eine Reise die Wertvorstellungen eines Menschen relativieren und verändern kann. Sein Schritt nach Südamerika war zwar eine Grenzüberschreitung, hob aber die soziale Raumbindung traditionaler Gesellschaften nicht gänzlich auf, weil alle Begegnungen und Berührungen mit der fremden Kultur und den dortigen Menschen sich im schützenden sozialen Raum ihres Standes abspielten.737 Auf seiner Schiffsreise nach Amerika sammelte er sicherlich Erfahrungen mit Passagieren unterer Klassen.738 Besonders faszinierend waren für ihn, der aus bürgerlichen Milieu stammte, solche Menschen aus dem Volk, die kurios und unheimlich wirkten. In den Erzählungen zu Hause bleiben hierbei Verzerrungen nicht aus.739 (TM)
Das Kennenlernen des Fremden in Lebens-, Arbeitsweise und Kultur prägt die Reiseerfahrungen von Christian und Thomas Buddenbrook. Wieder daheim stellen die Schilderungen ihrer Reise und ihre Erscheinung den Nachweis von Bildung und von eigenem Geschmack unter Beweis.740
S. 234f
Thomas Buddenbrook, noch ein wenig blass, war eine auffallend elegante Erscheinung. Es schien, dass diese letzten Jahre seine Erziehung durchaus vollendet hatten. mit seiner über den Ohren zu kleinen Hügeln zusammengebürsteten Frisur, mit seinem nach französischer Mode sehr spitz gedrehten und mit der Brennzange waagerecht ausgezogenen Schnurrbart und seiner untersetzten, ziemlich breitschultrigen Gestalt machte seine Figur einen beinahe militärischen Eindruc…
Amerika, ein faszinierender Kontinent für europäische Reisende und Zielort von Christians Reise, war ein bevorzugtes Ziel für Geschäftsmänner. Es strahlte die Aura des Fernen und Entrückten aus, New York galt als Metropole der Moderne und der Zukunft.
S. 237
Christian selbst bewies in seinen Briefen ein lebhaftes Wanderbedürfnis und bat eifrig um die Erlaubnis, „drüben“, das heißt in Süd-Amerika, vielleicht in Chile, eine Stellung annehmen zu dürfen. „Aber das ist Abenteuerlust“, sagte der Konsu…
… und im Sommer 1851 segelte Christian Buddenbrook in der Tat nach Valparaiso…
Christian kann sich nach dem dortigen Aufenthalt nicht mehr dem heimischen Berufsalltag unterwerfen. Der Kontrast zur heimatlichen Berufswelt und dem monotonen kaufmännischen Alltag von Lübeck mit seiner Disziplin führt zur inneren Distanz. Die Sehnsucht nach Südamerika lässt ihn mit sentimental-romantischen Augen die ferne Erinnerung idealisieren.
Begeisterung und Faszination, aber auch Nostalgie und Kritik an der heimatlichen Berufswelt prägen seine Erzählungen. Seine Beschreibungen der Südamerika-Reise erinnern an eine Vergnügungsreise, unterhalten mit kuriosen Beobachtungen und kleinen Abenteuern, sind heiter und spannend und betonen seine Souveränität. Sein Publikum besteht aus Verwandten und Freunden, die durch diese Art des Erzählens bestens unterhalten werden.741
S. 272
Christian Buddenbrook war ein „Suitier“ - er berichtete Abenteuer, die er auf Schiffen, auf Eisenbahnen, in St. Pauli, in Whitechapel, im Urwald erlebt hatte. Er erzählte, bezwingend, hinreißend, in mühelosem Fluss,. Er erzählte die Geschichte eines Hundes, der in einer Schachtel von Valparaiso nach San Franzisko geschickt worden und obendrein räudig wa…
Zur damaligen Zeit entstanden eine große Anzahl von gedruckten Reiseerfahrungen und Reisechroniken, in denen Expeditionen zu kulturell anders, der damaligen Auffassung nach geringer entwickelten Völkern, beschrieben wurden. Sie dienten den Bürgern zur Stabilisierung ihres Selbstbildes und der Demonstration der eigenen überlegenen Moral. Bei Christian ist dies anders: Er wertet die nationalen deutschen Tugenden des Kaufmanns ab und betont einseitig die ihm positiv erscheinenden Stereotypen des Südamerikaners.
So verherrlicht Christian die an ihn kritisierten Verhaltensweisen in seinen Anekdoten von südamerikanischen Geschäftsleuten: Sie stellen den Genuss vor die Arbeit und vor die Disziplin. Noch lange nach dem Reisen sind die Erlebnisse in ihrer Reflexion Teil seiner Lebenserinnerungen und der eigenen Identität. Dort und damals in Südamerika kultivierte er sich für den Lebensstil eines mußevollen Gentlemans, so dass er am Geschäftsleben in Lübeck keinen Gefallen mehr findet.
S. 273
Zu Hause erzählte er mit besonderer Vorliebe von seinem Comptoir in Valparaiso, von der unmäßigen Temperatur, die dort geherrscht, und von einem jungen Londoner Namens Johnny Thunderstorm, einem Bummelanten, einem unglaublichen Kerl, der er, „Gott verdamm’ mich, niemals hatte arbeiten sehen“, und der doch ein sehr gewandter Kaufmann gewesen sei. „Bei der Hitze! Na, der Chef kommt ins Comptoir. wir liegen, acht Mann, wie die Fliegen umher und rauchen Cigaretten, um wenigstens die Mosquitos wegzujagen du lieber Gott! ,Nun?‘ sagt der Chef. ,Sie arbeiten nicht, meine Herren?!' ,No, Sir! sagt Johnny Thundersturm. ,Wie Sie sehen, Sir! Und dabei blasen wir ihm Alle unseren Cigarettenrauch ins Gesicht.…
Ähnlich absonderliche Geschichten wie Christian, projezierten auch andere Reisende nicht selten „eben jene Möglichkeiten, Antriebe und Verhaltensweisen, die im Begriffe waren, den neuen Peinlichkeitsschwellen, Disziplinierungen und Distanzierungen und Verhaltensanforderungen im eigenen Sozialsystem" zum Opfer zu fallen.742
16.2 Erholungs- und Badereisen - der Bürger und das Meer
Neben den Bildungs- und Qualifikationsreisen unternahmen viele gut gestellte Bürger Freizeitreisen. Zunächst dominierten in der Mehrzahl die Engländer als führende Wirtschaftsnation viele Urlaubsorte Europas. Bei ihnen trat das bürgerliche Leistungsethos hinter dem Freizeitleben zurück. Das Reisen wurde zwecks Erholung und Vergnügen zu einer kulturellen Praxis, die stets den Gegensatz von Alltag und Freizeit bzw. von Erwerbsleben und Privatsphäre unterstrich und Erholung als eine Flucht aus der Enge des Alltags und der Kälte des Berufslebens betrachtete.
Zu den Dimensionen des Reisens im Bürgertum gehörten einerseits das Abenteuerliche in der Fremde, andererseits auch die Wiederholung und Routine eines jährlichen Badeurlaubs.
Zunächst suchten sich bürgerliche Familien nahe gelegene Urlaubsziele, später mondäne, ehemals vom Adel aufgesuchte Kur- und Badeorte, ab Mitte des 19. Jahrhunderts fuhr man ins Ausland, nach Amerika, Asien und in den Orient.
(TM)
Die Familie Buddenbrook wählt ihren Erholungsort am Meer in Travemünde.
S.209
Der Konsul hatte schwere und aufreibende Tage hinter sich. Thomas war an einer Lungenblutung erkrankt. Es hatte sich erwiesen, dass die Erkrankung seines Sohnes keine unmittelbare Gefahr in sich schließe, dass aber eine Luftkur im Süden, in Südfrankreich dringend ratsam sei, und da es sich günstig getroffen hatte, dass auch für den jungen Sohn des Prinzipals eine Erholungsreise geplant worden war, so hatte er die beiden jungen Leute, sobald Thomas reisefähig war, gemeinsam nach Pau reisen lasse…
Während Christian und Thomas sich auch über die Grenzen des Deutschen Bundes hinaus bewegen, verbringen Frauen und Kinder üblicherweise die Sommer auf dem Land oder in Bädern. Tony unternahm eine Nahreise für mehrere Wochen nach Travemünde, um sich von Grünlichs Werbung abzulenken.
S. 114
„Das geht nicht länger, Bethsy, wir dürfen das Kind nicht maltraitieren. … Gestern war zufällig der alte Schwarzkopf von Travemünde hier, Dietrich Schwarzkopf, der Lotsen Kommandeur. Ich ließ ein paar Wort fallen, und er zeigte sich mit Vergnügen bereit, die Dirn für einige Zeit bei sich aufzunehmen. Da hat sie eine behagliche Häuslichkeit, kann baden und Luft schnappen und mit sich ins Reine komme…
Als Anfang des 19. Jahrhunderts das Bürgertum wirtschaftlich und zahlreich in den Kurorten auftrat, glich es sich in seinem Reiseverhalten der Elite, dem Adel, an, (der sich nun wiederum dem Seebad als Nachfolger des Kurortes zuwandte) und führte aristokratische Kommunikations- und Unterhaltungsformen bzw. -räume in ihren Kurorten ein, z.B. Theater- und Konzertaufführungen, eine Promenade, ein Casino und Konversationsräume. Als später das Kurhaus mit der Spielbank zum wahren Zentrum wurde, lebte man in ihm fortan eigene elitäre Umgangsformen.
Kurgesellschaften setzten sich ausschließlich aus sozial gleichen Zirkeln zusammen. Man verkehrte mit Freunden und Bekannten der heimischen Gesellschaft, intensivierte mit gemeinsamen Wanderungen und Wasserkuren Beziehungen und konsolidierte so die eigene Gruppe.
(TM)
Die wohlhabende Familie Buddenbrook reist an Orte mit einem großen Erholungswert, an denen sich bürgerliche Kreise aus Lübeck aufhalten:
S. 129ff
Es war eine größere Gesellschaft, auf die Tony zuschritt,. - eine Gruppe, die vor dem Möllendorpfschen Pavillon lagerte und von den Familien Möllendorpf, Hagenström, Kistenmaker und Fritsche gebildet ward. Konsul Fritsche, ein ältere Herr mit glattrasiertem, distinguiertem Gesicht, beschäftigte sich droben im offenen Pavillon mit einem Fernrohr, das er auf einen in der Ferne sichtbaren Segler richtete.…
Tony Buddenbrook ward von den Hagenströms kalt, von der übrigen Gesellschaft mit großer Herzlichkeit empfange…
S. 665f
Herr Gosch war ebenfalls noch Kurgast, gleich einigen wenigen Leuten, einer englischen Familie, einer ledigen Holländeri…
Zwei oder drei Mal, an Nachmittagen, da es aussah, als ob die Sonne hervorkommen wollte, erschienen zurTable d’hôteein paar Bekannte aus der Stadt, die sich gern ein wenig unabhängig von ihren Angehörigen unterhielten: Senator Doktor Gieseke, Christian Schulkamerad, und Konsul Peter Döhlmann,…
Der Badebetrieb war so exklusiv, dass Adlige und Bürger getrennte Räume aufsuchten, während im Kurhaus unabhängig von Rang und Stand jeder Zutritt hatte.743
Gleichzeitig schätzte und respektierte man die Einheimischen in ihrer Ursprünglichkeit, „Natürlichkeit“ und Naturverbundenheit:
(TM)
S. 117f
„Oh! Diedrich Swattkopp, dat is’n ganz passablen ollen Kerl…
„Seine Frau kenne ich selbst nicht. Sie wird schon gemütlich sein.…
Lotsenkommandeur Schwarzkopf stand vor seiner Tür und nahm beim Herannahen der Kalesche die Schiffermütze a…
„Ist wahrhaftig eine Ehre für mich, Mamsell, alles, was recht ist, dass Sie eine zeitlang mit uns fürlieb nehmen wollen…
„Wissen Sie, hier wohnt man mindestens so gut, wie draußen im Kurhaus“, sage Tony eine Viertelstunde später, als man in der Veranda um den Kaffeetisch saß. „Was für prachtvolle Luft. Man riecht den Tang bis hierher. Ich bin entsetzlich froh, wieder in Travemünde zu sein…
Reisefreundschaften, wie die zwischen Tony Buddenbrook und Morten, hatten oft nur flüchtigen Charakter, obwohl sie in den Tagen des Reisens als „wahr“ und „echt“ angesehen wurden.
S. 143
„Ja, Morten. Ich halte große Stücke auf Sie. Ich habe sie sehr gern. Ich habe Sie lieber, als Alle, die ich kenne.…
Er fuhr auf, er machte ein paar Armbewegungen und wusste nicht, was er tun sollte. Er sprang auf die Füße, warf sich sofort wieder bei ihr nieder und rief mit einer Stimme, die stockte, wankte, sich überschlug und wieder tönend wurde vor Glü…
„Ach, ich danke Ihnen, ich danke Ihnen! Sehen Sie, nun bin ich so glücklich wie noch niemals in meinem Leben.!“ Dann fing er an, ihre Hände zu küsse…
„.Aber wollen sie mir versprechen, dass Sie diesen Nachmittag hier am Strande nicht vergessen werden, bis ich zurückkomme. und Doktor bin. und bei Ihrem Vater für uns bitten kann.?.“S. 158
„.Verlobte sich am 22. September 1845 mit Herrn Bendix Grünlich, Kaufmann zu Hamburg…
Das Vordringen der bürgerlichen Schichten veränderte in der Mitte des 19. Jahrhunderts Kurorte und -urlaube, denn sie verlebten, anders als bei den Adligen üblich, längere Urlaub mit der ganzen Familie und konzentrierten sich auf Strandaktivitäten. Eine mehrere Wochen dauernde Sommerreise ans Meer als Kur- und Badereise oder die sog. „Sommerfrische“ war für wohlhabende bürgerliche Familien obligatorisch und diente in nicht unerheblichem Maße der Selbstdarstellung. „Die Aufenthalte in den Badeorten waren nicht durch Urlaubsregelungen begrenzt, sondern Kennzeichen des Vermögens war gerade die lange Dauer.“744 (TM) S.629
Sommerferien an der See! Begriff wohl irgend Jemand weit und breit, was für Glück das bedeutet? Nach dem schwerflüssigen und sorgenvollen Einerlei unzähliger Schultage vier Wochen lang eine friedliche und kummerlose Abgeschiedenheit, erfüllt von Tanggeruch und dem Rauschen der sanften Brandung. Vier Woche…
Thomas Mann selber sah mit sieben Jahren zum ersten Mal das Meer der Lübecker Bucht, wo die Familie ab 1882 die Sommerferien verbrachte745 und von da an war er verliebt in das Meer, in das Schauen, das Nichtsstun, so wie Hanno, sein Alter Ego.
Während des Sommervergnügens beaufsichtigte ein Arzt Trinkkuren mit mineralhaltigem Wasser. Das Auf- und Abgehen auf der Kurpromenade und der Aufenthalt in der Natur und Landschaft dienten der gesundheitsfördernden Erholung. Besonders der Spaziergang galt bei einer Badekur als ein Mittel der Gesunderhaltung und der Geselligkeit und war damit als ein wichtiger Bestandteil des Badelebens.746 (TM) S. 135
Sie(Tony und Morten) gingen, das rhythmische Rauschen der langgestreckten Wellen neben sich, den frischen Salzwind im Gesicht, der frei und ohne Hindernis daherkommt, die Ohren umhüllt und einen angenehmen Schwindel, eine gedämpfte Betäubung hervorruft. Sie gingen in diesen weiten, still sausenden Frieden am Meere, derjedes kleine Geräusch, ob fern oder nah, zu geheimnisvoller Bedeutung erhebt.
S. 670
Hie und da besuchte Frau Permaneder ihren Bruder. Dann gingen die Beiden zum „Mövenstein“oder zum „Seetempel“, spaziere…
Man spannte die Regenschirme auf und trat unter dem Zeltdach hervor, um ein bisschen zu promeniere…
Stets begleiteten solch einen Aufenthalt Gespräche, der Austausch von Informationen, Meinungen und Kenntnissen, das Schließen von Bekanntschaften inbegriffen.
S. 133f
„Was nun?“ fragte der Lotsenkommandeur, wenn nach dem Mittagessen Tony und Morten gleichzeitig aufstanden und sich anschickten, auf und davon zu gehen. „Wohin mit den jungen Herrschaften…
„Ja, ich darf Fräulein Antonie ein bisschen zum Seetempel begleiten…
Morten war ein unterhaltender Begleite…
S. 668
Und immer in einem trägen, wegwerfenden und skeptisch fahrlässigen Ton, gleichgültig und schwer gesinnt vom Essen, vom Trinken und vom Regen, sprach man von Geschäften, den Geschäften jedes Einzelne…
Äußerst wichtig war die räumliche und damit auch mentale Distanz zur Heimat. Sie schuf eine Gegenwelt, jenseits des beruflichen und des sozialen Alltags, war Flucht aus dem Alltag und der Enge der Stadt, und insbesondere das Erleben des Nicht-Alltäglichen führte zur Regeneration.
Während Frauen die Kurbäder besuchten, war für den Mann die Erholung und Entlastung von der Arbeit und von deren Pflichten die wichtigste Funktion des Reisens. Der Beruf wurde für eine Weile ausgegrenzt, man war an einem Ort, der Ausgleich versprach, um danach wieder zu den Alltagspflichten zurückkehren zu können. „Zwischen den Polen der Arbeit und des Faulenzen etablierte sich Reisen mit seinem Erholungs- und Bildungsversprechen als respektable bürgerliche Freizeitbeschäftigung.“747
Allein die Abwesenheit von zu Hause, wo ganz andere Maßstäbe als im Urlaub galten, ermöglicht es, den heimischen Ansprüchen zu entkommen.
(TM)
Für Thomas Buddenbrook bedeutet der Aufenthalt am Meer der finale Rückzug vor finanziellen und sozialen Problemen und damit eine Erholung der Nerven:
S. 666
Ach, Doktor Langhals habe ihn der Nerven wegen hergeschickt, antwortete Thomas Buddenbroo…
Bürgerliche Frauen begnügten sich, entsprechend ihres Geschlechterrollenverständnisses mit dem Spaziergang auf der Promenade oder in der Natur, stets mit dem Ziel der Vorführung ihre Garderobe oder um die Familie zu repräsentieren. Eine vornehme Blässe musste auch im Urlaub durch das Tragen von üblicher Bekleidung und zusätzlichen Sonnenschirmen erhalten bleiben. Durch sie unterschied man sich von denen, die sonnengebräunt waren und im Freien arbeiten mussten.
(TM)
Während Tonys Aufenthalt bei Familie Schwarzkopf vergehen für sie auf diese Art die Tage:
S. 127f
Sie(Tony)hatte ihren großen Strohhut aufgesetzt und ihren Sonnenschirm aufgespannt, denn es herrschte, obgleich ein kleiner Seewind ging, heftige Hitz…
… Die Reihe der hölzernen Strandpavillons mit ihren kegelförmigen Dächern lag vor ihnen und ließ Durchblick auf die Strandkörbe frei, die näher am Wasser standen, und um die Familien im warmen Sande lagerten: Damen mit blauen Schutz-Pincenez ., gebräunte Kinder mit großen Strohhüten auf den Köpfe…
Es war eine größere Gesellschaft, … eine Gruppe, die vor dem Möllendorpfschen Pavillon lagert…
Peter Döhlmann, mit einem breitkrempigen Strohhut und rundgeschnittenen Schifferbart, stand plaudernd bei den Damen, die auf Plaids im Sande lagen oder auf kleinen Sesseln aus Segeltuch saße…
Nach der Errichtung eines einheitlichen Streckennetzes für die Kutschen wurde das Haus der Frau transportabel, bürgerliche Häuslichkeit, vom Sticken über die Kindererziehung bis hin zur geselligen Konversation, war nun auch unterwegs möglich.748 Mit der Kutsche bahnte sich das Interieur seinen Weg in die Öffentlichkeit.
Im Erholungsurlaub spielt damals wie heute die visuelle Wahrnehmung eine zentrale Rolle: Man wird auf Sehenswürdigkeiten in Kunst und Natur aufmerksam und wenn ein Blick auf ein Gebirge, Meer oder auf Witterungen die unberechenbare Naturgewalt zum Ausdruck bringen, ruft dies oftmals ein erhabenes Gefühl hervor.749 Neue Erfahrungen, die Begegnungen mit Menschen und der Natur brachten schon damals nicht nur Erholung und Distanz zum Alltagsleben, sondern führten auch zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit.
(TM)
Beispiele hierzu finden sich in Manns Roman zu Genüge:
Tony erweitert ihren sozialen und geistigen Horizont in einer nicht alltäglichen Gegend als sie Kontakt zu Morton findet, einem Mann jenseits der Standesschranken.
S. 139
Hierbei zog Morten aus einer Tasche seiner Joppe das Ende eines schmalen, buntgestreiften Bandes hervor und sah mit einem Gemisch von Erwartung und Triumph in Tonys Auge…
„Wie hübsch“, sagte sie verständnislos. „Was bedeutet das…
Morten aber sprach feierlic…
„Das bedeutet, dass ich in Göttingen einer Burschenschaftsverbindung angehöre - nun wissen Sie es. …
„Wir wollen die Freiheit!“ sagte Morte…
Die Empfindungen und Eindrücke bei der Betrachtung des Meeres stehen im Vordergrund und wirken exotisierend und verklärend (Tony), aber auch nervlich beruhigend (Thomas) und stärkend (Hanno):
S. 671
„Breite Wellen.“ sagte Thomas Buddenbrook. „Wie sie daherkommen und zerschellen, daherkommen und zerschellen, eine nach der anderen, endlos, zwecklos, öde und irr. Mehr und mehr habe ich die See lieben gelernt.. .Was für Menschen es wohl sind, die der Monotonie des Meeres den Vorzug geben? Mir scheint, es sind solche, die zu lange und tief in die Verwicklungen der innerlichen Dinge hineingesehen haben, um nicht wenigstens von der äußeren vor Allem Eins verlangen zu müssen: Einfachhei…
S. 633
Und doch war das Klügste stets, zur See zurückzukehren und noch im Zwielicht, das Gesicht dem offenen Horizonte zugewandt, auf der Spitze des Bollwerks zu sitzen, den großen Schiffen, die vorüberglitten, mit dem Taschentuch zuzuwinken und zu horchen, wie die kleinen Wellen mit leisem Plaudern wider die Stein bl öcke klatschten und die ganze Weite ringsum von diesem gelinden und großartigen Sausen erfüllt war, das dem kleinen Johann gütevoll zusprach und ihn beredete, in ungeheurer Zufriedenheit seine Augen zu schließen. … Welch ein beruhigtes, befriedigtes und in wohltätiger Ordnung arbeitendes Herz er immer mitnahm vom Meer…
Bedeutsam für die Entstehung dieser neuen Empfindung war auch hier Jean Jacques Rousseau, der französische Schriftsteller der Aufklärung. Er veränderte das Verständnis von Natur insofern, dass er sich für das Landleben begeisterte, die Unberührtheit und Schönheit des Elementaren in der Natur beschrieb, und betonte, wie sehr diese das natürliche Empfinden wecken und fördern könne.750
Durch ihn kehrte sich das Naturgefühl vom erschreckenden wilden und unkultiviertenbedrohenden Bild um zum kraftvollen ungezähmten Naturbild. Natur wurde romantisch verklärt und nicht mehr nur als Objekt des forscherischen Interesses betrachtet.
Beliebt war bei den Bürgern in der Sommerfrische das Einnehmen einer PanoramaPerspektive, einer „Aussicht“: Der Anblick des Meeres und der Küste als Symbol der ungezähmten Natur war eine Hauptattraktion - schon deshalb musste das Meer in Sichtweite der Hotels und Privathäuser sein.
(TM)
S. 133
Tony sonnte sich, sie badete, aß Bratwurst mit Pfeffernusssauce und machte weite Spaziergänge mit Morten: den Chausseeweg zum Nachbarort, den Strand entlang zu dem hoch gelegenen „Seetempel“, der eine weite Aussicht über See und Land beherrscht…
Naturerleben in der Schönheit und Frische der Natur suggerierten Schrankenlosigkeit in Bezug auf eine grenzenlose Gesellschaft.
(TM)
Die Spaziergänge Tonys am Meer mit Morten, der Gang am Meer und durch die Natur lässt den Charakter des Gegenüber entdecken. „Da öffnet sich die Seele, da werden im Gespräch tief verborgene Themen angeschnitten und Sehnsüchte offenbart.“751
S. 136f
Wir wollen Freiheit der Presse, der Gewerbe, des Handels. Wir wollen, dass alle Menschen ohne Vorrechte miteinander konkurrieren könne, und dass dem Verdienste seine Krone wird!…
Tony grenzt sich nicht von der unteren Schicht ab (Morten), was Befremden bei den Mitbürgern hervorruft. Der verliebte Spaziergang einer unverheirateten Frau in Zweisamkeit lässt die soziale Differenz vergessen, entsprach aber damals nicht der Norm weibliche Verhaltens, denn nur zu zweit mit dem Ehemann stand einer Frau ein Spaziergang im Badeort oder in der Sommerfrische zu.752 S. 132
„Wen grüßest du, Tony…
„Oh, das war der junge Schwarzkopf“, sagte Tony, „er hat mich herunterbegleitet…
„Der Sohn des Lotsenkommandeurs?“ fragte Julchen Hagenström und blickte mit ihren blanken schwarzen Augen scharf zu Morten hinübe…
Für das Leben in ländlichen und naturnahen Gegenden hegten insbesondere Städter große Sympathien, sahen es als ein Gegenbild zum Leben in der Stadt und idealisierten es: Man verband mit ihm Harmonie und Eintracht und betrachtete Landbewohner als die gesünderen und glücklicheren Menschen.753 Solch einen Traum vom Leben in der Natur ohne aufreibende Geschäfte wollte mancher Bürger wenigstens in den Ferien ausleben. Seeluft und Bergluft galten bereits damals, nach dem Ergebnis einer Luftgütemessung, als noch wesentlich reiner als Landluft und konnten aus medizinischer Sicht zur Gesundheit und Reinigung des Körpers beitragen754. Schon deshalb propagierten Ärzte, vor allem bei Lungenkrankheiten, den Nutzen der Seebäder und die Heilkraft der Meerluft.755 Das Meer wurde zur Erholungslandschaft, „deren Gewalt nicht mehr als direkte Bedrohung, sondern als reizvolle Kulisse wahrgenommen wurde“756 und die den Körper und den Geist der wohlhabenden Städter gesunden ließ.
S. 629
Dass aber Gerda, der kleine Johann und Fräulein Jungmann alljährlich für die Dauer der Sommerferien ins Kurhaus von Travemünde übersiedelten, war hauptsächlich Hannos Gesundheit wegen die Regel gebliebe…
Das Spazierengehen und langsame Wandern am Meer regten den Stoffwechsel an, beruhigte die Nerven und entschleunigte.
(TM)
Thomas Buddenbrook stellt dazu folgende persönliche Betrachtungen an: S. 671
Und doch wirkt es beruhigend und tröstlich, wie das Einfache und Notwendige. Mehr und mehr habe ich die See lieben gelern…
Ab dem 17. und 18. Jahrhundert fand das Baden im Meer Interesse, britische Ärzte verschrieben diese Betätigung als Therapie gegen viele Krankheiten, wie z.B. Hühneraugen und Krebs, die abführende Wirkung des Seewassers kam einem Kuraufenthalt gleich.757 Die puritanische und körperfeindliche Moral des protestantischen Bürgertums begrenzte jedoch das Baden und den Aufenthalt am Strand und der Spaziergang auf der Promenade hatte stets in vollständiger Straßenkleidung zu erfolgen. (TM)
Das Baden im Meer ist auch für Hanno ein besonderes Erlebnis:
S. 632
Das Baden dann, das hier eine erfreulichere Sache war als in Herrn Asmussens Anstalt, denn es gab hier kein „Gänsefutter“, das hellgrüne, kristallklare Wasser schäumte weithin, wenn man es aufrührte, statt eines schleimigen Bretterbodens schmeichelte der weich gewellte Sandboden den Sohlen…
Exkurs: Travemünde
Ein beliebtes Ferienziel deutscher Bürger war das Küstenbad Travemünde, ein kleines Seebad an der Ostsee. Familie Mann ging, ähnlich der Familie Buddenbrook, dort prestigeträchtig regelmäßig in die Sommerfrische, zum ersten Mal 1882. So wie Thomas Mann verbringen Hanno und seine Mutter die gesamten Sommerferien dort, um sich zu erholen:
S. 629
Seit manchem Jahr hatten Buddenbrooks sich der weiteren sommerlichen Reisen entwöhnt, die ehemals üblich gewesen waren. Dass aber Gerda, der kleine Johann und Fräulein Jungmann alljährlich für die Dauer der Sommerferien ins Kurhaus von Travemünde übersiedelten, war hauptsächlich Hannos Gesundheit wegen die Regel gebliebe…
Thomas Mann verweilt lange bei der Schilderung Travemündes, verband er doch Kindheitserinnerungen und glückliche Tage mit diesem Ort (s.o.) und viele der ihm bekannten historischen und geographischen Details finden in seinem Roman Erwähnung. Er liebte das Meer: „Immer wieder hatte er ihr (seiner Tochter Elisabeth) davon erzählt, von diesem großen Blau, der Weite, seinen Ferien in Travemünde, als er klein und glücklich war.“758 So entsteht ein anschauliches und plastisches Bild dieses Kurortes vor den Augen des Lesers.
S. 118
In einer Allee von jungen Buchen fuhren sie eine Strecke ganz dicht am Meere entlang, das blau und friedlich in der Sonne lag. Der runde, gelbe Leuchtturm tauchte auf, sie übersahen eine Weile Bucht und Bollwerk, die roten Dächer des Städtchens und den kleinen Hafen mit dem Segel- und Tauwerk der Boot…
Travemünde ist ein Beispiel dafür, wie sehr sich in einem ehemaligen Fischerdörfchen durch seine Entwicklung zum Kur- und Seebad die Bau- und Siedlungsstruktur veränderte. Die anfängliche Übernachtung in Fischerhütten von Seiten der Adligen und Bürger, verbunden mit einem einfachen Leben, wandelte sich in wenigen Jahren mit dem Bau von Hotels und Pensionen, von Baderäumen, Theatern und Bibliotheken zum exklusiven Kuraufenthalt.
(TM)
S. 118
Dann fuhren sie zwischen den ersten Häusern hindurch, ließen die Kirche zurück und rollten die „Vorderreihe“, die sich am Flusse hinzog, entlang bis zu einem hübschen kleinen Hause, dessen Veranda dicht mit Weinlaub bewachsen wa…
S. 122
In ihrem kleinen, reinlichen Zimmer, dessen Möbel mit hellgeblümtem Kattun überzogen waren, erwachte Tony am nächsten Morgen mit dem angeregten und freudigen Gefühl, mit dem man in einer neuen Lebenslage die Augen öffne…
Das nicht standesgemäße Übernachten Tonys bei den Schwarzkopfens wird als „allzu exklusiv“ und „originell“ betrachtet.
S. 131
„Und Sie wohnen…
„Bei Schwarzkopfs…
„Beim Lotsenkommandeur…
„Wie originell…
Zur Historie Travemündes:
Die Gründung des Städtchens ist mit dem Bau der gräflichen Burg 1187 gleichzusetzen. Durch die Niederlassung von Fischerfamilien dehnte sich der Stadtkern aus und hatte im 19. Jahrhundert knapp 1500 Einwohner, die abhängig waren von Lübecks Ämtern. Ihre Erwerbsquelle war die Seefischerei, der Heringsfang und die Zimmervermietung an Gäste.
Travemünde gehörte zum Staatsgebiet der Freien und Hansestadt Lübeck.
In privatwirtschaftlicher Initiative gründeten Lübecker Kaufleute, Beamte und Ärzte eine Aktiengesellschaft. So entstand 1802 die „Privat-Seebadeanstalt bey travemünde“, mit dem Ziel „die Summe körperlicher Leiden zu mindern, das allgemeine Menschenwohl dagegen zu vermehren.“ Mediziner und Kaufleute übten Kooperation, die einen fungierten als wissenschaftliche Berater, die anderen als Investoren.759 Ebenso wie Norderney und Heiligendamm übernahm man bei der Eröffnung der ersten Seebadeanstalten die britischen „Seaside resorts“ zum Vorbild. Als die Badeanstalt in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts in finanzielle Schwierigkeiten geriet, sicherten wiederum Privatleute ihren weiteren Bestand.
Reisende kamen auf dem Landweg in Sechssitzern mit Pferden in den Kurort, Abfahrtsstelle war die Bischofsherberge „Großherzog von Mecklenburg“ in der Großen Burgstraße in Lübeck. Vom Jahre 1839 an erhob man wegen der hohen Kosten und der Arbeit beim Bau der Landstraßen Wegezoll; die zwei- bis dreistündige Reise mit der Kutsche von Lübeck nach Travemünde kostete Chausseegeld und ein Fährgeld über die Trave.
(TM)
S. 114
Nach Travemünde geht es immer geradeaus, mit der Fähre übers Wasser und dann wieder geradeaus, der Weg war beiden wohlbekannt. Die graue Chaussee glitt flink unter den hohl und taktmäßig aufschlagenden Hufen von Lebrecht Krögers dicken Braunen aus Mecklenburg dahin. Man hatte ausnahmsweise um 1 Uhr zu Mittag gegessen, und die Geschwister waren Punkt 2 Uhr abgefahren, so würden sie kurz nach 4 Uhr anlangen, denn wenn eine Droschke drei Stunden gebraucht, so hatte der Krögersche Jochen Ehrgeiz genug, den Weg in zweien zu mache…
Vorbei an wunderschöner Natur führte die Fahrt zur Station der Herrenfähre, die die Feriengäste ans andere Ufer setzte. Auf dem anschließenden Ivndorfer Hügel konnte man den Blick über die Siechenbucht zum Travemünder Hafen bis zum Leuchtturm an der Travemündung genießen.
(TM)
S. 118
Der runde, gelbe Leuchtturm tauchte auf, sie übersahen eine Weile Bucht und Bollwerk, die roten Dächer des Städtchen…
Zu Zeiten der Buddenbrooks bestand Travemünde aus der
- Torstraße, die vom Stadttor zur Kirche führte. In ihr wohnten die Arbeitsleute und Fischer in kleinen niedrigen Häusern, und in ihnen quartierten sich nur die Badegäste ein, die das lebhafte Kurleben meiden wollten - dort verbringt Tony Buddenbrook in einer Pension mit Familienanschluss und Sozialbeziehung ihre „Sommerfrische“ in einer ländlich-heilen Welt;
- der Vorderreihe, sie galt als vornehm, in ihr standen die schönsten Gasthäuser. Man verschönte sie ab 1802 durch Lindenbäume und errichtete die Seebadeanstalt. Eine Allee lud zum Lustwandeln vom Lotsenberg bis zum Speise- und Logierhaus ein;
- der Hinterreihe, sie diente den Gewerbetreibenden, Handwerkern und Kleinbauern. In ihr wurden die Fuhrwerke und Gespanne der Reisenden untergebracht.
Weiterhin gab es am Ziegelberg das Kurhaus, als Gesellschafts- und Speisehaus gebaut und von zwei kleinen Gesellschaftsräumen flankiert. Dort tafelte man im Speisesaal zu den Klängen eines Orchesters und hatte von der Terrasse einen freien Blick auf die See. Neben dem Speisehaus entstand ein „Chinesischer Pavillon“, die spätere Spielbank. Hinzu kamen für die Badegäste das Warmbadehaus am Strand, Badekarren und ein „Schweizerhaus“ im alpenländischen Stil, das mit einem Musiktempel für Abwechslung bei den Gästen sorgte.
Bis weit über die Mitte des 19. Jahrhunderts logierten Lübecker und Hamburger Stadtaristokraten im Kurhotel und trafen sich im eleganten Speisehaus oder im Chinesischen Pavillon oder der Conditorei im Kurgarten, um auf den Kieswegen entlang der Rosenrabatten zu spazieren.
(TM)
S. 127
Sie gingen die „Vorderreihe“ entlang und spazierten durch den Kurgarten, der stumm und schattenlos mit seinen Kieswegen und Rosenanlagen dalag. Der Musiktempel zwischen Nadelbäumen versteckt, stand schweigend dem Kurhaus, der Konditorei und den beiden, durch ein langes Zwischengebäude miteinander verbundenen Schweizerhäusern gegenübe…
In den 20er Jahren wurde der Kurort durch die Gründung der Spielbank 1825 immer mehr zum Sommerdomizil für Adel und Großbürgertum. Er zog reiche russische Aristokraten und Geschäftsleute an, und während bei Tag die Badeanstalt großen Zuspruch fand und man die heilende Kraft des Meeres genoss, war es nachts das Glücksspiel, dem mancher erlag.
(TM)
S. 132
Dann speiste man an derTable d’hôte,trank bei der Kurmusik den Kaffee unter dem Zeltdach der Konditorei und sah drinnen im Saal der Roulette zu, um die lustige Leute, sich drängte…
Erwähnenswert wäre noch zwischen Kurzentrum und Badestrand die „Sahara“ Travemündes, das Leuchtenfeld, genannt nach dem Leuchtturm, eine schattenlose weite Fläche.
(TM)
S.127
Die Beiden gingen über den Kinderspielplatz mit den Bänken und der Schaukel; sie gingen nahe am Warmbadehause vorbei und wanderten langsam über das Leuchtenfel…
Tony und Hanno haben bei ihren Strandspaziergängen ein Ziel: den ,Seetempel’. S. 135
Der Seetempel, ein runder Pavillon, war aus rohen Borkenstämmen und Brettern erbaut, deren Innenseiten mit Inschriften, Initialen, Herzen, Gedichten bedeckt waren. Tony und Morten setzten sich in eine der kleinen abgeteilten Kammern, die der See zugewandt waren und in denen es nach Holz roch…
Die Trave war zunächst der Transportweg für die Schifffahrt. Seit sich in Lübeck Kaufleute niedergelassen hatten, waren Arbeitsleute zum Beladen und Löschen der Schiffe und als Träger zum Abliefern der Waren gefragt und obwohl Signalstangen ab 1814 den einzuschlagenden Kurs in die Hafeneinfahrt wiesen, waren Lotsen von großer Bedeutung. Dies waren Fischer, die sich auskannten und Erfahrungen hatten mit den Begebenheiten von Trave und Hafen und sich nun ein Zubrot verdienten, indem sie ankommenden Schiffen bei Tag und bei Nacht entgegenfuhren. „Das Lotsenwesen in Travemünde zeigte den sich nähernden Schiffen durch Zeichen am Signalturm den Wasserstand und die Strömungsverhältnisse auf der Trave an, um so die Einfahrt in den Hafen zu erleichtern.“760
Seit 1829 herrschte für größere Schiffe die Lotsenpflicht, alle ein- und ausfahrenden Schiffe wurden mit einem Eintrag ins Schiffsregister erfasst, während gleichzeitig in einem Lotsenzimmer mit Blick auf die See im Leuchtturm ein Lotse wachte. In der Hierarchie befehligte ein Lotsenkommandeur die Oberlotsen und Lotsen. Konnten Lotsen wegen gefährlicher See und Wind nicht ausfahren, entstanden für die Segler Probleme. Wie bedeutsam Lotsen waren, zeigt deren Übernahme ins Beamtenverhältnis 1876.
(TM)
S. 117
„Oh! Diedrich Swattkopp, dat is’n ganz passablen ollen Kerl. Sein Vater ist auf einem Norwegenfahrer geboren und nachher Kapitän auf dieser Linie gewesen. Diedrich hat einen guten Bildungsgang gemacht; die Lotsenkommandantur ist eine verantwortliche und ziemlich gut bezahlte Stellun…
Doch nicht nur als Transportweg, sondern auch für Dampferfahrten der Lübecker Bürger erfreute sich die Trave im 19. Jahrhundert großer Beliebtheit.
16.3 Reisen in Zeiten des Massentourismus- eine Form der kulturellen Begegnung
Der Umbruch in der Entwicklung des Reisens und damit der Anfang der modernen Reisekultur begann durch die Einführung regelmäßiger Postkutschenrouten. Die damit verbundenen abgestuften Tarife veränderten die soziale Zusammensetzung der Reisenden - es begann der preiswerte Massentransport und ein ebensolches Reisen.
Während Travemünde noch im 19. Jahrhundert das Ferienziel der Bürger war und bis ins 20. Jahrhundert touristische Reisetätigkeit generell als ein sozio-ökonomisches und kulturelles Privileg des Bürgertums gesehen werden kann, das sich durch Exklusivität gegenüber anderen abgrenzte, öffnete um 1900 die Industriealisierung das Reisen auch für klein- und unterbürgerliche Schichten. Körperliche und geistige Erholung im Zusammenhang mit Reisen gewannen von nun an für einen Großteil der Bevölkerung an Bedeutung.
Mit der Industriealisierung wandelte sich das Verkehrswesen und eröffnete mit Hilfe der Transportmittel für die industriellen und agrarischen Produkte die Möglichkeit einer Teilhabe am Fremdenverkehr: Eisenbahn bzw. Fernbahn verringerten die Fahrzeit und ihre Pünktlichkeit, Sicherheit und Bequemlichkeit ließen im Verlauf des 19. Jahrhunderts einen moderne Tourismus entstehen, der die Kavalierstour des Adels und die Gelehrtenreise endgültig beseitigte.
Als dann die Firma Benz&Co in Mannheim das Automobil entwickelte, das 1888 zum ersten Mal ausgefahren wurde, war eine weitere neue Form des Reisens geboren.
(AG)
Richard und Alma lernten sich Anfang des 20. Jahrhunderts als Studenten auf einer Wanderreise in Österreich kennen, in späteren Jahren ist der Urlaub für sie unbedeutend, da Richards politische Arbeit Vorrang hat (S. 201:Er hat für die Arbeit gelebt, Wochen ohne Sonn- und Feiertag…
S. 348ff
Ich weiß noch genau, wie wir uns kennengelernt haben, da waren wir noch ein bisschen jünger als heute, so jung wie das Jahrhundert damals, das war, als wir mit der akademischen Gruppe des Alpenvereins auf die Rax gefahren und den Danielsteig hinaufgegangen sind, du mit deinem Wanderzeichen am Revers … schau dir dieses sonnenbeschienen Kar an, die Latschen, die Felsabbrüche und dass ich all das genießen kann und meine Kraft im Klettern spüre … Das war im Jahr 1929, erinnerst du dic…
Das Reisen im Alter sieht Alma kritisch und lehnt es ab:
… wir hätten auch später mehr wegfahren sollen, aber jetzt ist es vorbei, ich will selber nicht mehr, denn wenn ich weg bin, denke ich den ganzen Tag an zu Hause, dort ist es halt doch am schönsten, von Schlafen als Gast kann eh nicht die Rede sein, arbeiten kann man nichts und Konversation machen, das weißt du, ist ebenfalls nicht meine Stärke, mit der fremden Verpflegu…
Das Reisen auf der Basis der faschistischen Werte, inhaltlich gestaltet von der Nationalsozialistische Gemeinschaft „Kraft durch Freude“, das erlebt Ingrid 1943/1944 während einer Klassenfahrt, die in ein Wirtshaus mit dem Namen ,Schwarzindien‘ führt und bei der eine Bemerkung von ihr bzgl. der Essensausgabe die Autorität der Lehrerin untergraben hat und Konsequenzen zur Folge hatte: S. 204f
Mädel vom Dienst im sommerlichen Schwarzindien, Fahnendienst im stürmischen Schwarzindien Küchendienst, Tagraumdienst, Stubendienst … Er hat die Einteilungsliste gesehen, als er Ingrid besuchte, im Zuge von Ingrids Degradierung zum langfristigen Klosettdienst. … Bei der Essensausgabe hatte sie beanstandet, dass die Lehrerin ein Stück mehr auf dem Teller hat als sie. Der Aufruhr, den diese Bemerkung nach sich zog, war trotz Kriegslärm bis nach Wien zu höre…
Der Massentourismus, wie wir ihn heute kennen, in dem Millionen von Touristen jenseits des Alltags eine Gegenwelt mit Bildung, Freiheit, Erholung und Abenteuer suchen, entwickelte sich in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Von da an war es auch für klein- und für unterbürgerliche Schichten wirtschaftlich möglich, in die Ferien zu fahren. Zu dem vermehrten Aufkommen von Vergnügungsreisen und Erholungsreisen trugen die internationalen Beziehungen der Länder und die neuen Verkehrsmittel bei. Der Tourismus demokratisierte sich und wurde von einer Sache der Besitzenden und des Bürgertums zu einer Sache der Allgemeinheit. „Die Etablierung des Massentourismus kann.als Teil dieses Verallgemeinerungsprozesses bürgerlicher Sozialpraktiken interpretiert werden.“761 (AG)
Familie Erlach verbringt noch zu Lebzeiten Ingrids ihren Familienurlaub in Venedig: S. 300
Sie hatten gerade einen Urlaub in Venedig hinter sich, dort fanden sie ohne Schwierigkeiten zu Fuß auf die Piazza San Marco, weil sie als Markierung die von Millionen Händen glattpolierten Straßenecken und Brückengeländer verwendet hatten. Ingrids Ide…
Es entstand eine Freizeitgesellschaft mit einem Rückgang der jährlich geleisteten Arbeitsstunden, einem Anstiegs der arbeitsfreien Zeit und dem garantierten Anspruch auf Urlaub für alle Beschäftigungsgruppen. Durch die Motorisierung und die erworbenen ökonomischen Ressourcen in unserer Konsumgesellschaft entwickelte sich ein höherer Lebensstandard, der seitdem einen Zugang zum Tourismus allen Schichten ermöglicht. Heute sind es der Preis und die Entfernung des Reiseziels, die eine Exklusivität herstellen.
Auch wenn Motive und Anlässe des Reisens unterschiedlich sind, ist die Wertschätzung des Reisens als Bildungsinstrument und als Kulturgut neben dem Aspekt der Erholung heute noch zu erkennen. Enzensberger spricht in diesem Zusammenhang von einem Fluchtmotiv: „Je mehr sich die bürgerliche Gesellschaft schloss, desto angestrengter versuchte der Bürger, ihr als Tourist zu entkommen.“762
Die Reisen der Protagonisten in den modernen Familien-Romanen bedeuten jeweils eine Überschreitung der Grenzen der eigenen Lebenswelt, mit verschiedenen Dimensionen von Kulturkontakten, unterschiedlich in Perspektiven, Wahrnehmungen, Erfahrungen und Begegnungen.
(AG)
Peters Familienreise 1978 ist ein Beispiel, wie sehr Beschäftigungsverhältnisse mit verbindlicher Urlaubsregelung im späten 20. Jahrhundert zu einer „touristischen Explosion“ führen und wie sehr sich die sozialen Markierungen verwischen, während Reiseströme die Welt durchdringen. Der Massentourismus hob die Exklusivität auf. „Die Menschen fliehen aus der Masse und landen in der Masse“. 763 Die Urlaubsziele liegen im Ausland und machen den Wunsch nach einer Distanzierung zum Gewohnten sichtbar.
S. 286
- Was uns an der Adria alles Schönes erwartet, sagt e…
- Ich wüsste nicht was, …
- Sonne und Meer, sagt Pete…
Sie befinden sich auf der Fahrt nach Jugoslawien, wo sie auch den großen Urlaub des letzten Jahres verbracht haben. Diesmal wollen sie campen, weil sich die Hotels im letzten Jahr teilweise in einem Zustand präsentierten, dass nicht einmal Peter je zuvor etwas ähnlich Trostloses vor Augen gekommen is…
Statt mit Entspannung und Erholung beginnt jedoch der Urlaub mit beschwerlichen und ungesunden Reisewegen und der überfüllten Autobahn, denn viele Urlauber brechen, so wie Peter Erlach, in den Monaten Juni, Juli und August, in den Sommerferien, zu ihrer Reise auf.
(AG)
S. 293
Bislang will keine Ferienstimmung aufkommen. Dabei ist die Erleichterung darüber, wie die Zeugnisse ausgefallen sind, bei allen groß …
Die Staus spiegeln die Massenhaftigkeit des touristischen Verhaltens in der heutigen Zeit wider:
S. 320f
- Sollte in den nächsten Minuten etwas weitergehen und ich bin nicht hier, dann schiebt doch den Wagen einfach nach vorne. …
… nochmals die reglose Kolonne der wartenden Fahrzeug…
- Eine Stunde Warten, sagt die Jugoslawin mit einem verlegenen Lachen. Eine kräftige, lachende junge Frau in Jeans und Bluse und mit einem sympathischen Mondgesich…
Der Mann in ihrer Begleitung, nackt bis zum Gürtel in der offenen Fahrertür kugelt zweimal seine Schultern und sag…
- Nix sehr schlimm. Geht vorwärt…
Peter nutzt die Reise, um Abstand von der Arbeit zu bekommen und die Beziehungen zu den Kindern zu intensivieren. Die Abkehr vom Alltag gelingt ihm nicht so einfach, da er zu Reisebeginn die alltägliche Arbeit mit in den Urlaub nimmt und verkehrsplanerisch tätig ist. S. 305
In Graz hinter dem Hauptbahnhof verlässt Peter die Durchfahrung. Er hält sich nicht Richtung Knoten Süd, wo ein neues Stück Autobahn ansetzt, sondern manövriert den Wagen südöstlich Richtung Stadtrand, wo er - kleine Fleißaufgabe - eine Kreuzung begutachten will, auf der sich Anfang der Woche ein tödlicher Unfall ereignet hat. …
- Muss das sein? fragen die Kinder unison…
- Es wird nicht lange dauer…
Die Kinder Sissi und Philipp suchen das Neue, Unvorhersehbare und Außergewöhnliche im Urlaub. Sissi findet es als Erwachsene in Amerika, auch heute noch ein bedeutendes Reise- und Auswanderungsziel.
S. 286
- Wir würden besser nach New York fahren, sagt Sissi …
S. 353
Sissi hat sich vor etlichen Jahren blicken lassen und Fragen über ihre Mutter gestellt auf der Suche nach ihren Wurzeln, damit sie sich in New York wohler fühlt ..was sie nur solange in New York macht mit der halben Erdkugel zwischen sich und Wien, sie ist in New York …
Phillip will sich als aktiver und selbständiger Mensch bewähren und den Rollen-und Zeitzwängen des Alltags entfliehen. Er versucht zu den Arbeitern, die ihm ein Stück Fremde und Neues ins Haus bringen, ein Verhältnis aufzubauen. Von seiner Seite aus ist die Beziehung von Annäherung, Verständigung, Vertrautheit und Ebenbürtigkeit geprägt - von Seiten der Fremden ist es zunächst Verachtung, Distanzierung und Gleichgültigkeit, seiner Bitte aber, ihn mit auf die Osteuropareise zu nehmen, stimmen sie zu:
S. 386f
- Nehmt ihr mich mit? Wenn ihr übermorgen fahrt? fragt Philipp im vagen Gefühl, dass die Gelegenheit jetzt, bei allem Stolz und bei aller Scham, die er empfindet, halbwegs erträglich ist. …
- Heißt das j…
- J…
Er würde mitfahren können, wahrhaftig. Und obwohl er sich aufdrängen musste, um diese Gunst zu erringen, freut er sich oder ist zumindest froh, sei’s, weil er statt Gehilfen Gefährten haben, sei’s, weil er für einige Tage dazugehören wird, was er schon seit einiger Zeit nicht mehr empfunden ha…
Philipps Passivität schlägt in glücklichen Aktivismus um, versinnbildlicht im Ritt auf dem Dachfirst, eine Anlehnung an das Buch des „grünen Heinrich“, indem der Protagonist in die Welt hinaus zieht.
Philipps Reise ist für ihn quasi seine „Unabhängigkeitserklärung“:
Wie in früheren Entwicklungsromanen des 18. Jahrhundert, in denen der Held die Familie verlässt, um seine Individualität außerhalb der Ausgangsfamilie zu finden, probiert er nun neue Entwürfe abseits der eigenen Familie aus. Die bewusste und befreiende Abkehr von der Wertewelt seiner Vorfahren durch die Flucht/Abreise zeigt seine Unfähigkeit und seinen Unwillen, ein Leben wie sie zu führen. Er sucht Mobilität und stellt den Stammsitz im Sinne eines dauerhaften Wohnorts in Frage, der umfangreiche Besitzstand wird für ihn zur hemmenden Last.
S. 389f
Gleich wird Philipp auf dem Giebel seines Großelternhauses in die Welt hinausreiten … Er wird reisen mit seinen Gefährten, für die er ein Fremder ist und bleibt, gleich geht es dahin auf den wenig stabilen Straßen der ukrainischen Südsee, gleich geht es dahin durch Moraste und über Abgründ…
Das Motiv der Suche oder der „Zeitkapseln“, d.h. der Orte, (Memoiren, Fotos,) die der Schriftsteller auf der Suche nach biographischen Spuren aufsucht, ist ein typisches Stilmittel der Romans von Ruge und Geiger und eine „metonymische Repräsentationen von Zeitlichkeit und Geschichte, in denen das Thema des Epochenbruchs mitreflektiert wird.“764 (ER)
Nadjeshda Iwanownas Sehnsuchtsziel ist Russland, es versinnbildlicht ihre Heimat, in einer kindlich-überhöhten Sicht, die die Armut und den fehlenden Komfort ausblendet: S. 139
In Slawa wurden jetzt die Kartoffeln gemacht, die ersten Feuer rauchten schon, das Kartoffelkraut brannte, und wenn erst mal das Kartoffelkraut brannte, dann war sie gekommen, unwiderruflich, die Zeit des abnehmenden Licht…
S. 158
Ein eigenes Haus hatte sie gehabt, eine eigene Wirtschaft, am Ende sogar eine Kuh, eine grauweiß gescheckte.Ja, Es war alles ganz einfach. Sie würde nach Slawa fahren, zu Ninas Geburtstag, das Visum hatte sie ja..Und dann würde sie sterben, ganz einfach. Dort in der Heimat würde sie sterben, dort wollte sie begraben sein, wie denn anders, ein Glück, dachte si…
Wie sehr jede Reise integriert ist in die Biographie des Reisenden und in die individuelle historische Lebenswelt und sich in ihrer Bedeutung unterscheidet, zeigt Eugen Ruges Roman.765 Bei ihm beweist sich, dass es gefährlich ist, nach vielen Jahren alten Erinnerungen nachspüren zu wollen.
Ruges Alter Ego Alexander fasst nach der Begegnung mit seinem dementen Vater und nach seiner eigenen Krankheit den Entschluss, der Geschichte der Großeltern auf die Spur zu kommen und eine Reise nach Mexiko zu unternehmen.
S. 104
Auf den Spuren der Om…
In diesem Land lebte seine Großmutter im Exil während des Zweiten Weltkriegs, bevor sie zurück nach Deutschland kam, um sich am Aufbau der DDR zu beteiligen. Der Enkel Sascha hatte zu ihr eine starke emotionale Bindung.
Der Mexikoaufenthalt der Großeltern wird dem Familiengedächtnis anvertraut. Als Erlebnisgeneration waren sie unmittelbar von dem Erlebten geprägt und in ihrer historischen Perspektive beschränkt.766 Als sie später, eingebunden in die Familie, täglichen Kontakt zu ihrem Enkel hatten, war ihr Einfluss auf ihn so groß, dass er die Generation seiner Eltern bei der Vergegenwärtigung des Familiengedächnisses übergeht, sonst wäre er nach Russland, dem Heimatland seiner Mutter, gereist und nicht nach Mexiko.
Zur eigentlichen Auseinandersetzung mit der Geschichte seiner Familie kommt Sascha bzw. Eugen Ruge durch seine schwere Krankheit. Er begibt sich kurz nach dem 911- Attentat von New York auf die Reise, um ein lebbares Verhältnis zu seiner Krankheit, zu sich und seiner Welt zu finden. Alexander ist an Erinnerungen interessiert, er geht mit Dokumenten, Brief und Geld auf die Suche nach seinen Wurzeln.
Es ist eine sentimentale Reise, die viele intensive Gefühle provoziert, eine Reise, die der Familiengeschichte auf die Spur kommen will. Es ist eine Suche nach der historischen Wahrheit der großmütterlichen Erzählungen und das an Ort und Stelle, denn hier lässt sich familiale Vergangenheit direkt erleben, stets mit einem bewussten Zugriff zu den Erlebnissen seiner Großeltern und der Erwartung, unbewusste Erbschaften aus sich hervorzuholen.
S. 107f
Wie empfindet man die einstmalige Anwesenheit einer Großmutte…
Das Einzige, was er empfindet: dass seine Fußsohlen schmerzen. Sein Rücke…
… Allee der Aufständischen. Eine Alltagsstraße, normaler, dreckiger als das Zentrum, aber auch nicht das, was er sich unter Mexico City vorgestellt ha…
S. 239
Dann steht er vor der Sonnenpyramide, ziemlich genau an dem Punkt, wo seine Großmutter vor sechzig Jahren gestanden haben muss, und fragt sich, was er eigentlich erwartet hat. Ist er tatsächlich so dumm gewesen, zu hoffen, dort oben, ganz auf dem Gipfel, wäre es lee…
Der Hutkauf am ersten Abend in der Stadt will als eine zeichenhafte Handlung seinem Leben eine andere Richtung geben und ihn aus der „krankmachenden Welt“ befreien.
S. 100
Alexander kauft einen Hut. Er hat, weiß er, schon immer einen Hut kaufen wollen. Jetzt gibt es Argumente dafür Jetzt könnte er sagen: In Mexiko braucht man einen Hut - wegen der Sonne. Aber er sagt es nicht. Er kauft den Hut, weil er sich mit Hut gefällt. Er kauft den Hut, um gegen die Ihm anerzogenen Prinzipien zu verstoßen …
Die Reise soll der Selbstvergewisserung und Bestätigung seiner Familienidentität dienen. Er flüchtet aus dem Alltag mit seinen Handlungsroutinen und seiner Einengung und sucht Distanz in fremden Landschaften, Stadtvierteln und bei unbekannten Menschen.
In Mexiko lebt er in der Phantasie und in der Realität, und indem er die Zusammenhänge zwischen persönlicher Identität und der familialen Geschichte erkundet, versucht er sich innerhalb der Familienkontinuität selbst zu finden und seine eigenen Beziehungen zum Heutigen zu entdecken. Die großmütterlichen Erinnerungen sind zu einem Teil seines Ichs geworden, sind geerbte Familienerinnerungen, die er nun in seine Wirklichkeit der Gegenwart integriert und das selbst Erlebte mit dem geschichtlich Erlebten verwebt.
Die Reise ist eine Identitätssuche und ähnelt im gewissen Sinne einer bürgerlichen Bildungsreise, einer Reise zum Volk und zur Begegnung mit ihm. Motiv und Anlass prägen die Verschriftlichung von Alexanders Reiseerfahrung. Er erzählt in poetischer Weise von den Erlebnissen und Eindrücken des bereisten Landes, von Kontakten mit Reisenden und deren Charakteren. Wie sehr aber die Vorkenntnisse und die Vorstellung von dem jeweiligen Land die Wirklichkeitserfahrung und -erschließung und ebenso die Rezeption und Wahrnehmung der besuchten Orte beeinflussen, zeigt diese Reise.
1959 hat Charlotte dem jungen Alexander ein spannendes, interessantes Bild von Mexiko in ihren Erzählungen vermittelt, begleitet von stimmungsvoller mexikanischer Musik (mexico lindo)
S.83 ff
Dann kam Musik. Goldene Gräte, und Omi begann zu erzählen. Sie erzählt von ihren Reisen; von tagelangen Reittouren; von Fahrten im Kanu; von Piranhas. und vom Urwald, der so dicht war, dass man sich mit einer Machete einen Weg hineinschlagen musste. Heute erzählte Omi von den Azteken. Das letzte mal hatte sie erzählt, wie die Azteken durch die Wüste gewandet waren. Heute fanden sie eine verlassene Stad…
Wie realpräsent diese Erinnerungen an Charlotte und an seine Kindheit sind, erlebt er im pulsierenden Leben auf der Straße in Mexico, wo er sich von einer mexikanischen Band das Lied „México lindo“ spielen lässt. Er ist tief gerührt und fängt an zu weinen.
S. 102
Das Lied ist zu Ende. Er merkt, dass ihm Tränen über die Wangen laufen. Die Musiker lachen. Der Sänger fragt ihn: -American…
-Alemán,sagt Alexander leis…
Eine anstrengende Busfahrt nach Vera Cruz und zu dem Hafen, in dem Charlotte und Wilhelm aus Marseille bzw. Nordafrika kommend, Mexiko erreichten, erinnert ihn besonders stark an die Erzählungen seiner Großmutter. Mexiko hatte für Charlotte, so reflektiert Alexander, die letzte Hoffnung bedeutet:
S. 312
So etwa - abgesehen von dem vielstöckigen Neubau direkt am Kai - muss sie sich den aus Europa Ankommenden dargeboten haben. So haben sie möglicherweise Nacht für Nacht vom Schiffsdeck aus in die Tiefe der Hafenpromenade geschaut, hinein in ein Land, das für viele die letzte Hoffnung bedeutet…
Emotion und Gegenwart treffen auf die Erinnerung der Großeltern. Doch das Land Mexiko, von dem seine Großmutter Charlotte erzählte, entspricht nicht mehr der damaligen Zeit. (S. 103,111)
Letztendlich empfindet er Mexiko nicht als ein schönes, sondern als ein absurdes, trauriges, überfülltes Land.
S. 99
Taxifahrt. Der Fahrer fährt wie eine gesengte Sau, schief auf seinem Sitz hängend, halb aus dem offenen Fenster gelehnt. Alexander lehnt sich zurück. Der Wagen rast über mehrspurige Avenidas, der Fahrer reißt das Steuer herum, fährt mit singenden Reifen im Kreis, irgendwie falsch herum, rast durch Nadelöhre, der Verkehr draußen brüll…
S. 105
Dann also Mexico City beiTag. Immer hat er sich die Stadt bunt vorgestellt. Aber das sogenannte historische Zentrum ist grau. Es sieht kaum anders aus als irgendeine südspanische Großstadt, abgesehen davon, dass die Häuser schief stehe…
Er erkennt, dass sein vorschnelles Glücksgefühl eine Täuschung und Selbstbetrug ist - und Mexiko eine Lebenslüge seiner Großeltern ist.
Als er beim ehemaligen Wohnhaus seiner Großeltern angelangt, empfindet er keinerlei Gefühl:
S. 108
Drei Kilometer weiter biegt Alexander links ab, dann nochmal links und rechts, dann ist er am Ziel: Die Tapachula. Eine schmale, baumlose Straße. Anstelle von Bäumen: Straßenlaternen und Masten, zwischen denen sich ein spinnenartiges Netz von Kabeln ausbreitet. Nummer 56 A: ein kaum vier Meter breites, zweistöckiges haus, er erkennt die Zinnen der Dachgartenbrüstung, von dort oben hat seine Großmutter heruntergeschaut, aber auf dem Foto, obwohl es schwarz-weiß war, hat alles irgendwie grün ausgesehen. Irgendwie tropisch und großzügig. … Er klingelt, niemand macht auf. Er wechselt die Straßenseite, betrachtet das Haus. Versucht, etwas zu empfinden. Wie empfindet man die einstmalige Anwesenheit einer Großmutte…
Das einzige, was er empfindet: dass seine Fußsohlen schmerze…
Von der Beobachterposition aus betrachtet er die Veränderungen. Er vermittelt den Eindruck, als sei alles mehr oder weniger unerheblich.
S. 111
Was hat er sich vorgestellt, um Himmels willen? Hat er wirklich geglaubt, jemand habe auf ihn gewartet?.Hat er wirklich gehofft, dieses Land würde ihn - ja, was eigentlich: heilen? Jaja, so etwas Ähnliche…
Ihm fällt es schwer, sich die fremde Welt und ihre Mentalität anzueignen. Das Fremde steht dem Eigenen gegenüber, Kultursysteme prallen bei ihm zusammen. Sascha bleibt seiner Ausgangskultur verhaftet und macht unmittelbar sinnlich-physisch eine Fremdheitserfahrung.
Als jemand ihm unaufgefordert die Schuhe putzt und eine Bezahlung erwartet, versteht niemand von den Mexikanern seine Reaktion. Die Kommunikationen scheitert aus sprachlichen Gründen:
S. 113f
- I have no money, schreit e…
Die Schmeißfliege weicht verblüfft zurüc…
-1 have no money, schreit Alexander noch einmal. I have no money! Und dann fällt es ihm sogar auf Spanisch ei…
- No tengo dinero, schreit e…
Hebt die Hände und schrei…
- No tengo diner…
S. 112
Den Hut haben sie ihm geklaut, die Hosen haben sie ihm geklaut. Gerade klaut ihm jemand seine tschechischen Wanderschuhe, die er schon seit Jahren, und zwar noch immer mit denselben Schnürsenkeln, träg…
- Was machst du denn d…
Allmählich kapiert er, dass der Mann, der da vor ihm kniet und sich an seinem rechten Schuh zu schaffen macht, ein Schuhputzer is…
Solche Erlebnisse reflektiert Sascha skeptisch-abwertend mit kritischen Kommentaren. Seine Erfahrungen entwickeln sich zur Ideologisierung und zu Stereotypen, besitzen zwar einen wahren Kern, spiegeln aber in der Regel das Gefühl der intellektuellen und moralischen Überlegenheit wider, und „fördern eher die Entwicklung feindlicher Gefühle“.767
S. 307ff
Die Fahrt soll sechs Stunden dauern. Schon nach einer Stunde hat sich Alexanders Ärger über die Lärmbelästigung zu einem veritablen Hass ausgewachsen: vor allem auf den Busfahrer, den er für zuständig hält, aber auch auf die Mitreisenden, die den Film vollständig ignorieren und ihre Gespräche in doppelter Lautstärke fortsetzen, wenn sie nicht gerade, halb beifällig, halb verschlafen mit dem Kopf wackelnd, auf den Bildschirm starren oder, unglaublich, sogar schlafe…
(.. oder besteht das Erstklassige gerade in dieser rücksichtslosen Berieselung, ist es gerade diese „Annehmlichkeit“, die den Preisunterschied ausmacht…
Sein Verhalten ist geprägt von Distanziertheit und Aggressivität auf das Ungewohnte und Unvertraute, das ihm begegnet:
S. 316
Noch eine zweite Apotheke wagt er zu betreten. Diesmal bedient ihn eine junge Frau, die ihn anscheinend sogar versteht, das Wort tampon fällt, das muss es wohl sein: ein Ohren-tampon, aber die Frau schüttelt den Kopf: - No hay. No tenemo…
Gibt’s nicht. Haben wir nicht: Wozu auch? Was könnte dieses Volk der Krachmacher und Gehörlosen mit Ohrstöpseln anfangen? Ein Volk, das klaglos Rosa-Kaninchen-Filme über sich ergehen lässt. Ein Volk, das es fertigbringt, zwei Hunde auf einem schattenlosen Dach anzuketten, und das nur zu dem Zweck, dass sie den Schlafsuchenden den Schlaf zerbelle…
Statt mystischer Erfahrung erlebt er Lärm und Hektik, ein Gefühl von Fremdheit und Einsamkeit.
Vorgeprägte Vorstellungen werden mit neuen Kenntnissen konfrontiert und rufen bei ihm unterschiedliche Reaktionen hervor. Das Gefühl, das seine Großmutter ihm vermittelt hat, verschwindet, als er die retrospektive Idealisierung mit der Realität konfrontiert. Der Wirklichkeitscharakter der Handlungsorte desillusioniert ihn:
S. 239
Dann steht er vor der Sonnenpyramide, ziemlich genau an dem Punkt, wo seine Großmutter vor sechzig Jahren gestanden haben muss, und fragt sich, was er eigentlich erwartet hat. ist er tatsächlich so dumm gewesen, zu hoffen, dort oben, ganz auf dem Gipfel, wäre es leer? Dort könnte man, auch nur einen Augenblick, mit den Steinen allein sei…
Bei einem Trickverkauf erwirbt er eine Obsidianschildkröte, die jedoch keinerlei Magie bei ihm auslöst.
S. 239f
Einer der Verkäufer spricht Alexander an, begleitet ihn ein paar Schritte. Seine Fingernägel sind schwarz wie die kleinen Obsidian-Schildkröten, die er verkauft. Obsidian - das Gestein, aus dem einst die Messer der Priester gemacht waren, die den Geopferten bei lebendigem Leibe das Herz aus den Rippen schnitten.Alexander nimmt die Schildkröte in die Hand, nicht um sie zu betrachten, eher um zu erfahren, wie sich Obsidian anfühlt. Der Mann redet auf ihn ein, versichert, die Schildkröte mit eigenen Händen hergestellt zu haben, setzt den Preis herab, von fünfzig auf vierzig Pesos. Alexander kauft die Schildkröt…
… Unauffällig, ohne dass die Frauen es sehen, stellt Alexander seine Schildkröte zu den anderen: den Hunderten, die hier auf den Verkaufstischen herumstehe…
Sie kosten fünfundzwanzig Peso…
Und statt Nostalgie erlebt er ein Trauma: einen Überfall, bei dem er beraubt wird.
S. 110
Aber ehe er sich versieht, hat der Kleine ihm die Brieftasche entrissen und prüft in sicherem Abstand den Inhalt. Unwillkürlich macht Alexander einen Schritt auf den Kleinen zu. Der Oberlippenbart hebt das Messer, fuchtelt hektisch damit herum. Der Kleine nimmt das Geld heraus, es sind dreihundert Dollar und ein paar hundert Pesos, und wirft Alexander die Brieftasche zu. Sekunden später sind die beiden verschwunde…
Ein Erinnerungsfoto seiner Großmutter von der großen Pyramide Teotihuacan führt ihn zum nächsten Reiseziel, an dem er zwar keine touristische, aber eine sehr authentische Erfahrung macht: Als Folge seiner Erkrankung kann er den Aufstieg nicht leisten.
Von da an begleitet seine Krankheit ihn auf der Reise. Er wird von Schmerzen gepeinigt und sieht sich im Sterben liegen. Nach einem schweren Anfall reist Alexander, ohne ein konkretes Motiv zu haben, sondern lediglich um der Ruhe willen, nach Pochutla, Puerto Angel („Engelhafen") am Stillen Ozean.
S. 319
Alexander tippt blindlings auf einen Ort am anderen, gegenüberliegenden Ozean, dem friedlichen, dem Stille…
- Pochutla, sagt der Man…
- Pochutla, wiederholt Alexander - ein Ortsname, von dem er sicher ist, dass er ihn noch nie im Leben gehört hat. Die Ortschaft heißt PuertoÁngel,wenn er richtig verstanden hat. Ein Ortsschild gibt es nich…
Dieser konkrete Ort am Pazifik wird für Alexander das, was der Name des Meeres wirklich bedeutet: ein Ort seelischer Ruhe, der ihm Schutz bietet. Hier beginnt nun ein Selbstfindungsprozess. Er erinnerte sich an seinen Flug nach Mexiko und sein überaktives Fassenwollen der Welt und erlebt einen „Schwebezustand. Embryonale Passivität“ (S. 407).
Die ab jetzt folgenden Begegnungen mit fremden Menschen sind zufälliger Natur, nicht absichtlich herbeigeführt, sie bleiben auf der Ebene des Alltäglichen und heben soziale Begrenzungen auf. Man ist freundlich, spricht miteinander, seine Geduld und sein Schachspiel schenken ihm Respekt und Anerkennung. Ihm erscheinen die Bewohner der Cafés, des kleinen Hotels, wie eine Familie, zu der er jedoch keinen näheren Zugang findet. Er bleibt ein Fremder.
S. 418
Sie werden ihm, wenn sie losgehen, zuwinken wie einem alten Bekannten, und Alexander wird zurückwinke…
S. 423
Der Motorradrocker wird ihn, als er ihn mit dem Schachbrett unter dem Arm kommen sieht, zu einer Partie auffordern, und Alexander wird zustimmen, obwohl die Nachmittagsschläfrigkeit ihm schon die Augen zuzudrücken beginn…
Umso intensiver werden die gedachten und erinnerten Beziehungen, vor allem zu Kurt, zu Marion, und die Reflexion über sich selber. Er findet eine existentielle Gelassenheit und die Offenheit, sich mit seinem Leben und der Person seines Vaters auseinanderzusetzen. S. 411
Aber ich habe immer mein Leben lang das Gefühl gehabt, nicht dazuzugehören. Obwohl ich mein Leben lang gern irgendwo dazugehört hätte, habe ich das, dem ich hätte zugehören wollen, niemals gefunden. Ist das krank? Fehlt mir ein Gen? Oder hat das mit meiner Geschichte zu tun? Mit der Geschichte meiner Famili…
Hat die Natur im bisherigen Leben Alexanders kaum eine Rolle gespielt, so wird sie für ihn nun (auch über die Erfahrung des Laufens) bedeutsam:
S. 409
Nach dem Zeitunglesen wird er noch einmal zum Strand gehen.und dem Sonnenuntergang zusehe…
Wenn die Sonne unwiderruflich ins Meer abgetaucht ist, wird er als einziger Gast.dem perlmutternen Abglanz am Himmel nachschauen, der ziemlich exakt von derselben Farbe ist wie die Innenseite der großen, leuchtenden Muschel von Oma Charlott…
Er wird sich darüber wundern, wie schief die Mondsichel häng…
S. 426
Einzig das Knirschen der Hanfseile wird noch zu hören sein. Und das gleichgültige, ferne Rauschen des Meere…
So erlebt er letztendlich diese Reise nach Mexiko als eine Befreiung und im kleinen Unscheinbaren die Wiederkehr dessen, was seine Oma ihm als Erinnerung hinterlassen hat:
S. 94 (1959) :
Und Klapperschlangen, die gibt es natürlich noch. Und Skorpione im Schuh. Aber da kennt er sich aus: Morgens die Schuhe ausschütteln - einfacher Trick. Den hat ihm Oma verrate…
S. 322 (2001 in Mexiko)
- Und schütteln S’ die Decken aus, sagt die österreichische Squaw: Es hat hier Skorpion…
17. Gesellschaftstreffen, Feierlichkeiten und geselliger Verkehr - ein Charakteristikum der bürgerlichen Familie
Ein Haus ohne Geselligkeit ist wie eine Blume ohne Duf…
(Sigismund von Radeck…
So wenig sich der Bürger auf Reisen gegen Geselligkeit und Kontaktaufnahme sperrte, so wenig schottete er sich daheim in seinem Wohnhaus von der Außenwelt ab - auch wenn im Zentrum des bürgerlichen Denkens das häusliche Glück mit Ehe und Familie standen, in der der Mann Erholung von der Arbeit finden konnte, und die Aufmerksamkeit auf die Kinder gerichtet war. „Häusliche Geselligkeit war ein wichtiger Teil. [der] bürgerlichen Selbstfindung und Selbstdefinition.“768 Die Offenheit für Freunde, Verwandte und Bekannte war charakteristisch für Bürgerhäuser, und Geselligkeit erhielt eine entlastende Funktion jenseits der Arbeit und der Geschäfte. Sie war ein Gegengewicht zum Alltag und eine Belohnung für die Arbeit, im Sinne Goethes: „Tages Arbeit, Abends Gäste/ saure Wochen, frohe Feste.“
Gesellschaftliche, berufliche Kontakte spannten ein Netzwerk weit über die eigene Stadt hinaus und wurden von Generation zu Generation weitergegeben
17.1 Private Treffen im Bürgerhaus
Ob man wirklich ein Mitglied in der bürgerlichen Gesellschaft war, zeigte sich durch die Teilhabe an und die Ausrichtung von privaten Geselligkeiten, größeren oder kleineren Verwandtentreffen und in der Anzahl von Hausfreunden.
Im Zentrum stand das Bürgerhaus, es wurde durch die ins Privathaus gezogene Geselligkeit „zu einem Raum sozialer Interaktionen, zu einem Ort kommunikativ verstandener Öffentlichkeit“769 und bildete als wichtiger gesellschaftlicher Treffpunkt einen Teil der Geselligkeitskultur (Vereine spielten lediglich eine Nebenrolle). Hier nahmen auch die Frauen teil und hatten als Gastgeberin eine wichtige Position inne. Man traf sich in den Repräsentationsräumen, z.B. dem Gesellschaftszimmer, das stets den Vorzug der besten Lage und Ausstattung hatte.
Die familienbezogene Geselligkeit, eine wenig aufwendige, intime und zwanglose Geselligkeit zwischen Familienangehörigen und Verwandten, wurde ergänzt durch Alltagszirkel mit befreundeten Familien und einzelnen Hausfreunden.770 (TM)
Bei den Buddenbrooks lud man Gäste zum jour fixe ein, einem gemütliches Zusammensein eines großen Teils der Familie und Hausfreunden, mit geringerem repräsentativen Aufwand.
Wie diese Zusammenkünfte gestaltet waren, zeigt das Bild der Gesellschaft am Romananfang der Buddenbrooks: Das Haus der Buddenbrooks fungiert hier als Kommunikationszentrum sozialer Beziehungen.
Solch eine Geselligkeit bedeutete Abwechslung insbesondere für die bürgerlichen Frauen, verbrachten sie doch die meisten Stunden des Tages in der Wohnung, nur mit dem Dienstpersonal als Kontaktpersonen, wohingegen die Männer ihrer Berufsarbeit, politischen Aktivität und der Vereinsgeselligkeit außerhalb des Hauses nachgingen.
Je nach der gesellschaftlichen Stellung und dem formellen Anlass lud man zu aufwendigeren Formen der Geselligkeit, Bewirtung incl., sei es zum Souper, Diner, Tanztee, zum Kartenspiel, Musizieren, zur Diskussion über Kunst und Literatur.
Für die Zusammensetzung der Gästeliste war der Beruf des Mannes entscheidend. Festliche Abendgesellschaften umfassten 12 bis 16 Personen, zu denen man die Honoratioren der Stadt, Berufskollegen und Hausfreunde aus dem bürgerlichen Rekrutierungsfeld einlud. Gerade als Kaufmannsfamilie war der häufige Kontakt und Umgang ein Zeichen der Weltläufigkeit und ein Erfordernis des Berufsstandes, denn durch ihn schuf man sich im eigenen Haus einen informellen Rahmen zum Austausch.
S. 304f
Mit dem Tode des Konsuls war das gesellschaftliche Leben in der Mengstraße erloschen. Ihr Sohn aber und seine Gattin hatten bereits ihr erstes Diner hinter sich, ein Diner, bei dem im Speise- und Wohnzimmer gedeckt worden war, ein Diner mit Kochfrau, Lohndienern und Kistenmakerschen Weinen, eine Mittagsgesellschaft, die um 5 Uhr begonnen, und deren Gerüche und Geräusche um 11 Uhr noch fortgeherrscht hatten, bei der alle Lang hals’, Hagenströms, Huneus. zugegen gewesen waren, Kaufleute und Gelehrte, Ehepaare und Suitiers, die mit Whist und ein paar Ohren voll Musik geschlossen hatte, und von der man an der Börse noch acht Tage lang in den lobendsten Ausdrücken sprac…
… „Sehr brav, Gerda!“ Wir haben uns nicht zu schämen brauchen. Dergleichen ist sehr wichti…
Tony Buddenbrook hat große Erwartungen, was den gesellschaftlichen Umgang in Hamburg betrifft, erlebt jedoch, im Unterschied zur Geselligkeit im Elternhaus, in Hamburg Isolation und Entfremdung. Sie fühlt sich einsam und kann Bestandteile ihres Selbstverständnisses, nämlich repräsentierende Vorsteherin des Hauswesens zu sein, nicht ausleben.
S. 170
Ich habe Grünlich schon oft um Anschaffung einesCoupésgebeten, denn das ist nötig hier draußen. Er hat es mit auch halb und halb versprochen, aber er begibt sich merkwürdiger Weise überhaupt nicht gern mit mir in Gesellschaft und sieht es augenscheinlich nicht gern, wenn ich mich mit den Leuten in der Stadt unterhalt…
Gesellschaften im Hause Buddenbrooks dagegen zeigen bereits Elemente der „Feudalisierung“ und grenzen in der Reichhaltigkeit der Speisekarte und der Auswahl der Gästeliste an Formalität und Repräsentativität des Adels.
Konsul Buddenbrook:
S. 26
Die Teller wurden aufs neue gewechselt. Ein kolossaler, ziegelroter, panierter Schinken erschien, geräuchert, gekocht, nebst brauner, säuerlicher Chalottensauce und solchen Mengen von Gemüsen, dass alle aus einer einzigen Schüssel sich hätten sättigen könne…
S. 31
Nun kam, in zwei großen Kristallschüsseln, der „Plettenpudding“, ein schichtweises Gemisch aus Makronen, Himbeeren, Biskuits undEiercréme.
„Im zweiten Keller rechts, das zweite Fach, hinter dem roten Cordeaus, zwei Bouteillen, du?“Senator Thomas Buddenbrook:
S. 363
… und er und seine Gattin standen den anderen reichen Häusern an Repräsentation nicht nach; seine Küche, sein Keller galten als „tip-top“, er war als verbindlicher, aufmerksamer und umsichtiger Gastgeber geschätzt, und der Witz seiner Toaste erhob sich über das Durchschnittsnivea…
Der Ablauf einer Geselligkeit erscheint uns heute formalisiert und ritualisiert:
Es begann mit der Versammlung der Gäste. Vor dem festlichen Abendessen traf man sich im Salon und plauderte. Die gemeinsame Tafel bot dann ein Festmahl mit blitzendem
Geschirr und teurem Service, die Sitzordnung und die Reihenfolge der Speisenverteilung entsprach der sozialen Hierarchie der Gäste. Waren alle anwesend, folgte das Auftragen der Speisen, im Anschluss daran die profanen Segenswünsche, dann das Essen: (TM) S. 20f
… wo die Gesellschaft mit der Placierung um die lange Tafel soeben fertig geworden wa…
… Es war jede Spur von Besorgnis und Unruhe aus dem Gesicht Madame Buddenbrooks verschwunden, als sie sich, zwischen dem alten Kröger, der an der Fensterseite präsidierte, und Pastor Wunderlich, niederlie…
„Bonappétit!“sagte si…
Man hatte soweit wie möglich bunte Reihe gemacht und die Kette der Verwandten durch Hausfreunde unterbrochen. Streng war dies nicht durchzuführen gewesen…
S. 26
Die Teller wurden aufs neue gewechselt. Ein kolossaler, ziegelroter, panierter Schinken erschien,. Leprecht Kröger übernahm das Tranchieren. .. Auch das Meisterwerk der Konsulin Buddenbrook, der „Russische Topf“, ein prickelnd und spirituös schmeckendes Gemisch konservierter Früchte wurde gereicht.…
Man beendete das Essen mit dem Nachtisch, mit Kaffee und Tee und Zigaretten.
Nach dem Diner folgte die Separierung je nach Geschlecht, d.h.der Gang ins Herrenzimmer und das Verweilen der Damen beieinander, um allesamt erst später wieder zusammen zu treffen.
(TM)
S. 36
Drinnen, im Esssaale herrschte Aufbruch…
Plaudernd, befriedigt und in bester Laune, Wünsche in betreff einer gesegneten Mahlzeit austauschend verfügte man sich durch die große Flügeltür ins Landschaftszimmer zurüc…
„Bringe ein paar Tassen Kaffee und Cigarren in den Billardsaal“, sagte er zu dem Folgemädchen, das über den Vorplatz gin…
Nicht selten boten Gäste und Gastgeber ihre musikalischen oder literarischen Darbietungen zur geselligen Unterhaltung.
(TM)
S. 36
Die sechs Herren hörten noch, als sie durch die Säulenhalle schritten, im Landschaftszimmer die ersten Flötentöne aufklingen, von der Konsulin auf dem Harmonium begleitet,…
Eine Steigerung des Geselligkeiten bildete die Feier eines bestimmten Festes, dem Mittelpunkt der familialen Ritualkultur. Die Familie zelebrierte damit die Wiederholung der eigenen Geschichte in einem gemeinsamen Raum, im eigenen Haus, dem familiären Lebensraum schlechthin.771 Allein die Mahlzeit dabei gab Anlass für die Zelebration von Familienritualen, die durch Dekor, Kerzen und Sitzordnungen bestimmt wurde. Man festigte den Familienzusammenhalt und den Gemeinschaftssinn durch familieneigene Riten (Vorlesen, Gedichte) und Bräuche und inszenierte sich damit selbst.
Das beste Beispiel dafür ist das Weihnachtsfest, Thomas Mann schildert es im Detail. Es hatte mit seinem festlichen Programm und den traditionellen Requisiten eine besondere Bedeutung für das Bürgertum im 19. Jahrhundert. In Familientraditionen solcher Art zeigte sich eine Familienkultur, in der die Familie sich ihres Zusammenhalts und ihres Bestands versicherte772, dies spiegelt d auch die kleine Ansprache der Konsulin am Weihnachtsabend wieder:
(TM)
S. 546
Und nun wolle man, mit hoffendem Herzzen, einträchtig anstoßen auf das Wohl der Familie, auf ihr Zukunft, jene Zukunft, die dasein werde, wenn die Alten und Älteren unter den Anwesenden längst in kühler Erde ruhen würden…
Das Entzünden der Kerzen, das Vortragen von Gedichten und Hausmusik, die Gaben vom Weihnachtsmann oder Knecht Ruprecht für die Kinder, all das gehörte zur bürgerlichen Institution Weihnachten und bewirkte, dass das Fest mit Muße und der Freude am Zusammensein gefeiert wurde.773 (TM)
S. 530
In der Tat, das weihevolle Programm, das der verstorbene Konsul für die Feierlichkeit festgesetzt hatte, musste aufrecht erhalten werde…
S. 533f
„Tochter Zion, freue dich!“ sangen die Chorknaben. diese hellen Stimmen, die sich, getragen von den tieferen Organen, rein, jubelnd und lobpreisend aufschwangen, zogen Aller Herzen mit sich empo…
Die Konsulin aber schritt langsam zum Tische und setzte sich inmitten ihrer Angehörigen auf das Sofa, das nun nicht mehr wie in alter Zeit unabhängig und abgesondert vom Tische da stand. Sie rückte die Lampe zurecht und zog die große Bibel heran, deren altersbleiche Goldschnittfläche ungeheuerlich breit war.…
Sie las die altvertrauten Worte langsam und mit einfacher, zu Herzen gehenderBetonung, mit einer Stimme, die sich klar, bewegt und heiter von der andächtigen Stille abho…
S. 536
Singend, geblendet und dem alt altvertrauten Raume ganz entfremdet umschritt man einmal den Saal, defilierte an der Krippe vorbei, in der ein wächsernes Jesuskind das Kreuzzeichen zu machen schie…
War früher Nikolaus der Gabenbringer, verschob sich dies nun auf den Weihnachtsmann und das Christkind. Man integrierte vorchristliche Elemente wie Knecht Ruprecht in die Heilig-Abend-Feier und entwickelte parallel dazu eine Geschenkkultur: Bereits um 1800 bestellten reiche Bürger Geschenke für ihre Kinder und zeigten sich großzügig. Die Artigkeit der Kinder, die Festtagskleidung und die reichhaltige Festtafel ließen die Weihnachtstage im Jahresverlauf herausragen.774 (TM)
S. 537
Er wandte sich dem Theater zu. Das Harmonium war ein überwältigender Traum, aber er hatte doch fürs Erste noch keine Zeit, sich näher damit zu beschäftigen. Es war der Überfluss des Glückes, in dem man, undankbar gegen das Einzelne, Alles nur flüchtig berührt, um erst einmal das Ganze übersehen zu lernen.. Oh, ein Souffleurkasten war d…
Das Weihnachtsfest entwickelte sich zu einem Kindfest, in dem dieBescherung immer mehr in den Mittelpunkt rückte. Das Weihnachtszimmer wurde zum Sakralraum und „Warenumschlagplatz“. Spielzeug wurde stets mit dem pädagogischen Ziel verschenkt, dem Kind Tätigkeit und unmittelbare Erfahrung zu vermitteln, was um so wichtiger wurde, je abstrakter sich das Lernen am Gymnasium entwickelte.775
(TM)
S. 546
… auf die Kinder, denen das heutige Fest ja recht eigentlich gehör…
Bei den Buddenbrooks gab es zu Weihnachten keine Abschließung nach außen oder Abkapselung auf die Kern-Familie, man zog das Gesinde mit ein und intensivierte die Wohltätigkeit gegenüber den bedürftigen Nachbarn und Mitbürgern, bescherte die Armen und die Dienstboten.
S. 530
… wo scheu und verlegen einige fremde alte Leutchen umher standen, Hausarme, die ebenfalls an der Bescherung teilnehmen sollte…
Im Laufe des Jahrhunderts gibt es bei den Buddenbrooks eine Veränderung in der Feier des Weihnachtsfestes und der Geselligkeitsformen, der Wandel vom „ganzen Haus“ zur Kleinfamilie ging langsam aber merklich vonstatten:776 Das bürgerliche Haus von Thomas und Gerda stand nicht mehr zu jeder Zeit den Verwandten und Freunden offen, und nur noch selten für geladene Gäste.
S. 607
Der Abend des 24. Dezembers wurde im Hause des Senators begangen, ohne die Damen Buddenbrook aus der Breitenstraße und ohne die altern Krögers; denn wie es nun mit den regelmäßigen „Kindertagen“ ein Ende hatte, so war Thomas Buddenbrook nicht geneigt, alle Teilnehmer an den Weihnachtsabenden der Konsulin nun seinerseits zu versammeln und zu beschenken…
Es fehlte der Chor der „Hausarmen“, die in der Mengstraße Schuhzeug und wollene Sachen in Empfang genommen hatten, und es gab keinen Knabengesang. Man stimmte im Salon ganz einfach das „Stille Nacht, heilige Nacht“ an, worauf Therese Weichbrodt aufs Exakteste das Weihnachtskapitel vorla…
(AG)
Bei Familie Sterk ist das Weihnachtsfest typisch bürgerlich, ein Sinnbild für familiäre Bindung, es wird feierlich mit Kerzen, Tannenbaum, Weihnachtsgeschenken und Gesang begangen.
Alma wünscht sich, mit Richard, nachdem er in das Pflegeheim eingewiesen worden ist, die Feiertage in der bekannten Form in bekannter Umgebung feiern, doch statt Freude am gemeinsamen Zusammensein, erlebt sie, wie ihr Mann im Wahn kaum die Bewandtnis des Festes begreift:
S. 341
Aber er war ganz abwesend, und die meiste Zeit glaubte er sich in einer Kapelle, vermutlich wegen der Kerzen. Er sang mehrmals unangekündigt, Großer Gott wir loben dich', und als Alma ihn soweit hatte, dass er begriff, welche Bewandtnis es mit dem Weihnachtsbaum und den Geschenken hat (Richard, das ist für dich, schau, das sind Weihnachtsgeschenke für dich, Richard, Weihnachtsgeschenke, es ist Weihnachten), traten ihm Tränen in die Augen, weil echte Kerzen am Baum leuchteten und er fürchtete, dass das Haus abbrenn…
Peter Erlach wird 1978 angesichts der Erinnerung an frühere Weihnachtsfeste, die sie als vollständige Familie mit Ingrid zusammen gefeiert haben, melancholisch. Lieder, wie ,Stille Nacht’ beschwören unvergessliche Momente: S. 304
,Blowing in the wind', stimmt Peter beim Refrain ein mit seinem ratternden und zittrigen Bass, gerührt wie zu Weihnachten bei ,Stille Nacht', einen schmerzlichen Kloß im Hals, weil es ihm einen Moment lang vorkommt, als seien sie, ja was? Dieser Gedanke kommt ihm nur selten vertraut vor,: eine Famili…
Familiensinn im Sinne des Bürgertums in form von Familienzusammenkünften gibt es auch heute noch: Man trifft sich mit der Familie an Hochzeiten und Beerdigungen, besonderen Geburtstagen und Taufen und insbesondere weiterhin an Weihnachten. Die „unmittelbare persönliche Abhängigkeit, wie sie zum bürgerlichen Familienideal gehörte und von diesem auf zahlreiche andere Formen der bürgerlichen Gesellschaft ausstrahlte“ gibt es jedoch nicht mehr.777 Die Geburtstage von Eltern und Kindern sind heute Fixpunkte familiärer Feierkultur.778 (ER)
Von einer Geburtstagsfeier der besonderen Art lesen wir in Eugen Ruges Roman:
Wilhelms 90. Geburtstag fällt mit dem 40. Geburtstag und der Auflösung der DDR zusammen. Die Zusammensetzung der Gäste besteht nur zu einem Teil aus Familienmitgliedern wie Kurt und Nadeshda Iwanowna, Melitta und dem Urenkel Markus. Irina folgt wegen Saschas Auswanderung der Einladung nicht, desweiteren erscheinen aber eine Delegation von Parteigenossen und Nachbarn.
Restbürgerliche Lebenskultur zeigt sich in bürgerlichen Verhaltens- und Umgangsformen und bürgerlicher Etikette: gemeinsam kultiviert man Geselligkeit, von der Begrüßung angefangen über das durch die Hausfrau servierte Abendessen, das Buffets, bis hin zur versuchten Konversation über aktuelle Gegebenheiten.
S. 154
Sie setzte sich ans Ende der langen Tafel, man schob ihr extra einen kleinen Sessel heran.sie bekam Kaffee und Kuchen, Gott sei Dank war der Kaffee nicht stark, und der Kuchen war köstlich, sie verzehrte zwei Stück, den Teller auf den Knien balancierend, während die anderen Gäste sich wieder ihren Gesprächen zuwandte…
S. 278
Einige Sekunden standen sie verloren herum, dann tauchte, dicht vor ihnen, die Urgroßmutter auf wie ein Geis…
- Wunderbar, dass ihr kommt. Ich bin ja so glücklic…
S. 334
Fette Buttercremetorte hätte er früher nicht angerührt. ..Auch Kaffee bekam er glei…
Der Ablauf ist ritualisiert, ebenso wie Wilhelms Reaktionen auf die Geschenke:
Im Vorfeld sind Einladungen von der Ehefrau und Hausfrau verteilt worden, Vasen mit der Beschriftung von Namensschildern warten in der Diele auf die Blumensträuße der Gäste. Ein Ausziehtisch, für dessen Postieren bisher Alexander zuständig war, dient zum Anrichten des Buffett: S. 198
- Da ist irgendwas passiert, sagte Charlott…
- Ich zieh den Ausziehtisch aus, sagte Wilhel…
Ein kaltes Buffet war bestellt worden und wurde dort aufgetischt.
Ein Pionierchor erscheint und gratuliert mit einem Lied, für das sich der Genosse Powileit mit einem Geldbetrag bedankt.
S. 197
Es klingelte, draußen stand der Pionierchor. Die Pionierleiterin sagte: Drei vier, und der Chor sang … Wilhelm holte einen Hundertmarkschein aus seiner Brieftasch…
Die Feier des Geburtstags ist, wie stets in der damaligen DDR, verbunden mit einer Auszeichnung: Titel, Orden, Zeremonien und Uniformen, Ansteckzeichen und -nadeln galten als politische Prestige- Zeichen und wurden im SED-Staat als eine Art Treubekundung bei vielen Gelegenheiten ausgeteilt.
S. 285
- . dir, lieber Genosse Powileit, den Vaterländischen Verdienstorden in Gold zu verleihen, hörte Markus den Schuldirektor sagen. Das hörte sich bombastisch an. Vaterländischer Verdienstorden, ein bisschen nach Kaiser und Krie…
Mit dem Öffnen der großen Schiebetür zwischen den Räumen beginnt die Feier. Wilhelm nimmt in seinem Ohrensessel die Gratulationen entgegen, und das jedesmal mit den Worte, die das Bürgerliche kontrastiert und entzaubert.
S. 202
Bring das Gemüse zum Friedho…
Nach der Laudatio des stellvertretenden Bezirkssekretärs eröffnet man das Buffet und die Gäste bedienen sich selber:
S. 342
Und bevor Kurt sich zu irgendetwas entschließen konnte, kam Bunke schon mit vollbeladenem Teller zurüc…
Während des Essens führen die Gäste untereinander Gespräche, bis ein Lied angestimmt wird, zunächst von Wilhelm, später von Nadeshja, der Russischen Babuschka’, in das alle Gäste einstimmen:
S. 343
Zuerst erschien es Kurt als Gemurmel. Er brauchte einen Moment, um es als Gesang zu erkennen … begriff er, was Wilhelm da sang : die berühmte Parteihymne …
S. 344
… aber bevor sie ihr Gespräch fortsetzen konnten, begann schon wieder etwas zu rumoren, dieses Mal kam es von rechts, und wieder, weil es so unwahrscheinlich war, brauchte Kurt einige Augenblicke, um es als Gesang zu erkennen: Nadeshda Iwanown…
Letztendlich endet die Geburtstagsfeier Wilhelm in einer Katastrophe.
(AG)
Alma und Richard Sterk haben gesellschaftliche Kontakte und Einladungen zum gemeinsamen Essen, im Alter reduzieren sich diese jedoch wegen Richards krankheitsbedingten Verständigungsschwierigkeiten:
S. 46
Sie denkt, ich sollte Fritz und Susanne mal wieder zum Essen einladen, ist auch schon Monate her seit dem letzten Mal, keine Ahnung, ob das an Richard liegt, dass mir die Lust vergangen ist, u…
Kienasts lassen sich auch immer seltener blicken, seit die Gespräche so quer gehen, dito mit Grubers, dasselbe in Grün, auf Dauer ist das allen zu blöd. Recht haben si…
Familie Erlach ist in Kontakt mit einer Familie Semmering; sie hatten zu Silvester eine Einladung ausgesprochen, die nun aber abgesagt wurde:
S. 267
- Die Einladung an den Semmering, zu der sich Peter hat breitschlagen lassen, ist ausgefallen, weil dort alle krank sind. Wenn die Kinder jetzt noch zwei Stunden schlafen, gehen wir zum Chinesen, sonst bleiben wir zu Haus…
17.2Die sozialistische Feierkultur
Im Bürgertum führte die Trennung von Wohnen und Arbeiten dazu, dass sich die Familie in der Freizeit traf. In der DDR dagegen sollte die Familie nicht wie im Bürgertum zum Rückzugsort (privater Feste) werden, stattdessen war es wichtig, die eigenen Freizeitinteressen in die Gruppe der Mitarbeiter zu integrieren. Die Gleichheit der Mitglieder in einem Betrieb durch die fehlende Hierarchie und die gleiche Entlohnung stärkte den Gemeinschaftssinn und reduzierte die Distanz zueinander; so gab es durchaus auch bei der Arbeit Zeit für Privatgespräche, Geselligkeit und intellektuellen politischen Austausch. Nichtsdestotrotz hoffte man durch diese Art der Solidarität und des Gemeinschaftssinns auch den Leistungswillen zu steigern, z.B., wenn sich Irina mit den Schauspielern zum entspannten Umtrunk trifft: (ER)
S. 167
Beim Frühstück eröffnete ihm Irina, dass sie heute noch einmal losmüsse: Gojkovic komme, der jugoslawische Schauspieler, der in dem Indianerfilm, den die DEFA drehen wollte, die Hauptrolle spielt…
Seit Irina - er wusste im Grunde gar nicht, als was - bei der DEFA arbeitete, kam es öfter vor, dass sie ihn in dieser Weise enttäuschte. Angeblich war es eine Halbtagsstelle, aber in Wirklichkeit arbeitete sie oft bis in die Nacht oder am Wochenende, und alles für nichts, denn am Ende verpulverte sie bei alldem mehr Geld, als sie verdiente, dachte Kurt. ja, natürlich hatte auch Irina ein Recht zu arbeiten. Wenngleich es eine höchst seltsame Arbeit war, mit irgendwelchen Schauspielern im Gästehaus der DEFA zu sitzen und Wodka zu saufe…
Die Kaffeerunde war ein Kern der Lebenskultur, sie zeigte DDR-Gemütlichkeit und eine Gemeinsamkeit „der kleinen Leute“.
(ER)
S. …
Zuerst wurde der Tisch gedeckt. Diensteifrig flitzte Alexander zwischen Küche und Salon hin und her, wie die Omi das große immer nannt…
S. 2…
Wilhelm hatte inzwischen zu Mittag gegessen und ein wenig geruht; Lisbeth hatte ihm noch einen Kaffee gekoch…
Man hatte informelle Netzwerke zu Freunden, Mitarbeitern, Bekannten und Verwandten für die Beschaffung von schwer zu erhaltenden Waren und Gütern. Es bestanden intensive nachbarschaftliche Beziehungen in den Wohnsiedlungen, eine Nachbarschaftssolidarität, die sich in gemeinsamen Mieterversammlungen zeigte oder in „Mach-Mit-Einsätzen“, um das Grün zu pflegen und Sauberkeit im Haus zu schaffen.
(ER)
Bei Wilhelms Geburtstag sieht man den engen Kontakt der Familie zu Nachbarn, Funktionären und Parteigenossen, die mitfeiern.
S. 202f
Die Weihes kame…
Mählich kam jetzt mit Fra…
Bunke kam jetzt herein. So einer war nun Oberst bei der Staatssicherhei…
Frau Bäcker die Gemüseverkäuferi…
Harry Zenk, Rektor der Akademie: war noch nie zu seinem Geburtstag gekomme…
Till Ewerts - nach Schlaganfal…
Aha, der Genosse Krüger, Abschnittsbevöllmächtigte…
Die Sondermanns…
Wilhelms Treffen mit (Partei)freunden sind politischer Art, sie finden im Keller, der sog. ,Zentrale‘ statt:
S. 118
… in der ,Zentrale‘, wie er den ehemaligen Weinkeller nannte, den er zu einer Art Versammlungsraum umgestaltet hatt…
S. 121
Auf dem großen Eichentisch zwischen überquellenden Aschenbechern, wichtig aufgeschlagenen Notizheften, zwischen Kaffeetassen und Vita-Cola-Flaschen lag eine Art Plakatentwur…
EINE LOKOMOTIVE FÜR KUB…
Charlotte wird von ihrem Mann beauftragt, für diesen Anlass Brote zurechtzumachen und zu reichen. Sie empfindet diese Tätigkeit als eine degradierende Dienstleistung, für die sie nicht zuständig ist. Nur widerwillig erfüllt sie daher Wilhelm den Wunsch:
S. 122
Sie entschied sich für die runde Schachtel Schmelzkäse und ein Glas sauere Gurken und begann, die auf dem Tablett ausgelegten Brote zu bestreiche…
Gleichwohl konnte man in den Jahrzehnten der DDR-Existenz eine „Verhäuslichung“ der Freizeit in der Ehe und insbesondere während der Elternschaft nicht verhindern.779 Die Partnerzentrierung war groß und eine Privatisierung und Regeneration in der Familie, schon aufgrund der geringen Freizeitangebote in der DDR, allenthalben antreffen.
(ER)
Kurt, Irina und Alexander verbringen viel Zeit miteinander in der Familie.
S. 79f
Sonntags kroch er zu seinen Eltern ins Bet…
Später Schachspielen. Papa gab ihm zwei Türme vo…
Zweitenfreitag ging er nämlich zur Omi…
S. 94
Es ist Sonntag. Alexander geht mit seinen Eltern die Straße entlang.Sie gehen mitten auf der Straße, Hand in Hand, links Mama, rechts Papa, und Alexander erklärt, wie er sich die Sache so vorstell…
Die Feier bestimmter Feste bilden auch hier den Mittelpunkt einer familiären Ritualkultur. Wie in Thomas Manns Roman ist es in Ruges DDR Roman das Weihnachtsfest, das die Feierkultur der Familie widerspiegelt.
Die Rituale des Weihnachtstages weisen im Hause Umnitzer ebenfalls auf bürgerliche Feierkultur hin: Das gemeinsame Essen, Gespräche und die Bescherung haben in frühen Jahren noch die Kraft, eine einigermaßen ausgleichende Wirkung zu entfalten.
Irina in der Rolle der Hausfrau spielt wie im 19. Jahrhundert eine wichtige Rolle und sorgt mit für den ritualisierten Ablauf dieser Geselligkeit.
S. 245ff
… außerdem Quitten, die Irina schälte und würfelte und zusammen mit den schon eingeweichten Aprikosen.in eine Pfanne gab. und als Füllung in ihre Weihnachtsgans stopfte, die sie nach einem dreihundert Jahre alten Rezept zubereitete und die, weil das Rezept angeblich von burgundischen Mönchen stammte, Burgundische Klostergans hie…
… Abgesehen von der burgundischen Gans war die Küche am Weihnachtstag deutsch. Außer Rotkohl und Grünkohl gab es noch Thüringer Klöße (die komplizierteste aller Kloßvarianten), Kartoffeln für Kurt, der keine Klöße aß, außerdem einen deftigen Rettichsalat als Vorspeise, rote Grütze als Nachspeise und selbstgebackenen Weihnachtsstollen zum anschließenden Kaffee - und das alles im Überflus…
auch wenn sie schon jetzt die bemüht einvernehmliche Atmosphäre spürte, die jedes Jahr an der Festtagstafel aufkam: die gestelzten Gespräche, das umständliche Öffnen der Geschenke, die vorgetäuschte Freude bei allen (außer bei Wilhelm, der jedes Jahr auf schärfste gegen das Beschenkwerden protestierte.). auch wenn das alles im Grunde peinlich und ansteckend und bis zu einem Grad idiotisch war, bestand Irina auf der Einhaltung des Rituals, ja, mochte es in gewisser Weise soga…
Der Weihnachtsbaumschmuck gehört zu dieser Tradition:
Kurt dekorierte den Weihnachtsbaum seit drei Jahren. Eigentlich hatte er den Weihnachtsbaum abschaffen wollen, nachdem Sascha ausgezogen war, aber Irina hatte auf Wahrung der Tradition bestande…
S. 248f-
- Ist er nicht zu kitschig, fragte Kur…
- Ein bisschen schief, sagte Irin…
- Ja, aber findest du nicht, dass ein bisschen zu viel dran is…
- Ach was, sagte Irina und betrachtete mit schiefem Kopf den schiefen Baum, dessen Äste dick mit Watte und Lametta belegt und mit bunten Kugeln behängt waren, so wie es sich gehörte, und obgleich der Baum, den Kurt ausgesucht hatte, im Grunde ein Schreckgespenst war: Sobald es dunkelte und die elektrischen Kerzen leuchteten, würde es nicht weiter auffalle…
Es folgt das Erscheinen der Gäste.
S. 250
Kurt hatte bereits die Haustür geöffnet. Zuerst erschien Sascha. Sascha blieb in der Tür stehen, wartete einen Augenblick und schob dann vor sich her und ins Haus hinein - die Neu…
S. 255
Pünktlich um zwei Uhr klingelte es: Charlotte und Wilhelm standen vor der Tür - mit ihren DederonEinkaufstaschen. Was würde wohl dieses Mahl darin enthalten sei…
S. 256
Auch Nadjeshda Iwanowna kam jetzt aus ihrem Zimme…
…das gemeinsame Essen:
S. 259
Tranchiert wurde am Tisch, die Verteilung erfolgte gemäß der jeweils anfallenden Teile: zuerst die Keulen - eine bekam Sascha, so weit war die Sache kla…
….. und die Bescherung.
S. 265
Dann stand Kurt auf und sagt…
- So, Kinder, jetzt werde ich mal eine Weihnachtsmusik auflege…
Das war das Zeichen. Die Geschenke waren bereits an den Sitzplatz des jeweiligen Adressaten gestellt worden. Nun begannen alle mit ihren Geschenkpapier zu rascheln, knoteten umständlich Bänder auf, falteten auseinander, strichen glat…
Nach der Verabschiedung der Gäste setzt man sich in der Kleinfamilie zusammen und amüsiert sich im kleinen Kreis:
S. 267
- So, jetzt brauche ich einen Kogna…
Kurt öffnete das Fenster, der Rauch verzog sich. Alle waren erhitzt, hatten rote Köpfe. Man ließ sich in der Sitzecke nieder, machte es sich bequem. Noch immer wurde Irina von nachbebenartigen Lachkrämpfen geschüttel…
Die Erzählung vom Weihnachtstag des Jahres 1991 (17. Kapitel) nimmt in variierter Form die entsprechenden Begebenheiten aus dem Jahre 1976 (12. Kapitel) wieder auf.
Als aber das Ritual des Weihnachtsessens vollzogen wird, werden die Veränderungen im Leben nach dem Untergang der DDR und der Wiedervereinigung deutlich: Irina kann sich die Zutaten für ihre Klostergans allesamt im Supermarkt kaufen, und Alexander kommt mit seiner jetzigen Freundin Catrin aus dem tief im Westen des vereinigten Deutschland liegenden Moers. Der Versuch, den Weihnachtsabend, für die ursprüngliche Intention der Gemeinschaft einzusetzen, führt zur Katastrophe. Die Rituale zeigen die komplette Destabilisierung der Familie: Es ist nichts mehr vom familiären Zusammenhalt zu spüren, trotz des Bemühens Irinas, eine Feier zu zelebrieren:
S. 366
… Ein Mal noch Weihnachten in diesem Haus. Ein Mal Klostergans. Ein Mal Klöße, so wie es sich gehört…
Die Hausfrau betrinkt sich in der Küche und verfolgt von dort aus die immer aggressiver geführten politischen Streitgespräche zwischen Kurt und Alexander, die in der Beurteilung des Sozialismus keinen Konsens finden.
S. 364
Sie trank den Whisky - das Zeug drehte ganz schön! - und rauchte noch eine Zigarett…
S. 367
- Scheiße, schrie Sascha zurück. Scheiß auf eine Gesellschaft, die Helden brauch…
- Scheiß auf eine Gesellschaft, in der zwei Milliarden Menschen hungern, schrie Kur…
Plötzlich stand Irina im Zimmer, sie wusste selbst nicht, wie. War im Zimmer und schri…
- Hört auf! Es war einige Sekunden lang still. Dann sagte sie: - Weihnachte…
Eigentlich hatte sie sagen wollen: heute ist Weihnachten. Sie hatte sagen wollen: Sascha ist seit Monaten zum ersten Mal wieder da. Also lasst uns diese zwei Tage in Frieden verbringen - so ungefähr. Aber obwohl ihre Gedanken noch vollkommen klar waren, hatte sie seltsamerweise Schwierigkeiten zu spreche…
Am Ende liegt Irina volltrunken neben der aufgeplatzten Gans auf dem Küchenboden und beleidigt die zu Hilfe eilende Catrin mit den Worten „Fass mich nicht an, du Aas“, worauf Alexander mit dem Ausspruch „So, das war’s“ (S. 370) einen Schlussstrich unter die familiäre Bindung zieht. Am Fest des Friedens und der Harmonie herrschen Streit und Chaos. Es kommt zum Zerwürfnis zwischen Sohn und Eltern und zur „Auflösung“ der Familie, gleichzeitig mit der Auflösung der Sowjetunion und der DDR.
17.3 Der Spaziergang als Symbol bürgerlicher Geselligkeit
Ein Symbol bürgerlicher Geselligkeits-/Familienkultur ist der Familienspaziergang. Galt im 18. Jahrhundert noch das Spazierenreiten oder -fahren als eine bevorzugte Bewegungsform, wertete man in der Folge der Aufklärung mit ihrer Entdeckung der Natur den Spaziergang auf und stufte ihn als gesünder ein: Frische Luft und Bewegung wurden empfohlen und galten/gelten als Gesundheitsvorsorge und Krankheitsvermeidung.780 Ab Mitte des 19. Jahrhunderts war er eine populäre und weit verbreitete Betätigung und wurde zumeist sonntags oder, wenn man es sich leisten konnte und die Zeit dazu hatte, abends oder mittags an den Wochentagen unternommen.
Das Flanieren durch den Park stärkte ähnlich der Landpartien, des Urlaubs und der Ferien bei Verwandten die Familienbande und ließ gleichzeitig Netzwerke knüpfen, die von Nutzen sein konnten. Zum Familienkreis gehörten nicht selten auch Kindermädchen, die die Kinder begleiteten, oder Handwerksgesellen.
(TM)
S. 285
An einem warmen und wolkenlosen Juli Nachmittag machte die Familie einen Spaziergang. Die Konsulin, Antonie, Christian, Clara, Thilda, Erika Grünlich mit Mamsell Jungmann und in ihrer Mitte Pastor Tiburtius zogen weit vors Burgtor hinaus…
Vorbild für das bürgerliche Flanieren war der Spaziergang des Adels, der damit seinen Rang höfisch inszenierte, wohingegen für die Bürger die Bewegung in der Natur körperliche und geistigen Regeneration bedeutete. Die Dichotomisierung der Bereiche Arbeit und Muße ließen den Spaziergang nicht wie beim Adel als Zeitverschwendung oder Müßiggang, sondern als verdiente Erholung nach der Arbeit definieren.781 In Abgrenzung vom steifen Bewegungsverhalten des Adels spielten Ungezwungenheit und Entspannung beim Bürger eine wichtige Rolle.
(TM)
S. 346
Erika jubelte über jede Krähe, die aufflog, und Ida Jungmann, die wie immer beim sichersten Wetter einen langen, offenen Regenmantel nebst Regenschirm trug, stimmte als eine richtige Kinderpflegerin, die auf die kindlichen Stimmungen nicht nur äußerlich eingeht, sondern sie ebenso kindlich mitempfindet, mit ihrem ungenierten und etwas wiehernden Lachen ei…
S. 349
Sie schöpften mit einem silbernen, zusammenschiebbaren Becher, den die Konsulin mitgebrachte hatte, aus dem kleinen, steinernen Bassin gleich unterhalb der Austrittsstellen und erquickten sich mit dem frischen, eisenhaltigen Wasser, wobei Herr Permaneder einen kleinen Anfall von Galanterie hatte, indem er darauf bestand, dass Frau Grünlich ihm den Trunk kredenzt…
Zunächst war es nur einer privilegierten Minderheit um 1800 gestattet, zu jeder Tageszeit im Schlendern und Spazieren ihre Klassenzugehörigkeit zu demonstrieren, während Kleinbürger nur den Sonntag wegen ihrer werktäglichen Arbeitszeiten als Spaziergangstag nutzen konnten. Später kam der Spaziergang als bürgerliches Vergnügen immer mehr in Mode und bot vielen Bürgern die Gelegenheit der Selbstdarstellung, des Sehens und des Gesehenwerdens.
Als Bürger grenzte man sich sowohl vom Adel als auch von den unteren Schichten ab: Den Spaziergang des Adels sah man als Müßiggang, den der Angehörigen der unteren Schichten, wie z.B. der Dienstmädchen, als Zeichen der Faulheit.782
Kennzeichnen des Spaziergangs wurde das langsame Schlendern und die aufrechte und selbstbewusste Haltung.
(TM)
S. 351
Vorm Gasthaus ward Ordre gegeben, dass in einer Stunde der Wagen bereit stehen solle, denn man wollte in der Stadt vor Tisch noch ein wenig ruhen können; und dann wanderten sie langsam, denn die Sonne brannte auf dem Staub, den niederigen Häusern des Fleckens z…
Der Spaziergang war ein Ort der Präsentation und der Begegnung von Mann und Frau. Man nahm die Erscheinung des anderen in Augenschein; gute Kleidung war eine Selbstverständlichkeit für den Spaziergänger, denn, wie autobiographische Zeugnisse zeigen, kam es nicht selten zur Kontaktaufnahme zum anderen Geschlecht.783
Begleitet wurde der Spaziergang dabei vom gegenseitigen angemessenen Begrüßungsverhalten in Form des Hut-Ziehens von Seiten des Mannes. Man erwies Jemanden die Reverenz.
(TM)
S. 348
Man grüßte sich erst, als Buddenbrooks in geringer Entfernung an der Gesellschaft vorüberstiegen. Die Konsulin neigte ein wenig zerstreut und gleichsam verwundert den Kopf, Thomas lüftete den Hut, indem er die Lippen bewegte, als sagte er irgend etwas Verbindliches und Kühles, und Gerda verbeugte sich fremd und formell. … Tony ihrerseits zog ein wenig die Schultern empor, legte den Kopf zurück, suchte trotzdem das Kinn auf die Brust zu drücken und grüßte gleichsam von einer unabsehbaren Höhe herab, wobei sie genau über Julchen Möllendopfs breitrandigen und eleganten Hut hinwegblickt…
Symbole in der Damenmode beim Spaziergang waren Accessoires, wie der Sonnenschirm und der Damenhut, der Arbeitsbeutel (Ridigül), eine Art Handtasche als Behältnis für Taschentuch und weitere persönliche Gegenstände wie Schlüssel und Handarbeiten, um sich stets die Rolle als Bürgersfrau, die für die Sphäre des Hauses zuständig war, in Erinnerung zu rufen.
(TM)
S. 353
Neben ihnen war ein Zaun, und daran lief ein langes, schmales Beet entlang, auf dem ein paar Reseden wuchsen und dessen lockere, schwarze Erde Frau Grünlich, geneigten und etwas erhitzten Hauptes, ungeheuer eifrig mit der Spitze ihres Sonnenschirm pflügt…
Der Spaziergang umfasste im 19. Jahrhundert nicht nur das Gehen an sich, sondern bezog sich zugleich auf den Ort des Spazierens: Ein Spaziergang im eigenen Garten mit Gästen, mit denen man plauderte, verband die natürliche Umgebung mit geselligen Umgangsformen. Aber auch Promenaden, Alleen oder Wege durch die Natur wurden als Sehnsuchtsorte neu entdeckt und gedeutet, schwärmerisch und genießend: „Die bürgerliche Landschaftsarchitektur war primär eine Architektur derWege, die den Spaziergänger in seiner Eigenbewegung, die ihn die Natur entdecken lassen sollte, leiteten.“784 Diese angelegten Wege zogen sich durch das Gelände und präsentierten die sie umgebene Natur.
(TM)
S. 349
Der schattige Waldweg wurde eben, und es dauerte gar nicht lange, bis sie die „Quelle“ erreicht hatten, einen hübschen, romantischen Punkt mit einer hölzernen Brücke über einen kleinen Abgrund, zerklüfteten Abhängen und überhängenden Bäumen, deren Wurzeln bloß lage…
Bezogen auf den in Lübeck spielenden Roman der Buddenbrooks nutzte man die Gegend vor dem Burgtor in Lübeck mit Rasenflächen und schattigen Allen für Spaziergänge, um zu promenieren. Die Bürger gingen damals die alte Lindenallee in Richtung Travemünde, zum Jerusalemberg und zur Aussicht über die Trave-Niederung und Israelsdorf mit Kaffeegärten zum Fischerdorf Gothmund. Vor dem Mühlentor fanden sich Obst- und Gemüsegärtnereien. Schwartau mit seinen Jahrmärkten und seinem Buchenwald war das Ziel der Katharineer, die dort im Sommer ruderten.
Tony B.und Permaneders Verlobung findet hier statt.
S. 346
Man war im Oldenburgischen. Buchenwaldungen kamen in Sicht, der Wagen fuhr durch den Ort, über das Marktplätzchen mit seinem Ziehbrunnen, gelangte wieder ins Freie, rollte über die Brücke, die über das Flüsschen Au führt…
Die Veränderung des Spaziergangs steht in Beziehung zu den sozialen und kulturellen Veränderungen seit dem 19. Jahrhundert: Er demonstrierte keine Schichtenzugehörigkeit mehr, sondern wurde zu einer Selbstverständlichkeit. Bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts gehörte zwar das Hutziehen bzw. die Berührung des Hutes noch zum Höflichkeitsritual, beides verschwand aber mittlerweile aus dem Straßenbild.
(ER)
Sowohl für Kurt als auch für Irina hat der gemeinsame Spaziergang eine besonders familiäre Bedeutung. Er erinnert sie an das innige Zusammensein mit Sascha:
S. 63
Anschließend würden sie zusammen zur Geburtstagsfeier gehen - eine erträgliche, ja beinahe angenehme Vorstellung, jedenfalls soweit sie den kleinen Spaziergang durch das herbstliche Neuendorf betraf, eine Vorstellung, die geeignet war, noch fernere, noch unwahrscheinlicherer Erinnerungen heraufzubeschwören, Erinnerungen an eine Zeit,.. als Sascha noch an der Hand neben ihr hertrippelt…
Zusammen mit seiner Frau bedeutet es für ihn Kommunikation und emotionale Nähe, für Irina hingegen ist es ein Zeitfresser.
S. 70
-Aber nach dem Frühstück gehen wir ein bisschen spaziere…
Irina nahm sich ebenfalls ein Brot aus dem Korb, beschmierte es mit Butter und Käse, rechnete durch, wie viel Zeit ihr zum Spazierengehen blieb, wenn sie das Russenmagazin einsparte. Andererseits: Sie hatte keine Lust spazieren zu gehen, schon gar nicht mit Kurt, der immer vorneweg rannte. Auch hatte sie gar keine passenden Schuh…
Der tägliche Spaziergang von Kurt stand im Zusammenhang mit seiner schriftstellerischen Tätigkeit und hatte stets die Post zum Ziel:
S. 31
Sie gingen Kurts Runde zur Post, wie es früher hieß, obwohl der Weg zur Post nur ein Bruchteil von Kurts täglicher Strecke war; dennoch hatte Kurt sich stets mit den Worten ,Ich geh mal zur Post' zu seinem Spaziergang abgemeldet - und auch als er längst nichts mehr zur Post zu bringen hatte, fuhr er fort, zur Post zu gehe…
In späteren Jahren, zur Zeit der Demenzerkrankung von Kurt, wird der Spaziergang ein Abschlussritual des Besuchs, das Kurt einfordert:
6. 31
… Kurt rannte schon zur Tür wie ein Hund, der die Regeln kennt und sein Recht forder…
In Mexiko zieht Alexander das Laufen dem Spaziergang wegen der topographischen Gegebenheiten vor:
S. 413f
Anfangs hat er es mit Spaziergängen versucht. Aber bald stellte sich heraus, dass die Gegend kaum für Spaziergänge geeignet ist. Das Hinterland, das er schon aus dem Taxi gesehen hat, ist kaum verlockend. Einzig der Strand würde zum Spazierengehen einladen, wenn nicht die einzelnen Buchten durch unüberwindliche Felsen voneinander getrennt wären. Man kommt nur auf der Straße von Bucht zu Bucht, und die Straße ist langweilig. Also läuft e…
(AG)
Geigers Roman zeigt, dass Familienzentrierung in Bezug auf Freizeitaktivitäten je nach Alter der Kinder intensiv oder, wie in der Zeit der Adoleszenz, weniger intensiv ist. Die Freizeitaktivitäten der Kinder haben sich im Vergleich zu früher gewandelt, Spielgruppen aus der Nachbarschaft fehlen, und das Verkehrsaufkommen ist gewachsen und draußen zu spielen stellt eine Gefährdung dar.
Bei Philipp und seiner Schwester begleitet die Mediennutzung durch Fernsehen und Telefon die Verhäuslichung (um ein Schlagwort aus der Gegenwart aufzugreifen) des Kinderspiels.785 Ingrid unterbricht dies durch Bewegung und Aktivität beim einem Spaziergang - ein Ausgleich zum passiven Freizeitverhalten.
S. 255
Wer Lust habe, sich auszulüften, solle bis in fünf Minuten gerichtet sei…
17.4 Bürgerliche Vereinskultur
In den Romanen begegnen uns Familien nicht als eine isolierte Gruppe, stattdessen stehen sie im Austausch mit anderen Menschen und mit der Umwelt. Diese Beziehungen und Beziehungsnetze sind ein soziales Kapital der Familie und zeigen einerseits den
Status der Familie, (Buddenbrooks) andererseits bedeutet ein Beziehungs- und Freundeskreis Geselligkeit, Information, gegenseitige Hilfe und Unterstützung. (Umnitzer)
Seit den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts konstituierten sich neue typische Institutionen des bürgerlichen Beisammenseins wie Klubs, Freimaurerlogen und gemeinnützige Vereine. Durch diese Vereine entwickelten sich informelle Strukturen für Mitglieder, die auf Reputation wie Besitz und Bildung Wert legten. ( siehe: Kap.13.3)
Einflussreich und tonangebend waren dort Familien und Berufe mit langer Tradition, ratsfähig, seit Generationen mit einem Netzwerk an Beziehungen und einem hohen Sozialprestige ausgestattet, darunter auch innovative Unternehmer vor dem Hintergrund allgemeiner Fortschrittsbegeisterung, (TM) wie z.B. Hermann Hagenström: S. 316
„Ja. - Man hat mir in der Harmonie von einer Bemerkung erzählt, die du gestern Abend im Klub hast fallen lassen, und die so deplaciert, so über alle Begriffe taktlos war, dass ich keine Worte finde. Die Blamage hat nicht auf sich warten lassen. Es ist dir eine klägliche Abfertigung zuteil geworden. Hast du Lust, dich zu erinnern?…
„Ja, Tom, ich muss dir sagen. Ich habe mich für Hagenström geschämt!…
„Du sagst in einer Gesellschaft, die sowohl aus Kaufleuten als aus Gelehrten besteht, das Alle es hören können: Eigentlich und bei Lichte besehen sei doch jeder Geschäftsmann ein Gauner…
„., aber du hast ja gesehen, wie der Spaß verstanden worden ist! ,Ich meinerseits halte meinen Beruf sehr hoch', hat Herr Hagenström dir geantworte…
Bereits kurz nach 1800 gab es sog. „Casinos“. In ihnen verkehrte die wohlhabende und gebildete Oberschicht, das Wirtschafts- und Bildungsbürgertum der Stadt, dominiert von den kaufmännischen Eliten. Wohlhabende einflussreiche Kaufleute trafen sich mit Fabrikanten, Aufsteigern, Beamten und Ärzten, die eines verband: Für alle zählte Bildung, beruflicher Erfolg und wirtschaftliche Unabhängigkeit. Man erörterte soziale, ökonomische, wissenschaftliche Zeitprobleme, tauschte sich zwanglos aus, diskutierte Neuigkeiten und pflegte den geselligen Umgang.786
Vereine und Clubs wurden besonders für das Bildungsbürgertum ein Forum ihrer sozialen, kulturellen und politischen Aktivität. Für die wohlhabenden Kaufleute und das Wirtschaftsbürgertum waren daneben Wohltätigkeit und die Teilnahme am öffentlichen Leben und in der städtischen Verwaltung von großer Bedeutung.
(TM)
Christian B.verbringt dort einen Großteil seiner Zeit:
S. 448
Dann und wann, wenn im „Klub“ niemand anwesend gewesen war, erschien auch Christian, nahm ein Gläschen Benediktiner, erzählte…
Man kann heute zurecht sagen, dass sich die Geschichte des Bürgertums in der Geschichte der Vereine widerspiegelt: Mit der Gründung eines Netzes aus Musik-, Kultur-, Kunst- und Naturkunde-Vereinen strebten die führenden, meist politisch engagierten Besitz- und Bildungsbürgern eine Neuordnung der Gesellschaft an.787 Ein Engagement in diesen Vereinen verbreitete Bildung in Literatur, Kunst und Wissenschaft. In ihnen tauschte der Bürger sich aus und entfaltete, indem er seinen Wissenshorizont erweiterte und gleichzeitig Freundschaften im Umgang mit anderen pflegte, seine Persönlichkeit. Das dortige Netzwerk von Beziehungen festigte die sozialen Kreise national und global. Nicht selten bestimmten Informationen aus den Vereinen das Ansehen einer Familie, (TM)
wie in der Familie Buddenbrook, als ihnen zugetragen wird, dass ihr Sohn Christian einer Schauspielerin mit Blumen die Aufwartung macht:
S. 81
In einer Pause nämlich erstand er im gegenüber liegenden Blumenladen für 1 Mark 8 1/1 Schilling ein Bouquet, mit welchem dieser vierzehnjähriger Knirps, vor einer Garderobentür auf Fräulein Meyer-de la Grange stieß, die im Gespräche mit Konsul Peter Döhlmann stand. Der Konsul wäre vor Lachen beinahe gegen die Wand gefallen, als er Christian mit dem Bouquet daherkommen sah…
Dies war der Tatbestand, den Peter Döhlmann am selben Abend im „Klub“ zum besten ga…
Mitgliedschaft in einem Verein bedeutete immer a k t i v e Mitwirkung in diesem Verein. S. 362
… und es folgten bis in den Abend hinein eine Menge an Arbeiten: handelte es sich um Geschäft oder um Zoll, Steuer, Bau, Eisenbahn, Post, Armenpflege, auch in Gebiete, die ihm eigentlich fernlagen.Er hütete sich, das gesellige Leben zu vernachlässige…
Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurden die exklusiven Geselligkeitsvereine zum dichten Geflecht vielfältiger bürgerlicher Organisation und halfen, dass sich bürgerliche Identität zusehends entfaltete.
Die Vereine waren täglich geöffnet und verfügten über Gesellschafts- und Spielzimmer, Billard- und Kartentisch, und über eine Bibliothek mit ausliegenden wissenschaftlichen Zeitungen aus dem In- und Ausland zur Information für die Mitglieder (was für die Ausweitung des Pressewesens von großer Bedeutung war).788 Herzstück der stadtbürgerlichen Vereinskultur bildete ein großer Festsaal.
(TM)
Thomas B. und mehr noch Christian sind regelmäßig mit anderen Mitgliedern der „guten Gesellschaft“ im Club, um dort zwanglos zu kommunizieren: S. 542
… und während drüben im Saale dem kleinen Hanno die Zeit schnell wie im Himmelreiche verging, lagerte im Landschaftszimmer eine schwere, beklommene, ängstliche Stille, die noch fortherrschte, als um halb 9 Uhr Christian aus dem Klub, von der Weihnachtsfeier der Junggesellen und Suitiers zurückkehrt…
Ein überregionales Vereinsleben bildete sich in den Freimaurerlogen und den Turner- und Burschenschaften heraus - ebenfalls mit der Tendenz zur Exklusivität.
In Europa ganz und in den USA entstanden in diesem Rahmen Vereinigungen mit der Intention der sittlich-moralischen Verbesserung des Menschen,789 in denen insbesondere die Verhinderung negativer Einflüsse als ein Vereins-Prinzip galt, das hieß: „[der] kritische Blick auf die Masse und die Bewahrung der individuellen Persönlichkeit“790 standen im Zentrum. Wirtschaftsbürgertum und Teile des Bildungsbürgertums demonstrierten hier soziales Handeln und ein Verantwortungs- und Bindungsbewusstsein für das eigene gesellschaftliche und soziale Umfeld der Stadt: Man stiftete oder spendete größere Summen für öffentliche Zwecke, für Bildungs- und soziale Institutionen wie Krankenhäuser oder Waisenhäuser, für kulturelle Einrichtungen wie Theaterneubauten (Mäzenatentum) und schuf Bibliotheken, Museen, Konzerthallen, in denen der gebildete Bürger heranwuchs. Auf diese Art setzte man Wohltätigkeit durch karitative Aktionen in die Tat um und unterstützte durch Kollekten den städtischen Armenfond.
Der Austausch über Vorträge, Literatur und Diskussionen, über alles, was dem Bürger als Mittel zur intellektuellen und moralischen Verbesserung galt, förderte die zweckfreie und allgemeine Bildung und ästhetische Kultur.
(TM)
S. 315
Konsul Buddenbrook kehrte aus der „Harmonie“, dem Lesezirkel für Herren, in dem er nach dem zweiten Frühstück eine Stunde verbracht hatte, in die Mengstraße zurüc…
Jeder Verein besaß seine eigene Verfassung und Satzung und wurde von einem Vorstand vertreten, den man in der Jahreshauptversammlung wählte. Statuten fixierten die Rechtsgleichheit der Mitglieder, den freiwilligen Ein- und Austritt und die freie und geheime Wahl der Mitglieder und des Vorstandes.791 Eine Generalversammlung des Vereins erörterte Fragen im vereinseigenen Clublokal und brachte sie zur Abstimmung.
Die finanzielle Basis bildeten die Aufnahmegelder der Neumitglieder und die Mitgliedsbeiträge, dem gegenüber standen Ausgaben für Möbel und Reparatur, Beleuchtung und Miete.792
Und so wurde man Mitglied im Club oder im Verein: Altmitglieder konnten einen Antrag auf Neuaufnahme eines männlichen und beruflich einflussreichen Kandidaten vorschlagen, womit bereits eine Selektion stattfand, denn eine Kooption/Empfehlung durch Vereinsmitglieder bewahrte ebenso wie die hohen Aufnahmegebühren die Exklusivität des Vereins.
In geheimer Abstimmung erfolgte die Aufnahme eines Kandidaten nach bestimmten Aufnahmekriterien, die da waren: Bildung, Besitz und öffentliches Engagement. Das Leistungsprinzip, konstituierend für das Bürgertum, galt als ein wichtiges Auswahlkriterium, der Verstoß gegen ethisch-moralische Prinzipien bedeutete ein Ende der Mitgliedschaft.
Der männliche Bewerber musste volljährig und bis 1830 noch von christlicher Konfession sein, Unbescholtenheit galt als Garant für kaufmännische Seriosität.
Die Zahl der ordentlichen Mitglieder betrug in kleinen Vereinen 100, in großen 400 oder 500 Männer. Gäste erhielten Fremdkarten mit begrenzter Gültigkeit, Familienangehörige konnten zu besonderen Anlässen in die Clubräume mitgebracht werden.793
Das bürgerliche Prinzip „Bürgersinn“, ein Engagement für das Wohl des Ganzen im Verein, entfaltete sich mit der Zeit auch in den anderen Schichten: Handwerker gründeten Gewerbe- und Hilfsvereine für berufliche Zwecke und waren im Gesangs- und Turnverein aktiv, einfachere Bürger sammelten sich ebenfalls dort und in sog.„Bürgervereinen“ Durch deren Verbreitung drangen freiwillige Assoziationen mit demokratischen Spielregeln, die irgendwann dann allen Bürgern offen standen, immer weiter vor.
Frauen jedoch blieben aus dem wirtschaftlichen und öffentlich-gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Sie erhielten Zugang in die Vereine nur zu besonderen Anlässen, z.B. bei Tanzveranstaltungen, die zum Repertoire vieler Vereine gehörten. Sie hatten ihre eigenen Frauenvereine in den Städten mit dem Schwerpunkt des sozialen Engagements.794 Im Zuge der Erweckungsbewegung wurden sie in der Armenpflege aktiv, ein Beispiel ist der von der Senatorentochter Amalie Sieveking 1832 gegründete „Weibliche Verein für Armen- und Krankenpflege“ für (unverheiratete) Frauen aus der Oberschicht.795 Frauen waren hier öffentlich wirksam und hatten Leitungs- und Repräsentationsaufgaben inne, was allgemein als tolerabel galt, denn diese Tätigkeit entsprach dem traditionellen Frauenbild und stellte die gesellschaftliche Stellung der Frau nicht infrage. Konsulin Buddenbrook ist dafür ein Beispiel:
S. 560
Sie, die ehemalige Weltdame, mit ihrer stillen, natürlichen und dauerhaften Liebe zum Wohlleben und zum Leben überhaupt, hatte ihre letzten Jahre mit Frömmigkeit und Wohltätigkeit erfüll…
In den 1880er Jahren setzte ein Niedergang der ursprünglichen bürgerlichen Vereine ein. Gründe lagen vor allem in der Verlagerung der Geselligkeit in die Privathäuser und in der Entstehung konkurrierender, sich spezialisierender Vereine wie den politischen und konfessionellen Vereinen oder den vielfältigen Sport-, Kunstvereinen.
18. Dienstboten/-mädchen in bürgerlichen Haushalten
Und die einen sind im Dunkeln. Und die andern sind im Lich…
Und man siehet die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nich…
(Bertold Brech…
Ein Merkmal bürgerlicher Lebenshaltung in einem mittelständisch-bürgerlichen Haushalt war die Dienstbotenhaltung, wiederum angelehnt an die Aristokratie. Mittlere und kleine Beamte/ Kleinstunternehmer waren es ihrer Stellung und Bildung, ihrem Lebensstil schuldig, ein Dienstmädchen zu haben.
Einmal mehr gilt das Halten eines Dienstmädchens als Beweis für die Bürgerlichkeit der Familien in den Romanen. In allen drei Romanen finden wir Dienstmädchen, in zwar gewandelten Familien, aber mit ähnlichem Muster,
Die Begriffe „Dienstbote“, „Dienstmädchen“ spiegeln eine Abhängigkeit wieder, die typisch für die feudal-ständische Gesellschaftsordnung war und die durch die Feudalisierung der bürgerlichen Haushalte eine Kontinuität erfuhren. Das Zeitalter der „Gesindeordnung“ endete 1918/19 und führte den neuen Ausdruck der „Hausangestellten“ ein.
Im Jahre 1849, der Zeit der Buddenbrooks, waren 4% der Bevölkerung im Deutschen Reich in häuslichen Diensten.796
Ein Dienstmädchen zu haben bzw. „Gesinde“ zu beschäftigen, war ein bürgerliches Statussymbol und demonstrierte den überlegenen Status der Oberschicht. Wer es sich leisten konnte, die körperliche Arbeit zu verdrängen und ein von Arbeit befreites Leben mit der Familie zu führen, leistete sich als Prestigeobjekt ein Dienstmädchen, denn: Körperliche Arbeit im Haushalt galt dem Bürger als unstandesgemäß und die Freistellung von der körperlichen Arbeit stellte ein wichtiges Kriterium zur Abgrenzung von der arbeitenden Klasse dar.
Für die Bürgerfrau waren Dienstmädchen unverzichtbar, Personal entlastete Frauen und Jugendliche. „Diese klassenbedingte Entlastung ist deshalb so wichtig, weil sie die Voraussetzung der bürgerlichen Kultur- und Bildungsorientierung gewesen ist.“ 797 Leistungsfähige Dienstboten waren zwingend, um den eigenen Ansprüchen des Hauhalts gerecht zu werden und selber Freiheiten für andere Aktivitäten sozialer und politischer Art zu bekommen. Neben ihrer Tätigkeit im Haus hatte die Ehefrau die Pflicht zu repräsentieren, und hierbei nahm die Bedienung durch Dienstmädchen einen breiten Raum ein.
Auch wenn die damaligen Pädagogik erwartete,798, dass sich die bürgerlichen Mütter um die Kinder kümmerten, waren es eher Kindermädchen, die diese beaufsichtigten und mit ihnen spazieren gingen, wie bei Tony Buddenbrook:
(TM)
S. 198
„. Der Haushalt nimmt mich in Anspruch! Ich wache mit zwanzig Gedanken auf, die tagsüber auszuführen sind, und gehe mit vierzig zu Bett, die noch nicht ausgeführt sind…
„Es sind zwei Mädchen da. Eine so junge Frau…
„Zwei Mädchen, gut. Thinka hat abzuwaschen, zu putzen, reinzumachen, zu bedienen. Die Köchin ist über und über beschäftigt. Du isst schon am frühen Morgen Koteletts. Denke doch nach, Grünlich! Erika muss über Kurz oder Lang jedenfalls eine Bonne, eine Erzieherin haben…
(AG)
Alma spielt mit dem Kind, das Dienstmädchen Frieda geht ihr zur Hand und übernimmt die notwendige Arbeiten:
S. 75
Als von hinter dem Haus Alma mit der weinenden Ingrid am Arm kommt, verstellt er die Lehne um mehrere Kerben nach vorn, so dass er jetzt beinahe sitzt. ..In dem Moment tritt Frieda aus der Verandatür, ein Bier in der Hand, über das ein Glas gestülpt ist. Nachdem sie Richard das Bier gereicht hat, hilft sie Alma mit Ingrid, die vor Anstrengung rot angelaufen ist ,deren Weinen jetzt aber nachlässt…
Ingrid versteckt sich im Kittel von Fried…
(ER)
Charlotte engagiert sich beruflich und hat Hilfe von einer Bediensteten im Haushalt, sowohl in Mexiko als auch später in Berlin. Im Alter gilt ihre Hauptbeschäftigung der Organisation des Haushalts im nun allzu großen Haus und der Versorgung ihres Mannes. S. 36ff
Die Redaktionssitzung war einmal die Woch…
Sie besprach mit Gloria, dem Hausmädchen, den Speiseplan für die kommende Woche, sah Rechnungen durch und goss ihre Blume…
S. 399
- Wir haben jetzt wirklich Wichtigeres zu tun, sagte Charlotte. In der Küche steht noch das ganze Geschirr. Und der Abendtee für Wilhelm muss auch allmählich aufgebrüht werden, sonst beschwert er sich wieder, dass er zu heiß is…
Dienstbotenhaushalte waren städtische bzw. großstädtische Haushalte in den mittelständischen Haupt- und Großstädten, seltener in den Industriestädten: (TM) Lübeck, (AG) Wien, (ER) Mexiko und Berlin
Diese Städte boten Mädchen eine Verbesserung der sozialen Situation an, versprachen Aufstieg und Abenteuer und wurden zum Ziel einer Dienstmädchenwanderung. Mädchen zogen die saubere Hausarbeit und die günstige Arbeitszeit in der Stadt der Arbeit auf dem Land vor, wohingegen eine Arbeit in der Fabrik als Männerarbeit galt und im Ruf der Unanständigkeit stand.
Gerne wechselte das ländliche, weibliche Gesinde darum in die Dienste der Stadtherrschaften und bevorzugte die Vorteile und Annehmlichkeiten der städtischen Lebensweise - nicht zuletzt auch als Heiratsmarkt.799
Mit solch einer Tätigkeit als Dienstmädchen verband die gesamte Familie des Mädchens die Aussicht auf Statusverbesserung, auf soziale Sicherheit mit Aufstiegsmöglichkeiten und eine Eheperspektive für die Tochter, womöglich in einen hohen Stand.
(AG)
Familie Sterk wohnt in Wien und steht in der Tradition des alten Wiens, einer Stadt der Dienstboten (Domestiken), die lange Zeit am Hofe, in ersten Fürstenhäusern und bei vermögenden Bürgern und Kanzleimännern zu finden waren. Ihre Kleiderordnung verriet, wieviel Reichtum und Einfluss ihre Herrschaften hatten.
Dies findet sich in Österreich bis ins 20. Jahrhundert: Die Mitglieder der Familie Sterk sind ein Beispiel für Herrschaften, die in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, als die Arbeitslosigkeit wegen der Wirtschaftskrise höher wurde, einem Dienstmädchen dennoch ausreichend Lebensmittel und gute Wohnverhältnisse bieten konnten.
18.1 Die Herkunft der Dienstmädchen
Das Familienleben der Bürger basierte auf die Mithilfe von Menschen, die aus einem gänzlich anderen Milieu stammten. Wer waren diese Dienstboten genau, und warum reduzierte sich ihre Zahl irgendwann so exorbitant?
Mädchen und Frauen zogen aus der ländlichen Unterschicht, aus Bauern- und Handwerkerhaushalten, in die Städte. Dort verbrachten sie dann die nun folgenden Jahre ihres Dienstbotendaseins nicht mehr in der Herkunftsschicht sondern in sozial höheren Schichten, um die Hausarbeit für Familien des mittleren und gehobenen Bürgertums zu verrichten. Mit ihrer Heirat kehrten sie zumeist in ihre Herkunftsschicht zurück.800
Grund ihrer Landflucht waren die engen Wohn- und Lebensbedingungen, die schlechten hygienischen Verhältnisse und die nur notdürftige Ausstattung der dortigen Wohnungen. Die Mädchen erfuhren im elterlichen, meist bäuerlichen Haushalt große Armut. Sie wuchsen in Familien auf, die erwarteten, dass ihre Arbeit die ökonomische Grundlage des Haushalts sicherte.801 (Männliche Diener stammten aus ähnlichen familiären Verhältnissen.)
Die berufliche Zukunft dieser Mädchen entschied sich nach der Schulentlassung. Bereits als Kinder hatte man sie in das bäuerliche Erwerbs- und Arbeitsleben der Familie eingespannt, sie landwirtschaftliche Arbeiten auf dem Feld verrichten und bei der Ernte und beim Anbau von Getreide und Rüben helfen lassen. Eine weitere Arbeit im elterlichen Haus oder der Besuch der Haushaltungsschule konnte zumeist nicht mehr finanziert werden, das Geld, was zur Verfügung stand, investierte man lieber für eine Ausbildung der Söhne. Mangels Alternativen suchten zumeist Mütter für ihre Tochter den Beruf des Dienstmädchens aus, verbunden mit der Hoffnung, diese möge durch ihre Tätigkeit elterliche Aufstiegswünsche realisieren.
Als Familienernährerin unterstützten sie mit ihrem Lohn regelmäßig die Familie, so dass der Kontakt zur Herkunftsfamilie stets noch gegeben war. Mit der Entfernung konnte er zwar schwieriger aufrecht erhalten werden, blieb aber, insbesondere als wichtige Schutzfunktion, bestehen, wenn die Tochter wegen Krankheit oder Kündigung wieder nach Hause geholt wurde.802 (TM)
S. 12
Als daher eines Tages seine Kinder von einer Reise nach Westpreußen dies junge Mädchen - sie war erst jetzt zwanzig Jahre alt - als eine Art Jesuskind mit sich ins Haus gebracht hatten, eine Waise, die Tochter eines unmittelbar vor Ankunft der Buddenbrooks in Marienwerder verstorbenen Gasthofsbesitzers, …
(AG)
S. 61
Lediglich Frieda ist noch auf … Sie sitzt in der Küche an dem mit Blech überzogenen Arbeitstisch und schreibt an einem Brie…
S. 63
… und Frieda ihm währenddessen die Namen ihrer zwölf Geschwister psalmodier…
S. 68
… diese Verschrecktheit aus Heimweh und der Unfähigkeit zu einem halbwegs normalen Deutsc…
Eine heimatlich-familiäre Arbeitserfahrung hatten die Mädchen bereits, wenn sie in die bürgerliche Familie wechselten, und auch ihre bisherige Erziehung zum Gehorsam bereitete sie auf das Funktionieren im späteren Beruf vor. Ihre Mütter hatten Gehorsam gefordert, sie gelehrt und ihnen vorgelebt, wie wichtig Tüchtigkeit ist und ihre Töchter dazu erzogen, nicht zu klagen, sondern Tätigkeit und Kampf zu zeigen, die Zähne zusammenzubeißen und gute Arbeit zu leisten. Die Mädchen internalisierten schon früh Verhaltensnormen wie die der Anpassungsbereitschaft, der Anerkennung von Überlegenheit, z.B. der Lehrpersonen und der selbstverständlichen Erfüllung von Befehlen - alles verbunden mit Bedürfnislosigkeit, aus dem Wissen heraus, am unteren Ende der Hierarchie zu stehen.
Ähnliches traf auf die Söhne der ländlichen Bevölkerung zu:
S. 76
„. Man bekommt einen braven und anspruchslosen Mann vom Lande…
Tüchtigkeit und Ehrlichkeit galten viel in einem bürgerlichen Haushalt und wegen des guten Rufs dieser Mädchen vom Land, ihrer Arbeitsamkeit und moralischen Tugend wurden speziell sie von der städtischen Dienstherrschaft bevorzugt. Erfüllten sie die Erwartungen, fand dies später im Zeugnis Erwähnung.
Dienstmädchen als Figuren im Roman zeigen eine Unbedarftheit, ihr Denken und Verhalten grenzt nach Ansicht mancher Hausfrau oder manches Hausherren an Dummheit:
(TM)
S. 175
Trina, die Köchin Trina, ein Mädchen, das bislang nur Treue und Biedersinn an den Tag gelegt hatte, war plötzlich zu unverhüllter Empörung übergegangen. Zum großen Verdrusse der Konsulin unterhielt sie seit einiger Zeit eine Freundschaft, eine Art von geistigen Bündnis mit einem Schlachtergesellen, und dieser ewig blutige Mensch musste die Entwicklung ihrer politischen Ansichten in der nachteiligsten Weise beeinflusst habe…
Als die Konsulin ihr wegen einer missratenen Chalottensauce einen Verweis hatte zu Teil werden lassen, hatte sie die nackten Arme in die Hüften gestemmt und sich wie folgt geäußer…
„Warten Sie man bloß, Fru Konsulin, dat duert nu nich mehr lang, denn kommt ne annere Ordnung in die Saak; denn sitt ick doar up’n Sofa in’siednen Kleed, und Sei bedeinen mich denn.“(AG) S. 61
Lediglich Frieda ist noch auf, das Kindermädchen . sie sitzt in der Küche an dem mit Blech überzogenen Arbeitstisch und schreibt an einem Brief. Während sie ihre Schleifen malt, murmelt sie jedes Wort Silbe für Silbe vor sich hi…
S. 68
-Vor die Soldaten ist man im Moment nirgends sicher, sagt sie, kichert verlegen, ihr Busen hebt und senkt sich schneller als sonst. wenn sie ihre Plumpheit verlie…
(ER)
S. 129f
Um zehn kam Lisbeth. Wie immer pflegte Lisbeth alle Fragen, auch die bereits geklärten, fünfmal zu stellen . nein, Lisbeth, es wird nicht staubgesaugt, wenn ich im Haus bin . Ja, heute Wäsche . Ja, Mittagessen um eins…
Aber Lisbeth war sowieso zu tum…
Das Verhalten von Charlottes Dienstmädchen Lisbeth ist im Grunde aber pragmatisch und ganz und gar nicht dumm:
5. 398f
- Was machst du denn da, fragte Charlott…
Ohne ihre Frage zu beantworten, sagte Lisbet…
- Sag mal, Lotti, haben wir nicht noch mehr Plastebehälter in der Küch…
- Ach was, Plastebehälter sagte Charlotte. Das kommt alles auf den Mül…
- In den Müll…
- Aber das ist doch schade, Lotti! Dann nehm ich es mit, wenn du’s nicht haben wills…
- Ach was, mitnehmen…
Noch immer war von Lisbeth nur der Hintern zu sehen. Allmählich kam es Charlotte vor, als spräche sie mit Lisbeths Hinter…
Dienstboten (insbesondere Ammen) stellten nach Ansicht der Oberschicht ein Risikofaktor in der Erziehung der eigenen Kinder dar. Man wollte das Ungebildete und Rohe des Volkes von den Kindern fernhalten und sah den Einfluss des Dienstpersonals oftmals kritisch: So beinhaltet „der Begriff des Ammenmärchens“ etwas Verächtliches, Unglaubwürdiges und Abergläubisches.
(TM)
S. 245
… auch der Onkel, welcher am Schluckauf zu Grunde gegangen war, hatte mit dreißig Jahren schon weißes Haar gehabt…
Der Beruf des Dienstmädchens war in der Regel ein Übergangsberuf und galt als ein „Eheerwartungs- und -vorbereitungsberuf[..]“. 803 Für lediglich 1 bis 5% der Frauen stellte er ein Lebensberuf dar. Auch wenn der Traum von der Heirat eines Dienstherren oder dessen Sohn in den Köpfen so mancher Dienstmädchen existierte, kam der Ehemann doch zumeist aus der ungelernten oder qualifizierten Arbeiterklasse, oder war ein im öffentlichen Dienst tätiger Arbeiter. Nach der Heirat machte die Vorstellung von Stabilität und Sicherheit in einer Geborgenheit und Versorgung schenkenden Ehe804 es nicht möglich, diesen Beruf weiter auszuüben, da er zu viel Zeit und Arbeitskraft erforderte.
Das Kennenlernen herrschaftlicher Verhältnisse führte bei den Mädchen, eben weil sie aus dem oben beschriebenen kleinbürgerlichen, ländlichen und rückständigen Milieu stammten, zu einer Verbürgerlichung ihrer Gewohnheiten und einer konservativen Gesinnung.805 Sie wurden in den Familienverband aufgenommen und bekamen mit der Zeit ein Selbstwertgefühl, das sie selbstbewusster machte - auch wenn ihr besonderer Status als Dienstmädchen trotz der persönlichen Beziehung zum Dienstgeber stets gewahrt blieb. Man darf nie vergessen, dass die Garantie ihrer sozialen Sicherheit verbunden war mit einem Mangel an Freiheit und dem Angewiesensein auf die Freundlichkeit der Herrschaften.
(TM)
S. 246
Aber Ida Jungmann hielt auch auf sich. Sie wusste, wer sie war, und wenn auf dem Mühlenwall sich ein gewöhnliches Dienstmädchen mit ihrem Zögling auf der selben Bank niederließ und von gleich zu gleich ein Gespräch beginnen wollte, so sagte Mamsell Jungmann: „Erikachen, hier zieht’s“, und ging von danne…
Frau Jungmann, als langjährige treue Dienstbotin der Buddenbrooks, bindet sich an die Herrschaftsfamilie und ignoriert ihre eigenen Zukunftspläne, gibt ihre Identität für die der Herrschaft auf.
S. 246
Jede Dame sagte zur Konsulin Buddenbrook oder ihrer Tochter: „Was für eine Mamsell haben Sie, Liebe! Gott, die Person ist goldeswert, was ich Ihnen sage! Zwanzig Jahre!, und sie wird mit sechzig und länger noch rüstig sein!…
Die Hingabe an ihre Arbeit und ein besonderer Arbeitsstolz wurden zu den zwei entscheidenden Wertvorstellungen der Dienstmädchen, und nicht selten kam es zu Machtansprüchen als Preis für die gute Arbeit, so wie bei Ida Jungmann gegenüber Gerda Buddenbrook:
(TM)
S. 699
… und zu seiner Mutter stand sie, lange schon, in einem ziemlich unangenehmen Verhältnis. Sie hatte diese Frau, die weit später in die Familie eingetreten war, als sie, eigentlich niemals recht als zugehörig und vollwertig angesehen und begann andererseits in vorgerückten Jahren mit dem Dünkel einer alten Dienerin sich selbst übertriebene Befugnisse anzumaßen. Sie erregte Anstoß, indem sie ihre Person als allzu wichtig betrachtete, indem sie sich im Haushalte dieses oder jenes Übergriffes schuldig macht…
Gleiches spiegelt sich im Gespräch zwischen Lisbeth, dem Hausmädchen, und Charlotte wider:
(ER)
S. 402
- Hast du noch ein paar Plastebehälter mitgebracht?, fragte sie. In der Hand hielt sie ein Würstche…
- Ach was, Plastebehälter, sagte Charlotte. Das kommt auf den Mül…
- Das kommt nicht in den Müll, sagte Lisbeth und biss in die Wurs…
S. 404
- Und was mache ich jetzt? Lisbeths Stimme. Soll ich den ganzen Mist wieder einsammel…
- Du gehst jetzt nach Hause, sagte Charlotte.…
- Aber Lotti, was soll denn das? Ich kann doch nicht…
18.2 Das Arbeitsverhältnis des Dienstmädchens
Dienstmädchen wurden zur Zeit des Bürgertums bereits mit 14 Jahren in eine Stellung gegeben und an den neuen Haushalt gebunden. Sie hatten zwar freie Kost und Logis im Haus des Arbeitgebers, doch die Entlohnung war gering. Man schloss einen Dienstvertrag auf bestimmte Zeit, in ihm waren Bezahlung und Beköstigung ebenso geregelt wie Wohnung und die Pflichten der Dienstboten. Oftmals erfolgte eine Anstellung als Dienstmädchen jedoch ohne schriftlichen Vertrag, nur nach mündlicher Absprache, und nicht wenige verloren in der sommerlichen Reisezeit oder vor Weihnachten ihre Arbeit, da man sich das Geschenk sparen wollte.
All das war ein Grund dafür, dass die „Dienstbotenfrage“ ein Teil der sozialen Frage Ende des 19. Jahrhunderts war.
Dienstmädchen unterstanden eigenen Gesetzen: Die Gesindeordnung verpflichtete die Mädchen, ein Dienstbuch zu führen, das u.a. das Datum des Dienstantritts und die Tätigkeitsbezeichnung enthielt und damit eine Information für die Herrschaften war - aber auch eine Möglichkeit der Disziplinierung darstellte. Es regelte die Kündigungsfristen, die je nach ländlichem und städtischem Gesinde zwischen sechs Wochen und drei Monaten variierten.
Zeugnisse vom Dienstherren, ab 1872 sog. „Gesinde-Dienstbücher“, wiesen die Eignung für die folgenden Arbeitgeber/Bürger aus, mit dem Nachweis von Personalien, Status, Tätigkeitsbereichen und einer Begründung für die Beendigung des Dienstverhältnisses.
Eine Stellenvermittlung erfolgte entweder durch Mundpropaganda im sozialen Netzwerk (Verwandte z.B.), durch eine Stellenanzeige oder eine Stellenvermittlerin.
(TM)
S. 76
„. Ein Diener wäre so angenehm für Kommissionen und dergleichen. Man bekommt einen braven und anspruchslosen Mann vom Lande. Aber ehe ich es vergesse, Jean: Louise Möllendorpf will ihren Anton gehen lassen; ich habe ihn mit Sicherheit servieren sehen…
In manchen Städten wurden auf Initiative von katholischen Geistlichen Dienstmädchenheime eröffnet, in denen die Mädchen nach der Ankunft in der Stadt, in der sie ihren Traum von einem sozialen Aufstieg in eine kleinbürgerliche Existenz zu verwirklichen suchten, Unterstützung bei der Stellenvermittlung fanden. Diese konfessionellen kirchlichen Vereine hatten größeren Einfluss als die gewerkschaftlichorganisierten, weil Dienstmädchen persönliche Beziehungen höher und als weniger entfremdend einstuften als die kapitalistische Form der Arbeitswelt mit ihren gesetzlichen Regelungen. Häusliche Geborgenheit und ausreichend Nahrung und sicherlich auch gütige Herrschaften waren für viele ein besseres Los als die Fabrikarbeit.806 Eine große Anzahl von Dienstmädchen gaben der Hausarbeit einen qualitativ so hohen Stellenwert, dass sie eine scharfe Trennung von Arbeits- und Freizeit ablehnten.807
Die Entlohnung der Mädchen erfolgte zunächst einmal in Form von Kost (Naturallohn), im besten Fall bekam das Dienstpersonal das gleiche Essen wie die Herrschaften, Logis und einem Lohn, der nach Alter und Berufserfahrung schwankte.
(ER)
S. 399
- Aber das is’ doch schade, Lotti! Dann nehm ich es mit, wenn du’s nicht haben wills…
S. 402
- Hast du noch ein Paar Plastebehälter mitgebracht?, fragte sie. In der Hand hielt sie ein Würstchen.Ach was, Plastebehälter, sagte Charlotte. Das kommt auf den Mül…
- Das kommt nicht in den Müll, sagte Lisbeth und biss in die Wurs…
Eine Weile sah Charlotte zu, wie sich Lisbeths Unterkiefer bewegte. Dann nahm sie ihr das Würstchen aus der Hand und warf es auf den Trümmerhaufen, der vom kalten Buffet übrig war. Nahm noch zwei von den Behältern, in denen Lisbeth Reste gesammelt hatte, und warf sie hinterdrei…
-Was machst du denn da, rief Lisabeth und hielt ihre Hände schützend über die restliche Behälte…
Hinzu kamen unregelmäßige Bezüge wie Trinkgeld und Weihnachtsgeschenke als Symbole eines persönlichen Dienstverhältnisses; damit war es für viele Dienstmädchen möglich (und nötig) für eine eigene Familiengründung oder ihre Herkunftsfamilie zu sparen.
(TM)
S. 89
Am herrlichsten aber war dennoch der Weihnachtsabend zu Hause, denn der Konsul hielt darauf, dass das heilige Christfest mit Weihe, Glanz und Stimmung begangen ward. Wenn man in tiefer Feierlichkeit im Landschaftszimmer versammelt war, während die Dienstboten und allerlei alte und arme Leute … sich in der Säulenhalle drängte…
S. 538
Man stand an der Tafel oder ging daran hin und her, plauderte und lachte, indem man einander die Geschenke zeigte und die des Anderen bewundert…
S. 569
„Erstens einmal ist sie von einer empörenden Habsucht. Sie geht an den Schrank, nimmt Mutters seidene Kleider heraus, packt sie über den Arm und will sich zurückziehen. ,Riekchen‘, sage ich, wohin damit?' - ,Das hat Frau Konsul mir versprochen!'. Sie nimmt nicht nur die seidenen Kleider, sie nimmt auch noch ein Paket Wäsche und geht. Waschkörbe voller Kleider und Leinenzeug werden aus dem Hause geschafft.. Das Personal teilt sich unter meinen Augen in die Sachen, denn die Severin hat den Schlüssel zu den Schränke…
(ER)
S. 193
Dann kam Lisbeth und stellte den Kaffee auf seinen Schreibtisc…
- Pssst, machte si…
- Komm her, sagte Wilhelm. Er nahm einen Hundertmarkschein aus seiner Brieftasch…
- Das ist zu viel, sagte Lisbet…
Kam aber trotzde…
Dienstboten im 19. Jh. unterstanden der Aufsicht der Herrschaft und durften ohne deren Erlaubnis nicht ausgehen. Das Verhältnis von Herrschaften und Dienstboten war ein patriarchalisches: Der Hausherr besaß eine „weitgehende Zwangsgewalt“ 808, was im Charakter der bürgerlichen Familie mit ihren klar aufgeteilten autoritären Strukturen und Befehlsverhältnissen begründet lag, in der alle Bewohner des Hauses der Aufsicht des Mannes mit der Entscheidungsgewalt unterstellt waren.
Als Tugenden eines Hausvaters sah man Strenge und Festigkeit, und so wie die Kinder Gehorsam Dankbarkeit, Lerneifer und Fleiß zollten, hatte auch die Dienerschaft sich gottesfürchtig, ehrerbietig und fleißig zu zeigen. Als wichtige Eigenschaften galten Treue, Ehrlichkeit, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Sparsamkeit 809, und wie für die Bürger selber hieß es auch für sie, das rechte Maß zu halten, nicht in Extreme zu fallen und absolute Loyalität der „Herrschaft“ gegenüber zu zeigen. Diese wiederum war zu regelmäßigen Lohnzahlungen verpflichtet.
(TM)
In der Familie Buddenbrook findet sich das Stereotyp der „Perle“, die bis ins hohe Alter dauerhaft in dieser Familie bleibt, die Kinder umsorgt und Geborgenheit, Stabilität vermittelt, und im höheren Alter nach der Erziehung der ihr anvertrauten Kinder ihr Gnadenbrot bekommt.
S. 402
„Ja, Ida“, sagt der Konsul, „ich habe mir gedacht - und meine Mutter ist einverstanden -, Sie haben uns alle einmal gepflegt, und wenn der kleine Johann ein bisschen größer ist. jetzt hat er noch die Amme, und nach ihr wird wohl eine Kinderfrau nötig sein, aber haben Sie Lust dann zu uns überzusiedeln…
„Ja, ja, Herr Konsul, und wenn’s Ihrer Frau Gemahlin wird recht sein…
Auch Gerda war zufrieden mit diesem Plan, und so wird der Vorschlag schon jetzt zum Beschlus…
Frau Jungmann gibt den Gedanken an ein Eigenleben zugunsten einer von der Herrschaft abgeleiteten Identität auf. Sie wird in familiale Rituale bei Familienfesten mit eingebunden und zeigt eine besondere Ergebenheit ihren Schützlingen gegenüber. Mit großer Selbstverständlichkeit nimmt Frau Jungmann die Mahlzeiten mit der Familie ein. Sie besitzt in der bürgerlichen Phantasie von Thomas Mann weder Körper noch Sexualität, ihre Zuneigung gilt allein den Herrschaften.
Doch ganz selten nur waren Dienstboten so integriert in das Familienleben wie bei den Buddenbrooks (hier spiegelt sich Th. Manns Erwartung an das Dienstpersonal wieder) und eine Bindung wie sie sich in seinem Roman liest, war außergewöhnlich. Stattdessen herrschten oft Missstände in Haushalten, und die Hoffnung auf höherem Lohn, leichtere Arbeit und kürzere Arbeitszeit wurde eher selten erfüllt. Aufdringlichkeiten des Hausherrn und verächtliche Behandlung bzw. Tyrannei durch die Kinder zwangen viele Dienstmädchen zur Mobilität.810 Um Dienstmädchen dennoch zu einem langen Verbleib zu bewegen, prämierte man treue Dienstboten mit materiellen Beigaben. Eine Altersrente nach einer hohen Anzahl von Dienstjahren bestand nach den dazu erlassenen Gesetzen seit dem Ende des 19. Jahrhunderts.
Konkret auf Lübeck und damit auf das Dienstpersonal der Familie Mann/Buddenbrook bezogen, ist bekannt, dass Hauspersonal in der von der „Gemeinnützigen Gesellschaft“ unterhaltenen „Industrieschule für dürftige Mädchen“ ausgebildet wurde. Der Verdienst betraf 1846 acht bis zwanzig Taler, für exklusive Geschenke und Trinkgelder und Aussteuer sorgte die Herrschaft. Das patriarchalische Verhältnis zu den Dienstboten liest sich im Kirchengebet folgendermaßen: „... auf dass es unserem Gesinde wohl in unseren Häusern sei.“811
Dienstmädchen trugen je nach Region eine besondere Tracht. In Lübeck trugen sie „noch ihre derben, praktischen ,eingemachten‘... Röcke, meist rot und grün gestreift und Saum mit handbreitem schwarzen Samtstreifen verziert, dazu eine kurzärmelige einfarbige Jacke, weißen Leinwandplatten und weiße Mütz (Haube), die von Mullbändern unterm Kinn gehalten wurde. Ein Ausgang in die Stadt zu Besorgungen wurde nie ohne den sog. Mädchenkorb unternommen, einen Korb mit sehr hohem, ovalen, gewölbten Deckel aus feinstem Rohr mit vielen Kettchen und Mustern im Geflecht verziert.“812 (TM)
S. 414
… Dienstmädchen mit Halstuch, Schürze und dickem, gestreiften Rock, die kleine weiße Mütze auf dem Hinterkopf und den großen Henkelkorb am nackten Arm…
(AG)
S. 62
… hatte Richard sie betrachtet, ihre kurzen dunkelblauen Hosen, das bunte, quergestreifte Ruderleibchen und das weiße, auf beiden Seiten verknotete Tuch am Kop…
18.3 Hausarbeiten im Dienstverhältnis
Im Roman „Buddenbrooks“ wird unterschieden zwischen den Handelsgehilfen in der Firma und dem Haushaltsgesinde wie z.B. den Stubenmädchen, Köchinnen, Kindermädchen und anderem primär zur Unterstützung der Hausfrau angestellten Personal; weibliche Dienstboten unterteilte man in der Regel in die der Küchenmädchen und der Kinderfrauen.
Bürgerliche Familien hielten mindestens zwei Küchen- oder Stubenmädchen. In Kaufmannshäusern wie den Buddenbrooks dagegen ist zahlreiches Dienstpersonal anzutreffen, die alten Kröger haben zur Bedienung eine Zofe und einen Diener, daneben noch zwei Mädchen und einen Kutscher. In der Mengstraße sind die Wirtschafterin Mamsell Jungmann und weitere drei Mädchen beschäftigt, Näherinnen und Flickfrauen kommen zusätzlich noch an bestimmten Tagen ins Haus.
(TM)
S. 59
Die feudalen Neigungen der mütterlichen Familie regten sich in dem kleinen Fräulein, wenn sie vom Schaukelstuhle aus der Zofe oder dem Diener einen Befehl erteilte. Zwei Mädchen und ein Kutscher gehörten außer ihnen zum Personal der alten Herrschaften. (Familie Sterk beschränkt sich auf ein Dienstmädchen:
(AG)
S. 61
Lediglich Frieda ist noch auf, das Kindermädchen (das Hausmädchen, das Mädchen für alles)(ER)
Charlotte und Wilhelm Powileit in der DDR haben ebenfalls nur das Dienstmädchen Lisbeth.
Je größer die Zahl des Dienstpersonals, desto größer war die finanzielle Mehrbelastung der Familien, und es bestand nicht selten deswegen die Notwendigkeit, mit weniger Dienstpersonal auszukommen. Deren Arbeitsbelastung wurde dann aber, je nachdem wie sehr die Hausfrau sich zur Beteiligung bereit fand, stärker.
Begnügte man sich mit einem einzigen Dienstmädchen, wie z.B. in kleineren bildungsbürgerlichen Haushalten, war es, s.o. „das Mädchen für alles“, wie bei Sterk und Pawoleit:
(AG)
S. 67
Richard schaute wiederum zum Vorplatz, wo Frieda, von der anderen Seite des Hauses kommend, auf einer ihrer Runden den Kinderwagen in sein Blickfeld schieb…
S. 74
-Wo ist Fried…
Otto hält im Laufen inne und dreht sich zurüc…
-Sie sitzt in der Veranda und schreibt einen Brie…
-Bitte sie, mir ein Bier aus dem Keller zu bringe…
(ER)
S. 193
Und jetzt mach mir mal einen Kaffe…
S. 395
Tatsächlich hatte Charlotte angewiesen, die Mäntel in den Keller zu bringen, weil die Garderobe ja voller Blumenvasen stand. Allerdings hatte Lisbeth die Mäntel wieder nach oben gebracht, als die Leute ginge…
S. 399
- Wir haben jetzt wirklich Wichtigeres zu tun, sagte Charlotte. In der Küche steht noch das ganze Geschirr. Und der Abendtee für Wilhel…
Die Arbeitszeit, man bezeichnete sie als Arbeitsbereitschaft, betrug zwischen zwölf und sechzehn Stunden, ohne geregelten Arbeitsbeginn und -ende und war oftmals, falls der Haushalt dies erforderte, unbegrenzt, z.B. bei gesellschaftlichen Verpflichtungen.
Dienstboten standen je nach den Bedürfnissen der Familienmitglieder ständig zur Verfügung und hatten für die Herrschaften da zu sein. Die aber rechneten so manche Tätigkeit gar nicht zur Arbeitszeit, wie z.B. Einkaufen oder Tisch decken. Ebensowenig war die Begleitung der bürgerlichen Familie auf einer Reise ein Urlaub für Dienstmädchen, denn es bedeutete generell eine Beschäftigung mit den Kindern, (TM)
wie für Ida Jungmann in Travemünde:
S. 633
Man konnte einen Spaziergang machen, in das Städtchen, … von Ida Jung mann vorlesen lassen. Und doch war das Klügste stets zur See zurückzukehren und noch im Zwielicht, das Gesicht dem offenen Horizonte zugewandt, auf der Spitze des Bollwerks zu sitzen, ..Dann aber sagte Ida Jungmann: „Komm, Hannochen; müssen gehen; Abendbrotzeit; wirst dir den Tod holen, wenn du hier wirst schlafen wollen…
Die Wohnverhältnisse für das Dienstmädchen waren geprägt vom Mangel an Privatheit und einer kaum möglichen räumlichen sowie sozialen Trennung von der Herrschaft. So erstreckten sich die Unterbringungsmöglichkeiten für das Dienstpersonal oft über Hausböden, die über der Toilette oder Speisekammer sich befanden; oder es gab ein Bett, aufgestellt im Keller, in einem unbeheizten Mansardenzimmer, in der Speisekammer oder im Abstellraum, ohne eine Rückzugsmöglichkeit, so dass die Dienstmädchen den Befehlen und Launen der Herrschaften ausgesetzt waren - eigentlich aber Verhältnisse, die sie von ihrer Kindheit an gewohnt waren.
(TM)
S. 37
… während die Küche, aus der noch immer der säuerliche Geruch der Chalottensauce hervordrang, mit dem Weg zu den Kellern links von der Treppe lang. Ihr gegenüber, in beträchtlicher Höhe, sprangen seltsame, plumpe aber reinlich lackierte Holzgelasse aus der Wand hervor: die Mädchenkammern, die nur durch eine Art freiliegender, gerader Stiege von der Diele aus zu erreichen waren. Ein Paar ungeheuer alter Schränke und eine geschnitzte Truhe standen danebe…
(AG)
S. 222
Erst jetzt fällt Richard auf, dass das Bett, neben dem er steht, aus der ehemaligen Kammer des Kindermädchens stammt. Das Bett ist ohne Matratze, ein bloßes Gerippe. . einige Federn des Rostes sind gebrochen, allen anderen Federn ist nicht mehr zu trauen. Sonderbar, dass sie früher gehalten haben.…
… sie schrieb hundertmal ,Ich hasse dich' auf die Tapete in ihrem Zimme…
(ER)
Die Trennung von Wohn- und Arbeitsplatz beendete dieses Verhältnis.
Die Aufgaben eines Dienstmädchens umfassten:
- die Wohnungsreinigung: Sie betraf Küche, Flure mitsamt dem Treppenhaus, Wohnzimmer, Schlaf- und Kinderzimmer und den repräsentativen Salon und war aufgrund der gediegenen und überladenen Einrichtung eine schmutzige und schwere Arbeit. Im Anschluss daran erfolgte stets ein Kontrollgang der Hausherrin.
- Kochen und Einkauf; Vorbereitung von Familienfesten und Abendgesellschaften; gab es eine Köchin, hatte diese den Machtbereich in Küche und Speisekammer und sorgte mit aufwendiger Herstellung für dreigängige Mittagessen,
- Wäsche, dazu gehörte ebenso das Bürsten und Ausklopfen der Kleidung,
- Bedienung der Familie und der geladenen Gäste, Servieren,
- Kranke pflegen und bei ihnen wachen (was besonders bei den Kindern zu persönlichen Bindungen führte)
(TM)
S. 546
Eine Stunde später lag Hanno in seinem Bett, und sah mit erregten Augen der guten Ida entgegen, die, schon in der Nachtjacke, aus ihrem Zimmer kam und mit einem Wasserglase vor sich in der Luft umrührende Kreisbewegungen beschrieb. Er trank das kohlensaure Natron rasch aus, schnitt eine Grimasse und ließ sich wieder zurückfalle…
„Ich glaube, nun muss ich mich erst recht übergeben, Ida…
„Ach wo; Hannochen. nur still auf dem Rücken liegen. Aber siehst du wohl? Wer hat dir mehrmals zugewinkt? Und wer nicht folgen wollt, war das Jungchen…
(AG)
S. 81
Es ist Frieda, die Kaffee und eine Schale mit Brombeeren bringt.…
während Frieda Kaffee einschenkt, ruft Richard sich die einzelnen Vorgänge ins Gedächtnis zurück.…
(ER)
S. 390
- Ich fang jetzt mal an, sagte Lisbet…
S. 398
Dann wandte sie sich ihren Aufgaben zu. Es war noch eine Menge zu tun, und jetzt, wo sie allmählich in Fahrt kam, machte es sie nervös, dass Lisbeth noch immer unter dem Ausziehtisch steckt…
Die Arbeiten des Dienstmädchens von Charlotte Powileit erzeugen eine Situationskomik.
S. 402
Lisbeth hockte noch immer unter dem Tisc…
- Du hockst ja noch immer unter dem Tisch, sagte Charlott…
Lisbeths Hintern bewegte sich unendlich langsam unter dem Tisch hervor. Sie zog einen Eimer mit Scherben hinter sich her sowie verschieden Behältnisse, in denen sie noch verwertbare Reste gesammelt hatt…
- Hast du noch ein paar Plastebehälter mitgebracht?, fragte sie. In der Hand hielt sie ein Würstche…
Dienstbotenarbeiten waren in ihrer Abfolge und Häufigkeit unberechenbar und erfolgten nicht nur durch regelmäßig vorgegebene Anforderungen. Stets hatte das Personal sich den Befehlen der Herrschaften unterzuordnen und ein devotes Verhalten zu zeigen, was ihnen leichter fiel durch das Erleben eines bisher nur erträumten Luxus und der herrschaftlichen Ausstattung.
18.4 Kindermädchen - kein gewöhnliches Dienstpersonal
Ein Unterschied zum gewöhnlichen Dienstpersonal stellten Kindermädchen dar: Stammten Dienstmädchen in der Regel aus den unteren Schichten, kamen Kindermädchen nicht selten aus einem „guten“ Haus.
(TM)
Ida Jungmann war:
S. 12
… eine Waise, die Tochter eines unmittelbar vor Ankunft der Buddenbrooks in Maienwerder verstorbenen Gasthofbesitzers, …
Ihre Arbeit bedeutete eigentlich, Kinder persönlich zu bedienen, aber oft war, wenn es der Bedarf erforderte, Arbeit im ganzen Haushalt zu tun. Galten sie doch als „Mädchen für alles“, das die Arbeit im Haus unauffällig und geräuschlos zu erledigen hatte. Bei den Buddenbrooks ist sie quasi die Vorgesetzte des Personals: (TM) S. 442
… die nun die Dienstboten der Konsulin regierte und den Hausstand führte, …
Der Einfluss auf die Kinder hatte so gering wie möglich zu sein: „Ammen und Kindermädchen sollten ganz aus der bürgerlichen Familie verbannt werden, denn sie infizierten den Nachwuchs mit Untugenden und Krankheiten, die in den sozialen Unterschichten heimisch waren und vor denen sich das Bürgertum sorgfältig abzuschirmen suchte.“813 Aufgrund ihrer Herkunft und ihres Mangels an Bildung hatten sie nämlich eine Vorliebe für Schauergeschichten und einfache irreale Erklärungen, erzählten den Kindern von Kinderschreckgestalten, wie dem Schwarzen Mann etc, oder reklamierten Sprichworte und Erzählungen, die sich Eltern nicht für ihre Kinder wünschten und vom gebildeten Bürgertum als läppische und verdummende Vermittlung angesehen wurden.
(TM)
Der Großvater Buddenbrook und der Konsul missbilligen die unterschichtsspezifischen fremden Einflüsse und wünschen den Umgang zwischen Kindern und Dienstboten zu verhindern:
S. 82
Eines Tages überraschte der Konsul sie mit Verdruss dabei, dass sie gemeinsam mit Mamsell Jungmann Clauren’s „Mimili“ las, er blätterte in dem Bändchen, schwieg und verschloss es auf imme…
(AG)
S. 73f
- Stimmt es, erkundigte Otto sich von der Schaukel, dass man um den Ast herumschaukeln kann, wenn man schnell genug schaukel…
- Wer behauptet das? fragt Richar…
- Fried…
- Es ist Unsinn, du würdest dir den Schädel an den Ästen darüber anhaue…
- Und wenn man die Äste darüber wegschneiden würd…
- Dann würden wir im Herbst keinen Most bekomme…
Mit Alter und Geschlecht veränderte sich die Beziehung zwischen den Kindern und den Dienstmädchen: Bei den Söhnen lockerte sie sich früher und sie begegneten in ihrer Adoleszenz der Kinderfrau weniger vertraut. Anders verhielt es sich bei den Töchtern der Familie, bei ihnen erfolgte der Ablösungsprozess erst spät und schrittweise.
(TM)
Ida Jungmann hat als „gehobenes Personal“ eine bevorzugte Stellung als Erzieherin und bis zu Schulzeit der Kinder eine erzieherische Funktion. Bei Tony dauert diese bis weit nach der Geschlechtsreife, und noch vor ihrer zweiten Ehe lässt sie sich von ihrem vertrauten Kindermädchen Ratschläge diesbezüglich geben.
Man erkennt, wie sich durch das ständige Beisammensein zwischen den Kindern und Frau Jungmann eine exklusive Beziehung entwickelt, die durch besondere Vertrautheit geprägt ist.
Sie teilen Geheimnisse, Ängste und Gedanken miteinander.
S. 337
„Ach, Ida, bitte, komm doch noch ein bisschen herüber! Ich kann nicht schlafen, will ich dir sagen, ich muss so viel denken, dass der Kopf mir weh tu…
Ida hatte sich zu ihr gesetzt, hatte ihre Nadel und den über die Stopfkugel gezogenen Strumpf wieder zur Hand genommen und während sie den glatten grauen Scheitel neigte und mit ihren unermüdlich blanken braunen Augen die Stiche verfolgte, sagte si…
„Meinst du, dass er wird fragen, morgen…
Die Arbeit der Kindermädchen war von großer Verantwortung geprägt, mussten sie doch auf das Kind achtgeben, damit ihm nichts zustieß und bei kleinen Kindern viel Pflegearbeit verrichten.
(TM)
S. 34
„Ach Gott, Madamchen!“ sagte Ida, die mit dem Doktor bei ihm stand. „Christian, dem Jungchen, ist gar so schlecht…
S. 245
In diesem Augenblick trat Ida Jungmann, die kleine Erika an der Hand, ins Zimmer. Das Kind stak in einem frisch gestreiften Kattunkleidchen, verbreitete einen Geruch von Stärke und Seife und sah sehr drollig au…
Beim gemeinsamen Essen wird von ihrer Seite auf die Essmanieren der Kinder geachtet: (TM)
S. 427
wie geht es Hanno, Tom…
„Er wird gerade mit der Jungmann zu Abend essen.…
Sie schlafen mit den Kindern in einem Zimmer, sind nachts stets bei ihnen und rufen die Kinder in der Nacht nach ihnen, sind sie auch dann für sie da, ziehen sie bei Bedarf an, frühstücken mit ihnen und beaufsichtigen die Hausaufgaben.
(TM)
S. 461
„Pst“, sagte Ida; „ja, er schläft.“ Und Frau Permaneder trat auf den Zehenspitzen an das Bettchen, lüftete vorsichtig die Gardinen und lugte gebückt in das Gesicht ihres schlafenden Neffe…
„Geht er denn gern zur Schule…
„Nein, nein, Tonychen! Hätt lieber noch bei mir weiter lernen wollen. Und ich hätt’ s auch gewünscht, mein Kindchen, denn die Herren kennen ihn ja nicht so von klein auf wie ich, und wissen es nicht so, wie man ihn nehmen muss beim Lernen. Das Aufmerken wird ihm oft schwer, und er wird rasch müde…
(AG)
S. 68f
- Ist sie schon eingeschlafen? will Richard wisse…
Frieda wiegt den Kop…
- Warum fährst du nicht in den Park mit ih…
- Frieda errötet und drückt den Stoßbügel halb mit den Händen, halb mit dem Bauch nach unten, damit der Wagen ein wenig schaukel…
S. 75
Ingrid versteckt sich im Kittel von Frieda. Frieda ist mittlerweile in die Knie gegangen und murmelt etwas Unverständliches in ihrem Weinviertler Dialekt. Sie klemmt Ingrid zwischen ihre Schenkel, und Ingrid lässt sich mit zwei Handvoll Wasser, die Frieda aus der Gießkanne nimmt, folgsam den Rotz aus dem Gesicht waschen. Frieda trocknet das Gesicht des Mädchens mit dem Ende ihres Kleides ab…
Die Erziehungsmethoden zeigten Milde und fehlende Härte, denn als Bedienstete scheuten sie sich, das Herrschaftskind autoritär zu behandeln oder zu bestrafen. Dies Straftabu ließ eine zärtliche Beziehung entstehen, oft intensiver und von größerer Nähe geprägt als zur Mutter; die Kommunikation war spontaner und ehrlicher, die Kinder sprachen über Gefühle und Stimmungen ihr gegenüber eher als mit den eigenen Eltern.
(TM)
Frau Jungmann ist eine Ersatzmutter für die Buddenbrook-Kinder. Hanno, Thomas, Christian und Tony erleben in der langjährigen Vertrauten einen Stabilitätsfaktor in ihrem Leben. Geschlechtssolidarität und Freundschaft sind erkennbar und lassen Standesmauern bröckeln. Solch eine Loyalität zwischen dem Kindermädchen und der Herrschaftstochter rührt aus der ähnlichen Stellung den Eltern gegenüber: beide, Kind und Kindermädchen, schulden ihnen Gehorsam und Unterordnung. Trotzdem zeigt Tonys Kindermädchen keine Unterstützung und eher Unverständnis für Tonys Zweifel bzgl. der Heirat, denn auch sie betrachtet die Ehe in diesem Fall aus bürgerlicher Sicht:
S. 112
… selbst Mamsell Jungmann sagte: „Tonychen, mein Kindchen, brauchst keine Sorgen haben, bleibst in den besten Kreisen…
Zwischen Hanno und Mamsell Jungmann existiert eine besondere Solidargemeinschaft, sie sind Verbündete: Beim Gedicht-aufsagen z.B. flüchtet er in ihre Arme.
S. 484ff
Zuvor aber galt es, dem Papa das Gedicht aufzusagen, das Gedicht, das er mit Ida auf dem Atlan in der zweiten Etage sorgfältig erlern…
Er hob die Wimpern und suchte die Augen Idas, die mit ihrer Uhrkette spielte und ihm in ihrer säuerlich-biederen Art mit dem Kopf zunickte. Ein übergroßes Bedürfnis befiel ihn, sich an sie zu schmiegen, sich von ihr fortbringen zu lassen und nichts zu hören, als ihre tiefe, beruhigende Stimme, die da sagte: Sei still, Hannochen, mein Jungchen, brauchst nichts hersage…
Nie, dachte Hanno verzweifelt, nie werde ich zu den Leuten spreche…
„Überlege dir die Sache bis heute Nachmittag“, schloss der Senator; und während Ida Jungmann bei ihrem Pflegling kniete, ihm die Augen trocknete und halb vorwurfsvoll, halb zärtlich tröstend auf ihn einsprach, ging er ins Esszimmer hinübe…
Die Nähe zu Kind und Familie schuf die besondere innerfamiliäre Position der Kindermädchen. Machtbefugnisse in der Herrschaftsfamilie erfüllten sie mit Stolz und Selbstbewusstsein und ließen sie dem anderen Personal oder anderen Kindermädchen gegenüber ein soziales Überlegenheitsgefühl und Respektabilität empfinden. Sie grenzten sich gegenüber den übrigen Dienstboten ab als ein Beweis ihrer Loyalität und Ergebenheit der Familie gegenüber.
S. 634
Eine Menge von Leuten aus der Stadt, die gar nicht hierher gehörten. „Eintagsfliegen aus dem guten Mittelstande“, wie Ida Jungmann sie mit wohlwollender Geringschätzung nannte, …
18.5 Zwischen Distanz und Identifikation - das Verhältnis des Dienstpersonals zur Bürgerfamilie
Die Beziehung zum Dienstherrn und seiner Familie war für das Dienstpersonal durch Nähe und Privatheit einerseits und sozialer Distanz wegen seiner Zugehörigkeit zur unteren Schicht andererseits geprägt. Man zielte auf ein angemessenes Miteinander hin, d.h.: es wurde ungestraft geduzt, kritisiert und kommandiert, wohingegen das Dienstpersonal sich devot und formelhaft ausdrücken musste.
(AG)
S. 68
- Warum fährst du nicht in den Park mit ih…
Frieda errötet …
Sie bewegt sich mit scheuer Ungelenkigkeit an ihm vorbe…
Das emotionale Klima konnte kalt, aber auch, weil es gegenseitige Unterstützung gab, warm sein.
In der verherrlichten alten Zeit schildert Riehl das „ganze Haus“ als einen Gegensatz zur „Familie“: Es sollte eine Gemeinschaft von Familienmitgliedern einschließlich des Gesindes sein, das seine Herrschaften mit „Vater“ und „Mutter“ anredete, sich als integralen Bestandteil der Familie betrachtete und nicht ausgeschlossen wurde. 814 Doch gab es das überhaupt?
(TM)
Ansatzweise liest man davon im Roman von Th. Mann. Bei der Einweihung des Hauses dankt Thomas Buddenbrook den Arbeitern/Maurern beim Richtfest in ganz besonderem Maße und beweist damit seinen Großmut :
S. 425
Es kam heran, und ward mit allen Umständlichkeiten begangen. Droben auf dem flachen Dache hielt ein alter Maurerpolier eine Rede. Dann aber ward in einem nahen Wirtshause den sämtlichen Arbeitern an langen Tischen ein Festmahl mit Bier, belegtem Butterbrot und Cigarrren gegeben, und mit seiner Gattin und seinem kleinen Sohn, den Madame Decho auf dem Arme trug, schritt Senator Buddenbrook in dem niedrigen Raume zwischen den Reihen der Tafelnden hindurch und nahm dankend die Hochrufe entgegen, die man ihm darbracht…
Sicherlich gab es gelegentlich Familienanschluss, ähnlich dem des Kindermädchens Frau Jungmann. Th. Mann schildert hier jedoch eine im 19. Jahrhundert nicht mehr existente, sondern eine längst vergangene Zeit. Mit der Auflösung des Hauses fehlte die Aufnahme und Zugehörigkeit zur Familie. Der Dienstbote war durch Dienst und Lohn zwar mit der Familie verbunden, aber aus dem Kreis der Familie ausgeschlossen, ähnlich wie bei Thomas Buddenbrook.
Eine Beziehung völliger Ergebenheit und umfassender Fürsorge findet sich andeutungsweise in der Erinnerung Charlottes an das mexikanische Dienstmädchen: (ER)
S. 405
Sie dachte an das Dienstmädchen, das sie damals in Mexiko gehabt hatte: ein zierliches, lautloses Geschöpf, das Charlotte - selbstverständlich - stets mitSeñoraangesprochen hatte. Leider fiel ihr der Name nicht ein. Aber dann fiel er ihr doch ein: Gloria! Was war wohl aus ihr geworden? Gloria. Ob sie noch lebt…
Reduzierte sich die Anzahl der Dienstboten, konnte es zu einer Intimisierung des Dienstverhältnisses kommen, dann nämlich verringerte sich der kommunikative Abstand und eine soziale Grenzziehung wurde schwieriger.815 In so einem Fall wurde eine Distanzierung durch bestimmte Sprachregelungen („gnädige Frau“, das „Sie“ den Herrschaften gegenüber) oder in der Kleidung, durch die sich das Dienstmädchen von den Herrschaften unterscheiden sollte, umso wichtiger.
(TM)
Gerda hat ein distanzierteres Verhältnis zu den Dienstboten und übt sich in Distanz und Zurückweisung, was die soziale Ungleichheit widerspiegelt. Ein entscheidender Grund dafür ist Frau Jungmanns Verhalten.
S. 346
Erika jubelte über jede Krähe, die aufflog, und Ida Jungmann, ., stimmte als eine richtige Kinderpflegerin, die auf die kindlichen Stimmungen nicht nur äußerlich eingeht, sondern sie ebenso kindlich mitempfindet, mit ihrem ungenierten und etwas wiehernden Lachen ein, so daß Gerda, die sie nicht hatte in der Familie grau werden sehen, sie wiederholt einigermaßen kalt und erstaunt betrachtet…
Der innerfamiliale Status von Frau Jungmann geht Gerda zu weit, sie distanziert sich von den ungewöhnlichen Manieren des Dienstmädchens und dessen vermeintlicher Unbildung. Insbesondere die Tischgemeinschaft ist nicht in ihrem Sinne, da Essen ihr ein
Stück Intimität mit der Familie bedeutet. Ida Jungmann wird, als Hanno etwas älter ist, entlassen.
Dienstmädchen dagegen identifizierten sich mit dem bürgerlichen Milieu, wenn sie mit der luxuriösen Klassenlage der Herrschaften konfrontiert wurden. Sie machten sich die Werte der bürgerlichen Familien, deren Einrichtung und Umgangsformen zu eigen und übernahmen bürgerliche Errungenschaften. Das Prestige ihrer Herrschaften förderte bei ihnen ein Gefühl der Besonderheit, so dass sie sich nicht mehr dem städtischen Unterschicht/Proletariat sozial zuordneten, so zu erleben bei Ida Jungmann. Letztendlich ging die Verbreitung bürgerlicher Sitten und Verhaltensformen auf die Dienstmädchen zurück.
Die Beziehung zwischen Dienstmädchen und Hausfrau war eine andere als die zwischen ihm und dem Hausherrn. Beide waren zur Zusammenarbeit verpflichtet. Hausarbeiten galten als Frauensache, und allein deshalb hatte die bürgerliche Hausfrau das Mädchen in den Techniken des Reinigens und des Servierens anzulernen und sich den gemeinsamen Arbeitsbereich des Haushalts mit ihr aufzuteilen. Sie sollte ein Vorbild sein und durch das Herstellen einer persönlichen Beziehung und durch Fürsorge das Dienen für die Dienstboten so angenehm wie möglich machen. Dann nämlich, so war die Auffassung, verrichteten diese zufrieden und aufopferungsbereit ihre Aufgabe. Dass dies nicht der Realität entsprach, ist bei TM und bei ER zu lesen: (TM)
Während der Revolutionszeit weist die Konsulin ihre Köchin Trine wegen einer missratenen Sauce zurecht und wird von dieser daraufhin wüst angefahren und ob ihrer herrschaftliche Stellung verunglimpft.(s.o.)
(ER)
Charlotte erinnert sich an ihre Zeit in Diensten der Oberschicht:
S. 40f
Hatte sie (Charlotte) wirklich vor, den Rest ihres Lebens Kinder reicher Leute zu unterrichten? Oder die Hausangestellten eines verwitweten Universitätsprofessors zu kommandiere…
Irina fühlt sich in einer fast sklavischen Dienstmädchen-Rolle, als sie im Haus ihrer Schwiegermutter wohnt:
S. 61
Wie den letzten Dreck hatte Charlotte sie behandelt. Wie ein Dienstmädche…
(AG)
In der Familie Sterk überlässt Alma dem Dienstmädchen im stillschweigenden Einverständnis die Arbeit im Haus und zeigt sich ihr gegenüber gleichgültig. Sie arbeitet mit Frieda im Sinne der Kinder zusammen, unwissend der Beziehung, die ihr Mann zu dem Dienstmädchen hat.
S. 75
Als von hinter dem Haus Alma mit der weinenden Ingrid am Arm kommt, verstellt er die Lehne um mehrere Kerben nach vorn, so dass er jetzt beinahe sitz…
- Du wirst sehen, bis zur Hochzeit ist es wieder gut, sagt Alma zu Ingrid. Und zu Richard:Sie ist über eine der Weinkisten gefallen, in denen Otto seine Heupferdchen hält. …
In dem Moment tritt Frieda aus der Verandatür, ein Bier in der Hand, über das ein Glas gestülpt ist. Nachdem sie Richard das Bier gereicht hat, hilft sie Alma mit Ingrid, die vor Anstrengung rot angelaufen ist, deren Weinen jetzt aber nachläss…
Der Hausherr hatte die Befehlsgewalt und wurde vom Dienstmädchen aufgrund seines Berufs und der größeren Distanz mit Respekt und Achtung angesehen. Während sie der Hausfrau und deren Eigenarten und Launen täglich begegnete, nahm der Mann die Dienstmädchen oft wegen der Trennung von Lebens- und Arbeitsbereich gar nicht wahr, entschied großzügiger und trat eher korrigierend und vermittelnd auf.
(TM)
Ida Jungmanns Nachfolgerin erkennt in Thomas Buddenbrook die Respektperson und durchschaut Christian als einen Müßiggänger und behandelt ihn als solchen:
S. 442f
Riekchen Severin nämlich, Ida Jungmanns Nachfolgerin, die nun die Dienstboten der Konsulin regierte und den Hausstand führte, ein untersetztes, 27jähriges Geschöpf vom Lande, mit roten, gesprungen Wangen und aufgeworfenen Lippen, hatte mit bäuerlichem Sinn für Tatsachen erkannt, dass auf diesen beschäftigungslosen Geschichtenerzähler, der abwechselnd albern und elend war, und über den die Respektperson, der Senator, mit erhobener Augenbraue hinwegsah, nicht viel Rücksicht zu nehmen sei, und sie vernachlässigte ganz einfach seine Bedürfniss…
„Ja, Herr Buddenbrook!“ sagte sie. „Ich hab’ nu keine Zeit für Ihnen…
(ER)
Charlotte schätzt die Beziehung zwischen Wilhelm und Lisbeth folgendermaßen ein:
S. 397
Lisbeth konnte man ja nicht trauen. Die spionierte für Wilhel…
Lisbeth hat eine enge freundschaftliche Beziehung zu ihrem Hausherrn und vergisst z.B. dessen Geburtstag nicht:
S. 192
Lisbeth kam. Raschelte mit den Kleidern. ..In der Hand hielt sie einen Strauß Rose…
- Lisbeth, du sollst kein Geld für mich ausgebe…
Lisbeth hielt ihm die Blumen hin und strahlt…
Nicht selten besaß das Dienstmädchen mit zunehmender Erfahrung und nach einer großen Anzahl von Dienstjahren eine besondere Machtstellung. Diese kollidierte dann mit den Bedürfnissen der Hausfrau/der Herrschaft, und wird letztendlich ein Grund für die Kündigung:
(TM)
S. 176
„Warten Sie man, bloß, Fru Konsulin, ..“ Selbstverständlich war ihr sofort gekündigt worde…
Tony und Gerda entlassen ebenfalls aus diesem Grund ihre Mädchen:
S. 364
Und das ist nun schon die zweite, denn die erste Person, welche Kathi hieß, habe ich mir erlaubt, aus dem Haus zu schicken, weil sie immer gleich grob wurde…
S. 699
Sie.begann andererseits in vorgerückten Jahren mit dem Dünkel einer alten Dienerin sich selbst übertriebene Befugnisse anzumaßen. die Lage war unhaltbar und obgleich Frau Permaneder. für sie bat,. erhielt die alte Ida den Abschie…
(ER)
Eine Machtverschiebung zeigt sich im Roman, der im Sozialismus spielt.
Die Politisierung der Arbeiterklasse hatte das Dienstverhältnis verändert: weg vom patriarchalischen Modell, in dem Dienstmädchen als infantil angesehen und von den Herrschaften durch Lob und Tadel erzogen wurden, hin zu einem Lohnverhältnis. Dies wiederum beeinflusste das Verhältnis der Dienstmädchen zu den bürgerlichen Herrschaften und hatte nicht selten eine Charakterveränderung des Personals zur Folge, d.h. sie wehrten Verrichtungen mit Unterwerfungs- und Dienstcharakter ab. Das Sich- Wehren und Sich-Verweigern vollzog sich bei den Dienstmädchen selten sprachlich in einem Wortwechsel, sondern eher durch das Ignorieren von Befehlen, durch Uminterpretieren und einem Verhalten, das auf die Durchsetzung der eigenen Meinung angelegt war und manchmal auch Rache oder Protest bedeutete.
S. 400
- Das Geschirr mache ich nachher noch, sagte Lisbeth. Und den Tee kannst du doch rasch aufbrühen, eh ich hier hoch bi…
- Selbstverständlich, sagte Charlotte. Entschuldige! Ich hatte vergessen, dass du hier die Hausherrin bis…
Das Gleichgewicht zwischen Personal und Dienstherrin ist nicht mehr gewahrt, die fehlende soziale Distanz führt zu Konflikten und zu fehlender Zurückhaltung auf Seiten des Dienstmädchens.
Charlotte ist nicht die gütige Frau, die Gleichberechtigung und Nähe zulässt, sondern eher eine emotional kühle Hausherrin, die eine autoritäre Beziehung vorzieht - aber aufgrund der anti-bürgerlichen Einstellung ihres Mannes nicht leben darf. Geiz und Herrschsucht machen ihrem Dienstmädchen das Leben schwer. Bei Lisbeth zeigt sich ein sprachloser Protest, der die Ebene innerpsychischer Verarbeitungen nicht verlässt.
Als bürgerliche Frau versichert sich Charlotte ihres Status im konkreten Umgang mit der Angehörigen aus der unteren Schicht, während der Ehemann durch den Umgang mit Menschen verschiedener Milieus und als Kommunist großzügiger und leutseliger ist und für die Hausgehilfin Position bezieht.
Die Machtverhältnisse haben sich nun umgekehrt: Die gemeinsame Arbeit lässt die soziale Distanz zwischen Hausfrau und Haushaltshilfe zurücktreten, man duzt sich und ein gealtertes Dienstmädchen gewinnt an Macht.
Charlotte empfindet den Umgang zwischen sich und dem Dienstmädchen als zu vertraut, sie fürchtet um um ihre Privatsphäre und entwickelt Abgrenzungswünsche:
S. 400
Niemals, dachte Charlotte, hätte sie dieser Frau das Du anbieten dürfen. Kein Respekt, kein gar nichts. Tanzte ihr auf der Nase herum. Machte, was sie wollte. Wenn Wilhelm mal aus dem Haus ist, dachte sie, fliegt Lisbeth rau…
S. 404
- Du bist gekündigt, sagte Charlotte. In drei Minuten verlässt du das Haus. - Aber Lott…
- Und nenn mich nicht Lotti, sagte Charlotte. Sonst rufe ich die Polize…
Resigniert und kampflos wird dem Dienstmädchen letztendlich der persönliche Machtbereich des Haushalts überlassen.
Wilhelms solidarisches Verhalten dem Dienstmädchen gegenüber hat ideologische und sozialpolitische Gründe (s.o.). Er lehnt eine Zurschaustellung seines Reichtums und seiner höheren sozialen Position ab und betrachtet Dienstmädchen als Teil des ausgebeuteten Proletariats. Er unterstützt die Forderung des Marxismus und der Sozialdemokratie, dass Dienstmädchen Klassenbewusstsein zeigen sollen, um nicht mehr Dienende zu sein (zumal sie oft Arbeiter heirateten).
S. 120
Charlotte ging durch die Küche zum ehemaligen Dienstboteneingang (die Tür zwischen Küche und den Wohnräumen hatte Wilhelm idiotischerweise zugemauert, jetzt musste man immer, auch wenn man das Mittagessen aufdeckte, den langen Weg über die Diele nehmen…
S. 400
Ein schwacher Schein ließ auf jener Tür, die Wilhelm vor fünfunddreißig Jahren vermauert hatte, die Konturen der Ziegelsteine hervortrete…
Wenn Wilhelm mal aus dem Haus ist, dachte sie, kommt die Tür wieder auf. Idiotisch, das alles! Die Personalklingel hatte er auch abgeschafft, gleich als Erstes damals: weil es gegen seine proletarische Ehre verstieß! Aber sie durfte sich die Kehle wund schreien, wenn Lisbeth wieder irgendwo im Haus herumstreunte. Das verstieß nicht gegen seine proletarische Ehr…
Selbstbewusstes und anspruchsvolles Auftreten der Dienstmädchen führte bereits im 19. Jahrhundert zur emotionalen Distanzierung, wurde aber von den Herrschaften keineswegs als Zeichen von Mündigkeit, sondern als unbotmäßig und als vorlaute Unverschämtheit und Renitenz angesehen.
Die Verweigerung von Befehlen von Seiten des Dienstpersonals empfanden Bürger als eine Störung und Gefährdung ihrer Lebensweise. Die sichtbaren Standesunterschiede, denen das Dienstpersonal im Lebensstandard des Haushalt vom Dienstpersonal begegnete, führten bei ihnen zu Unzufriedenheit, die das Bürgertum zwar verstand aber auch fürchtete, denn eigene Aufstiegswünsche vom Dienstmädchen standen der bürgerlichen Lebensweise entgegen. Ungehorsam,Verweigerung der Arbeit und fehlende Einsichtsfähigkeit waren oftmals Ursache von Klage.
(TM) . .
Ein Ärgernis wurden die Buddenbrookschen Dienstboten während der revolutionären Tage: Das Bürgertum fürchtete die Rache der klassenbewussten Industriearbeiter und dass diese die Dienstmädchen, die eine uneindeutige soziale Selbstverortung hatten, in ihre Bewegung integrieren könnten. Die Folge war die sichtbare Verweigerung des Dienstes mit einer aggressiven Note und offen ausgetragene Konflikte. Das Dienstmädchen akzeptiert seinen abhängigen Status nicht mehr als Dienende. Die Konsulin erlebt die Situation als bürgerlichen Albtraum der wild gewordenen Unterschicht.
18.6 Dienstmädchen als Objekt bürgerlicher Sexualphantasien
Thomas Mann und Arno Geiger erzählen in ihren Romanen von dem Dienstmädchen in der Opferrolle. Der Hausherr (Alois Permaneder und Richard Sterk) hat eine heimliche Liebschaft zu ihm und beutet sie sexuell aus. Dies stellt keineswegs ein Klischee dar, sondern ist realistisch:
Weil Dienstmädchen vom Land kamen, unterschieden sich ihre Normen von Bürgertum insofern, dass ihnen ein weniger tabuisierter und freierer Umgang mit dem Körper und der Sexualität in ihrer Kindheit beigebracht worden war. Schon aufgrund der engeren
Wohnverhältnisse erlebte man Krankheiten und Tod zu Hause, meist in Abwesenheit eines Arztes, und manche Bürger sahen aus diesem Grund Angehörige der Unterschicht als sexuell freizügiger an, versehen mit einer geringen Sexualmoral und einem freien Umgang in Liebesdingen.
Und gar nicht so selten suchten auch die Dienstmädchen in ihrer Freizeit Aufregung und Abenteuer und wurden durch ihre Unerfahrenheit Opfer von betrügerischen Männern. Bürgerliche Familien befürchteten zwar das Eindringen von Freiern in die eigene Sphäre, wenn das Personal Tanzveranstaltungen besuchte oder Sonntagsvergnügen nachging und sahen dies ungern, dabei kam es aber von Seiten des Dienstherrn selbst nicht selten zu sexuellen Projektionen.
Bereits adelige Herren kannten den Dualismus von ehelicher/keuscher und außerehelicher/erotischer Liebe.816 S. Freud beschrieb die Rolle des Dienstmädchens die sexuellen Bedürfnisse des Ehemannes betreffend: Da die eigene Frau aufgrund ihrer schichtenspezifischen Sexualmoral zurückhaltender war und der bürgerliche Mann vor ihr als Frau großen Respekt besaß, vollziehe sich vollständige Hingebung somit eher bei einem „unsittlichen Weib“ und erniedrigten Sexualobjekt.817
(TM)
S. 374
Um die Mitternacht dem 24. und 25. des laufenden Monats war Madame Permaneder, … aus einem leichten Schlummer geweckt worden. Ein anhaltendes Geräusch dort vorn an der Treppe war schuld daran gewesen, ein schlecht unterdrückter, geheimnisvoller Lärm, in dem man das Knarren der Stufen, ein hustendes Gekicher, gepresste Worte der Abwehr und ganz sonderbare knurrende und ächzende Laute unterschied...Nicht einen Augenblick konnte man über das Wesen dieses Geräusches im Zweifel sein. Es war eine Balgerei gewesen, ein unerlaubter und unsittlicher Ringkampf zwischen der Köchen Babette und Herr Permaneder. Das Mädchen. hatte sich hin und her gewunden und den Hausherrn abzuwehren gestrebt…
(AG)
Diese zwei gegensätzlichen Frauentypen, die der intellektuelle Respekt einflößenden Ehefrau und die der körperlich lüsternen unterwürfigen Frau aus der Unterschicht zeigt sich bei Richard Sterk: Seine Beziehung zum Kindermädchen ist als eine Kompensation seiner unbefriedigten Bedürfnisse zu verstehen.
S. 71
Komisch, dass er dem Kindermädchen die Füße küsst, während er bei Alma, obwohl ihre Schönheit nach wie vor seinen Herzschlag beschleunigt, meist nur das Nachthemd hochschiebt. . Ob es ihr auch von hinten gefallen würde? Durchaus im Bereich des Möglichen. Aber was denkt er da eigentlich? Egal, er wird sie ohnehin nicht fragen, denn sein Respekt vor ihr vereitelt jeden Anlau…
Sexuelle Ausbeutung von Mägden gab es bereits im 18. Jahrhundert, als die wirtschaftliche Privilegiertheit des Hausherren eine solche Beziehung ermöglichte und Dienstmädchen, der Laune und Willkür des Hausherrn ausgesetzt, den eigenen Körper ebenso widerstandlos preisgaben wie den eigenen Willen.818
Das Dienstmädchen, jung und unverheiratet, und damit in Konkurrenz zur Frau des Hauses stehend, zeigte ständige Anwesenheit und Verfügbarkeit, ähnlich einer
Prostituierten, und rief durch ihre Attraktivität eine erotische Zuneigung des Hausherrn hervor. Sie war dessen Willkür ausgesetzt und erduldete vieles, aus Gutgläubigkeit (z.B. das erotische Verlangen betreffend) und da sie sich, aus einer anderen Schicht stammend, unterlegen fühlte. (TM) S. 37
„Ja, Line, Kaffee, du? Kaffee!“ wiederholte Herr Köppen mit einer Stimme, die aus vollem Magen kam, und versuchte, das Mädchen in den roten Arm zu kneife…
(AG)
S. 62f
Er kommt von diesem Mädchen nicht los, obwohl es allerhöchste Zeit wäre. Sooft er den Beschluss fasst, dass es das definitiv letzte Mal sein wird oder gerade ist oder war, so oft sehnt er den Augenblick herbei, an dem er erneut mit Küssen über diese kinderspeckige Weinviertler Molligkeit herfällt. … Bereits mit dem warmen, rauen Kleid in der einen Hand, wenn er unter Friedas Achseln riecht, wenn er mit der anderen Hand die Speckröllchen streichelt …
Dann, mit den Händen ihre Hinterbacken auseinander- und hochschiebend, während Frieda in ihr rechtes Handgelenk beißt, …
Körperliche Arbeit wirkte ambivalent auf den männlichen Bürger und setzte Phantasien frei: Durch freizügige Bewegungen konnte das Mädchen einerseits sexuelle Ausstrahlung haben, rief aber gleichzeitig auch Verachtung, Abwehr und Verdrängung beim Hausherrn hervor.
Verführungsversuche begannen mit Geldangeboten und endeten mit Drohungen bzw. Kündigung bei Ablehnung. Da laut der Gesindeordnung Preußens die körperliche Züchtigung von Seiten des Hausherrn erlaubt war, konnte diese sogar als Sonderform der möglichen sexuellen Beziehung zwischen Hausherrn und Dienstmädchen gesehen werden: Unterwerfung als eine Form der Demütigung, die Lust am geschlagenen Körper erzeugte.
Eine oft nicht verschließbare Kammer erleichterte es dem Hausherrn, seine sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen: (AG) S. 63
Diesmal dreht er sie herum, sie beugt sich bereitwillig nach vorn und die Sommernacht und das Zirpen der Heuschrecken und die Dünste der Küche und das Knallen einer Fliege am gekippten Fenster …
Richard nutzt das soziale Gefälle zu seinem Vorteil aus und insbesondere die „bürgerfremden“ Faktoren des Dienstmädchens haben für ihn einen Reiz. Er missbraucht Leichtgläubigkeit und Unerfahrenheit und pervertiert den Familienanschluss. Als notorischen Lüstling mit einer Triebnatur bewegt ihn keine seelische Bindung, sondern allein körperliche Begierde. Das Mädchen zeigt keinen Widerspruch, ist sprachlos und wird von ihrem Herrn auf die Rolle des Opfers und auf ihre Körperlichkeit reduziert.
S. 63
Oft empfindet er eine solche Abscheu gegen sich, und weil er Abscheu gegen sich empfindet, auch eine Abscheu gegen Frieda, dass es ihn Überwindung kostet, sich im eigenen Haus von einem Zimmer ins nächste zu bewegen. Ich darf kein Doppelleben führen, ermahnt er sich beim Mittagesse…
(ER)
In der Familie Powileit ist Wilhelm den Reizen Lisbeths gegenüber nicht abgeneigt, die wiederum keineswegs entrüstet ist, sondern ihm gegenüber Achtung und emotionale Geborgenheit verspürt.
S. 192f
- Herzlichen Glückwunsch, sagte si…
- Lisbeth, du sollst kein Geld für mich ausgebe…
Lisbeth hielt ihm die Blumen hin, strahlte. Ihre Zähne waren ein bisschen schief. Aber ihr Hintern war stramm, und ihre Brüste schwappten durchs Dekollete wie Wellen durchs Schwimmbecken. Aber nachher nimmst du sie wieder mit, befahl Wilhelm. Und jetzt mach mir mal einen Kaffe…
Dann kam Lisbeth und stellte den Kaffee auf seinen Schreibtisc…
- Pssst, machte si…
- Komm her, sagte Wilhel…
Er nahm einen Hundertmarkschein aus seiner Brieftasch…
- Das ist zu viel, sagte Lisbet…
Kam aber trotzdem. Wilhelm zog sie dicht an sich heran und steckte ihr den Hundertmarkschein ins Dekollett…
- Du Schlimmer sagte Lisbet…
Ihre Wangen röteten sich, wurden noch dicker. Sie wand sich sanft aus seiner Umarmun…
Warum willigten die Mädchen ein und gaben sich dem Hausvater hin? Zunächst waren es die Einsamkeit und die Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Intimität, Liebe und Wärme. In ihrer isolierten Arbeitssituation und dem fehlenden sozialen und emotionalen Umfeld fühlten sie sich schutzlos und in erhöhter Abhängigkeit.
Ihre Bewunderung und Idealisierung der Herrschaften und deren Leistung war groß. Hinzu kam, dass die Mädchen das positive und privilegierte Gefühl hatten, begehrt zu werden und der Wunsch, in eine höhere soziale Sphäre vorzudringen zur Fiktion von einem sozialen Aufstieg führte. Sie träumten davon, Statusschranken zu durchkreuzen und vielleicht sogar den Dienstherrn zu heiraten.
(AG)
Bei Familie Sterk distanziert sich das Mädchen keineswegs, sondern empfindet Richards Begehren als Ehre, als Schmeichelei. Es ist fasziniert vom Hausherrn und dem Reichtum, dem Urbild des Herrschaftlichen. Mit stumpfsinniger Gefügigkeit gibt sie sich dem Hausherrn hin in der Hoffnung auf sozialen Aufstieg und einer festen Partnerschaft.
S. 64
… dass ihm dieses Doppelleben seit fünfeinhalb Monaten, seit Ende Februar, besser (wenn auch nicht leichter) von der Hand geht, als er es sich zugetraut hätt…
So wie in diesem Roman endete ein Dienstherr-Dienstmädchen-Verhältnis oftmals mit einem Konflikt, evtl. mit einer Schwangerschaft oder Abtreibung und, da die häuslichen Beziehungen und das Zusammenlebens mit der Familie und der Ehefrau unwiderruflich gestört waren, mit der Entlassung.
(TM)
Permaneders Aufdringlichkeit dem Dienstmädchen gegenüber und Tonys Reaktion darauf sind ein Beweis dafür, wie sich die Ablehnung und Wut der Hausherrin gegen das Mädchen und deren Attraktivität richtet, die für sie eine Konkurrentin darstellt.819
S. 375f
Bei Antoniens Erscheinen hatte Babette etwas wie „Jesses, Maria und Joseph!“ hervorgestoßen. - und während das Mädchen im selben Augenblick auf geschickte Weise spurlos verschwunden war, hatte er mit hängenden Armen, hängendem Kopfe und hängendem Schnauzbart vor seiner Gattin gestande…
Frau Antonie hatte ihre Kleider zusammengerafft, um sich ins Wohnzimmer zurückzuziehen. Da aber war, zum Schlusse, ein Wort ihr nachgeklungen,…
(AG)
Ein adäquates Verhalten ist für Richard in bestimmten Situationen nur noch schwer möglich.
S. 63
Er will nicht den Rest seines Lebens in solcher Unordnung verbringen.…
S. 68
Das Verhältnis ist ohne Zukunft, und trotzdem ist da ein enormer Reiz, der anhält und anhält und von dem ganz unklar ist, wozu er sich auswachsen wird. Im Moment: Er weiß nicht, es muss ein Ende haben, und zwar rasch, er hat keine Begabung für die Unordnung…
Was dann folgte, war die Aufkündigung der Arbeitsstelle und ein Stellenwechsel. Bei Frieda blieb das Gefühl der Enttäuschung und des Im-Stich-gelassen-Seins.
S. 223
… (er weißt noch, dass Frieda geweint hat, als sie ihre Kündigung erhielt, sie schrieb hundertmal ,Ich hasse dich' auf die Tapete in ihrem Zimmer, was erst auffiel, als das Mädchen bereits auf der Bahn war)…
18.7 Das Ende der Dienstboten-Zeit
Mit dem zahlenmäßigen Anstieg der Industriearbeiter in der Mitte des 19. Jahrhunderts setzte ein Rückgang der Dienstbotenzahl ein. Frauen bot sich nun die Erwerbsmöglichkeit in der industriellen Produktion und als Angestellte in den Warenhäusern oder im Büro - und dies zu besseren Arbeitsbedingungen.
Es kam zu einem Mentalitätswandel: Das Bedientwerden im häuslichen Raum galt einfach nicht mehr als zeitgemäß sondern wurde als Ausbeutung und als unwürdig angesehen. (Sozial)Demokratisches Denken schloss Dienstbotenarbeit aus. Bereits im BuddenbrookRoman sind Anklänge daran zu finden: (TM)
S. 344
Der Kutscher zog den Hut, und mit dem patriarchalischen Wohlwollen, das Thomas manchmal ein bisschen in Verlegenheit brachte, nickte die Konsulin ein überaus herzliches „Guten Morgen, lieber Mann!“ zu ihm hinau…
Man versuchte, die Zahl des Dienstpersonals zu erhöhen durch das Versprechen von Familienanschluss und einer Aufstiegsideologie mit dem Angebot einer kostenlosen Ausbildung im hauswirtschaftlichen Bereich, jedoch ohne Erfolg. 1918 hob man die Gesindeordnung auf.
Überhaupt fehlten durch die Kriege, die Inflation und Arbeitslosigkeit vielen Haushalten die finanziellen Mittel, um Dienstboten zu beschäftigen.
(AG)
Dass höhere Beamte und freie Berufe aufgrund einer stabilen wirtschaftlichen Situation weiterhin Personal beschäftigen konnten, zeigt sich in Arno Geigers Roman. In Österreich, wo die Anstellung von Dienstpersonal eine besondereTradition hatte, gehörte Familie Sterk zu den bürgerlichen Gruppen der leitenden Beamten/Direktoren und Angestellten, die es sich leisten konnten.
S. 66
… wozu bin ich ein reicher Mann …
Dienstmädchen wurden zum Symbol eines verschwundenen Lebensstils. Als Berufsgruppe gibt es sie heutzutage nicht mehr, zugenommen hat aber die Zahl der stündlich oder täglich gemieteten Putz-, und Tagesfrauen, das sog. Outsourcing: Hauswirtschaftliche Tätigkeiten werden von höher qualifizierten und besser verdienenden Frauen gegen Entgelt an familienfremde Personen übertragen, um die eigenen wachsenden Ansprüche an Freizeit und individueller Selbstverwirklichung zu erfüllen.
Privilegierte und einkommensstarke Familien wie Richard und Alma Sterk in Wien (AG) und Charlotte und Wilhelm im Berlin (ER) lassen sich von Alltagsarbeiten durch Hilfskräfte im Haushalt entlasten.
(AG)
Ingrid liebäugelt mit diesem Dienstleistungsmodell, doch Peter lehnt familienexterne Hilfskräfte bzw. die Externalisierung bestimmter Aufgaben wie Putzen und Waschen ab.
S. 260
Nicht einmal eine Hilfskraft für die Kinder oder den Haushalt gelang es ihr durchzusetzen. Peter legte sich wiederholt mit dem Argument quer, er hasse diese semifamiliären Bindungen, er wolle nicht parat stehen für fremde Leute und jederzeit den Chauffeuer machen müssen. Damit hatte es sich. Das Angebot ihres Vaters, das Kindermädchen von der Steuer abzusetzen, indem er es als Hilfskraft beim Ordnen seines Nachlasses führt, kam gar nicht zur Diskussio…
Die langfristige Entwicklung spürt Ingrid: Es entstand in den mittleren sozialen Schichten eine Doppelbelastung der Hausfrauen. Sie übernehmen die Arbeiten der Dienstmädchen. S. 260f
Und Ingrid hatte es auszubaden. Wären nicht Frau Andritsch und die anderen Nachbarinnen gewesen, sie hätte sich aufhängen könne…
S. 240ff
Also weiter zum Konsum, einkaufen, sehr kursorisch, Hauptsache viel. … Nach dem Nachtdienst ist sie immer so halb hinterm Mond, sie neigt an diesen Tagen zu Spontaneinkäufen. …
Mit einer Zigarette zwischen den Lippen wäscht Ingrid denen Teil des Geschirrs ab. … Ingrid stürzt sich ins Kochen, damit es keine Nachrede gibt, sie mache ihre Arbeit nich…
19. Das bürgerliche Ehe- und Liebesideal
Das Bürgertum stieß ein Phänomen an, das zu einer grundlegenden Veränderung in der Ehe und im Familienleben führte.
Bis zum 18. Jahrhundert herrschte eine eher sachliche Einstellung zur Ehe, man stellte die wirtschaftliche und soziale Vernünftigkeit der Eheschließung in den Vordergrund.
Unter dem Einfluss der Französischen Revolution und der Romantik bahnte sich eine Wende an: Man forderte die Freiheit von gesellschaftlichen und familiären Zwängen - die Liebe wurde zur neuen Leitvorstellung als Voraussetzung der Ehe.
Die Aufwertung der emotionalen Beziehung in der Partnerschaft begann zur Zeit des Sturm und Drangs und der Romantik. Ihre Vertreter ließen entgegen der kalten Vernunft die Leidenschaften und Gefühle zu Wort kommen, mit der Forderung, dass die Rolle der Männer und Frauen sich ändern sollte: freie Partnerwahl, Verzicht auf die formelle Heirat und das Postulat vor- und außerehelicher Beziehungen (Goethe lebte z.B. ohne Eheversprechen mit Christiane Vulpius).
Die Aufklärer hingegen postulierten eine ,vernünftige Liebe’ für die Ehe, mit der Vernunft als Primat, und sahen Elemente wie Attraktivität, Sinnlichkeit und Erotik, Sexualität negativ, denn sie erzeugten keine Stabilität und waren nie von Dauer. Dauerhaft war dagegen die geistige Verbindung, Gefühle hatten sich zu entfalten und Zufriedenheit und Einigkeit als ein Ausdruck emotionaler Bindung zu gelten, wohingegen Emotionen schadeten und die Vernunft lähmten.820 (TM)
Als Tony ihrem Vater brieflich ihre Bindung mit dem Sohn des Lotsenkommandeurs, einem zukünftigen Arzt, gesteht, weist dieser sie mit solch rationalen Überlegungen auf ihre Pflicht als Tochter der Buddenbrooks hin und nennt ihr Denken und ihre Gefühle „kurzsichtig“:
S. 146
Wir sind, meine liebe Tochter, nicht dafür geboren, was wir mit kurzsichtigen Augen für unser eigenes, kleines persönliches Glück halten, denn wir sind nicht lose, unabhängige und für sich bestehende Einzelwesen, sondern wie Glieder in einer Kette.. und du müsstest nicht meine Tochter sein, … wenn Du ernstlich im Sinne hättest, mit Trotz und Flattersinn Deine eigenen unordentliche Pfade zu gehen. …
Romantiker sahen in der Liebe gar die Möglichkeit, über die Standesgrenzen zu springen, erwarteten von der idealen Geliebten, dass sie zum Seelenverkehr mit ihrem Geliebten in der Lage war, philosophieren konnte und intellektuell emanzipiert war - allein diese Erwartungen unterbanden eine soziale Mobilität, so dass Standesunterschiede dadurch keinesfalls überwunden wurden.
Dabei schwankten die romantischen Verfechter zwischen einer leidenschaftlichen Sinnenliebe und einem körperfeindlichen Gefühl; Grundlage blieben übereinstimmende Neigungen, mit der sich Innerlichkeit und Stabilität versöhnten.821 Etwas befremdlich blieb damals das Modell eines kombinierten Geschlechtscharakters mit dem Entwurf einer Vereinigung von Männlichkeit und Weiblichkeit im Geistig-Ideellen zur Menschheit und zur Gesamtpersönlichkeit.
Die Liebesheirat fand Verbreitung, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts machte man die Liebesehe zur Norm. Eine Ehe ohne Liebe galt als eine Herabsetzung des Partners und als etwas Inhaltsloses.822 War bisher der materielle Aspekt in einer Verbindung entscheidend gewesen, lehnte man nun das Schließen einer Ehe aus rein sachlichen Erwägungen ab und betonte stattdessen die g e i s t i g e Gemeinschaft der Eheleute. Zuneigung und gegenseitige Achtung sollten die Ehe zu einer Gefühls- und geistigen Gemeinschaft werden lassen.
(TM)
In solch einer geistigen Gemeinschaft steht das Ehepaar Thomas und Gerda Buddenbrook zueinander, sie empfinden durchaus mehr als Sympathie, füreinander und suchen beim künftigen Ehepartner Austausch und Gemeinsamkeit.823
S. 288
… aber in der niederländischen Malerei war ich schon besser zu Hause, und in der Literatur verstanden wir uns durchau…
S. 643
Allein von Liebe wiederum, von dem, was man unter Liebe verstand, war zwischen den Beiden von Anbeginn höchst wenig zu spüren gewesen. Von Anbeginn vielmehr hatte man nichts als Höflichkeit in ihrem Umgang konstatiert, eine zwischen Gatten ganz außerordentliche, korrekte und respektvolle Höflichkeit, die aber unverständlicherweise nicht aus innerer Fernheit und Fremdheit, sondern aus einer sehr eigenartigen, stummen und tiefen gegenseitigen Vertrautheit und Kenntnis, einer beständigen gegenseitigen Rücksicht und Nachsicht hervorzugehen schie…
Viele Frauen konnten sich eine Ehe ohne Liebe nicht vorstellen und wünschten sich eine legitimierte Liebesbeziehung im Sinne der romantischen Schriftsteller: „Leidenschaftliche Hingabe an den anderen Menschen, Verschmelzung zu einer Einheit bei gleichzeitiger Wahrung beider Identitäten“ 824und, „dass die persönlichen Wünsche des Mädchens beachtet werden sollen und es nicht gegen seinen Willen eine Ehe schließen soll.“ 825 Mann und Frau hatten nicht fremdbestimmt, sondern selbständig als Paar zusammen zu leben.
Der Anspruch auf individuelles Glück, auf Bildung und Entfaltung spiegelte sich nun in den Eheerwartungen, so dass gar einer Heirat über die Standesgrenzen hinweg und gegen den Willen der Eltern eigentlich nichts im Wege stehen sollte.
Liebe und Zuneigung als Grundvoraussetzung für eine funktionierende Ehe bedeuteten einen absoluten Wandel im Eheverständnis, und dass Zuneigung als Grundvoraussetzung für eine funktionierende Ehe angesehen wurde, entsprach ganz und gar nicht der bisherigen Moral und Norm, nach der die eheliche Liebe Ausdruck von Kameradschaft und der Erfüllung von gegenseitigen solidarischen Pflichten war.
Ehe galt im katholischen Glauben als Sakrament und hatte den Zweck der Erzeugung und Erziehung von Kindern und nicht ein Ausdruck einer erotischen und sentimentalen Liebe zu sein. Sinnliche Liebe, so war man der Meinung, konnte nicht Grundlage für eine lebenslange Verbindung sein, da sie nur von kurzer Dauer sei und nicht ewig Bestand habe. Eine materielle solide Grundlage dagegen, glaubte man, war die Gewähr für eine Ehe auf Dauer.826 Auch wenn die realen Lebensbedingungen die hohen Erwartungen an die erotische Liebes-Ehe scheitern ließen, blieben die romantischen Vorstellungen von Ehe und Familie bis heute bestehen.
Im Bürgertum stellte das Ideal der Liebesheirat mit anschließender Familiengründung einen entscheidenden Wert dar und ist im Roman, der Literaturform des Bürgertums schlechthin, das zentrale Thema. Ein harmonisches und glückliches Familienleben bedurfte der Liebe, so war die Meinung des aufgeklärten Bürgers am Ende des 18. Jahrhunderts, und gebildete Eltern stimmten einer Liebes- bzw. Neigungsheirat zu. Es war das „genuin bürgerliche und geschlechtsübergreifende Phänomen der Emotionalisierung“, die Empfindsamkeit von Männern und Frauen, das mit dem gesteigerten Subjektivismus pietistisch geprägter Religiosität und der Erweckungsbewegung zusammenhing, einer Strömung, die in nachnapoleonischer Zeit Bedeutung gewann und in die Familie Buddenbrook hineinreichte. (siehe: Religiosität im Bürgertum)
Maßstab bürgerlichen Verhaltens wurde die Konzentration auf das Ich, eine Innerlichkeit und eine Besinnung auf Menschlichkeit, verbunden mit dem Wunsch nach Freundschaften und innigen Beziehungen.827 Sie prägten die Denk- und Handlungsweisen ebenso wie die liberale Einstellung. Nicht mehr Zweckmäßigkeit war das Fundament der Ehe, sondern Treue als Verpflichtung einer dauerhaften Beziehung über alle Konflikte hinweg.
Doch wie sah dann die damalige bürgerliche Ehe-Realität wirklich aus?
„Die Frage ist jedoch, welche soziale Reichweite die neuen Ideale in der Wirklichkeit erlangten, ob sie als allgemein gültige Norm in der Realität auch praktiziert wurden, ob nicht vielmehr die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung diesem Ideal zwar vor der Öffentlichkeit huldigte, in der Praxis jedoch anderen Kriterien den Vorzug gab.“828
In der Zeit des Bürgertums im 19. Jahrhundert unterlag die Eheschließung weiterhin dem Postulat der Ökonomie! Nicht der geistige und emotionale Gleichklang war entscheidend, sondern die Steigerung des von beiden Seiten eingebrachten ökonomischen Kapitals, denn „.in den großbürgerlichen Kaufmannsfamilien nun sind Eheschließungen immer zugleich Geschäftsverbindungen gewesen.“829 Eine „gute Partie“ vermehrte das Kapital und die Geschäftsverbindungen und sicherte das Ansehen. Gefühle spielten dabei eine untergeordnete Rolle.
Die Ehe ermöglichte es dem Mann, je nach seiner sozialökonomischen Position gesellschaftlichen Status zu erwerben.
(TM)
Bendix Grünlich wertet seine Person und Liquidität durch die Heirat und die Gründung einer eigenen Familie auf:
S. 159
Erst mit den 80 000 hatte er die „traditionelle Höhe der Bar-Mitgift“ erreicht…
Hierauf empfahl sich Herr Grünlich und reiste nach Hamburg a…
S. 227
„… schon vor vier Jahren, als uns schon einmal das Messer an der Kehle stand, der Strick um den Hals lag. wie wir da plötzlich die Verlobung mit Mademoiselle Buddenbrook an der Börse ausschreien ließen, noch bevor sie wirklich stattgefunden hatte.jederlei Achtung.…
Das Ziel der Ehe lag zusätzlich in der Zeugung der legitimen Nachkommen, die für den wirtschaftlichen und machtpolitischen Fortbestand der Familie sorgten.830 Zwar propagierte man in der Öffentlichkeit die Liebe statt der Versorgung als Substanz der Ehe, jedoch wurde „vor einer Heirat weiter sehr sorgfältig nach bester Buchhaltermanier über Plus und Minus der Ausgewählten abgerechnet und ein ansehnliches Vermögen um ein Vielfaches höher bewertet als eine ansehnliche Figur.“831
Die ,Liebesheirat’ als Forderung des sich gegenüber dem Adel emanzipierenden Bürgertums war ein Ideal, das von jener Gruppe, die sie stellte, weitgehend n i c h t realisiert wurde. Das Konzept der Liebesehe stand oft in Widerspruch zu den Bemühungen bürgerlicher Eltern, die ihre Kinder nach den Kriterien des wirtschaftlichen und sozialen Standards verheiraten wollten. Ein Mädchen mit Mitgift hatte die Aussicht auf eine standesgemäße Heirat - und die galt als wesentlich wichtiger als das Gefühl.
Das Ideal der reinen Liebesehe wurde demnach kaum verwirklicht, denn die Realität forderte andere Grundlagen als nur Liebe. Und nicht nur das gehobene Bürgertum erkannte, wie schwierig es war, die Lebensqualität durch eine Intimisierung der Ehe zu vermehren.832
Zwar maß man dem Moment der Zuneigung eine größere Bedeutung bei als früher, aber es war nicht das uneingeschränkte Motiv für eine Heirat, und auch die Ehe verlor nicht in Gänze den Charakter einer primär geschäftlichen Transaktion.833 In nachromantischer Zeit waren demnach ebenso sachliche Kriterien, wie das Vermögen und der Beruf ausschlaggebend für die Partnerwahl 834 und man wählte nicht selten eine Versorgungsehe, um eine finanziell gesicherte Zukunft zu haben.
Die Vermutung liegt nahe, dass „bürgerliche Frauen der Ehe wie auch der Verbindung von Liebe und Ehe einen höheren Stellenwert einräumten als Männer.“835 (TM)
Tony Buddenbrook hat keinerlei Wahlfreiheit bzgl. des geliebten Partners:
S. 145
Ich weiß ja, dass es Sitte ist, einen Kaufmann zu heiraten, aber Morten gehört eben zu dem anderen Teile von angesehenen Herren, den Gelehrten. Er ist nicht reich, was wohl für Dich und Mama gewichtig ist, aber das muss ich Dir sagen, lieber Papa, so jung ich bin, aber das wird das Leben Manchen gelehrt haben, dass Reichtum allein nicht immer glücklich mach…
Th. Mann vermittelt in seinem Roman den Eindruck, dass sich in den konservativen Kaufmannskreisen die Liebesheirat noch nicht durchgesetzt hat und eine Vermischung von Bildungs- und Besitzbürgertum nicht akzeptiert wird, S. 603
… denn da vorteilhafte Heiraten zwischen Geschwisterkindern in der Stadt nicht Ungewöhnliches waren, so nahm Niemand Anstoß dara…
Tonys Eltern machen als parteiische Berater Druck bei den Eheschließungen ihrer Kinder. 836Sie betrachten eine Heirat mit Morten als „schlechte Partie“: Ein Arzt war zwar finanziell abgesichert, zählte aber nicht zum Besitzbürgertum, und damit steht Morten als Bildungsbürger außerhalb des Milieus, abstammend aus einer einfachen Lotsen- und Mittelstandsfamilie.
Die bürgerliche Ehe verband Elemente einer alten und einer neuen Eheauffassung: Sie stand zeitlich zwischen der traditionellen Sachehe und der reinen Liebesehe. Zur Norm wurde die „vernünftige Liebe“. Nicht eine leidenschaftliche Liebe sollte das Fundament der Ehe sein, sondern eine Liebe, die sich entwickelte, und in der der Partner die persönlichen Eigenschaften und die Tugend des geliebten Menschen anerkannte und liebte.
(TM)
Johann Buddenbrook hat beides in seinen Ehen erlebt:
S. 54f
Ja, Johann Buddenbrook musste diese erste Gattin, die Tochter eines Bremer Kaufmannes, in rührender Weise geliebt haben, und das eine, kurze Jahr, das er an ihrer Seite hatte verleben dürfen, schien sein schönstes gewesen zu sein. …
Sie starb, dachte er, indem sie die hohe Pflicht des Weibes erfüllte, und ich hätte die Liebe zu ihr zärtlich auf das Wesen übertragen. Dann, später, hatte er sich Antoinette Duchamps, dem Kinder einer reichen und hochangesehen Hamburger Familie vermählt und respektvoll und aufmerksam hatten die beiden nebeneinander geleb…
Die Ehebeziehung selber bekam einen anderen Wert, man nahm Rücksicht auf die Gesundheit der Frau, die nun als Gefährtin und Repräsentantin nicht mehr nur durch Dauerschwangerschaften strapaziert werden sollte. Wichtig war die kultivierte Kommunikation zwischen den Ehegatten und der Austausch der Erfahrungen nach dem Arbeitstag des Mannes und allein dies zeigt, wie relevant die seelisch-geistigen Eigenschaften des Partners wurden. Solch ein Austausch der Gatten über Arbeit und Familie konnte aufgrund der geringen räumlichen Distanz zwischen Arbeitsplatz und Wohnraum stattfinden, wenn auch die Frau nur selten über das Fachwissen verfügte und wegen der geringen Transparenz nur einen geringen Einblick in die Arbeitswelt ihres Mannes hatte.
(TM)
Jean Buddenbrook und seine Frau führen ein solches Gespräch, als seine Frau wegen der Einstellung eines weiteren Dieners nachfragt:
S. 77
„Sollten wir wirklich einen Bedienten nicht erschwingen könne?“ fragte die Konsulin lächelnd. „Wenn ich an das Personal meiner Eltern denke…
„Deine Eltern, liebe Bethsy! nein, nun muss ich Dich fragen, ob du dir eigentlich über unsere Verhältnisse klar bist…
„Nein, das ist wahr Jean, ich habe wohl nicht hinlängliche Einsicht.…
„Nun, die ist leicht zu beschaffen“, sagte der Konsul. Er setzte sich im Sofa zurecht.. und begann, während er die Augen ein wenig zusammenkniff, mit außerordentlicher Geläufigkeit seine Zahlen hervorzubringe…
Die „vernünftige Liebe“ (oder Vernunftehe) des Bürgertums verband sich stets mit wirtschaftlichem Kalkül; Ehre, Besitz, Macht und Prestige blieben die Auswahlkriterien und Standesgemäßheit spielte weiterhin eine große Rolle - niemand wollte ,nach unten’ heiraten. Die bürgerliche Familie gab materielles und kulturelles Kapital an die nächste Generation weiter und wollte, ähnlich dem Adel, durch Heiratspolitik und Festigung des inneren Zusammenhalt eine Machtkonsolidierung der Gesamtfamilie erzielen - und dies forderte Opferbereitschaft von einzelnen Familienmitgliedern.
Im Zuge der Verbürgerlichung wurde es üblich, der Tochter eine Dotation, eine Mitgift als Erbe mitzugeben, ein nicht immer nur weibliches Phänomen (wie z.B. in den Realteilungsgebieten in Württemberg, wo durchaus auch für Söhne eine solche ausgehandelt wurde).837 (TM)
Grünlich schätzt die Mitgift seiner zukünftigen Frau und den tadellosen politischgeschäftlichen Leumund in der exponieren Stellung seines Schwiegervaters.
S. 159
„Ich bin vollkommen Ihrer Meinung, mein werter Freund. Diese Frage ist von Wichtigkeit und muss erledigt werden. Kurz und gut: Die traditionelle Bar-Mitgift für ein junges Mädchen aus unserer Familie beträgt 70000 Mar…
„.ein Geschäft vergrößert sich, eine Familie blüht empor…
„Mein werter Freund“, sprach der Konsul.“ Sie sehen in mir einen Geschäftsmann von Coulanz! mein Gott. Sie haben mich nicht einmal ausreden lassenS. 341
Und sobald Permaneder angekommen war, hat Tom in aller Stille geschäftliche Erkundigungen über ihn eingezogen, da sei überzeugt, und als die ziemlich günstig und sicher lauteten, da war es beschlossene Sache bei ih…
Tony versucht durch die Verheiratung mit Grünlich und den Verzicht auf Morton ihre Familie finanziell zu stärken. Die vermeintliche Liquidität des Ehepartners bedeutet Kreditwürdigkeit und ergänzt sich mit den Interessen der Familie Buddenbrook. Sie lässt sich verheiraten, ganz im Sinne der bürgerlichen Vorstellung und hofft, damit die Traditionen der Familie fortzuführen. Und auch die zweite Heirat soll den familiären Ruf, den sie durch ihre Scheidung geschädigt sieht, bessern.
Tony steht stets im Konflikt zwischen Emotionen und materiellen Interessen. Die Ehebeziehung zwischen Tony und Grünlich ist charakterisiert durch die „Vernunftehe“, in der die Partner ohne echte Neigung füreinander in vermeintlichem Wohlstand mit einem Kind zusammen lebten.
Nach den Fehlschlägen kehrt Tony in der Rolle des Kindes in die Familie zurück.
Eine bürgerliche Ehe war ein „generalstabsmäßig“ geplantes Unternehmen mit klar definierten Zwecken und Aufgaben. Für den Mann bedeutete sie, je nach seiner sozialökonomischen Position, die Möglichkeit, den Familienverband fortzusetzen und Vermögen, gesellschaftlichen Status sowie kulturelle Traditionen und Eigenarten an legitime Erben weiterzugeben. Zugleich wertete er seine Person durch die Gründung eine eigenen Familie auf, löste sich aus der väterlichen Gewalt und wurde als Haus- und Familienvater eine vollständige Persönlichkeit mit allen Rechten und Pflichten.838 Noch 1900 trug Das Bürgerliche Gesetzbuch der Bedeutung der Geldheirat im Bürgertum Rechnung, indem der Besitzstand der Familien in einem Besitzrechtsregister einsehbar war: Damit hätte die Heirat zwischen Tony und Grünlich später also nicht stattfinden können und Grünlichs handfeste materiell-berufliche Strategie wäre durchschaut worden.
Eigenschaften und Verhaltensweisen betrachtete man als genealogisch bedingt und somit, so war man der Auffassung, verfügte ein zukünftiger Partner aus einer „guten Familie“ über die notwendige persönliche Qualität und die erforderliche soziale Platzierung. Kriterien für die Wahl einer Ehefrau waren: Gesundheit (zum Gebären der Kinder), ein nicht zu niedriges Alter, (um die 20), Schönheit und Klugheit, sie sollte aber keine Gelehrte sein.839
Zukünftige Ehegatten lernten sich in den sozialen endogamen (Heirats-) Kreisen kennen, in denen sie sich bewegten: Der gleiche Habitus, ähnliche Erziehung und Wertvorstellungen, gleiche Interessen und gleiche Sprache, Schönheitsideale, körperliche Anziehung, Geschmack und Vorliebe stimmten meist überein, und so verbanden sich Unternehmer- und Kaufmannstöchter vor allem mit Unternehmern und Kaufleuten, Töchter aus Akademikerhaushalten mit höheren Beamten und Freiberuflern; man blieb bei der Wahl des Partners im eigenen Herkunftsmilieu. Eine Heirat zwischen Unternehmerfamilien förderte die Zusammenarbeit und den geschäftlichen Kontakt und brachte neues Kapital durch die Mitgift in die Firma.
(TM)
Die Eheschließungen im Roman zeigen, wie groß die Abhängigkeit vom Nutzen, d.h. von sozialen und ökonomischen Aspekten war, z.B. die Heirat von Thomas und Gerda.
S. 289
Und was die „Partie“ betrifft?. Ach, ich ängstige mich beinahe davor, dass Stephan Kistenmaker und Hermann Hagenström und Peter Döhlmann und Onkel Justus und die ganze Stadt mich pfiffig anblinzeln wird, wenn man vor der Partie erfährt, denn mein zukünftiger Schwiegervater ist Millionä…
Das Liebesideal beeinflusste sichtlich die Mentalität der nachfolgenden Generationen: Gefühle wurden bei der Verehelichung aufgewertet und anerkannt, so dass im Laufe des 19. Jahrhunderts die Töchter lernten, ihre Vorstellung von einer Liebesheirat und -ehe mit ins Spiel zu bringen - willigten aber auch letztendlich oft in eine Versorgungsehe ein, um nicht als „alte Jungfer“ zu enden.
In den modernen Romanen erleben wir, wie sich die Ehe zur reinen Liebesehe entwickelt und die bürgerliche Geldehe obsolet wurde - ein wichtiger Moment des sozialen Wandels! Es vollzog sich die autonome Wahl des Partners und diese Wahlfreiheit wurde letztendlich ein Bestandteil der Menschenrechte.840
19.1 Die ( Liebes-) Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau im Bürgertum
Was galt aber nun als Liebe in der damals bürgerlichen Zeit und wie gestaltete sich in dieser Beziehung eine bürgerliche Ehe?
Liebe - das meinte die Verschmelzung der beiden Menschen mit ihren polaren Charakteren und ebenso die Enträtselung und das Erkennen der Individualität des Partners. Damalige Briefwechsel, bereits bei kürzeren Trennungen verfasst, ließen den anderen teilnehmen am eigenen Erleben und erhoben die Liebe oftmals ins Religiöse.841
Im lutherischen Eheverständnis war die Frau die Gefährtin ihres Mannes, die die Kinder im Glauben erzog und gleichwertig neben dem Mann stand.842
Daneben hatte das französische Recht, der code civil, großen Einfluss auf die europäische Privatrechtsentwicklung und legitimierte die Rechtsprivilegien des Mannes.843. In der Rechtsform der „bürgerlichen Ehe“ wurde der Frau ein Zugang zur Mündigkeit und zur Rechtsautonomie auf politischem, gesellschaftlichem und gewerblichem Gebiet versperrt, und durch die strikte Rollen- und Charakterdifferenzierung dem Mann einerseits eine rechtlich verbürgte Autorität und Entscheidungsgewalt eingeräumt, andererseits war er der Frau „nach Maßgabe seiner Lebensstellung, seines Vermögens und seiner Erwerbsfähigkeit Unterhalt zu gewähren verpflichtet.“844
Mit Partnerschaft in unserem Sinne hatte das wenig gemein, aber das heutige Ideal von Beziehung kann nicht als Maßstab für eine Beziehung im vergangenen Jahrhundert genommen werden, damals war es eine Gratwanderung zwischen Selbstbehauptung, der Äußerung von Wünschen und der Unterordnung der Frauen.
(TM)
Die Romane zeigen, wie die Frauen es verstanden, ihre Stärken einzusetzen und Einfluss zu nehmen, wenn z.B. die Konsulin die Einstellung eines neuen Dienstmädchens durchsetzt, Schwäche und Gutheit ihres Mannes ausnutzend.
S. 79
„. Ich hoffe, deine Einsicht ist nun eine klarere, liebe Bethsy -…
„Vollkommen, Jean, vollkommen!“ beeilte sich die Konsulin zu antworten, denn sie gab für heute Abend den Bedienten auf. „Aber lass uns zur Ruhe gehn, wie? es ist allzu spät geworden.“ Übrigens wurde nach ein paar Tagen, als der Konsul gut gelaunt aus dem Comptoir zu Tische kam, dennoch der Beschluss gefasst, Möllendorpfs Anton zu engagiere…
Wenn junge Frauen ihren zukünftigen Ehemann kennenlernten, verließen sie sich auf das Urteil ihres Vaters oder Bruders. Kam es zur Verlobung, dauerte die damaligen Verlobungszeit eine kurz Zeitspanne, in der stets die Balance zwischen Nähe und Distanz zum zukünftigen Partnergehalten wurde.
(TM)
S. 102
„Liebe Tony“, sagte die Konsulin sanft, „wozu dies Echauffement! Du kannst sicher sein, nicht wahr, dass deine Eltern nur dein Bestes im Auge haben, und dass sie dir nicht raten können, die Lebensstellung auszuschlagen, die man dir anbietet.…
Tonys Verlobungszeit dauert etwa ein Vierteljahr:
S. 158ff
„. Verlobte sich am 22. September 1845 mit Herrn Bendix Grünlich, Kaufmann zu Hamburg…
Es verging der Dezember, und zu Beginn des Jahres sechsundvierzig ward Hochzeit gemach…
Thomas Vermählung mit Gerda erfolgt bereits bei seinem ersten Aufenthalt in Amsterdam im Juli 1856, die Heirat dann nach Ablauf des Trauerjahres:
S. 289
… und seit gestern Nachmittag ist die Verlobung perfek…
S. 297
Gleich nach der Weihnacht sollte Claras Trauung in der Säulenhalle mit allem Aufwand gefeiert werden, während die Hochzeit in Amsterdam, der „bei Leben und Gesundheit“ auch die Konsulin beizuwohnen gedachte, bis zum Beginn des nächsten Jahres verschoben werden musste: damit eine Ruhepause vorherging…
Für die Frau war der direkte Übergang vom Elternhaus in die Ehe üblich. Sie war in ihren Vorstellungen von persönlicher Autonomie und Glück und Lebensplanung durch Literatur, z.B. Familienromane, beeinflusst, anders als bei den Jungen, die durch den außerhäuslichen Schulbesuch bereits eine gewisse Freiheit erleben durften und ihren Aktionsradius durch Ausbildung und Reisen vergrößerten.
Der Charakter der Hochzeit, früher eine glanzvolle prestigeträchtige Feierlichkeit, privatisierte und individualisierte sich während des 19. Jahrhunderts, man ehelichte ohne große Gesellschaft, oft geschah die Trauung zu Hause ohne öffentlichen Kirchgang. (TM) S. 163
Die Halle war mit Blumen geschmückt und ein Altar an ihrer rechten Seite errichtet worden. Pastor Kölling von St. Marien hielt die Trauung,. Alles verlief nach Ordnung und Brauc…
Mit der Heirat erfolgte meist ein Ortswechsel für die Frau, sie zog dorthin, wo der Mann seinen Beruf ausübte. Dort fiel ihr die Eingewöhnung oft schwer, der Kontakt zu Eltern und Geschwistern fehlte, die Eheleute waren auf sich selber verwiesen und das Eheleben an den Berufserfordernissen des Mannes auszurichten:
(TM)
Trennungsschmerz zeigt sich bei Tony, die als Ehefrau ihrem Mann nach Hamburg folgen und ihre Eltern und Geschwister verlassen muss.
S. 163
Nachdem Tony mehrere male die Überzeugung ausgesprochen hatte, dass sie sehr bald zu Besuch nach Hause kommen und dass auch der Besuch der Eltern in Hamburg nicht lange auf sich warten lassen werde, stieg sie guten Mutes in die Kutsch…
Durch die außerhäusliche Position des Familienoberhaupts verstärkte sich das Autoritätsgefälle zwischen Mann und Frau und die Rolle der Frau reduzierte sich durch die dualistische Geschlechterordnung in der bürgerlichen Familie auf die Aufgaben im hauswirtschaftlichen Rahmen und auf ihre Tätigkeit als Hauptbetreuungsperson der Kinder.
Das durchschnittliche Heiratsalter betrug für Männer zwischen 31 und 33 Jahre, denn seine längeren Ausbildungszeiten führten erst spät zu einem eigenständigen Lebensunterhalt, ohne dass sie auf die finanzielle Unterstützung der Eltern angewiesen waren. Damit war eine Heirat im Bürgertum des 19. Jahrhunderts für den Mann stets mit einer gesicherten beruflichen Position verbunden. Er musste seiner Frau ein standesgemäßes Zuhause, Kapital und eine entsprechende eigene Stellung bieten, war er dazu nicht in der Lage, war dies ein Hinderungsgrund, um eine Ehe einzugehen.
Das Heiratsalter der Frauen lag zwischen 22 und 27 Jahren, und allein schon eine Altersdifferenz von 10 Jahren bestimmte die Rolle der kindlichen Ehefrau und die des erfahrenen, zu ehrenden, Autorität ausstrahlenden Ehemannes und trug zur Ungleichheit der Ehepartner bei. Anreden wie „mein liebes Kind“ drückten diese Hierarchie aus, nicht zuletzt bestärkte das christliche Ehegelübde eine Abhängigkeit der Frau.845 (TM)
Tony Buddenbrook ist ein Beispiel für solch eine Kindfrau, zerrissen zwischen Familie und Gefühl, ist sie keine gereifte Persönlichkeit und hat keine geistige und emotionale Tiefe. Grünlich dagegen gehört zu den bürgerlichen Männern mit größere Lebenserfahrung, dies sieht auch der Konsul:
S. 103
„Meine kleine Tony“; sagte er, „was solltest du auch von ihm wissen? Du bist ein Kind, siehst du, du würdest nicht mehr von ihm wissen, wenn er nicht vier Wochen, sondern deren zweiundfünfzig hier verlebt hätte. Du bist ein kleines Mädche…
Die Asymmetrie von Alter und geistiger Reife zwischen Mann und Frau findet sich nicht bei allen Buddenbrooks. Bei Thomas Buddenbrook gibt es kein besonders großes Altersgefälle oder gar eine Abhängigkeit von Gerda. Die Beziehung ist von Distanz und gegenseitigen Respekt geprägt, die kein autoritäres Gebaren von Thomas Seite zulässt, so zu lesen im Brief von Thomas an seine Mutter:
S. 289
Denn es liegt für dich doch kein Einwand darin, dass Gerda nur drei Jahre jünger ist als ich? Du wirst wohl niemals angenommen haben, hoffe ich, dass ich irgend einen Backfisch aus dem Kreise Möllendorpf-Langhals-Kistenmaker-Hangenström heimführen würd…
Thomas hatte ein starkes Wissen um die Richtigkeit dieser Frau, obwohl es keine Liebesgeschichte im Voraus gab, und auch Gerda sagte sofort „Der oder keiner. Nicht Liebe, sondern dieser Imperativ“ ist die Grundlage der Beziehung.846 Gerda ist eine ihm ebenbürtige Frau, die ihr Selbstbewusstsein nicht nur aus seiner gesellschaftlichen Position oder aus ihrer Erfüllung von Aufgaben und Erziehung zieht, intellektueller und kultureller Austausch stehen im Mittelpunkt.
S. 287f
Ich erinnere mich sehr wohl, dass Gerda - gestattet, dass ich mich bereits ausschließlich des Vornamens bediene - schon als ganz junges Mädchen, als sie noch bei Mademoiselle Weichbrodt am Mühlenbrink zur Schule ging einen starken und nie ganz verlöschten Eindruck auf mich gemacht hat. jetzt aber sah ich sie wieder: größer, entwickelter, schöner, geistreicher. In der Musik konnte ich ihr nicht Widerpart halten, . aber in der niederländischen Malerei war ich schon besser zu Haus…
Gerda Arnoldsen stammt zwar aus „guter“, d.h. wohlhabender, Familie, entspricht aber in ihrem Erscheinungsbild nicht dem Bild einer Ehefrau, die gesunde Nachkommen zeugen kann: Ihre Beschreibung ähnelt einer Toten, einem Gespenst, das in der Dämmerung erscheint:
S. 303
… in einem faltig hinabfallenden Hauskleide aus schneeweißemPiqué.Das schwere, dunkelrote Haar umrahmte das weiße Gesicht, und in den Winkeln der nahe bei einander liegenden brauen Augen lagerten bläuliche Schatte…
Musik hat für sie eine erotische Dimension und lediglich beim Musizieren zeigt sie Gefühl. „In die Ehe eingetreten und vaterrechtlich verfugt, beansprucht sie eine Autonomie der
Lust, die mit den sozialen Regeln unverträglich ist.“ 847 Da aber Thomas keinen Zugang zur Musik findet, bleibt die Beziehung der Ehepartner distanziert.
19.2 Die Ehe und das Verhältnis der Geschlechter in heutiger Zeit
Sozio-kulturelle Strömungen und Entwicklungen veränderten die Sicht auf die Ehe und das Verhältnis zwischen den Geschlechtern, zwischen Ehemännern- und Ehefrauen, Eltern und Kindern. Im Vergleich zu den bürgerlichen Ehepaaren des 19. Jahrhunderts zeigen sich im Verhältnis der Geschlechter heute sowohl Kontinuitäten als auch Unterschiede.
(AG)
Die Ehe von Alma und Richard ist geprägt von den Grundsätzen der bürgerlichen Ehe des 19. Jahrhunderts: der Liebesheirat mit anschießender Familiengründung.
S. 22
Sie wünscht sich all diese Momente zurück, in denen sie Richard bewundert hat. .. Oft kann sie schon gar nicht mehr glauben, dass der Mann, mit dem sie unter einem Dach lebt, derselbe sein soll, der sie mit seiner Klugheit beeindruckt ha…
Es war eine ökonomisch gesicherte, d.h. eine ,vernünftige Ehe’! Das wundert nicht, denn Anfang des 20. Jahrhundert, in der Zeit, als Alma ihre Kind- und Jugendzeit erlebte, galten noch die geschlechtsspezifischen Erziehungsziele der Mädchenerziehung: „Die Aufgabe, die der Frau ganz speziell im Volksganzen zufällt, ist vielmehr eine geistlich sittliche, die eng verknüpft ist mit jenem Wesenszug in ihr, mit der Mütterlichkeit, die sich nicht nur in physischer Mutterschaft auszuwirken braucht, sondern, im tiefsten und weitesten Sinne genommen, hinausführt über den Kreis der Familie zu der großen Volksgemeinschaft und dort alles umfasst, was gehegt und getragen werden muss, was nach Lösung verlangt durch persönliches, warmes Einsetzen des ganzen Menschen. .[Dies] verlangt sehr sachliche Schulung, sehr bewusste Kräftigung intellektueller und sittlicher Fähigkeiten, Selbstdisziplin - Eigenschaften, die nur eine Erziehung wecken kann, die bewusst dieses Ziel sieht, die sich bewusst einstellt auf die neue Persönlichkeitsauffassung der Frau.“848
Der Altersunterschied, zwischen Alma und Richard ist, wie in bürgerlichen Ehen üblich, groß, was zu einem besonders ausgeprägten Patriarchalismus führt.
S. 71
Sie ist jünger als er, im Vormonat einunddreißig geworde…
S. 71
Und er? Er hat gesagt, jetzt wird geheirate…
Sachliche Kriterien, wie das Vermögen und der Beruf sind nicht unwesentlich für die Partnerwahl:
Richard ist vermögend und beruflich erfolgreich, Alma gebildet und eine gleichwertige Partnerin. Heirat und Familiengründung erfolgen nach dem Berufseintritt, Richard bleibt der Hauptverdiener und erarbeitet den Unterhalt für Haushalt und die Erziehung der Kinder und hat damit die Verantwortung für die Familie.
S.. 15
Als junge Frau hat sie einen Verwaltungsjuristen in der Elektrizitätswirtschaft und späteren Minister geheirate…
S. 66
… wozu bin ich ein reicher Mann …
S. 196
In seiner Jugend hätte er nie zu hoffen gewagt, je einer Frau mit Bildung zu begegnen, die …
Alma gibt bei der Eheschließung ihr Studium auf:
S. 70
Ob sie wohl ihrem Studium nachtrauer…
Dies erinnert sehr daran, dass bei jungen Männern im Bürgertum traditionellerweise zunächst ihre Ausbildung und der Berufseintritt erfolgte, bevor sie eine Familie gründeten, für die beiden Kinder wird Alma als Mutter zur Hauptbezugsperson, Richard ist einen Großteil seiner Zeit beruflich tätig:
S. 16
… weil das nötige Hirnschmalz durch die sporadische Anwesenheit des Haushaltsvorstandes eingebracht wir…
Mit ihrer Diplomatie und Besonnenheit gelingt es Alma eine Atmosphäre der Harmonie und Geborgenheit in der Familie entstehen zu lassen:
S. 147
Andererseits die im Mahlwerk der Ehe schon etwas rundgeschliffene Hausfrau, Flötenspielerin und Bienenzüchterin, die sich aus allen Konflikten heraushält, Moment, nein, die nur o tut, als würde sie sich heraushalten, die gleichzeitig im Hintergrund zu glätten versucht, was zu glätten geht, und von der man fairerweise sagen muss, dass sie beiläufig bei ihrem Mann mehr ausrichtet als Ingrid mit offenem Revoltiere…
Alma akzeptiert den Dominanzanspruch ihres Mannes und begehrt nicht auf, auch nicht, als er das Wäschegeschäft ihrer Mutter verkauft und sie damit ihre berufliche Tätigkeit aufgeben musste:
S. 26
Was aber Entscheidungen, Finanzen und technische Dinge anbelangt, haben Frauen das Maul zu halten, ja. Klappe. Dass Alma das viel zu oft getan und damit mehr als nur einen Fehler begangen hat, merkt sie erst, als es zu spät war. Das erste Mal 1938, kurz nach dem Anschluss, als Richard aus nie ganz klargewordenen Gründen das Wäschegeschäft ihrer Mutter an eine Handelskette abgab …
Die Beziehung ist geprägt von Liebe und Zuneigung und vom Respekt zueinander, was Richard aber nicht davon abhält, außereheliche sexuelle Beziehungen zu anderen Frauen einzugehen:
S. 71
Egal, er wird sie ohnehin nicht fragen, denn sein Respekt vor ihr vereitelt jeden Anlau…
S. 64
Bisher tut Alma, als lebe sie ohne Verdacht. Richards spätes Heimkommen …
S. 360
1952 haben Richard und sie gemeinsam befunden, dass Frau Ziehrer von allen Bewerberinnen die beste Sekretärin abgeben werde. Schade halt, dass es für Alma eine so unglückliche Wahl war. Aber ob sie jetzt traurig ist oder nicht oder nachtragend oder nicht, es ändert nichts an dem, was zwischen Richard und Frau Ziehrer war. …
Tendenziell zeigt sich in dieser Ehe bereits die gleichwertige Beziehung von Frau und Mann mit einer Kooperation in den unterschiedlichsten Bereichen des Alltags:
S. 361
1952 haben Richard und sie gemeinsam befunden, dass Frau Ziehrer von allen Bewerberinnen die beste Sekretärin abgeben werd…
Nach dem Anschluss Österreichs und der beginnenden Judenverfolgung in der Nachbarschaft:
S. 70
- Ja, Frau Mende…
- Ich nehme halt an, man wird im Verkehr mit ihr in nächster Zeit die Lage berücksichtigen müssen, in der sie sich neuerdings befinde…
Diese Art Logik, denkt er, ist Almas Stärke, außer ihr kennt er niemanden, der sich in der Befindlichkeit anderer wie in einem vertrauten Element bewegt. … Diese Gabe ist etwas, was ihn in ihrem Fall beunruhigt, was er in seinem Fall gerne für sich hätt…
Alma ist das Beispiel für eine Generation, in der, idealerweise, die romantische Liebe im Lauf der Ehe in eine pragmatische Liebe und Kameradschaft umgewandelt werden kann. 849
S. 208
Er hat es satt, sich vor Ingrid ständig rechtfertigen zu müsse…
Er bleibt einige Augenblicke unschlüssig. Alma kommt ihm zu Hilfe und leitet auf das eigentliche Thema des Besuchs über …
Insbesondere im Alter und nach der Erkrankung Richards ist Almas Gefühl zu ihrem Mann von Mitleid und Verbundenheit durch die Erinnerungen geprägt:
S. 29
Es war nicht das erste Mal, dass Richard seine Pläne wegen eines plötzlichen Anflugs von Willensschwäche unter dubiosen Vorwänden aufschob. Doch da Richard sich seit einigen Jahren immer einsperrte, bekam es Alma mit der angst zu tun. Sie dachte, womöglich ist er ernsthaft krank und spielt es herunter, weil Krankheit für einen Mann wie ihn eine schwer zu ertragende Schande ist., vergleichbar mit mutwilliger Sachbeschädigun…
S. 30
Er war im offenen Schlafrock und sah erschöpft aus. An seinem Pyjama zeichneten sich große Schweißflecken ab, als bedeute Schlafen und Im-Zimmer-Sitzen für ihn eine anstrengende Arbeit. Alma tat es weh, ihn so zu sehen, so abgezehrt und mitgenommen. Richtig versackt sah er aus. Ein Bild des Jammers. Deshalb und um ihm die Sache ein bisschen leichter zu machen, verzog sie sich nach unte…
S. 352
… weshalb ich dich jetzt so behandle, als wärst du mir all die Jahre ein treu fürsorglicher Ehemann gewesen, das erklärt auch, warum mir die Vorstellung, mein Leben mit einem anderen Menschen verbracht zu haben, ganz fremd is…
Richard hingegen hält an seinem Dominanzanspruch, seinem althergebrachten Geschlechterverhältnis und dem weiblichen Rollenbild fest. Selbst als er immer öfter die Hilfe und die Ratschläge seiner Frau benötigt, will er keine Schwäche zeigen und unterstellt Alma mangelnde Kenntnis - Alma durchschaut sein Verhalten:
S. 26f
-Dein Spott ist genau das, was mir fehlt. Gib sie mir zurück. Ich werde mich selbst drum kümmer…
… Aber gleichzeitig erinnerte sie sich daran, was für ein armer Kerl er war und dass er die Dinge niemals mehr so sehen würde wie sie. Die Zeit des Begreifens war für ihn vorbei, statt dessen gab es jetzt Verunsicherung. Alma hatte schon oft die Beobachtung gemacht, dass in Situationen, in denen Richard Schwäche zeigen musste oder wenigstens nicht auftrumpfen konnte, es meist nicht lange dauerte, bis er innerlich die Fäuste ballt…
Im Laufe des 20. Jahrhundert änderte sich die Eheauffassung dahingehend, dass aus der ausschließlich elterlichen Auswahl eines Ehepartners für die Tochter eine Auswahl mit Vetorecht für die Tochter wurde, später eine Entscheidung der Tochter mit einem Vetorecht der Eltern und heute eine freie Wahl von Seiten der Kinder existiert, unbeeinträchtigt von den Eltern.850 (Zwangsverheiratungen in anderen Kulturkreisen bleiben unberücksichtigt.) (AG)
Als Beispiel kann die Ehe von Ingrid und Peter gelten, für Richard eine ,unvernünftige Ehe’!
S. 214
Er selbst hatte dann nur mehr die Wahl, entweder seinen Namen in den Dreck gezogen zu sehen und sich nicht drum zu kümmern oder der sofortigen Hochzeit zuzustimmen. Was er dann wohl oder übel gemacht ha…
Zwar ist eine Altersdifferenz vorhanden, der Ehemann ist älter und reifer, jedoch hat Peter weder einen gesicherten Beruf noch stammt er aus einer gutbürgerlichen betuchten Familie:
S. 148
Für um so unverantwortlicher halte er es, einem Mädchen, das sechs Jahre jünger ist, mit Heiratsgedanken das Herz schwer zu machen, wenn man sein Studium seit Jahren nicht weiterbringe und auch sonst nichts vorzuweisen habe außer Schulde…
S. 222
Seinem Schwiegersohn ist nichts peinlich, diesem Windbeutel, der keinen Familienstolz kennt, diesem Weiberhelden und verwaschenen Sozialisten, der auf fremden Dachböden wildert und dort nur totes Inventar findet, weil seine eigene Vergangenheit, nazibedingt entrümpelt, nein, abgeschafft is…
Richards Haltung lässt erkennen, wie bedeutsam in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts der gesellschaftliche Stand (Standesdünkel) und die sozio-ökonomische Rolle des Ehepartners in Teilen der Gesellschaft noch waren. Die Heirat sollte sich, so seine Auffassung, unter sozial, wirtschaftlich und kulturell ähnlich gelagerten Menschen vollziehen,851 dies war keine ,gute Partie’.
Dabei waren Begegnungen zwischen Leuten unterschiedlicher sozialer Herkunft wie in diesem Fall im 20. Jahrhundert viel wahrscheinlicher geworden als es früher war. Die totale Überwachung der Jugendlichen ist nicht mehr möglich, es gibt im Umgang zwischen jungen Menschen Berührungspunkte, die zu Partnerschaften führen können.
Ingrid, Tochter aus dem österreichischen Bürgertum, überlässt es nicht mehr ihren Eltern, zu entscheiden, wen sie heiratet, und die Frage, ob es standesgemäß ist, stellt sich ihr nicht. Eine Erheiratung von Vermögen hat keine Relevanz, das Gefühl der Liebe ist entscheidend.
Sie schließt ihre Eltern von der Gattenwahl aus, ihre individuelle Freiheit der Entscheidung verbietet ihnen einen Einmischungsversuch, und heiratet ohne das elterliche Einverständnis. Ebensowenig kommt es zu einer Verschwägerung der Familien.
Ingrid löst sich in ihrer Entscheidung für Peter von ihrer Herkunftsfamilie - sie sieht sich nicht in der Zukunft ihrer Eltern.
S. 146
Dass er den Kontakt zwischen ihr und Peter unterbinden wird. Nur zu, das wollen wir mal sehen, … da wird er nämlich gegen eine Wand laufen, weil er nicht mit dieser wunderbaren Liebe rechnet.Die Beziehung zwischen Richard und seinem Schwiegersohn bleibt ein Leben lang unversöhnlich.
Ingrids romantische Liebesbeziehung ist verbunden mit erotischer Anziehung, Leidenschaft und bedingungsloser Liebe:
S. 149
-Mama, es ist so ungerecht, dass er sich zwischen zwei Menschen stellt, die sich liebe…
S. 159f
Als er scharrend und knirschend zum Tor setzt, deckt ein Glücksgefühl Ingrids Sorgen zu. …
Peter steigt aus, sie umarmen sich. Ingrid ist nur wenig kleiner als er. Die Becken der beiden drängen aneinander. … Noch mal ein Kuss (da bleibt ihr eh beinah die Luft weg…
Und: Weil sie sich mehr nach Vitalität sehnt als nach jener Sicherheit …
Bis in die 60er Jahre war die kindorientierte Eheschließung eines Paares üblich. Materielle und rechtliche Gründe und der Versorgungsanspruch der Frau bei der Geburt der Kinder standen in der Ehe an erster Stelle und gingen einher mit Verantwortung und Sicherheit.
Die Existenzsicherung der eigenen Familie lag weiterhin in der Verantwortung des Ehemannes und eine Familiengründung erfolgte in der Regel erst - nicht so bei Peter - wenn die berufliche Zukunft und der Verdienst des Mannes gesichert waren. Es war immer noch seine Berufsposition, die den sozialen Status des Mannes bzw. der Familie definierten, und das betont auch Ingrid:
S. 167
… auch der Titel spielt eine Rolle … ich will meine Ehe unter guten Voraussetzungen beginnen und stolz sagen können, er ist Architekt, ein Diplomingenieur.…
(AG)
Peter übernimmt die Verantwortung und fasst beruflich Fuß:
S. 307
Als Entwickler einer allgemeinen Knotenlehre hat er sich internationale Reputation erworben …
Wenn das Liebesideal und die Zuneigung zum einzigen Ehemotiv werden und die Gegenseitigkeit sich auf die Liebesbeweise bezieht, können später Gleichgültigkeit und Mangel an Achtung die Existenzgrundlage der Beziehung untergraben. Erfüllen sich die hohen emotionalen Erwartungen und Affekte, auf die die Ehe basiert, nicht, begünstigt dies die Trennung vom Partner.
In Ingrid und Peters Partnerschaft deckten sich die Erwartungen von Beginn an nicht. Ingrid lehnt das bürgerliche Leben in materieller Sicherheit, wie es ihre Eltern führten, ab und wählt einen Mann ohne Ausbildung und feste Arbeit. Sie überwirft sich zwar mit den Eltern, teilt aber im Grunde deren Werthaltungen, da ihre eigenen Erziehungserfahrungen als Kind und Jugendliche, die Beziehungsstruktur im Elternhaus einschließlich der dortigen emotionalen Nähe und gegenseitigen Unterstützung, sie geprägt haben:
S. 165ff
… wenigstens, dass die Schulden gezahlt sind, ein wenig Betriebskapital da ist und eine Wohnung ..Die Studiererei bringt dich ja nicht um, wirst sehen, und du bekommst am Ende als Belohnung mic…
Du willst doch sicher nicht, dass die Frau am End mehr verdient als der Mann …
Ihre Entscheidung für diese Partnerschaft sieht sie ambivalent:
S. 165
Du, ich denke mir manchmal alles so schön, aber gleich darauf verliere ich wieder den Mut zu glauben, dass es mit der Zeit besser wird, …
In späteren Jahren bekommt die romantische Liebe von Ingrid und Peter Risse, Konflikte und Spannungen treten auf, sogar an eine Trennung wird von Ingrids Seite gedacht:
S. 249
Im Weitergehen nimmt sie an, dass Peter und sie an diesem Tag nicht mehr viel miteinander reden werden. So ein Idio…
Elterlich-traditionelle Lebensformen waren innerhalb einer Generation infrage gestellt worden und das Ausmaß der Veränderung die ehelichen/familialen Rollen betreffend groß. Die feministische Bewegung, die sog. „sexuelle Revolution“ und die 68er Bewegung hatten den Blick auf Beziehungen verändert und trugen dazu bei, dass die Ideale der Freiheit und Gleichheit auf die Geschlechterordnung und die Partnerbeziehungen übertragen worden waren.
Die Frauenbewegung der 1970er Jahre brachte eine Auf- und Neubewertung der Frauenrolle und eine Umwertung der Männerrolle. Familien- und Ehegesetze wurden reformiert: Von nun an galt der Gleichstellungsgrundsatz des Grundgesetzes im Familienrecht, d.h. die Verpflichtung der Ehefrau zur Hausarbeit wurde aufgehoben, die Verordnung, dass die Frau nur mit dem Einverständnis des Mannes berufstätig sein durfte, außer Kraft gesetzt und im Scheidungsrecht statt der Schuldfrage das Zerrüttungsprinzip zugrunde gelegt.
Die gestiegene ökonomische Unabhängigkeit der Frauen führte zu einem Anstieg des Heiratsalters.
Beeinflusste bisher der berufliche Status und der Bildungsstand der Männer das Heiratsverhalten der Frauen852 entwickelt sich von jetzt an ein neues Frauen- und Männerbild, das die Sicht von einer Partnerschaft beeinflusste.
Parallel zur Vorstellung von der Gleichberechtigung von Mann und Frau ergab sich ein neues Leitbild: Das der partnerschaftlichen Ehe löste das der Hausfrauenehe ab. Frauen und Männer waren nun gemeinsam für Haushalt und Kindererziehung verantwortlich. Dies fand in der Bevölkerung große Verbreitung: „Über das Vehikel Prominenz wurden in den Programmzeitschriften im Verbund mit dem Fernsehen neue Lebens- und Verhaltensoptionen sowie Werthaltungen präsentiert, die auch in anderen Teilen der Zeitschriften aufgenommen und reflektiert wurden. Dabei wurde ein gesellschaftlicher Wertewandel propagiert, der den Abbau konservativer Lebensformen im Bereich von Ehe und Familie ab Ende der Sechziger Jahre unterstützte.“853
Philipp beweist, dass der Stellenwert der Ehe und ihre Exklusivität im Zuge der Säkularisierung und Entweihung der Institution Ehe heute ein anderer ist. Rechte, die früher mit einer Eheschließung verbunden waren, sind heute von ihr abgekoppelt, wie z.B. die Sexualität, die unabhängig von der Ehe gelebt werden kann, die Gleichstellung von ehelichen und nichtehelichen Kindern, die Selbständigkeit der Frauen, die in der Versorgung nicht mehr vom Ehepartner abhängig sind, die Möglichkeit der Gründung eines Hausstandes unabhängig vom Familienstand - all das macht eine Eheschließung nicht mehr zwanghaft notwendig.
Forscher glauben eine nachlassende Eheneigung zu erkennen:
Die Wahrscheinlichkeit der Heirat von Personen im heiratsfähigen Alter in Deutschland und Österreich sank auf 70%.854
S. 13f
Wenig später verabschiedet sich Johanna. Sie küsst Philipp, bereits mit einer Wäscheklammer am rechten Hosenbein, und verkündet, dass es so mit ihnen nicht weitergehen könn…
- Typisch, fügt sie hinzu, nachdem Philipp ausgesehen hat, als wolle er zu einer Antwort ansetzen, dann aber nichts herausbrachte: Keine Antwort, somit auch kein Interesse, nicht anders als für deine Verwandtschaf…
- Dann haben wir das auch besproche…
Johanna stickt klingelnd in die erste Seitengasse und klingelt noch, während Philipp sich eine Zigarette ansteckt und überlegt, warum sie ihn besucht hat. Warum? Warum eigentlich? Er kommt zu keinem Ergebnis. Einerseits will er sich keine falschen Hoffnungen machen (sie hält ihn für nett, aber harmlos und hat sich deswegen schon einmal für einen anderen entschieden)S. 94
Bei der Gelegenheit fällt ihm auch wieder ein, wie selbstverständlich er sich vor einigen Jahren damit abgefunden hat, Nummer zwei zu sein, wie anstandslos er sich seit Johannas Heirat mit der stundenweisen Liebe begnüg…
Doch sogar in dieser nicht-ehelichen Beziehung zwischen Phillip und seiner Freundin gibt es die traditionelle Geschlechterrolle: Johanna organisiert die Arbeit am geerbten Haus: S.101
Halb stolz, halb spöttisch teilt sie ihm mit, dass sie sich mit einem Bekannten aus dem Baugewerbe verständigt habe, und trotz der von ihr detailliert wiedergegebenen Schilderung der Zustände, die am Dachboden der Villa herrschen, würden sich morgen in aller Früh zwei Schwarzarbeiter auf dem Anwesen einfinde…
Letztendlich sind es die instabilen wirtschaftlichen Verhältnisse von Phillip und seine fehlende soziale und berufliche Verantwortung, die eine dauerhafte Beziehung mit Familiengründung verhindern.
S. 98
- Und deshalb drehst du dir lieber deine eigenen Geschichten zusammen, ja? Aber selbst dafür könnte ich dich bewundern. Ich glaube, das könnte ich, wenn du nicht eitel wärst, also wirklich dran arbeiten würdest, …
Er ahnt schon, dass Johanna wider am Boden der Wirklichkeit angelangt ist mitsamt der Erkenntnis, dass er, Philipp Erlach, nicht der Mann ist, der Johanna Haus aus ihrer kaputten Ehe reiß…
S. 377
- Das hätte ich mir denken können, dass ich dir zwei Arbeiter schicke, die dir den Rücken freihalten sollten für die Familienfront, und du verwendest die freigewordenen Energie dafür, diesen trostlosen Figuren hinterherzulaufen. Da kann ich nur sagen, viel Glück. Hoffentlich holst du dir bei den beiden eine Injektion Tatendrang in Sachen Scheiße beiseite räume…
19.3. Ehe und Geschlechterbeziehung in der ehemaligen DDR
War die Entwicklung im anderen Teil Deutschlands ähnlich?
In der DDR gab es wie anderswo die Liebesheirat mit der Vorstellung von einem glücklichen Leben und mit Glückserwartungen, die sich allzu oft nach wenigen Jahren als Utopie erwiesen.
Zum staatlich gesteuerten Leitbild in der DDR gehörten eine für das Leben geschlossene Ehe, später nicht mehr als unauflösbar betrachtet, und in den 80er Jahren durch voreheliche Partnerschaften und Scheidungen erweitert.
Kinder galten in der DDR als der Sinn und das Glück der Ehe. Beide Ehepartner sollten, entsprechend dem Frauenbild im Sozialismus, ihren Anteil an deren Erziehung, Pflege und im Haushalt leisten, (siehe: „Frau in der DDR“) jedoch sah man Mutterschaft nicht mehr als lebenslange Erfüllung an - im Durchschnitt wurden zwei Kinder aufgezogen, dies verkürzte die Mutterschaft der Frau - und man legte stattdessen den politischen Schwerpunkt auf das Gefühls- und Berufsleben der Frau.
In der sozialistisch geprägten, auf der Ideologie des Marxismus basierenden DDR war von Anfang an nicht das traditionelle Modell der Versorgungsehe sondern die Partnerschaftsehe verbreitet. Als ihre Grundlage galt die finanzielle Unabhängigkeit beider Partner, so dass eine Trennung bzw. Scheidung jederzeit möglich war. Damit gab es keinen finanziellen Zwang zur Eheschließung oder zum Verbleib in der Ehe.
(ER)
Irina und Kurt Umnitzer durchlaufen das übliche Vier-Phasen-Modell einer Lebenslaufbiografie: 1.die Phase der jungen Ehe ohne Kinder, 2. Ehe mit Kind (Kleinkinder, Präadoleszenz, Adoleszenz),3. die nachelterliche Gefährtenschaft, als der Sohn bereits früh aus dem Elternhaus scheidet und 4. die Phase als zurückbleibendes Elternteil, Kurt in diesem Fall, zunächst mit neuer Partnerin, dann krank und alleinlebend.855
Ein zentraler Entwicklungsschritt im Lebenslauf einer Person war die erste Paarbeziehung und damit oftmals, als Markierung des Erwachsenenstatus, der Auszug aus dem Elternhaus.
Das Zusammenziehen mit einer Partnerin signalisiert die Ernsthaftigkeit der Paarbeziehung, weil es aber zu Beziehungsbeginn oftmals nur unvollständige Informationen über den Partner gab, erfolgt bald schon eine Trennung.
Die DDR zeichnete sich ähnlich anderer kommunistischer Länder durch ein niedriges Alter bei der ersten Eheschließung aus. Die Ehe hatte für die Frauen aufgrund der eigenen Erwerbstätigkeit und der Ganztagsbetreuung der Kinder keinerlei ökonomische
Sicherungsfunktion, eher waren es die Rahmenbedingungen auf dem Wohnungsmarkt, die die Gründung ehelicher Gemeinschaften als Lebensform in der DDR erleichterten: Zweckrationale Gründe zur Eheschließung wie der Erhalt einer Wohnung und die Inanspruchnahme eines Ehekredits waren bedeutsam. Nicht selten wählten junge Menschen Heirat und Ehe als Ersatz für fehlende Freizeit- und Erlebnismöglichkeiten.856
Saschas Beziehungs- und Partnerschaftsbiographie beginnt mit der ersten ernsthaften Paarbeziehung zu Christina, als er zum Wehrdienst muss.
S. 222
… das Mansardenzimmer aber auch sein Mansardenzimmer seine „Heimatadresse“, seit er vor fast einem Jahr hier eingezogen war (noch als Schüler und unter dem Protest seiner Eltern…
Er neigt dazu,mit einer Partnerin zusammenzuziehen. Die Beziehungsstabilität ist gering und es kommt wiederholt zu Partnerschaftstrennungen:
S. 62
Immer zog er sofort mit den Frauen zusammen, anstatt erst mal abzuwarten, sich ein bisschen kennenzulernen. Mal zu schauen, ob das überhaupt gin…
Als Vater ist er mit der Mutter seines Kindes zunächst liiert. Wir lesen von einer Institutionalisierung der bestehenden Partnerschaft:
S. 293
- Wir haben dir damals abgeraten, Hals über Kopf zu heiraten, eine Frau, die du kaum kennst. Wir haben dir abgeraten, ein Kind in die Welt zu setzen mit zweiundzwanzi…
In der nachfolgenden Generation von Markus gelten andere „partnermarktrelevante Kontexte“ zur Begegnung mit Frauen.857 Ein Geschlechterungleichgewicht in Ostdeutschland zu Lasten der Männer erschwerte die Partnersuche, und auch win ländlicher Wohnort wirkte sich negativ aus. In Berlin, dem städtischen Raum, ist der „Partnermarkt“ effizienter organisiert und größer - aber anonymer und für Markus nicht unbedingt erfolgversprechend in den Bars, die er besucht:
S. 374ff
Kurz vor Mitternacht kamen sie am Bunker an.Es gab nur noch den Sound und das bleckende Licht und die wabernde Menge und die unerreichbar fernen GoGos auf den Boxen, die ihre Haare herumwarfen und ihren Bauch kreisen ließen…
eine Weile hatte er eine Art unsichtbaren Körperkontakt mit einer kleinen, sportlichen, schmutzig blonden Frau in einem ausgeleierten Top, das andauernd verrutschte.hatte Augensex mit einer zerrissenen Strumpfhose, mit schwarzen Zombieauge…
… und irgendwann später, nachdem jeder von ihnen zwei Black Russian getrunken hatte, knutschten sie in einem Gang rechts vom Klo., er erkundete die tatsächliche Größe ihrer Titten, fummelte auch ein bisschen zwischen ihren Beinen herum, aber mehr war bei ihr nicht dri…
Auch wenn Frau und Mann meist auf dem gleichen Bildungs- und Qualifikationsniveau heirateten, gab es häufiger als in der Bundesrepublik heterogene Intelligenzfamilien mit einer Differenz im Bildungsniveau. Das hohe Ansehen der Arbeiterklasse führte dazu, dass in der DDR Paare über die Klassenschranken hinweg heirateten: Nicht nur männliche Angehörige der Intelligenz heirateten Frauen mit geringerer Qualifikation, auch umgekehrt heirateten Frauen mit hoher Bildung Männer mit geringerer Qualifikation. Solche Ehepaare mit Ehepartnern aus unterschiedlichen Schichten sind sozial heterogen und bringen unterschiedliche Interessen und Werte, Alltagserfahrungen in die Beziehung mit ein. Vieles muss ausgehandelt werden, was die Beziehung anfälliger macht als in homogenen Familien.
(ER)
Charlotte als Akademikerin ist mit einem Arbeiter verheiratet. Das Gerüst der Beziehung ist die gemeinsame politische Einstellung. Unterschiede gibt es in der Sprache, im Intellekt, beides entwickelt mit den Jahren ein immer größeres Konfliktpotential: S. 122
Sie war Sektionsleiterin an einer Akademie - und was war Wilhelm? Ein Nichts. Ein Rentner, vorzeitig pensioniert. Sie selbst hatte ihn ermutigt, den Posten des Wohnbezirksparteisekretärs zu übernehmen. Das war der Mann, der den Parteibetrag der zehn oder fünfzehn Veteranen zwischen Thälmannstraße und OdF-Platz kassierte - nichts weite…
S. 401
Sie war Institutsdirektorin geworden mit vier Jahren Haushaltsschule!.während andere den Vaterländischen Verdienstorden bekame…
Die Ehe zwischen Charlotte und Wilhelm ist von Intrigen und Verheimlichungen und zunehmender Rücksichtslosigkeit von Wilhelms Seite geprägt.
S. 82
- Na, dann woll’n wir mal sehen, was ihr da angerichtet hat für ein’ Affenfraß, sagte Wilhelm und stolzierte in den Salo…
S. 1…
- Sind die Blumen beschrifte…
- Herzlichen Glückwunsch, sagte Charlott…
Sie sah aus wie ein Voge…
- Ich weiß, dass ich Geburtstag habe, sagte Wilhelm.S.193
- Lisbet…
- J…
Sie blieb stehe…
- Wenn ich mal tot bin, hat sie mich vergifte…
- Aber Wilhelm, wie kannst du denn so was sage…
- Ich sage, was ich sage, sagte Wilhelm. und ich will, dass du’s weiß…
S. 330
-.. und bitte, Kurt, wenn du jetzt reingehst, kein Wort über irgendwelche Ereignisse. Du weißt schon: Ungarn, Prag . Und nichts über die Sowjetunio…
- Und nichts über Polen, sagte Kur…
- Genau, sagte Charlott…
- Und nichts über das Weltall und nichts über den Mond, sagte Kur…
Beide stehen stellvertretend als überzeugte Kommunisten für die Politiker des Politbüros, die sich in Machtkämpfen verwickelten.
19.4 Voreheliche Liebe und sexuelle Beziehungen im Bürgertum und heute
Die veränderte Bedeutung von Ehe und die Frage nach deren Sinnhaftigkeit steht im Zusammenhang mit der veränderten Sichtweise von vorehelicher Sexualität.
Bis ins 18. Jahrhundert war sexuelles Verhalten ein Teil der christlichen Sittlichkeit und Geschlechtsverkehr und Sexualität begrenzt auf die Zeugung von Nachkommen in der Ehe. Religiöse Diskurse in der Amtskirche selbst sahen die Keuschheit als einen bevorzugten und privilegierten Zustand an, und noch bis ins 15. Jh. war die Lust an der sexuellen Vereinigung eine lässliche Sünde - das Eheleben, wenn es nicht der Fortpflanzung diente, sollte keusch sein. 858 Was jedoch keineswegs hieß, dass sexuelle Enthaltung Askese bedeutete - mit inhärent menschlichen Trieben sollte durch Lustbeherrschung maßvoll umgegangen werden.859
Innerhalb der Diskussion über die Liebesheirat wurde Sexualität, ein bisher tabuisiertes Thema, nicht mehr ausgeklammert, sondern u.a. in der damaligen pädagogischen Literatur angesprochen. Forderten die einen eine freie Sexualität in der Ehe, war für andere Triebhaftigkeit unmoralisch und wollten ihr mit religiösen und sittlichen Normen Einhalt bieten, statt sie als menschliches Bedürfnis zu akzeptieren.860
Kernmerkmal der bürgerlichen Gesellschaft war die Distanzierung und Tabuisierung von Körperlichkeit und Sexualität.861. Der im Bürgertum verbreitete Protestantismus entwickelte eine Prüderie zwischen den Geschlechtern und „die notwendige Kontrolle der Affekte und Emotionen erstreckte sich auch auf die Sexualität.“862 Man forderte keusches Verhalten und erlaubte Sinnlichkeit und Sexualität nur als „eheliche Pflicht mit dem Ziel der Sexualität als Zeugung legitimer Nachkommen.“ (TM)
Thomas Mann erwähnt keine sexuellen Handlungen bzw. Erotik, anders als die Autoren der modernen Romane. Bürgerliche Moral disziplinierte Sexualität, verlangte Distanz und Scheu und tabuisierte die Lust, wie zwischen Morten bzw. Grünlich und Tony:
S. 144
Sie antwortete nicht, sie sah ihn nicht einmal an, sie schob nur ganz leise ihren Oberkörper am Sandberg ein wenig näher zu ihm hin, und Morten küsst sie langsam und umständlich auf den Mund. Dann sahen sie nach verschiedenen Richtungen in den Sand und schämten sich über die Maß…
Das individuelle Begehren zwischen ihr und Morten ist von der Konvention bestimmtes Verhalten. Obgleich sie und Morten die Möglichkeit gehabt hätten, sich direkt zu berühren, spüren sie scheinbar keine Begierde.
Erst in der Verlobungszeit durften sich die Paare körperlich näher kommen und Küsse austauschen: (TM)
Grünlich hält sich zurück, was Tony erstaunt aufgrund seines vorherigen Drängens. Sein Verhalten wird vor dem Hintergrund des tatsächlichen Ausmaßes seiner ökonomischen Lage und seiner Heiratsmotive später begreiflich.
S. 161
Hie und da freilich, wenn er zufällig mit ihr allein geblieben war, konnte eine scherzhafte, eine neckische Stimmung ihn überkommen, konnte er den Versuch machen, sie auf seine Kniee zu ziehen, um seine Favoris ihrem Gesichte zu nähern, und sie mit vor Heiterkeit zitternder Stimme zu fragen: „Habe ich dich doch erwischt? Habe ich dich doch ergattert?.“ Worauf Tony antwortete: „O Gott, Sie vergessen sich!“ und sich mit Geschicklichkeit befreit…
Das späte Heiratsalter im Bürgertum bedingte eine lange Jugendzeit, die auch Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht ermöglicht hätten, wenn nicht Eltern und Pädagogen den Umgang durch die Unterdrückung des Sexualtriebs reglementiert und die Beherrschung der Begierden mit dem Verbot des körperlichen Kontakts zwischen Jungen und Mädchen gefordert hätten. Aufklärung, wenn überhaupt, fand durch die Mutter und durch Lesestoff statt.863 Die Trennung von Eltern-Schlafzimmer und Kinderzimmer verbarg die Sexualität der Eltern.
Erst mit einer Heirat legitimisierte man die Sexualität. Sie war nun eine eheliche Pflicht und beendete die Lebensphase der Jugendzeit, in der der Mensch sich zur autonomen Persönlichkeit entwickelte.
(TM)
Tony B. erlebt als junge Frau des Bürgertums den ersten sexuellen Kontakt in der Ehe und „fand es widerlich“:
Die Erwartungen des Vaters, dass die Bewältigung des Alltags eine Annäherung bringen würde, erfüllen sich nicht. Die Ehepartner können auch in der Ehe nicht zueinanderfinden.
S. 213
Er wusste wohl, dass sie in diese Verbindung nicht aus Gründen der Liebe gewilligt hatte, aber er rechnete mit der Möglichkeit, dass diese vier Jahre, die Gewöhnung und die Geburt des Kindes vieles verändert haben konnten, dass Tony sich jetzt ihrem Manne mit Leib und Seele verbunden fühlen und aus guten christlichen und weltlichen Gründen jeden Gedanken an eine Trennung zurückweisen konnte.…
S. 217
Sprich offen zu mir, Tony, hast du in diesen Jahren der Ehe deinen Mann lieben gelernt…
„Ach, was fragst du, Papa!. Ich habe ihn niemals geliebt. er war mir immer widerlich. weißt du das denn nicht.…
Bei Frauen und Männern wurden hinsichtlich der vorehelichen Sexualität unterschiedliche Maßstäbe angelegt: Frauen galten als asexuelle und unschuldige Geschöpfe, wurden keusch erzogen und waren oftmals unaufgeklärt und unwissend in Bezug auf sexuelle Themen. Sie hatten streng die Normen der Sitte und Moral zu befolgen und unschuldig vor der Ehe und ehelich treu sein. Jungfräulichkeit galt als Zeichen von Sittsamkeit und Tugend. Die Eltern achteten darauf, dass die Tochter „unberührt" in die Ehe ging. Ein voreheliches sexuelles Verhältnis wäre ein Makel für die „Ehre“ einer Bürgerstochter gewesen und hätte das Ansehen der Familie geschmälert.
Die bürgerliche Frau erhielt Orientierung für die o.g. propagierten asketischen Normen in der Literatur und Kunst, große Denker der damaligen Zeit lieferten die entsprechenden philosophischen Begründungen:
Fichte z.B. sah die Frauen als Mittel zur Befriedigung des Mannes, sie galten für ihn als niemals selbständig handelnde Subjekte. Aktivität in der Sexualität schrieb er dem Mann zu, während die Frau als passiv galt und Triebkontrolle üben musste.864 Rousseau gab der Sexualität einen besonderen Stellenwert und sprach Frauen und Männer gleich starke sexuelle Triebe zu. Die Frau aber sei auf die Erregung durch den Mann angewiesen und müsse Keuschheit und Widerstand vortäuschen, der Mann dagegen verfüge über eine geringere physische und sexuelle Kraft und liefe Gefahr, von Frauen sexuell geschwächt zu werden. Eine Kontrolle der weiblichen Sexualität sei daher auf jeden Fall erforderlich.865
Während die bürgerliche Frau als ein sittsamer Mensch galt, wenn sie eine gute Haufrau, Gattin und Mutter war, sah dies in sexueller Hinsicht beim Ehemann anders aus: Ihm entschuldigte man einen Fehltritt, - konnte er diesen doch in der Berufswelt durch Tüchtigkeit und Erfolg wettmachen.866
Bei Männern tolerierte man das Sammeln vorehelicher Erfahrungen und sexuellen außerehelichen Verkehr, nicht selten mit weiblichen Angehörigen unterer sozialer Schichten, Dienstmädchen, Angehörigen des Kleinbürgertums oder Schauspielerinnen. Sie waren seine „Lehrmeisterinnen“, ihnen unterstellte man sexuelle Bedürfnisse. In Liebschaften mit ihnen durften sie sich „die Hörner abstoßen“ und ihre Sexualität ausleben.867 Junge Bürgerinnen dagegen durften nicht kompromittiert werden und hatten jungfräulich in die Ehe zu gehen.
In der Ehe kompensierten die Männer sexuelle Entbehrungen durch Bordellbesuche. So wurde Sexualität in die verbotene Welt der Heimlichkeit abgedrängt, die sog.bürgerliche Doppelmora…
(TM)
Thomas und seine Affäre mit dem Blumenmädchen offenbart dies:
S.167
Aber wird dich nicht weg, hörst du, Anna?. Denn bis jetzt hast du dich nicht weggeworfen, das sage ich dir!“ Sie weinte in ihre Schürze, die sie mit ihrer freien Hand vors Gesicht hiel…
„Und du?. Und du?…
„Das weiß Gott, Anna, wie die Dinge gehen werden! Man bleibt nicht immer jung. du bist ein kluges Mädchen, du hast niemals etwas von heiraten gesagt und dergleichen…
„Nein, behüte!. dass ich das von dir verlange…
„Man wird getragen, siehst du. Wenn ich am Leben bin, werde ich das Geschäft übernehmen, werde eine Partie machen. ja, ich bin offen gegen dich, beim Abschied. Und auch du. das wird so gehen…
Aus Christians Beziehung zur Schauspielerin Aline Puvogel ist ein Kind hervorgegangen: S. 405
„Du meinst Aline. Das dritte Kind, das kleine Mädchen, das seit einem halben Jahre da ist. es ist von mir.…
„Esel…
„Sage das nicht, Thomas.. Was aber Aline betrifft, so ist sie durchaus nicht minderwertig! so etwas darfst du nicht sagen. Es ist ihr keineswegs gleichgültig, mit wem sie lebt, und sie hat meinetwegen mit Konsul Holm gebrochen, der viel mehr Geld hat, als ich, so gut ist sie gesinnt.S. 576
Aber ich habe dir doch gesagt, dass ich Verpflichtungen habe! das letzte Kind, die kleine Gisela…
„Ich weiß von keiner kleinen Gisela und will von keiner wissen. Ich bin überzeugt, dass man dich belügt. Jedenfalls aber hast du einer Person gegenüber, wie der, die du im Sinne hast, keine andere Verpflichtung, als die gesetzliche, die du wie bisher weiter erfüllen magst…
(AG)
Dieser sexuellen Sozialisation, nach der sich Sexualität lediglich zwischen den Ehepartnern zu vollziehen hatte, sind Richard und Alma noch verhaftet, sie wurden von ihren Eltern im kirchlichen Sinn erzogen:
S. 351
… erinnerst du dich, wie wir mit den Fahrrädern in Italien waren, 1929, noch vor der Hochzeit, streng dich an, Richard, dein oberkatholischer Vater hätte dich ums Haar erschlagen, weil es noch vor der Heirat war …
Alma als gebildete und junge Frau ist ein Beispiel für die Modernität und Unverklemmtheit in den Anfangsjahrzehnten den 20. Jahrhunderts:
S. 196f
Sie blicken einander an. Richard fällt ein, was Ludwig Klages vor mehr als zwanzig Jahren behauptete: Wenn in einer Ehe die beiden Partner sexuell übereinstimmen, ist alles andere weniger wichtig. Er und Alma hörten Klages gemeinsam bei einem Vortrag im Bösendorfersaal, und Richard betrachtete es von da an als Garantie, dass Alma und er immer eine gute Ehe haben würden. …
In seiner Jugend hätte er nie zu hoffen gewagt, einer Frau mit Bildung zu begegnen, die er nicht jedesmal unter Anwendung von Rhetorik würde dazu bringen müssen, mit ihm ins Bett zu gehen.Almas sexuelles Bedürfnis, stets bezogen auf das Eheleben, verändert sich mit den Jahren:
S. 197
- Mir war in letzter Zeit, als bedeute es dir nichts meh…
- Es hat mir in der Tat schon mehr bedeute…
Richard pflegt als Ehemann und Familienvater eine ,bürgerliche Doppelmoral’ mit außerehelichen Verhältnissen.
Mitte des 20. Jahrhunderts kam es zu einer Liberalisierung der Sexualmoral und zu mehr vorehelichen Partnerschaften. Die moralische Bindung von Fortpflanzungsabsicht und sexuellem Erleben, wie es die katholische Kirche propagierte, verlor aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung ( s.o.) ihre Bedeutung, und mit der Frauenbewegung kam es auch zur sexuellen Gleichberechtigung der Frau. Die Geburtenkontrolle konnte das generative Verhalten, eine ungewollte Schwangerschaft und die Kleinhaltung der Familie realisieren. Sexualität diente von nun an nicht mehr wie in der traditionellen Verhaltensweise der Reproduktion sondern der Selbstverwirklichung, war eine schnell erreichbare Lust ohne langfristige Folgen.
Als Grundelement der Partnerbeziehung trat statt der ökonomischen Motive die emotionale Komponente, die sexuelle Anziehung, in den Mittelpunkt. Die Partnerwahl erfolgt nach psychischen, sexuell-erotischen und ästhetischen Aspekten. Erotik und Sexualität wurden die zentralen Punkte einer emotionalen Beziehung und haben bis heute eine wichtige Bedeutung für die Ehe.
(AG)
Ingrids Generation hat zur Sexualität ein anderes Verhältnis als die „asketischverspannten Vorgänger“.868
Die Eltern bleiben bzgl. der hetero-sexuellen Beziehung ihrer Tochter unwissend, werden auch unwissend gehalten, wobei anzunehmen ist, dass die Mütter eher auf der Seite der Kinder stünden und auch Alma Ingrid unterstützen würde.869
5. 150(Richard-Ingrid)
- Dann kann ich mich darauf verlassen, dass du mir keine weiteren Dummheiten machs…
Sie findet, dass es Ansichtssache ist, was man unter Dummheiten versteht, und so nickt sie …
S. 151(Alma-Ingrid)
- Ich sollte einmal anfangen, deinen Zyklus mitzuschreiben, wäre neugierig, was dabei herauskomm…
- Hack du nur auch auf mir heru…
- Ich hack nicht auf dir herum. Mich beschäftigt, wie es dir geht. Aber du musst auch ein Minimuman Verständnis für deine Eltern aufbringen.
In der Sexualität zwischen Ingrid und Peter und zwischen Philipp und Johanna, die jenseits der strengen Tabus der vorherigen Genration ausgeübt wird, ist die spontane erotische Anziehungskraft ganz offensichtlich ein Kriterium der Bindung und hat die Dominanz des Mannes außer Kraft gesetzt. Das veränderte Verhältnis zur Zeit führt dazu, dass vor der sexuellen Hingabe keine langwierigen Handlungen/Initiationen vom Liebhaber verlangt werden: Die erotische Befriedigung wird nicht mehr aufgeschoben und der Entschluss zum Zusammenlebens kommt später. Wir lesen, wie Sexualität zur sinnlichen Körperlichkeit wird und ein Ausdruck gegenseitiger Anziehungskraft ist. Die Beziehungen sind emotional hoch aufgeladen:
S. 173
Ingrid steht auf, umarmt Peter und küsst ihn mit der Zunge. Sie fährt mit den Händen in die Gesäßtaschen von Peters Jean…
S. 177
Er legt seine vom Arbeiten mit Papier trockenen Hände auf ihre Hüften, er berührt ihre Hinterbacken, drückt, betastet, streichelt ihren Rücken, wo die Nieren sind. Seine Hände legen sich um ihre Brüste, kreisen dort. …
Sexualität ist bei Ingrid und Peter noch ein Vorspiel zur Heirat und wird im Sinne der Liebe und Treue in der Ehe kanalisiert.
Die leidenschaftliche erotische Liebe als ehestiftenden Motiv ist etwas, was in der Romantik des 18. Jh. bereits auftauchte, dann in der Zeit des Bürgertums zurückgenommen wurde, aber heute die Vorstellung von Liebe und Ehe beeinflusst: Der lust- und erlebnisorientierte Aspekt der Sexualität steht im Vordergrund, so wie in der auf Ingrid folgenden Generation Philipp augenblickliche Lustgefühle hastig auslebt und die Liebe auf Zeit mit Frauen sucht, die entweder gebunden sind oder mit denen er keine Beziehung auf Dauer haben wird. Bei ihm rückt die befriedigende Sexualbeziehung in den Vordergrund, der sexuelle Trieb unterwirft sich dem freien Spiel seiner Bedürfnisse. Sexuelles Begehrtsein ist ein Zeichen der Attraktivität geworden.
S. 233
Er begehrt sie(Johanna)mehr, als er sie versteh…
S. 96
Vom oberen Stockwerk hat Philipp eine Federkernmatratze heruntergeschafft, sie frisch bezogen und unter das Fenster gelegt. Zu dieser Matratze zieht Philipp Johanna hin. Er ist nervös, aber nicht wegen der Großeltern, die als erkaltetes Abbild eines Brautpaares von der Wand aus zusehen, sondern im Wissen, dass er mit Johanna schlafen und es das einzige Mal an dies…
Wochenende sein wird, … Trotzdem greift seine linke Hand von hinten zwischen Johannas sich bereitwillig öffnende Beine, mit dem Mittelfinger voran,…
Die Affäre zwischen Philipp und der Briefträgerin ist ein weiteres Beispiel dafür:
S. 281f
Die Postbotin kommt. Auch eine Postbotin sagt Bedeutsame…
-Zu mehr reicht die Zeit nich…
Sie lacht verängstigt und zieht rasch ihre Hosen hoch.…
Sie sind beide benommen und mutlos, ein wenig verlegen. Ihrer beider Abenteuerlust hat Sprünge bekommen. .. Sie küssen einander zum Abschied.…
Doch bis heute ist Sexualität von den früheren romantischen Vorstellungen durchsetzt: Intimitäten gelten als zulässig, wenn Gefühle mitsprechen und eine Liebesbeziehung vorausgesetzt wird.
In der DDR galt ein harmonisches Sexualleben als Grundlage einer stabilen Ehe und sollte der Rekreation dienen. Die kirchliche Sexualmoral, die die Sexualität der Geburt von Kindern unterordnete, hatte keine Bedeutung mehr, die tabuisierten Sexualbeziehungen für die Frau lösten sich auf und sexuelle Betätigung wurde zu einer Sache der Partnerschaft und des Individuums.
Es kam häufiger zur Aufnahme sexueller Beziehungen zu anderen Partnern - und in Verbindung damit nicht selten auch zu Verunsicherung und Belastung.
(ER)
Ein Partnerwechsel ist in den DDR-Romanfamilien öfter anzutreffen. Intimität, stets verbunden mit dem Gefühl der Verantwortung füreinander, erfolgt schon nach kurzer Zeit. Als Saschas Partnerinnen sind erwähnt: Christina, seine Ehefrau Melitta, mit der er ein Kind hat, Catrin und Marion.
S. 222
… Christinas Mansardenzimmer, aber auch sein Mansardenzimmer, seine „Heimatadresse“, seit er vor fast einem Jahr hier eingezogen war (noch als Schüler und unter Protest seiner Eltern…
S. 268
Aber Melitta wollte keinen Kognak. sondern lieber Wasser.die beiden jungen Leute warfen einander einen Blick zu - und da kapierte Irina plötzlic…
Da kapierte sie, dass diese Frau..im Begriff war, sie, Irina Petrowna, wahres Alter: noch keine fünfzig, zur Oma zu mache…
S. 62
Nein, sie hatte nichts gegen Catrin, dachte Irina. Natürlich, es ging sie nichts an. Und sie hütete sich, auch nur ein Sterbenswörtchen zu sagen. Dennoch wunderte sie sich, das ein so gut aussehender, intelligenter junger Mann keine bessere Frau fand. Schauspielerin, angeblich. Sah er denn wirklich nicht, dass diese Frau hässlich wa…
S. 409
Liebe Marion.In letzter Zeit passiert es häufig, dass ich an dich denke…
Kurt hat oftmals außereheliche Beziehungen und divergente Erklärungen dafür:
S. 163
Kurt fragte sich nicht zum ersten Mal, ob seine Schwäche in Bezug auf Frauen eher - wozu er als Marxist neigte _ aus den Verhältnissen zu erklären sein (nämlich aus der Tatsache, dass er den größten Teil seiner Jugend im Lager verbracht hatte) oder ob sie angeboren war, ob er sie tatsächlich von seinem Vater, den Charlotte als unglaublichen Schwerenöter darstellte, geerbt hatt…
So auch auf seiner Reise nach Moskau:
S. 162f
Nur auf das Techtelmechtel mit der Doktorandin hätte er lieber verzichten sollen, dachte Kurt. Das war dumm, dachte er, solche Dinge im Kreis der Kollegen. Obendrein war die Frau noch nicht einmal sonderlich attraktiv gewesen, sogar - im Vergleich zu Irina - beschämend unattraktiv, aber mit diesem bestimmten Blick, diesem Augenaufschlag, da war er erledigt; es ging einfach nicht ander…
Als bei Kurt die Ehezufriedenheit durch Irinas Alkoholkonsums nachlässt, nimmt er eine außereheliche Sexualbeziehung auf.
S. 348f
Kurt klingelte zweimal kurz und wartete, bis sich oben im zweiten Stock ein Fenster öffnet…
- Ich bin’s, sagte er…
Eine Stunde später lag Kurt rücklings auf Veras Bett, noch in derselben Haltung, in der Vera es ihm, wie er es nannte, „mündlich“ besorgt hatt…
Lange hatte er Veras Rücken gestreichelt und über ihre rätselhafte, seit Jahren anhaltende Bereitschaft nachgedacht, ihm gelegentlich zur Verfügung zu stehe…
Charlotte sehnt sich nach der in Mexiko unerfüllt gebliebenen Liebe zu Adrian. Sie entschied sich für die Reise in die DDR, um dort an verantwortungsvoller Stelle beim Aufbau mitzuhelfen.
S. 40
Im März begann es völlig unplanmäßig zu regnen, und Adrian mache ihr einen Heiratsantrag. Sie hatte nichts mit Adrian. Allerdings hatte sie auch nichts mit Wilhelm, der seit seiner Abwahl aus der Parteileitung sexuell inaktiv wa…
Bei Markus kommen die Beziehungslosigkeit und der Leistungscharakter der Sexualität zum Ausdruck, Versagensängste und die Frage, ob man den Erwartungen genügt und mit anderen Männern konkurrieren kann, verunsichern ihn.
S. 375
Allmählich wich die Verlegenheit aus seinen Knochen. Zwar konnte er nicht tanzen, hatte noch nie tanzen können, aber langsam wurde er locker, eine Weile hatte er eine Art unsichtbaren Körperkontakt mit einer kleinen, sportlichen, schmutzig blonden Frau in einem ausgeleierten Top. hatte Augensex mit einer zerrissenen Strumpfhose . Dann fand er die Schmutzigblonde mit den Sporttitten wieder. und irgendwann später, nachdem jeder von ihnen zwei Black Russian getrunken hatte, knutschten sie in einem Gang rechts vom Klo…
19.5 „Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet! Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang.“
Friedrich Schiller, 1799, „Das Lied von der Glock…
Im Bürgertum wurde bei einer Eheschließung zwar auf die inneren Neigungen vermehrt Rücksicht genommen und die Ehe als die Möglichkeit angesehen, das Gefühl der Liebe zu konstituieren, wichtiger aber waren die materielle Situation und der gesellschaftliche Stand der Partner. Vernunft- und Standesehen wie im Adel standen zwar im Gegensatz zu den
Reformbestrebungen und zur Idee von der Freiheit der Person, jedoch galt Liebe ohne Rückbindung an Vernunft und materielle und soziale Umstände als zu instabil für eine Dauerbeziehung. Damit war der Anspruch auf individuelles Glück nur für wenige Frauen verbindlich, und sie schickten sich in das Los einer weniger glücklichen Ehe, die im religiösen und im allgemeinen Sinne zunächst als unauflösbar galt.
19.5.1 Ehescheidung und Familienauflösung im 19. Jahrhundert
Die für Eheleute typischen Lebens- und Familienphasen sind augenfällig: Heirat/Geburt - Familienphase - nachelterliche Phase - Tod des Ehemannes/ Ehefrau, Verwitweung - Tod. Und doch lesen wir bereits im Familienroman des 19. Jahrhunderts von weiblichen Lebensläufen, in denen eine Scheidung diese Phasen unterbricht.
Die rechtlichen Grundlagen für Ehe und Scheidung waren im Allgemeinen Landrecht für die Preußischen Staaten festgelegt. In ihm galt die Ehe als ein Vertrag: „Die Ehe ist ein Kontrakt, durch welchen zwei Personen verschiedenen Geschlechts sich verbinden, vereinigt zu leben, Kinder miteinander zu erzeugen und zu erziehen und sich in ihren Bedürfnissen gegenseitig Hilfe und Unterstützung zu leisten.“ 870
Die Scheidungsgesetzgebung (= das Scheidungsrecht des Allgemeinen Landrechts) übertrug man vom Kirchenrecht, das zuvor von katholischer Seite her die Scheidung fast ausnahmslos ausgeschlossen hatte, auf die weltliche Gerichtsbarkeit. Dies galt bis zum Bürgerlichen Gesetzbuch von 1899 und war der protestantischen Ehelehre verpflichtet und zunächst sozial sensibel, denn diese eröffnete der Frau Möglichkeiten der Trennung und betrachtete sie als gleichberechtigtes Rechtssubjekt. Das liberale Scheidungsrecht wurde in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts insofern geändert, dass die Liste der Scheidungsgründe gekürzt und der Ehebruch der Frau strenger als der des Mannes bestraft wurde. Grund dafür war, dass der Mann als der Berufsmensch galt, die Frau dagegen ihre „substantielle Bestimmung“ in der Ehe fand.871
Das BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) reduzierte die Scheidungsgründe und schrieb im Familienrecht dem Ehemann größere Rechte zu, z.B. die Entscheidungsgewalt über die in der Ehe zu regelnden Angelegenheiten.
Bevor Gesetz und Gericht bei einer Scheidung aktiv wurden, zeigte ein Ortsgeistlicher zuvor seinen Einfluss durch Sühneversuche.872 Waren die Einflüsse des Ortsgeistlichen erfolglos,873 kam es zur Gerichtsverhandlung, hier galten das Schuldprinzip oder das Zerrüttungsprinzip.
Eine Scheidung kinderloser Ehen sah das Allgemeine Landrecht als unproblematisch an und nannte in diesem Fall oftmals als Scheidungsgrund eine „unüberwindliche Abneigung“. Waren Kinder vorhanden, galten als Scheidungsgründe u.a. Ehebruch, Mordversuch, Wahnsinn, „Versagen der ehelichen Pflicht“ und mündliche Beleidigungen.874
Bestimmungen über die „Trennung der Ehe durch richterlichen Ausspruch“ erweiterten die Scheidungsmöglichkeit. Dies bewirkte eine liberalere Scheidungspraxis und führte über Jahrzehnte hinweg zu 3000 Ehescheidungen pro Jahr.875
Das Allgemeine Landrecht regelte die vermögensrechtlichen Beziehungen zwischen den Eheleuten: Es sprach bei der „Verwaltungsgemeinschaft“ den Besitz der Frau nach der Auflösung der Ehe dem Mann zu, in der „echten Gütergemeinschaft“ wurde das Eigentum der Partner vereint und nach der Auflösung der Frau ihr Besitz wieder zugesprochen.
Wurde der Mann als schuldig befunden, legte man die Abfindung, die sich an den finanziellen Umständen des Mannes orientierte, durch das Landrecht festgelegt.
(TM)
Die Schuldzuweisung in den Scheidungen Tony Buddenbrook betrifft in beiden Fällen den Ehemann.
Bei Tonys erste Ehescheidung spielen folgende Gründe eine Rolle:
S. 233
„… Der Paragraph ist vollkommen klar; ich habe ihn studiert! Unfähigkeit des Mannes seine Familie zu ernähren…“
Bei der 2. Scheidung verhält es sich anders:
S. 392
„…beiderseitige unüberwindliche Abneigung“ ward festgesetz,
Die mehrheitlich von Frauen eingereichten Scheidungen fußten auf Gründe wie Trunkenheit, Ehebruch oder Versagung des Unterhalts und waren oft die Folge einer ausweglosen Ehesituation für die Frau, die nur so die Möglichkeit hatte, ein demütigendes Eheleben zu beenden. Durch die Scheidung hatte sie ein Recht auf Unterhalt, der in einer Ehe nur unzureichend gewährleistet war, wie bei Tony Buddenbrook: (TM) S. 391
… so betreiben wir Rechnungslegung sowie Erstattung meiner dos. Weigert er sich, so brauchen wir ebenfalls nicht zu verzagen, denn du musst wissen, Tom, dass Permaneders Recht an meiner dos nach seiner juristischen Gestalt allerdings Eigentum ist - gewiss, das ist zugegeben! - gewiss, dass ich aber materiell immerhin auch meine Befugnisse habe, Gottseidank…“
Ohne Mann, finanziell eingeschränkt und gesellschaftlich isoliert, lebte sie aber von nun an mit dem Makel einer Scheidung und hatte die sozialen Folgen ihres menschlichen Schicksals zu tragen.
(TM)
S. 231
Tony bezog mit Erika im zweiten Stockwerk die Zimmer, die ehemals, zur Zeit der alten Buddenbrooks, ihre Eltern innegehabt hatten…. als ihr Papa ihr mit sanften Worten auseinandersetzte, es zieme sich vorderhand nichts Anderes für sie, als in Zurückgezogenheit zu leben und auf die Geselligkeit der Stadt zu verzichten, denn wenn sie auch an dem Geschick, das Gott als Prüfung über sie verhängt, nach menschlichen Begriffen unschuldig sei, so lege doch ihre Stellung als geschiedene Frau ihr fürs Erste die äußerste Zurückhaltung auf…
S. 393
Sie überhörte mit unberührbarer Würde die wunderbar hämischen kleinen Pointen der Damen Buddenbrook, sie übersah auf der Straße mit unaussprechlicher Kälte die Köpfe der Hangeströms und Möllendopfs, die ihr begegneten, und sie verzichtete gänzlich auf das gesellschaftliche Lebe…
Meist wurden die Frauen, wie z.B. Tony Buddenbrook, in ihrer Herkunftsfamilie wieder aufgenommen, oder versuchten, eigene Einkünfte zu bekommen - wegen der fehlenden Berufsausbildung war dies schwer.
Zur Auflösung einer Ehe kam es trotz Ehekrisen in bürgerlichen Familien nur gelegentlich, die Ehescheidung war „bei den besitzenden Schichten extrem selten und wurde möglichst verhindert, und zwar nicht nur aus ideologischen, sondern auch aus materiellen Gründen. Vor allem musste eine klare und eindeutige Schuldzuweisung an einen Partner bei der Scheidung möglich sein.“876
Wenn es Unstimmigkeiten in der Ehe gab, wurden sie zunächst vor den eigenen Eltern verborgen, um ihnen eine heile Ehe vorzugaukeln.
S. 212
„Höre, mein liebes Kind“, sagte der Konsul, indem er mit der Hand über ihr Haar strich. „Ich muss dich nun etwas fragen, etwas Ernstes! Sage mir einmal. du liebst doch deinen Mann von ganzen Herzen…
„Gewiss, Papa“, sagte Tony mit einem so kindisch heuchlerischen Gesicht, wie sie es ehemals zustande gebracht, wenn man sie gefragt hätte: Du wirst nun doch niemals wieder die Puppenliese ärgern, Ton…
Oder man versuchte eine Scheidung zu verhindern, so wie Thomas Buddenbrook es bei seiner Schwester tut:
S. 381f
„Ich werde nicht nach München zurückkehren, Thomas…
„Wie beliebt?“ fragte er, indem er sein Gesicht verzog, eine Hand ans Ohr legte und sich vorwärts beugt…
„Tony“, sagte er plötzlich, indem er aufstand und seine Hand fest auf die Lehne des EmpireStuhles niedersinken ließ, „du machst mir keinen Skandal…
Ein Seitenblick belehrte sie, dass er bleich war, und dass die Muskeln an seinen Schläfen arbeitete…
„.Was willst du tun? Willst du dich scheiden lassen…
„Das will ich, Tom. Das ist mein fester Entschluss.…
„Na, das ist also Unsinn“, sagte er gelassen, drehte sich auf dem Absatze um und ging von ihr fort, als ob damit überhaupt das Ganze erledigt sei. „Zum Scheidenlassen gehören Zwei, mein Kind; und dass Permaneder sich so ohne Weiteres mit Vergnügen dazu bereit finden wird, der Gedanke ist doch wohl bloß belustigend…
S. 391
Sie solle sich gedulden und sich gefälligst noch fünfzigmal besinne…
Bestand eine Wiederverheiratungs-Möglichkeit war dies eine willkommene und damit neue soziale Rückversicherung für die Frau.
Tony sah Ihre Chancen, einen weiteren Ehemann zu finden und den durch die Scheidung geschädigten Ruf ihrer Familie zu bessern, als nicht gering an.
S. 234
„Vater“, sagte sie, „ich weiß wohl, dass dies Ereignis einen Flecken in unserer Familiengeschichte bildet. … Aber sei ruhig. es ist meine Sache, ihn wieder fortzuradieren! Ich bin noch jung. findest du nicht, dass ich noch ziemlich hübsch bin?. Alles wird durch eine neue vorteilhafte Partie wieder gut gemacht werden!…
Sie trifft bei einem Besuch in München Herrn Permaneder, aber auch diese Ehe wurde geschieden. Als Gründe könnte man anführen: der Verlust eines Kindes, eine schmerzhafte und bittere Erfahrung, die oft eine Lebens- und Ehekrise mit sich bringt, das Techtelmechtel zwischen Permaneder und der Bediensteten Babette oder auch grundsätzlich die unterschiedliche Mentalität zwischen den Nord- und Süddeutschen, die zwanglosen Umgangsformen der süddeutschen Bevölkerung, der Katholizismus und der geringe Bekanntheitsgrad ihrer Familie, der Tony in ihr Elternhaus nach Lübeck zurücktrieb.
S. 386
Wie unglücklich ich gewesen bin, du weißt es nicht, Thomas, . Aber ich habe gelitten, Tom, gelitten mit Allem, was in mir ist, und sozusagen mit meiner ganzen Persönlichkeit. Wie eine Pflanze, um mich dieses Bildes zu bedienen, wie eine Blume, die in fremdes Erdreich verpflanzt worden. Alle haben mich lächerlich hochmütig gefunden. Man hat es mir nicht gesagt, aber gefühlt habe ich es zu jeder Stunde und auch darunter habe ich gelitten. Ha! In einem Lande, wo man Torte mit dem Messer isst, und wo die Prinzen Mir und Mich verwechseln, und wo es als eine verliebte Handlungsweise auffällt, wenn ein Herr einer Damen den Fächer aufhebt, in einem solchen Lande ist es leicht, hochmütig zu scheinen, Tom! Akklimatisieren? Nein, bei Leuten ohne Würde, Moral, Ehrgeiz, Vornehmheit und Strenge, bei unsoignierten, unhöflichen und saloppen Leuten, bei Leuten, die zu gleicher Zeit träge und leichtsinnig, dickblütig und oberflächlich sind. bei solchen Leuten kann ich mich nicht akklimatisieren und würde es niemals können, so wahr ich deine Schwester bin!…
19.5.2 Ehescheidung im 20. Jahrhundert
Die gesellschaftliche Entwicklung des 20. Jahrhunderts stellte die bürgerlichen Heiratsregeln in Frage: Die Wahl des Ehepartners wurde nicht mehr von der Familie bestimmt und die Ehe verlor im Zuge der Säkularisierung und „Entweihung“ der Institution in verschiedenerlei Hinsicht an Wert.
Statt des elterlichen Arrangements setzte sich die freie Entscheidung der Kinder und deren eigene Wahl des Ehepartners durch, dabei wurde die emotionale Beziehung entscheidend, soziale und ökonomische Motive traten zurück.
Die moderne Ehe basiert auf gegenseitiger Liebe und Verständnis, die Paare unterwerfen sich nicht mehr den früheren gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und religiösen Zwängen. Demzufolge führt das Verschwinden der Liebe oft zur Trennung der Partner und zur gerichtlichen Scheidung.
Eine Dauerhaftigkeit der Paarbeziehung ist heute seltener gegeben und die rechtliche Möglichkeit der Scheidung wird viel öfter genutzt als früher: Die Scheidungsrate stieg zwischen 1881 /85 und 1971/75 von 1,5% auf 23,1 %.877 Gründe dafür, dass die Scheidungsquoten so hoch schnellten liegen im Rollenwandel der Frau, im Rückgang der religiösen Bindungen und der Individualisierung der Lebenskonzepte. Das Ich und die eigene Zufriedenheit sind die Grundlage der Existenz und das Gefühl, auf niemandem angewiesen zu sein, bedeutet individuelle Freiheit. „Man ist kaum noch bereit, um der Gemeinsamkeit willen etwas von sich aufzugeben.“878 Mit zu berücksichtigen ist dabei aber auch die längere Dauer der heutigen Ehe, sie kann in einer ehelichen Beziehung im Laufe der Jahrzehnte zu gegenseitiger Distanzierung führen.
Das neue Scheidungsrecht in den 70er Jahren machte mit der Gleichberechtigung Ernst: Die geschiedene Ehefrau stand gleichberechtigt neben dem Mann, dessen Rechte nicht selten beschnitten wurden. Sie hatte nun Anspruch auf die Hälfte des miteinander erwirtschafteten Vermögens, und eine Trennung des Vaters von den Kindern wurde möglich, wenn dies der Wille der Mutter war.
Seit der Reform des Eherechts gibt es kein Schuldprinzip mehr, sondern nur noch das Zerrüttungsprinzip. Man spricht eine Scheidung aus, wenn die Ehegatten ein Jahr getrennt leben und die Scheidung beantragt haben.
Von nun an war eine Scheidung sozial akzeptiert.
(AG)
In Geigers Roman findet sich ein Hinweis auf die neuen Scheidungsgesetze, die für Frauen als Gelegenheit gesehen werden (geäußert von einer Krankenschwester), im Ehealltag nicht mehr alles zu akzeptieren:
S. 238
- Ich bin seit 11 1/2 Jahren verheirate…
- Das schaffe ich nie, sagt Ladurne…
Und eine junge Schwester gibt ebenfalls ihren Kren daz…
- Ich auch nicht, schon gar nicht, wo hoffentlich bald neue Scheidungsgesetze kommen. Da werden wir die Männer schön angelehnt lasse…
Als Ehescheidungsrisiken gelten heute: ein geringes Heiratsalter (wie es in der DDR war), ein höheres Bildungsniveau der Frauen als die Männer (Bildungsdifferenzen); wohingegen der Besitz von Eigentum, Konfessionszugehörigkeit, eine hohes Heiratsalter und Kinderreichtum eine geringere Scheidungswahrscheinlichkeit mit sich bringen.879 Die Romane verdeutlichen, dass Frauen ihre Partnerschaft oft kritischer sehen als der Mann und höhere Erwartungen an eine Partnerschaft haben. Diese unerfüllten Erwartungen führen zu einer Instabilität der Ehe, und ähnlich wie im 19. Jahrhundert neigen heute Frauen eher dazu, die Scheidung einzureichen.880 (AG)
Ingrid stellt, wie viele Frauen, an Ehe und Familie höhere Ansprüche als ihr Mann und äußert ihre Unzufriedenheit. Sie zieht nun, wie andere Frauen, da sie in ihrer wirtschaftlichen und sozialen Existenz nicht auf ihren Mann angewiesen ist, eine Scheidung in Erwägung.881 Die finanzielle Unabhängigkeit lässt sie Konflikte in der Ehe offener austragen und die Möglichkeit der Scheidung diskutieren. Der Zeitpunkt dazu ist für sie gekommen, als das jüngste Kind aus der Phase der intensivsten Betreuung heraus ist.
S. 272
- Es ist ein Erfolg, dass wir dieses Jahr überstanden haben. Das kommende kann eigentlich nur besser werde…
Ingrids Hoffnung auf emotionale Geborgenheit und sexuelles Glück, Grundlage der romantischen Ehe, gehen nicht in Erfüllung und tragen die Ehe nur kurze Zeit.
S. 249
Die seltenen Male, die er sich für seine frühzeitigen Ejakulationen entschuldigt, sind gezähl…
Im Vergleich zu heute gab es in den 70er Jahren aber noch eine höhere normative Verbindlichkeit der Ehe mit dem Wunsch nach einer „verantworteten Elternschaft“ und einer intakten Familie - das war schlecht mit einer Scheidung vereinbar. (ein Denken, das so in der DDR nicht vorhanden war).
Auch der Sohn Philipp erlebt als Kind die Ehe seiner Eltern als konfliktreich und erklärt damit seine familiäre Unambitioniertheit’.
S. 10
Die Ehe meiner Eltern war nicht das, was man glücklich nennt. Ein ziemlich lausiges Weite…
S. 11
Aber was rede ich, fügt Johanna hinzu, familiäre Unambitioniertheit ist bei dir ja nichts Neue…
19.5.3 Scheidung in der DDR
Die Zahl der Ehescheidungen und damit die Zahl der unvollständigen Familien nahm zwar auf beiden Seiten Deutschlands zu,882 in der DDR jedoch liberalisierte sich die Scheidungspraxis durch das FGB (Familiengesetzbuch) von 1965 so sehr, dass es dort wesentlich häufiger zu Scheidungen kam als im Westen und die Auffassung, dass zur sozialistischen Gesellschaft die harmonische Ehe und Familie gehörte, ins Wanken geriet. Die Scheidungsregeln waren einfacher als in Westdeutschland: Das Trennungsjahr entfiel ebenso wie der Unterhaltsanspruch für den geschiedenen Partner. Der Ehepartner hatte die Berufstätigkeit und gesellschaftliche Arbeit des anderen zu unterstützen, und waren die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Eheleuten nach der Scheidung beendet, entfielen Unterhaltszahlungen.883
Es gab keine finanziellen negativen Folgen oder ökonomische Benachteiligungen nach einer Scheidung, da Frauen eine finanzielle und soziale Unabhängigkeit besaßen.
Leichtfertige Scheidungen sollten zwar aus Verantwortung dem Partner und den Kinder gegenüber vermieden werden, doch die fehlende Konfessionszugehörigkeit und die geringe Bedeutung des Katholizismus führten dazu, dass Ehescheidung moralisch und „gesellschaftlich entdramatisiert“ wurde884 und die Ehe an Verbindlichkeit einbüßte.
Bürgerliche Moralvorstellungen von Treue galten im Sinne der sozialistischen Ethik als überholt, wodurch es öfter als bei uns in Westdeutschland außereheliche Affären gab, die zu Trennung und Scheidung führen konnten.
(ER)
Kurts Affären sind ein Beispiel dafür:
S. 162
Nur auf das Techtelmechtel mit der Doktorandin hätte er lieber verzichten sollen, dachte Kurt …
S. 338
Immerhin hatte es den Vorteil, dass Kurt nun, da Melitta sich dem Redner zuwandte, ungehemmt ihre gemusterten Strümpfe betrachten konnte. Genauer gesagt, ihre Strumpfhose oder, noch genauer, die Stelle knapp unter dem Saum ihres Rocks ..Kurt spürte, wie sich in seinem Unterleib etwas regte, und er überlegte, ob er sich schlecht fühlen müsse angesichts der Tatsache, dass es sich um seine ehemalige Schwiegertochter handelte …
S. 348
Eine Stunde später lag Kurt rücklings auf Veras Bett, noch in derselben Haltung, in der Vera es ihm, wie er es nannte „mündlich“ besorgt hatte…
Irina weiß um die „Schwäche“ ihres Ehemannes für attraktive Frauen.
S. 253
Männer waren scharf auf komplizierte Dessous, nicht auf Wollstrumpfhosen! Oder war Sascha anders? Anders als Kurt? Der auch mit fünfundfünfzig noch nicht zur Ruhe kam, immer noch nach anderen Weibern schaut…
Am häufigsten endeten Frühheiraten in einer Scheidung: 1985 wurden 65% aller Scheidungen bei einer Ehedauer unter 10 Jahren vollzogen, zu 70% mit Kindern unter 16 Jahren - Kinder waren kein Grund, sich nicht scheiden zu lassen.
Es kam in der DDR zu einer Modernisierung der Moralvorstelllungen in Bezug auf uneheliche Kinder und Scheidungen und zu einem vorurteilsfreien Klima gegenüber Geschiedenen und ledigen Müttern.885
(ER)
Dies deckt sich mit dem Romangeschehen. Alexander geht schon früh Beziehungen ein und zieht mit den Partnerinnen zusammen:
S. 222
… seit er vor fast einem Jahr hier eingezogen war (noch als Schüler und unter dem Protest seiner Elter…
Melittas rasche Schwangerschaft findet im (Kap. „1976“) Erwähnung. Nach wenigen Jahren kommt es auch hier zur Trennung - trotz der Heirat (ein Trennungsrisikos bei unverheirateten Lebensformen ist erwiesenermaßen höher).886 Der Grund zur Scheidung bleibt unklar:
S. 294
Du kannst nicht gleich alles hinschmeißen und wegrennen, weil es mal ein Problem gibt. Das ist nun mal so in einer Ehe, dass es auch mal Probleme gibt…
- Gibt es eine andere Fra…
- Ich denke, Melitta hat euch alles erzähl…
- Melitta hat uns gar nichts erzähl…
- Nein, es gibt keine andere Frau, sagte Sasch…
- Was dan…
Sascha lacht…
- Vielleicht hat Melitta ja einen anderen Mann? Das ist ja auch eine Möglichkei…
Bei Markus klingt ein Grund für die Trennung der Eltern an:
S. 274f
Irgendwie machte es ihn erst recht wütend, wenn Muddel seinen Vater verteidigte. Er hatte sie beide verlassen - auch ihn! Er hatte seiner Mutter Dinge angetan. Zwar war er noch zu klein gewesen, um sich zu erinnern, behauptete Muddel, aber ein bisschen erinnerte er sich trotzdem daran: an das Verlassenwerden. An den Horror. An Quäldinge. Er erinnerte sich an Mudde…
Wimmern, leise, damit er nicht hörte, was sein Vater im Nebenzimmer mit ihr machte, es hatte irgendwie zu tun mit An-den-Haaren-Ziehen, mit Über-den-Fußboden-Schleifen, Frauen abschleppen, hatte Muddel einmal gesagt, obwohl ihm natürlich inzwischen klar war, dass dies etwas anderes bedeutete - aber an das Wimmern im Nebenzimmer erinnerte er sich gena…
Die junge Familie wird auseinandergerissen, nicht ohne Folgen sowohl für den Vater Alexander als auch für den Sohn Markus.
Das kritische Lebensereignis der Trennung und der Auflösung einer Familie muss bewältigt werden. Es beginnt für Sascha eine destabile Phase, er experimentiert mit neuen Lebensstilen und zieht sich von seinem Kind und von seinen Eltern zurück - nicht unbedingt aus Lieblosigkeit und Gleichgültigkeit, sondern eher aus Resignation und Hilflosigkeit.
S. 299f
- Hast du deine Diplomarbeit ferti…
- Ich schreibe meine Diplomarbeit nicht fertig. …
- Ich bitte dich, hör ein einziges Mal in deinem Leben auf meinen Rat. Du bist augenblicklich in einem labilen Zustand. Du solltest in einem solchen Zustand keine Entscheidung treffe…
- Ich bin vollkommen klar im Kopf, sagte Sasha. Ich war noch nie so klar im Kopf wie jetz…
S. 302
Was Kurt jetzt einfiel. Melitta hatte erzählt, dass Sascha neuerdings in der Bibel las. Dass er sogar irgendwie, so hatte Melitta behauptet, an Gott glaube …
Was das Sorgerecht angeht, sprach man das Kind infolge des DDR-Rechts automatisch der Mutter zu. Trotz aller Modernität spiegelt dies das konservativ-bürgerliche Bild von der Mutter als die für die Kinder Verantwortliche wider. Das Familiengesetzbuch der DDR von 1975 sah das volle Erziehungsrecht (Sorgerecht) der nichtverheirateten Mutter vor - damit war die DDR der Bundesrepublik um 23 Jahre voraus, denn hier wurde erst 1998 die nichtverheiratete Mutter unumschränkte Trägerin des elterlichen Erziehungsrechtes. Nichtverheiratete Väter erlebten in der DDR eine noch stärkere Diskriminierung als in der BRD. Sie hatten noch nicht einmal die sehr eingeschränkte Möglichkeit des § 1711 BGB, der in bestimmten Fällen ein Umgangsrecht des Vaters vorsah. Aufgrund der höheren Scheidungsrate wuchsen mehr Kinder (als in der Bundesrepublik) bei alleinerziehenden Müttern und bei nicht- leiblichen Eltern auf.
(ER)
Im Roman sieht Markus seinen Vater selten:
S.269
Nur, es gab auch etwas, das sie nicht wusst…
Hätte er es ihr sagen sollen? Sie hatte ihn nicht danach gefragt, nur irgendwie hintenrum, aber er hatte schon gewusst, woraus sie hinauswollte: Hat er denn gekocht für euch beide, solche Fragen. Wart ihr beide im Kino? Ja, wir waren im Kino - aber zu dritt. Hatte er nicht gesagt. Mit seiner Neuen. Hatte er nicht gesagt. Mit seiner Tuss…
Die negative Folgen der elterlichen Trennung auf die Entwicklung der Kinder zeigen sich bei ihm. Er wird auf der Suche nach der eigenen Identität von seinem Vater allein gelassen.
S. 286f
Markus schaute sich um, aber natürlich war sein Vater nicht da. Immer wenn man ihn brauchte, war er nicht da: jetzt, zum Beispiel, um die durchgeknallte Urgroßmutter zu fragen, ob man in den Wintergarten durfte. Zum Kotzen, einen Vater zu haben, der nie da war. Andere Väter waren da, nur er, Markus Umnitzer, hatte so einen Scheiß vater, der immer nicht da war. Der Arsc…
Frauen sahen in der Scheidung und in einer neuen intakten Ehe und weniger familialen Spannungen für sich eine Möglichkeit, zu regenerieren. Und so nahmen Wiederverheiratungen schnell zu, die Partner versuchten die mit der Ehe und Familie verbundenen hohen Erwartungen und Ziele in einer neuen Beziehung zu realisieren, wenn diese in der ersten nicht erreicht wurden.887 Das Fehlen eines Elternteils wurde damit ersetzt. In einer sog. „soziale Vaterschaft“ nahmen Männer die neue Vaterrolle an und erzogen das Kind der Frau aus der vorhergehenden Ehe/Bindung.
(ER)
Markus werden verlässliche emotionale Bindungen und Gesprächsbereitschaft von seinem Stiefvater und seiner Mutter angeboten, er fühlt aber eine kindliche Ort- und Ziellosigkeit.
S. 379
Er ließ den üblichen Psalm über sich ergehen, das Leben, der Beruf, und wenn du jetzt nicht … Und dann sollte er „Stellung nehmen“. …
Klaus wieder: Er könne sich ja auch woanders bewerben, und wenn man gute Leistungen hätte und so weiter, und Markus fragte sich, was Klaus eigentlich fr tolle Leistungen vollbracht hatt…
20. Familie und „Ganzes Haus“ - Die Familienorientierung im Bürgertum
„Die Familie ist es, die unseren Zeiten nottut…
Adalbert Stift…
Dies Zitat von Adalbert Stifter unterstreicht die Bedeutung der Familie in der damaligen Zeit und insbesondere im Bürgertum. Das Anliegen dieses Kapitels ist es, einen Eindruck der Familienentwicklung in den Generationen der letzten Jahrhunderte zu vermitteln - stets mit dem Blick auf die Romane.
Betrachtet man das Leben von Frauen/Ehepaaren /Familien im 19. Jahrhundert in Deutschland und in Österreich und der DDR im 20. Jahrhundert im Kontext der Familienentwicklung stößt man auf Prozesse, die für die eine Gesellschaft charakteristisch waren bzw. sie voneinander unterscheidet. Familie ist universell, variiert aber je nach Gesellschaftsform in ihrer Struktur in der Art, da politische Verhältnisse und der sozialgeschichtliche Hintergrund intergenerationelle Beziehungen unterschiedlich beeinflussten. Familie ist ein soziales System, historisch und kulturell geprägt, „an der gesellschaftliche Umbrüche individuell vermittelt und gedeutet werden.“ 888 Sie ist ein „Reflex historisch-gesellschaftlicher Verhältnisse und Normen“889- und dies wird in den drei Romanen deutlich:
Die Familienbilder in den Romanen sind Spiegel des soziokulturellen Lebens ihrer Zeit und ihres Ortes/Landes und die Eltern als Erzieher sind die Vermittler und Modelle von Verhaltensweisen, Weltanschauungen und Werten der jeweiligen Gesellschaft und Schicht; von ihnen imitieren Kinder Beobachtetes und Gehörtes.890
Für den Staat ist die Familie gerade wegen der von ihr vollzogenen Dienste, Erziehung von Kindern und Pflege der älteren Generation, sehr wichtig.
Als charakteristische Merkmale einer Familie gelten heute:
- Jedes Individuum wird in eine Familie hineingeboren, wächst darin auf und bleibt - auch bei Gründung eines eigenen Hausstandes - mit dieser Familie verbunden; oftmals ist die Loyalität der eigenen Herkunfstfamilie gegenüber größer als gegenüber dem Partner.891
- Das Individuum wird in dieser Familie sozialisiert, Bindungen und Beziehungen prägen seine Werte, ja, seine Existenz. In familienpsychologischer Hinsicht finden sich in jeder Familie „über Generationen hinweg Verhaltensmuster, Wertvorstellungen und Aufträge tradiert“, die jedes Mitglied der Familie, wenn es der Familie gegenüber loyal sein will, verinnerlicht.892 Loyalität bedeutet in diesem Fall die Einhaltung von bestimmten Regeln.893
- Die Beziehungen zwischen den Mitgliedern, die Rollen- und Aufgabenverteilung und die emotionale Beziehung wie Zuneigung und Ablehnung prägen das Zusammenleben.
Die von mir untersuchten Familienromane spiegeln all diese Merkmale in ihren Familien wieder und zeigen uns das Bedürfnis der Schriftsteller, von Identitäten zu erzählen, die in einer familiären Herkunft gründen.894 Es bleibt aber dennoch stets ein literarisch-familiäres Selbstverständnis.
Von seinem Ursprung her geht der Begriff der ,Familie‘ auf das lateinische Wort „familia“ zurück und meinte damals die häusliche Gemeinschaft, d.h. das ganze Haus, die Gemeinschaft von Eltern, Kindern, Verwandten und Hausgesinde, und nicht wie heute die Blutsverwandtschaft. „Familia“ waren die Menschen, die vom Grundherren abhängig waren, eine „Rechts-, Arbeits-, Konsum- und Wirtschaftseinheit“.895 In solch einem „ganzen Hause“ erstreckt sich der Segen der Familie auf Gruppen familienloser Leute, die hineingezogen werden, wie durch Adoption, in das sittliche Verhältnis der Autorität und Pietät, was für die soziale Festigung eines ganzes Volkes von tiefster Bedeutung sei, so Riehl.896 Die Familie ist, so las man damals, einer „natürlichen, gottgewollten, patriarchalischen Hierarchie verpflichtet.“897 Gustav Freytags Familienroman „Soll und Haben“ ist die Verwirklichung der Riehlschen Theorie vom „ganzen Haus“ mit seiner sozialen Harmonie, dem Frieden und einer als befriedigend empfundenen Arbeit. Die Arbeitswelt und die Erfahrung des Arbeitsplatzes wirkte in die Erziehungswelt der Familie hinein und beeinflusste das Familiengeschehen. Das „ganze Haus“ als familienwirtschaftlich fundierte Hausgemeinschaft stand im Gegensatz zu der auf Eltern und Kind reduzierten Kernfamilie und war durch Solidarität, Rollen und Arbeitsteilung geprägt, mit einer patriarchalisch-hierarchischen Struktur: vom Hausvater und Firmenchef als einer klar begrenzten und kontinuierlich gleichbleibende Autoritätsperson, den Eltern, Kindern und den Dienstboten.
Das 18. Jahrhundert stellte den Höhe- und Schlusspunkt dieser Haushaltsfamilie dar, danach begann bis ins 19. Jahrhundert hinein deren Auflösung als Wohn- und Arbeitsstätte, in der nicht mehr die produktive Arbeit im Mittelpunkt des Familienlebens stand, sondern die Sozialisations- und Beziehungsarbeit.898
Man schätzte die Bindungskräfte und Ressourcen in der traditionellen Großfamilie der Vergangenheit reichhaltiger ein als die in der später entstehenden Kleinfamilie,899 denn in ihr half man sich gegenseitig und fühlte sich verbunden. Dankbarkeit für Erziehung und Wohlstand, Respekt und Liebe verband die Kinder mit den Eltern, und man konnte Versorgung im Alter erwarten.
Historische Erscheinungsformen und Untertypen dieser ,erweiterten Familie’ sind die ,Mehrgenerationenenfamilie‘ (wenn ein oder mehrere verheiratete Sohn/Söhne mit Frau/ Frauen und Kindern mit den Eltern Zusammenleben), die ,Großfamilie als Verwandtschaftsfamilie', wenn verheiratete Söhne nach dem Tod der Eltern in ungeteilter Erbengemeinschaft, evtl. mit Vettern und Neffen/Verwandten, Zusammenleben900 und die ,Haushaltsfamilie', sie „ist exakt abgrenzbar, zum Unterschied von der Verwandtschaftsfamilie, die einen unbestimmten Kreis von Blutsverwandten und Verschwägerten umfasst.“901
P.-G. F. Le Play unterschied in diesem Zusammenhang drei Familientypen: die „patriarchalische Familie“, in der die Söhne auch nach der Heirat im väterlichen Haus blieben und sich seiner Autorität unterstellten; die „instabile Familie“, bei der die Kinder früh das Haus verließen, um sich selbständig zu machen, und die „Stammfamilie“, in der eines der Kinder mit der später eigenen Familie bei den Eltern blieb und in einem Dreigerationenhaushalt lebte; letzteres sah Le Play als ideal an.902 Diese Stammfamilie war eine der charakteristischen Familienformen in Deutschland. In ihr gab es den designierten Erben, der die leitende Position und den bestehenden Haushalt übernahm, im Haus der Eltern mit seiner eigenen Familie lebte und Interesse zeigte an der Kontinuität und Dauerhaftigkeit der Familie, die er durch materielle und andere Hilfe versorgte. Die eigenen Interessen ordneten sich denen des Mehrfamilienhaushalts unter, auch wenn dabei eine Einschränkung der eigenen freien Entscheidung und als Folge Konflikte nicht ausblieben.903
20.1 Der bürgerliche Familienverband
Als sich das Bürgertum als soziale Klasse konstituierte, entstand mit ihm neben der bürgerlichen Lebensweise eine neue Familienideologie mit einer Aufwertung der familialen Beziehungen.
Eine Einbeziehung des Gesindes in Form des „ganzen Hauses“ gab es im Bürgertum nicht, stattdessen distanzierte man sich von den Dienstboten, die nicht in die familiale Privatsphäre vordringen sollten.
Aufklärung, Säkularisierung, Individualisierung und die Emotionalisierung als Form der Empfindsamkeit beeinflussten als sozio-kulturelle Strömungen das Miteinander der Familienmitglieder. Das Bürgertums galt als sozial isoliert. Es fehlte ihm die ständische Verortung904 und genau aus diesem Grund bildete die Familie die Keim- und Kernzelle des gesamten bürgerlichen Lebens und „musste in Opposition zur höfischen Gesellschaft entwickelt und gefestigt werden.“ 905„Fehlende ständische Garantien und Regelungen ersetzend, stellte die Familie eine zentrale Instanz personaler Unterstützung und Förderung dar, ohne die der einzelne den Zufällen und Widrigkeiten seiner sozialen Umwelt ungeschützt ausgesetzt gewesen wäre.“906
Familie wurde zum Zentrum bürgerlicher Ideologie, und nur eingebunden in eine Familie galt eine Person als ein vollwertiger Mensch. (In Auftrag gegebene Familienporträts bürgerlicher Familien setzten die Familienideologie perfekt ins Bild und spiegeln die patriarchale Familie wieder.907)
Leitbild war die gutsituierte Kleinfamilie, „in welcher der Vater die gesellschaftliche Stellung bestimmt, die Mutter die Häuslichkeit gestaltete, beide verbunden in ehelicher Liebe … verbunden im Interesse an der Aufzucht wohlgeratener und wohlerzogener Kinder, die sich bei Berufs- und Gattenwahl nach den Wünschen der Kinder zu richten hatten.“908
Als Kennzeichen der bürgerlichen Familie, die entscheidend für die Ausprägung der modernen heutigen Familie wurde, sind zu nennen:
- die Familie als Ort der Privatheit, die sich als Lebensbereich vom Beruf abschottete;
- die Intimisierung der Ehebeziehung; nicht selten waren Religiosität und Frömmigkeit das bindende Element und vereinte Paare in geistiger und emotionaler Hinsicht;
- die zentrale Bedeutung der Kinder, deren Zahl auf max. drei beschränkt bleiben sollte. Man praktizierte erfolgreich Familienplanung im Bürgertum: Geburtenkontrolle erfolgte durch Enthaltsamkeit und durch Aufklärungsschriften und spezielle Ratgeber für Frauen mit Verhaltensvorschriften. Die Säuglingssterblichkeit und die Todesfurcht vor jeder Schwangerschaft, d.h. die Angst vor dem Verlust der Frau, senkte ebenfalls langfristig die Geburtenrate.
Wilhelm Heinrich Riehl veröffentlichte 1855 sein BuchDie Familie,das in seinen Ausführungen zur bürgerlichen Familie als paradigmatisch für das 19. Jahrhundert gesehen werden kann. In ihm beschreibt er die Geschichte und Theorie der bürgerlichen Familie und fixiert die Familie auf den privat-sittlichen Bereich, die Öffentlichkeit klammert er gänzlich aus. Kritik äußert er gegenüber der durch die Industrialisierung drohende Entwurzelung und Vereinzelung der Familienmitglieder909. Die vorbildliche bürgerliche Familie dagegen entspräche dem idealistischen Familienmodell und sei das Muster einer sozialen Gemeinschaft, mit natürlichen Autoritätsstrukturen und bestehenden traditionellen Werten und Ordnungen.
(TM) ..
Die Buddenbrooks als typisch bürgerliche Familie stellen einen Übergang zwischen dem „ganzen Haus“ und der neuen bürgerlichen Familie dar: In ihr vereinigt sich noch in einem egalitär-demokratischen Grundzug Wohnung, Kontor und Lager, wie oftmals in den Bürgerhäusern des 18. und frühen 19. Jahrhunderts, sehr ähnlich dem Haus der Buddenbrooks:
S. 37f
„. Ja, sehen sie, die Diele wird von den Transportwagen passiert, sie fahren dann durch das ganze Grundstück bis zur Beckergrube…
Die weite, hallende Diele, drunten, war mit großen, viereckigen Steinfliesen gepflastert. Bei der Windfangtüre sowohl wie am anderen Ende lagen Comptoirräumlichkeite…
Die Herren aber schlugen vom Hofe aus den Weg zur Linken ein, der zwischen zwei Mauern über einen zweiten Hof zum Rückgebäude führt…
Dort führten schlüpfrige Stufen in ein kelleriges Gewölbe mit Lehmboden hinab, das als Speicher benutzt wurde, und von dessen höchstem Boden ein Tau zum Hinauswinden der Kornsäcke herabhin…
S. 304
Der Konsul begab sich dann sofort in die Mengstraße, wo die Comptoirs der fFrma verblieben waren, nahm das zweite Frühstück im Zwischengeschoss gemeinsam mit seiner Mutte…
In solch einer Kaufmannsfamilie waren Unternehmen und Familie verquickt durch räumliche Nähe. „In der großbürgerlichen Kaufmannsfamilie im 19.Jh [haben] sich länger als in anderen zeitlichen, regionalen und schichtunspezifischen Familienformen Elemente und Strukturen der Großfamilie gehalten.“ 910 Zur Großfamilie der Buddenbrooks gehörten mehrere Generationen,Verwandte und Personal und „gegenseitige Achtung der Ehepartner, Respekt der Jüngeren vor den Älteren, ein sachliches und verantwortungsbewusstes Verhältnis der Geschwister untereinander und die Akzeptanz des Gebots der Vernunftheirat waren die Grundbedingungen für das Funktionieren der Firmenfamilie: den Zusammenhalt und die Mehrung des Vermögens und der unmittelbaren Verwandtschaft.“911
Bei den Buddenbrooks bedingt das Familienunternehmen, dass die Generationen an einem Ort verblieben und keine räumliche Mobilität zeigen. Das Miteinanderleben vollzieht sich nicht auf engem Raum, sondern in einem großen Haus mit ausreichend zur Verfügung stehenden Stockwerken und Zimmern. Alleinstehende weibliche Verwandte, wie die in Trennung lebende Tony oder die verwitwete Mutter, führen ihren Haushalt und leben zusammen mit der jungen Generation:
S. 277
Sie (die Konsulin) strebte danach, das weitläufige Haus mit dem Geiste des heimgegangenen zu erfüllen, mit dem milden und christlichen Ernst, der eine vornehme Herzensheiterkeit nicht ausschlos…
S. 377
„Nun, meine liebe Tony“, sagte sie endlich, indem sie ihrer Tochter noch einmal die Hände entgegenstreckte, „wie die Dinge auch liegen mögen: du bist da, und so sei mir denn aufs Herzlichste willkommen, mein Kind. . Lege ab, in deinem Zimmer, mach es dir bequem.…
Die Auflösung dieser Mehrgenerationenfamilie erfolgt, als Thomas sich im Zuge der wirtschaftlichen und finanziellen Saturierung der Firma „neolokal“ in Lübeck mit seiner Kleinfamilie niederlässt.
Die Drei-Generationen-Familie, wie sie im Roman „Buddenbrooks“ beschrieben wird, gab es in Folge der niedrigeren Lebenserwartung, aufgrund des höheren Heiratsalters und der höheren Säuglings- und Kindersterblichkeit in Wirklichkeit eher selten,912 und von einer „Dominanz der Großfamilie als Lebensgemeinschaft mehrerer Generationen kann (...) für die vorindustrielle Zeit sicher nicht gesprochen werden.“913
Die Annahme, dass die Mehr-Generationen-Familie im 19. Jahrhundert weit verbreitet war, ist ein Mythos. Das Bild der Großfamilie des 18. und 19. Jahrhunderts wurde als ein Gegenbild zur modernen Kleinfamilie im kollektiven Bewusstsein der Moderne entwickelt, und vom Modell einer Reihe gleichzeitiger und ungleichzeitiger Familienformen mit unklaren Übergängen abgelöst.914 Wie die Großfamilie lässt sich jedoch auch die Kleinfamilie nicht eindeutig bestimmen. Je nach sozialer Stellung unterschied sich die Haushaltsgröße in Deutschland: So betrug die durchschnittliche Größe vier bis fünf Personen, wobei in städtischen Oberschichten eine größere Anzahl von Personen dazu gehörte.915
Das Bürgertum schied die Familie von der Erwerbssphäre, der familiale Raum bildete eine Privatsphäre, in der die menschlichen Beziehungen als Mittelpunkt des Familienlebens sentimentalisiert wurden.
(TM)
Im Folgenden wird solch eine vertraute Atmosphäre beschrieben, Der Konsul und der Senator Buddenbrook verbringen ihre freie Zeit mit ihrer Frau bzw. der Familie:
S. 75
Die Konsulin saß auf dem gelben Sofa neben ihrem Gatten, der, eine Cigarre im Munde, die Kursnotizen der städtischen Anzeigen überblickte. Sie beugte sich über eine Seidenstickerei und bewegte leichthin die Lippen. Neben ihr, auf dem zierlichen Nähtisch mit Goldornamenten, brannten die sechs Kerzen eines Armleuchters…
S. 243
Buddenbrooks saßen im Landschaftszimmer und warteten auf den Konsul, der sich unten noch ankleidet…
Bürgertum bedeutet(e) „Familiensinn“, verbunden mit einem Bewusstsein von Zugehörigkeit zu dem Kreis von Menschen, dem man mit Zuneigung und Verantwortung verbunden war.
(TM)
Die Konsulin bittet ihren Bruder nach dem Tod ihres Mannes, Vormund der jüngsten Tochter Clara zu werden - und er willigt ohne zu zögern ein:
S. 251
„Die Sache ist diese, mein lieber Justus. ich habe dich bitten lassen. kurz zu sein, es handelt sich um Clara, das Kind. Mein lieber seliger Jean hat die Wahl eines Vormundes, dessen die Dirn noch während dreier Jahre bedarf, mir überlassen. ich weiß, du liebst es nicht, mit Verpflichtungen überhäuft zu werden…
„. Ich möchte dich bitten, die Vormundschaft zu übernehmen…
„Gern, Bethsy, wahrhaftig, das tu’ich gern.…
Dieses Harmoniemodell „Familie“ betraf auch Vorfahren und Nachkommen, für die man Toleranz und Stolz aufbrachte und die mit einer persönlich-innigen Verbindung zur Unterordnung unter der Sittlichkeit verpflichteten.916 Tony liest voller Ehrerbietung und Respekt die Überlieferungen aus der Familiengeschichte:
S. 158
Sie blätterte zurück bis ans Ende des großen Heftes, wo auf einem rauen Foliobogen die ganze Genealogie der Buddenbrooks mit Klammern und Rubriken in übersichtlichen Daten von des Konsuls Hand resümiert worden w…
Für Thomas Buddenbrook sind Firma und Familie eine ideelle Einheit:
S. 65
Thomas, der seit seiner Geburt bereits zum Kaufmann und künftigen Inhaber der Firma bestimmt wa…
Kontakte zwischen Verwandten und deren Familien wurden von den Familien des Bürgertums gefördert, da es aufgrund des gleichen Sozialisationshintergrunds die gleichen Wertvorstellungen gab.
(TM)
Bei den Buddenbrooks vergeht kaum eine längere Zeit, in der nicht eine Person hinzu kommt oder ausscheidet. Mitglieder der näheren oder weiteren Familie nimmt man, falls es erforderlich war, selbstverständlich auf:
S. 13
Sie führte die kleine Klothilde an der Hand, ein außerordentlich mageres Kind in geblümtem Kattunkleidchen, mit glanzlosem, aschigem Haar und stiller Altjungfernmiene. Sie stammte aus einer völlig besitzlosen Nebenlinie, war die Tochter eines bei Rostock als Gutsinspektor ansässigen Neffen des alten Herrn Buddenbrook und ward, weil sie gleichaltrig mit Antonie und ein williges Geschöpf war, hier im Hause erzoge…
Unverheiratete Frauen/Tanten, die die ihnen zugedachte Rolle als Ehefrau und Mutter nicht ausfüllten und finanziell unterstützt werden mussten, wurden belächelt und als Nutznießer betrachtet - und auch so behandelt. Aber man war als Familie stets loyal, wenn ein Familienmitglied ohne Verschulden, wie Tony nach den gescheiterten Ehen, den guten Ruf hätte verlieren können.
S. 309
Am Ende des April zog Frau Grünlich wieder im Elternhaus ei…
Zu den verwandtschaftlich-familiären Beziehungen zählte auch die Patenschaft; man suchte sie wohl kalkuliert aus, um potenten und vornehmen Verwandten Erziehungseinfluss einzuräumen und die Kinder als Nutznießer dieser Kontakte für die Zukunft zu sehen.
(TM)
S.399
Und der zweite Pate? Es ist dieser schneeweiße, würdige, alte Herr, der hier mit seiner hohen Halsbinde und seinem weichen, schwarzen Tuchrock,., sich in dem bequemsten Lehnstuhl über seinen Krückstock beugt: Bürgermeister Doktor Oeverdieck. Es ist ein Ereignis, ein Sieg! Manche Leute begreifen nicht, wie es zugegangen ist, guter Gott, es ist doch kaum eine Verwandtschaft! Die Buddenbrook haben den Alten an den Haaren herbeigezoge…
Generell galt d e n Verwandten ein besonderes Interesse, die von Vorteil waren und ökonomische Risiken teilen konnten, wohingegen Verwandte eine Belastung bedeuteten, wenn sie schlecht gestellt waren.917 Solch unterschiedliche ökonomische Bedingungen von verwandten Familien führten nicht selten zu Wohltäter-und Bittsteller-Rollen. Außenseiter, unbürgerliche Nonkonformisten in der Familie hielt man von der intakten Familie mit Hilfeleistungen fern, wie Gotthold, den Sohn von Johann Buddenbrook aus erster Ehe:
(TM)
S. 47f
„. Wie verhalten sich die Dinge denn eigentlich? Damals, als er für seine Mamsell Stüwing inflammiert war, als er mir Scene für Scene machte und am Ende, meinem strengen Verbot zum Trotz, diese Mesalliance einging, da schrieb ich ihm:Mon très cher fils, duheiratest deinenLaden,Punktum. Ich enterbe dich nicht, ich mache keinspectacle,aber mit unserer Freundschaft ist es zu Ende. Hier hast du 100 000 als Mitgift, ich vermache dir andere 100 000 im Testamente, aber damit basta…
„Vater, wir waren stolz und glücklich in dem Bewusstsein, etwas geleistet zu haben, etwas erreicht zu haben. unserer Firma, unsere Familie auf eine Höhe gebracht zu haben, wo ihr Anerkennung und Ansehen im reichsten Maße zu Teil wird. Aber, Vater, diese böse Feindschaft mit meinem Bruder, deinem ältesten Sohne.Eine Familie muss einig sein, muss zusammenhalten, Vater, sonst klopft das Übel an die Tür…
Gotthold wird aber nicht fallen gelassen, sondern auf Abstand gehalten. Man beweist Familiensinn und christliche Nächstenliebe.
Familien-Zusammenhalt schloss das Zurückdrängen von Individualismus ein. „Im Hause allein aber kann bei uns das Volk den Geist der Autorität und Pietät noch gewinnen, im Haus kann es lesen, wie Zucht und Freiheit miteinander gehen, wie das Individuum sich opfern muss für eine höhere moralische Gesamtpersönlichkeit - die Familie.“918
Die Familienehre stand stets im Vordergrund und das hieß, den guten Ruf der Familie zu wahren. Die Fassade einer glücklichen Familie’ war entscheidend und um den Schein zu wahren, durften negative Emotionen und Erlebnisse aus der Familie nicht an die Öffentlichkeit gelangen.(Im Roman von Arno Geiger findet sich dafür der Satz „Es geht uns gut“.) Familiale Bewährungsproben stärkten die Geschlossenheit.
(TM)
Der unverheiratete Sohn Christian, von seinem Bruder belächelt und nicht ernst genommen, schädigt dem sozialen Ansehen seiner Familie durch seine Affären - und doch: Er bekommt eine Anstellung in dieser Firma und später die monetäre Grundlage zur Selbständigkeit in Hamburg:
S. 265f
Der Chef der Firma „Johann Buddenbrook“ hatte seinen Bruder bei dessen Ankunft mit einem längeren, prüfenden Blick gemessen, er hatte ihm während der ersten Tage eine ganz unauffällige und beiläufige Beobachtung zugewandt, und dann, ohne dass ein Urteil auf seinem ruhigen und diskreten Gesicht zu lesen gewesen wäre, schien seine Neugier befriedigt, seine Meinung abgeschlossen zu sein.…
Wir werden also zusammen arbeiten, mein Junge?. Was deine Beschäftigung betrifft, so weiß ich ja nicht, wie weit deine kaufmännischen Kenntnisse vorgeschritten sind. Ich denke mir, dass du bislang ein bisschen gebummelt hast, wie? ..Jedenfalls wird dir in der Hauptsache die englische Korrespondenz am meisten zusage…
Ein inniges Familienleben und ein glücklicher Familienzusammenhalt wurden auf verschiedene Weise präsentiert, z.B. durch gemeinsames Reisen, gemeinsame Mahlzeiten und Familienfeiern. “Familientage“, deren Vorbild ebenfalls beim Adel zu finden ist, dienten in den Familien dem Austausch familiengeschichtlicher Nachrichten und der Stärkung des Zusammenhalts.
(TM)
Diese Vergewisserung und Sicherung der eigenen Identität in ihrer Familie findet sich auch bei den Buddenbrooks.
S. 274
Donnerstags, an den überlieferungsgemäßen „Kindertagen“, um 4 Uhr, fand man sich in dem großen Hause in der Mengstraße zusammen, um dort zu Mittag zu speisen und den Abend zuzubringe…
S. 524
Donnerstag, wenn die Familie, umgeben von den ruhevoll lächelnden Götterstatuen der Tapete, beim Essen sa…
Ritualisierte Treffen mit Familienangehörigen, wie z.B. am Weihnachtsfest, und der Austausch von Erinnerungen sind ein Verstärker für der emotionalen Nähe.
S. 607
Der Abend des 24. Dezember wurde im Hause des Senators begangen. Nur Frau Permaneder mit Erika Weinschenk und der kleinen Elisabeth, Christian, Klothilde, die Klosterdamen, und Mademoiselle Weichbrodt waren gebeten,…
Die Selbststilisierung der Familie als Familienverband und Einheit, dokumentierte eine Familienchronik, ich komme auf sie später zu sprechen, und „da sich diese Familien in immer weitläufigeren Maße überschnitten und durchdrangen, fand auf dieser Ebene der eigentliche Prozess der Ausprägung, der Formierung der neuen bürgerlichen Gesellschaft statt.“919
Diese Familienchroniken (Bsp. Familie Bassermann) fassen die Geschichte von wohlhabenden Bürgerfamilien über Generationen zusammen und zeigen ihren Wandel und letztendlich den der Gesellschaft in einer sich verändernden Welt.
Im bürgerlichen Verständnis bildete Familie den „Innenraum der Privatheit im Unterschied zur Öffentlichkeit.“920- Öffentlichkeit verstanden als der Bereich, in dem der Beruf und die Arbeit des Mannes ihren Sitz hatte. Die Familie als Schutzraum- hier spiegelt sich „Innerlichkeit“ und die Zufriedenheit des deutschen Mannes wider, wenn er mit seiner Familie und seinen Kindern beisammen ist.
Diese Form der bürgerlichen Familie ist, wie es die Romane belegen, noch bis weit in die Mitte des 20. Jahrhunderts, ja, bis heute anzutreffen, wobei heute natürlich auch die Frau dominieren darf.
Die Familie grenzte sich als System von der Außenwelt ab und wurde zu einem ,verschlossenen Familiensystem’ mit rigider Rollenverteilung.921 Der Zusammenhalt der Familie stand vor allen anderen Interessen!
20.2 Die moderne Klein-/Kernfamilie im Familienroman
Artikel 6 Abs. 1 des Grundgesetzes: „Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung…
Die klassische bürgerliche Familie existierte ca.150 Jahre. „Davor und seither ist Familie eher ein Sammelsurium von Lebensformen mit Menschen, die mehr oder weniger verwandt oder verschwägert in einer Bedarfs- und Ernährungsgemeinschaft zusammen ihren Alltag organisieren.“922
Die Familienbilder in den Romanen sind Spiegel des soziokulturellen Lebens ihrer Zeit und ihres Ortes/Landes. In ihnen manifestieren sich die veränderte soziale Konzeption von Familie und der demographische Wandel, die fallenden Fertiliäts- und Mortalitätsraten, und der Aufbruch der bürgerlich-hierarchisch durchorganisierten Familienstruktur.
Eine Familie muss deshalb stets im Kontext ihrer sozialen, ökonomischen und kulturellen Bedingungen gesehen werden - Veränderungen im gesellschaftlichen System führen zu veränderten Formen des familiären Zusammenlebens, denn so wie der familiale Strukturwandel verursacht ist durch gesamtgesellschaftliche strukturelle Veränderungen (Erziehungsziele, Scheidungen, Kinderbetreuung.), sind familiäre Umbrüche auch stets eine Folge ökonomischer und sozialer Prozesse, z.B. der Neugestaltung der Frauenrolle - von der Hausfrau zur berufstätigen Frau.
„Ein Festhalten an anachronistisch gewordenen Mustern familiären Zusammenlebens kann für den einzelnen wie für die Gruppe zu einer zumindest unnötigen, wenn nicht sogar gefährlichen Beschränkung der Entfaltungsmöglichkeiten führen.“923
Die Entwicklung der Familie von der umfassenderen zur kleineren Familienform, von der Hausgemeinschaft mit Gesinde zur kleinen familiären Einheit im Zuge der Industrialisierung ist statistisch belegt.924 Durch die Reduzierung der Kinderzahl lebte nur noch eine kleinere Zahl von Personen längere Zeit im Familienverband zusammen.
Der moderne Familienbegriff definiert Familie als eine Gemeinschaft von Eltern und Kindern und entstand, als sich die Wirtschafts- und Sozialeinheit auflöste. Die „Haushaltsfamilie ist exakt abgrenzbar, zum Unterschied von der Verwandtschaftsfamilie, die einen unbestimmten Kreis von Blutsverwandten und Verschwägerten umfasst.“925 Weitere Verwandte, wie z.B. die Großeltern und die Enkel findet man immer seltener in der häuslichen Gemeinschaft, sie leben stattdessen in wohnörtlicher Näh oder auch weiter entfernt..
Das alte Familiensystem mit dem großen Verwandtschaftsnetz wie bei den Buddenbrooks reduzierte sich auf eine Kleinfamilienform mit zwei Generationen und ist in jedem zweiten Haushalt zu finden.926 Damit halbierte sich die durchschnittliche Größe der Familien in den vergangen hundert Jahren, und Drei-Generationen-Haushalte stellen eine sehr seltene Ausnahme dar.
Das Kleinfamilienmodell mit Vater, Mutter und Kind entspricht der exemplarischen, archetypischen Familie schlechthin, und wurde in der Heiligen Familie des Christentums zum Vorbild.927 Früher wie heute wird die Vater-Mutter-Kind-Familie als die ideale Norm imaginiert, als ein Ort der Harmonie, der Liebe und des Vertrauens, der gelebten Gemeinschaft, die zum Umgang mit anderen sozialisiert928 und in der gegenseitiger Beistand und emotionale Zuwendung zum Tragen kommen.
(TM)
Buddenbrooks entwickeln sich zur Kleinfamilie mit Thomas, Gerda und Hanno, sie sind eine Kernfamilie.
S. 614
In diesem Kabinett verbrachte er nicht nur am Morgen eine lange Zeit, sondern auch vor jedem Diner,... ja selbst vor den alltäglichen Mahlzeiten zu Hause, bei denen außer ihm selbst nur seine Frau, der kleine Johann und Ida Jungmann zugegen ware…
Die zeitgenössischen modernen Familienromane sind ein Beispiel für die Dysfunktionalität eines bürgerlichen Familienheims und gleichzeitig für die Suche nach einem Heim in der heutigen globalisierten Welt. Für die „Intimisierung, Emotionalisierung und Sentimentalisierung des Familienlebens“ 929 bleiben die Familien Sterk/Erlach und Umnitzer ein Beispiel.
(AG)
In der ersten Familiengeneration der Familie Sterk besteht dieses ,verschlossene‘ Familiensystem:
Als Kleinfamilie leben Alma und Richard mit den Kindern Ingrid und Otto zusammen.
Das Familienleben zeigt das Bild einer intakten Kleinfamilie, in der Harmonie und Geborgenheit gelebt werden, und in der der Familienvater Richard sich von der Arbeit erholt und neue Kräfte sammelt, dies spiegeln seine Gedanken wider:
S. 73 (1938)
Schon lange ist er nicht mehr so gelegen, alles kommt ihm friedlich vor, so frei von Sorgen. Ein Gefühl der Zufriedenheit erfasst ihn, und einen Augenblick lang hat er die sichere Empfindung, nicht nur Teil dieser Geräuschkulisse zu sein, sondern ihr Mittelpunkt, Brennpunkt eines familiären Kraftfeldes, der Unterbau, der dem Überbau zuhör…
Tochter und Sohn verleben ihre Freizeit im Garten des Elternhauses, unweit von Mutter und Vater, eine biedermeierlich wirkende Idylle:
S. 67
Richard schaut zu Otto hinüber, faul liegt der Bub, die Katze im Arm, auf den warmen Steinplatten unter der mit Bohnen bewachsenen Pergola in der Nas…
S. 73
Immer wieder lässt Alma sacht einige Spritzer Wasser aus der Gießschnauze auf Ingrids Schultern und Rücken schwappen, auch noch, als Ingrid Richtung Vorplatz schwenkt. Beide leisten sich eine strahlende Mien…
Solch ein Bild von Familie ist bei Familie Sterk/Erlach bis in die 60/70er Jahren existent:
S. 263ff Familie Erlach (1970)
Sie nennt Philipp Waschbär und Sissi ,Iltis‘. Die Kinder stoßen ihre schrillen Lacher aus, und weil Ingrid vom Dienst und vom Spaziergang ziemlich geschlaucht ist und weil sie von der Kälte Kopfweh hat, überredet sie die beiden zu einem Wettbewerb, wer länger tauchen kann.…
Es ist vielleicht das letzte Mal, dass die Kinder um die Wette tauchen, denkt Ingrid.…
S. 268f
Peter föhnt den Kindern die Haare und füttert sie mit Broten ab..…
Dann geht sie nach unten, wo Peter im Spielzimmer für die Kinder den August macht. Philipp herzt Peter ein paarmal und drückt ihn, so dass Ingrid fast ein wenig eifersüchtig wir…
Als Alma mit dem Verkauf des Wäschegeschäfts, zu dem Richard als Ehemann damals das Recht hatte, sämtliche Außenkontakte genommen werden, beschränkt sich ihr Leben auf die Beschäftigung mit Bienenstöcken und die Erziehung der Kinder, Besuche von Angehörigen gehören ebenso wie bei den Buddenbrooks zum Familienleben:
S. 364
… Otto und Ingrid, ihre Mutter oft da, und Richard, der sich freute, wenn recht viel Besuch ka…
Das Verhältnis Almas zu Richards Verwandtschaft, insbesondere zu seiner Schwester, ist aber nicht durch Nähe und Zusammenhalt geprägt, sondern eher getrübt:
S. 53
… dass sie (Nessi) eine Erbschleicherin ist und ständig zugunsten ihrer Kinder Richards Konten plündert, obwohl es längst kein Geheimnis mehr ist, dass sie Richard über die Höhe ihrer Witwenpension belogen ha…
Die einstmals Eltern und zwei Kinder umfassende Familie von Familie Sterk reduziert sich, als der Sohn Otto im 2. Weltkrieg beim Volkssturm ums Leben kommt, zurück bleibt eine 3-Personen-Familie.
Familie Erlach zeigt sich als eine Hilfs- und Solidargemeinschaft bei der Pflege der kranken Mutter in der Zeit des Nationalsozialismus.
Nach der Kapitulation findet Peter jedoch weder Hilfe noch ein Unterkommen bei seinen Verwandten:
S. 121ff
- Als Neffe wärst du willkommen, aber nicht als Soldat. Wo doch die Russen. Du musst verstehen. dDe Familie. Da ist es besser, wir sind ab jetzt neutra…
- Aber wenn wir die Uniformen und das ganze Zeug in die Weingärten …
Sie (Tante Susanne) zögert nochmals und sieht Peter einen Augenblick lang an, nicht unschlüssig, mehr als wolle sie sich seiner Hartnäckigkeit vergewissern. Ann sagt sie: - Heil Hitle…
Peter hat in diesem Moment keine Familie mehr.
Ingrid und Peter Erlach bilden mit den Kindern Sissi und Peter die Klein-/Kernfamilie der nächsten Generation. Zurück bleiben nach dem Tod der Mutter die zwei Kinder und der Vater, ohne dass ein sonstiges verwandtschaftliches Netzwerk besteht.
(ER)
Die im DDR-Roman vorkommende Drei/Mehr-Generationen-Familie unter einem Dach, hatte nur eine geringe Verbreitung. Sie umfasst drei unterschiedliche Zeitepochen und Generationen: die älteste Generation war um 1880 und 1900 geboren, personifiziert durch Charlotte und Wilhelm. Sie erlebt das Kaiserreich und den Ersten Weltkrieg, hat aber auch Erfahrungen innerhalb der Weimarer Republik und des Faschismus gesammelt; die mittlere Generation, um 1920 geboren, erlebte den Zweiten Weltkrieg: Kurt und Irina. Die nächste Generation der 50er Jahre wurde, wie Sascha, in der Nachkriegszeit geboren und wuchs in die sozialistische Gesellschaft hinein, kann also als eine der ersten Generationen der DDR bezeichnet werden. Für sie hatte die Nachkriegszeit keine zentrale Bedeutung mehr. Die jüngste in den 70er Jahren geborene Generation personalisiert Markus, der als Kind beständige soziale und politische Strukturen spürt, unbeschwert in die DDR- Gesellschaft hineinwächst, staatliche Reglementierungen erlebt, die zum Alltag gehören, im Jugendalter mit der Wende von 1989 konfrontiert wird und eine berufliche Ausbildung im wiedervereinten Deutschland beginnt.
Der Zusammenhalt der Kern-Familie ist auch hier anzutreffen, als Kurt, Irina und Sascha/ Alexander nach dem Wegzug aus Russland zunächst im Haus der Großeltern Charlotte und Wilhelm unterkommen, die in den Erziehungsprozess des Enkels eingebunden werden.
Die Drei-Generationen-Familie wird aber in diesem Fall nicht als eine harmonische Gemeinschaft erlebt, im Gegenteil, zwischen den Schwiegereltern und der Schwiegertochter herrscht eine konfliktreiche Stimmung:
S. 58
Ohnehin betrat sie das Haus ihrer Schwiegereltern nicht gern, schon der Gedanke daran war ihr unangenehm. . Alles erinnerte sie an ihre Leidenszei…
S.61
Wie den letzten Dreck hatte Charlotte sie behandelt. Wie ein Dienstmädchen. Und am liebsten, dachte Irina, hätte Charlotte sie wieder zurückgeschickt, in ihr russisches Dorf - und Kurt mit Frau Dr. Stiller verkuppel…
Man teilt sich die Erziehungsarbeit, zu Irinas Bedauern: S. 58
Ohnehin betrat sie das Haus ihrer Schwiegereltern nicht gern, schon der Gedanke daran war ihr unangenehm. Nein, auch noch dreiunddreißig Jahren hatte sie nicht vergessen, wee es war, die Ritzen in der holzvertäfelten Flurgarderobe zu putzen. Wie sie Haferflocken hatte kochen müssen für Wilhelm. Kurt hatte, während sie, das Kind am Rockzipfel, in der Wäschekammer stand und Wilhelms Hemden bügelte, bei Charlotte auf dem Sofa gesesse…
Sascha erzählt:
S. 81
Mama stand oben an der Treppe. Omi stand unten an der Trepp…
-Na, komm schon, mein Spätzchen, sagte Om…
Irina holt ebenfalls ihre Mutter aus Russland nach Berlin,
S. 60
… und seit ihre Mutter mit im Haus wohnte (Irina hatte sie vor dreizehn Jahren unter unvorstellbarem bürokratischen Aufwand aus Russland herübergeholt…
Diese lebt nun für einige Zeit mit ihnen zusammen im Haus Am Fuchsbau 7, im ehemaligen Zimmer des Enkels. Das Zusammenleben ist nicht konfliktfrei:
S. 65
… in den dreizehn Jahren, die Nadjeshda Iwanowna hier lebte, hatte sie kein Wort Deutsch gelern…
S. 66
… weil Nadjeshda Iwanowna immerzu irgendwelches halbverdorbenes Zeug in ihr Zimmer schleppte, um es dort zu essen - heimlich, weil sie partout beweisen wollte, dass sie niemandem zur Last fie…
S. 71
Irina riss die Tür auf und reichte ihrer Mutter den Teller mit dem fertig geschmierten Bro…
- Hier, iss das, befahl si…
- Was ist das, fragte Nadjeshda Iwanowna, ohne den Teller anzunehme…
- Herrgott, das ist ein Brot! Mit Käse! Denkst du, ich will dich vergifte…
- Ich vertrag keinen Käse, sagte Nadjeshda Iwanown…
Irina stand auf, ging in das Zimmer ihrer Mutter, knallte den Teller auf den Tisc…
Nach dem Auszug der Kinder bleibt den Eltern der Kernfamilie das sog. „empty nest“. Getrenntes Wohnen in finanzieller Unabhängigkeit mit eigenen Hausständen der Jung- und Unverheirateten („Neolokalität“) wurde zur Norm im Familienleben im 20. Jahrhundert. Die Individualisierung der Lebensentwürfe und die Pluralität der Lebenswelten sind durch die Zunahme der Berufs- und Heiratsmöglichkeiten gestiegen - auch dies führte zu einer Verminderung des Zusammenhalts innerhalb einer Familie und ist in den modernen Familienromanen erkennbar.
Umfrageergebnisse in Österreich zeigten bereits in den 60er Jahren, dass sich die Mehrzahl der Befragten nicht wünschte, mit den Eltern zusammenzuwohnen, ebensowenig wollten Eltern mit den verheirateten Kindern unter einem Dach wohnen. Erst bei älteren verwitweten oder krankten Menschen änderte sich dies und die Vorstellung, mit den Kindern zusammenzuleben, gilt bei ihnen dann als durchaus akzeptabel.930
Oft wohnen die Generationen in gegenseitiger Nähe voneinander, haben Kontakt zueinander und leisten gegenseitige Unterstützung. Die Ausführung von Haushaltstätigkeiten übernehmen zwar eher externe Auftragnehmer, doch engste Verwandte, wie Eltern, Geschwister und Cousins, wenn auch deren Zahl abnahm, helfen, wenn sie in der Nähe wohnen, durch persönlichen Einsatz bei Haushaltsführung und Kinderaufzucht, (eher selten finanziell) wobei vielmals eine der beiden Mütter der älteren Generation der aktive Teil ist.931 (AG)
Ingrid erhält z.B. Mobiliar für ihre Wohnung aus dem Elternhaus:
S. 212
Bei der spanischen Eichentruhe, in der früher Kinderspielzeug deponiert war, hält Ingrid inne und bittet ihre Mutter, die Truhe mitnehmen zu dürfen. …
S. 217
Ingrid und Peter nehmen nur, was nicht beständig ist, Verlegenheitsmöbel, Reserveschränke, alles, was nicht sonderlich anstrengt …
Nachdem auch das Bett und der Schrank aus ihrem eigenen früheren Zimmer zum Abtransport bestimmt worden sind.…
Die geringe Zahl der Nachkommen dünnte das familiale Netz aus. „Wenn die Zahl der Geburten in der westlichen Welt um zwei Kinder pro Person schwankt, so könnte einer der Gründe auch sein, dass wir uns in männlicher und weiblicher Form zu reproduzieren wünschen, wobei es als Ideal gilt, wenn man die Erfahrung machen darf, einen Jungen und ein Mädchen aufzuziehen;.“932
Die Tendenz zur Schrumpfung der Familie im 20. Jahrhundert hat in den Romanen einen Abbruch der Beziehungen zwischen der Kern- und der erweiterten Familie nach sich gezogen. Die Netzwerke umfassen nur eine kleine Gruppe von vertrauten Personen.
Die Wandlung innerhalb der Familie kann man als einen Wechsel vom Wir-Gefühl in der Großfamilie zur Ich-Stärke des Einzelnen bezeichnen. War es bei den Buddenbrooks noch so, dass die Familie zusammenhielt, weil sie „gemeinsame Vorstellungen davon teilte, was eine moralisch korrekte Lebensführung ausmacht“ 933 mit gemeinsamen Normen und Werten, werden diese gemeinsamen Einstellungen bei Geiger (von Ingrid und ihren Eltern) und Ruge (Sascha und seine Eltern) in der Kleinfamilie nicht mehr geteilt.
Die Sozialität, die für das Gefühls- und Geistesleben im Bürgertum eine große Rolle spielte, reduzierte sich in dem Maße wie die Bedeutung der Gesellschaft, der Nachbarschaft, der Öffentlichkeit und der kollektiven Lebensformen, in der sich das Leben früher abspielte, abnahm, und die moderne Familie mit ihrer Art des Familiensinns und ihrer Isolierung deren Platz eingenommen hat. 934 Weiterhin sind Familienmitglieder, wie in der vergangenen Zeit, miteinander durch Gefühl und Lebensweise verbunden. Die für die Großfamilie typischen Funktionen wie die Kultfunktion, die Sozialisationsfunktion wurden aber im Rahmen der gesellschaftlichen Veränderung abgegeben935 und von Institutionen übernommen (z.B. Altersheim, Pflegedienst, a.a.O.)
Bereits Wilhelm Heinrich Riehl spricht in seinem Buch „Die Familie“ von 1855 diesen Punkte an: „.Zerreißung sozial-moralischer Bande, übermäßiger Egoismus des Einzelnen und mangelnde Solidaritätsbereitschaft, soziale Atomisierung als Folge nachlassender familialer Integrationskraft; politische Fehlsteuerung durch den Staat, schließlich auch Unterminierung der Familie durch fehlgeleitete Rechts- und Emanzipationsansprüche der Frauen und Kinder.“936
20.3 Historisch verortete Männlichkeit - das Vaterbild und männliche Leitbilder im Wandel der Zeiten
„In der Kindheit kann ein Leben ohne väterliches Vorbild ebenso wenig wie eines ohne Nähe der Mutter folgenlos ertragen werden.…
(Alexander Mitscherlic…
Die Familie stand im Mittelpunkt der bürgerlichen Ideologie - und wie definierten Väter darin ihre Rolle? Wichtig zu wissen, ist, dass die in den Romanen auftretenden Väter sich zurückführen lassen aus den Autobiographien der aus Akademiker- und Bürgerfamilien stammenden Autoren. Diese nahmen ihre eigenen Väter und deren Beruf als Vorbild, ja, für manche Thomas-Mann-Forscher steht die Beziehung von Vater und Sohn im Roman „Buddenbrooks“ sogar im Mittelpunkt.937
Sowohl das Elternhaus von Thomas Mann als auch von Eugen Ruge waren, bedingt durch den väterlichen Beruf, Teil des Wirtschafts- und Bildungsbürgertum. Geigers Bildungsprivileg äußert sich darin, dass er als Einziger der Klasse zum Studium ging, was Rückschlüsse auf sein Elternhaus zulässt.
Der Tod der Väter kann als das das auslösende Moment für die Söhne zum Schreiben der Romane angesehen werden.
Diese Familienromane sind eine narrative Form des In-Szene-Setzens von Familie und Männlichkeit und erzählen eine Geschichte zwischen Vätern und Söhnen/Töchtern und damit auch vom historischen Wandel der Männlichkeit.938
Welche Dimensionen der männlichen und väterlichen Rolle finden sich in den Romanen?
Wir werden in den Romanen familienorientierten Vätern begegnen und solchen, die den Fokus auf den Beruf legen, oder beides, oft in einer Personen vereint. Ebenso lesen wir von überwiegend abwesenden Ernährern, mit traditionellen oder nicht-traditionellen Rollenarrangements, manchmal wirken sie bemitleidenswert und schwach, während sich demgegenüber die Frauen als eine weibliche Figur und als starke Heldin etablieren.
20.3.1 Männlichkeitsideale im Bürgertum des 19. Jahrhunderts
Wie sich ein Mann in der Gesellschaft versteht und behauptet, hängt in erster Linie von der Rolle der Familie ab, die ihn prägt(e): „als Familienmänner, die zuerst überwiegend von Müttern erzogen und später als Söhne und als Väter ihren Mann zu stehen haben.“939 Seit der Psychoanalyse wissen wir, dass die Beziehung zwischen Mutter und Kind Ausgangspunkt der geschlechtlichen Identität ist (Objektbeziehungstheorie): Die Mutter prägt das Kind und die Entwicklung der Geschlechter, sie ist das erste Beziehungsobjekt des Kindes. Das weibliche Kind gibt dabei im Gegensatz zum männlichen Kind die Identifizierung mit der Mutter nie ganz auf, beim männlichen Kind findet die Ablösung statt, beides wird unterstützt durch Kultur und Gesellschaft.
Der Übergang vom „ganzen Haus“ zur bürgerlichen Kernfamilie brachte die Polarisierung der Geschlechtscharaktere940 und damit die „Auseinanderentwicklung“ von Mann und Frau mit sich. Der historische Kontext veränderte männliche Geschlechtsidentität ,und damit war auch die Rolle des Familienvaters einem Wandel unterworfen.
Wenn man einen Blick auf die frühere Zeit richtet, erkennt man, wie entscheidend für die Ideale deutscher Männlichkeit Nation und Familie waren:
Das auf Aktivität, Tatkraft, physische Stärke, Härte, basierende Männlichkeitsideal mit seiner Kriegermentalität basiert auf der Militarisierung nach der Gründung des zweiten deutschen Kaiserreichs. In Folge der Befreiungs-Kriege gegen Frankreich und mit der Einführung der Allgemeinen Wehrpflicht 1813/14 wurden ständische Beschränkungen im Militär aufgehoben und der Bürger-Soldat mit seiner männlichen Geschlechtsidentität geformt, der den Soldatendienst als eine ehrenvolle Tätigkeit für die Nation betrachtete. Die duellierenden ,Ehrenmänner‘ können als Beispiel gelten. Im Gegensatz dazu sah man die eheliche Paarbeziehung für den Mann als eine Gefahr der Feminisierung, die eine Schädigung des männlichen Charakters in sich barg.941
(TM)
Thomas Buddenbrook befürchtet eine Feminisierung seines Sohnes durch den Umgang mit zu vielen weiblichen Personen:
S. 521
Und wenn Hanno seinerseits ein wenig Frische und Wildheit von dem kleinen Grafen empfing, so war das mit Freude zu begrüßen, denn Senator Buddenbrook verhehlte sich nicht, dass die beständige weibliche Obhut, unter welcher der Junge stand, nicht eben geeignet war, die Eigenschaften der Männlichkeit in ihm anzureizen und zu entwickel…
S. 619
Aber die Zeit begann, da einem Vater Gelegenheit gegeben wird, auch seinerseits auf seinen Sohn zu wirken, ihn ein wenig auf seine Seite zu ziehen und mit männlichen Gegeneindrücken die bisherigen weiblichen Einflüsse zu neutralisiere…
Der familiäre Begriff „Vater“ leitet sich ab vom„pater familias“ im Römischen Reich, er war das Oberhaupt der Familie und verfügte über den Familienbesitz.942 Als im Mittelalter die Familie als abgegrenzte soziale Einheit entstand, erreichte der Vater eine Stellung, die dem des Stammesvaters entsprach. Er vertrat Frau und Kinder nach außen, konnte ihnen Befehle erteilen, hatte das Recht und die Pflicht, die Kinder zu erziehen und trug für sie die Verantwortung.
Aufgabe des Mannes im 19. Jahrhundert und ein Beweis seiner Männlichkeit war, die reproduktive Pflicht zu erfüllen: Nachkommenschaft und die genealogische Fortdauer des väterlichen Namens, die Bedeutung der Ahnentafel in der Genealogie, dienten als Imagination der Männlichkeit und der Familiengeschichte, denn nur der Mann war der ,vaterrechtlicher‘ Vertreter nach außen und stand in der Kontinuität der Generationen.943 Da die Heirat der bürgerlichen Männer erst nach Erreichen einer beruflich sicheren Position erfolgte, wurden sie Vater, wenn sie bereits eine stabile Persönlichkeit hatten, Geduld entwickelt hatten und Autorität verkörperten.
(TM)
Große Freude herrschte bei Thomas Buddenbrook über die Geburt des „Stammhalters“: S. 396
… ein Erbe! Ein Stammhalter! Ein Buddenbrook! Begreift man, was das bedeute…
Begreift man das stille Entzücken, mit dem die Kunde, als das erste, leise, ahnende Wort gefallen, von der Briten- in die Mengstraße getragen worden?., nun ist er da und empfängt das Sakrament der Taufe, er, auf dem längst so viele Hoffnungen ruhen, von dem längst so viel gesprochen, der seit langen Jahren erwartet, ersehnt worden, den man von Gott erbeten und um den man Doktor Grabow gequält hat … er its da und sieht ganz unscheinbar au…
Das Männerbild war hierarchisch-chauvinistisch und autoritär - aus heutiger Sicht ein negativ konnotiertes Männerbild.944 Zur Männlichkeit gehörten, dem bipolaren Geschlechtersystem entsprechend, Verstand, Willenskraft, Zielstrebigkeit und die Unterdrückung von Gefühl und Schwäche, doch beweisen im Roman „Buddenbrooks“ die Reflexionen von Thomas und Hanno Buddenbrook, dass es bei jungen Männern Introspektion, die Auseinandersetzung mit dem Innenleben und der Entwicklung in der Familie durchaus gibt.945 (TM)
Hanno Buddenbrook wird den Ansprüchen der Männlichkeit (Sportlichkeit, männlichaktives Verhalten) ebenso wenig gerecht wie den Anforderungen seines Vaters. Ihrer Beziehung fehlt aus diesem Grund die emotionale Nähe:
S. 649
Er wollte, indem er mit dem Buche, das er trug, die Wand entlangstrich, mit gesenkten Augen und einem leisen Gruße an seinem Vater vorübergehen; aber der Senator redete ihn a…
„Bist du denn ein kleines Mädchen?“ ist der Vorwurf des Vaters, der in seinem Sohne keinen lebenstüchtigen Erben erkennt und er.
S. 653
„wandte sich enttäuscht und hoffnungslos von seinem einzigen Sohn ab, in dem er stark und verjüngt fortzuleben gehofft hatte…
(ähnlich: << Arno Geiger, S. 25f „Es hat mit dem zu tun.“ )
Bürgerliche Männlichkeit zeichnete sich dadurch aus, dass der Mann sich in zwei Sphären aufhielt, verflochten war in häuslicher und gesellschaftlicher Sphäre. 946 Die Funktion des Vaters erweiterte sich auf die des Hausvaters u n d des Berufsmenschen, die familiale Hausgemeinschaft wurde zur Repräsentationsfamilie. Der Hausvater bzw. der Firmenchef verkörperte eine notwendige, klar begrenzte Autoritätsperson in der familienwirtschaftlich fundierten Hausgemeinschaft.
Die Charakteristika und Tugenden eines männlichen Bürgers sind eine Beschreibung des ehrlichen Mannes bzw. des bürgerlichen Hausvaters mit den häuslichen Tugenden des Fleißes, der Pünktlichkeit, einer ordentlichen und strengen Hauswirtschaft mit Sach- und Geschäftskenntnis, Selbstdisziplin und Pflichtbewusstsein, Aufstiegsstreben und Selbstverantwortlichkeit. „Der Bürger entsprach dem Muster des bürgerlichen Tugendkatalogs: dem unabhängigen, sittlichen, auf Mäßigung triebhafte Genüsse und Fürsorge der von ihm Abhängigen bedachten Haus- und Familienvater.“ 947 Die wichtige Tugend der Sparsamkeit war die ökonomische Kompetenz, um einen bestimmten Status aufrecht zu erhalten. War bereits ein auskömmliches Jahresgehalt erforderlich, um eine Familie gründen zu können, entschied nun letztendlich die finanzielle Situation der Familie über die Kreditwürdigkeit eines Mannes und seines Unternehmens.
(TM)
Jean Buddenbrook führt gewissenhaft Buch über Ein- und Ausgaben im Haushalt, während und der aufwendige Lebensstil seiner Schwiegereltern bei ihm nicht unbedingt auf Zustimmung stößt:
S. 75ff
Er war mit Hingebung bei der Sache und ahmte den stillen und zähen Fleiß des Vaters nac…
„.Jean, ich habe wohl nicht die hinlängliche Einsicht…
„Nun, die ist leicht zu beschaffen“, sagte der Konsul. .. und begann, während er die Augen ein wenig zusammenkniff, mit auerordentlicher Geläufigkeit seine Zahlen hervorzubringe…
S. 79
Im übrigen lassen sich deine Eltern, was mich so aufrichtig freut, nichts abgehen, sie führen ein herrschaftliches Leben, …
(TM)
Thomas Buddenbrook räumt der Sparsamkeit einen hohen Stellenwert ein:
S. 467
Dass aber die Firma Buddenbrook nicht mehr das war, was sie vor Zeiten gewesen, das schien eine gassenläufige Wahrhei…
Gleichwohl war er selbst es, der zur Entstehung dieser Anschauungsweise am meisten beigetragen hatt…
… hatte doch die Vorstellung, sein Glück und Erfolg sei dahin, … in in einem Zustand so argwöhnischer Verzagtheit versetzt, dass er, wie niemals zuvor, das Geld an sich zu halten und in seinem Privatleben in fast kleinlicher Weise zu sparen begann. Hundertmal hatte er den kostspieligen Bau seines neuen Hauses verwünscht, das ihm, so empfand er, nichts als Unheil gebracht hatte. Die Sommerreisen wurden eingestellt, und der kleine Stadtgarten musste den Aufenthalt am Strande oder im Gebirge ersetzen. Die Mahlzeiten, die er gemeinsam mit seiner Gattin und dem kleinen Hanno einnahm, waren auf sein wiederholtes und strenges Geheiß von einer Einfachheit.Während längerer Zeit war Dessert nur für den Sonntag gestatte…
… Anton, der langjährige Bediente. wusste auch, dass er entlassen werden sollte. . mit einem angemessenen Geldgeschenk ward Anton, der so lange den Bock eingenommen hatte, wenn Thomas Buddenbrook in den Senat fuhr, verabschiede…
Beratung über eventuelle Hilfen und die finanzielle Unterstützung eines Verwandten trugen stets die Männer der Familie aus. Ein Beispiel dafür ist in diesem Fall Herr Grünlichs Ehe bzw. die spätere Scheidung mit ihren finanziellen Konsequenzen:
(TM)
S. 159
„Ich bin vollkommen Ihrer Meinung, mein werter Freund. Diese Frage ist von Wichtigkeit und muss erledigt werden. Kurz und gut. Die traditionelle Bar-Mitgift für ein junges Mädchen aus unserer Familie beträgt 70 000 Mark.
Herr Grünlich warf seinem zukünftigen Schwiegervater den kurzen und prüfenden Seitenblick eines Geschäftsmannes z…
S. 221
„Sie erlauben nun, dass ich mir einen genaueren Einblick in die Lage der Dinge verschaffe“, sagte der Konsul und griff nach dem Hauptbuch. Plötzlich streckte Herr Grünlich schirmend beide Hände über den Tisch hin, ., und rief mit bewegter Stimm…
einen Augenblick!.Sehen Sie in mir einen Mann, Vater, der sich ohn’Ermatten gegen das Schicksal gewehrt hat, der aber von ihm zu Boden geschlagen ist!.
S. 224
„So erkläre ich, dass ich nicht willens bin, mich länger in irgend einer Weise mit dieser Angelegenheit zu beschäftigen.
Wenn möglich wurden keine anderen Instanzen hinzugezogen. Umso erzürnter ist Thomas Buddenbrook über das eigenmächtige Handeln seiner Mutter, als sie Claras Erbe derem Mann zuspricht:
S. 433f
„Thomas, um Christi willen, lass mir Gerechtigkeit widerfahren! Konnte ich denn anders?. ,Mutter‘, schreibt sie, ,.Gott hat uns nicht mit Kindern gesegnet, aber was mein gewesen wäre, wenn ich Dich überlebt hätte, lass es, wenn Du mir dereinst dorthin nachfolgst - lass es ihm zufallen, damit er es zu seinem Lebzeiten genieße!.
„Und man gönnt mir nicht eine Silbe! Man verheimlicht mir alles! Man geht über mich hinweg!“wiederholte der Senato…
„Ja, ich habe geschwiegen, Thomas; denn ich fühlte, dass ich die letzte Bitte meines sterbenden Kindes erfüllen müsste. und ich weiß, dass du versucht hättest, es mir zu verbieten!
„Ja! bei Gott! Das hätte ich!
„Und du hättest das Recht nicht dazu gehabt, denn drei meiner Kinder sind einig mit mir!
„O mich dünkt, meine Meinung wiegt die zweier Damen und es maroden Narren auf.
Die wenige Zeit in der Familie und die dominierenden Rolle als Berufsmensch führten dazu, dass es zwischen dem Vater und seinen Kindern an Gesprächsstoffen mangelte. Seine Beschäftigung mit Kindern war durch die Rolle als Lehrmeister geprägt.
(TM)
Thomas B. nimmt seinen Sohn mit zum Hafen, um ihm das Berufsleben zu zeigen und damit eine Erziehung zur Männlichkeit zu fördern. Er erfasst Hanno nicht in dessen Eigenheit und Entwicklung, seine Leistungs- und Berufsorientierung hat eine innere Distanzierung und Entfremdung zwischen Vater und Sohn zur Folge.
S. 510
Er ließ nichts merken von der Sorge, mit der er die Entfremdung beobachtete, die zwischen ihm und seinem kleinen Sohne zuzunehmen schien, und der Anschein, als bewürbe er sich um des Kindes Gunst, wäre ihm furchtbar gewesen. Er hatte ja während des Tages nur wenig Muße, mit dem Kleinen zusammenzutreffe…
… nichts verriet etwas von dem schmerzlichen Sich zusammen ziehen seines Inneren, wenn das Kind einfach einen scheuen Blick aus seinen goldbraunen, umschatteten Augen zu ihm hingleiten ließ…
S. 626
„Willst du mitkommen, Hanno?“ sagte er ein ander Mal. „Ein neues Schiff, das zu unserer Reederei gehört, läuft heute Nachmittag vom Stapel. Ich taufe es. hast du Lust?“ Und Hanno gab an, dass er Lust hab…
Die bürgerliche Familie Buddenbrook zeigt sich uns mit getrennten Lebensbereichen von Mann und Frau, in der der die Entscheidungsgewalt beim Hausvater liegt.
„Das Gefüge dieses Familienromans, konzentriert auf die männliche und väterliche Nachkommenschaft, widerspricht .. einer bestimmten kulturellen Signatur der Familie, wie sie sich im 19. Jahrhundert entwickelt. Dort nämlich verlagert sich das Gravitationszentrum der Familie gerade auf diesen zunehmend von der Mutter-Kind-Einheit geprägten inneren Raum der Familie : auf jene neue, mutterzentrierte Normalfamilie, von der in den Buddenbrooks freilich kaum etwas zu sehen ist.“948
Der soziale Status des Mannes spiegelte sich in der Arbeit, im Erfolg und in der öffentlichen Anerkennung wider. Sein Beruf als sein Hauptwirkungsort war von großer Relevanz für die ökonomischen Disposition. Von Seiten der Kinder wurde die väterliche Stellung mit Stolz betrachtet, sie zollten ihm Respekt, weil sie erlebten, wie die Umwelt ihm mit Hochachtung begegnete. Die Familienmitglieder empfanden Schutz und Sicherheit durch seine Macht und seine Stärke.
(TM)
Bereits als Kind besitzt Tony ein Empfinden für die berufliche Position des Vaters:
S. 64
Denn wurde ihr von seiten irgend eines Gequälten eine Drohung zu teil, so musste man sehen, wie sie einen Schritt zurücktrat, den hübschen Kopf mit der vorstehenden Oberlippe zurückwarf und ein halb entrüstetes, halb moquantes „Pa!“ hervorstieß, als wollte sie sagen: „Wage es nur, mir etwas anhaben zu wollen! Ich bin Konsul Buddenbrooks Tochter, wenn du es vielleicht nicht weißt…
Sie ging in der Stadt wie eine kleine Königin umher, die sich das gute Recht vorbehält, freundlich oder grausam zu sein, je nach Geschmack und Laun…
Beruf, bürgerliche Vereinskultur und politische Aktivität bestimmten das Leben des bürgerlichen Mannes und entfernten ihn aus dem häuslich-familiären Bereich, wo er nur mehr eine periphere Position inne hatte.
An der Aufzucht der Säuglinge und Erziehung der Kinder beteiligten sich Väter nicht oder nur in geringem Maße. Väter waren nicht zum Anfassen. Ein Vater hatte Strenge zu zeigen, kühl und emotional distanziert zu sein. Man schloss ihn aus der emotionalen Mutter-Kind-Beziehung aus. Lediglich die Mutter teilte die Freuden und den Kummer mit den Kindern und ließ den Vater oftmals nur als Normenvollstrecker walten. Der Vater galt als die pädagogische Instanz, der die bürgerlichen Tugenden vermittelte. Insbesondere die Repräsentationsfamilie des 19. Jahrhunderts ließ die Vaterpflichten zurücktreten. Unterordnung und Gehorsam der Kinder wurden immer wichtiger.
(TM)
Thomas Buddenbrook zeigt Strenge und Autorität gegenüber seinem Sohn:
S. 485
„Das ist der Tag des Herrn“, sagte er ganz leise, und desto stärker klang die Stimme seines Vaters, der ihn unterbrac…
„ Einen Vortrag beginnt man mit einer Verbeugung, mein Sohn! Und dann viel lauter…
Das war grausam, . Aber der Junge sollte sich nicht beirren lassen! Er sollte Festigkeit und Männlichkeit gewinne…
Rousseau, der einflussreichste Pädagoge der damaligen Zeit, verlangte dagegen die Erziehung zur Komplementarität und wertete die Erziehung als eine männliche Aufgabe auf. Er kritisierte die Trennung von Berufs- und Erziehungspflicht und glaubte, die Frauen seien als Erzieher zu verzärtelnd und vernachlässigend. „So, wie die Mutter die natürliche Amme ist, ist der natürliche Erzieher der Vater.“949 (TM)
Konsul und Jean Buddenbrook verfügen über ein Kontor im Haus und hatten durch ihre bürgerlichen und beruflichen Pflichten weniger Einfluss auf die Entwicklung der Kinder als die Mutter, ihre Entscheidungsgewalt greift in bedenklich-schwierigen und wichtigen Situationen:
S. 101
Acht Tage später ereignete sich jene Scene im Frühstückszimmer. Tony kam um 9 Uhr herunter und war erstaunt, ihren Vater noch neben der Konsulin am Kaffeetische zu finde…
S. 209f
Der Konsul hatte schwere und aufreibende Tage hinter sich. Thomas war an einer Lungenblutung erkrankt. Er hatte die Geschäfte in den bedächtigen Händen seines Prokuristen zurückgelassen und war auf dem kürzesten Wege nach Amsterdam geeilt…
… kaum nach Hause zurückgekehrt, war er von diesem Schlage getroffen worden, der sein Haus für einen Augenblick in seinen Grundfesten erschüttert hatte: diesem Bankerotte in Bremen, bei welchem er „auf einem Brett“ achtzigtausend Mark verloren hatt…
Da aber, mitten im Kampf, mitten unter Depeschen, Briefen, Berechnungen, war noch dies über ihn hereingebrochen: Grünlich, B. Grünlich, der Mann seiner Tochter, war zahlungsunfähig…
Thomas Buddenbrook ist ein Beispiel dafür, wie sehr das eigene Wohlbefinden des Mannes abhängig war vom beruflichen Erfolg und wie sehr Misserfolg und der Verlust von beruflicher Anerkennung eine Krise hervorrufen konnten. Dies führt die Situation nach der Überschreibung von Claras Erbe vor Augen:
S. 434
Es war vielmehr dies, dass in seinem vorher schon gereizten Empfinden sich auch dieser Fall noch der Kette von Niederlagen und Demütigungen anreihte, die er während der letzten Monate im Geschäft und in der Stadt hatte erfahren müssen. Nichts fügte sich mehr! Nichts ging mehr nach seinem Wille…
Gotthold und Christian erfahren Geringschätzung, letzterer zeigt eine extreme Entfernung von der geforderten Männlichkeit sowohl im Verhalten als auch in seiner beruflichen Biographie:
S. 578
„Und du begreifst nicht, Mensch,“, rief Thomas Buddenbrook leidenschaftlich, „dass alle diese Widrigkeiten folgen und Ausgeburten deiner Laster sind, deines Nichtstuns, deiner Selbstbeobachtung?Arbeite! Höre auf, deine Zustände zu hegen…
Männlichkeit bestand in der vom Vater an den Sohn weitergereichten Macht und Aktivität, Tauschgeschäfte zu betreiben und Töchter als Tauschobjekte zwischen Familien einzusetzen.950
Thomas B. übernimmt die ,paternale Funktion’ 951 seines Vaters bereits früh und legt zu gegebener Zeit die Rolle des Sohnes ab. Er wird zum erziehenden strengen Vater seiner Schwester Tony gegenüber:
S. 383
„Du wirst mir glauben, Kind.…
Dieses Rollenschema erfolgt im gegenseitigen Einverständnis. Tony überträgt ihm die väterliche Macht:
S. 586
„Du musst für uns denken und handeln, denn Gerda und ich sind Weiber. Wir können dir nicht Widerpart halte…
Christian verbietet er die Adoption der unehelichen Kinder der Schauspielerin.
S. 581
„Du wirst es nicht tun.“ wiederholte Thomas Buddenbrook. „Und wage es nicht, gegen dies Verbot zu handeln, das rate ich dir!…
Zur Relativierung des bürgerlichen Bildes von Männlichkeit und Vatersein kam es, wenn die Normalität ins Schwanken geriet und der liebende und leidende männliche Bürger/ Vater hervor trat.
Dann zeigte sich die Diskrepanz zwischen der Stärke und den hinter der Inszenierung stehenden unterdrückten Emotionen.
(TM)
So nähert sich Jean seiner Tochter Tony sehr zärtlich-mitfühlen, als er erkennt, dass religiöse Schwärmerei seinen Blick auf die Person Grünlichs getrübt hatte. Dieses Verhalten verändert das Tochter-Vater-Verhältnis, das in der bürgerlichen Familie stets durch ein extremes Autoritätsgefälle gekennzeichnet und ein „Abhängigkeitsverhältnis [war], das dem ehelichen vorausgeht.“ 952 Tony empfindet ihrem Vater gegenüber fortan nicht mehr die „ängstliche Ehrfurcht“, die Ungehorsam oder Respektlosigkeit einer Tochter ihrem Vater gegenüber als ein Ding der Unmöglichkeit macht, sondern „Zärtlichkeit“:
S. 233
Ihr Verhältnis zu ihm( zum Vater)war mit einem Schlage weit inniger geworden als früher. Sie hatte bislang, bei seiner Machtstellung in der Stadt, bei seiner emsigen, soliden, strengen und frommen Tüchtigkeit, mehr ängstliche Ehrfurcht, als Zärtlichkeit für ihn empfunden; während jener Auseinandersetzung aber in ihrem Salon war er ihr menschlich nahe getreten, und es hatte sie mit Stolz und Rührung erfüllt, dass er sie eines vertrauten und ernsten Gespräches über diese Sache gewürdigt, . dass er, der Unantastbare, ihr fast mit Demut gestanden, er fühle sich nicht schuldlos ihr gegenüber.. und ihre Gefühle für ihn wurden weicher und zarter dadurc…
Thomas Buddenbrook zeigt als erwachsener Mann Schwäche und für die damalige Zeit unmännliche Eigenschaften. Hinter seiner formalen Fassade emotional verunsichert, sucht er Gemeinschaft und Geborgenheit und findet sie bei seinem Sohn.953 Hanno erkennt in dieser Situation bei seinem Vater die eigene Empfindsamkeit wieder:
S. 627
Alles mit einer formalen Versiertheit des Wortes und der Gebärde, die er ersichtlich gern der Bewunderung seines Sohnes produzierte und von der er sich unterrichtende Wirkung versprach. Aber der kleine Johann sah mehr, als er sehen sollte, und seine Augen, diese schüchternen, goldbraunen, bläulich umschatteten Augen beobachteten gut. Er sah nicht nur die sicherer Liebenswürdigkeit, die sein Vater auf Alle wirken ließ, er sah auch - sah es mit einem seltsamen, quälenden Scharfblick - wie furchtbar schwer sie zu machen war, wie sein Vater nach jeder Visite wortkarger und bleicher, mit geschlossenen Augen, deren Lieder sich gerötet hatten, in der Wagenecke lehnte, und mit Entsetzen im Herzen erlebte er es, dass auf der Schwelle des nächsten Hauses eine Maske über ebendieses Gesicht glit…
Beim Besuch des Leutnants konfrontiert er seinen Sohn Hanno, wie ein Kind stammelnd, mit seiner Verzweiflung, und findet bei ihm Verständnis und Mitgefühl:
S. 650
Und dann, plötzlich, vernahm Hanno über sich etwas, was in gar keinem Zusammenhange mit dem eigentlichen Gespräche stand, eine leise, angstvoll bewegte und beinahe beschwörende Stimme, die er noch nie gehört, die Stimme seines Vaters, dennoch, welche sagt…
„Nun ist der Leutnant schon zwei Stunden bei Mama.Hanno…
Das Eine aber war sicher, und sie fühlten es Beide, dass in diesen Sekunden, während ihre Blicke ineinander ruhten, jede Fremdheit und Kälte, jeder Zwang und jedes Missverständnis zwischen ihnen dahinsank, dass Thomas Buddenbrook, wie hier, so überall, wo es sich nicht um Energie, Tüchtigkeit und helläugige Frische, sondern um Furcht und Leiden handelte, des Vertrauens und der Hingabe seines Sohnes gewiss sein konnt…
Beim Firmenjubiläum weist die Sehnsucht nach der Umarmung der Mutter bereits in ihrer Körper-Metaphorik auf den Verfall der Männlichkeit hin.
S. 481
Den Senator befiel eine Schwäche in dieser Umarmung. Es war, als ob in seinem Inneren sich etwas löste und ihn verließ. Seine Lippen bebten. Ein hinfälliges Bedürfnis erfüllte ihn, in den Armen seiner Mutter, an ihrer Brust, in dem zarten Parfüm, das von der weichen Seide ihres Kleides ausgingen und nichts mehr sagen zu müsse…
Diese Ereignisse unterstreichen: „DieBuddenbrookshandeln von einem väterlichen Gesetz, dem die Söhne nicht mehr folgen können.“954
Der Spagat zwischen Familie, dem Wunsch, „Teil des emotionalen Familienlebens zu sein“ und dem Männlichkeits-Bild mit dem rastlosen Tätigsein für Beruf/Firma gestaltete sich schwierig bis unmöglich für die Männer des Bürgertums. Die Folge war eine immer größer werdende Anfälligkeit für Krankheiten. Zur Wiederherstellung der Gesundheit und um für die Arbeit wieder zur Verfügung zu stehen, unternahm man Bäderreisen und Kuren, jedoch „überlebten viele Männer kaum ihre Pensionierung.“ 955
20.3.2 Das Männlichkeits- und Vaterbild im 20. Jahrhundert
Leitbilder und Männlichkeitsideale änderten sich in den 150 Jahren, die zwischen den Romanen liegen, doch eine Nachwirkung des Konstrukts der väterlichen Allmacht ist, wenn auch in abgeschwächter Form, im 20. Jahrhundert noch zu verzeichnen.956
Die traditionelle Auffassung, dass der Vater streng und unnachsichtig und mit viel Autorität die Söhne zu kraftvollen Männern erziehen sollte, fand im 20. Jahrhundert weiterhin Verbreitung. Auftretende Männerbünde wollten in ihren Gruppierungen diese Art von Erziehung in die Hand nehmen. Wie die Männlichkeitserziehung in der NS-Zeit funktionierte, werde ich bei der Figur von Peter näher erläutern.
Die Entwicklung der Kleinfamilie mit dem Rückgang der Kinderzahl ließ die Macht des Vaters schwinden: „Die Väter wurden zu Herrschern ohne Reich.“957 Nach dem 2. Weltkrieg kam es zu einer Diskussion über das Versagen der Vätergeneration. Vaterlose Söhne, deren Väter im Krieg gefallen waren, suchten eine Orientierung. Sie endete mit einer Ablösung des bisherigen Männer- und Vaterbilds und dem Bild der „Mutterfamilie“, bei der der Frau als Ehefrau und Mutter die Hauptverantwortung in der Ehe und in der Kindererziehung zufiel.958
Heute ist ein System von Vorstellungen, das Männern eine Macht über Frauen gibt, in Westeuropa nicht mehr denkbar, Väter stehen im Kontrast zur Generation der Erwachsenen in der Nachkriegszeit.
Dem Patriarchat wurde durch die gesetzliche Gleichberechtigung der Frau und einer Machtstellung der Mutter die Grundlage entzogen und vom Leitbild der Komplementarität abgelöst.
Auch wenn manch einer von konservativer Seite den Kampf um die Gleichheit der Geschlechter als einen Schaden für die Machtstellung des Vaters und der Familie sah, ist die Arbeitsteilung in männliche und weibliche Sphäre (Haushalt/Erziehung der Kinder)) wenn auch noch nicht ganz aufgegeben, so doch sehr in Frage gestellt worden. Es entwickelte sich, leider meist nur in der Theorie, wie wir noch sehen werden, die gemischtgeschlechtliche Arbeitsteilung. Ethnologen sehen die Universalität der geschlechtlichen Rollenverteilung als asymmetrisch an, nämlich zu Ungunsten der Frauen, in den demokratischen Gesellschaften jedoch wird heute das Leitbild von der Ähnlichkeit der Geschlechter vertreten.959
Mit dem Gleichberechtigungsgedanken in Bezug auf die Geschlechterrollen und dem Abbau des Patriarchats entwickelte sich ein neues Vaterbild: Die Väterherrschaft endete, der Vater hat nicht mehr wie bei den Buddenbrooks die „Stellungsautorität“ allein durch seine Rolle als Ernährer und Familienvorstand, der moderne Vater ist eine Beziehungsautorität, die durch Liebe, Kompetenz und Unterstützung seiner Kinder Autorität ausübt.960
Vaterschaft ist heute aber so wie früher verbunden mit Reife und Festigung. Die Verantwortlichkeit für Kinder und Familie lässt die eigene Position in der Gesellschaft überdenken und den Lebensstil verändern, denn die Existenzsicherung der eigenen Familie liegt auch im 20. Jahrhundert, oftmals zumindest nach der Geburt der Kinder, in der Verantwortung des Ehemannes, so dass eine Familiengründung erst erfolgt/erfolgen sollte, wenn die berufliche Zukunft und der Verdienst gesichert sind. Der spezifisch menschliche Aspekt der Familie liegt im Ernährungsverhalten der Männer.961 Die Berufsposition definiert wie zur Zeit des Bürgertums den sozialen Status des Mannes.
Die zeitgenössischen Romanfamilien präsentieren uns Varianten des traditionellen und des modernen Männlichkeits- und Vaterbildes.
(AG)
Richard Sterk
In der zeitgenössischen Roman-Familie Sterk finden wir das Autoritätsmodell. Richard Sterks Vaterrolle geht auf das patriarchalische Familienbild zurück: Als Teil der sicherheitsund ordnungsliebende Kriegsgeneration ist Richard geprägt von den traditionellen Werten der Pflichterfüllung, Ordnung und von einer klaren Leistungsethik.
Er ist beruflich erfolgreich, zeigt chauvinistische Attitüden und pocht auf unumstrittene Autorität. Als konservativer Vater fühlt er sich als unanfechtbares Oberhaupt und als Repräsentant der Familie.
Traditionsverwurzelt erwartet er, dass seine Frau zuständig ist für den Alltag, für die Erziehung der Kinder und für die emotionale Zuwendung. Als starker und verantwortungsbewusster Haupternährer steht er in der Pflicht. S e i n e Aufgabe ist die Einkommenssicherung, die seiner Frau die Familienorganisation. Alma identifiziert sich eindeutig mit der klassischen weiblichen Geschlechtsidentität und Rollenzuweisung, die bis 1970 beherrschend war.
Richards praktischer Lebensmittelpunkt ist der außerhäusliche Beruf.Dein männliches Selbstverständnis ist abhängig von der öffentlichen Bestätigung. Er wird an den Rand des familiären Alltags gedrängt und zeigt nur geringes Interesse am Privatleben, kehrt als Erholungssuchender in den Schoß der Familie zurück und sieht sich als.
S. 73
… Brennpunkt eines familiären Kraftfeldes …
Jede familiäre Regung ein Attribut seiner großmächtigen Perso…
Richards Verhalten charakterisiert ihn als einen Mann, dem persönliche Schwäche und Krankheit unbekannt sind bzw. diese niemals nach außen jmd. zeigen würde:
S. 23
In einer Sitzung, die bis weit nach Mitternacht dauerte, ließ Richard sich beide Kiefer ausräumen. Dem Vernehmen nach schlief er trotz der Schmerzhaftigkeit der Extraktionen wiederholt ei…
S. 29
Sie dachte, womöglich ist er ernsthaft krank und spielt es herunter, weil Krankheit für einen Mann wie ihn eine schwer zu ertragende Schande ist, vergleichbar mit mutwilliger Sachbeschädigun…
Alltägliche Versorgungsaufgaben delegiert er an Alma und das Dienstmädchen.
Seine Funktion als Vater in der Familie ist wenig emotional, er ist Disziplinierungsperson und nicht Mentor seiner Kinder, S.91
Otto setzt das Heulen und Tanzen for…
- Otto, hör auf, es reicht, schnauzt Richar…
Er winkt den Buben zu sich her und gibt ihm eine Ohrfeige. Er ist überzeugt, dass es nicht schaden kann, wenn auch Otto sich ein wenig disziplinier…
- Auf der Mauer hast du nichts verloren, und verräum dein Tretauto dort, wo es hingehör…
Solch ein väterliches Erziehungsverhalten liegt wiederum in seinen Kindheits-Erfahrungen mit seinem Vater begründet:
S. 72
Dass sein Vater überhaupt mit ihm geredet hätte als er, Richard, klein war? Er kann sich nicht erinnern, dass das vorgekommen ist. Verständigung bedeutete, den Kindern etwas aufzutragen. Ansonsten hatten sie sich wie Topfblumen zu betragen, kein Vergleich zu den heutigen Familien.S. 89
Richard ruft nach dem Bube…
Keine Antwor…
Otto ist und bleibt eine Rotznase, das ist Richards Meinun…
Für ihn ist ein Kind erst interessant, wenn es „vernünftig“ ist und er mit ihm reden und es belehren kan. Mit kleinen Kindern kann er wenig anfangen, wie er selber zugibt.
S. 26
Oder durch reine Gedankenübertragung, da der Mann mit den Kindern ja ohnehin nicht rede…
Er zeigt sich seiner Tochter gegenüber gegenüber weder fürsorglich noch emotional zugewandt, aber als es zu Schwierigkeiten in der Landverschickung während der NS-Zeit geht, greift er ein.
In der Erinnerung der späteren Jahre hinterfragt er einmal mehr die Richtigkeit seiner Art von Erziehung und wie wenig emotional angemessen er reagiert hat:
S. 204f
,Schwarzindien‘ hieß das Wirtshaus, in dem Ingrids Klasse untergebracht war. … Bei der Essensausgabe hatte sie beanstandet, dass die Lehrerin ein Stück mehr auf dem Teller hat als sie. Der Aufruhr, den diese Bemerkung nach sich zog, war trotz Kriegslärm bis nach Wien zu hören. Bei Richards Ankunft, das wird er so schnell nicht vergessen, warf sich ihm ein todunglückliches Mädchen in die Arme, blieb den ganzen Tag an seinen Hals geklammert … Das heulende Elend. Papa, das wird mir eine Lehre sein, das schwör ich. Jaja, das sollte es, Kindchen, wirst sehen, dann renkt es sich wieder ein. Oder sonstwas an Allerweltsweisheit. Da redet man stundenlang vor dem Nationalrat, und wenn die Tochter Kummer hat, fällt einem nichts ei…
… Dass das Mädchen die ganze Härte der seinerzeitigen Erziehungsmethoden zu spüren bekam,, nachdem Richard bei seinem Besuch keinerlei Abmilderung der Strafmaßnahmen hatte erwirken könne…
„Die häufig zu beobachtende Mischung von derben väterlichen Machtdemonstrationen und sentimentalen Anwandlungen sind deutliche Zeichen der Destabilisierung der Vaterautorität.“962
In den 50er Jahren ist das Verhältnis zwischen ihm und seiner Tochter ganz und gar nicht entspannt: Die väterliche Bedeutung und sein Ansehen werden zwar respektiert, jedoch treten Dissonanzen auf, und seine Autorität wird untergraben. Strenge und Härte kennzeichnen seinen Männlichkeitshabitus und schüchtern Ingrid ein. Richard fordert als Vater Grenzen mit Strenge und Argumentation ein, jedoch hat sein Wille nur noch eingeschränkte Macht. Als Ingrid sich über den Regelkanon des Vaters hinweg setzt, kommt es zu familiärem Stress.
S. 143
Er nimmt für sich in Anspruch, in allem recht zu haben. Papa omnipotens. Was aus seinem Mund kommt, ist Dikta…
S. 149
-So kannst du Mama in die Tasche stecken. Bei mir funktioniert der Trick nicht.…
- Das ist der Gipfel! so lasse ich nicht mit mir reden! Ich erwarte von dir, dass du dich ins familiäre Regelwerk einfügst, sonst setzt es Konsequenzen! Ist das kla…
Die Kommunikation mit seiner Tochter misslingt, er findet keinen angemessenen Ton und zurück bleiben Sprachlosigkeit und ein Zeit des Lebens bestehendes zerrüttetes VaterTochter-Verhältnis.
S. 210
- Alt und gediegen: Für mich sind das Werte, sagt e…
Und Ingrid lapida…
- Für mich nich…
Er sieht das Etikett, das er gerade verpasst bekommen hat, als wäre es ihm mit Spucke auf die Stirn geklebt: Spießig - unflexibel - gestrig … Denn dass ihr sein Leben insgesamt gegen den Strich geht, hat sie ihn oft genug spüren lasse…
- Das beweist nicht, dass du das Leben besser verstanden hast. Es bestätigt nur, dass sich unsere Erfahrungen nicht decken und dass wir deshalb verschiedener Meinung sin…
- letzteres ist unbestritte…
Sein traditionelle Rollenverständnis bleibt über den Auszug der Tochter und das Ende der Berufstätigkeit hinaus bestehen.
S. 24f (1982)
- Was willst du damit sagen? fragte Richard. In seinen Augen ein Ausdruck unsäglicher Verwunderung und das zur Gewohnheit gewordene Misstrauen, als gebe er sich inmitten der Disteln und Dornen dieser Welt redliche Mühe zu begreifen, was Alma im Schilde führ…
… Davon verstehst du nichts, hört sie dann meistens. Und dazu dieses siebengescheite MinisterGetue. Immer das gleiche. Wie oft scho…
Peter Erlach
Peter weist als Figur einen Erlebnisbezug zum NS-Kapitel der deutschen Geschichte auf. Er gehört zu der Kriegsgeneration, die Schelsky als die ,Skeptische’ Generation betrachtete und ist in seinem Männlichkeitsverhalten durch die Männerbünde der Hitlerzeit geprägt.
Die HJ gab ihm in seiner Jugend ein Verbundenheitsgefühl zum soldatisch-männlichen Wir, skandierte Lieder betonten damals männliche Tugenden wie Stärke und Kraft.
Das Männerbundgefühl und dessen Ethos dienten der männlichen Hitlerjugend, ebenso wie andere jugendbewegten Stil- und Umgangsformen, als Basis ihrer „Pädagogik“ und ihrem martialischen Männlichkeitsideal - nicht zur eigenen Familie sondern zu Volk und Vaterland sollten junge Männer emotionale Bindungen haben.
Die NS-Propaganda trug durch die Verunglimpfung christlicher Traditionen und Werte, wie z.B. dem Mitleid, dazu bei, die Psyche der Soldaten zu brutalisieren. Dagegen bedeutete Kameradschaft ein wichtiges Instrument für die Kampffähigkeit der Truppe, in ihr lebte man Gefühle aus und zeigte Härte ebenso wie Gesten der Menschlichkeit. Ihre Praxis jedoch war ambivalent und sah bisweilen anders aus als es Peter erwartet hatte: Er erlebte eine Hackordnung, gegenseitige Beobachtung und Überwachung, aber auch Geborgenheit, die im Laufe der Brutalisierung des Krieges immer wichtiger wurde und einen Ersatz für die Familie darstellte. Mit den familienanalogen Rollenaufteilungen in der HJ sollte der Fähnleinführer zu einem Ersatzvater werden, doch:
S. 107
Er mag seinen Fähnleinführer nicht, der hat von Anfang an darauf verzichtet, es unter seinen Buben zu besonderer Beliebtheit zu bringen. Anfang Februar hat er auf dem Wehrertüchtigungslager in Judenburg Peters Degradierung durchgesetzt …
Das reale Modell für die Entwicklung eines Jungen ist stets der Vater. Er vertritt die äußere Realität mit Berufstätigkeit, Verdienst und politisches Engagement, sein Verhalten, seine Meinungen, Neigungen und Abneigungen nimmt der Sohn zum Vorbild, vorausgesetzt, es besteht eine geglückte Beziehung. Als Junge wünscht sich Peter stets Lob und die Zuneigung seines eigenen Vaters, doch im Mittelpunkt der familiären Aufmerksamkeit steht die krebskranke Mutter. Peter kommt sich wertlos vor und hatte ein Gefühl der Ohnmacht, während seine Schwestern entsprechend des Frauenbildes der damaligen Zeit, der Mutter eine Hilfe waren.
Angstvoll erlebt er, wie die Mutter während der Luftangriffe vor Angst um ihr Leben, vor ihrer Krankheit und vor dem Tod schreit. Er ist 15, als seine Mutter stirbt und durch das frühe „Kriegsspielen“ geprägt.
S. 258
… und dass Peter, als seine Mutter starb, erst fünfzehn war, im Krieg, das frühe Kriegsspielen, das dürfte sich bei ihm ebenfalls negativ eingeschrieben haben …
Dann sieht sie den kleinen Peter, wie er seinen verwundeten Arm hält, wie ihm die Rotzglocke von der Nase hängt, wie er sich sagt (sie glaubt es): Alle sind gegen mich, die einen schießen auf mich, und die andern lassen mich im Stich, allen voran die Famili…
Andererseits ist Ingrid der Auffassung:
S. 242
Der Krieg ist bei ihm eine Art Männer-Migräne, sehr schlau, klug, ausgeklügelt. Ausrede…
Peters Verhältnis zum eigenen Vater ist unweigerlich mit den Erlebnissen während und nach der Zeit des Nationalsozialismus verbunden:
S. 111
Während der T34 ausbrennt, wünscht sich Peter, dass ihn sein Vater sehen könnte, dem würde er so gerne gefallen. In letzter Zeit gab der Vater nie ein Lob und teilte nur aus, obwohl diese Mißbilligung das ist, was Peter am meisten verletzt. Seit es mit der Mutter bergab geht (oder seit die Siegesmeldungen ausbleiben, das ist schwer zu beurteilen), hat sich das Verhältnis zwischen ihm und seinem Vater rapide verschlechtert.…
An allem hat der Vater etwas auszusetzen, und immer ist es Peter, der hart angepackt und verhauen wird …
Wenn jetzt noch der Krieg verlorengeht, wird der Vater nicht mehr auszuhalten sein. Peter fragt sich, wie das bloß enden soll. …
Vertrautheit und Nähe zu ihm erlebt Peter nach dem Anschluss Österreichs, als sein Vater, mit der Politik konform gehend, Vorteile aus seiner Parteizugehörigkeit zur NSDAP zieht und Arbeit und Brot findet:
S. 126
Wie er vor sieben Jahren, fast auf den Tag genau, so gelegen ist, im Augarten neben seinem Vater, sonntags, an dessen rechter Seite. Und wie der Vater ihn ins Vertrauen zog, …
Aus dem Vater, der für ihn zunächst eine Autorität und ein Held ist, wird ein Täter und Verbrecher. Man verurteilt ihn wegen seiner politischen Gesinnung zweimal zur Zwangsarbeit, er bekommt Berufsverbot, bleibt aber seinem Standpunkt treu. Die Folge ist der soziale Abstieg der Familie, und Loyalitätskonflikte von Seiten Peters im Verhältnis zu seinem Vater:
Die in Kriegs- und Nachkriegszeit erfahrene Not und Gefährdung der eignen Familie durch Flucht, Ausbombung, Deklassierung, Besitzverlust, Wohnungsschwierigkeiten, Schul- und Ausbildungsschwierigkeiten, der Verlust der Eltern oder eines Elternteils haben einen sehr großen Teil der damaligen Jugendgeneration frühzeitig in die Lage versetzt, für den Aufbau und die Stabilisierung ihres privaten Daseins Verantwortung und Mitverantwortung übernehmen zu müssen.963
Nach 1945 erfolgte eine Umkehrung der Männlichkeitsideale: Die Männerrolle und die Attribute des Männerbildes mussten umdefiniert werden, die „Zivilisierung“ der Männlichkeit ersetzte ihre Militarisierung.964 Mit entscheidend hierfür war das Erscheinungsbild der Besatzer: Statt korrekter Kleidung und Härte galten nun Lockerheit und formlose Kleidung als angemessen männlich.965
Auch Peter zeigt in den 50er Jahren ein gegensätzliches Männerbild als das in der NS-Zeit propagierte:
Er wirkt unambitioniert, ist kein kämpferischer, eher ein gelassener, bedächtiger Typ:
S. 164
Peter verdrückt sich verlegen zu seiner Arbeit.…
Er ist geduldig und steckt vieles ein, wenn Ingrid ihm z.B. eine Strafpredigt bzgl. seiner Lebensweise und Arbeit hält:
S. 165
Weil deine ewige Pleite liegt mir bleischwer im Magen, das geht nun schon so, seit ich dich kenne…
Es fehlt ihm nach Ingrids Ansicht ein männliches ,Attribut‘:
S. 170
… aber du musst jetzt mit eiserner Energie arbeiten und wirklich versuchen, Papa einen Beweis deiner Tüchtigkeit zu liefern … es ist leider ein Zug, den ich an dir vermisse und von dem Papa eines zuviel hat, die Nüchternhei…
Er ist gutmütig und kinderlieb:
S. 174
Dort überreicht er dem Buben ein Abziehbild der Großglockner-Hochstraße. Für das hintere Schutzblech des Tretrollers, wie Peter sagt. Der Knirps kann sich vor Begeisterung kaum halten, er bedankt sich mehrfach mit kleinen Verbeugungen …
Ingrid charakterisiert ihn in späteren Jahren folgendermaßen:
S. 261
Peter in seiner freundlichen, unbekümmerten, konsequent distanzierten, eingefleischt gleichgültigen Art zu lieben. Fortsetzung: In seiner grundanständigen, gutmütigen, selbstgenügsamen, nein anspruchslosen, in seiner alles verharmlosenden und vieles herunterspielenden, von Not und Krieg gelehrten, defensiven, kontaktscheuen …
In den 60er Jahren hat er die Vaterrolle in einer traditionellen Familie inne: Als deren Ernährer beruflich stark außerfamiliär beansprucht und richtet sich auf einen privaten und beruflichen Neuanfang ein. Die Mutter/Vater-Kind-Beziehung ist konservativ mit dem Gefühlsmonopol bei der Mutter (Retraditionalisierung)
In den 70er Jahren fordert Ingrid, inzwischen berufstätig, von Peter eine Neudefinition der Männerrolle, doch da zu dieser Zeit der Wandel der Vater-Rolle noch nicht sonderlich weit fortgeschritten ist, hat der Beruf für ihn eine große Relevanz. Es gab zur damaligen Zeit keinen Rechtsanspruch auf Elternzeit oder Teilzeitarbeit. Das Zeitbudget der Väter war gering. Die traditionelle Rollenteilung ist das Resultat einer überkommenen Geschlechtsidentität - ein Denken, das der damaligen Zeit geschuldet ist und dem nachwirkenden Einfluss der eigenen Elterngeneration, denn eigentlich, so wird sich zeigen, ist Peter kein Patriarch mit chauvinistischen Attitüden.
In wenigen Fällen lässt er sich neben der Arbeit Spielraum für die Beschäftigung mit den Kindern, meist sind es Routinehandlungen:
S. 262
Peter hilft den Kindern aus den Stiefeln …
S. 268f
Peter föhnt den Kindern die Haare und füttert sie mit Brote…
… Dann geht sie nach untern, wo Peter im Spielzimmer für die Kinder den August macht, Philipp herzt Peter ein paarmal und drückt ihn, so dass Ingrid fast ein wenig eifersüchtig wird. Dass Peters Nichtstun ihm bei den Kindern soviel Ansehen einträg, sobald er sich doch einmal herbeilässt, mit ihnen zu spielen, ist ein Phänomen, das sich Ingrid nie erhellen wird. Aber bitte, sie erzieht die Kinder, Peter konsumiert si…
Der Tod Ingrids fällt in eine Zeit, in der sich die familialen Rollenvorstellungen veränderten und der autoritäre Vater alten Stils verschwindet.966
Die „neue Väterlichkeit“ wird zum Merkmal einer neuen Männlichkeit, d. h. zur ganzheitlichen Erziehung gehörte von nun an auch der Vater, und was früher als unmännlich galt, zeigten moderne Väter der Gegenwart. Eine Angleichung der Geschlechter implizierte für den Vater Sanftheit und einen zärtlichen Umgang mit Kindern, von dem man bisher glaubte, nur Frauen seien fähig dazu. Bemutterung war nun nicht nur Sache der Frauen. (Philosophisch spricht man in diesem Zusammenhang vom Mythos des Androgynen, wie ihn Aristophanes in Platons „Gastmahl“ schildert, in dem drei Arten von Menschen, die männliche, weibliche und eine aus den beiden anderen zusammengesetzte dritte Art auftritt. In jedem Menschen sind Männliches und Weibliches ineinander verflochten und damit die Ähnlichkeit von Frau und Mann.967)
Peter als Witwer kehrt nach einer Zeit der Trauer in diese „Normalität“ zurück.
S. 302
…. seit die Anfangszeit überstanden ist, damals, als er wie mit einer Bleiweste lebte und den Kindern vor lauter Zeitdruck die Hausaufgaben diktierte, …
Das Verhältnis zwischen ihm und den Kindern ist zunächst eher distanziert, zu sehr stand bisher seine Berufstätigkeit im Vordergrund, und es bedarf längerer Zeit, den Tod der Mutter, die für alle d a s verbindende Element war, zu verarbeiten.
Doch er nimmt die neue Rolle an, wird ein erziehender Vater mit den als typisch weiblich geltenden Eigenschaften der Fürsorge und der Aufopferung. Peter ist als alleinerziehender Witwer der Interaktionspartner der Kinder, er geht auf die kindliche Psyche ein, akzeptiert ihre Unvollkommenheit, übernimmt die Hege- und Pflege-Funktion der verstorbenen Mutter und engagiert sich in der Erziehung und Sozialisation seiner minderjährigen Kinder. S. 290
Seit Ingrids Tod hat er sich Strategien zurechtgelegt, wie er mit den Kindern über die Runden kommt. …
Solange er sich keine Sorgen macht (dieses Recht werden sie ihm hoffentlich zubilligen), redet er den Kindern nicht drein. Und wenn eines der Kinder unbedingt seine Meinung hören will, versucht er, diese möglichst neutral zu formulieren ..Er beklagt sich selten über den verheerenden Saustall in den Zimmer…
S. 295
Du hast einen ganz großartigen Bruder, Sissi. Du hast allen Grund, stolz auf ihn zu sei…
Während er selber in seiner Biographie eine autoritäre Erziehung zur Unterordnung erlebte, praktiziert er nun eine moderne Erziehung, trifft Entscheidungen gemeinsam mit den Kindern durch Verhandlungen und verlangt keineswegs mehr Unterordnung und Gehorsam. Er will nicht in erster Linie disziplinieren und legt auch nicht mehr die Verhaltensnormen der Erwachsenen als Maßstab für die Kinder an. Er begegnet den Kindern als Freund und Partner anstatt Autoritätsperson zu sein. Wenn, dann kann man bei ihm eher von einer Beziehungsautorität sprechen, die aus der Liebe zwischen Vater und Kind entsteht, Autorität von dem Begriff der Macht getrennt.968 Auf der Fahrt in den Urlaub zeigt er, wie liberal, geduldig, gutmütig und großzügig er ist: S. 288
- Ich frag mich, warum ausgerechnet du derjenige sein willst, der weiß, was gut für mich ist. …
- Weil ich ein paar Jahre mehr am Buckel habe als du. …
- Ich würde mir so sehr einen liberaleren Vater wünschen. …
- Ich bin liberal, wendet er ein: als nächstes käme die totale Teilnahmslosigkeit, die hast du mir auch schon vorgeworfe…
S. 296
- Wenn ich’s mir überlege, Sissi, kann ich kein so schlechter Vater sein, bei dem vielen, was ich erzähl…
Nachdenklich reflektiert er das angespannte Verhältnis zwischen sich und seiner Tochter, die nach Ingrids Tod mit ihren 17 Jahren Mutterersatz für Philipp ist:
S. 290
Und er sieht auch ein, dass zutrifft, womit ein Arbeitskollege ihn unlängst trösten wollte, nämlich dass es nicht ganz einfach ist, ein siebzehnjähriges Mädchen für sich zu gewinnen, wenn man das Unglück hat, ihr Vater zu sei…
S. 319
Er weiß beim besten Willen nicht, was das für eine merkwürdige Phase ist, die das Mädchen gerade durchläuf…
S. 320
Irgend etwas an der Art, wie er lebt, gefällt ihr nicht. Oft wochenlan…
Ist es Liberalität und Großzügigkeit, Gewährenlassen als Folge von Resignation und eine fehlende Bereitschaft zur Auseinandersetzung oder Unsicherheit? „[Von] dem Vater können notwendige Forderungen an das Kind unterbleiben aus Angst“, um die emotionale Beziehung nicht zu gefährden.969
Er wünscht sich, etwas über die Freuden und Sorgen seiner Kinder zu erfahren. Die Fahrt in den Urlaub soll hierzu das Gefühl verstärken, eine Familie zu sein.
5. 297f
Na, komm, Philipp, erzähl uns was, sagt Peter. …
- Ihr könnt was singen. Na? wie wär’s? Zur Hebung der allgemeinen Moral. Was ist? ja? ja? na, so was! das freut mich … aber … aber … das lobe ich mi…
Peter konfrontiert in Gedanken seinen Sohn mit seinen Ansprüchen von Männlichkeit, die beinhalten: Erfolg im Sport zu haben und eine geschlechtsspezifische Art von Verhalten und sozialen Beziehungen.
Aus Peters Blickwinkel ist Philipp nicht allzu jungenhaft, statt sportlich ist er eher zögerlichvorsichtig. Erkennbar ist hier durchaus noch der Geschlechtercharakter aus dem Bürgertum.970
S. 294
Ja wahrlich, ein kleiner Depp. Er kann einem richtig leid tun. Nicht einmal Peter ist bislang aufgegangen, welche Talente der Rotzfresser mitbringt. Geschickt ist er jedenfalls nicht, es ist unmöglich, ihm beizubringen, wie man auf den Fingern pfeift oder auf einem Grashalm, da tun ihm hinterher die Backen weh. Geschäftstüchtig ist er auch nicht. Er besitzt keinen Ehrgeiz, weder im Sport noch bei den Mädchen … Und Mut ist ebenfalls nicht seine Sache. Wahrlich, was für ein Trop…
Doch Peter hinterfragt die Rituale der traditionellen Männlichkeit und hat einen Blick für ungleiches Verhalten und Strukturen.
S. 298
Still und in sich gekehrt lehnt der Bus seitlich an der Tür. Könnte auch sein, dass sich hinter Philipps Träumen konzentrierte Wachsamkeit verbirg…
In nachdenklicher Selbstreflexion überdenkt er sein Verhalten als Ehemann und Vater zu Lebzeiten Ingrids und nimmt mit der Bereitschaft zur Selbstveränderung wahr, dass ein Wandel des männlichen Rollenbildes sich vollzogen hat und auch er selber nun ein anderes Selbstverständnis hat.
S. 302
… denn seither ist vieles geschehen und anders geworden, die Zeit hat so manches geregel…
Und er wünschte, dass … sie gemeinsam gute Bücher läsen und die Kinder stolz wären und gerne nach Hause käme…
… er weiß doch, dass seine Ehe nicht das war, was sie sich vorgestellt hatten …
Philipp Erlach
Philipp erlebt durch seinen Vater den Wandel der Familien- und Erziehungsziele: Die männlichen Ideale von Ordnung, Autorität und Gehorsam verloren an Bedeutung. Die Feminisierung der Vaterrolle wirkte sich auf seine Entwicklung aus.971
Die erzieherischen Werte, die Peter als Vater ihm weitergibt, sind nicht nur verbal sondern auch habituell kommuniziert. Frühe Erfahrungen mit Väterlichkeit und den sich darin gebildeten Mustern nimmt Philipp auf und trägt sie in die Partnerschaften.
Ähnlich wie Peter ist er ein stiller und eher umambitionierter Mensch, der Konflikte meidet, als Mann eine gewisse Verunsicherung bei Entscheidungen zeigt und zwischen mehreren Zielen hin und her geworfen ist. In ihm spiegelt sich der Umbruch im Selbstverständnis des Mannes: Klassisch-weibliche Attribute wie Gefühle und Zärtlichkeit tauchen auf, sog. „weiche Kompetenzen“, wie z.B. romantisches Empfinden und Zärtlichkeit, Empathie, Selbstverwirklichung sind nun tolerierbar.972
Dabei distanziert er sich von den klassischen männlichen Attributen wie Kompetenz, Leistung, Erfolg, Durchsetzungsvermögen. Karriere, Status und Besitz sind für ihn sekundär, so dass seine Partnerin von ihm mehr Engagement einfordern muss. Dem monitären zieht er den ideellen Gewinn vor, finanzielle Überlegungen rücken bei ihm in den Hintergrund. Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwinden.
Er gehört zu den jungen Männern, die nicht darauf vorbereitet sind, dass ihnen gesellschaftlich die Rolle des „Breadwinners“ (Ernährers) zugewiesen wird, sie wollen und können diese Aufgabe nicht ausfüllen.973
(ER)
Die Männer der Familie Umnitzer
Im Kommunismus der DDR gab es bereits nach dem Krieg eine andere Vorstellung von Geschlechterrollen und Männlichkeit als im westlichen Ausland. Ein Beleg dafür sind die Männer in Ruges Roman:
Kurt Umnitzer
Sozialisiert in der Staatsideologie des Sozialismus, die das männliche Ernährermodell des Westens nicht mehr gelten ließ, unterstützt Kurt als Ehemann seine Frau emotional, materiell und in organisatorischen Dingen und zeigt sich offen dafür, dass Irina im Anschluss an die Erziehungszeit in den Beruf zurückkehrt. Sein Bild von der Frau ist mit Erwerbstätigkeit gekoppelt. Kurt und seine Frau agieren auf Augenhöhe.
Prinzipiell stimmt er einer Mitarbeit im Haushalt zu, übernimmt einzelne Tätigkeiten zur Entlastung der Frau. Eine gleichgestellte Mitarbeit im Haushalt ist nicht vorhanden, aber das liegt an Irina, sie präferiert die traditionelle Aufteilung der Hausarbeit und will primär für den Haushalt zuständig sein.
S. 56
Seit neuestem hatte Kurt sich in den Kopf gesetzt, dass er am Wochenende das Frühstück machte - wohl um zu beweisen, dass auch er für die Gleichberechtigung wa…
Irina verzog das Gesicht und trauerte für ein paar Sekunden der verlorenen Morgenstunde nach: der einzigen Stunde, die ihr gehörte, wenn niemand anrie…
So wie er ein Gespür für das Empfinden seiner Mitmenschen hat, ist er auch sensibel für die Lage und die Nöte seiner Frau und stolz auf deren Leistungen in Beruf, Haushalt und Kindererziehung.974
S. 64
Kurt erwiderte nichts, stellte die Eierbecher ab und umarmte Irina. Es war eine väterliche, ganz absichtslose Umarmung, bei der Kurt beide Arme ganz um Irinas Körper schlang und sie sanft hin und her wiegte: „Trösten“ hieß das in ihrer internen Sprache, und obwohl es Irina zuerst widerstrebte, ließ sie sich im Grund genommen gern tröste…
S. 165f
Fünf Jahre lang war er überzeugt gewesen, dass Irina mit ihrem Umbau übertrieb; … aber am Ende, das musste er zugeben, hatte Irina doch irgendwie recht behalten …
Seine Briefe drücken intensive Emotionen eines Mannes aus:
S. 23
„Liebe, liebste Irina!“ (195…
„Meine Sonne, mein Leben!“ (196…
„Meine geliebte Frau, mein Freund, meine Gefährten!“ (197…
In der Erziehung des Kindes ist er aufgrund der staatlichen Betreuungseinrichtungen wenig eingebunden, in dieser Beziehung gibt es kein egalitäres Rollenkonzept bei den Umnitzers. Die häusliche Erziehung obliegt Irina. Er sieht seine Aufgabe darin, Vorbild zu sein und mit Strenge Sekundärtugenden zu vermitteln.
S. 80
Später Schachspielen. Papa gab ihm zwei Türme vor, trotzdem gewann er imme…
S. 173
- Mein Leben lang, sagte er, versuche ich dich zum Arbeiten zu erziehen. Und du …
Und auf einmal hörte er sich schreie…
- Du wirst Gammler! mein Sohn wird Gammle…
Er riss das Tonbandgerät an sich, das mit einem kläglichen Rülpser verstummte, und marschierte lo…
Er ärgerte sich, eigentlich über sich selbst, versuchte aber umso mehr, seinen Wutanfall zu rechtfertigen …
Seine Beziehung zu seinem Sohn wird in dessen Adoleszenz problematisch:
S. 175
- Ich frage dich. Trägst du das Kreuz auch in der Schul…
- Ja, sagte Sasch…
Kurt merkte, wie der Ärger erneut in ihm aufstie…
- Bist du denn wirklich so dämlic…
Sascha fehlt , nach Ansicht seines Vaters, die Lagererfahrung und ist in Kurts Augen allzu privilegiert aufgewachsen:
S. 173f
Aber seine lasche Haltung, seine Faulheit, sein Desinteresse für alles, was er, Kurt, für wichtig und nützlich hielt ..Wie konnte man dem Jungen nur begreiflich machen, worauf es ankam? Der Junge war intelligent, keine Frage, aber irgendetwas fehlte ihm, dachte Kurt. Irgendetwas dadrinne…
Alexander weiß nicht um die hilflose Liebe Kurts zu ihm:
S. 176
Und plötzlich empfand er ein unbändiges, fast schmerzliches Gefühl, diesen Menschen vor all dem Ungewissen, das noch auf ihn zukam, zu beschütze…
Als Vater signalisiert Kurt seine Autorität bei zentralen Entscheidungen. Als Sascha sich im Erwachsenenalter in einer krisenhaften Phase befindet, agiert Kurt und nicht Irina: 1989: S. 70
- Du sprichst aber mal mit Sascha, sage Irina. nicht, dass er irgendwelchen Unsinn mach…
Kurt winkte a…
- Als ob Sascha auf mich hören würd…
- Trotzdem, du musst mit ihm spreche…
Kurt sucht in dieser Situation das Gespräch mit Alexander, um ihn von diesem - in seinen Augen - selbstzerstörerischen Weg der gesellschaftlichen Verweigerung abzubringen. Alexander soll, so ist sein Wunsch, nicht seine bürgerliche Zukunft gefährden.
1979:
S. 294
- Entschuldige, aber ich finde, wir, als deine Eltern, haben ein gewisses Recht, zu erfahren, was los ist. Du verschwindest einfach für Wochen, du meldest dich nicht.. Kannst du dir wirklich nicht vorstellen, was bei uns zu Hause los ist? Baba Nadja weint den ganzen Tag. Deine Mutter ist vollkommen erledig…
S. 300
- Gut, sagte Kurt. Mach, was du willst. Aber dann …
- Was dann, sagte Sasch…
Kurt fiel nichts anderes ein al…
- Dann ist der Ofen au…
- Oho, sagte Sascha. Oh…
- Du bist verrückt, sagte Kur…
S. 299
- Was heißt eigentlich, dein Studium ist bereits beende…
- Das heißt, ich studiere nicht meh…
- Hast du deine Diplomarbeit ferti…
- Ich schreibe meine Diplomarbeit nicht ferti…
- Sag mal, drehst du jetzt vollkommen durc…
Sascha schwie…
- Du kannst doch nicht hinschmeißen, so kurz vorm Schluss. Was willst du denn machen ohne Diplom? Auf’n Bau gehen oder wa…
Alexander wiederum wirft seinem Vater in provokanter und abgrenzender Weise vor, ein angepasstes und verlogenes Leben geführt zu haben. Dauerhafte Fremdheit und Unverständnis ist die Folge.
In Mexiko erinnert sich Sascha in an diese Begegnung mit Kurt im Winter in Berlin 1979 und gesteht sich sein eigenes provokantes Fehlverhalten ein:
S. 425
… den zu tragen er damals für nötig befand, weil er das unerklärliche Bedürfnis verspürte, abstoßend zu wirke…
Seine Erinnerungsperspektive weicht von der Darstellung Kurts in dessen Notizen erheblich ab. Der Blick auf den Vater verändert sich, der frühere Konflikt scheint für ihn geklärt. Er sieht Kurt zum ersten Mal nicht mehr als der in der Lüge Lebende: S. 423
… es folgt ein schwer zu entziffernder Satz über das Leben, das Kurt sich, wenn Alexander richtig liest, nicht versauen lassen wil…
S.420
Er wird sich fragen, ob Kurt ihn, Alexander, auf irgendeine dunkle, unklare Weise vermiss…
Alexander/Sascha Umnitzer
Welches Bild von Männlichkeit verkörpert Alexander, sozialisiert in den 60er- und 70er Jahren in der DDR?
Alexander zeigt intensive Emotionen und Empathie, beispielsweise in seinem imaginierten Brief an Marion, gehalten in einem beinahe pathetischen Stil; liebevoll und intim bekennt er seine Liebe und schließt ihn mit einem Heiratsantrag: S. 412
Aber ich habe Sehnsucht. Und das Seltsame ist: Es ist nicht einmal schlimm. Doch, es ist schlimm, aber gleichzeitig tröstlich. Es ist tröstlich, dass es dich gibt. Es ist tröstlich, an deine dicken schwarzen Haare zu denken. …
Einerseits zieht es mich zu dir, um nachzuholen, was ich zu geben versäumt habe … Andererseits fürchte ich, du wirst es als eine Art Heiratsantrag aufnehmen - und das ist es ja auc…
Mit diesem Brief gleicht sich Alexander an Kurt an, den er um dessen Liebesfähigkeit und Fähigkeit, ein solches Gefühl sprachlich zu artikulieren, noch im 1. Kapitel beneidet hat.
S. 23
Wie hatte der Kerl das gemacht und bei alldem die irritierend überschwänglichen Anreden, mit denen er Irina überschüttete …
S. 27
Oder hatte Kurt Irina geliebt? Hatte dieser alte, pedantische Hund, hatte diese Maschine Kurt Umnitzer es fertiggebracht zu liebe…
Alexander wünscht sich eine gleichberechtigte Partnerschaft mit einer berufstätigen Partnerin, mit der er auf Augenhöhe kommunizieren kann und die für ihn ein Schutzort ist - in Marion hat er diese Frau gefunden: S. 412f
Dass ich einfach verschwinden sollte aus deinem Leben. Dass ich das, was ich mir eingebrockt habe, nun allein auslöffeln sollte. Wie kann ich jetzt, wo mich die Krankheit erwischt hat, unter deine Decke kriechen wollen. Wie kann mir jetzt einfallen, Sehnsucht nach dir zu haben? Aber ich habe Sehnsuch…
… Oder dich von der Arbeit abholen. Du in Latzhose zwischen kniehohem Grün und wie du dir mit dem Handrücken den Schweiß aus der Stirn wischs…
Seine Rolle als Vater sieht er selbst nicht als ein für ihn schönes Feld. Er ist kein aufgeschlossener moderner Familienvater und zeigt weder Fürsorge für seinen Sohn noch versorgt er seine Familie.
S. 274
Irgendwie machte es ihn erst recht wütend, wenn Muddel seinen Vater verteidigte. Er hatte sie beide verlassen - auch ihn…
S. 286
Markus schaute sich um, aber natürlich war sein Vater nicht da. Immer wenn man ihn brauchte, war er nicht da …
Dies führt letztendlich dazu, dass ein andere Mann mit den männlichen Attributen des sozialen, materiellen und kulturellen Kapitals für seine Frau attraktiver wird.
S. 373
Klaus war nämlich auf einmal Politiker und saß im Bundestag - Pfarrer Klaus, .., war auf einmal Bundestagsabgeordneter und weiß der Geier was noch alles, flog jeden Montag nach Bonn und verdiente die fette Kohle. Und Muddel verdiente noch dazu …
Die Zurückhaltung in Ehe und Vaterschaft könnte für ihn einen Verlust an Lebenssinn und Lebensinhalt bedeuten, jedoch definiert sich Alexander jenseits der Vaterrolle in seinem Beruf als Künstler. Dafür nimmt er die Ausreise und den Umzug in das westliche Deutschland und die Trennung von seiner Familie in Kauf.
Markus
Sascha ist für seinen Sohn zwar nicht physisch anwesend, spielt aber im Leben des Kindes weiterhin eine wichtige Rolle. Die Vaterabwesenheit hat erhebliche Folgen für die kindliche Entwicklung von Markus. Freud sieht die Aufgabe des Vaters darin, „das Kind mit den Anforderungen der Umwelt zu konfrontieren und in die Gesellschaft einzuführen“.975 Demnach werden Autonomie, eine stabiles Selbstwertgefühl und eine gefestigte Geschlechtsrollenidentität durch die Erziehung des Vaters entwickelt. Abwesenheit schadet insbesondere der Entwicklung von Söhnen, denn Väter verhalten sich anders als Mütter: Sie sehen Kinder als weniger hilfsbedürftig, trauen Kindern mehr Selbständigkeit zu und fordern mehr Disziplin.976
Ein Kontakt zum Vater nach einer Trennung fördert die Entwicklung von Kindern und lässt Verhaltensprobleme verringern. Gute Väter sind verantwortungsbewusste Väter, Verantwortung meint, an der Sozialisation teilzunehmen, neben der materiellen Absicherung und der Rolle als Ernährer.977
Markus wünscht sich Kontakt zu seinem Vater, doch Alexander verhält sich unzuverlässig: Getroffene Vereinbarungen werden nicht eingehalten, es gibt keine emotionale Unterstützung oder Partizipation an der Sozialisation seines Sohnes, und dies nicht zuletzt wegen der geographischen Entfernung, da Sascha aus beruflichen Gründen im Westen lebt. Der fehlende Kontakt zu seinem leiblichen Vater und die räumliche Trennung vom ihm führen bei Markus letztendlich dazu, dass die Beziehung zur Herkunftsfamilie verloren geht.
S.279f
… daran saßen schon eine Menge Leute. Sein Vater war nicht dabei. Auch Oma Irina konnte er auf den ersten Blick nicht finden: es waren zumeist alte, uralte Leute, die hier am Tisch saßen und diskutierten, eine Saurierversammlung …
… überhaupt mochte er seinen Opa, und es tat ihm immer ein bisschen leid, wie Opa sich, wenn er hin und wieder bei den Großeltern zu Besuch war, mühte, ihm irgendwelche Spielebeizubringen, aus denen man fürs Leben lernte.
S. 385
… ob Oma Irina nicht einfach dort neben Opa Kurt in der vorderen Reihe saß, oder neben ihm, seinem Vater, aber natürlich saß sie nicht da. Stattdessen saß dort die Tuss…
Besonders in der Zeit des Übergangs zum Erwachsenenleben des Sohnes kommt dem Vater eine wichtige Funktion in emotionaler und praktischer Sicht zu. Markus sucht sich das fehlende väterliche Rollenmodell in Peer-Groups, in denen aggressives Verhalten positiv verstärkt wird.978
S. 374
Dann kamen Klinke und Zeppelin, und Zeppelin hatte die Idee, irgendeinem Scheißtürken, der irgendeine Braut aus Zeppelins ehemaliger Klasse angemacht hatte, die Reifen von seinem Scheiß-Opel zu zerstechen .., denn obwohl Markus, um nicht weichlich zu erscheinen, sofort zustimmte, war die Idee … so gut wie Selbstmor…
Seine Befindlichkeit verschlechtert sich gleichzeitig, wie sich das Konfliktniveau in der Familie erhöht. Das aggressive Verhalten von Markus macht die Beziehung zum Stiefvater problematisch. Dabei ist dieser durchaus ein Beispiel für die Familienorientierung ostdeutscher Männer und will als Vaterersatz die Rolle des Erziehers übernehmen:
S. 373
Klaus, der neuerdings versuchte, auf Vater zu machen, legte Wert darauf, dass Markus mit seinem Lehrgeld auskam, er zog ihm noch was ab, wenn er mal das Werkzeug im Garten liegenließ oder versehentlich was kaputt machte …
Allen Männern von Ruges Roman ist eins gemeinsam: das „Suchen“ nach Orientierung im Laufe ihrer lebenslangen Entwicklung (außer bei Wilhelm, der sich erst gar nicht entwickelt) und ein Verhältnis zu Frauen, das einerseits problematisch ist, wodurch sie ihnen Leid zufügen oder sie missachten, andererseits aber Liebesfähigkeit zeigt - wobei für Markus zu diesem Zeitpunkt noch keine endgültige Aussage getroffen werden kann. (vgl. aber Eugen Ruges späteren Roman „Follower“).
20.4. Die Rolle der Frau und Mutter in der bürgerlichen Familie
Nur um eine liebende Frau herum kann sich eine Familie bilde…
-Friedrich von Schlegel (1772 - 1829), deutscher Kulturphilosoph, Schriftsteller und Literaturwissenschaftler.…
(Quelle: Schlegel, F., Fragmentensammlungen. Fragmente. Erstdruck in: Athenäum, 1. Bd., 2. Stück, Berlin 1798)
In den Romanen zeigt sich der Wandel der Geschlechterordnung: Jede weibliche Hauptfigur kann als Stellvertreterin der Frauen ihrer Generation gesehen werden, und weist darauf hin, wie sich in der Zeit vom 19. zum 20. Jahrhundert für Frauen immer größere Handlungsspielräume eröffneten.
Sowohl in der Epoche der Klassik und als auch der Romantik gab es die Vorstellung von einer Geschlechterordnung als Idee der Ergänzung von Mann und Frau: Beide seien nach Natur und Bestimmung auf Ergänzung angelegt, und ihre Tätigkeitsfelder ließen sich der Öffentlichkeit bzw. der Familie zuordnen. Weiterhin gab es ein um 1800 im jungen Deutschland und in der Romantik auftretendes Bild von der „romantischen Frau“: Es betonte das Gefühl, die Empfindsamkeit und die Individualität der Frau.
Die Ausführungen von dem Journalisten und Kulturhistoriker Wilhelm Riehl aus dem Jahre 1855 zur bürgerlichen Familie und ihrer „Geschlechterdifferenz“ fanden weite Verbreitung und geben Aufschluss über die damalige Vorstellung vom Verhältnis der Geschlechter und den arbeitsteiligen Aufgaben von Mann und Frau.
Der Daseinsbereich der Frau im Bürgertum war die Häuslichkeit, sie wurde auf den Bereich der Privatheit, der Kindererziehung und der Familie verwiesen, es galten die drei Ks: Kinder, Küche, Kirche, die Entscheidungskompetenz lag beim Mann aufgrund des angenommenen überlegenen Verstandes.
„Viel spricht dafür, dass neben den sozialen Klassenunterschieden zwischen Produktionsmittelbesitzern und Lohnarbeitern die Geschlechterdifferenz zu ...[dem] konstitutiven Ungleichheitssockel bürgerlicher Gesellschaften gehört.“979
Die Lebenswelt der Bürgerfrau umfasste im 18. und 19. Jahrhundert die Rolle der Hausfrau und Mutter, letzteres war oftmals bis an das Lebensende erfüllend, wenn die Kinder bis zum Tod der Eltern im Haus lebten (Buddenbrooks) Dieses Familienideal förderte die Idealisierung der Mutterschaft. Sie galt als Berufung und Erfüllung der Frau. Eine Ehe ohne Kinder war unvollkommen. „Auf dem Hintergrund gesellschaftlicher Umbruchprozesse war mehr denn je die konsolidierende Funktion der Familie gefordert, und damit erhielt auch die familientragende Mutterrolle neues Gewicht.“980
Die Niederkunft fand bei Bürgermüttern, wie der Konsulin Buddenbrook z.B., im Schlafzimmer des eigenen Hauses statt.
S. 57
Dann ging er ins Schlafzimmer hinüber.. eine Stimmung von Erholung und Frieden nach überstandenen Ängsten und Schmerzen lag in der Luft, …
Über die Wiege gebeugt standen die beiden Alten nebeneinander und betrachteten das schlafende Kind. Die Konsulin aber, in einer eleganten Spitzenjacke, das rötliche Haar auf beste frisiert, streckte, ein wenig bleich noch, aber mit einem glücklichen Lächeln ihrem Gatten die schöne Hand entgegen.. „Nun, Bethsy, wie geht es?“ „Vortrefflich, vortrefflich, mein lieber Jean…
Bereits kurz nach der Geburt oblag der Frau eine Fülle von Aufgaben, insbesondere die große Verantwortung für die ersten Lebensjahre der Kinder - in ärztlichen Ratgebern wurden ausschließlich die Mütter angesprochen - und für den Bürgerhaushalt mit seiner Organisation und Zeiteinteilung.
Bei Krisen im privaten Bereich waren stets die Frauen gefragt.
(TM)
Die Konsulin ist in ihrer Rolle als Mutter präsent, als Tony B. nach der Trennung von Grünlich und Permaneder wieder in ihr Elternhaus zurückkehrt:
S. 376f
„Ja, ja“, sagte sie, „da habe ich traurige Dinge hören müssen, Tony. Und ich verstehe Alles ganz gut, meine arme kleine Dirn, denn ich bin nicht bloß deine Mama, sondern auch eine Frau wie du.. Ich sehe nun, wie sehr berechtigt dein Schmerz ist,…
„Nun, meine liebe Tony“, sagte sie endlich, indem sie ihrer Tochter noch einmal die Hände entgegenstreckte, „wie die Dinge auch liegen mögen: Du bist da, und so sei mir denn aufs Herzlichste willkommen, mein Kind.. Lege ab, in deinem Zimmer, mach es dir bequem.“(AG)
Alma ist während des Konflikts zwischen Vater und Tochter die ausgleichende Instanz:
S. 151
Als der Wagen ab fährt, sagt Alma ohne Zorn und Vorwur…
- Ingrid, Ingrid.…
- Ich hack nicht auf dir herum. Mich beschäftigt, wie es dir geht. Aber du musst auch ein Minimum an Verständnis für deine Eltern aufbringe…
Sie sehnt sich nach Harmonie und, dass ihr Mann und ihre Tochter ein gutes Verhältnis zueinander haben:
S. 207
Ich bitte dich, Richard, egal, wie Ingrid sich anstellt, vergiss nicht, dass du nur diese eine Tochter has…
Nach dem Tod Ingrids bleibt sie in einer Übergangszeit die Bezugsperson für ihre Enkel.
Mutterpflichten überwogen im Vergleich zu den Vaterpflichten, die Mutter fungierte als Lehrmeisterin für die kleinen Kinder und wirkte mit an der standesgemäßen Erziehung der Kinder. Ihre Pflicht war es, in der Pflege und Erziehung, mit Liebe und Vertrauen, die bürgerlichen Normen an ihre Kinder zu vermitteln und so die Stabilität der Familienbeziehungen zu stärken.
Autobiographische Zeugnisse erzählen darüber hinaus von der christlich-frommen Mutterschaft, durch die die Kinder in Gebeten, religiösen Geboten und religiösen Erzählungen unterwiesen wurden.
Kinder hatten aufgrund dessen die stärkere emotionale Beziehung zu ihrer Mutter, dem Vater gegenüber empfanden sie Respekt und Ehrfurcht.
Wie eng eine Mutter-Sohn-Beziehung sein konnte, zeigt sich in der Buddenbrookschen Verwandtschaft der Familie Kröger: Die Mutter ist die Gebende, die den Sohn entgegen den Willen des Vaters heimlich unterstützt.
S. 695
Justus Kröger war ebenfalls abgeschieden, und das war schlimm; denn nun hinderte niemand mehr seine schwache Gattin, das letzte Silberzeug zu verkaufen, um dem entarteten Jakob Geld schicken zu können, der irgendwo draußen in der Welt sein Lotterleben führt…
Die mutterzentrierte Kernfamilie der späteren Zeit bleibt bei den Buddenbrooks ausgeblendet, zeigt sich jedoch in den späteren modernen Romane…
Ähnlich verhält es sich in den modernen Familienromanen:
(ER)
Das Verhältnis zwischen Sascha und seiner Mutter ist symbiotisch, die Mutter die Gebende:
S. 263
- Für mich ist das Wichtigste, dass du glücklich bist, sagte Irin…
S. 296
Deine Mutter hat euch diese Wohnung besorgt, hat mit Tapeten geklebt. Und du schmeißt alles hin, und deine Mutter kann dir die nächste Wohnung besorge…
Mutterliebe konnte ein Ersatz für die Zuneigung des Gatten sein, konnte zur Kompensation von Frustration und einem unerfüllten Leben genutzt werden, um Ansprüche, die die Mutter selber nicht verwirklicht hat, zu erfüllen. Das Kind verkörpert(e) die Hoffnung auf ein anderes Leben.981 (TM)
Die Erziehung Erikas und deren Heirat zeigt Tonys Anspruch in dieser Hinsicht:
S. 393
… Erika, auf deren vornehme Erziehung sie Sorgfalt verwandte und in deren Zukunft sie vielleicht letzte heimliche Hoffnungen setzt…
Der Tod eines Kindes, trotz aller liebevollen Hege und Pflege, war immer ein harter Schlag. Schuld- und Versagensgefühle der Mutter mischten sich in ihre Trauer. Nicht mehr Gottes Wille wurde als Grund für dieses Unglück gesehen, sondern die eigene Verantwortung für das Schicksal. (TM)
Diese bittere und schmerzhafte Erfahrung ruft bei Tony eine Krise hervor, die sich auf die Ehe auswirkt. Tony kann die Schwierigkeiten des Einlebens in München nicht verwinden, ein Kind hätte eine zeitfüllende Aufgabe für sie sein können.
S. 368f
… denn das Kind, ein kleines Mädchen, sollte nur ins Leben treten, um nach einer armen Viertelstunde, während welcher der Arzt sich vergeblich bemühte, den unfähigen kleinen Organismus in Gang zu halten, dem Dasein schon nicht mehr anzugehöre…
… und besonders der Beobachtung des Konsuls war es nicht entgangen, dass nicht einmal das gemeinsame Leid imstande gewesen war, die beiden Gatten einander erheblich zu näher…
Tonys Briefe aber verloren von nun an nicht mehr den Ton von Hoffnungslosigkeit und selbst von Anklage.“Ach, Mutter“, schrieb sie, „was kommt Alles auf mich herab! Erst Grünlich und der Bankerott und dann Permaneder als Privatier und dann das tote Kind. Womit habe ich soviel Unglück verdient…
(AG)
Alma erlebt den Tod beider Kinder, und die Traurigkeit ist seitdem stets präsent: S. 347
Es ist schon abenteuerlich, nach so vielen Jahren, dass diese Schmerzen noch immer nicht verschmerzt sind. Ich denke, daran wird sich nicht mehr viel änder…
Bis ins hohe Alter ist die Sehnsucht und der Wunsch vorhanden, den Kindern im Tod nahe zu sein, Otto, der im Krieg umkam und Ingrid, die in der Donau ertrank:
S. 367f
Eigenartig ist, dass Alma erst ein halbes Jahr nach Ingrids Tod angefangen hat, von ihr zu träumen, und dass diese Träume seither anhalten. Auch von Otto hat sie früher oft geträumt, meistens, dass er aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückkehrt, wo er nie war, weil er mit seinen vierzehn Jahren für die Gefangenschaft viel zu jung gewesen wäre. Diese Träume gingen bis ins Jahr 1957, dann hörten sie plötzlich au…
Einmal, sie sieht es noch heute, kam Otto über Ungarn, es war der letzte Traum, den sie von ihm hatte, der stand mit dem ungarischen Aufstand in Verbindung. Sie hörte Schritte. Wer kann jetzt kommen? Es war Otto, er trug seine blonden Haare wieder wie damals, bevor sie ihm beim Jungvolk auf Zündholzlänge geschnitten worden waren ..Ich bleibe zu Haus…
S. 367
Dass sie Otto nicht in ihrem Schoß betten konnte. Sie kann denken, soviel sie will, es gibt keinen Ersatz dafür, dass sie Kinder, als sie starben, nicht in den Armen gehalten hat. .. Aber in Wahrheit ist es ein Vorwurf gegen sich selbst, weil das Aufpassen und Beschützen in den Aufgabenbereich der Mutter fällt. Sie würde es gerne besser machen, sie würde - doch wenigstens - den Kopf des toten Otto in ihren Schoß nehmen dürfen und den Kopf der toten Ingrid. Ob das eine Rettung wäre? Vielleich…
Als Mutter sieht Alma sich zuständig für deren Schutz:
S. 367
Manchmal denkt sie mit einem sacht unter der Asche glühenden Groll, die Kinder hätten besser auf sich aufpassen sollen. Aber in Wahrheit ist es ein Vorwurf gegen sich selbst, weil das Aufpassen und Beschützen in den Aufgabenbereich der Mutter fäll…
In den Träumen ist sie ihrer verstorbenen Tochter Ingrid nah:
S. 37
… ihre Träume spiegeln immer Wünsche wider…
S. 36
In dem Traum ging Alma mit Richard und Ingrid, die etwa fünfzehn war, .. Da gibt es Leute, die behaupten, dieses wunderbare Mädchen sei tot. Ingrid sprang aus dem Wasser und stand wieder auf der Brücke mit ihrem zurückhaltenden Lächeln, das sie hatte, wenn sie sich über etwas besonders freute. .. Alma betrachtet Ingrid und war glücklich, wie innerlich strahlend das Mädchen aussa…
Sie und Richard haben folgendes vereinbart, um den Schmerz nicht unerträglich werden zu lassen und um ihr Alltagsleben zu bestehen:
S.38
Vielleicht, weil es irgendwie ausgemacht ist, dass über die Kinder nicht viel geredet wir…
Die ideale Bürgerfrau stand als ein wichtiger Garant für die Dauerhaftigkeit der Ehe. Sie zeigte Fürsorge für den Mann und Interesse an seiner Berufswelt, war stets ein emotionaler Rückhalt des Mannes und der Kinder. 982 Bei ihr im privaten Bereich war das Refugium des Mannes, dort fand er Rückzugsmöglichkeiten und Kompensation.
Der Begriff des „Biedermeier“ aus den 50er Jahren des 19. Jahrhundert verspottet die Lebensart, sich in den Innenraum der Familie, in die liebevolle Beziehung zu Frau, Ehemann und Kindern in das Haus zurückzuziehen.
S. 91
Kurz nach 5 Uhr, eines Juni-Nachmittages, saß man vor dem ,Portale‘ im Garten, woselbst man Kaffee getrunken hatt…
Im Halbkreis saßen der Konsul, seine Gattin, Tony, Tom und Klothilde um den runden gedeckten Tisch, auf dem das benutzte Service schimmerte. Der Konsul war mit seiner Cigarre und den „Anzeigen“ beschäftigt. Die Konsulin hatte ihre Seidenstickerei sinken lassen und sah lächelnd der kleinen Clara zu, . Tony hatte den Kopf in beide Hände gestützt und las versunken in Hoffmanns „Serapionsbrüdern…
Die verheiratete Bürgerfrau teilte mit dem bürgerlichen Mann Werthaltungen und Habitus und hatte eine Schlüsselstellung bei der Ausprägung der bürgerlichen Kultur. Es verband sie mit ihrem Mann das bürgerliches Pflicht- und Arbeitsethos und der Wunsch nach Aufstieg und Erfolg.
Sie agierte im Hintergrund und stärkte ihren Mann. Die Unterstützung der Karriere und die Ausübung der Repräsentationspflichten wurden für sie zwingend.983
In Folge partizipierte sie am sozialen Status ihres Mannes.
Frauen als Trägerin der Kultur verkörperten die moralischen und geistigen ,höheren’ Werte, während der Mann, zuständig für die materiellen Werte, weniger Zeit für kulturelle Aktivitäten hatte. Um eine adäquate Gesprächspartnerin und geistige Gefährtin des Mannes zu sein, konsumierte die Frau Literatur und Kunst. Lesen, Klavierspielen, das Musizieren und Zeichnen gehörten zu ihrer Kultur und wurden zum schichtspezifischen Unterscheidungsmerkmal.
(TM)
S. 288
In der Musik konnte ich ihr nicht Widerpart halten, . aber in der niederländischen Malerei war ich schon besser zu Hause, und in der Literatur verstanden wir und durchau…
Mussten Hausvater und Hausmutter im „ganzen Haus“ noch miteinander kooperieren, differenzierten sich männlich-weibliche Tätigkeitsbereiche durch die Trennung von Erwerbs- und Familiensphäre. Durch diese Zurückdrängung auf das Heim hatte die Bürgersfrau oftmals keinen Einblick mehr in die die Einkommens- und Vermögensverhältnisse. Dabei war in den Anfängen des Bürgertums die Rolle der Hausfrau noch die der Geschäftsfrau, die mit Geschäftssinn und Sparsamkeit (im heutigen Sinne: „gutbürgerlich“, „bürgerliche Küche“, d.h. preiswert, ohne Aufwand) den gesamten häuslichen Bereich organisierte, und das erforderte nicht wenig Aufwand und Energie.984 In der Zeit der materiellen Sicherheit veränderte sich dies, und ein repräsentativer Lebensstil („bürgerliche Wohnkultur“) etablierte sich mit der völligen Trennung von Haus und Geschäft. Dabei gingen die Funktionen der Hausfrau auf entsprechendes Personal über, körperliche und hauswirtschaftliche Arbeit waren von nun an für die Bürgerfrau tabuisiert.
(TM)
S. 76
„Ach, das Haus ist so groß, Jean, dass es beinahe fatal ist. Ich sage: ,Lina, mein Kind, im Hinterhaus ist schrecklich lange nicht abgestäubt worden!', aber ich mag die Leute nicht überanstrengen, denn sie müssen schon pusten, wenn hier vorn alles nett und reinlich ist. Ein Diener wäre so angenehm für Kommissionen und dergleichen…
Beachtung fand in der damaligen Zeit die Aussage des Philosophen und Pädagogen Rousseau: Es gäbe eine gegenseitige Abhängigkeit zwischen Mann und Frau, doch sei die Abhängigkeit der Frau vom Mann eine absolute Abhängigkeit, während der Mann eine relative Abhängigkeit hat, die er aufkündigen kann.985 Das hieß: Die Frau hatte ihre wirtschaftliche und soziale Abhängigkeit vom Mann zu akzeptieren. Die Aufgabe der eigenen Anspruchshaltung war entscheidend, weil die Beziehung zum Ehepartner aufrecht gehalten werden musste.986 Diese finanzielle Abhängigkeit und unselbständige Position der Ehefrau wurde noch wesentlich später im BGB von 1900 mit der Dispositionsbefugnis gefestigt: Sie übertrug das Vermögen der Frau dem Ehemann.
(TM)
Das innerfamiliale Machtverhältnis bei den Buddenbrooks gründet darauf, dass die Konsulin und Gerda aus reichem Elternhaus stammen und beide eine kapitalkräftige Mitgift in die Ehe mitbringen, durch die es zur Festigung des Unternehmens kommt.
In den gehobenen Bürgerschichten delegiert die Hausfrau Haushaltstätigkeiten an die bezahlte Dienerschaft, an Gouvernanten und Hauslehrer, die die Kinder pflegten und unterrichteten. Währenddessen demonstrierte die Gattin ihre Schönheit und Eleganz und damit den beruflichen Erfolg ihres Mannes.
Man zeigte der Außenwelt, dass die Bürgerfrau nicht arbeiten musste, wie eine Salondame, die sich dem Müßiggang hingab. „Ihr demonstrativer Müßiggang, ihre Ausstattung mit ständig neuer modischer Garderobe und kostbaren Schmuck, ihre interessiert-dilettierende Teilhabe am öffentlichen Kulturleben galten als Maßstab bürgerlichen Wohlstands.“987 Der Glanz des Nichtstuns spiegelte die gesellschaftliche Position, die man inne hatte. Freizeit besaß eine soziale Funktion und wurde so ausgefüllt, wie es der Gesellschaftsschicht, dem Alter und Geschlecht entsprach.988
Spezielle Tätigkeiten im privaten Bereich durften jedoch nicht allein den Bediensteten überlassen werden. Ein bürgerlicher Haushalt forderte wie ein komplexer Wirtschaftsbetrieb eine hohe ökonomische Qualifikation von der Hausfrau, z.B. die Überwachung des Einkaufs, die Leitung der Produktions- und Verarbeitungsgeschäfte im Haus, die Herrichtung der Gerichte, Räuchern, Pökeln, Brot backen, das Inspizieren der Küche und Vorratskammern.989
„Die Sorge für Reinlichkeit und Schönheit, die Anordnung der häuslichen Angelegenheiten, eine Aufsicht über das Ganze, die sich bis auf das kleinste erstreckt, das Wissen um alles, was im Haus geschieht, und die Überzeugung, dass jedes recht geschieht, sollte das Weib sich nicht nehmen lassen, das darauf Anspruch macht, ein häusliches zu heißen... So bald ein häusliches Geschäft durch andre gar nicht oder nur schlecht verrichtet werden kann, darf keine Rücksicht das häusliche Weib von der eigenen Besorgung abhalten.“990
(TM)
Die Köchin Trina bekommt dies zu spüren, ebenso Babette, Tonys Bedienstete in München:
S. 176
Als die Konsulin ihr wegen einer missratenen Chalottensauce einen Verweis hatte zu Teil werden lassen, hatte sie die nackten Arme in die Hüften gestemm…
S. 364
„Und wenn ich Frikadellen‘ sage, so begreift sie es nicht, denn es heißt hier Pflanzerin‘; und wenn sie Karfiol sagt, so findet sich wohl nicht so leicht ein Christenmensch, der darauf verfällt, dass sie Blumenkohl meint; und wenn ich sage :Bratkartoffeln’. so schreit sie so lange ,Wahs!‘ bis ich ,Geröhste Kartoffeln' sage, denn so heißt es hier…
Eine bedeutende Aufgabe der Bürgerfrau war ihre Pflicht zur Repräsentation: Gesellschaftsfähigkeit galt als eine Grundvoraussetzung der bürgerlichen Karriere.991 Die Privatsphäre wurde zum gesellschaftlichen Ort, um beruflichen Erfolg und Wohlstand vorzuführen. Hier waren es die Frauen, die zu anderen bürgerlichen Familien Kontakte pflegten, bürgerliche Familiennetzwerke flochten, die dann letztendlich für die eheliche Partnerwahl der Söhne und Töchter eine bedeutsame Rolle spielten.992 Mit der Verheiratung der Kinder erwarb man ein Netzwerk von Allianzen und neuen Beziehungen.
Der Frau oblagen Planung und Durchführung der Gesellschaften. Sie sorgte mit dem Dienstpersonal für den Ablauf, beginnend mit der Versendung der Einladungen, es folgte die Erstellung der Tischordnung, der räumlichen Kulisse, der Zusammenstellung eines aufwendigen und exquisiten Speiseplans und des Tafelschmucks. Sie organisierte den reibungslosen Ablauf mit einer tadellosen Bedienung, zeigte sich aber während des Gerichts als von der Arbeit freigestellt, ihr Standesattribut waren die gepflegten und weichen Hände.993 Es hing vom Geschick der Ehefrau als Gastgeberin und ihrer Organisationsgabe ab, ob und dass der Ehemann sich gut präsentieren und eine Selbstvergewisserung als Bürger erfolgen konnte.994 (TM) S. 23
Die Meißener Teller mit Goldrand wurden gewechselt, wobei Madame Antoinette die Bewegungen der Mädchen scharf beobachtete, und Mamsell Jungmann rief Anordnungen in den Schalltrichter des Sprachrohrs hinein, das den Esssaal mit der Küche verban…
Sie selber war dabei in der Rolle als elegante, modisch und teuer gekleidete und gewandte Gastgeberin gefragt, die den Status ihres Mannes und ihre Herkunft aus gutem Hause repräsentierte. Als Gastgeberin waren Selbstsicherheit und Organisationstalent gefragt. Gelang ihr dies, erschien ihre Familie in einem guten Licht und stabilisierte und stärkte die Reputation ihres Ehemannes.
(TM)
Frau Buddenbrook agiert als entspannte Gastgeberin:
S. 23
Die Meißner Teller mit Goldrand wurden gewechselt, wobei Madame Antoinette die Bewegungen der Mädchen scharf beobachtete…
S. 33f
Als aber die Konsulin mit dem Dichter trank, färbte ein ganz feines rot ihren zarten Tein…
Die Konsulin erhob sich ganz unauffällig und ging davon, denn dort unten waren die Plätze von Mamsell Jungmann, Doktor Grabow und Christian frei geworde…
(AG)
S. 46
Sie denkt, ich sollte Fritz und Susanne mal wieder zum Essen einladen . und Kienasts lassen sich auch immer seltener blicken, seit die Gespräche so quer gehen, dito mit Grubers…
Die Hausfrau spielte eine offizielle Rolle, wenn Geschäftspartner oder Kollegen des Mannes zu Gast waren. Man würdigte ihren Beitrag der Familienleistung für den Erfolg und den Stand des Mannes, in der Nennung des Titels, den der Ehemann trug, die Ehefrau des Konsul Buddenbrook war „Konsulin“:
S. 156
Die Konsulin, Christian, Klothilde, Clara und Ida Jungmann standen zur Begrüßung droben auf dem Treppenabsatz versammel…
Die meisten Frauen des (Bildungs)bürgertums meisterten den komplizierten Arbeitsalltag, zumeist mit Fluchten aus der aufopfernden Rolle für die Familie: z.B. durch Romanlektüre (Alma) und Klavierspiel/Geigenspiel (Gerda), Handarbeiten (Tony, ihre Mutter) (TM)
Gerda widmet sich der Musik. Nicht selten erlaubt sie sich den Rückzug aus dem Familienalltag wegen Unwohlseins.
Tony und die Konsulin finden Zeit für das Handarbeiten.
(AG)
Alma versenkt sich als Romanleserin in die Literatur und ist in der verbleibenden Freizeit Bienenzüchterin und Gärtnerin:
S. 47f
Sie inspiziert die Traube, die sich in Kopfhöhe leicht erreichbar, im Blattwerk der Quitte gebildet hat, eine ausgefranste, zähflüssige, laut summende Masse ohne scharf gezogene Grenzen . Alma schöpft mit dem Löffel einen Teil der Masse ab, dort, wo sie am dichtesten ist. . breiig quellen Bienen über den Rand der Kelle, fliegen teilweise von selbst in die Schwarmkiste, was vermuten lässt, dass Alma die Königin auf Anhieb erwischt ha…
S. 34
Zwar wollte sie vor dem Mittagessen noch die Fuchsien und Usambaraveilchen spritzen beziehungsweise abpinseln, sie hat sie bereits gestern in die Pergola getragen, damit sie die Blumen bis in einigen Tagen nicht von Blattläusen zugrunde gerichtet finde…
20.5 Außerfamiliäre und berufliche Tätigkeiten einer Bürgersfrau
Der Wirkungskreis der verheirateten Frau umfasste demnach zeittypisch im 19. Jahrhundert ihre Funktionen als Gattin, Mutter und Hausfrau, mit den Machtbefugnissen über die Dienstboten. Ihr Selbstbewusstsein erhielt sie aus der Leistung und gesellschaftlichen Position des Mannes, nicht aus ihrer eigenen Leistung!995
Der Bildungsgedanke, noch in der Aufklärung artikuliert, war für die Frau seit Rousseaus ErziehungsromanEmileobsolet. Ein gewisses Maß an Allgemeinbildung und die Kenntnis schöngeistiger Lektüre galten neben den Kenntnissen im Erziehungs- und
Hauswirtschaftsbereich als notwendig, aber eine bezahlte professionelle Tätigkeit stand außer Frage. Ihre Arbeit spielte sich in den eigenen vier Wänden ab.
Eben weil die bürgerliche Frau auf die häusliche Sphäre verwiesen war, entschieden die finanziellen Verhältnisse und die tolerante Haltung der Familienangehörigen, inwiefern und ob sich eine Frau sozial und beruflich entwickeln und außerhalb der Familie überhaupt andere Tätigkeitsfelder ausüben konnte. Hier zeigte sich rechtlich die patriarchalische Struktur: Es bedurfte der formellen Zustimmung des Mannes, wenn eine Frau ein Gewerbe treiben wollte, und wenn eigenes Vermögen fehlte, hing die Realisierung vom Ehemann ab. Mit einer Ausnahme: Ehefrauen von Kleinhändlern durften arbeiten, sie hatten den Status der „mithelfenden Familienangehörigen“.996
Die bürgerliche Gesellschaft sah eine verheiratete Frau, die arbeiten ging, als sozial und wirtschaftlich gescheitert und als eine schlechte Mutter an. Eine verheiratete Frau genoss damals weitaus mehr gesellschaftliche Anerkennung als die ledige Frau. Dieser brachte man wenig Achtung entgegen, weil sie keine Machtbefugnisse in einer Familie genoss. Als unverheiratete Frau galt sie als „alte Jungfer“ und lebte im Haushalt der Eltern oder Geschwister. Für s i e gab es die Möglichkeit zu arbeiten: Zur Wahl standen eine Arbeit als Gouvernante, wo jedoch die Konkurrenz, bestehend aus adligen Bewerberinnen aus guter Familie, weitaus bessere Chancen hatten, und der Lehrerinnenberuf. Er war seit Beginn des 19. Jahrhunderts in den Elementar- und Mädchenschulen eine Tätigkeit für „höhere Töchter“ und erforderte als Qualifizierung meist lediglich die Assistenz bei den früheren Lehrern. Dieser Beruf entsprach im landläufigen Sinn einer frauentypischen Berufstätigkeit und war angelehnt an den häuslichen Tätigkeitsbereich.
(TM)
Für Tony gilt es, geduldig auf die Zukunft und einen prospektiven Ehemann zu warten, sie kritisiert die unproduktive Alternative von Religion und Handarbeit und hat die Absicht zu arbeiten:
S. 302
„Also während eurer Abwesenheit hätte ich beinahe eine Stelle angenommen, eine Stelle als Gesellschafterin in Liverpool. Hättest du es empörend gefunden?. Aber immerhin etwas fragwürdig? Ja, ja, es wäre wahrscheinlich unwürdig gewesen. Kurz, es hat sich zerschlagen. Ich schickte der Missis meine Photografie, und sie musste auf meine Dienste verzichten, weil ich zu hübsch sei; es sei ein erwachsener Sohn im Hause. ,Sie sind zu hübsch', schrieb sie. ha, ich habe mich niemals so amüsiert…
Als Angehörige einer gehobenen Schicht war es zwar ein Standessymbol der Frau nicht zu arbeiten, aber sie sollte auch nicht, und das im Sinne der protestantischen Ethik, in der Freizeit ausschließlich dem Müßiggang nachgehen. Stattdessen gab es für sie die Option, neben ihrer Rolle als Mutter, eine soziale Tätigkeit in der Wohlfahrtspflege zu verrichten. Das gemeinnützige Engagement fand sein Vorbild sowohl beim Adel als auch bei Königinnen und gar der deutschen Kaiserin. Diese präsentierten öffentliche soziale Mildtätigkeit und Güte und erlangten dadurch Sozialprestige. Bürgerfrauen fühlten sich ebenfalls zur Erhaltung des sozialen Friedens und kümmerten sich um die weniger begünstigten Schichten: D.h. sie brachten den Arbeiterfrauen Haushaltung und Kinderpflege, gesunde Ernährung und sparsame Wirtschaftsführung bei, um deren Notlage zu mildern.997
Diese soziale Pflicht, gemischt mit dem Gefühl einer gewissen Eitelkeit der Mildtätigkeit, titulierte man als ,geistige Mütterlichkeit’: „In der Wohlfahrtspflege verstanden die Frauen soziale Arbeit als Bildungsprozess, in dem sich die gesellschaftspolitische Bildung unmittelbar an die lebenspraktischen Fertigkeiten bindet. Die sozial gebildete und einfühlsame Frau sollte als Hausfrau in die Lage versetzt werden, im engeren Familienkreis, in der Nachbarschaft oder der ehrenamtlichen Wohlfahrtspflege im Verständnis von „geistiger Mütterlichkeit“ zu wirken.“998 (TM)
S. 278
Die Konsulin selbst aber verlangte weit mehr noch von sich, als von ihren Kindern. Sie richtete zum Beispiel eine Sonntagsschule ein. Am Sonntag Vormittag klingelten lauter kleine VolksschulMädchen in der Mengstraße, … wanderten … über die große Diele in das helle Gartenzimmer ..., wo Sitzbänke aufgeschlagen waren, und wo die Konsulin Buddenbrook, … sie eine Stunde lang katechisiert…
S. 279
Einmal wöchentlich saßen an der langausgezogenen Tafel im Esssaale beim Scheine von Lampen und Kerzen etwa zwanzig Damen, die in dem Alter standen, wo es an der Zeit ist, sich nach einem guten Platze im Himmel umzusehen, tranken Tee oder Bischof, aßen fein belegtes Butterbrot und Pudding, lasen sich geistliche Lieder und Abhandlungen vor und fertigten Handarbeiten an, die am Ende des Jahres in einem Basare verkauft wurden, und deren Erlös zu Missionszwecken nach Jerusalem geschickt wa…
Der fromme Verein ward in der Hauptsache von Damen aus der Gesellschaftssphäre der Konsulin gebildet, …
20.6 Die „bürgerliche Frau“ im 20. Jahrhundert - der Wandel der Mutter- und Frauenrolle im zeitgenössischen Familienroman von Arno Geiger
Auch wenn im 19. Jahrhundert bereits einige wenige prominente Frauen emanzipiert auftraten (z.B. George Sand) und für Frauen den Zugang zu Berufen und Bildung forderten, verfestigte sich zunächst das oben beschriebene bürgerliche Frauenbild. „Die ausgefeilte Unterscheidung zwischen Weiblichen und Männlichen gehört ebenso wie ihre konträre Kodierung zu den langlebigsten Errungenschaften der bürgerlichen Kultur.“999
In bürgerlichen Elternhäusern entwickelten Eltern bis zur Zeit des 1. Weltkriegs aber immer mehr die Bereitschaft, ihren Töchtern die Möglichkeit einer universitären Ausbildung zu geben, so dass die höhere Mädchenbildung eine Expansion erlebte. Die Mehrheit der studierenden Frauen stammte aus der Oberschicht oder der oberen Mittelschicht und besaß nach Abschluss und anschließender Arbeit ein Recht auf Selbständigkeit und Selbstverwirklichung und die finanzielle Unabhängigkeit.
Im Falle der Heirat, meist mit einem Akademiker, erfolgte die Aufgabe der Berufstätigkeit zugunsten der traditionellen Rolle als Hausfrau, Gattin und Mutter.
Im ersten Weltkrieg kam es vermehrt im Bereich der Industrie und Dienstleitung zur Frauenerwerbsarbeit.
In der Weimarer Republik wurde dann die Gleichberechtigung der Geschlechter zum Grundrecht. 1919 verkündete man das Frauenwahlrecht, zehn Jahre später war dies in fast allen europäischen Staaten und Nordamerika festgeschrieben.
Die autoritär-patriarchalische Ordnung, noch bis zum Kaiserreich präsent, wurde als Lebensmodell ebenso aufgegeben wie die Annahme von der Polarität der Geschlechter. Nun war die geschlechtsspezifische Rollenverteilung nicht mehr so eindeutig und Frauen wagten erste emanzipatorische Schritte.
Immer mehr Frauen übten ihren Beruf aus und emanzipierten sich durch Mode und ein selbstbewusstes Auftreten in der Öffentlichkeit. Jedoch galt diese Zeit der Selbständigkeit für die meisten von ihnen weiterhin als eine Übergangsphase bis zur Heirat.
Doppelverdiener waren in der Gesellschaft nicht erwünscht, und man ging so weit, Frauen im Interesse stellungsloser Familienväter zu entlassen, und kein Frauenverein protestierte. Die „Gesellschaft“ [sei] „unter dem Primat der Erwerbsarbeit von Konkurrenz und Ambition geprägt“ und Frauen nähmen darin nur einen marginalen Status ein, ihr Wert bemesse sich hauptsächlich ,nach der Stellung des Mannes’.“1000
Erwähnenswert als eine revolutionäre Erneuerung der 20er Jahre ist das öffentliche Gespräch über Sexualität, Aufklärung und Geburtenregelung. Die Psychoanalyse war es, die Sexualität entmystifizierte und bewirkte, dass man die Prüderie des Kaiserreichs hinter sich ließ.
Während der Wirtschaftskrise sahen sich viele Frauen gezwungen, eine bezahlte Arbeit anzunehmen, die Berufsmöglichkeiten erweiterten sich, und nicht wenige bekamen die Chance männliche Berufe zu ergreifen. Der typische weibliche Beruf war der der kaufmännischen Angestellten. Haushaltsangestellte ,ehemals Dienstmädchen, waren nun kaum noch zu vermitteln, da junge Mädchen die Fabrikarbeit dem häuslichen Dienst vorzogen und die Ehefrauen des bürgerlichen Mittelstandes ihren Haushalt durch Geräte technisierten und mechanisierten - ein hygienisch sauberer Haushalt, ohne Dienstpersonal.
Die Familie blieb auch in der Weimarer Republik der wichtigste Ort für die Frauen.
(AG)
Die Figuren der mittleren Generation variieren die traditionellen Rollenbilder und man erkennt, wie das traditionell verfestigte auf das feministisch inspirierte Frauenbild trifft. Alma erlebt Anfang des 20. Jahrhunderts in ihrem Elternhaus Unterstützung für eine akademische Ausbildung und ist im Begriff, selber eine medizinische Laufbahn mit dem Studium einzuschlagen:
S. 70
Dass sie vor neuen Jahren(1929), als sie einander kennenlernten, behauptete, eine moderne junge Frau zu sein, und dass sie zum Argwohn seines Vaters das Haar schon damals sehr kurz trug. … Ob sie wohl manchmal ihrem Studium nachtrauer…
S. 358
Richards Hand, seine Fingernägel, vor allem die Fingernägel - sie sehen aus wie von den Leichenhänden im „Handkurs“ zu Beginn des Studiums. Das Studium, Das sie nie beendet ha…
Da Frauen mit intellektuellen Ambitionen von Seiten der Männer noch nicht die Akzeptanz fanden wie heute, gibt auch Alma ihre Ausbildung für ihre Ehefrauen- und Mutterrolle auf und beschränkt sich von nun an auf den Tätigkeitsbereich Familie: Die frühkindliche Sozialisation ihrer Kinder fällt ausschließlich ihr als Mutter zu.Sanftmut, Geduld und ein großes Harmoniebedürfnis zeichnen Alma aus.
S. 75
Als von hinter dem Haus Alma mit der weinenden Ingrid am Arm kommt, verstellt er die Lehne …
-Du wirst sehen, bis zur Hochzeit ist es wieder gut, sagt Alma zu Ingrid. …
Sie stellt die Gießkanne zurück zum Brunnen und fährt dem weinenden Kind mit der frei gewordenen Hand über die Wang…
S. 173
-Was sagt eigentlich deine Mutte…
- Mama? Die übt sich in Neutralität. Ich muss ihr halt immer versprechen, brav zu sei…
Die Diktatur in den dreißiger und vierziger Jahren stärkte erneut das Patriarchat. Josef Goebbels deklamierte 1933: „Den ersten, besten und ihr gemäßesten Platz hat die Frau in der Familie.“1001 Das hierarchische Verhältnis in der Ehe blieb bestehen: „Der Mann ist Organisator des Lebens, die Frau seine Hilfe und sein Ausführungsorgan.“1002 In der NS- Bevölkerungspolitik wurde Familie hoch geschätzt, ebenso die Arbeit der Mütter für Rasse und Volk. Die Frauenfrage jedoch fand kein Interesse in einer Partei, die sich als Männerbund verstand.
(AG)
Das Zusammenleben der Familie Sterk zeigt in der Zeit des Nationalsozialismus, und damit in einer Zeit der totalitären Indienstnahme der Familie, das „klassische“ Familienmodell mit dem uns bekannten traditionellen Rollenbild mit der Ernährerfunktion des Mannes. Alma begegnet uns als die unterstützende, nicht interferierende Gattin, die die Karriere ihres Mannes fördert und deren Aufgabe es ist, in Krisenzeiten, bei Umstrukturierungen und hohen Belastungen, für ihn da zu sein, das patriarchalische Monument des Mannes aufzubauen und mögliche Konflikte zu glätten. 1003 Weder persönliche Profilierung noch Selbstverwirklichung, sondern die Beaufsichtigung der Kinder und ihre Mutterrolle stehen im Vordergrund. Hausarbeit bedeutete in dieser Generation noch „die Arbeit am Haus...,reduziert... auf die Arbeit an und mit Familienmitgliedern.“1004
Alma ist Ansprechpartnerin für die Familienmitglieder und als Mutter das Zentrum der Erziehung, bei ihr suchen die Kinder Wärme und Aufmerksamkeit.
S. 71
Als sie schwanger wurde -. Wie war das damals? Sie hat es auf die ihr typische Art in Glück umgemünzt, mit offenen Armen für alles, was vorfällt, weil sie so gerne am Leben ist (ihre eigenen Wort…
S. 35
In dem Traum ging Alma mit Richard und Ingrid, die etwas fünfzehn war, durch Moos bei einer bestimmten Brücke am Mauerbach.…
Für Alma öffneten sich durch ihre Ausbildung die Tore zur Außenwelt, schlossen sich jedoch danach wieder.
S. 70
Ob sie wohl ihrem Studium nachtrauert?Nein. Und wenn doch? Ein bisschen vielleicht. Als sie schwanger wurde. Und er? Er hat gesagt, jetzt wird geheiratet. Ein großes Haus. Das war vorhande…
Die Intimisierung der modernen Kleinfamilie führt auch in dieser Familie zu einer Isolation, von der besonders die Hausfrau und Mutter betroffen ist. Die Integrität der Familie bewahrt Alma, unsicher der Treue ihres Mannes, dessen Seitensprünge sie im Alter erkennt. Sie will alles so erhalten, „wie es war, als es noch eine Familie gab“. (S. 343) „Diese Haltung der Contenance wird oft mit der Natur der Österreicher verbunden, mit einem Land, in dem Vergangenheit und Gegenwart saumlos miteinander verschmelzen, so dass der Geist Franz Josephs wichtiger bleibt als Hitlers Intermezzo.“1005
In der Retrospektive erscheint Alma die Rollenzuschreibung als Hausfrau und Mutter als einengend. Der Verlust beider Kinder muss für sie eine verzweifelte Sinnleere bedeutet haben, auch wenn wir als Leser nichts über ihre damalige emotionale Situation erfahren. Als sie in späteren Jahren von der Untreue ihres Mannes erfährt, stellt sich ihr nur ihre Jugend als eine glückliche Lebensphase dar.
S. 348f
Du, es war eine schöne Zeit, die zwanziger und dreißiger Jahre, ich glaube, das war bei mir, was man die Blüte des Lebens nennt. Ich war glücklich, ich meine, insofern glücklich als ich damals nicht ahnte, dass das Leben eine großes Hindernislaufen sein wird, das auf die Dauer müde mach…
S. 22
Also schön: vor dem Spiegel, da muss sie klein beigeben. Da beschleicht sie ein tristes Gefühl, um etwas betrogen worden zu sein, das sie einmal war und jetzt nicht mehr finde…
Eine Berufstätigkeit von Frauen, besonders die der Doppelverdiener, wurde in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts zwar nicht gerne gesehen, aber Frauen waren billige Arbeitskräfte und ihr Zuverdienst für die Familie oftmals notwendig, deshalb setzte sich das alte Rollenverständnis nicht ganz durch. Dem sollten Gesetze nachhelfen: Seit 1933 zahlte man ein zinsloses „Ehestandsdarlehen“ als Anreiz aus, wenn die Frau während der Darlehenslaufzeit nicht erwerbstätig war. Kinderreiche Familien wurden steuerlich begünstigt, Kindergeld für das dritte und vierte Kind bezahlt, hohe Geburtenzahlen prämiert, der Muttertag zum nationalen Fest. Man vergab Ehrenkreuze für die deutsche Mutter: für vier und fünf Kinder ein Kreuz in Bronze, für sechs und sieben das silberne, für acht und mehr Kinder das goldenen Mutterkreuz.
Ein erweitertes Mutterschutzgesetz sprach Arbeiterinnen und Angestellten bezahlten Mutterschaftsurlaub zu, ein sechswöchige Muttergeld nach der Geburt wurde dem vollen Grundlohn entsprechend bezahlt.
Der Reichsmütterdienst bot Mutterkurse, Erholungsaufenthalte und Hauswirtschaftskurse an. geleitetet von bürgerlichen Frauen, die auf diese Art ihre Vorstellungen von Mutterschaft und Haushaltsführung verbreiteten. „Bei ihnen zu Hause sorgte derweil ein Dienstmädchen für Sauberkeit, Ordnung und nährwertreiche Mahlzeiten, und bis 1944 kam der Staat trotz akuten Arbeitskräftemangels nicht auf die Idee, diesen Luxus einzuschränken.“1006
Die Lebensraum-Politik und das Argument, dass das deutsche Volk für seine Entfaltung östliche Gebiete unterwerfen und besiedeln müsse, setzte Anreize zur Mutterschaft mit dem Ziel, das Bevölkerungswachstum zu steigern, um ein starkes „Herrenvolk“ zu entwickeln.
In diesen Zusammenhang muss man die damalige Änderung des Scheidungsrechts sehen: Die Einführung des Zerrütungsprinzips erleichterte die Scheidung (und spätere Wiederverheiratung) ohne Angabe von Gründen nach dreijährigem Getrennt-Leben. Doch das geplante Ziel wurde nicht erreicht: Die Kinderzahl je Ehe stieg nicht, kamen in den 1920 bis 1930 geschlossenen Ehen durchschnittlich 2,3 Kinde zur Welt, waren es in den zwischen 1930 und 1940 geschlossenen Ehen nur noch 2,2.
Wie sah es in den Bildungsinstitutionen für die Frauen aus? Die Nationalsozialisten führten von 1933 bis 1935 an den Universitäten zwar einen geschlechtsspezifischen Numerus Clausus ein, aber der Krieg führte dazu, dass dennoch viele Frauen im Lehr- und Forschungsbetrieb tätig wurden, um die zur Wehrmacht eigezogenen Studenten und Akademiker zu ersetzen. Statt der Lyzeen und Oberlyzeen gab es nun die Oberschule mit einem sprachlichen bzw. hauswirtschaftlichen Zweig, deren Besuch mit einer ergänzenden Prüfung im naturwissenschaftlichen und fremdsprachlichen Bereich zur Immatrikulierung an der Universität berechtigten.
Staatliche Organisationen banden die Kinder und Jugendlichen zu politischen Zwecken ein und nahmen Einfluss im ideologischen Sinne, um Hitler als höchste Autorität darzustellen und den Einfluss der Familie einzuschränken. Auf die organisatorische Trennung der Geschlechter wurde dabei Wert gelegt: Mädchen traten mit zehn Jahren für vier Jahre den Jungmädeln des Bundes Deutscher Mädel (BDM) der Hitlerjugend bei. Deren Reichsführerin Lydia Gottschewski orientierte sich an dem nordischen, natürlichen Stil, hatte selber nichts von der verordneten Rolle als kommende Mutter an sich und begeisterte mit Freizeitunternehmungen wie Radtouren, Zeltlagern und Sport die Mädchen. Mit 14 Jahren verbrachten die Mädchen weitere vier Jahre in der Gruppe „Glaube und Schönheit“, dann folgte ein halbjähriger Arbeitsdienst oder ein Pflichtjahr mit anschließendem Beitritt in die NS-Frauenschaft.
Vielen der Frauen bot man in den staatlichen Jugend-Organisationen Aufstiegschancen in Abteilungen und Leitungsstellen an, wo sie als ehrenamtliche oder bezahlte Funktionärinnen arbeiteten, Anerkennung fanden und zu Führerinnen aufstiegen.
(AG)
Peter fühlt sich bei der Pflege der kranken Mutter fehl am Platze und attestiert seinen Schwestern Kenntnisse, die ihnen in den Mädchenorganisationen im 3. Reich vermittelt worden waren.
S. 129
Als die einzige Männersache, nämlich die Mutter in den Keller zu tragen, gestrichen war, stand Peter überall im Weg, vor allem seit die Schule geschlossen hatte. Oft beneidete er seine Schwestern, die durch hauswirtschaftliche Ertüchtigung im Rahmen des BDM im Vorteil waren …
Nach der Zeit des Nationalsozialismus kodifizierte man im Grundgesetz die Gleichberechtigung von Mann und Frau und schaffte alle Regelungen ab, die diesem Gleichheitsgrundsatz widersprachen und Frauen diskriminierten.
In Österreich gilt seit dem Staatsgrundgesetz von 1867 der Gleichheitssatz als
Verfassungsgebot. Seit der Wiederherstellung der Republik Österreich 1945 gilt wieder der Artikel 7 der österreichischen Verfassung von 1920: „Alle Bundesbürger sind vor dem Gesetz gleich“ und erweitert diesen allgemeinen Gleichheitsgrundsatz durch den Satz „Vorrechte der Geburt, des Geschlechts, des Standes, der Klasse und des Bekenntnisses sind ausgeschlossen.“
Was folgte, war jedoch eine „Restaurierung der alten familiären Verfassung und Lebensweise “.
Die traditionelle Eltern-Familie erlebte als Form des Zusammenlebens bis in die 60er Jahre hinein eine Periode der Hochschätzung, erhielt kirchliche und staatliche Förderung und fand stärkste Verbreitung.1007 Die Ehe stand hoch im Kurs und man favorisierte die Kernfamilie als dominantes Lebensmuster.
Die 50er Jahre galten als das „goldene Zeitalter der Ehe“, in diesem Jahrzehnt kam es zu einer Familialisierung in West- und Mitteleuropa. Die Wahrscheinlichkeit einer Heirat lag bei Personen im heiratsfähigen Alter bei 90%.
Familienpolitik orientierte sich weiterhin an einem traditionellen Bild der Familie mit männlicher Erwerbs- und weiblicher Hausarbeit mit Familienaufgaben. Diese althergebrachten Familienstrukturen waren nach dem 2. Weltkrieg für viele ein wichtiger und wohl der einzige intakte Halt in unsicheren Zeiten - Fluchtburg Familie! „Nach der immensen Kräfteanstrengung der vierziger Jahre schienen sich die Frauen nach Entlastung zu sehnen und das „normale“ Rollenangebot der Hausfrau und Mutter, von Kirchen, Wissenschaftlern, Verbänden und Politikern eilfertig propagiert, bereitwillig zu akzeptieren.“1008
Die klassische bürgerliche Familie und die Zwei-Kinder-Familie wurden zur Norm, und angesichts der Arbeitslosigkeit in den frühen 50er Jahren hätte auch niemand Verständnis für eine erwerbstätige verheiratete Frau gehabt. Der Mann, so das geschlechtstypische Rollenbild, verschaffte der Familie mit seinem Einkommen einen hohen Lebensstandard und ein hohes Sozialprestige:
Richards Sterks berufliches Leben ist geprägt von einem besonderen Pflichtethos und Elitebewusstsein. Nach dem Krieg stellt er sich diszipliniert und beruflich kompetent in den Dienst der Sache und ist nach einer erfolgreichen und verantwortungsbewussten Berufskarriere im Ruhestand gut abgesichert.
S. 201
Er hat für die Arbeit gelebt, Wochen ohne sonn- und Feiertage,...hat Turbinenhallen bauen lassen groß wie Opernhäuser. Er hat mitgeholfen, den Platz zu schaffen, den der Wohlstand benötigt, um sich auszubreite…
Die Aufgaben als Mutter und Hausfrau hatten Vorrang, wohingegen die Berufstätigkeit der Frau als ein Grund für den Verfall der bürgerlichen Familienstruktur gesehen wurde. Aus einer Radiosendung „Das Diakonische Jahr“ im Bayerischen Rundfunk 1954: „Haben unsere jungen Frauen die rechten Berufe, also solche, die es ihnen ermöglichen, die von Gott in sie gelegten mütterlichen reichen Gaben zu entfalten? Der Ehemann braucht[…] mehr als nur eine ausgezeichnete Sekretärin oder eine perfekte Köchin, auch mehr als eine weltgewandte Akademikerin. Er verlangt nach einem mütterlichen Menschen, der auch dann nicht verzagt, wenn Leid, Krankheit und Siechtum ins Haus kommen.“ 1009Akzeptiert wurde Erwerbstätigkeit der Frau nur, wenn es für den Familienunterhalt erforderlich war, ansonsten warf man berufstätigen Mütter fehlenden Familiensinn und Egoismus vor.
(AG)
Die Generation von Ingrid und Peter lehnt sich in ihren Lebensentwürfen zunächst an ihre Elterngeneration an und sieht in Heirat und in Elternschaft die zentralen Orientierungspunkte für ihr Leben.
In Ingrids Monolog mit Peter in den 50er Jahren zeigen sich weiterhin althergebrachte bürgerlichen Familienbilder und Rollen-Erwartungen, die die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung untermauern.
S. 167
… ich will gerne mitverdienen, wenigsten zeitweise. Du willst doch sicher nicht, dass die Frau am End mehr verdient als der Mann …
S. 168
… und denk dran, was du deiner zukünftigen Familie schuldig bist, der ganze Aufwand mit Platz und Kleidung und Essen, wenn ich zu Hause bin. …
Ingrid hat zu dieser Zeit aber schon die Bedeutung eines Berufs erkannt und ihn für sich und ihre Zukunft in den Blick genommen:
S. 169
… ich sammle meine Aussteuer zusammen, lass mich von dir nicht abbringen und tu auf der Uni mein möglichstes, um in der Zeit zu bleibe…
Ein Spiegel der 50er Jahre ist der Film „Hofrat Geiger“,in dem Ingrid als Statistin mitspielte. Während der Inhalt des Films früher bei ihr Rührung erzeugt, durchschaut sie in späteren Jahren die patriarchalischen Strukturen in diesem Streifen - und wird selber ein Opfer dieser Rollenzwänge1010
Das traditionelle Geschlechterrollenbild führt bei Ingrid zur frühen Heirat und Elternschaft. Peter erfährt die emotionale Stabilität, die ihm in der Kindheit versagt geblieben war. Die Narben und Erinnerungen an den Krieg werden überdeckt, der Krieg als sein prägendes Ereignis scheint keinen Platz mehr in seinem Leben zu haben. Sozial bedingte Faktoren wie Steigerung des Wohlstands und Arbeits- und Bildungsmöglichkeiten wirken sich in diesem Jahrzehnt auf Familie und Innenbeziehungen aus, gesamtgesellschaftlich beginnt jetzt für die mittlere Roman-Generation der soziale Aufstieg.
Peter kann Lizenzen für seine Spiele verkaufen und hat teil an der Wirtschaftswunderzeit, während Ingrid die Tochter zur Welt bringt.
S.259
Peter war beruflich unterwegs, weil er seine Straßenkreuzungen zu fotografieren hatt…
Auch wenn es bei Jungverheirateten verstärkt eine „Neolokalität“ (Auszug aus dem Elternhaus) gab, was einem Beitrag zur persönlichen Individualisierung1011 gleichkommt, die Rollenmuster in der Ehe bleiben dieselben wie in der vorhergehenden Generation.
(AG)
Mit Macht wirken bei Ingrid in der Anfangsphase ihrer Ehe noch die in der Herkunftsfamilie gelernten Bilder nach: In der restaurierten Haushalts- und Kernfamilie gilt für Ingrid das Hausfrauenmodell, wohingegen Peter als der Vater nur wenig zur Sozialisation der Kinder beiträgt und sich stattdessen der beruflichen Karriere widmet - Familienarbeit wurde bei weitem sozial nicht so hoch angesehen wie Erwerbsarbeit. In der Phase der Elternschaft dann, in der es um Haushaltsaufgaben und Kinderpflege geht, ändert sich der Charakter der Ehegatten-Beziehung von der romantischen Liebesbeziehung hin zur Partnerschaft mit familiären Aufgaben. 1012
S. 260
Die Crux bestand darin, dass sie in dem Strudel aus Alltagssorgen nicht zur Besinnung kam und deshalb das Ausmaß, wie wenig Unterstützung sie von Peters Seite erhielt, gar nicht zu würdigen wusst…
Auf die Zeit nach der Geburt ist Ingrid ungenügend vorbereitet, denn mit dem Übergang zur Elternschaft wird die Arbeit im Haushalt zulasten der Frau umverteilt und „traditionalisiert“: Elternschaft zieht Konsequenzen für die Erwerbssituation der Mütter und Väter nach sich, da Familiengründung stets eine Neustrukturierung der Lebensumstände bedeutet, sei es in der Freizeitgestaltung, im Erwerbsverhalten oder den familialen und außerfamilialen Beziehungen. Peter als der vollzeit-berufstätige Familienernährer hat keinen zeitlichen Spielraum für die Kinder, während bei Ingrid die Reduktion auf die Mutterrolle, der Verzicht auf soziale Aktivitäten, das Alleinsein-müssen mit den Kindern, die wenige Zeit für das Studium und für die Prüfungen die Ehe-Zufriedenheit verändern:
S. 216f
Das Studium hat jetzt eindeutig Vorrang. …
Ingrid erinnert sich gerade noch rechtzeitig, dass sie vor allem erst einmal die Prüfung ablegen muss, wie sich’s auf eigenen Beinen steht - weil (wenigstens) die väterliche Hand mit dem darin befindlichen Geld sich nie von ihr zurückgezogen hat. Auf der Basis von Verliebtheit ist halt noch keine Existenz zu gründe…
Wir lesen nur von wenigen Kontakten zu ihren Eltern, die eine Hilfe hätten darstellen können:
S. 265f
Seit Peter und ihr Vater beim Auseinanderbauen der Wohnzimmermöbel handgreiflich geworden sind, hat sich der Kontakt zwischen dem dreizehnten und dem achtzehnten Bezirk auf ein Minimum reduziert. …
Ingrid ist nicht unfreundlich, aber hörbar distanziert. … Ihr Vater seufzt nachsichtig. So milde hat sie ihn schon lange nicht mehr erlebt. Er spricht eine weitere Einladung für den Neujahrstag aus. … stellt sie einen Besuch erst im Anschluss an den nächsten Nachtdienst in Aussich…
Die Geburt eines Kindes zeigte dem jungen Paar, dass Elternschaft nicht mehr nur die Reduzierung der individuellen Freiheit bedeutet, sondern auch materielle Einschränkungen mit sich bringt. Ein Grund, sich Möbel für ihre Wohnung aus dem Elternhaus zu beschaffen:
S. 207
Als der ockerfarbene Kleinbus, den Peter sich ausgeborgt hat, hupend in die Einfahrt biegt, ist es kurz nach vier und das Wetter wieder schön....Peter wendet den Bus und setzt ihn zurück zur Eingangstür damit die Möbel nicht unnötig geschleppt werden müsse…
Ende der 60er Jahre erfolgte ein Bedeutungswandel der Familie durch die politische neue Linke, durch Frauen- und Friedensbewegung und die Kritik der 68er Generation an der „bürgerlichen Gesellschaft“ und der „bürgerlichen Familie“ - all das bewirkte ein gesellschaftliches Umdenken.
Die liberale Reformbewegung mit ihrer vermehrten weiblichen Erwerbstätigkeit bestimmte das politisch-kulturelle Klima: Man hinterfragte die Rolle der Hausfrau, die öffentliche Anerkennung vermissen ließ und als Dienst für andere sozial und funktional entwertet wurde. Eine Ausbildung wurde zur Norm und der Beruf als d a s Mittel der Selbstverwirklichung gesehen. Eine bessere Schulbildung, bedingt durch den quantitativen Ausbau höherer Bildungsinstitutionen, vergrößerte die Ansprüche und Erwartungen an die eigene Zukunft.
Berufstätigkeit war nun nicht mehr die Domäne des Mannes, sie war eine Voraussetzung für weibliche materielle Unabhängigkeit und persönliche Entfaltung und ein Zeichen für gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und persönlichen Erfolg. Sie bedeutete nicht mehr nur eine Ergänzung des Einkommens des Mannes, sondern Berufsprestige und soziale menschliche Kontakte.1013
In der modernisierten Frauenpolitik in Österreich und Westdeutschland förderte man das nun übliche Drei-Phasen-Modell mit Teilzeitarbeitsplätzen und der Wiedereingliederung von Frauen nach der Familienphase, das Zuverdienermodell. Anders in der DDR, dort ging es im gleichgestellten Familienmodell schwerpunktmäßig um die vollständige Teilhabe von Frauen an der Erwerbsarbeit.
Viele Frauen folgen von nun an dem propagierten Lebensphasenmodell wenn ihre Lebenspläne nicht durch Krieg oder dem Verlust des Partners durchkreuzt wurden und umdisponiert werden mussten. Reformen im Familienrecht brachten Veränderungen im Familienleben. Neue Normen und Ziele prägten die Lebensgestaltung und stellten das bisherige Familienideal in Frage.1014
Die Dominanz der bürgerlichen Kleinfamilie verschwand, die als Referenzmodell bisher geltenden Formen des ehelichen und familialen Lebens wurden in Frage gestellt und galten als reaktionär.
Der Wandel familialer Strukturen und Lebensformen und die in die Familie hineingetragenen demokratischen Vorstellungen brachten eine Gleichberechtigung von Söhnen und Töchtern mit sich. Die Bildungsexplosion führte bei den Frauen zu höheren Bildungschancen und ermöglichte allen ein Studium und eine Berufsausbildung, so dass von nun an die Notwendigkeit einer Versorgungsehe nicht mehr bestand.
(AG)
Ingrids späterer Wiedereinstieg in den Beruf entspricht dem Drei-Phasen-Modell mit einer vorgezogenen Familiengründung und der verzögerten Berufskarriere.1015 In den 70er
Jahren nimmt sie die Ausbildungsphase wieder auf, in einer Zeit, in der die Chancengleichheit und die Qualifizierung der Mädchen und Frauen d a s wichtige Thema der sozialliberalen Reformpolitik wurde.1016
Die Hausfrauenrolle und -arbeit wurde als kontaktarm empfunden und die Erwerbsquote von verheirateten Frauen bzw. von Müttern mit Klein- und Schulkindern stieg an. (Ein Vergleich: Die Zahl der verheirateten berufstätigen Frauen betrug 1950 26,4% und 1980 48,3%)
Anders als früher verlässt heute das letztgeborene Kind das Elternhaus, wenn die Mutter fast 50 Jahre ist, so dass sie mit dem Ehepartner noch mehrere Jahrzehnte im „leeren Nest“ verbringt. Diese Zeit wird oftmals mit dem Wiedereinstieg in den Beruf ausgefüllt.1017 Die Mehrheit der akademisch ausgebildeten Frauen ergreift den Beruf der Lehrerin oder Ärztin.1018. Da bereits in den 50er Jahren die sog. Frauenlohngruppen verboten wurden, waren die Lohn- und Gehaltsunterschiede zu den männlichen Gehältern gering und der Beruf nicht mehr nur ,Zuerwerb‘ der Ehefrau. Persönliche Motive wie die Unabhängigkeit vom Ehemann durch den eigenen Zuverdienst, Freude am Beruf und das Entstehen sozialer Kontakte (s.o.) durch den Beruf traten bei den Frauen in den Vordergrund. 1019 Statt auf die „gute Partie“ zu warten, wurde der Beruf das ökonomische Standbein der Frau!
(AG)
Bei Ingrid zeigen die feministisch inspirierten Ideen Wirkung, sie lehnt sich gegen die Reduzierung auf die innerfamiliale Rolle auf :
S. 272 (1970)
Sie liebt ihren Beruf. … In der Dienstkleidung fühlt sie sich als moderne, selbständige und kräftige Frau. Ihre Schrift in den Krankenakten. Der Umgang mit den Patienten und dem Persona…
In Anbetracht der exzellenten Ausbildung (Medizinstudium) und ihrer sozialen Herkunft erfolgt bei ihr die Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit mit kleinen Kindern schon während der Vorschulphase des jüngsten Kindes. Es gibt für sie nicht unbedingt einen ökonomischer Zwang für den Wiedereinstieg in das Studium, aber die angestrebte Karriere und die eigene Erwerbstätigkeit bedeuten für sie Unabhängigkeit, der Einkommens-Effekt und die persönliche Befriedigung sind für sie mit dem Aspekt der Selbstverwirklichung verknüpft.
20.6.1 Die Frau in ihrer Doppelbelastung
Das neue Leitbild der berufstätigen Frau stieß in der Gesellschaft nicht nur auf Zustimmung, sondern auch auf Ablehnung. Viele befürworteten die bisherige traditionelle Aufgabenteilung, so wie Ingrids Ehemann Peter:
S. 245
Ihre Berufstätigkeit beeinträchtige das Familienleben auf eine Art, da könne er nicht einfach zusehe…
Eine berufsorientierte Frau zu akzeptieren und das patriarchale Diktat zugunsten von Aushandlung und einem veränderten Familienmanagement aufzugeben, fällt ihm schwer. S. 272
Peter meint dann noch, es falle ihm schwer, sich mit ihrer Position abzufinde…
Dass die herkömmlichen Rollenvorstellungen und die traditionelle Machtverteilung ganz und gar nicht verschwunden waren, zeigt sich ebenso auf Ingrids Arbeitsstelle, wenn männliche Oberärzte Frauenwitze erzählen, gegen die sie als Frau nicht aufbegehren darf. S. 239
Wieder am Gang, erntet das lauteste lachen ein Witz von Oberarzt Kobe…
- Fünf Frauen an der Kette in der Küche. Artgerechte Haltun…
Ingrid lacht pflichtschuldi…
- Ist echt zum Schießen. Hahah…
Kery hingegen wird böse, Kober solle sich als geohrfeigt betrachten, weil, wie sie sagt, frauenfeindliche Aussage. Ingrid weiß sofort, wie gut das bei den Kollegen ankommt. Kery, das dumme Huhn kapiert nicht, dass sie sich mit dieser Masche in die Sackgasse manövriert. Ingrid bespricht den , schönen Fall' mit Kollegin Ladurner, die stimmt zu und meint, sie würde sich ebenfalls hüte…
Wie sehr der Beruf und die Berufstätigkeit der Frau Familienleben verändert, erzählt Arnold Geiger in seinem Roman:
Eine familienexterne Kinderbetreuung bot man im Österreich der 60er und Anfang der 70er Jahre noch nicht an, und damit blieb Erziehung im Roman Frauensache1020, was zwar die emotionale Beziehung von Mutter und Kind verstärkte, gleichzeitig aber zu Schuldgefühlen bei der Frau führte.
Die Organisation disparater Bereich bewirkt ein Gefühl der Zerrissenheit mit der Defizitdiagnose, Job und Kindern nicht gerecht zu werden,
S. 256
… und sie hat ein schlechtes Gewissen, so dass sie die Ohrenstöpsel herausnimmt, sich anzieht und den Rest der Familie zusammentrommelt. Wer Lust habe, sich auszulüften, solle bis in fünf Minuten gerichtet sei…
Sissi grantelt, kommt aber mit. …
Ingrid spannt die Gummis am Ende von Philipps Overall-Hosenbeinen ..., zieht Philipp die Pudelmütze über den Kop…
Die bisherigen Geschlechterbilder wurden aufgeweicht, die strikte Rollentrennung war obsolet, nun forderte man die Väter auf, sich aktiver an der Erziehung zu beteiligen und sich der mütterlichen Rolle anzupassen statt abwesend zu sein. War der Mann bisher auf die Geldgeber- und Autoritätsfunktion reduziert, kam nun eine sozio-emotionale Komponente mit dem weichen und gefühlsbetonten Aspekt in der Vaterrolle hinzu.1021 Erziehung war jetzt eine Aufgabe beider Elternteile, womit Vater und Mutter zum Vorbild und Identifikationsobjekt der Kinder werden.
Doch: War oder ist es de facto so?
(AG)
Ingrid problematisiert die Situation der Frau 1970:
S. 249
Er hält sich in ihr eine Putzfrau, eine Köchin, eine Gouvernante für die Kinder und ab und zu eine Geliebte, die aber nicht befriedigt wird....Und die Verwandlungskunst geht weiter: Wäscherin, Büglerin, Tippse. Und alles sehr billig. Die Früchte des langen Kampfes für die Emanzipation der Frau. Wohin diese Entwicklung bisher geführt hat, dafür ist Ingrid der gemeingültige Beweis. Da pfeift sie auf den ganzen Linksruck, der ist nur auf den Straßen laut. Aber zu Hause heißt es: Pss…
Die Geburt eines Kindes bringt die Paare, die eigentlich eine Gleichstellung praktizieren wollen, meistens zur traditionellen Rollenteilung zurück. Es kommt zur Retraditionalisierung auf der Ebene des Verhaltens, die dann doch dazu führt, dass die Frau zeitweise aus dem Erwerbsleben ausscheidet.
Die eheliche Zufriedenheit nach der Geburt der Kinder lässt typischerweise nach1022 und finanzielle und gesellschaftliche Sorgen lassen oftmals kein echtes Liebesglück mehr aufkommen.
Das Vorhandensein der Kinder macht die Beziehung komplexer und die Illusion der Liebe schwindet. Statt gleichgestellter Arbeitsteilung werden viele Haushaltsaufgaben nach traditionellem Muster aufgeteilt, und bis heute noch liegt das Engagement für die Kinder verstärkt in den Händen der Frauen, auch wenn die zeitliche Beteiligung an der Kinderbetreuung von väterlicher Seite sich langsam wandelt.
Die feministischen Bewegungen der 70er Jahre machten der Teilung von Rechten und Aufgaben von Männern und Frauen nur langsam ein Ende, wie langsam, das zeigt die Mehrfachbelastung, die Ingrid als Ärztin und Hausfrau/Mutter hat.
S. 245
Er solle sich endlich mit den Tatsachen auseinandersetzen und sie (Ingrid) mit seinen Ausflüchten und ewiggleichen Antworten in Ruhe lassen. Für alles sei sie der Trottel, und falls er sie in dieser Ansicht korrigieren wolle, soll er zuerst in den Windfang schauen und dann in die Abwasch. Es gebe ja immer den Trottel Ingrid der hinter allen herräum…
Die im 19. Jahrhundert häusliche Zuständigkeit der Frauen hat Ingrid bei weitem nicht hinter sich gelassen: Für sie rückt als Hauptbetreuungsperson die Sozialisations- und Erziehungsaufgabe der Kinder in den Mittelpunkt, das entspricht der traditionellen weiblichen Fürsorge für die Kindergeneration.
Nun jedoch produzieren Stressoren Konflikte: Lange und unregelmäßige Arbeitszeiten verlangen die Partizipation des Mannes an den hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, die traditionelle Geschlechterrolle der Frau verschwindet nicht, sondern wird ergänzt vom Bild der doppelbelasteten Frau.
Ingrid, hat neben der Tätigkeit als Ärztin die Mehrfachbelastungen einer Hausfrau und Mutter zu tragen.
S. 266
- Geh es dir gu…
- Ich denke, ja, so halbwegs. Ich bin halt ohne Unterbrechung beansprucht. Nichts Neue…
Ihre Erwerbsarbeit als hochqualifizierte und verantwortungsvolle Tätigkeit als Ärztin passt sie möglichst unauffällig in den persönlichen Familienrhythmus ein und befürchtet, dass ihre Emanzipationswünsche zu Lasten der Familie, besonders der Kinder, gehen.
Die Synchronisation von Erwerbs- und Familienarbeit konfrontiert sie als Frau mit Problemen, die Männer nicht kennen: Beruf und Familie, Mutterschaft und Erwerbsarbeit werden als Bereiche räumlich und funktional getrennt und die Frau versucht, beides mit hohem zeitlichen Engagement und überdurchschnittlichem beruflichen Einsatz zu vereinbaren.
„Verstärkt wird diese Tendenz durch das unveränderte Verhalten der Männer, die sich immer noch kaum aktiv am familialen Bereich zur Entlastung der Frauen beteiligen.“1023 Die betreuungsintensivste Zeit, die die meisten Abstimmungsleistungen von familialer und beruflicher Anforderung erforderlich macht, ist bei Ingrid noch nicht vorbei. In der Betreuung der Kinder ist sie eine verantwortungsvolle und liebevolle Mutter mit einer intensiven emotionalen Beziehung zu den Kindern, für die täglichen Bedürfnisse der Kinder zuständig und für die Organisation des Familienlebens zuständig, erlebt aber eine unzureichende Entlastung in Haushalt und Familie.
S. 253
Ingrid stürzt sich ins Kochen, damit es keine Nachrede gibt, sie mache ihre Arbeit nich…
Die Kombination von Beruf und Familie verstärkt das Problem der zeitlichen Koordination.1024 Diese Zeitknappheit führt zu einer familienzentrierten Freizeitgestaltung und zu geringen außerfamiliären sozialen Außenkontakten. Stress und psychische Belastung verstärken sich durch die Schicht- und Nachtarbeit im Krankenhaus. Die dortige Organisationsstruktur ist anti-familial und nimmt keine Rücksicht auf die familialen Zeitpläne.
S. 239f
Raus und weg. …
Der Laden ist bummvoll, und stundenlanges Warten kommt für Ingrid nicht in Frage, weil ihr kein Laden bekannt ist, in dem man sich Zeit anschaffen kan…
Das Problem der Doppelorientierung Familie/Beruf verwehrt Ingrid die Regeneration zu Hause, und anders als früher für den bürgerlichen Mann, ist für sie die Familie nicht mehr der Ort, wo sie sich als Berufstätige erholen und Kraft finden kann, um wieder gestärkt ins Berufsleben einzutreten.
S. 243
Ingrid legt sich auf die Couch. Sie richtet den Heizlüfter auf ihre Beine und wickelt sich eng in die Decke, die Arme vor der Brust überkreuzt. Ehe sie einnickt, sieht sie fünf Minuten ,Hofrat Geiger…
Ingrid wacht auf, als sich Peter in der Küche durch die Besteckschublade wühl…
S. 253
… keine Verbindung zu der vierunddreißigjährigen Frau, die übernächtigt mit einem summenden Gefühl in den gliedern auf der Fernsehcouch eine kleinen Hauses im achtzehnten Bezirk sitzt …
S. 269
Du kannst nicht für das Glück aller zuständig sein. Man braucht auch ein Minimum an Energie für sic…
Gerne würde Ingrid ihre Arbeit im Haushalt an familienfremde Hilfen abtreten, wie es in den großbürgerlichen Familien üblich war. Ihr Vater bietet an, ein Kindermädchen von der Steuer abzusetzen, doch Peter lehnt es ab, dass eine fremde Person die Erziehungsaufgabe und den Haushalt übernimmt, während seine Frau arbeiten geht: S. 260
Nicht einmal eine Hilfskraft für die Kinder oder den Haushalt gelang es ihr durchzusetzen. Peter legt sich wiederholt mit dem Argument quer, er hasse diese semifamiliären Bindungen, er wolle nicht parat stehen für fremde Leute und jederzeit den Chauffeur machen müsse…
Die Frauenbewegung und die Single-Diskussion der 70er Jahre zeigen bei Ingrid Wirkung:
S. 269
Denk daran, was in der Cosmopolitan stand, die vor einigen Wochen im Ärztezimmer lag: ,Man verwendet seine Energien für sich und den Rest, der verbleibt, für andere.
Aber die Berufstätigkeit gibt Ingrid trotz Stress und Doppelbelastung eine große Zufriedenheit, was sich auch positiv auf den Sozialisationsprozess der Kinder auswirkt.
S. 240
Für einen kurzen Moment, als sie träge den Schnee von den Scheiben ihres Käfers schiebt und der Wind ihr die aufgewirbelten Kristalle seitwärts ins Gesicht und in den Atemzug treibt, empfindet sie so etwas wie Glüc…
Ihre große Motivation im Berufsleben rührt daher, dass sie eine interessante und anspruchsvolle Tätigkeit mit relativer Selbständigkeit und große Verantwortung ausübt. Positive Arbeitsaspekte sozialer Art, wie Wertschätzung durch Vorgesetzte, kommen hinzu. Der Arbeitsmarkt als Partnerschaftsmarkt ist für Ingrid zwar noch nicht relevant, aber sie ist sensibilisiert für Aufmerksamkeiten ihrer männlichen Arztkollegen.
S. 237
Oberarzt Doktor Kalvach streichelt Ingrid die Haare, was Ingrid als Ausdruck größten Wohlwollens auffass…
Peter bleibt als Vater in dieser Zeit farblos, mit nur geringer Partizipation an den familiären Tätigkeiten. Sein Arbeitseinsatz und Aufgabenspektrum bezieht sich auf andere Tätigkeiten, da von ihm als Mann ein uneingeschränktes berufliches Engagement erwartet wird, so dass von einer neuen Aufteilung familiärer Pflichten nicht die Rede sein kann. Er nimmt sich seine Auszeiten und misst der persönlichen Freizeit große Bedeutung bei.
S. 247
Peter regt sich furchtbar auf, er habe sich für Montag soviel vorgenommen, er sei davon ausgegangen, Ingrid werde zu Hause sein … Er habe sich mit zwei Kollegen für das Fußballturnier in der Stadthalle verabrede…
Ingrid kann Peter nicht zur Mitarbeit bewegen, besteht aber auch nicht darauf. Nach mehrmaliger Aufforderung zur Mithilfe, kommt es dazu, dass die Arbeit von Seiten der Frau erledigt wird, was wiederum das traditionelle Muster und die Menge der Arbeit verstärkt.
S. 257
… hätte sie ihren Mann besser rechtzeitig zum Mithelfen erzogen, etwas, wofür er jetzt nicht mehr zu gewinnen is…
S. 249
Im Weitergehen nimmt sie an, dass Peter und sie an diesem Tag nicht mehr viel miteinaner reden werden. so ein Idiot. Alles, was recht ist. Er hält sich eine Putzfrau, eine Köchin, eine Gouvernante für die Kinder und ab und zu eine Geliebte, die aber nicht befriedigt wird. … Und die Verwandlungskunst geht weiter: Wäscherin, Büglerin, Tippse. Und alles sehr billi…
Männer wie Peter, die sich der Aufgabenteilung widersetzen, „brechen damit den Vertrag der Solidarität und Gegenseitigkeit, der die Grundlage des Ehelebens bildet.“1025„Als problematische Verbündete tritt im übrigen bei der innerfamilialen Arbeitsteilung noch die sog. romantische Liebe auf den Plan. Denn die emotionale Beziehung zum Ehemann könnte mit eine der verursachenden Bedingungen für allzu schnelle Hilfsbereitschaft sein.“1026
Es folgt Peters Rückzug in den Keller, dort verbringt er den großen Teil der Freizeit mit technischen Hobbys, wie dem Modellbau. Bei Bedarf ist er zwar ein Ansprechpartner für die Kinder, jedoch findet Interaktion zwischen ihm und den Kindern zu dieser Zeit kaum statt. (anders als nach Ingrids Tod)
Die bürgerliche Ehe hatte bisher ein geringes Scheidungsrisiko aufgewiesen, dies ändert sich nun.
Das Verhältnis von Ingrid und Peter zeigt, wie sehr weibliche Erwerbstätigkeit die Ehequalität und Ehestabilität beeinflusst: Die Beziehung wird nicht befriedigend gestaltet und der ehemals geistige Partnerschaft git nicht mehr das Hauptaugenmerk.
Ingrid zieht eine Trennung von Peter in Erwägung, will aber auf keinen Fall die Beziehungen zu den ihr sehr nahe stehenden Kindern kündigen. Konfliktreiche Aushandlungsprozesse zwischen beiden Ehepartnern produzieren eheliche Konflikte1027, die sogar eine evtl. Scheidung thematisieren - durch die wirtschaftliche Unabhängigkeit einfacher als in früheren Jahrhunderten - und „je stärker, nun der institutionelle Charakter der Ehe in den Hintergrund tritt und allein die Beziehungsebene und damit Emotionen und Affekte bedeutsam werden, desto eher können Enttäuschungen über den Partner die Auflösung der Ehe begünstigen.“1028
„Ob Väter oder Mütter die Integration von Familien und beruflichen Rollen als spannungsgeladen leben, hängt (...) vom Niveau der Ansprüche an die Qualität des Familienlebens, von den Anpassungskapazitäten an veränderte Aufgaben, von der Inanspruchnahme unbezahlter Arbeit aus der Verwandtschaft, von der Beteiligung des Mannes an den Haushaltsaufgaben und von einer primär innenfamiliär verbrachten Freizeit ab. “1029
Mit einem vergleichbar höheren Qualifikationsabschluss als der Mann empfindet Ingrid die Belastung durch den Haushalt stärker und ihre Arbeit als größere nervliche Belastung.1030 Statuskonkurrenz reduziert die eheliche Zufriedenheit (statistisch gesehen, sind Ehen, in denen Frauen höher qualifiziert sind als die Männer, besonders instabil.1031) Sie beurteilt die Tätigkeit ihres Mannes als ineffezient, als eine Vertiefung in Nebensächliches, um anderen Tätigkeiten aus dem Weg zu gehen. Es ist das „Kind im Mann“, das kreativ und phantasiereich seine Seite auslebt.
S. 248
Er ist Straßenverkehrsspezialist, der ganze Tage durch die Gegend heizt, wie es ihm belieb…
S. 252
- Was baut er da unten? fragt sie schar…
- Ein Modell der Opernkreuzung, sagt Philipp na…
Peter dagegen sieht sich durch die Berufstätigkeit seiner Frau in der Position als Versorger und Oberhaupt der Familie bedroht und damit seine männliche Identität reduziert.
Theoretisch erkennt er zwar den Wert der Gleichberechtigung an und zeigt bewahrende und traditionelle Züge im Rollenverständnis: Ingrid soll gleichzeitig Hausfrau und erfolgreiche erwerbstätige Ärztin sein. Argumentativ belegen kann er sein fehlendes Einverständnis zur Berufstätigkeit der Frau nicht, der eigene berufliche Erfolg genießt in seiner Werthierarchie oberste Priorität.
Die Art des Umgangs in Konfliktsituationen erfolgt sowohl in sprachlicher Form, als auch durch Versöhnungsgestern von Peter:
S. 262
… schwingt Peter sich zu dem Bekenntnis auf, dass er sich ein Leben ohne sie drei nicht mehr vorstellen könne. Auch das tut Ingrid gut, …
Als Ingrid die Kinder in die Badewanne steckt, bringt Peter sogar eine Tasse Kaffee mit warmer aufgeschäumter Milch. Sehr aufmerksam. Er ist wie verwandel…
Peters „partnerschaftliche Minderbegabung“ (S. 262) erstickt aber Auseinandersetzungen bereits in den Anfängen.
S. 272
Peter drückt seine Zigarette aus und sitzt da mit den Händen in den Hosentaschen, die Schultern hochgezogen. Ingrid reicht ihm verbal den einzigen Strohhalm, der zwischen ihren Fingern noch irgendwie Substanz ha…
- Es ist ein Erfolg, dass wir dieses Jahr überstanden haben. Das kommende kann eigentlich nur besser werde…
Erst nach dem Tod von Ingrid, in der Rolle des alleinerziehenden Vaters und nun selber vom beruflich-familialen Alltag betroffen, engagiert er sich und weist in der Reflexion ein modernes Geschlechterverständnis auf.
S. 304 (1978)
Dann sagte sie noc…
- Du erträgst es offenbar nicht, wenn nicht du im Mittelpunkt stehst, sondern wer andere…
Wenn er sich diese Momente ins Bewusstsein ruft ., überkommt ihn eine abscheuliche Stimmung,. so bedrückend ist ihm, was er nicht ungeschehen machen kan…
20.7 Wie sozialistische Familienpolitk in der DDR Familie und Elternschaft prägte
„Die Familie ist immer und überall abhängig von der Gesellschaft, zu der sie gehört.“1032 In Westeuropa wird sie als Privatsphäre behandelt, in der nur bei Verletzungen der elterlichen Sorge eingegriffen wird. „Familie ist keine reine Privatsache und kann es niemals sein.“1033 Sie ist die Keimzelle des Staates und vollzieht wichtige Dienste in der Erziehung, Sozialisation, Persönlichkeitsentwicklung, Freizeitgestaltung und in der Beziehung und Pflege der älteren Generation vollzieht.
Im anderen Teil Deutschlands spiegeln sich diesbezüglich die sozialen, ökonomischen und politischen Verhältnisse der DDR wider. Die Ideologie der DDR beeinflusste Familienpolitik und Familie.
Ein glückliches Familienleben galt in beiden deutschen Staaten als der zentrale Lebenswert1034. Die subjektive Wertschätzung eines glücklichen Familienlebens war unter den Menschen der DDR groß und stand in der Lebensplanung der Menschen (ähnlich wie im Roman) als ein wichtiger angestrebter und sinnerfüllender Lebenswert.1035 Der Wunsch nach einer Familie mit Kindern war sowohl bei Männern als auch Frauen vorhanden.
Für Irina sind Familie und Partnerschaft eine Glücks- und Zweckgemeinschaft. Ihre hohen Erwartungen an die zwischenmenschlichen Beziehungen zu Kurt und den anderen Familienmitgliedern führten zu einer Überfrachtung der Familie mit Erwartungen.
Die Ausreise Saschas in den Westen und die Weihnachtsfeier machen dies erkennbar: S.75f -Was ist denn, wo ist e…
- In Gießen, sagte Kurt leis…
- Ihr Körper reagierte sofort - als wäre ihm ein Schlag versetzt worden …
- Sascha ist weg, schrie sie. Tot, verstehst du, to…
S.354
In diesem Jahr jedoch war sie entschlossen, noch einmal ein richtiges Weihnachtsfest stattfinden zu lassen: wer weiß, vielleicht war es das letzte Mal in diesem Haus …
S.370
… Stopfte es wieder hinein. Dumme Gans. Und hatte noch die Hand drin, hatte das Kalte noch in der Hand, außen heiß, innen kalt … als es ins Rutschen kam.Die ganze Küche. Die fliesen. Und tanzten. Nur, jetzt waren es Fußbodenfliese…
Catrin fasste sie unter die Arme…
- Fass mich nicht an du Aas…
- So, das war’s, sagte Sasch…
Die Familienpolitik in der DDR aber unterschied sich sehr von der der westlichen Staaten. Familie galt zwar von Beginn der DDR an als die wichtigste Institution für die Entwicklung und Verbreitung der sozialistischen Lebensweise (zusammen mit den öffentlichen Erziehungseinrichtungen) und der Erziehung zur sozialistischen Persönlichkeiten, wurde aber zunächst gesellschaftlichen Zielen und Interessen untergeordnet.
So umfasste Familienpolitik in den 40er bis 60er Jahren Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Frauen-, Bildungs- und Gesundheitspolitik standen, mit der Maßgabe, dass durch die Annäherung der Klassen und Schichten ein einheitlicher Familientyp entstehen sollte.
Familienpolitik beruhte auf dem Marxismus/Leninismus und fand vor dem Hintergrund sowjetischer Erfahrungen statt. In der sowjetischen Familienpolitik, dem Vorbild der DDR, gab es eine Wertschätzung von Familie und Ehe. Lenin hielt die Familie für eine persönliche Angelegenheit der Menschen, gleichzeitig aber sollten Familienerziehung und öffentliche Erziehung eine Einheit bilden. Politische Bewusstseinsbildung im Sinne des marxistischen Weltbildes musste in der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder eingeschlossen sein.1036
Marx sah zwar Ehe und Eigentum als die Grundlage einer bourgeoiren Herrschaft,1037 ließ aber die Frage offen, was an die Stelle der bürgerlichen Familie treten sollte. Als deren bindendes Glied sah er das Geld und die Langeweile. Er kritisierte die Zerstörung der Familienbande in der proletarischen Familie durch die Industrie und betrachtete die Kleinfamilie als eine Folgeerscheinung der kapitalistischen Produktionsweise.
Arbeit selber dient nach Meinung von Marx und Engels der Selbstverwirklichung des Menschen1038 und allein aus diesem Grund war die Berufstätigkeit der Frau und deren wirtschaftliche Unabhängigkeit unabdingbar und Voraussetzung für die weibliche Emanzipation.
In der DDR ist nie an eine Abschaffung der Familie gedacht worden. Ehe und Familie bildeten die Grundlage des Gemeinschaftslebens und wurden 1949 in der Verfassung unter den Schutz des Staates gestellt. (§30, Abs.1). Die Familie leistete demnach einen wichtigen Beitrag zum Bestand der Bevölkerung, zur Reproduktion von Arbeitskräften und zur Persönlichkeitsentwicklung von Eltern und Kindern. Sie galt als kleinste Zelle des Kollektivs, als eine private Einheit, die Geborgenheit, Liebe, Sicherheit und Zuflucht vor den äußeren Belastungen schenkte und ethisch-moralische Orientierung, d.h.: Sie war die Instanz zur Formung der sozialistischen Persönlichkeit. Einstellungen und Verhalten der jungen Menschen, ihre Ziele und Chancen, all das wurde beeinflusst von der Familie und all das nahm der Mensch mit, wenn er sie hinter sich ließ.
Man sah in der ,sozialistischen’ Familie das Idealbild, mit der Liebesehe als Basis, gekennzeichnet durch ideologischen Kollektivismus und gesellschaftlich-politischer Loyalität. In einer kommunistischen Erziehung sollte die Gleichberechtigung der Frau verwirklicht werden.1039
Das Familiengesetzbuch von 1965 (FGB) bestimmte die sozialistische Familienpolitik bis zum Ende der DDR und damit die rechtliche und ideologische Position der Familie in der sozialistischen Gesellschaft. In ihm regelte man die die Ehe auf dem Grundsatz der Gleichberechtigung und die Erziehungsarbeit der sozialistischen Familie. Insbesondere die Einbeziehung der verheirateten Frauen in die Berufstätigkeit sollte das traditionelle Familienbild wandeln und eine Abkehr von der klassischen Ernährer- und Hausfrauenfamilie einläuten.
Die Politik entlastete die Familien von vielen Alltagsaufgaben, bot finanzielle Leistungen und Kindereinrichtungen an und bestimmte, dass Erziehung, Betreuung und materielle Versorgung der Kinder im neuen System arbeitsteilig durch Familie und Gesellschaft gewährleistet wurden:
§ 3.(1) Die Bürger gestalten ihre familiären Bindungen so, daß sie die Entwicklung aller Familienmitglieder fördern. Es ist die vornehmste Aufgabe der Eltern, ihre Kinder in vertrauensvollem Zusammenwirken mit staatlichen und gesellschaftlichen Einrichtungen zu gesunden und lebensfrohen, tüchtigen und allseitig gebildeten Menschen, zu aktiven Erbauern des Sozialismus zu erziehen.
(2) Die Erziehung der Kinder ist zugleich Aufgabe und Anliegen der gesamten Gesellschaft. Deshalb gewährleistet der sozialistische Staat durch seine Einrichtungen und Maßnahmen, daß die Eltern ihre Rechte und Pflichten bei der Erziehung ihrer Kinder ausüben können. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Hilfe für kinderreiche Familien und für alleinstehende Mütter und Väter.
Das Leitbild der sozialistischen Familie schloss familialen Wandel aus. Familie galt in dieser sozialistischen Gesellschaft nicht als Nische, in der Schutz und Zuflucht gesucht wurde, wie sie das Bürgertum im 19. Jahrhundert sah. Sie sollte kein Rückzug von der Welt der Arbeit sein und der Erholung dienen, im Gegenteil: Außenkontakte galten als ein ganz besonderer Stabilitätsfaktor, und da die Arbeit im Sozialismus keine entfremdete Arbeit war und es für eine Isolierung der Familie in der Gesellschaft keinen Grund gab, war auch kein Rückzug nötig,
Stattdessen war Familie Teil der sozialistischen Gesellschaft und als Erziehungsträger ein sozialistisches Kollektiv unter vielen.1040
Die Familie galt also einerseits als ein Baustein des Sozialismus, wenn Familienmitglieder sich öffentlich zu sozialistischen System bekannten; andererseits aber war sie eine potentielle Bedrohung für die sozialistische Kontrolle, wenn dies nicht der Fall war.1041 Der Privatcharakter der Familie machte ihre Kontrolle und Lenkbarkeit schwer. Beeinflussung von Seien der SED erfolgte, indem sie in institutionalisierten Gruppen ideologische Erziehung vermittelte: Sozialistische und staatsbürgerliche Erziehung in Zusammenarbeit mit Elternvertretungen sollten das Zusammenwirken von Schule und Elternhaus fördern. In der Realität war es so, dass die kollektive Sozialisierung in den staatlichen Kinderkrippen, -gärten, Jugendorganisationen die Bedeutung der Familie aber nur in geringem Umfang beeinflusste: Für viele DDR Bürger war die Politik weit entfernt, sie fühlten sich geborgen in ihrem Kollektiv und ihrer Familie.
(ER)
Ruge zeigt in seinem Buch den großen Einfluss der Familie: Die Erzählungen der Großmutter von Charlotte wecken in Sascha früh den Wunsch, nach Mexiko zu reisen. Die Tätigkeit des Vaters als Historiker führt dazu, dass Sascha Geschichte studiert.
S. 94
- Und wenn ich groß bin, dann fahr ich nach Mexik…
5. 299f
- Du hast dir das Studium selbst ausgesucht, sagte Kur…
Niemand hat dich gezwungen, Geschichte zu studieren, im Gegentei…
In den 70erJahren verstärkte sich die These von der gewachsenen Bedeutung der Familie für die Entwicklung der Persönlichkeit und für die Charakterprägung. Problematische Familienverhältnisse hatten die Jugendkriminalität anwachsen lassen und man versuchte nun, dies durch stärkere Unterstützung der Jugendhilfe zu reduzieren.
Kurt erzieht Sascha im sozialistischen Sinne:
S. 175
- Aber wenn deine Begeisterung für diese Beatmusik dazu führt, dass du Gammler werden willst, dann muss ich dir sagen, dass deine Lehrer recht haben, wenn sie so etwas verbiete…
Die dominierende Familienform in der DDR war die Zwei-Generationen-Familie, d.h. die Kernfamilie mit Eltern und Kindern lebte in einem gemeinsamen Haushalt und bewahrte bei den heranwachsenden Kindern auch im weiteren Lebenslauf eine große Bedeutung. Das Zwei-Phasen-Modell in der Lebensbiografie hieß: Von der Geburt bis zum 40./45. Lebensjahr lebte man in der vollständigen Kleinfamilie der Herkunftsfamilie und der selbst gebildeten Familie (wenn keine Scheidung erfolgte).1042
Als eine soziale Norm, die durch familienpolitische Maßnahmen unterstützt wurde, galt es, möglichst früh zu heiraten und Kinder zu bekommen. Nicht selten erlebten kinderlose Frauen ab Mitte zwanzig in dieser Hinsicht sozialen Druck und Diskriminierung: Es galt als egoistisch und kleinbürgerlich, keine Kinder zu haben.
Ähnlich anderer kommunistischer Länder zeichnete sich die DDR durch ein niedriges Alter bei der Erstgeburt und der Eheschließung aus. Ursache für dieses Heiratsverhalten: Durch die eigene Erwerbstätigkeit und die Ganztagsbetreuung der Kinder hatte die Ehe für Frauen keine ökonomische Sicherungsfunktion mehr (und konfessionelle religiöse Werte für eine Heirat fielen nicht mehr ins Gewicht), und nicht nur Frauen, auch ostdeutsche Männer hatten ein großes Interesse, eine Familie zu gründen, wenn auch die Entscheidung für den Zeitpunkt eher bei den Frauen lag.
Eine Kopplung von Heirat und Familiengründung bestand bei der Mehrheit der Frauen zur Zeit des ersten Kindes meist noch nicht. Kinder hatten die Funktion, emotionale Bedürfnisse zu befriedigen in einer durch emotionale Kälte gekennzeichneten Gesellschaft, in der Solidarität und Geborgenheit nur noch Phrasen waren.1043 Aus diesem Grund wies Ostdeutschland eine hohe Nichtehelichkeit der Kinder auf, viele Frauen bekamen ihr erstes Kind schon während der Ausbildung. Elternschaft und Eheschließung erfolgten also nicht mehr, wie es im Westen die bürgerliche Norm war, nach Erreichen einer sozialen und/oder beruflichen Position und mit ausreichender ökonomischer Existenzgrundlage.
Nach der Eheschließung hatten Ehepaare ihren eigenen Haushalt, und das trotz problematischer Wohnsituation und geringer Verfügbarkeit von Wohnungen in der DDR.
(ER)
In Ruges Roman ist Sascha das Beispiel eines jungen Mannes, der nach dem Verlassen seiner Herkunftsfamilie keine Zeit des Alleinseins und -lebens hat, in der er vielleicht unabhängig von neuen Bezugspersonen experimentiert. Die Familiengründung erfolgte früh, wie in der DDR üblich. Seine Beziehungen waren krisenanfällig, sie wurden Hals über Kopf eingegangen, und eine wirkliche Ablösung von Zuhause hat es nie gegeben.
S. 293/S. 296
-Wir haben dir abgeraten, Hals über Kopf zu heiraten, eine Frau, die du kaum kennst. Wir haben dir abgeraten, ein Kind in die Welt zu setzen mit zweiundzwanzig. ...
- Entschuldige, sagte Kurt. Ein bisschen geht es auch um die Wohnung. Deine Mutter hat euch diese Wohnung besorgt, hat mit dir noch Tapeten geklebt, weil Melitta schwanger wa…
In der Beziehung zwischen Sascha und den Eltern hat die Erzieherrolle in erster Linie die Mutter wahrgenommen wird, der Mann greift erst in Krisensituationen in den Erziehungsprozess ein. Kurt dagegen verbringt die meiste Zeit in seinem Arbeitszimmer. Diese Vernachlässigung nimmt Sascha ihm noch als Erwachsener übel: S. 164f
Entsprechend verhalten reagierte Sascha auf das kleine Geschenk, das Kurt ihm aus Moskau mitgebracht hatte …
- Danke schön, leierte er, ohne das Buch auch nur anzusehe…
Er würde sich mehr um den Jungen kümmern, beschloss Kur…
S. 292
- Deine Mutter macht sich Sorgen, begann Kur…
Sascha zuckte mit den Schulter…
- Mir geht es gu…
- Das freut mich, sagte Kurt. Dann kannst du mich ja mal darüber aufklären, was eigentlich los is…
- Was soll los sein. …
Irinia kompensiert durch innige Mutterliebe die Vernachlässigung des Sohnes durch Kurt.
S. 78
-Aber Saschenka, ich werde doch nicht verhaftet. Er begann zu weinen. Seine Mutter hob ihn hoch und küsste ihn.
Mit den Jahren entwickelte sich in der DDR eine Entkopplung von Liebe, Ehe und Elternschaft:1044 Immer mehr Frauen hatten außereheliche Geburten und lebten alleinstehend. Ein Grund dafür war die Bevorzugung bei der Wohnraumvergabe und bei der Bereitstellung von Krippenplätzen.
Eine alleinstehende Mutter mit Kind zu sein galt in der DDR nicht als Makel, weil, laut Gesetz, die „außereheliche Geburt weder dem Kinde noch seinen Eltern zum Nachteil gereichen“ durfte.1045 (ER)
Markus lebt in einer Ein-Eltern-Familie ohne Integration des außerhalb lebenden Elternteils, zu seinem leiblichen Vater geht der Kontakt verloren
S. 274
- Ich geh nicht mehr zu meinem Vater, verkündete e…
- Wass ist denn jetzt los, sagte Muddel. …
- Der Arsch, sagte Mark…
S. 286
Markus schaute sich um, aber natürlich war sein Vater nicht da. Immer wenn man ihn brauchte, war er nicht da: jetzt, zum Beispiel, … Zum Kotzen, einen Vater zu haben, der nie da war. Andere Väter waren da, nur er, Markus Umnitzer, hatte so einen Scheißvater, der immer nicht da war: Der Arsc…
S. 387
… und die ersten, die kamen, bildeten jetzt automatisch so etwas wie ein Spalier, und er, Markus, stand plötzlich ganz vorne im Spalier. Er hätte seinen Vater berühren können. Ja, er berührte ihn fast! Aber sein Vater ging an ihm vorbei, ohne ihn zu bemerke…
Bei Markus wirkt sich die Abwesenheit des Vaters negativ aus, verbunden mit der Scheidung führt dies zu psychosozialen Auffälligkeiten und einer wenig positiven schulischen Entwicklung:
S. 379f
Es stellte sich heraus, dass wieder mal ein Brief von seiner Telekom gekommen war. Das Übliche: Fehltage, schlechte Noten …
Dope. Gras. Ein Stoff, der nach Markus’ Überzeugung tausendmal ungefährlicher war als Alkohol, kein Grund, sich aufzuregen - aber Muddel regte sich auf. Muddel regte sich wahnsinnig au…
Das Leitbild der sozialistischen Familie hatte in der Theorie bis zum Untergang der DDR Bestand, doch kam es schon früh zum Rückzug ins Privatleben. Man konzentrierte sich mehr auf den privaten Gewinn als auf das Engagement und den Einsatz für den Betrieb.
Statt Generationskonflikte gab es innerhalb der DDR eine besonders ausgeprägte Familiensolidarität, diese nutzte man insbesondere bei Schwierigkeiten und
Problemen.1046 Vor allem seit den 80er Jahren konnte man ein familiaristisches Denken und eine Konzentration auf die eigene Familie feststellen. Die Menschen traten den Rückzug ins Private an, weil sie eine wachsende Entfremdung von Politik und in ihrer beruflichen Tätigkeit weder die Anerkennung individueller Leistung erlebten noch irgendeine Kreativität umsetzen durften.1047
Es entwickelte sich der Trend zum Zweit- Dritt- und Viertkind, zumal wirtschaftliche Erwägungen bei der Gründung einer kinderreichen Familie keine Rolle spielen mussten.
Auch wenn die Partei versuchte, die Bevölkerung durch ihre Politik von der Richtigkeit des sozialistischen Weges zu überzeugen, wurde das Private in der DDR zu einer Gegenkraft in der Gesellschaft. Die Familie als Nische war ein Platz „der Menschen drüben, an dem sie Politiker, Planer, Propagandisten, das Kollektiv, das große Ziel, das kulturelle Erbe - an dem sie das alles einen guten Mann sein lassen … und mit der Familie und unter Freunden die Topfblumen gießen, das Automobil waschen, Skat spielen, Gespräche führen, Feste feiern. Und überlegen, mit wessen Hilfe man Fehlendes besorgen, organisieren kann, damit die Nische noch wohnlicher wird.“1048 In der Familie konnte man seine Meinung offen sagen (falls nicht Verwandtschaftsangehörige zur Stasi gehörten und im Dienst des Staates standen):
S. 69
- Das ist eine Warnung, dozierte Kurt. Das bedeutet: Leute, wenn es hier zu irgendwelchen Demonstrationen kommt, dann machen wir das wie die Chinesen auf dem Platz des himmlischen Friedens. Herrgott, nee wirklich, Beton, sagte Kurt. Beto…
S. 136
Es geht hier um Richtungskämpfe. Es geht hier um Reform oder Stillstand. Demokratisierung oder Rückkehr zum Stalinismu…
Familie wurde ein Synonym für Freizeit und und Freiheit, auch wenn die hohen Scheidungsraten zeigten, dass Hoffnungen und Erwartungen oftmals Familien überforderten.1049
Das bürgerliche Modell der Familie mit seiner Intimisierung und Emotionalisierung der Beziehungen setzte sich dementsprechend gesellschaftsweit in West- und Ostdeutschland durch und hatte auch in der DDR eine Abkapselung zur Folge.
Familie war eine Gemeinschaft von Vater, Mutter und Kinder, ein Ort des privaten Erfolgs und der Geborgenheit und Liebe, abgeschirmt von der Umwelt:
Diese Bedeutung von Familie und Privatheit wird in Ruges Roman deutlich, gleichzeitig wird nie explizit, wie familienpolitische Maßnahmen die private Lebensführung beeinflusst haben.
(ER) S. 79Sonntags kroch er zu seinen Eltern ins Bett.S. 86Mama brachte ihn ins Bet…
S. 94
Es ist Sonntag. Alexander geht mit seinen Eltern die Straße entlang … Sie gehen mitten auf der Straße. Hand in Hand: links Mama, rechts Papa, und Alexander erklärt, wie er sich die Sache so vorstell…
S. 177
Und plötzlich empfand er (Kurt) ein unbändiges fast schmerzliches Bedürfnis, diesen Menschen (Sascha) vor all dem Ungewissen, das noch auf ihn zukam, zu beschütze…
Trotz des autoritären Staatsapparates und der Kontrollorgane und Institutionen, die eine starke institutionelle außerfamiliäre Betreuung der Heranwachsenden bildeten, gab es in den Familien einen modernen, demokratischeren Umgang. Kinder erlebten zwar eine sozialistische Gesellschaftsstruktur, wobei die politischen Beschlüsse aber nicht in die familialen Generationsbeziehungen und Interaktionen hineinwirken.1050
Familie Umnitzer zeigt den Lesern, in welchem Maße die SED-Familienideologie der Realität entsprach, denn diese DDR-Familie ist trotz Loyalität zum Staatssystem vom propagierten Familienleitbild entfernt: Das bevölkerungspolitische Ziel mit dem Wunschbild einer 2-3 Kinder-Familie als Norm-Familie wird nicht erreicht. Wir lesen von Scheidung und Ehebruch und erleben trotz eines gewissen gesellschaftspolitischen Charakters ein traditionelles Rollenbild und eine Privatsphäre - eigentlich der ähnlich wie in Österreich und Deutschland. Die Familie von Kurt, Irina und Sascha und den Großeltern ist eine Familie mit dem Charakter einer bürgerlichen Rückzugsnische. Sie führt ein Leben in häuslicher Geselligkeit ohne sich zu isolieren - wie es von der sozialistischen Gesellschaft wertgeschätzt wurde.
Die Nach-Wende-Familie von Markus hat das bürgerliche Familienideal offensichtlich für sich als Grundlage:
S. 377ff
… und erschien in der großen, bei der Renovierung noch um das Doppelte vergrößerten Wohnküche …
… während er die einfarbigen grünen Servietten faltete und die grünen Kerzen auf den Tisch stellte in Äußerungen der Mutter…
Und dann war auf einmal „Familienrat“ angesagt. …
Markus negiert es durch seine konkreten Lebensumstände.
Auch wenn Familien wie die Umnitzers vom sozioökonomischen und politischen Milieu der DDR beeinflusst wurden, blieb das Bild einer einheitlich verbreiteten sozialistischen Familie Wunschbild, und war nur partiell in der DDR zu finden. Es existierten weiterhin soziale Familientypen, wie z.B. Arbeiter-, Genossenschaftsfamilien oder Intelligenz- und Angestelltenfamilien.1051 Familie vermittelte weiterhin die Normen einer Schicht und Klasse und ein bestimmtes Kulturniveau, stabilisierte damit Schichten und Klassen, obgleich das sozialistische Bildungs- und Erziehungssystem dies zu relativieren wünschte,1052 zu entdecken ist dies bei Familie Umnitzer: S. 18
Dort standen die Nachschlagewerke, die auch Alexander mitunter benutzt hatte (Aber zurückstellen!) dort die Bücher zur russischen Revolution, da in langer Reihe die rostbrauenen Lenin-Bänd…
S. 80
Später Schachspiele. Papa gab ihm zwei Türme vor, trotzdem gewann er imme…
20.8 Die Frau in der DDR
Während Westdeutschland und Österreich das traditionelle Leitbild der bürgerlichen Familie stützte, die Rollenverteilung nach dem Krieg 1945 zunächst traditionellwertekonservativ war und später zur Verhandlungssache des Paares wurde, ist der Wandel des Verhältnisses zwischen Mann und Frau in der DDR ein öffentlichgesellschaftlicher gewesen.
Dort löste das sozialistische Leitbild, konzipiert auf die Rolle der berufstätigen Frau, das traditionale Leitbild ab, Berufsarbeit galt als die Voraussetzung für die Überwindung der Benachteiligungen einer Frau.
Das Ziel war eine neue sozialistische Frauengeneration, auf der Grundlage der sozialistischen Frauenemanzipationstheorie, gestützt durch gesetzliche Maßnahmen. Die Entscheidungsgewalt in der Ehe war auf Seiten beider Partner, ohne eine dominante Entscheidungsstruktur.1053
Emanzipation stand in der Tradition des philosophischen Marxismus, und diesen gleichberechtigten Status von Frauen verankerte man laut Art. 20 der DDR Verfassung von 1949 „in allen Bereichen des gesellschaftlichen, staatlichen und persönlichen Lebens“. Es galt damit die formal-juristische Gleichstellung der Frau und das Prinzip der Lohngleichheit bei gleicher Arbeit. Gleichberechtigung der Frau wurde stets im Zusammenhang mit einer Unabhängigkeit vom Mann und einer ökonomischen Selbständigkeit der Frau gesehen.
Ein neues Verhältnis der Geschlechter zueinander sollte entstehen.1054 Die „sozialistische Familie“ stimmte in ihren Grundinteressen mit der Gesellschaft überein, in ihr herrschte Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann wie in allen gesellschaftlichen Bereichen und beide Elternteile nahmen am gesellschaftlichen Leben und dessen Gestaltung teil.1055 Gesellschaftspolitischer Tätigkeit in Freizeitgruppen, Parteien, Organisationen sollten das Familienleben bereichern1056, so gehen in Ruges Roman beide, Irina und Kurt ihrem Beruf nach und nehmen am gesellschaftlichen Leben teil.
Die sog. „sozialistische Familienbeziehung“ sollte auf Gleichberechtigung, Liebe, Achtung und gemeinsamer Verantwortung für die Kinder gegründet sein.1057 Ihre Unterstützung und Förderung orientierte sich an dem Selbstverständnis des Systems. In ihm gab es, so die Ideologie, eine „Übereinstimmung der Grundinteressen von Familie und Gesellschaft“, denn der Widerspruch zwischen den Bedürfnissen des Individuums und den Bedingungen des gesellschaftlichen Lebens galt als durch die Beseitigung des Privateigentums an Produktionsmitteln überwunden.
Gesetze und Bestimmungen, die der Gleichberechtigung der Frau entgegenstanden, waren in der DDR aufgehoben worden (anders als im BGB in Westdeutschland, in dem sich durchaus noch Bestimmungen fanden, die die Benachteiligung der Frau zementierten).
Die Verfassung der DDR besagte konkret:
dass alle Gesetze, die die Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Familie beeinträchtigen, aufgehoben sind. (§30 Abs. 1 u.2)
In Art. 18 wird der Frau der gleiche Lohn bei gleicher Arbeit zugesichert;
Art. 30 stellte Ehe und Familie unter den Schutz des Staates;
Art. 31 sah die Erziehung der Kinder als ein natürliches Recht der Eltern;
Art. 32 garantierte einen besonderen Mutterschutz, den Schutz und die Fürsorge des Staates während der Mutterschaft;
Art 33 stellte außerehelich geborene Kinder gleich;
und Art. 35 versprach das gleiche Recht auf Bildung und auf freie Wahl des Berufs. (ER)
Charlotte hat sich 1952 journalistisch von Mexiko aus dazu geäußert:
S. 37
Sodass Charlotte keinen anderen Weg gesehen hatte, als ihrerseits einen Bericht an Dretzky zu schicken. Ihr „Verstoß gegen die Parteidisziplin“ hatte nämlich hauptsächlich darin bestanden, dass sie am 8. März, am Frauentag, eine Würdigung des neuen Gleichberechtigungsgesetzes der DDR gebracht hatte, obwohl der Vorschlag mehrheitlich als „uninteressant“ abgelehnt worden wa…
Die gesellschaftliche Gleichstellung der Frau zielte in den sozialistischen Länder auf die umfassende Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt und das hieß, es musste gleichzeitig eine Erleichterung des Lebens für die Frau erfolgen, damit diese Berufstätigkeit, Kinder und Haushalt vereinbaren konnte. Familienpolitik wurde nun zur Frauenpolitik mit dem Fokus auf berufliche Entwicklung, Geburtenentwicklung und der Vereinbarkeit von Familie und Mutterschaft. Damit wich die DDR von der ursprünglichen marxistisch-leninistischen Programmatik ab, wonach die bürgerliche Familie aufgelöst werden sollte und die Hausarbeit vergesellschaftet werden sollte.
Es ging nicht um die Freiheit der persönlichen Entscheidung der Frau und nicht um Selbstverwirklichung; es ging in der DDR um die Vereinbarkeit von Mutterschaft, Berufstätigkeit und um Mithilfe der Frau beim Aufbau des Sozialismus. Kollektive Ziele ersetzten die patriarchalischen Strukturen und Zwänge von früher.
Es folgt ein kurzer Abriss der Frauenpolitik in der DDR, die den Hintergrund von Eugen Ruges Familienroman bildet:
Bereits kurz nach dem 2. Weltkrieg organisierten sich Frauen in Frauenausschüssen und dem Demokratischen Frauenbund (DFD), einer Massenorganisation wie FDGB, FDJ etc. und regten andere Frauen für den Wiederaufbau und zur Mitarbeit an. Das Bild der Frau als Trümmerfrau, die das Chaos beseitigte, wurde aufgewertet und Frauen wurden beim Aufbau des Staatswesens in den weiblichen Pflichtenkreis der Sozialfürsorge, Volksbildung und des Gesundheitswesens einbezogen. Sie hatten beim Wiederaufbau den Großteil der Überlebensarbeit zu leisten, und wenn auch eine Vielzahl der Familien im Nachkriegsdeutschland ohne männliches Oberhaupt war, wurde an den Traditionen des deutschen Familienlebens festgehalten. Familie galt weiterhin als Ort der Zuflucht und der Geborgenheit, als Ruhepunkt im Umfeld der Zerstörung. Die Frau hatte dabei ihre Rolle als Hausfrau und Mutter auszufüllen (dies zeigen Analysen von DDR-Illustrierten aus der damaligen Zeit), und dies mit den Tugenden der Arbeitsamkeit und Bescheidenheit, wegweisend für das ideologische Selbstverständnis der DDR als ,Arbeitsgesellschaft‘ und solidarischer Gemeinschaft.1058
Die 50er und 60er Jahre waren in der DDR ebenso wie im Westen eine familienbetonte und restaurative Phase.1059 Die damalige Tugendlehre tolerierte weder uneheliche Kinder noch das Zusammenleben ohne Trauschein oder die Scheidung, erst gegen Ende der 50 Jahre endete dieser Puritanismus und es kam zu Lockerungen im Umgang der Geschlechter.
Für ledige, verwitwete und geschiedene Frauen bestand in der DDR nun die Pflicht zur Arbeit. Ab 1952 bemühte man sich um die berufliche Qualifizierung aller Frauen, von 1959 -1964 um eine Verallgemeinerung der Berufstätigkeit, was hieß, dass man auch verheiratete Frauen und Mütter in den Arbeitsprozess einbezog. Der Grund war weniger emanzipatorischer als ökonomischer Art: Die Erfüllung der Planziele und der Bedarf an Arbeitskräften standen im Vordergrund. Da durch die Fluchtbewegung aus der DDR ausgebildete Fachkräfte verloren gingen, verschärfte sich die Arbeitskräftesituation, Frauenarbeit war schon aufgrund der zahlenmäßigen Überlegenheit der Frauen in der SBZ (es gab ca. 2 Mio. mehr Frauen als Männer) unerlässlich. Für viele Familien war das Dazuverdienen der Frau wegen des niedrigen Durchschnittsgehalts des Mannes eine wirtschaftliche Überlebensfrage. Man schulte Frauen um und lernte sie an, damit sie in industriellen Arbeitsbereichen eingegliedert werden konnten.1060
Dass es trotzdem anfangs eine relativ hohe Frauenarbeitslosigkeit gab, erklärt sich aus der ungenügenden Qualifikation vieler Frauen und nicht zuletzt aus den damals verbreiteten traditionellen Vorstellungen von Frauenberufen - sie verhinderten eine Tätigkeit in Männerberufen.
Ebenso wirkten sich Frauenfeindlichkeit und Vorurteile der Gewerkschaftsfunktionäre oder der Betriebsleitungen und Facharbeiter negativ auf die Einstellung der Frauen und die Bemühungen um Frauenqualifizierung aus (auch SED-Führungsmänner hielten Frauen aus ihrem Machtbereich heraus!), so dass bis 1958 nur 18,3% der Frauen in Familien berufstätig waren und in den meisten Familien der DDR noch das traditionelle Familienbild mit einem berufstätigen Vater und einer Mutter als Hausfrau weiterlebte. Viele verheiratete Frauen hatten selber die Vorstellung von einer nur kurzzeitigen beruflichen Tätigkeit und sahen das Erlernen eines Berufs als überfüssig an, mit ein Grund für ihre mangelnde Qualifikation. Dagegen folgten alleinstehende Frauen wesentlich häufiger der Aufforderung der Propaganda und nahmen eine Berufsarbeit an.1061 Mit Hilfe der Medien präsentierte man die berufstätige und verantwortungs- und pflichtbewusste Frau, zeigte Frauen in der
Schichtarbeit und bei schwerer körperlicher Arbeit und wertete, wo es möglich war, die Nur-Hausfrau als ein kapitalistisches Relikt gesellschaftlich ab. Mit den Hausfrauenbrigaden, die stundenweise in Industrie und Landwirtschaft arbeiteten, beendete man die „Hausfrauen-Ehe“.
Schon bald zeigte diese Frauenpolitik der SED und die ideologische Beeinflussung Wirkung und eine nicht geringe Anzahl der Frauen entwickelte berufliche Ambitionen.
Zum Idealbild der sozialistischen Frau gehörte Ende der 50er Jahre die Berufstätigkeit. Sie sollte ein inneres Bedürfnis sein, was bedeutete: Verheiratete Frauen hatten die Pflicht zur Arbeit.
(ER)
Charlotte 1952:
S. 41
Vielmehr teilte er mit, dass zwei Einreisevisa im sowjetischen Konsulat für sie bereitlägen, und bat sie, umgehend die Rückreise anzutreten, um für ihre neuen Aufgaben zur Verfügung zu stehen: Charlotte sollte als Direktorin das Institut für Literatur und Sprachen an der demnächst zu gründenden Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft übernehmen …
Irina 1961
S. 133
… während Irina noch immer nicht ihre Ausbildung als Dokumentaristin beendet hatt…
Große Bedeutung besaß familienpolitisch weiterhin die Ehe und die Erziehung der Kinder zu Kämpfern für den Sozialismus/Kommunismus.1062 Dafür gründete man Frauenausschüsse in Betrieben, die die Einrichtung von Betriebskindergärten und -krippen und speziellen Frauenräumen in Angriff nahmen. Aber nicht selten stießen sie auf finanzielle Barrieren und männliches Desinteresse, was letztendlich die Ausführung mancher Vorschläge verhinderte. Erst Ende der 50er Jahre und Anfang der 60er Jahre wurde der breite Ausbau realisiert.1063
Im „Gesetz über den Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der Frau“ von 1950 sicherte man den Frauen soziale Hilfen und staatliches Kindergeld zu. Das gemeinsame Entscheidungsrecht beider Eheleute löste das Alleinbestimmungsrecht des Mannes ab und ermöglichte der Frau bei der Eheschließung die Ausübung des Berufs.
Dieses Gesetz fixierte die staatliche Unterstützung von Müttern und kinderreichen Familien durch den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen und die Erweiterung des Dienstleistungsangebot. Für die neu entstehenden Vorschulerziehungseinrichtungen und Horte bildete man eine große Anzahl von Frauen zu Erzieherinnen aus.
Nach der Geburt eines Kindes bekamen Mütter ihren vollen Nettolohn für die Zeit des gesetzlichen Schwangerschafts- und Wochenurlaubs (5 Wochen vor und 6 Wochen nach der Geburt) ausgezahlt. Bei der Rückkehr in den Betrieb wurde insofern Rücksicht auf Mütter von Kleinkindern genommen, dass sie keine Schicht- und Nachtarbeit zu verrichten brauchten und keinen gesundheitsschädigenden Arbeitsbedingungen ausgesetzt werden durften.1064
Die gesundheitliche Betreuung der Kinder erfolgte durch den Bau von Kinderpolikliniken, gleichzeitig verringerten Schwangerenberatungsstellen die Säuglingssterblichkeit.
Des weiteren wurde den Frauen zugesichert:
-das Rückkehrrecht auf den vorherigen Arbeitsplatz nach der Freistellungszeit vor und nach der Geburt, die Zahlung von einer einmaligen Geburtenbeihilfe,
-die Gewährung von zinslosen Ehekrediten,
-Kinderkrippen für Kinder bis zum Alter von 3 Jahren,
-eine außerschulische Betreuung für Kinder,
-Ferienbetreuungen für Kinder.1065
Während in den westlichen Ländern die Familie weiterhin prägend für das Lebensschicksal war, entstanden nun in Ostdeutschland Erziehungseinrichtungen (Krippen, Horte), die die Form des Aufwachsens in der Familie, wie sie in Westeuropa besteht, veränderten, die Mütter entlasteten und familiale Aufgaben auf gesellschaftliche Einrichtungen übertrugen.
Familie und Betrieb waren aufeinander bezogen und stellten ein funktionierendes Räderwerk dar,1066 um den Organisationsdruck im Alltag und die Zerrissenheit zwischen Job und Familie, die Frauen erleben, zu vermeiden. Beruf und Familie waren nicht mehr strikt getrennt, nicht selten fühlten sich die Kollegen privat miteinander verbunden und empfanden den Arbeitsort als zweite Familie.
Ob sich aber durch die „patriarchalische Gleichberechtigungspolitik“, die Lebenssituation der Frauen in Beruf und Familie verbesserte, bleibt fraglich.1067
Die Qualifizierungskampagne für Frauen machte es möglich, Frauen von jetzt an entsprechend ihrer Leistungen und Fähigkeiten einzusetzen. Unterstützt von Presse, Funk und Fernsehen sprach man insbesondere junge Frauen an, um in einer Zeit knapper Arbeitskräfte, Reserven zu erschließen und sie mit der emanzipatorischen Vision von Seiten des DFD (Demokratischer Frauenbund Deutschlands) nicht nur für ein paar Jahre zur Arbeit zu bewegen. Sie sollten, so war das Ziel, höhere Qualifikationen erlangen, damit sie später Führungs- und Leitungspositionen einnehmen konnten. Der Grad der Emanzipation wurde abhängig gemacht vom Qualifikationsstand der Frauen.1068
Betriebe waren verpflichtet, Frauenförderpläne zu entwickeln und Frauen zur Weiterbildung freizustellen, so dass Frauen ihre Berufsausbildung in Abendkursen und Sonderlehrgängen nachholen konnten. Anfangs vermieden viele Frauen solch eine Belastung der beruflichen Weiterentwicklung und nutzten ihre Zeit lieber für die Familie und die Erziehung und Förderung der eigenen Kinder, eine aus der Geschichte bekannte geschlechtstypische Arbeitsteilung.
Man qualifizierte Frauen für Tätigkeiten in technischen Berufen, in der Elektrotechnik und der Chemieindustrie, zur Facharbeiterin in mittleren und leitenden Funktionen, wobei man sich auch bei diesen Kampagnen in den Betrieben nicht selten mit Vorurteilen und einem Überlegenheitsgefühl der Männer auseinandersetzen musste.
Bereits in den Schulen lenkten Lehrer die Interessen der Mädchen verstärkt auf technische und naturwissenschaftliche Berufe. Trotzdem hielt sich die geschlechtsspezifische Aufteilung der Arbeitswelt in männliche und weibliche Berufstätigkeit hartnäckig: Frauen waren eher in den Bereichen Erziehung und Gesundheitspflege beschäftigt oder in den unteren Lohngruppen, während in den höheren Lohngruppen mehr Männer zu finden waren,1069 z.B. gab es in der Büromaschinenfabrik überwiegend männliche Arbeiter mit Männern in Führungspositionen.
Auf dem Hintergrund des Arbeitskräftemangels ging mit den beruflichen Weiterqualifizierungsmaßnahmen für Frauen zumeist eine bessere Entlohnung einher, nicht so in der Textilindustrie und anderen weiblich dominierten Berufssparten, dort gab es weiterhin niedrigere Löhne als in männlich dominierten Arbeitsbereichen.
Eine Verbesserung der Vereinbarkeit von Teilnahme an Qualifizierungen und Familienpflichten folgte durch die Verabschiedung des Familiengesetzbuches (FGB) 1966. Darin wird die Gleichverpflichtung der Ehepartner für die Aufgaben im Haushalt und für die Kindererziehung erklärt: In §9 werden die Ehepartner verpflichtet „über alle Angelegenheiten des gemeinsamen Lebens und über die Entwicklung des einzelnen zu beraten und eine gemeinsame Entscheidung herbeizuführen“.1070 Ehemänner hatten den Vorteil der Qualifizierung zu erkennen und notwendige gleichberechtigte Mitarbeit im Haushalt zeigen.
Mitte der 60er Jahre lag der Beschäftigungsgrad der Frauen mit gleicher Qualifikation bei 80%.1071 Frauen entwickelten Stolz und Selbstbewusstsein aus ihrer eigenen wirtschaftlichen Unabhängigkeit, sie begannen sich etwas zuzutrauen, machten nicht selten „Eingaben“ zu öffentlichen Belangen oder beteiligten sich aktiv in verschiedenen Angelegenheiten.1072
Berufsarbeit in Vollzeitbeschäftigung wurde zum sinn- und identitätsstiftenden Moment. Die meisten Paare praktizierten ein doppeltes Vollzeitmodell: Hier war nicht der Mann mehr der alleinige Ernährer. Das Zwei-Phasenmodell oder Drei-Phasen-Modell wie in Westeuropa war unbekannt, es dominierte die kontinuierliche Vollbeschäftigung, unterbrochen durch die einjährige Freistellung nach einer Geburt.
(ER)
Wie sehr die gesellschaftlichen und sozialpolitischen Bedingungen die Art der Doppelorientierung von Beruf und Familie prägten, lesen wir in Ruges Roman: Nahezu alle Frauen der erzählten Generationen waren ständig berufstätig, und damit unterschied sich ihre Lebensqualität von der der Frauen in den anderen Romanen.
Charlotte, Irina und Melitta sind Muster des sozialistischen Frauen- und Mutterbildes.
Charlotte war als Redakteurin in Mexico und als Institutsleiterin, Dozentin und Rezensentin in der DDR tätig: S. 37
… .seit man sie als Chefredakteur abgelöst hatt…
S. 41
Charlotte sollte als Direktorin das Institut für Literatur und Sprachen an der demnächst zu gründenden Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft übernehme…
S. 115
Sie war seit fünf Uhr morgens auf den Beinen. vor der ersten Briefkastenleerung hatte sie noch einmal, ein letztes Mal, den Artikel durchgesehen, den der Genosse Hager bei ihr bestellt hatte. Am vormittag zweimal zwei Stunden Spanisch. Nach dem Mittag das Realismus-Seminar: Fortschrittliche Literatur Nordamerika…
Sie packte die Kontrollarbeiten ein, die sie am Vormittag hatte schreiben lasse…
Irina war in Russland Sanitäterin und Zeichnerin, arbeitet später in der DDR bei der DEFA:
S. 78
Andererseits hatte Mama im Krieg gekämpft: gegen die Deutsche…
- Hast du welche totgeschosse…
Nein, Saschenka, ich habe nicht geschossen. Ich war Sanitäteri…
S. 2…
- Damals war sie Zeichnerin im Projektierungsbüro gewese…
S. 133
… .während Irina noch immer nicht ihre Ausbildung als Dokumentaristen beendet hatt…
S.167
Seit Irina - er wusste im Grunde gar nicht, als was - bei der DEFA arbeitete. Angeblich war es eine Halbtagsstelle, aber in Wirklichkeit arbeitete sie oft bis in die Nacht oder am Wochenend…
Melitta, die wie Sascha studiert hatte, arbeitet in der Wende-Zeit selbständig als Töpferin, später als psychologische Kraft in der Forensik:
S. 251
Was Irina bisher über die Neue wusste, war wenig: dass sie Melitta hieß (wie die Filtertüten im Westfernsehen) und dass sie, wie Sascha auch, an der Humboldt-Universität studiert…
S. 264
Beim Kaffeetrinken gab es noch eine Überraschung, nämlich dass die Neue Psychologie studierte. Nicht Geschichte wie Sasch…
S. 270
Sein Zimmer lag im mittleren Teil des Vierseitenhofs, der eigentlich nur drei Seiten hatte, direkt über der Werkstatt, manchmal hörte er abends noch die Töpferscheibe grummel…
S. 372
Seit sich mit der Keramik nichts mehr verdienen ließ, arbeitete sie wieder als Psycho in der Floristik oder wie das hieß (irgendwas mit durchgeknallten Verbrechern)…
Als Kindheitserfahrung entscheidend ist für Sascha die Erwerbstätigkeit der Mutter, aber ebenso erlebt er sie als die für die Erziehung und Hausarbeit zuständige Person, so dass sich auch dieses Stereotyp verinnerlicht und erhalten bleibt.
S. 77
Dann waren sie schon beim Konsum…
- Willst du mit einkommen, fragte die Mama, oder willst du hier draußen warte…
S. 262f
Abräume…
-Gibt die Teller her und bleibt sitzen, ordnete Irinia an, so bestimmt, dass auch die Neue nicht aufzustehen wagte.…
-Soll ich was helfe…
-Ach, Sascha. Geh mal rein, ich koch jetzt Kaffe…
Sascha nahm Irina an den Schultern, zog sie hoch und drückte si…
Kurt sieht die Berufstätigkeit seiner Frau aus seinem Blickwinkel, eher abschätzig: S. 167
Seit Irina - er wusste im Grunde gar nicht, als was - bei der DEFA arbeitete, kam es öfter vor, dass sie ihn in dieser Weise enttäuschte. Angeblich war es eine Halbtagsstelle, aber in Wirklichkeit arbeitete sie oft bis in die nacht oder am Wochenende, und alles für nichts, denn am Ende verpulverte sie bei alldem mehr Geld, als sie verdiente, dachte Kur…
… Wenngleich es eine höchst seltsame Arbeit war, mit irgendwelchen Schauspielern im Gästehaus der DEFA zu sitzen und Wodka zu saufen. Oder mit diesem Indianer durch die Gegend zu fahre…
Die Berufstätigkeit der Frauen ist in der DDR zu einem kulturellen und politischen Selbstverständnis geworden und für die Frau ein Bestandteil ihres Lebens. Der Mauerbau und die danach folgende Abriegelung vom Westen förderten die Durchsetzung dieser familienpolitischen Konzeption der SED.
Doch wie in allen Industriegesellschaften hatte auch die DDR einen Geburtenrückgang zu verzeichnen. Als Ursachen wären zu nennen: die Sinn-Erfüllung im Beruf und Doppelbelastung der Frau, die Freigabe der Abtreibung, Scheidungen, eine geringe Zahl von Eheschließungen und die Ausgabe von Ovulationshemmern. (Die „Wunschkindpille“ setzte den geplanten und bewussten Kinderwunsch in den Vordergrund und wurde in die Utopie vom neuen sozialistischen Menschen integriert, der von jetzt an frei von ethischen Bedenken als gleichberechtigter Sexualpartner über Mutterschaft entscheiden solle.)
In Folge war es das Ziel der Familien- und Frauenpolitik, die Geburtenrate zu heben. Da eine 2-Kinder-Familie den Rückgang der Bevölkerungszahl zur Folge gehabt hätte1073, wurde die 3-Kind-Familie angestrebt. dies wurde begründet damit, dass „der dauernde Verzicht auf Kinder [und] die gewollte Beschränkung auf ein Kind moralisch in der Regel nicht gerechtfertigt und allzuoft Ausdruck einer kleinbürgerlichen Haltung war.“1074
Man verlängerte den Schwangerschafts- und Wochenurlaub auf 14 Wochen und zahlte finanzielle Unterstützungsleistungen, wie Geburtsprämien, man vergab an Eheleute zinslose Kredite, die „abgekindert“ werden konnten, d.h. nach dem 3. Kind entfielen die Rückzahlungen, das monatliche Kindergeld wurde erhöht, Studierende mit Kind und berufliche Mütter erhielten finanzielle Zuwendungen, hinzu kamen Wohnungsbauprogramme und Wohnungsvergünstigungen.
Diese Maßnahmen zeigten bald Wirkung: Es kam zum Babyboom - und dazu, dass Mütter oft wieder nur Teilzeit arbeiteten und ihren traditionellen Platz in der Familie einnahmen.
In den 70er Jahren galt deshalb dem Abbau der weiblichen Teilzeitarbeit die Aufmerksamkeit. Den Frauen fehlte nach Ansicht der SED das Bewusstsein für die Bedeutung der Berufstätigkeit, die diese für ihre Persönlichkeitsentwicklung und für die Gesellschaft hat. 1075 Stattdessen aber gab es in vielen Familien eine ungleiche Verteilung der Hausarbeit. Engpässe in der Konsumgüterproduktion zwangen Frauen zur Organisation und Fertigung von Produkten und verkürzten damit deren Freizeit. 1076
Es kam zur Verabschiedung weiterer Verordnungen und Fördermaßnahmen:
- Verlängerung des Schwangerschafts- und Wochenurlaubs auf 18 Wochen ( in späteren Jahren auf 24 Wochen),
- die Förderung der Schwangerschaft und Mutterschaft bei Studentinnen mit monatlichen Zahlungen für die studierenden Mütter und die zu betreuenden Kinder. Auf Wunsch von studierenden Müttern wurde das Kind bereits mit 10 Wochen in die Krippe aufgenommen.
Um entsprechende familienpolitische Maßnahmen zu erhalten,1077 bekamen junge Paare außerhalb der Ehe Nachwuchs und der Anteil der nichtehelichen Geburten stieg 1989 auf 34 %.
Die traditionelle Überzeugung, dass Mütter kleiner Kinder in den ersten Jahren nicht berufstätig sein sollten, galt als überholt und die meisten Frauen hatten wegen der stärkeren Berufsbindung nur eine kurze Unterbrechungszeit.
Es folgten weitere staatliche Förderungen, wie
- die Erhöhung der staatlichen Geburtenhilfe,
- eine Gewährung von Krediten zu vergünstigten Bedingungen an junge Eheleute, die materielle Schwierigkeiten verhindern sollten;
- die Verkürzung der gesetzlichen Arbeitszeit für vollbeschäftigte Mütter mit zwei Kindern unter 16 Jahren auf 40 Stunden/Woche;
- die Gewährung eines Babyjahres ab 1976 für das zweite und jedes weitere Kind, ab 1986 auch für das erste Kind, mit 80%tiger Lohnfortzahlung. Kinderreiche Familien mit niedrigem Einkommen wurden gefördert durch Bereitstellung geeigneten Wohnraums und eine Erhöhung des Kindergeldes für das 4. und jedes weitere Kind.
(ER)
Sascha gründet in einer wirtschaftlich nicht abgesicherten Situation eine Familie.
1972 verabschiedete man „Das Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft“, es sah die Fristenregelung vor und ließ die Entscheidung für ein Kind zu einer bewussten Entscheidung werden.
(ER)
S. 293
- Melitta ist die Mutter unseres Enkels, sagte Kurt. Und das haben nicht wir uns ausgesucht. Das war deine Entscheidung. Du wolltest heiraten. Du wolltest ein Kind. Wir haben dir damals abgeraten …
- Richtig, sagte Sascha, ihr habt uns geraten, das Kind zu töte…
- Wir haben dir abgeraten, Hals über Kopf zu heiraten, eine Frau, die du kaum kennst. Wir haben dir abgeraten, ein Kind in die Welt zu setzen mit zweiundzwanzi…
Die Politik forcierte den Ausbau der Einrichtungen für Mütter und Kinder zur Sicherung der Berufstätigkeit. Die Krippenbetreuung (in den 50er Jahren zunächst kurzzeitig diskutiert, dass die Versorgung der Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch die Mutter vielleicht dochökonomischsinnvoller wäre) und die Hortbetreuung der Schulkinder in den Morgenstunden und an den Nachmittagen waren von nun an kostenlos.1078 Aufgrund des Mangels an Plätzen spielten bei der Vergabe von Betreuungsplätzen die Wegezeiten zur Arbeit, die volkswirtschaftliche Bedeutung der mütterlichen Tätigkeit und die Versorgung von Geschwistern eine Rolle. Insofern waren verheiratete Frauen nicht selten noch auf Hilfe im persönlichen Bereich (Großmutter) angewiesen.
(ER)
Sascha Umnitzer erlebt beide Elternteile im Erwerbsprozess, das Wochenende dient dem Rückzug in die Familienleben:
S. 79
Sonntags kroch er zu seinen Eltern ins Bet…
S. 94
Es ist Sonntag. Alexander geht mit seinen Eltern die Straße entlan…
Die Tageseinrichtungen werden von Familie Umnitzer in Anspruch genommen:
S. 76
Dann bekam er ein Buch auf den Kopf. Das war Frau Remschel, sie passte auf, dass man schlief. Wer nicht schlief, bekam ein Buch auf den Kop…
S. 94
Kindergarten. Nun war er schon in der großen Grupp…
Unterstützung kommt aus dem privaten familiären Bereich von Seiten der Großeltern:
S. 80
Die Wochentage: Montag bis Freitag. Und auch das wusste er schon: Es gaben Erstenfreitag und Zweitenfreitag. Zweitenfreitag ging er nämlich zur Om…
In den 80er Jahren differenzierte man den sozialpolitischen Maßnahmekatalog der 70er Jahre: Studentinnen und Lehrlinge erhielten Kindergeld, Absicherungen, Vergünstigungen und ein Krankengeld zur Pflege kranker Kinder.
Doch noch etwas anderes begann in den 80er Jahren: Miss-Wahlen und Erotik im Fernsehen beendeten die Prüderie der vergangenen Jahrzehnte und zeigten die starke Orientierung an westlichen Lebens- und Konsummustern. Die Sexualisierung der Frauenkörper war kein Tabu mehr. 1079 (ER)
S. 269f (1989)
Muddel vor dem Badezimmerspiegel, Augenbrauen zupfend. Er beobachtete schon seit einer Weile, wie sie sich aufmotzte, … und jetzt: Stöckelschuhe auf einmal, die Beinhaare hatte sie sich auch schon weggemacht ..., jetzt rupfte sie sich die Augenbrauen aus, weit vorgebeugt über das Waschbecken, man sah, wie sich unter dem Rock der Schlüpfer abzeichnete, grausam, man sah wirklich alles …
… und er wunderte sich, wie routiniert sie das alles machte, wie gekonnt sie sich jetzt die Lippen anmalte, wie sie danach - mit haargenau denselben Grimassen wie die Tussi - die Lippen aufeinander presste und diese Schnute machte, wie sie das Geld auf den Fingerspitzen verteilte und in die frisch gewaschenen Haare strich …
S. 336f
Kurt schaute zu, wie die beiden von Wilhelms Sessel Aufstellung nahmen, wie Melitta sich zu Wilhelm hinunterbeugte, wirklich knallkurzer Rock. …
All die aufgezählten frauenspezifischen arbeits- und sozialpolitischen Regelungen mit ihren finanziellen Anreizen und bevölkerungspolitischen Motive des Staates unterschieden sich sehr von der Politik des Westens. Sie führten dazu, dass die DDR eine der höchsten Frauenerwerbsquoten der Welt hatte: 91,3% der arbeitsfähigen Frauen waren Ende der 80er Jahre berufstätig1080, und darunter viele Mütter.
Die Frage ist: Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gab esrealiterzwischen den in marktwirtschaftlichen (Westdeutschland/Österreich) Ländern lebenden Frauen und denen in der DDR hinsichtlich ihrer Lebensgestaltung und welche Veränderungen bzw. Entwicklungen fanden wirklich statt.
Die Sozialpolitik der DDR stützte und bevorzugte Mütter. Sie und nicht die Väter hatten das Erziehungsrecht (Väter, die ein uneheliches Kind hatten, wurden sämtliche Rechte im Umgang mit ihrem Kind entzogen). Die Ausklammerung der Väter aus der Sozialpolitik hatte aber allein ökonomische Gründe: Die Sozialpolitik der DDR bezog sich auf die Einkommen, und Männer hätten aufgrund ihres höheren Einkommens eine höhere, sprich finanziell teurere Förderung bekommen müssen.1081 (ER)
S.296
- Aber du kannst dem doch nicht einfach die Wohnung überlasse…
- Vater, die Wohnung bekommt sowieso Melitta zugesproche…
- Aber du verlierst doch dein Anrech…
In Westdeutschland dagegen fand sich eine positive Haltung der Betriebe Vätern gegenüber: Einkommenszuwachs von verheirateten Männer im Zuge der Vaterschaft hatte nicht selten einen beruflichen Aufstieg gerade wegen der Familiengründung zur Folge.1082 Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sollte in der DDR für die Frau und nicht für den Mann möglich gemacht werden, alle Regelungen zur Erleichterung der Vereinbarkeit von Familien- und Berufsarbeit hatten familiäre Rollenzuweisungen zur Folge und zementierten die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in der Familie.
Und noch eins ist zu beachten: Frauen erhielten nicht in gleichem Maße wie die männlichen Facharbeiter Führungspositionen in Führungs- und Managementebene. Sie hatten trotz der Annäherung an das gleiche Qualifikationsniveau der Männer nicht die gleichen Chancen wie Männer. Eine Folge der zentralistischen Planung des Bildungswesens war, dass die Bildungs- und Ausbildungsgänge je nach Erfordernissen gelenkt wurden, und wenn die berufliche Position auch durch das Niveau der (Schul)ausbildung und der Qualifikation bestimmt war, fanden Frauen trotz eines hohen Qualifikationspotentials keine Entsprechung in einem Beruf, wenn die Planwirtschaft für sie keine Umsetzung fand. Aus bestimmten Bereichen und Wirtschaftszweigen wurden Frauen ausgegrenzt bzw. verplant in Bereichen mit hohem Frauenanteil.
Ihre beruflichen Chancen blieben in der DDR hinter denen der Männer zurück. Je höher die Hierarchie, desto geringer war der Frauenanteil und lag z.B. auf den obersten Leitungsebenen bei Direktoren oder Rektoren im Hochschulwesen bei 3%.1083 In den
Bereichen der Kultur dagegen waren Frauen gut vertreten, ihr Anteil als Bürgermeisterin in kleinen Gemeinden war wesentlich höher als in größeren Gemeinden.1084
Ungleiche Karrierechancen in geschlechtstypischen Arbeitsmärkten zeigen im Roman die deprivierte Situation der Frauen am Arbeitsmarkt:
(ER)
Charlotte ist nicht blind für die reale Benachteiligung, die sie erfährt und sieht die Ungleichheit der Geschlechter:
S. 116
- Als Frau, hatte Gertrud Stiller heute beim Mittagessen gesagt, musst du doppelt so viel leisten, um dich durchzusetze…
Sie bekommt die fehlende Durchlässigkeit der geschlechtsspezifischen Segregation zu spüren,. Ihre beruflichen Ambitionen und Leistungen werden nicht belohnt, obwohl für sie die Mitwirkung und Mitbestimmung in der Gesellschaft von großer Bedeutung waren und sie es als ihren Beitrag zum Aufbau der sozialistischen Gesellschaft sah, Literatur in der DDR zu rezensieren.
S. 115f
Autodidakt. … sie als Autodidakt solle sich nicht noch in fremde Fachgebiete einmischen - Harry Zenk auf der großen Leitungssitzung vor einem halben Jahr, als sie, Charlotte, sich bereit erklärt hatte, ein Seminar zum fünfzigsten Jahrestag der mexikanischen Revolution anzubiete…
S. 118
Nein, dachte sie, Madame Zackzack gab nicht auf. Madame Zackzack würde kämpfen. Harry Zenk Prorektor! Na, das wollen wir doch mal sehe…
Die rigide Berufslenkung führt dazu, dass sie sich nicht ihrer Qualifikation entsprechend eingesetzt fühlt. Sie realisiert keinen beruflichen Aufstieg, und wenn sie ihre Stellung mit der ihrer männlichen Zeitgenossen, mit Wilhelm z.B., vergleicht, erkennt sie, wie gering die Chancen für Frauen sind, in Führungspositionen zu kommen.
S. 41f
Wilhelm sollte Verwaltungsdirektor der Akademie werden. …
Wilhelm hatte im Grunde genommen, von nichts eine Ahnung. Wilhelm war Schlosser, sonst gar nicht…
S. 401
Sie war Institutsdirektorin geworden mit vier Jahren Haushaltsschule! Zählte das alles nichts? Zählte nur Wilhelms proletarische Ehr…
Warum es nicht zur Chancengleichheit von Frauen in der DDR kam, lag nicht zuletzt darin begründet, dass alle politischen Entscheidungen von Männern beschlossen wurden.1085 Bereits in dem offiziellen politischen System herrschte Sexismus, lediglich die Frau von Erich Honecker, Margot Honecker, war Vollmitglied im Zentralkomitee.
Eine weitere Erklärung für die geschlechtsspezifischen Berufsstrukturen ist die, dass in den Familien und Bildungseinrichtungen wie in früheren Zeiten geschlechtsspezifisch sozialisiert wurde. Grundsätzlich schätzten Frauen in der DDR den Wert der Familie höher ein als Männer, ein Ergebnis der „historisch erworbenen Einstellungen der Geschlechter“.1086 Die Entscheidung für einen eher berufs- oder eher familienzentrierten Lebensverlauf hatte immer auch Wirkungen auf spätere berufliche Lebensabschnitte. Günstige Bedingungen für die Kombination von Familien- und Berufsarbeit hatten Frauen in pädagogischen oder in Büro- und Verwaltungsberufen, dort gab es vorteilhafte Arbeitszeitregelungen und eine geringe physische Beanspruchung.1087 Orientierte sich die Berufsausübung der Frauen an familialen Erfordernissen, d.h. ordnete sie die berufliche Entwicklung unter, erfuhr sie Benachteiligung in ihrem Berufstätigkeit. Familienbezogene Stellen- und Tätigkeitswechsel angesichts günstigerer Arbeitsbedingungen, räumlicher Nähe etc. waren für sie eine Möglichkeit, Familie und Beruf zu verbinden und mehr Rücksicht auf die Familie zu nehmen, also berufliche und familiale Beanspruchungen aufeinander abzustimmen. Das aber wurde von Seiten der „Arbeitgeber“ negativ und als uneffizient bewertet und schloss einen beruflichen Aufstieg aus.
Der Wunsch auf einen Berufsverzicht nach Ablauf des Babyjahres und derzeitweiseAusstieg aus dem Berufsleben war durchaus auch in der DDR verbreitet, trotz des in der DDR herrschenden Standardmodells.1088 Das hätte einem ähnlich in der Bundesrepublik herrschenden Drei-Phasen-Modell entsprochen, nur wünschten sich die DDR-Frauen hierbei eine kürzere Unterbrechung als im Westen.
Alle sozialpolitischen Maßnahmen, die die Verbindung von Berufstätigkeit, Haushalt und Mutterschaft und damit die Überlastung der Frauen erleichterten, verfestigten demzufolge die traditionellen Rollenbilder der Geschlechter anstatt sie zu überwinden. Man bestätigte die Tätigkeiten der Frau als Hausfrau und die Doppelrolle in Produktion und Reproduktion. Sowohl Mann als auch Frau sollten zwar theoretisch beide zu gleichen Teilen die Verantwortung für die Familie und die Hausarbeit tragen, jedoch sah die Realität auch in der DDR anders aus.1089 Frauen hatten eine betonte Stellung in der Erziehung und Kinderbetreuung,1090 und ebenso wie im Westen lag die familiale Alltagsorganisation und Haushaltsführung neben ihrer Erwerbstätigkeit bei den Frauen, während die Männer selbstverständlich der Berufstätigkeit nachgingen. Nach der beruflichen Arbeit begann für viele Frauen die Arbeit im Haushalt mit diversen Tätigkeiten und Aufgabenfeldern, und diese Arbeit war wegen der Versorgungsmängel eine zeitaufwendige Arbeit!
5. 65f
- Brauche kein Frühstück, äffte Irina ihre Mutter nac…
- Sie verhungert schon nicht, sagte Kur…
Irina winkte ab. Kurt hatte gut reden., er kümmerte sich nicht um Nadjeshda Iwanowna. Er wusste nicht, wie es in ihrem Zimmer aussah:. Kurt musste nicht das Geschirr nachspülen … Er musste nicht die Gurkenepidemie ertragen …
Der Roman zeigt, dass eine Familie moderne und traditionale Merkmale besitzen kann (u.a.: Gleichberechtigung, Offenheit, Hausfrauenrolle).
(ER)
In der DDR-Familie ist Irina, wie traditionell üblich, für die Erziehung des Kindes zuständig und für den Einkauf, verrichtet den großen Teil der Hausarbeit, kocht und fühlt sich für das Wohlbefinden aller zuständig und arrangiert die Wohnungseinrichtung nach ihrem Geschmack. Ihre Gleichberechtigung zeigt sich darin, dass sie einem Beruf nachgeht, den Führerschein hat und Auto fährt. Kurt ist als Historiker tätig, arbeitet hybrid: schreibt im homeoffice und fährt gelegentlich nach Berlin.
S. 77
Dann waren sie schon beim Konsum…
- Willst du mit reinkommen, fragte die Mama, oder willst du hier draußen warte…
- Mit reinkommen, sagte e…
S. 61
Sie hörte Kurt in die Küche zurücktapsen. Herrgott, wie lange brauchte denn dieser Mensch, um ein Stück Käse auszuwickeln und zwei Teller hinzustellen? Und am Ende bildete er sich noch ein, er würde etwas zur Hausarbeit beitragen. Dabei schadete er mehr, als er nutzt…
S. 165
… dass Irina Unsummen ausgab, weil es unbedingt diese Tür, dieses Holz, dieses rot sein musste, aber am Ende, das musste er zugeben, hatte Irina doch irgendwie recht behalten …
S. 167
Irina lächelte still, während sie Kurt Kamillentee eingoss. sie bestand darauf, dass er vor dem Kaffee eine Tasse Tee trank, wegen des Magens, und Kurt tat ihr den Gefalle…
S. 176
In der Nacht rumorte sein Magen. Am Morgen verordnete Irina ihm eine Rollku…
S. 147
Professor war er, fuhr nach Berlin jeden Montag, mit einer Aktentasche, machte da irgendwas, sie wusste es nicht genau, aber von Staats wegen irgendwas, und Geld verdiente er, hatte Ira ein Auto gekauft, das glaubte ihr keiner in Slawa: Die Frau fuhr Auto, und der Mann ging zu Fu…
S. 20
An diesem Tischlein hatte Kurt sein Werk verfasst. Hier hatte er gesessen ..und im ViereinhalbFinger-System auf seiner Schreibmaschine herumgehämmert . Sieben Seiten täglich, das war seine „Norm…
Irina zieht sich im Laufe der Jahre aus sozialen Zusammenhängen zurück. Sie wird ein Wendeopfer und dient als Beispiel für ostdeutsche Frauen, die von Arbeitslosigkeit am stärksten betroffen gewesen sind.1091 (Ein Kognak täte gut, dachte Irina, während der Bundestag ein Gesetz zur Einführung der Mütterunterstützung in den sogenannten neuen Bundesländern beschloss …
S. 358
Von ihrer Rente ganz zu schweigen. Plötzlich sollte sie irgendwelche Arbeitsnachweise aus Slawa erbringen: Was für eine Bürokratie! . Auch ihre Zusatzrente würde sie vermutlich nicht mehr bekommen (die DDR hatte ihr eine Rente als sogenannte Verfolgte des Naziregimes zuerkannt, als Ersatz für die Ehrenrente, die sie als „Kriegsveteranin“ in der Sowjetunion bekommen hätte): Kaum anzunehmen, dass die westlichen Behörden sie dafür belohnen würden, dass sie als Gefreite der Roten Armee gegen Deutschland gekämpft hatt…
Fazit: Eine Gleichberechtigung der Frauen war in der DDR nicht realisiert, es wurde weder die Arbeitsteilung von Frauen und Männern bei der Erziehung noch die Wahlmöglichkeit für Männer gewährt. Die Verbindung von Berufstätigkeit und Mutterschaft (,werktätige Frau und Mutter’ war die Sprachformel) war das emanzipatorische Ideal - trotz einer damit verbundenen zeitlichen Belastung der Frauen und der typischen geschlechsspezifischen Arbeitsteilung. (Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang der monatlich bezahlteHausarbeitstagfür vollbeschäftigte Frauen, wenn sie verheiratet waren und Kinder bis 18 Jahren hatten oder wenn sie älter als 40 Jahre waren!) „Die wirtschaftliche Effizienz des Systems ging vor allem auf Kosten der Frauen, speziell derjenigen mit Haushalt und Kindern.“1092
Die propagierten Ideale, Anspruch und Wirklichkeit von Gleichberechtigung klafften weit auseinander. Der Verhaltenswandel bei den Männern war begrenzt, sie hatten ihre Einstellung zur Arbeitsteilung nicht geändert und Geschlechtsrollen, Stereotypen, d.h. das Geschlechterverhältnis blieben auch in der DDR bestehen.
(ER)
Für den männlichen Partner war die Beteiligung an der Hausarbeit optional, so wie für Kurt:
S. 59
Aber Kurt bestand darauf, dass sie liegen blieb, bis er den Kopf durch den Türspalt steckte und sie mit kindlicher Stimme zum Frühstück rie…
Der Grundsatz der geteilten Haushaltsführung ist zu erkennen, doch traditionelle Einstellungen Irinas verhindern dessen Durchsetzung:
S. 56
Kurt ging zurück in die Küche. … Seit neuestem hatte Kurt sich in den Kopf gesetzt, dass er am Wochenende das Frühstück machte - wohl um zu beweisen, dass er für die Gleichberechtigung wa…
Jedoch fühlten sich die Frauen deshalb nicht ungleichberechtigt, sie empfanden einen hohen Grad der Partnerschaftlichkeit trotz der geschlechtstypischen Aufgabenverteilung im Haushalt.
(ER)
Dass Geschlechtsrollenstereotype in den oberen Schichten und bei höherer Bildung eher abgebaut werden und ein partnerschaftliches Geschlechterverhältnis praktiziert wird, zeigt die zweite Ehe von Melitta: die Zuständigkeit für Erziehung und Haushalt liegt bei Mann und Frau.
S. 376f
… und erschien in der großen, bei der Renovierung noch um das Doppelte vergrößerten Wohnküche, wo Muddel und Klaus schon kochten (das heißt, Klaus kochte, und sie durfte irgendwas schnibbeln) …
21. Lebensformen neben der klassischen Familie
Im Wandel der Zeiten: Famil…
Großmutter heiratete und hatte viele Kinde…
Tochter allein erziehende Mutter mit einem Kind, Enkelin heiratet nicht und will auch keine Kinde…
Willy Meurer (1934-2018), deutsch-kanadischer Kaufmann, Aphoristiker und Publizist, M.H.R (Member of the Human Race), Toron…
Das familiäre Leben ist wie vieles andere Wandlungsprozessen unterworfen. Bereits für vorhergehende Epochen und Gesellschaften war es kennzeichnend, dass von der Kernfamilie abweichende Lebensformen existierten. Die Gründungsanlässe waren andere als heute, und oft waren es nicht frei gewählte Lebensformen, sondern bedingt durch Lebensphasen, Beruf oder eingeschränkte Wahlmöglichkeiten.
In den Romanen bestehen solche facettenreichen Formen von Familie und Typologisierungen neben dem traditionalen Modell von Familie: In der Familie Buddenbrook lesen wir von Trennung und Scheidung, Wiederverheiratung, Stiefelternschaft, Verwitweung...
Sascha(ER) und Philipp(AG) wiederum sind Beispiele dafür, dass Autonomie und Selbstverwirklichung oftmals die Familiengründung verhindern.
Heute ist die traditionelle Vorstellung von Familie, d.h. die biologisch-genetische ElternKind-Einheit mit formaler Eheschließung nur eine Familienform unter vielen, und der Einzelne hat die individuelle Freiheit zwischen den Formen des Zusammenlebens auszuwählen ohne einer Tradition verpflichtet zu sein.
Pessimistische Einschätzungen über die gegenwärtige Situation der Familie gehen heute sogar so weit zu behaupten, deren Ende nahe, doch ist die Familie als Lebensform trotz sozialen Wandels für viele Menschen nach wie vor attraktiv,1093 weil freundschaftliche Beziehungen im Unterschied zu familiären Beziehungen ein größeres Bestandsrisiko haben.1094
Heute werden 14 Erscheinungsformen von Familie nachgewiesen. Sie entstehen durch Geburt, Scheidung, Verwitweung und Wiederheirat und können dynamische Familienprozesse darstellen, z.B. in Ein-Eltern-Familien durch Scheidung oder Tod des Partners, in Vater- oder Mutterfamilien, nichtehelichen Gemeinschaften, Wiederverheiratungen und gleichgeschlechtliche Beziehungen.1095
Sie alle besitzen moderne und traditionale Merkmale (Gleichberechtigung, Offenheit, Hausfrauenrolle).
Folgende unterschiedliche Typologien von Familie finden sich in den Romanen:
21.1 Nichteheliche Lebensgemeinschaften
Die Veränderungen im Partner-, Ehe- und Familienleben zeigten sich in neuen Lebensgemeinschaften und Lebensformen, so lebten von nun an Partner auch ohne Trauschein in einer gemeinsamen Haushaltsführung mit oder ohne Kindern zusammen, oder junge Menschen gingen eine Probeehe ein, wo sich ein Zusammenleben zunächst bewähren musste und die als eine „Orientierung auf die Ehe“ hin verstanden wurde.1096 Das Zusammenleben unter Alltagsbedingungen mit geteilten Pflichten und Belastungen sollte die Haltbarkeit einer Beziehung aufzeigen, scheiterte die Beziehung, war es leichter sich zu trennen.
Die Institution Ehe erlebte, sowohl in Westdeutschland als auch in der DDR einen „Exklusivitätsverlust“.1097 Die nicht-eheliche Lebensgemeinschaft war aufgrund der sozialistischen Familienpolitik, die alleinstehenden Müttern Vergünstigungen gewährte, eine frei wählbare Lebensform.
(ER)
Sascha wählt diese Lebensform mit der Partnerin Christina während der NVA-Zeit und auch in späteren Jahren, sie hat episodenhafte Züge:
S. 222
… .das Mansardenzimmer Christinas Mansardenzimmer seine „Heimatadresse“, seit er vor fast einem Jahr hier eingezogen war (noch als Schüler und unter dem Protest seiner Eltern), und jetzt doch wieder Christinas Zimmer: Vom ersten Augenblick an fühlte er sich wie zu Besuc…
In den westlichen Ländern nahmen nichteheliche Lebensgemeinschaften in den 70er Jahren zu, als der gesellschaftliche Wandel „offene Familiensysteme“ mit dem Merkmal einer neuen Rollenverteilung entstehen ließ. Heute sind sie, mit dem erhöhten Erstheiratsalter, zu einem Merkmal unserer modernen Gesellschaft geworden.
Die Motive für solch eine Lebensform sind unterschiedlich: Während früher Lebensgemeinschaften oftmals ökonomisch motiviert waren, entstehen sie heute aus der freien Entscheidung heraus als Alternative zur Ehe. Solch eine eheähnliche Gemeinschaft kann auf Dauer sein, mit oder ohne Heiratsabsicht, mit gemeinsamem Bekanntenkreis, gemeinsamer Kasse und gemeinsamen Kindern, sie kann aber auch die Unabhängigkeit mit getrennten Lebensumfeld und finanzieller Unabhängigkeit als Merkmal haben, d.h. Living-apart-together, temporär angelegt oder als notweniges Zwischenstadium zum gemeinsamen Haushalt.
Ältere Paare in nichtehelichen Lebensgemeinschaften haben häufig Scheidungserfahrung oder den Tod eines Partners miterlebt und sind einer erneuten Eheschließung gegenüber skeptisch.
(ER)
S. 222
… aber auch sein Mansardenzimmer seine „Heimatadresse“ seit er vor fast einem Jahr hier eingezogen wa…
S. 360
Irina hatte Catrin zum letzten Mal im Sommer gesehen, und sie erinnerte sich jetzt, dass ihr schon damals eine Wandlung aufgefallen wa…
S. 26
Hatte eine unbestimmte Anzahl Frauen gevögelt (deren Namen er nicht mehr zusammenbrachte). Hatte sich nach einer Zeit des Umherstreunens - wieder auf so etwas wie eine feste Beziehung eingelassen…
(AG)
Philipp hat seit mehreren Jahren eine Beziehung mit Johanna, sie ist verheiratet, hat ein Kind. Es besteht kein gemeinsamer Haushalt und keine Hoffnung auf eine zukünftige Ehe, es gibt lediglich Besuche von Johanna. Sie hat nicht die Absicht, sich von ihrem Mann zu trennen.
S. 13
Er sieht nicht ein, worüber Johanna sich beklagen will. Immerhin ist sie es, die es nicht schafft, sich von Franz zu trennen. .. Er braucht keine Geliebte, die nur jedes zweite mal mit ihm schläf…
S. 92
Johannas Ruf: Ich will dich nicht verlieren, ich trenne mich von meinem Mann! Darauf die kurze Hoffnung, dass sie es wirklich und wahrhaftig tun wird, und unmittelbar danach das Gelächter der Wiederholung ., weil der Vorsatz auch diesmal vorübergehen wird wie eine Grippe, wie eine Halluzinatio…
21.2 Ein-Eltern-Familien
- durch Scheidung
In Preußen nannte man Haushalte, in denen verlassene, verwitwete, geschiedene Elternteile mit Kindern lebten „unvollständige Familienhaushalte“.1098 Der Begriff „unvollständig“ wies hier deutlich auf einen Mangel und einen Makel hin.
In den letzten Jahrzehnten fand die Ein-Eltern-Familie in den westlichen Ländern eine wachsende Verbreitung, entweder als eine bewusst gewählte Lebensform oder als ein Durchgangsstadium, unfreiwillig entstanden, nicht auf Dauer angelegt, mit einer festen Partnerbeziehung endend oder aufgrund von Scheidung.
Die heutige Definition dieser Familienform benennt verschiedene Entstehungsursachen von Ein-Eltern-Familien: Man unterscheidet „ledige, verheiratet getrennt lebende, geschiedene oder verwitwete Väter und Mütter, die mit ihren minder- oder volljährigen Kindern Zusammenleben. Es ist unerheblich, ob außer dem allein erziehenden Elternteil und den Kindern noch weitere Personen im Haushalt leben.“1099 (TM)
Für Tony als alleinerziehende Frau, die nach ihrer ersten und zweiten Ehe mit ihrer Tochter Erika zu ihren Eltern zurückzieht, ist es eine durch die Schicksalsschläge erzwungene Lebensform. Für Erika bedeutet die Trennung der Eltern die Rückkehr ins Haus der Großeltern und in ihre Heimatstadt.
S. 393
Dann kam der Tag, an dem die Scheidung rechtskräftig und endgültig ausgesprochen wurde, an dem Tony die letzte notwendige Formalität erledigte. und nun galt es, sich an die Sachlage zu gewöhne…
Sie tat es mit Tapferkeit. .; sie hatte. Erika, auf deren vornehme Erziehung sie Sorgfalt verwandte und in deren Zukunft sie vielleicht letzte heimliche Hoffnungen setzte. So lebte sie, und so entschwand die Zei…
In der DDR galt das „Alleinerziehen“, wie wir gelesen haben, als eine gleichberechtigte und nicht defizitäre Lebensform. Nicht selten gab es nacheheliche Partnerschaften (mit Kindern), in denen ein Partner geschieden war.1981 wohnten 14% der Kinder unter 17 Jahren in der DDR mit nur einem Elternteil zusammen.1100
Oft werden Ein-Eltern-Familien (Alleinerziehende) mit einer Defizitannahme für die Kinder versehen. Die Kontaktmöglichkeiten zum Elternteil, das aus der Hausgemeinschaft ausscheidet, reduzieren sich zwar, was aber nicht gleichzeitig bedeuten muss, dass sich das Eltern-Kind-System auflöst. Zumeist ist der Vater abwesend, und da sowohl er als auch die Mutter wichtige sozialisatorische Funktionen für die Kindern haben, kann es durchaus beim Kind zu emotionalen Schäden, schlechten Schulleistungen kommen. Der Wegfall eines Elternteils löst oftmals das Gefühl des Verlassenwerdens, der Trauer oder Wut aus, wie bei Markus, dem Sohn von Sascha Umnitzer. Kinder erleben dann nicht selten eine symbiotische Beziehung der/des Alleinerziehenden, der/die als Haupterzieher/ in die eigenen emotionellen Bedürfnisse auf das Kind überträgt.
(ER)
Kap 1. Oktober 1989 S. 269ff
Die Erfahrung von Scheidung und Trennung der Eltern verringern die Familienorientierung von Markus. Er misstraut der Verlässlichkeit der Vater-Beziehung und reagiert mit aggressivem Verhalten.
- durch Tod
Der Tod des Ehepartners unterscheidet sich von der Scheidung insofern, dass der Partnerverlust unwiederbringlich ist und diese Endgültigkeit oft Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit mit sich bringt. „Hinzu kommt, dass die Emotionalisierung und Intimisierung der modernen Ehe eine Verstärkung des Verlustschmerzes ...nach sich zieht.“1101 (TM)
Gerda erfährt nach dem Tod ihres Mannes üble Nachrede und materiellen Verlust:
S. 697
Unbestimmte und übertriebene Gerüchte über die ungünstige Liquidation gingen um, und sie wurden genährt durch die Nachricht, dass Gerda Buddenbrook das große Haus zu verkaufen gedenk…
(AG)
Eine Zäsur in der Familie von Peter zeigt sich nach dem frühzeitigen Tod von Ingrid. Peter gehört mit seiner Witwerschaft der Minorität der Vater-Familien innerhalb der alleinerziehenden Eltern an; Ein-Eltern-Familien entstehen zumeist aufgrund von Scheidung, und nur im seltenen Fall, durch Verwitwetsein. 1102
Peter hat das Gefühl, etwas Unwiederbringliches verloren zu haben und spürt das Unvermögen, die Vergangenheit wieder gut zu machen. In der Reflexion und dem Sicherinnern erkennt er, warum er und Ingrid sich selbst nicht glücklich machen konnten.
S. 303
… und dass die Zutaten für ein haltbares Glück nicht gereicht hatten und dass wenigstens Sissi alt genug war, die Misere mitzubekommen. Und er weiß auch, dass die Jahre vor Ingrids Tod die am wenigsten erfolgreichen Jahre seines Lebens waren, das will was heißen …
S. 299f
Die Male, dass die Kinder Ingrid erwähnen, unvermittelt, Sätze wie dieser, werden von Jahr zu Jahr weniger, und auch der Schmerz lässt nach, den diese Sätze aus einem stillen Gären wecken. Und Peter wünschte, dass Ingrid zurückkäme, um zu sehen, wie er sich verhält, … dass sie wieder eine Familie wären und die Welt so schön wie in einem Album, .. dass sie glücklich wären bis ans Lebensend…
Wenn er sich diese Momente ins Bewusstsein ruft, … überkommt ihn eine abscheuliche Stimmung, da fühlt er ein nagendes Gefühl im Magen, und er hätte am liebsten, dass dem Auto Flügel wüchsen, so unangenehm, so bedrückend ist ihm, was er nicht ungeschehen machen kan…
Dieses „Verlusterlebnis“1103, der Tod des Partners bzw. der eines Elternteils für die Kinder, ist stets verbunden mit schmerzhaften Gefühlen, Verzweiflung, Verlassenheitsangst und Traurigkeit und kann erst nach einer intensiven Trauerarbeit als Schicksal angenommen werden:
Peter erwartet nach dem Unfall nun nur noch das Schlimmste, vorbeugender „Pessimismus“ und Desillusionierung sollen weitere Enttäuschungen verhindern.
Kritische Lebensereignisse ähnlich diesem hatte Peter im Laufe seines Lebens bereits bei dem Tod seiner Mutter erlebt. Er hat sie überstanden und damit schon eine gewisse Einübung in die Fertigkeit, solche Erlebnisse zu bewältigen. Seine Beziehung zu seiner Mutter war geprägt gewesen von intensiver Nähe. Die Übernahme von Hausarbeitspflichten während ihrer Erkrankung hat er sich in früher Kindheit bereits angeeignet.
S.111 (1945)
Dazu ein Vollalarm nach dem anderen, kein Gas, kein Licht, die jüngste Schwester oft am Weinen und wieder am Bettnässen, die Sorge um das Heizmaterial, um Kalorien, um Schmerzmedikamente, weil alles Morphium an der Front is…
S. 129
Er wurde allenfalls als kompetent für Gänge außerhalb angesehen. Und dann erwartete die Mutter, das er, von diesen Gängen zurück, ihre Hand hielt und erzählte. Aber er hatte nichts zu erzählen angesichts dessen, dass die Mutter star…
- Erzähl, wie ist es draußen, Pete…
- Da ist nichts Besonderes, alles wie imme…
Dennoch ist die Situation nach dem Tod von Ingrid ist für ihn eine Herausforderung. Er muss Stärke und besondere Qualitäten zeigen, um den Alltag ökonomisch zu gestalten: Bisher nur mitverantwortlich, trägt er jetzt die Alleinverantwortung für alle Bereiche des täglichen Lebens.
S. 290
Seit Ingrids Tod hat er sich ein par Strategien zurechtgelegt, wie er mit den Kindern über die Runden komm…
Auf Ressourcen in materieller und persönlich-sozialer Hinsicht und ein soziales Netzwerk kann er zurückgreifen. Unmittelbar nach dem Tod werden in dieser psychischen Ausnahmesituation familiär-verwandtschaftliche Kontakte, insbesondere die der Schwiegereltern/Großeltern, intensiviert, so dass Peter emotionale Unterstützung und instrumentelle Hilfe erhält. Generell erlebt er positive Reaktionen der Umwelt. In seiner Situation als Witwer ist er ein Exot und löst Hilfsbereitschaft aus.1104 Alleinerziehend erhält er eine besondere Wertschätzung von der Umwelt, die die Erziehung durch Männer als eine außergewöhnliche Leistung ansieht.1105 Anfängliche Selbstzweifel reduzieren sich. Peter funktioniert beruflich und privat.
S. 302
Und er wünschte, dass Ingrid zurückkäme, um ihm beizupflichten, wie gut sie es jetzt haben könnten, denn seither ist vieles geschehen und anders geworden, die Zeit hat so manches geregel…
Isolation, ein Problem der modernen Kleinfamilie, wirkt oftmals verstärkend auf die Krise innerhalb der Familie nach dem Tod eines Elternteils und auch Peter, per se ein Einzelgänger, lebt zurückgezogen.
Sissi und Philipp wachsen nun in einer Vaterfamilie auf. Zunächst traurig ob der fehlenden Präsenz der Mutter, doch Peter wird zum aktiven Vater und verbringt die meiste Zeit wie selbstverständlich mit Kinderbetreuung und lässt sie so den Tod der Mutter zeitweise vergessen. Während er sich in die neue Lebensform „Vaterfamilie“ einlebt, toleriert er vieles bei seiner pubertierenden Tochter, nimmt vieles hin.
Mit der alleinigen Verantwortung verändert sich die Rollen- und Interaktionsstruktur zwischen ihm und den Kindern. Ihr Beziehung wird intensiver als vorher und ist von emotionaler Nähe geprägt. Er nimmt die Bedürfnisse der Kinder wahr und eignet sich soziale und alltagspraktische Kompetenzen an, ist tolerant, fürsorglich und offen im Umgang mit ihnen, gefühlsbetont und humorvoll.
Neue Formen der Kommunikation entstehen: Peter fühlt sich (als Teil der mittleren Generation) nicht dem autoritären Stil verpflichtet und will sich so verhalten, „wie ich es mir von meinen eignen Eltern gewünscht hätte.“
S. 290
Er bemüht sich, seinen Kindern innerhalb vernünftiger Grenzen den größtmöglichen Spielraum zu gewähren. … solange er sich keine Sorgen macht (dieses Recht werden sie ihm hoffentlich zubilligen), redet er den Kindern nicht drein. Und wenn eines der Kinder unbedingt seine Meinung hören will, versucht er, diese möglichst neutral zu formulieren, damit er sich nicht vertu…
„Der verwitwete Vater ist vielleicht infolge seines Kummers allzu nachsichtig...“1106 Peter hinterfragt seine liberale und Kräfte zehrende Erziehung:
S. 289
„Man müsste sie für zwei Wochen zu einem ihrer Großväter schicken, … da kämen sie schon nach der halben Zeit zurück, hoffentlich mit bescheideneren Ansprüchen und objektiveren Begriffen von dem, was man unter liberal zu verstehen hat…
Die Auffassung der Tochter dazu unterscheidet sich:
S. 289
- Du bist nur liberal, solange es für dich bequem is…
Zwischen Vater und Tochter herrscht eine besondere Beziehung: Das Erziehungsverhalten des Vaters unterstützt ihre Selbstbestimmung. Die frühe Selbständigkeit zeigt sich in der Heirat und dem Wegzug in die USA .
Der Tod eines Ehepartners löst eine Idealisierung und Mythologisierung der/des Verstorbenen aus, was in psychologischer Sicht problematisch bei der Verbreitung des Todes sein kann.1107 Die Schmerzerfahrung ist zu groß, als dass Peter sich langfristig auf neue soziale Beziehungen einlässt. Die Beziehung zu Ingrid hatte in einer schweren Zeit für ihn begonnen und birgt viele Erinnerungen. Um ihr Bild in Ehren zu halten, geht er keine sichtbare feste Partnerschaft mehr ein und versteckt ein kurzzeitiges Verhältnis mit einer verheirateten Frau vor seinen Kindern.
S. 307
Manchmal schläft er mit einer Bibliothekarin der Technischen Universität. Aber weil die Frau verheiratet ist, kommt es ihm als eine Angelegenheit vor, die ihn zu nichts verpflichtet. Eine Mittagspausenbeziehung, die er vor seinen Kindern geheimhält. Kleines Versteckspiel. Bei anderer Gelegenheit, als er weniger umsichtig war, ist er schuldig gesprochen worden, mit seinem noch nicht abgestumpften Interesse an Frauen, das Ansehen der verstorbenen Mutter herabzusetze…
Peter ist als Alleinerziehender weiterhin Erwerbsperson, er kann es sich nicht leisten, nicht zu arbeiten. Seine wirtschaftliche Situation scheint nicht problematisch zu sein, denn er ist in der Lage von seinen Einkünften den gemeinsamen Urlaub mit seinen Kindern zu finanzieren.
So findet er eine Balance zwischen Berufs- und Familienleben und kann, da seine Arbeit ein selbstbestimmtes Arbeitszeitregime mit zeitlicher und örtlicher Unabhängigkeit ermöglicht, die Lebensbereiche Beruf und Familie integrieren - die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Vaterrolle funktioniert.
21.3 „Stieffamilien“
Die Lebensform „Stieffamilie“ entsteht durch die Trennung und Wiederverheiratung von Ein-Eltern-Familien und trägt oftmals die Züge einer patchwork-Familie, in der die Lebenspartner Kinder mit in die neue Beziehung bringen. Dies gab es bereits im 19. Jahrhundert im Bürgertum:
(TM)
Ein Beispiel dafür ist Tonys Wiederverheiratung. Ihre Tochter Erika scheint sich mit den Familienentscheidungen ihrer Mutter abzufinden. Wir hören nichts davon, wie ihrer Mutter die Zusammenführung der Familie mit Herrn Permaneder glückt, und ob Erika noch Kontakt oder Loyalittätskonflikte zum leiblichen Vater hat, wird nicht explizit erzählt. Die neue Eheschließung der Mutter lässt sie aber sicher nicht gleichgültig.
S. 355
Die Konsulin war unterrichtet darüber, und in einem ausführlichen Gespräche zwischen ihr, Herrn Permaneder, Antonie und Thomas, welches gleich am Abend des Verlobungstages im Landschaftszimmer stattfand, wurden ohne Hindernis alle Fragen geregelt: auch in Betreff der kleinen Erika, welche, auf Tonys Wunsch und mit dem gerührten Einverständnis ihres Verlobten ebenfalls nach München übersiedeln sollt…
Die Form der „Stief-Familie“ war in der DDR recht häufig und findet sich auch in Ruges Roman.:
(ER)
Kap 1995, S. 371ff:
Saschas frühere Frau Melitta geht eine neue Ehe ein und Markus wird Teil einer Stief- Familie. Für Markus ist die Familie mit dem leiblichen Vater noch präsent, obwohl die neue Ehe seiner Mutter und der Stiefvater als eine für ihn fremde Person ihm die Unwiderruflichkeit der neuen Beziehung zeigt.
Die Beziehungen zu der Familie des leiblichen Vaters lösen sich nach und nach auf, und mit der neuen Partnerschaft der Mutter geht auch die enge symbiotische Mutter-KindBeziehung zu Ende.
Die attraktiven Eigenschaften des Partners (hohes Bildungsniveau, Politiker, MdB) bringen seiner Mutter einen hohen Nutzen. Ihr neuer Mann befindet sich in einer guten ökonomischen Lage und sie profitiert von dem zusätzlichen Einkommen und der neuen Betreuungsperson. Die Probleme mit Markus haben wiederum einen negativen Einfluss auf das Partnerschaftsverhalten.
Markus hat nicht mehr das Gefühl, selbst über sich zu entscheiden und fühlt sich bevormundet von seinem einflussreichen Stiefvater, der sich in die vertraute Beziehung zwischen ihm und seiner Mutter gedrängt hat.
5. 378f
Beim Essen nervte Klaus wieder mit Politik, genauer gesagt, mit kleinen Geschichten, mit denen er sich wichtig machen wollte: Wen interessiert es, was Helmut Kohl letzte Woche beim Mittagessen gesagt hatte . Markus hörte gar nicht hi…
… aber Muddel regte sich plötzlich auf ..und wie dankbar er sein müsse, dass Klaus ihm die Lehrstelle besorgt hätte blablabl…
- Ich habe ihn nicht drum gebeten, sagte Marku…
„Die Stieffamilie ist in unserer Gesellschaft auch durch fehlende Rollendefinitionen gekennzeichnet. Von alten Vorstellungen, wie sie in Märchen dargestellt werden, belastet, wissen Stiefeltern nicht, was von ihnen in ihrer Rolle erwartet wird und ihre Zuständigkeit ist in Erziehungsfragen zumeist nicht eindeutig festgelegt; Rollenambiguität ist die Folge: Sollen sie sich als Eltern (als Vater/Mutter), als Freund, als Verwandter oder als Stiefvater bzw. -mutter … verhalten?“ 1108 Im Roman zeigt sich eben dieser Rollenkonflikt beim Stiefvater.
21.4 Ehelosigkeit und Individualisierung
Im 18. und 19. Jahrhundert war die Ehe das primäre Lebensziel der Frauen und Männer. Aus eigenem Entschluss blieb kaum jemand ehelos, wenn, dann eher aus wirtschaftlichen und rechtlichen Gründen. Unverheiratete Männer wurden diskriminiert, sie galten als anormal und verdächtig, rückten in die Nähe der Verbrecher, Junggesellen sah man als künftige Selbstmörder.
Thomas Buddenbrook diskreditiert das Alleinleben:
S. 303
„Zunächst bin ich sehr froh, verheiratet zu sein und einen eigenen Hausstand begründet zu haben. Du kennst mich: ich hätte schlecht zumGarçongetaugt. Alles Junggesellentum hat einen Beigeschmack von Isoliertheit und Bummelei, und ich besitze einigen Ehrgeiz, wie du weißt…
Andererseits galt Ehelosigkeit als funktional für bestimmte dienstleistende Tätigkeiten, wie z.B. für Beamte und Priester.
Über einen längeren Zeitpunkt ledige Personen in den Büchern sind im Roman „Buddenbrooks“: Tony, Christian, Klothilde, im Roman von Arno Geiger: Peter, Philipp und Alma, im Roman von Eugen Ruge: Sascha Umnitzer. Die Gründe für ihr Alleinleben sind vielfältig, oft ungeplant und ungewollt. Für alle gilt, dass das Ledig-Sein keine auf Dauer freiwillig gelebte Lebensform ist.
(TM)
Bei den Buddenbrooks bleiben unverheiratete Kinder oftmals im Elternhaus, wechselten, wie Christian, in das Geschäft des Bruders oder gingen als Frau in ein Kloster, wie Klothilde.
Tony ist nicht glücklich in der Zeit des gezwungenen Alleinlebens nach den zwei Ehen; für sie bedeutet Frau zu sein, eine Familie zu haben. Der Verheiratetenstatus gilt für sie als prestigemäßig erhöht, während das Alleinleben ohne erwachsenen Partner sie deklassiert.1109
S. 301
„Kurz, das Traurige ist, dass das Kind mich allzusehr an Grünlich erinnert.Und dann, wenn ich es vor mir habe, muss ich beständig denken: Du bist eine alte Frau mit einer großen Tochter, und das Leben liegt hinter dir. ..ich empfinde noch so jugendlich, weißt du, und ich sehne mich danach, noch einmal ins Leben hinauszukommen.. Wenn ich mich wieder verheiratete? Offen gestanden, Tom, es ist mein lebhaftester Wunsch! Damit wäre Alles in Ordnung, der Fleck wäre ausgelöscht. glaubst du, dass es so völlig ausgeschlossen ist…
Die Gesellschaft und die Familie der Moderne aber ist von Individualisierung geprägt und von einer Herauslösung aus traditionellen normativen Vorgaben und sozialen Bindungen. Entscheidungsspielräume werden größer, Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung spielen eine wichtige Rolle, jede Person entscheidet nach den ihr eigenen Bedürfnissen und Interessen.1110
Zeigte sich Individualisierung bereits im Bürgertum in einer Spezialisierung in Kinder- und Elternzimmer, verstärkte sich dies Phänomen in der Mitte des 20. Jahrhunderts und ging einher mit der emanzipatorisch-individualistischen feministischen Bewegung und dem Aufbrechen der traditionellen Rollenmuster.
Die „Radikalisierung der Individualität“, wenn Selbstentfaltung, zum Lebensinhalt wird, führt dazu, dass eine Orientierung an dem „Gemeinwohl“ oder der Familiensolidarität obsolet werden.1111 Individualisierung und die freie Entfaltung der Persönlichkeit führen zu einer Unverbindlichkeit im Zusammenleben, wenn das Individuum sich aus allen Bindungen löst und die eigenen Ziele in den Vordergrund stellt. Als Folge davon lässt die intergenerationelle Solidarität und die Verantwortung im Familienverband nach, die ökonomische und emotionale Verantwortung der Generationen innerhalb einer Familie und die Vorbildfunktion der älteren Generation gegenüber der jüngeren verändern sich. Einsamkeit als letzte Konsequenz des Individualismus:1112 (AG) S. 20 ,Die Menschen treiben aneinander vorbei, einer sieht nicht den Schmerz des anderen…
Die Generationen der 60er und 70er Jahrgänge des 20.Jahrhunderts haben das Phänomen der Kinderlosigkeit ins Spiel gebracht, für sie haben private und berufliche Projekte Priorität gegenüber den langfristigen Bindungen der Familie. „Freiwillige Kinderlosigkeit scheint als dauerhafte Lebensform an Attraktivität zu gewinnen.“1113 Und auch wenn die Eheschließung wegen ihrer normativen Akzeptanz und der ökonomischen Notwendigkeit unangefochten blieb, wuchs die Skepsis ihr gegenüber mit der wirtschaftlichen Eigenständigkeit von Mann und Frau und einem Wandel der sozialen und rechtlichen Normen.Der Anteil der Kinderlosen und dauerhaft Ehelosen wächst von Geburtskohorte zu Geburtskohorte, Einpersonenhaushalte sind häufig anzutreffen - und einer Diskriminierung sind Allein-Lebende nicht mehr ausgesetzt.
Der Verzicht auf eine Familie entspricht dem modernen Leitbild, das Mobilität, Unabhängigkeit und Selbstständigkeit in den Mittelpunkt stellt. Diese Art des Singledaseins ist häufig bei Menschen mit überdurchschnittlichen Bildungsabschluss in Ballungszentren vertreten: „...ein höheres Bildungsniveau [kann]zu ausgeprägteren Individualismus und zu höheren Ansprüchen an den Partner führen, was u.U. den Partnerfindungsprozess erschweren könnte.“1114
Ein urbaner Lebensstil begünstigt ebenfalls solch ein „Singlehood“, zumal in der Stadt sich Konsum-, Wohn- und Freizeitangebote auf den kinderlosen Erwachsenen ausrichten.1115
Im Roman sind es die Enkelfiguren der 3. Generation, bei denen diese Lebensform zu einem Element ihres Lebensstils und zu einem Mittel der Distinktion und der Symbolisierung sozialer Unterschiede und Zugehörigkeiten wird.1116 Sie verkörpern Individualisierung einschließlich Selbstverwirklichung und Selbstkreation: (AG) Philipp und (ER) Sascha sind ungebundene solitäre Männer, beide leben in einer Großstadt.
(AG)
Philipp ist kinderlos, lebt ohne eigene Familie, für die er Verantwortung tragen müsste.1117 Er stellt den eloquenten, egozentrischen Einzelgänger dar, der seine Interessen auslebt und auf bürgerliche Sekundärtugenden verzichtet. Sein Habitus ist geprägt von Spontanität.
S.10
Ich finde es ausgesprochen sinnlos, hier etwas nachholen zu wollen. Da denke ich lieber über das Wetter nac…
Er verkörpert die literarische Figur des Junggesellen, familiale Generationenbeziehungen erscheinen ihm sinn- und bedeutungslos. Zwar bleibt er bei der Betrachtung von Familienfotos den familialen Wirkungen der Vergangenheit irgendwie verhaftet, jedoch stiftet Familie keine Kohärenz. Selbstverwirklichungswünsche und Selbstkreation1118 sind für ihn von immenser Bedeutung, Spuren der Vergangenheit schränken ihn in seiner Beweglichkeit ein und müssen beseitigt werden.
S. 189
Er wirft in großem Stil weg, was ihm seine Großmutter hinterlassen hat. …
Erinner dich daran, dass Familiengedenken eine Konvention ist, die von denen erfunden wurde, die es nicht ertragen können, zu sterben und in Vergessenheit zu gerate…
Sein Streben nach individueller Lebenserfüllung beeinträchtigt das Ziel nach verantwortlicher Elternschaft und Familienleben. Das geänderte generative Verhalten in seiner Generation und sein individueller Lebenslauf zeigen die Veränderung der zeitlichen biografischen Strukturierung, die mit der Verlängerung des Lebens einhergeht und eine Familiengründung hinauszögert.1119 Philipps Lebensführung ist geprägt durch das, was Wohlbefinden, fördert. Er lebt ich-bezogene Ansprüche aus, und der Verzicht auf Kinder als ein sinnstiftender Lebensinhalt erhält ihm seine Mobilität und Unabhängigkeit
Philipps Selbstbezogenheit überschreitet die Grenze zum Infantilismus, im 40. Lebensjahr sieht er sich selber noch nicht als einen erwachsenen Menschen:
S. 377
Vielleicht, denkt Philipp, ist das hervorragendste Merkmal des Erwachsenwerdens, dass man systematisch die Zuversicht verliert, das Blatt könnte sich jeden Moment zum Guten wenden. Er ist auf dem besten We…
Philipp ist eine problematische Figur mit der Neigung zu alternativen Lebensentwürfen.1120 Einer maximalen Freiheit stehen Sesshaftigkeit, einengende Normen und die Bindung an ein (geerbtes) Haus gegenüber. Selbstfindung auf neuen Wegen soll am Ende zur Unabhängigkeit führen. Er sucht Grenzerfahrungen und wird dabei stets geleitet von einer Spontanität, ist unkonventionell und non-konformistisch.
S. 50
Zwischendurch liest er, versuchsweise, unkonzentriert, zunächst in ,Zoo oder Briefe nicht über die Liebe', später in den ,Stanisläusen. Korrekt: Der alte und der junge und der kleine Stanislaus', ein Buch, das Philipp in seiner Kindheit sehr gemocht hat … Lese ich eben die ,Stanisläuse‘, sagt er zu sich. Oder ich schreibe ein Buch: Glanz und Elend der Stanisläuse…
Seine Entscheidungen gelten nur für begrenzte Lebensabschnitte und können ggf. revidiert werden - auch ein Merkmal moderner Lebensführung.
S. 386ff
Nehmt ihr mich mit? Wenn ihr übermorgen fahrt? fragt Philipp im vagen Gefühl, dass die Gelegenheit jetzt, bei allem Stolz und bei aller Scham, die er empfindet, halbwegs erträglich ist. … Gleich wird Philipp auf dem Giebel seines Großelternhauses in die Welt hinausreiten, in diesen überraschend weitläufigen Parcour…
Negative subjektive Erfahrungen sind oftmals ein Grund für das Singledasein und Erfahrungen in der Herkunftsfamilie, wie Eheprobleme der Eltern, erhöhen die Bereitschaft, eine alternative Lebensform für sich zu suchen:
(AG)
Philipp hat eine distanzierte Position zur familiären Vergangenheit und führt als Grund dafür, dass er ein einsamer Sonderling und „partnerschaftlich minderbegabt“ ist, die unglückliche Ehe seiner Eltern an. Durch sie wurde ihm die „Zärtlichkeit“ und die „Fähigkeit zum Gespräch“ vorenthalten.
Ein Single im ursprünglichen Sinne ist er nicht, er ging vor zehn Jahren eine nicht zukunftsträchtige dauerhafte Beziehung ein: Die Freundin lebt in einer traditionellen Ehe- und Familienform, empfindet aber ihre Ehe offensichtlich nicht als alternativlos.
S. 95
- Du wirst schon sehen, beteuert Johanna. Bei Franz und mir lässt sich nichts mehr beschönige…
- Wie gesagt, ich bin gespannt …
Wir könnten zusammenziehen … Wir könnten rasch ein Kind machen oder zwei und -. Nein, das wird nicht passier…
S. 138
… und dass er keine Wahlmöglichkeit hat, wenn er sich einbildet, Johanna zu lieben. Johanna hingegen nutzt die Tatsache, sich im gleichen Moment und seit knapp zehn Jahren abwechselnd nicht viel oder nicht genug aus ihm zu mache…
Philipp tut nicht den letzten Schritt zum Erwachsensein. Es fehlt ihm eine tragfähige und verbindliche Partnerbeziehung und eine materiell komfortable Lebenssituation mit wirtschaftlicher Absicherung,
Dabei sympathisiert er mit selbstsicheren und selbstbewussten Frauen, wie der Metereologin Johanna, zeigt Wertschätzung gegenüber ihrer fachlichen Kompetenz
S. 94
… wie anstandslos er sich seit Johannas Heirat mit der stundenweisen Liebe begnügt …
S. 187
Da fühlt sich einer (ich) zu einer Frau hingezogen (Johanna), die stichhaltige Prognosen abgibt darüber, wie die Dinge einmal sein werde…
Als Haushaltsform wählt er die Living-Apart-Together-Variante, sowohl er als auch die Partnerin nehmen sich Freiräume für eigene Interessen. Diese Partnerschaft ist beidseitig instrumentell und ungleichgewichtig: Die Partnerin übernimmt zeitweise die Organisation alltagspraktischer Aufgaben, weil sie, im Gegensatz zu ihm, Organisationsgeschick und strategisches Wissen besitzt. Beiden ist die Befriedigung der sexuellen Bedürfnisse wichtig. Doch scheint das Prinzip der Austauschbarkeit hier vorzuliegen (Postbotin). Philipp bewertet persönliche Beziehungen unter dem Aspekt der individuell-expressiven Erfahrungsmöglichkeit: einengend und hemmend für die Selbstverwirklichung, oder aufgezwungen, wie die familiären Beziehungen.1121
Es ist ein stagnierend perspektivloses und orientierungsloses Leben, er zeigt weder eine Leistungsorientierung noch Ehrgeiz, ist wenig status- und aufstiegsorientiert und passiv. Bestätigt sich bei ihm das Ergebnis von Untersuchungen, dass Unverheiratete im Vergleich zu Verheirateten öfter körperliche und emotionale Pathologien aufweisen, da ihnen die kontinuierliche Partnerschaft fehlt, die ihnen bei Problemen beisteht?1122 Sein hedonistisches Lebensgefühl ist von Hypes und Frustrationsgefühlen, Fluchttendenzen und Resignation geprägt.
S. 139f
Die Stimmen, die Philipp hinter der Mauer hört, sind Kinderstimmen, … Vielleicht hat man ihnen als Volksschüler aufgetragen, in das Schönschreibheft zu schreiben, dass das Glück zu denen kommt, die warten könne…
… denkt er, dass alles immer ist, als versuche man denselben Satz diesmal noch schöner in sein Heft zu schreiben. Vielleicht ist es das, was uns zu armen Teufeln mach…
Die Vortreppe ist der symbolische Ort dieses Verharrens auf der Stelle, wo er gedankenverloren und melancholisch über Briefe sinniert.
S. 55f
Obwohl er Freude an diesen Entwürfen hat, ist Philipp unsicher, ob sie ihm weiterhelfen. Vielleicht sind es ja doch nur Spinnereien, die sich auf nichts gründen …
Er legt sein Notizbuch zur Seite und steht vor der Vortreppe auf, um sich ein wenig abzulenken. Zunächst probiert er, ob ihm an der sehr stabil gebauten Teppichstange ein Hüftschwung gelingt. Gelingt ihm nicht, obwohl er sein Bestes gibt.…
S. 187
Deine Passivität ist eine strategische Passivität, die dich vor der Gefahr bewahren soll, dich dingen auszusetzen, die nicht angenehm sind. … du glaubst, du kannst den Katastrophen ausweichen oder wenigstens deine Probleme vereinfachen, indem du dich sowenig wie möglich bewegs…
Auch in der DDR begann in den 80er Jahren ein Prozess des Wertewandels, weg von sozialistischen Werten und Verhaltensmustern, hin zu individualistischen Einstellungen.
Die Enkelgeneration orientierte sich nicht mehr an den sozialistischen Werten der Nachkriegsgenerationen und suchte in der privaten Lebensführung mehr Individualität. (ER)
Waren die Erwartungen an den Lebenssinn und das Lebensglück in der DDR früher verstärkt auf die Familie gerichtet, sind für Sascha nach der Trennung von Melitta andere Lebensbereiche und -formen von Bedeutung.(Individualisierung)
S. 26
Er war abgehauen und wieder zurückgekehrt (wenn auch das Land, in das er zurückkehrte, verschwunden war). Er hatte einen ordentlich bezahlten Job bei einem Kamp-Kunst-Magazin angenommen (und wieder gekündigt). Hatte Schulden gemacht (und wieder zurückgezahlt) Hatte ein Filmprojekt angezettelt (vergisses)
S. 361
… und hörte sich an, was er zu erzählen hatte: über die neue Wohnung...und über das neue Auto...dann über Paris, wo sie neulich gewesen waren, das ihnen aber weniger gefallen hatte als London, obwohl das Essen in London grauenhaft gewesen war.…
Sascha definiert sich als Künstler, ist unkonventionell mit generationstypischen Eigenschaften. Bei ihm finden sich der Wunsch nach persönlicher Autonomie und Freiheit einerseits und nach einer Zweierbeziehung andererseits. Er lebt keine verantwortete Elternschaft und übernimmt weder die ökonomische Verantwortung für sein Kind noch gibt er ihm eine psychische und zeitliche Zuwendung.
Berufsbedingte und partnerschaftsbedingte Wohnungswechsel lösen sich bei ihm ab, er träumt von der Liebe und trägt schwer an seiner Einsamkeit.
S. 322
… hat er sich in die Vorstellung verliebt, an heißen Nachmittagen in der unmittelbar vor seiner Zimmertür aufgespannten Hängematte zu liegen, im Schatten des Palmendaches und mit Blick auf das irrsinnige Blau des Pazifi…
S. 408f
Nach dem Zeitunglesen wird er noch einmal zum Strand gehen … und dem Sonnenuntergang zusehen…
S. 415
Einer jedoch, ein Wohlgeformter und Schicker mit blauen Augen und sonnengebleichtem Haar wird sich ihm plötzlich anschließen, und Alexander wird, allen guten Vorsätzen zum Trotz, seine Schritte kaum merklich verlänge…
S. 412 im Brief an Marion:
Wie kann mir jetzt einfallen, Sehnsucht nach dir zu haben? Aber ich habe Sehnsucht. … Es ist tröstlich, dass es dich gib…
Alleinleben soll für ihn nur ein (Übergangs)stadium/eine Zwischenstufe nach Trennungen und Scheidungen sein.
S. 413
Andererseits mache ich gerade die seltsame Erfahrung, dass man nicht unbedingt besitzen muss, was man liebt. Einerseits zieht es mich zu dir, um nachzuholen, was ich zu eben versäumt habe. Andererseits fürchte ich, dass ich - nach dem, was mir die Medizin prognostiziert - umso mehr der nehmende wäre. Einerseits möchte ich dir gern alles schreiben. Andererseits fürchte ich, du wirst es als eine Art Heiratsantrag aufnehmen - und das ist es ja auc…
Philipp und Sascha sind Beispiele für die Individualisierung, die einher geht mit einer Entfernung vom Heimatort. Letztendlich löst sich bei beiden das Familiengefüge auf, es bleibt Kontaktlosigkeit und die Isolation des modernen Menschen „.. und was einst eine Familie gewesen war, bestand aus versprengten Einzelwesen, die man liebte oder verzweifelt bedauerte..“1123
22. Kindheit und Erziehung als Spiegel des Eltern-Kind-Verhältnisses
22.1 Rousseau - Entdecker und Reformer der Kindheit
Der Mensch kommt moraliter ebenso nackt auf die Welt als physice. Daher ist seine Seele in der Jugend so empfindlich gegen die äußere Witterun…
Johann Wolfgang von Goet…
Entscheidend für die Ausformung der Kindheit sind stets die politischen und kulturellen Bedingungen und die Klassen- und Nationalitätszugehörigkeit. So wie in der Zeit des Bürgertums das Verständnis von Familie eine Änderung erfuhr, wandelte sich auch die Bedeutung der Kindheit. Und mit ihm veränderte sich der Umgang der Eltern mit den Kindern, das Generationen- und Geschlechterverhältnis und die Erziehungsziele.
Heute bezeichnet man ,Kindheit‘ als die Zeit zwischen Geburt und Geschlechtsreife, die ca. im 13. Lebensjahr einsetzt und die Phase ist, in der sich die geistig-seelische und körperliche Entwicklung vollzieht.
Im Mittelalter war Kindheit nur eine bedeutungslose Übergangszeit. Der eigentliche Wandlungsprozess dieser Lebensphase begann im 17. und 18. Jahrhundert ( vgl. Aries ), als das Wort „Familie“ in der deutschen Sprache heimisch wurde und das ganze Haus (s.o.) meist in bäuerlichen und in städtischen (Kaufmanns-)haushalten, auch die Kinder mit der Erfüllung von Aufgaben beauftragte. Die Umgangsformen waren damals nicht affektiv, sondern rational.1124 So erklärte noch der Grüne Heinrich in Gottfried Kellers teilweise autobiografischen Roman, „dass die Kindheit schon ein Vorspiel des ganzen Lebens ist und bis zu ihrem Abschlusse schon die Hauptzüge der menschlichen Zerwürfnisse im kleinen abspiegel[t].“1125
Mitverantwortlich für das neue Bild von Kindheit und für die neuen Erziehungskonzepte des Bürgertums war eine Pädagogik, die die Fähigkeiten und Neigungen des Kindes in den Mittelpunkt stellte.
Jean-Jacques Rousseaus gilt als d e r Entdecker der Kindheit schlechthin und betonte die Eigenständigkeit und den Eigenwert der Kindheit. Das Kind sollte ein Recht auf Kindheit haben und vollständig in der Gegenwart leben dürfen. „Gönnen wir ihnen doch wenigstens einen Lebensabschnitt, der frei vom Joch ist, das uns die Natur auferlegt hat; lassen wir der Kindheit die natürliche Freiheit, die sie wenigstens eine Zeitlang von den Lastern fernhält, die man in der Sklaverei annimmt.“1126
Sein Roman „Emile“ von 1762 wurde zum Erziehungsratgeber des Bürgertums. In ihm idealisierte er die Kindheit bzw. die Natur des Kindes und verklärte diese Zeit zum Paradies. Erwachsensein wurde das Gegenstück davon. Er verlangte eine kindgemäße entwicklungsstufenorientierte Erziehung, Kindheit sei anders als Erwachsensein und stehe in Distanz zu dieser, so Rousseau, sie solle lange erhalten bleiben und die Jugend hinausgeschoben werden, denn mit dem Eintritt ins Jugendalter beginne der Eintritt in die Gesellschaft.
Rousseau brachte seine Erfahrungen als Hauslehrer in sein Buch ein,und betonte, es sei k e i n e Abhandlung über Erziehung oder gar eine Anleitung, sondern ein Roman und ein Modell des Menschseins.1127 Der verdorbenen Welt stellt Rousseau Gott und die Natur gegenüber. Die Natur im Menschen sind Gewohnheiten, die der Natur gemäß sind, ohne menschliche Beeinflussung. Die Natur des Kindes kann bestehen bleiben - an ihr richtet sich Erziehung aus, wobei körperliche Ertüchtigung und Stärke eine nicht unbedeutende Rolle spielen.
Der gegenwärtige Mensch ist für Rousseau nicht der Mensch schlechthin, sondern der Mensch der jeweiligen Epoche und Gesellschaft. Ein Kind kommt als reiner Ausdruck der Natur auf die Welt und kann sich idealerweise auf natürlicher Basis entwickeln. Natur wird zum Gegenbegriff zur Gesellschaft, in der es an Gutheit und Wahrhaftigkeit fehlt; das Kind jedoch ist innerlich rein, seine Anlagen sind reine Natur und ihre Ausbildung soll unterstützt werden: „Wir werden empfindsam geboren.“1128 Der reine natürliche Mensch, illustriert am Kind Emile, ist vom Künstlichen befreit. Dabei gibt es drei Dinge, die für das Kind Lehrer und Erzieher sind : Natur-Mensch-Dinge.1129
Im Roman „Emile“ erzählt Rousseaus seine durch (Selbst)Beobachtung gewonnenen Vorstellungen von einer „natürlichen Erziehung“ und hebt die besondere Position der erziehenden Person hervor. Während die Gesellschaft den Menschen seiner Natur entfremdet, wird der Held durch seinen Lehrer und Erzieher Jean Jaques zum Menschen und Bürger erzogen. „Alles ist gut, wie es aus den Händen des Schöpfers kommt, alles entartet unter den Händen des Menschen.“1130 Emile wächst abgeschottet mit seinem Erzieher auf dem Land auf, fern von Übeln und Versuchungen und mit Abstand zur Erwachsenenwelt. Mit Hilfe des Erziehers, der sich in bestimmten Situationen auf die gleiche Stufe begibt und das Kind wie seinesgleichen behandelt, bewahrt das Kind seine natürliche Reinheit. Emile zeigt Echtheit im Verhalten und überlässt sich dem natürlichen
Gefühl. Er lebt für sich, nicht für andere, genügt sich selbst und vergleicht sich nicht mit anderen (Selbstgenügsamkeit).
Rousseaus „Emile“ ist das klassische Buch des bürgerlichen und des „pädagogischen" 19. Jahrhunderts. Es zeigt, dass das Wesen des Kindes des veredelnden Eingriffs des Menschen bedarf1131 und verdeutlicht die Hoffnung auf die Kraft der Erziehung, die die Möglichkeit in sich trägt, Verhältnisse zu verändern. Das Kind wird zum Hoffnungsträger einer menschlicheren Zivilisation/Zukunft und Gesellschaft.
Dem Wesen des Erziehers kam in pädagogischer Hinsicht demnach große Bedeutung zu. Seine Aufgabe war es, nicht weniger als das Kind zum Erwachsenen zu formen, indem die Vernunft durch das Gefühl vervollkommnet wird. Anhand von Beispielen beschreibt Rousseau Maßnahmen für eine moralische Erziehung. Der Erzieher muss die Zukunft des Kindes in der Gesellschaft im Blick haben und daran denken, was seinem Zögling später nutzen wird. Das Ziel ist die Freiheit und Unabhängigkeit, ohne Einordnung in einen bestimmten Stand - Erziehung orientiert sich an der Natur des Kindes und dessen innerer Entwicklungslogik1132, d.h. auch, dass die Berufswahl nicht abhängig vom Beruf des Vaters sein sollte.
„Die häusliche oder natürliche Erziehung“ ist wesentlich für Rousseau.1133 Er plädierte für eine gefühlvolle Einstellung den Kindern gegenüber, Zwang und Drohung sollen keine Erziehungsmittel mehr sein.1134 Eine neue Vertraulichkeit zeigt sich u.a. im Du zwischen Eltern und Kindern.
Als besonders wichtiges lesenswertes Buch in der Kindheit empfahl Rousseau den Roman „Robinson Crusoe“, denn es verbindet, seiner Auffassung nach, Phantasie und Aktivität und ist ein Beispiel für eine natürliche Erziehung.
Erziehung muss die Suche nach dem eigenen Wohl und die Selbstsucht beim Kind in die rechte Bahn lenken und es anhalten, je älter und intelligenter es wird, den Unterschied zwischen Arbeit und Zeitvertreib zu erfassen: Zeitvertreib bedeutete Erholung von der Arbeit. „Dann können Dinge realen Nutzens zum Teil seiner Studienobjekte gemacht werden und es dazu anhalten, sich ihnen mit größerer Ausdauer zu widmen als früher dem bloßen Zeitvertreib.“1135
(TM)
In diesem Sinne legt Thomas B. Wert darauf, dass sein Sohn sich nicht bloß zeitvergessen dem bloßen Zeitvertreib der Musik widmet, er zeigt ihm die Arbeit mit ihrem real-konkreten Nutzen und welche Mühe und welchen Aufwand sie erfordert. Damit will er ihn im Sinne von Rousseau auf die Anforderungen des künftigen Lebens vorbereiten.
S. 522
Ein Bild schwebte ihm vor, nach dem er seinen Sohn zu modeln sich sehnte: das Bild von Hannos Urgroßvater, wie er ihn als Knabe gekannt - ein heller Kopf, jovial, einfach, humoristisch und stark. Konnte er so nicht werden? War das unmöglich? Und warum?. Hätte er wenigstens die Musik unterdrücken und verbannen können, die den Jungen dem praktischen Leben entfremdete, seiner körperlichen Gesundheit sicherlich nicht nützlich war und seine Geisteskräfte absorbiert…
Der Theorie Rousseaus schlossen sich andere Pädagogen an und entwickelten weitergehende Kindheits-Konzepte. Manche betrachten das Kind als einen ,höheren’ Menschen: So betonte Montessori die Göttlichkeit des Kindes und die Kunsterziehungsbewegung die edle Kreativität des Kindes mit seinen aktiven und spontanen Kräften, die z.B. im Kunstwerk zum Ausdruck kommen.1136
Pestalozzi entwickelte ein Erziehungskonzept für das Volk (Volkserziehung) und eine „Elementarbildung“, in der Grundformen und Grundbegriffe als das Fundament der Bildung galten, auf dem alles weitere aufbauen muss. Die Bildung des Geistes und die Bildung von Herz und Hand, die drei Wesensmerkmale des Menschen, stehen für ihn im Vordergrund. Er bewertete die Kinder ebenfalls als von Natur aus unschuldig und setzte sich für eine individuelle Entwicklungsfreiheit ein. Er forderte, dass Pädagogik und Bildung auf die Bedürfnisse des Kindes abgestimmt zu sein haben und verlangte eine Gleichbehandlung von Jungen und Mädchen. Die Frau und insbesondere die Mutter stand im Zentrum seiner Pädagogik.1137 Entscheidend für die Entwicklung der Sittlichkeit, der Menschenliebe und des Vertrauens des Menschen ist für Pestalozzi deren Fürsorge und Liebe. „Die Muttermuss- sie kann nicht anders, sie wird von der Kraft eines ganzen sinnlichen Instinktes dazu genötigt - das Kind pflegen, nähren, es sicherstellen und es erfreuen. Sie tut es, sie befriedigt seine Bedürfnisse, sie entfernt von ihm, was ihm unangenehm ist, sie kommt seiner Unbehelflichkeit zu Hülfe; das Kind ist versorgt, es ist erfreut -der Keim der Liebe ist in ihm entfaltet.“1138
Ähnlich sah es der klassische Bildungsphilosoph und Pädagoge Fröbel. Er idealisierte die Beziehung von Mutter und Kind in der bürgerlichen Familie. Sie galt für ihn als der ideale Ort der Erziehung, in dem das Kind sich in der Einheit von Körper, Seele und Geist verwirklichen und entfalten konnte.
So kam es zur „Entdeckung der Kindheit“: Von nun an definierte man Kindheit als eine wichtige eigene Entwicklungsphase, in der das Kind gefördert und umsorgt werden sollte. Man löste die Kinder aus der Welt der Erwachsenen heraus, Kindheit wurde zu einem Schonraum, in dem Kinder auf ihr zukünftiges Leben durch Bildungsinstitutionen und Familie vorbereitet wurden.1139
22.2 Kindheit im Bürgertum
Die Pädagogisierung im Umgang mit den Kindern ließ die „bürgerliche Kindheit“ entstehen:1140
(TM)
S. 436
Und zwischen zwei Kriegen, unberührt und ruhevoll in den Falten seines Schürzenkleidchens und dem Gelock seines weichen Haares, spielt der kleine Johann im Garten. Diese Spiele, deren Tiefsinn und Reiz kein Erwachsener mehr zu verstehen vermag,. vor allem aber die reine, starke, inbrünstige, keusche, noch unverstörte und uneingeschüchterte Phantasie jenes glückseligen Alters, wo das Leben sich noch scheut, uns anzutasten, wo noch weder Pflicht noch Schuld Hand an uns zu legen wagt, wo wir sehen, hören, lachen, stauen und träumen dürfen, ohne dass noch die Welt Dienste von uns verlang…
„Bildbarkeit“ und „Erziehbarkeit“ des Kindes wurden zu einem Credo der bürgerlichen Familie und führten dazu, dass die Aufmerksamkeit für die Phase der Kindheit wuchs. Das Kind galt, gemessen an den Verhaltensstandards des gebildeten Erwachsenen als wild, unzivilisiert, roh und ungebildet, es musste erst Mensch werden. Nur erzieherische Tätigkeit und pädagogische Kinderliteratur konnte sein Leben wandeln und veredeln.
Die Erziehung von Kindern als bildungsfähige und unschuldige Geschöpfe erforderte Aufmerksamkeit und Sorgfalt.
Erwachsene entwickelten durch sie Traumbilder von einem besseren Leben.1141
Die Konsulin nimmt das Kind in seiner Eigenheit an und förderte es in dieser Hinsicht: (TM)
S. 285
Die Konsulin betrachtete sie, und sie konnte sich nicht verhehlen, dass es trotz der stattlichen Mitgift und Claras häuslicher Tüchtigkeit schwer halten werden, dies Kind zu verehelichen. Keinen der skeptischen, rotspontrinkenden und jovialen Kaufherren ihrer Umgebung, wohl aber einen Geistlichen konnte sie sich an der Seite des ernsten und gottesfürchtigen Mädchens vorstelle…
Mit dem Bürgertum begann die Emotionalisierung und Intimisierung der Familie: Häuslichkeit, Intimität und affektive Verbundenheit wurde nunmehr zwischen den Ehepartnern und zwischen Eltern und Kindern betont. Wurden früher die Kinder als Arbeitskräfte und Garant der Altersversorgung gesehen, zu denen Eltern keine exklusive emotionale Beziehung aufbauten (schon der hohen Kindersterblichkeit wegen), nahm man im Bürgertum die Kinder in ihrer Besonderheit wahr. Erziehung lief bewusst ab. Kinder bekamen einen hohen Wert für die Eltern und rückten in den Mittelpunkt der Fürsorge.1142 Sie bedeuteten nunmehr in erster Linie Freude und Sinnerfüllung, auf deren Wohlergehen die Eltern achteten: (TM) S. 15
Er (Christian)war ein Bürschchen von sieben Jahre…
„Wir haben furchtbar gelacht“, fing er an, zu plappern, während seine Augen im Zimmer von Einem zum Anderen gingen. „Passt mal auf, was Herr Stengel zu Siegmund Köstermann gesagt hat.“ Er beugte sich vor, schüttelte den Kopf und redete eindringlich in die Luft hinei…
„,N Aap is hei!“ wiederholte der alte Buddenbrook kichernd. Herr Hoffstede aber war außer sich vor Entzücke…
„Charmant!“ rief er. „unübertrefflich…
S. …
Wo war Doktor Grabow? Die Konsulin erhob sich ganz unauffällig und ging davon, denn dort unten waren die Plätze von Mamsell Jungmann, Doktor Grabow und Christian frei geworden und aus der Säulenhalle klang es beinahe wie unterdrücktes jammern. Sie verließ schnell hinter dem Folgemädchen,., den Saal - und wahrhaftig, dort im Halbdunkel. lag oder kauerte der kleine Christian und ächzte leise und herzbrechen…
Hanno als lang ersehnter Erbe erlebt dies im äußersten Maße:
S. 423
Unter den Blicken voll verhaltener Zärtlichkeit, die sein Vater ihm schenkte, unter der Sorgfalt, mit der seine Mutter seine Kleidung und Pflege überwachte, angebetet von seiner Tante Antonie, mit Reitern.und Kreiseln beschenkt von der Konsulin und Onkel Justu…
Dennoch wollte man auch einen besonderen ökonomisch-utilitaristischem Nutzen von ihnen haben: (TM)
S. 14f
Thomas ist ein solider Kopf, er muss Kaufmann werden, darüber besteht kein Zweife…
S. 155
jetzt steht es zum Beispiel fest, dass ich Anfang nächsten Jahres nach Amsterdam gehe. Papa hat eine Stelle für mich…
Wie groß die Bedeutung und die Aufmerksamkeit war, die man Kindern schenkte, zeigt sich darin, dass eine eigene Welt der Kinder entstand: Kinder erhielten kindgemäße Kleidung, Kinderliteratur und -kultur und einen eigenen Wohnbereich mit Kindermöbeln und Spielzeug. Das Kinderzimmer entstand: ein eigener gestalteter Raum als die erste eigene Sphäre des Kindes, mit dem es seine Grenzen markieren und sich von Eltern und Geschwistern distanzieren konnte und mehr Freiräume als bisher hatte. Dieses Kinderzimmer in wohlhabenden Familien bedeutete gleichzeitig eine räumliche Abschirmung von der elterlichen Sexualität. 1143
S. 703
Das kleine Schülerzimmer, kalt und kahl, mit seiner Sixtinischen Madonna als Kupferstich über dem Bette, seinem Ausziehtisch in der Mitte, seinem unordentlich vollgepfropften Bücherbord, einem steifbeinigen Mahagoni-Pult, dem Harmonium und dem schmalen Waschtisc…
Um dennoch die Kinder nicht ohne erzieherischen Einfluss zu lassen, kontrollierte die sich nun entwickelnde Kinderliteratur die Gewissensausbildung: Exempel-Geschichten und moralische Erzählungen sprachen kindliche Bedürfnisse an und hatten die Aufgabe, die Persönlichkeitsstruktur des Kindes auszubilden1144 und im kindlichen Protagonisten Identifikationsmöglichkeiten zu wecken. Dafür findet sich in den Geschichten oftmals ein realistischer Schauplatz, (Haus, Garten, Keller..), der die Umwelt des Bürgerkindes widerspiegelte.
(TM)
Ein Beispiel sind die moralischen Beispielgeschichten, die Hannos Tugenden entwickeln sollen:
S. 463f
„Was für Gedichte waren das, Ida…
„Sie stehen in seinem Lesebuch“, antwortete Fräulein Jungmann, „und darunter ist gedruckt ,Des Knaben Wunderhorn…
Sie sind kurios.Dies bucklige Männlein steht überall, zerbricht den Kochtopf, isst das Mus, stiehlt das Holz. und dann, zum Schlusse, bittet es auch noch, man möge es in sein Gebet einschließen! Ja, das hat es dem Jungchen nun angetan. Er hat tagein-tagaus darüber nachgedacht. Zwei-, dreimal hat er gesagt: Nicht wahr, Ida, es tut es nicht aus Schlechtigkeit, nicht aus Schlechtigkeit! Es tut es aus Traurigkeit und ist dann noch trauriger darüber. Wenn man betet, so braucht es das Alles nicht mehr zu tun.…
Die Gebrüder Grimm sammelten und veröffentlichten in Erinnerung an ihre bürgerliche Kindheit Hausmärchen, die, gebunden als Märchenbuch, damals (und heute) auf keinem Weihnachtstisch des Bürgertums fehlen durften. Oftmals stehen in diesen Märchen bürgerliche Mütterlichkeit und Väterlichkeit im Mittelpunkt. Das Haus wird in ihnen als Zentrum der Sozialisation und des Privaten zum idealen Märchenort.1145
(TM)
S. 623
Und wenn Senator Buddenbrook, auf dem Wege zu seinem Ankleidezimmer, an dem „Altan“ in der zweiten Etage vorüberging, so hörte er aus dem mittleren der drei dort oben gelegenen Zimmer, das Hannos war, seitdem er zu groß geworden, bei Ida Jungmann zu schlafen, die Töne des Harmoniums oder Kais halblaute und geheimnisvolle Stimme, die eine Geschichte erzählt…
Kindliche Sozialisation legte auf die Abgrenzung nach unten großes Gewicht. Der kindliche Spielplatz war nicht mehr die Straße, ein Ort nunmehr der niederen Schichten, sondern die Wohnung stand als schützender Ort zur Verfügung.1146 Nur wenn die Wohnsituation keine Segregation anbot, spielten bürgerliche Kinder auf der Straße und begegneten nichtbürgerlichen Kindern.
Hanno verbringt einen großen Teil des Tages mit dem verarmten Adelssohn:
S. 518
Hand in Hand mit ihm, in den Pausen, hatte er ihm von seinem Heim, von den jungen Hunden und Hühnern erzähl…
Eines Tages hatte er verlangt, dass Hanno, statt nach dem Mühlenwall, mit ihm nach seines Vaters Besitz spazieren gehe, um neugeborene Meerschweinchen zu besehen. sie waren nach dem gräflichen Anwesen hinausgewandert, hatten Misthaufen, das Gemüse, die Hunde, Hühner und Meerschweinchen in Augenschein genommen und waren schließlich auch in das Haus eingetreten woselbst in einem niedrigen, langgestreckten Raume zu ebener Erde Graf Eberhard, ein Bild trotziger Vereinsamung, lesend an einem schweren Bauerntisch gesessen und unwirsch nach dem Begehren gefragt hatt…
Ida Jungmann bestand danach darauf, dass Kai von nun an zu Hanno zu Besuch kommen solle.
S. 521
Was den kleinen Kai betraf, so war die beiderseitige Zuneigung stärker gewesen, als ihr Misstrauen, auch hatte der Name sie ein wenig bestoche…
Es entstand ein regelrechterKindheitskult:Kindheit wurde romantisiert.
(TM) ,,
Jeans Äußerungen drücken dies aus, als er indirekt seinem Vater bzgl. dessen Kritik an das magische Weltverständnis der von der Kinderfrau erzählen Geschichten, widerspricht: S. 12
„Sie sind zu streng, Papa. Warum sollte man in diesem Alter über dergleichen Dinge nicht seine eigenen wunderlichen Vorstellungen haben dürfen.…
Das Kind wurde als Individuum bedeutsam, und diese Individualisierung der Personen war es, die die Betrachtungsweise und den Umgang mit Kindern veränderte: Liebe und Wertschätzung und das Erkennen der Motive des kindlichen Verhaltens standen von nun an im Mittelpunkt der Erziehung, die Lernfunktion wurde ausgegliedert. Die um das Kind zentrierte Familie wird zu einer „moralischen Anstalt“, und kümmert sich um die eigenen Interessen, d.h. die „Fortsetzung ihrer selbst“.1147 Von der Erwerbsarbeit entlastet galt es für die Kinder nun, sich auf die Erwachsenenrolle vorzubereiten. Die Verletzung von Normen wird in den bürgerlichen Familien nun nicht mehr wie in der vorbürgerlichen Gesellschaft durch den Gebrauch von körperliche Gewalt als Bestrafung geahndet.
Kinderliebe, so der Historiker Philippe Aries, ist eine Erfindung der bürgerlichen Kultur im 19. Jh. Der soziale Status der Kindheit, zuvor nur gering ausgeprägt, veränderte sich durch die Ausgliederung der Kinder aus dem gesellschaftlichen Leben der Erwachsenen. Die damit verbundene Unfreiheit der Kinder und pädagogische Dressur führte bis heute dazu, so ist die Meinung von Aries, dass ein Kind erst spät als gleichberechtigtes Glied in der Gesellschaft akzeptiert wird.
Ein signifikantes Zeichen der „bürgerlichen“ Familie war die Kontrolle der Kinderzahl. So setzte sich eine Bürgerfamilie idealerweise aus Vater, Mutter und zwei Kindern (bestenfalls Sohn und Tochter) zusammen.1148 So konnte man inwenigeKindermehrinvestieren und ihnen die notwendige materielle und emotionale Zuwendung geben. Deren Tod wurde als eine entsetzliche Katastrophe empfunden.
In allen Generationen der drei Romane wachsen die Kinder in einer behüteten Atmosphäre auf, sie erfahren emotionale Nähe und gegenseitige Unterstützung.
In einer liebevollen und warmen Eltern-Kind-Beziehung hörte man auf die Worte der Kinder, beobachtete und amüsierte sich über sie.
(TM)
Tony und Christian belustigen ihre Familie bei der Einweihung des neuen Hauses.
S. 8
Er erkundigte sich sich nach Tonys Acker und Vieh, fragte, wieviel sie für den Sack Weizen nähm…
S. 15
„Wir haben furchtbar gelacht“, fing er an, zu plappern. „Passt mal auf, was Herr Stengel zu Siegmund Köstermann gesagt hat“…
„“’N Aap is hei!“ wiederholte der alte Buddenbrook kichern…
Sozialisationsträger waren, so erfahren wir in den Romanen, Großeltern, Eltern und ältere Geschwister.
Die Primärsozialisation von Thomas, Christian, Tony und Hanno wurde nach Adelsgepflogenheit in die Hände eines Kindermädchen, gegeben, danach standen die Kinder bis ins Jugendalter unter dem Einfluss elterlicher Gewalt und der Fremdbestimmung durch Schule und Ausbildung. Sie bedeutete eine Investition in die Zukunft, auch wenn es für die jungen Menschen wirtschaftliche Unselbständigkeit mit sich brachte.
Eine Störung erfolgte immer dann, wenn die Erwartungen der Eltern nicht erfüllt wurden, wie bei Christian:
S. 67
Christian dagegen erschien launenhaft, neigte einerseits zu einer albernen Komik und konnte andererseits die gesamte Familie auf die sonderbarste Weise erschrecke…
S. 82
„Das ist mein Sohn, so entwickelt er sich…
Er gibt sein Taschengeld für diese Lorette-! Er weiß es nicht, nein; aber die Neigung zeit sich! Die Neigung zeigt sich…
Und auch zwischen Thomas und seinem Sohn gibt es diese Missstimmung, denn dieser nimmt die gesellschaftliche und geschlechtsspezifische Rolle, die die Zukunft für ihn bereit hält nicht, nicht ein:
S. 486
Gedenkst du dich später immer in Tränen zu baden, wenn du zu den Leuten sprechen sollst?“ Nie, dachte Hanno verzweifelt, nie werde ich zu den Leuten spreche…
22.3 Erziehungsziele
So wie Familie nie unabhängig von anderen gesellschaftlichen Institutionen und gesellschaftlichen Strukturen war, ist Erziehung immer auch die Vermittlung von Erziehungsinhalten, die für das Leben in der jeweiligen Gesellschaft in ihrer Zeit von Bedeutung sind (Unterordnung oder Selbstbestimmung?).
Die Roman-Figuren einer Generation sind Repräsentanten einer Zeitepoche, die historische Erziehungsformen praktizierten und diese an die nächste Generation weitergaben. Erziehungs- und Interaktionsmuster zwischen Großeltern, Eltern und Kindern sind immer Teil der sozialen Wirklichkeit und dessen, was die jeweilige historische Epoche für ein Verständnis von Familie und Erziehung hat.1149 Diese Erfahrungen haben Einfluss auf die intellektuellen und sozialen Fähigkeiten, auf Kommunikationsstil und Beziehungen und legen die Wurzeln für spätere Interpretationen von Beziehungserfahrungen.
In den Romanen lesen wir von Erziehungserfahrungen dreier Generationen - stets vor dem Hintergrund der zeitgeschichtlichen Epoche und da politische, ökonomische und sozio-kulturelle Strukturen einer Gesellschaft die Familie und ihr Erziehungsverhalten beeinflussen, werden beim genaueren Hinschauen unterschiedliche Inhalte und Akzente von Erziehung sichtbar.
Erziehung unterscheidet sich demnach nicht nur nach der sozialen Herkunft, auch jede Generation hat ihre eignen Erziehungserfahrungen und ihre jeweils praktizierten Erziehungsmuster und wird damit zu Vertretern einer historischen Zeit.
Ein vergleichender Blick auf die gegenwärtige Familienerziehung und die Historie zeigt uns den Wandel der Erziehungsmuster und der Aufwachsbedingungen in den Familien, zeigt, wie Erziehung und familiale Interaktion gestaltet wurde/wird und welche Rechte und Pflichten Kinder und Jugendlichen zugestanden wurden und werden. Ist der Erziehungstil durch Kommunikation und die Beziehungsebene zwischen Eltern und Kindern durch Nähe und einer engen Beziehung, durch emotionaler Verbundenheit und Vertrautheit geprägt? Wie groß ist die Kontrolle, gibt es Konflikte zwischen Kindern und Eltern, und wie werden sie gelöst? Ist der Umgang und die Kommunikation durch Offenheit geprägt, ist sie symmetrisch oder asymmetrisch, ist der Erziehungsstil eher partnerschaftsorientiert oder hierarchisch?
„Wandel“ ist das Zauberwort: Der Wandel der Beziehungen zwischen den Generationen und den Geschlechtern brachte gleichsam den Wandel der Erziehungsmuster mit sich1150. Er ging einher mit einer Veränderung der Erziehungsziele und -ideale und macht Unterschiedlichkeiten und Parallelen in den Erziehungs-, Interaktions- und Beziehungsstrukturen erkennbar.
Ein wichtiger Aspekt ist in dem Zusammenhang die sinkende Geburtenquote seit dem 19. Jh. und damit die Zunahme der Kleinfamilien als Ein- und Zwei-Kinder-Familien und das Verschwinden der Drei-Generationen-Haushalte.1151 Mit der Abnahme der Kinderzahl und der Zentrierung auf ein oder maximal drei Kinder intensivierte sich die Erziehungsaufgabe, gleichzeitig erhöhten sich die Erwartungen der Eltern an ihre Kinder. Wie verhielten sich Eltern ihren Kindern gegenüber im 19. und wie im 20. Jahrhundert, wie förderten und erzogen sie sie, damit ihre Entwicklung gelang? Entwicklungsfördernd und beziehungsfördernd? Konkrete Beispiele von pädagogischen Alltagssituationen aus den Romanen werden als Belege hinzugezogen.
22.3.1 Erziehung im 19. Jahrhundert
Das eigentlich Erziehungsobjekt war der Sohn.1152 Der Sohn als der „Stammhalter“, der sie soziale Position der Familie zu stabilisieren hatte. In ihn setzte die bürgerliche Familie ihre Hoffnung. Seine Erziehung hatte das Ziel, die Dynastie aufrecht zu erhalten: „Das intergenerationelle Erhalten oder gar Verbessern des sozialen Status erforderte Zukunftsinvestitionen in die Ausbildung der Söhne oder die Mitgift der Tochter.“1153 „Vom Knabenalter“ an (Fröbel) wurde er vom Vater und Lehrer auf den Lebensberuf vorbereitet und verließ nach kürzerer Verweildauer als die Schwestern die weiblich geprägte Sphäre des Hauses.
Das polare Geschlechtermodell postulierte Männlichkeit mit den Merkmalen der Zweckrationalität, Zukunftsorientiertheit und mit den Fähigkeiten des Denkens und des Fühlens im aufklärerischen Sinne 1154. Deshalb zielte Erziehung darauf, den Wert der Arbeit zu erkennen, sich Ziele zu setzen, um erfolgreich im Beruf, und im Erwachsenenalter ökonomisch unabhängig und selbständig zu sein. „So ist männliche Erwerbsidentität eng mit Geschlechtsidentität verbunden.“1155 Im Mittelpunkt stand die Ausbildung einer Ich-starken Persönlichkeit.
(TM)
Thomas Buddenbrook versucht, seinem Sohn dies zu vermitteln:
S. 485f
Das war grausam, und der Senator wusste wohl, dass er dem Kinde damit den letzten Rest von Haltung und Widerstandskraft raubte. Aber der Junge sollte ihn sich nicht rauben lassen! Er sollte sich nicht beirren lasse…
„Worüber weinst du? ..Bist du denn ein kleines Mädchen? Was soll aus dir werden, wenn du so fortfährs…
Wichtige bürgerliche Eigenschaften, wie die Unterdrückung spontaner Regungen und Triebwünsche und die Leitwerte der Bescheidenheit und der Maßhaltung lebten die Erzieher vor.
Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern war gleichermaßen pädagogisch-erzieherisch und emotional-empathisch und basierte auf Vertrauen, Verbundenheit und Zuneigung. Statt Schläge setzte man die Mechanismen Lob und Tadel ein, um Verhalten zu steuern. (TM)
Im Buddenbrook-Roman legen die Eltern großen Wert auf eine kindgerechte Erziehung bei der Vermittlung ihrer sozialen und kulturellen Normen. Sie verkörpern die Prinzipien von Fleiß und Pflichterfüllung, Respekt, Gehorsam, Dankbarkeit und die inneren Werte wie Tugendhaftigkeit und Wahrheitsliebe und belehren durch ihr beispielhaftes Verhalten. Familiäre Bedingungen wie diese nannte man: „gute Kinderstube“ - ein Synonym für die gut-bürgerliche Erziehung.1156 Die enge Bindung und affektive Zuwendung zu den Eltern führte dazu, dass die Kinder deren Normen und eine Verhaltensdisziplin verinnerlichten.1157
(TM)
Thomas verortet sich in der familialen Traditionslinie und übernimmt die elterlichen Bildungsaspirationen. Dafür erhält er die Anerkennung seiner Familie.
Christian erlebt die an ihn gestellten Anforderungen als ein zwanghaftes Korsett und grenzt sich von den bürgerlichen anerzogenen Werten ab:
S. 578ff
Du bist unseren Eltern immer der bessere Sohn gewesen…
du hast dir einen Platz im Leben erobert, eine geehrte Stellung…
„Wie satt ich das Alles habe, die Taktgefühl und Feingefühl und Gleichgewicht, diese Haltung und Würde…
In der Erziehung favorisierte man eine Dichotomie der Elternrollen, d.h.: der Vater war für die sittlich-moralische und intellektuelle Erziehung, die Mutter für die seelisch-moralische Entwicklung vom Kleinkindalter bis zum 7. Lebensjahr verantwortlich und bereitete die väterliche Erziehung vor.
Um die Erziehungsziele Disziplin und Selbstkontrolle für den bürgerlichen Jungen zu erreichen, galt die väterliche Autorität als bedeutender als eine intensive Mutter-KindBeziehung. Diese, so glaubte man, führe zu einer schwächlichen und ängstlichen Disposition.
Hanno hat, als der letzte männliche Erbe, angstvollen Respekt vor seinem Vater, spürt aber schon als Kind, dass er dessen Ansprüchen nicht genügen wird:
S. 510f
… .wenn das Kind einfach einen scheuen Blick aus seinen goldbraunen, umschatteten Augen zu ihm hingleiten lie…
Er mochte vorher ganz munter gewesen sein, mochte sogar mit seinem Vater geplaudert haben - so wie das Gespräch auch nur annähernd den Charakter einer kleinen Prüfung annahm, sank die Stimmung unter Null, brach seine Widerstandskraft zusamme…
… .ein strenges Wort, ein Klopfen mit der Gabel auf den Messerblock von Seiten seines Vaters schreckte ihn…
Massiver (Leistungs-, Anpassungs- und Erwartungs-)Druck vom Vater mit gleichzeitiger Unterstützung von Seiten der weiblichen Personen begleiteten den weiteren schulischen Weg des Jungen. Die Eltern gestalteten seinen beruflichen Werdegang und die Heranwachsenden beschritten ohne zu murren diesen von den älteren Generationen vorgezeichnet Lebensweg.
Väter fungierten hier als Vorbild und als Experte in Lebensfragen, und dies meist in sehr überzeugender Weise, da der verheiratete bürgerliche Mann beruflich und gesellschaftlich erfolgreich war und in Anbetracht seiner Reife eine stabile Persönlichkeit hatte.
Als im Laufe des 19. Jahrhunderts der Vater immer mehr aus der Familiensphäre ausgeschlossen wurde, begann eine Mutterzentriertheit in der Erziehung, und der Vater stand als strenge Autorität nunmehr im Hintergrund der Familie.1158 (TM)
Thomas spürte bereits als Kind, welche Erwartungen in ihn gesetzt wurden und erfüllte die Anforderungen, ohne sich um einen individuell ihn zufriedenstellenden Lebensentwurf zu bemühen. Bereits als Junge fühlte er eine vorrangige Verpflichtung auf den materiell notwendigen Berufsbereich:
S. 65
Thomas, der seit seiner Geburt bereits zum Kaufmann und künftigen Inhaber der Firma bestimmt war., war ein kluger, regsamer und verständiger Mensc…
Als Vater fordert er, so wie die ganze Familie Buddenbrook das Gleiche von seinem Sohn: S. 396
Ein Erbe! Ein Stammhalter! ein Buddenbroo…
Und echauffiert sich über die unmännliche Entwicklung seines Sohnes:
S. 486
Weinen könnte man darüber, dass du selbst an einem Tage wie heute, nicht Energie Aufbringen kannst, um mir eine Freude zu machen. bist du denn ein kleines Mädchen?.“Erziehung war zwar nicht Sache des Familienoberhaupts, aber: „Beispiel geben, angemessenes Spielzeug, angemessene Verkleidungen schenken lassen, die für die Söhne vorgesehene Rolle möglichst perfekt vorspielen - das waren des Konsuls Möglichkeiten, auf den Nachwuchs Einfluss zu nehmen.“1159
Die Spielzeugindustrie produzierte bereits im 19. Jahrhundert pädagogische und lehrreiche Produkte, die die Söhne auf die Bewährung in der realen Welt vorbereiten sollten - deshalb die Warnung von Christian seinem Neffen gegenüber, als er das Spielzeug-Theater geschenkt bekommt: Hannos Spielzeug ist kein typisches Jungenspielzeug, das auf wilde Kämpfe in Form von Ritterduellen und der Nachstellung von Kriegen mit Zinnsoldaten ausgerichtet ist.
S. 537
Er wandte sich dem Theater zu. Das Harmonium war ein überwältigender Traum…
So wie Hanno andere Vorlieben zeigt, fanden auch beim Autor Thomas Mann selber Männergeschenke, wie Ritterrüstung mit Visierhelm, Lanze, Schild, Bleisoldaten oder das Kostüm der Husarenuniform wenig Anklang.1160
Im klassischen erzieherischen Verhältnis des 19. Jahrhundert bestimmten neben den Eltern auch noch aufgrund ihres Erfahrungsvorsprungs die Lehrer über die Erziehungsmittel und -ziele,1161 und, obwohl manch damaliger pädagogischer Ratgeber vor der Betreuung der Kinder durch Dritte warnte, verzichtete man selten auf Kindermädchen, schon allein wegen der vielen Aufgaben im Haushalt und den gesellschaftlichen Verpflichtungen.1162 (TM)
Thomas Buddenbrooks Primär-Sozialisation erfolgt im Rahmen der Hausgemeinschaft, Sozialisationsträger sind Eltern und Großeltern und andere Bezugspersonen, wie das Kindermädchen, dem für zwei Generationen die Verantwortung übergeben wird:
S. 402
„Ja, Ida“, sagte der Konsul, „ich habe mir gedacht - und meine Mutter ist einverstanden-, Sie haben uns alle einmal gepflegt, und wenn der kleine Johann ein bisschen größer ist. jetzt hat er noch die Amme, und nach ihr wird wohl eine Kinderfrau nötig sein, aber haben Sie Lust dann zu uns überzusiedeln…
„Ja ja, Herr Konsul,…
S. 486
Eine Sehnsucht nach gewissen Nächten überkam ihn plötzlich, in denen er, ein wenig krank, mit Halsschmerzen und leichtem Fieber im Bette lag und Ida kam, um ihm zu trinken zu geben und liebevoll eine frische Kompresse auf seine Stirn zu lege…
Einflussreiche Sozialisationsträger sind weiterhin das Lehrpersonal des RealGymnasiums, eine auf die Knabenerziehung ausgerichtete Institution. (siehe: 15.2: Bildung in der Schule des 19. Jahrhunderts)
(AG)
Noch im 20. Jahrhunderte sind Ansätze dieses bürgerlichen geschlechtsdifferenten Erziehung in Geigers Roman zu finden:
Richard, geboren 1907, wird von seinen Eltern religiös streng sozialisiert, im Unterschied zu Alma, die ein freies Leben als Kind und Jugendliche führen kann:
S. 40
In Meidling führte ich ein fast ebenso freies Leben wie die Halbwüchsigen heute, jedenfalls im Vergleich zu ihm. In seiner oberklerikalen, reichen Familie hatte er ja so gut wie keine Spielräum…
Das Spielzeug und die Form des (körperlichen/sportlichen) Spiels untermauert die männliche Sozialisation und deren o.g. bürgerliche Erziehungsziele.
(AG)
Ottos Erziehung ist eine andere als die Ingrids, geprägt vom männlichnationssozialistischen Erziehungsideal (s.o.).
S. 67
Vermutlich ist auch das Tretauto beteiligt, das Otto im Vorjahr bei einer Kindertombola gewonnen ha…
S. 74
Otto lehnt sich mit ausgestreckten Beinen weit zurück, holt Schwung, dann springt er am höchsten Punkt seiner Schaukelbahn ab, breitet die Arme aus und imitiert ein Flugzeug. Die Schaukelkette klirrt, als das Brett zurücksaust. Nach einer Drehung um 180 Grad landet Otto mit einem Plumps auf allen vieren, …
Männliche Sozialisation bedeutet auch für Peter noch männlich etikettiertes Verhalten in Bezug auf den traditionellen Geschlechtscharakter:
S. 294
Geschickt ist er jedenfalls nicht..Er besitzt keinen Ehrgeiz, weder im Sport noch bei den Mädchen, … Und Mut ist ebenfalls nicht seine Sach…
So wie die Männlichkeitsvorstellungen mit der bürgerlichen Familienkonzeption korrelierten1163 und mit ihnen die Erfüllung bürgerlicher Tugenden einherging, bekam die Frau einen ihr zugeordneten Platz und Wert, wobei man besonders im Anfang nicht so sehr darauf sah, bürgerliche und staatsbürgerliche Tugenden bewusst in den Mittelpunkt ihrer Erziehung zu stellen - Dasjenige, was der Familie und der Frau zufiel, war die Erhaltung der bürgerlichen Eigenart und das Durchsetzen des eigenen Standes; denn es „muss der Bürger eifersüchtig wachen über seine gesellschaftliche und politische Stellung, und so ist er in besonderem Masse daran interessiert, sich und seinen Stand zu bewahren.“1164
Mädchenerziehung hat demnach, so Rousseau, anders zu sein als die Erziehung von Jungen. Er assoziiert mit den geschlechtsspezifischen Neigungen des Mädchens, z.B. der Präferenz, mit einer Puppe zu spielen, die Berufung zur Mütterlichkeit und leitet daraus Maximen für die Mädchenerziehung ab, die sich an der künftigen gesellschaftlichen Stellung der Frau orientieren.
„So muss sich die ganze Erziehung der Frauen im Hinblick auf die Männer vollziehen. Ihnen gefallen, ihnen nützlich sein, sich von ihnen lieben und achten lassen, sie großziehen, solange sie jung sind[…]“.1165 Die Verantwortlichkeit für den Bestand von Familie und Gesellschaft gäbe der Frau eine ganz exklusive Macht.
Mädchen band man mehr denn je in den familialen Haushalt ein und hielt sie „möglichst lange in der elterlichen Familie“.1166 In ihr fand die eigentliche Ausbildung statt, Riehl 1854: „Die Tochter soll, noch weit entscheidender als der Sohn, möglichst lange in der elterlichen Familie gehalten werden, denn wenn sie auch nebenbei in die Schule geht, ihre Hochschule wird immer das elterliche Haus seyn.“1167 (TM)
Tonys Leben zeigt, dass ihre Familie ihr den Lebensweg vorzeichnet und dieser auf Engste mit ihrer Familie verknüpft ist:
S. 105
Sie hatte den Beruf, auf ihre Art den Glanz der Familie und der Firma „Johann Buddenbrook“ zu fördern, indem sie eine reiche und vornehme Heirat eingin…
Die Eltern äußern ihr gegenüber die familiären Erwartungen, ihr Vater schreibt:
S. 146
Dein Weg, wie mich dünkt, liegt seit Wochen klar und scharf abgegrenzt vor Di…
S. 158
„Wie ein Glied in einer Kette war sie von hoher und verantwortungsvoller Bedeutung, - berufen, mit Tat und Entschluss an der Geschichte ihrer Familie mitzuarbeite…
„Die antizipierte Zukunft in der bürgerlichen Existenzform der Ehe ist ein maßgebliches Konstituens der Mädchenerziehung.“1168 Im Mittelpunkt stand als Erziehungsideal die Gemüts- und Charakterbildung.
Im Unterschied zum Mann hatte die Frau zur damaligen Zeit keineswegs teil an der Persönlichkeitsauffassung der liberalen Strömung,1169 im Gegenteil, die Theorien großer Pädagogen wie Kant, Humboldt, Hensel, Pockel, Rousseau, Ehrenberg und Campe untermauerten die damalige Ausbildung des weiblichen Charakters. Insbesondere Campe konzipierte eine Mädchenbildungstheorie für die Töchter der höheren Schichten in seinem „Väterlichen Rath für meine Tochter“ 1791, in der er die Mädchenerziehung an der Bestimmung der Frau zur Gattin, Hausfrau und Mutter ausrichtete, mit dem Ziel, „beglückende Gattinnen, bildende Mütter und weise Vorsteherinnen des inneren Hauswesens“ zu werden.1170 Weiterhin war es in bürgerlichen Kreisen zu der Zeit üblich, dass Frauen hilflos und schutzbedürftig erschienen und man ihnen anerzog, „schicklich“, nicht allzu „lebenstüchtig“ aufzutreten.1171
Erziehungsziele waren: Ordnung, Enthaltsamkeit, Aufmerksamkeit, Sparsamkeit und eine Erziehung zur Ästhetik der Sauberkeit, die eine Inkriminierung des Schmutzes und eine Etablierung des Ekels beinhaltete. Diese Erziehung zur Reinlichkeit war mit makellosem Benehmen und reinlicher geschmackvoller Kleidung verknüpft.
Ein wichtiger Teil der Erziehung der Mädchen bestand in der Förderung von Scham-, Angst und Schuldgefühlen und der Zurückdrängung des Trieblebens. Aufklärung gab es nicht, Mädchen sollten durch „Schicklichkeit“ und sittliches Verhalten lernen, Verlockungen zu widerstehen, denn - Mädchen, die mit ,manierlicher’ Arbeit beschäftigt und diszipliniert waren, hatten keine Gelegenheit, Unmoralisches zu denken oder gar zu tun.
Erziehung von Mädchen war die Vermittlung von Tugenden, die da hießen: Unterwürfigkeit, Sanftmut und Pünktlichkeit,Sparsamkeit und Geduld.1172
(TM)
Dass aber bei einem Mädchen wie Tony Buddenbrook, wenn die Verhältnisse es fordern, oft erstaunliche Lebens- und Urteilskraft, Pragmatismus und Tüchtigkeit, zutage treten, erkennt man, als sie ihren Bruder von der Vorauszahlung des Weizens überzeugt:
S. 469
„Man begegnet einem Vorschläge nur dann mit Erregtheit, wenn man sich in seinem Widerstande nicht sicher fühlt“...Eine verteufelt schlaue Person, diese kleine Ton…
Galten die weiblichen Charaktereigenschaften als eine Veranlagung der Natur, verlangte hingegen die „reine Weiblichkeit“ Selbstbildung und „Selbstpflege“.1173
S. 92
„Tony, deine Haltung ist nicht comme il faut“, bemerkte die Konsulin, worauf Tony, ohne die Augen von ihrem Buch zu erheben, einen Ellbogen vom Tische nah…
Weibliche Eitelkeit im Zusammenhang mit Verschwendungs- und Zerstreuungssucht wurde als Folge einer fehlgeleiteten Erziehung angesehen. Man lastete es den Frauen an, dass sie „immer unfähiger [werden] zu solchen Entwürfen, die dem häuslichen Wirken und Genießen eine reizende Mannigfaltigkeit beschaffen. Ihr ganzer Erfindungsgeist wird auf die Ausschmückung des Äußern gewendet, und so vergeht ihnen auch das Gefühl für das Einfachschöne, wovon die Häuslichkeit ihre Nahrung zieht.“1174
Negative Charaktermerkmale mussten diszipliniert werden, um die idealen Eigenschaften wie Geduld, Verständnis und Einfühlungsvermögen zu entwickeln, damit in der kleinen privaten Welt die Familienmitglieder die raue Welt von außen vergessen können.1175 S. 82
… und der Konsul war um so entsetzter, als auch Tony, wie gesagt, sich nicht zum besten betrug. Zwar verzichtete sie mit den Jahren darauf, den bleichen Mann tanzen zu lassen und die Puppenliese zu besuchen; aber sie zeigte eine immer keckere Art, den Kopf in den Nacken zu werfen, und äußerte, besonders, wenn sie den Sommer draußen bei den Großeltern verlebt hatte, einen argen Hang zu Hoffart und Eitelkei…
Eltern schenkten solch einer standesgemäßen Erziehung viel Aufmerksamkeit. Wurde den Knaben Unbeschwertheit und Freiheit erlaubt, waren die Rollenerwartungen für die Mädchen starr: Sie hatten einen engeren Aktionsradius als die Jungen und wurden in ihrer Umgebung abgeschirmt. Damit keine Versuchung ihr Leben gefährdete, führten Erzieherinnen und Hauslehrern vormittags und nachmittags Aufsicht über sie auf den Schulwegen, in Gärten oder im öffentlichen Gelände.
Auf diese Art beugte man falschem Umgang vor und ermöglichte den Kindern, „die bürgerliche Wohlanständigkeit der Familie und die Berufs- und Geschäftsqualifikation des Vaters zu repräsentieren.“1176
Vorbild der Mädchen war stets die Mutter. Sie, die ihr ganzes Leben im Kreis der Familie verbracht hatte, erst als Tochter, dann als Mutter, sozialisierte die jungen Frauen so, dass diese nach dem gleichen Rollenschema lebten. Mütterliche Erziehung umfasste die Einführung in die häuslichen Pflichten, die Vermittlung von Kenntnissen der häuslichen Aufgaben und die Erfüllung der Anforderungen mit Liebe, Freude und Hingabe.1177 Konkret bedeutete dies, dass das wirtschaftliche Talent ausgebildet und zur Erziehung eigener Kinder praktisch angeleitet wurde.
(TM)
Erikas Werthaltungen und Orientierungen, ihr Lebensstil und ihr Rollenmuster haben sich dem ihrer Mutter angeglichen, so dass Tony auch nach der Heirat die Person mit dem größten Einfluss auf Erika bleibt:
S. 445ff
Erika sollte sich von ihrer Mutter nicht trennen. Mit dem Einverständnis des Direktors, ja, auf seinen Wunsch hin, war beschlossen worden, dass Frau Antonie - wenigstens vorderhand - bei den Weinschenks wohnen, dass sie der unerfahrenen Erika im Haushalte zur Seite stehen sollt…
Und es begann Tony Buddenbrooks dritte Eh…
In der Tat, alle Sorgen des Hausstandes fielen auf sie, aber auch Freude und Stolz nahm sie für sich in Anspruc…
… zeigte Frau Antonie den Besuchern die Möbel, die Portieren, das durchsichtige Porzellan,, das blitzendeSilberzeug.esist fast so vornehm wie bei Grünlich und sicherlich vornehmer, als bei Permanede…
Das Verhältnis zwischen Mütter und Töchtern kann auch von einem frauensolidarischen Einverständnis geprägt sein und vielleicht sogar von dem gemeinsamen Wunsch anders zu leben:
(TM)
S. 376
„Ja, ja“, sagte sie, „da habe ich traurige Dinge hören müssen, Tony. Und ich verstehe Alles ganz gut, meine arme kleine Dirn, denn ich bin nicht bloß deine Mama, sondern auch eine Frau wie du. Ich sehe nun, wie sehr berechtigt dein Schmerz ist, wie völlig dein Mann während eines Augenblickes der Schwäche vergessen hat, was er dir schuldet…
Nicht nur die Mütter formten in der Familie das Frauenbild, über den Kern der Elternbeziehung hinaus bestand ein großer emotionaler Bezug zu weiteren, oft im Haus lebenden Familienmitgliedern, wie den Großmüttern, Tanten und Großvätern. Tonys Sozialisation erfolgt insbesondere durch das Kindermädchen Frau Jungmann, die mit viel Einfühlungsvermögen agiert. Für sie als Frau sind die geschlechtsspezifischen Anforderungen in der Erziehung mit dem Zurückstellen eigener Interessen verbunden.
22.3.2 Erziehung im 20. Jahrhundert
Im 20. Jahrhundert übernimmt die Kleinfamilie die Sozialisations- und Erziehungsaufgaben. Die ältere Generation der 30er und 40er stellte als Eltern klare Regeln auf und forderte die Erfüllung von Pflichten und die Einordnung der Kinder in das familiale Gefüge; Befehl und Unterordnung spielten eine große Rolle. Diese traditionale Erziehung war bestimmt durch eine Verhaltensanforderung und einem zentralen Inhalt der Erziehung: dem Gehorsam. Man stellte Verhaltensmuster auf, und nur kleine Freiräume gaben Kindern die Möglichkeit ohne Kontrolle der Eltern zu sein.
(AG)
Richard Sterks Kindheit wird von Alma als unfrei und streng religiös charakterisiert: S. 40
In seiner oberklerikalen, reichen Familie hatte er ja so gut wie keine Spielräum…
Sie selber erlebt, ähnlich wie Tony Buddenbrook, eine unbeschwerte, freie Kindheit, derjenigen der Jungen zwar ähnlich. Aber all deren Spiele mitzuspielen war ihr als bürgerliches Mädchen verwehrt, weil es sich auch damals nicht schickte und mit den Tugenden der bürgerlichen Weiblichkeit, z.b. der Sauberkeit, nicht vereinbart war. Die Straße galt als ein Ort der Unterschichtskinder:
S. 40
In Meidling führte ich ein fast ebenso freies Leben wie die Halbwüchsigen heute…
Der Spritzwagen war immer von einer Menge Buben begleitet, die sich die Hosen ganz hoch hinaufsteckten, um möglichst weit in den Strahl laufen zu können. . Eigentlich wäre Alma auch gerne mitgelaufen, aber sie wusste, dass das nur Gassenkinder tun, solche, deren Väter auf den fingern pfeifen. Ihre Mutter, die oft für einen Augenblick aus dem Fenster schaute, hätte es bestimmt nicht gern gesehen, wenn ihre Tochter mit von der Partie gewesen wär…
Almas Mutter-Tochter-Beziehung zu Ingrid ist durch Ansprache und Verständnis geprägt und anders als das Verhältnis von Ingrid zu ihrem Vater.
S. 172
- Vorerst hast du Hausverbo…
- Was sagt eigentlich deine Mutte…
- Mama? Die übt sich in Neutralität. Ich muss ihr halt immer versprechen, brav zu sei…
Almas Erziehung unterscheidet sich von der ihres Mannes insofern, dass sie mit Liebe und Fürsorge auf das Kind/die Kinder eingeht, Freude am gemeinsamen Spiel zeigt und dem Kind in Worten und Gesten viel Zärtlichkeit schenkt.
S. 151
- Ich hack nicht auf dir herum. Mich beschäftigt, wie es dir geht. Aber du musst auch ein Minimum an Verständnis für deine Eltern aufbringe…
Richard dagegen fordert Einordnung in die Familienstruktur. Als Generation aus der NS- Zeit ist sein Umgang mit den Kindern von Gehorsam, Unterordnung und Strenge geprägt. Und wenn Richard auch an die nationalsozialistischen Verheißungen „nicht recht glauben kann“ (S. 60), hat er einen „Herrschaftsanspruch [..] zu Hause“ und will „Herr im eigenen Haus „(S. 145) sein.
S. 143
Papa omnipotens. Was aus seinem Mund kommt, ist Dikta…
In der Hierarchie der Familie war er als der Vater die oberste Instanz. Sein beruflicher Erfolg und das damit verbundene soziale Ansehen bestimmten, so wie in der Zeit des Bürgertums, seine familiäre Position als Oberhaupt. Er repräsentierte die Familie, traf Entscheidungen und stützte die patriarchalische Struktur der Familie.
Peter Erlach wurde durch die NS-Zeit mit der Erziehung des Befehlens und dem Gehorsam als zentralen Inhalt der Erziehung konfrontiert. Das Bild von seinem Vater ist durch die nationalsozialistische Ideologie und deren autoritären Befehlshaushalt geprägt. „Traditionale Machtbalance“1178 hieß: Eltern sind die Respektpersonen und in der ElternKind-Konstellation hatten Eltern mit dem Kind, dem kleinen Tyrannen, eine Machtprobe auszufechten. In Ratgebern wurde der mitleidlose und disziplinierende Zugriff auf das Kind propagiert (Johanna Haarers Ratgeber „Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind“ und dessen Veröffentlichung in Zeitungen.), andere Erziehungskonzepte wurden als willensschwach und überspannt bezeichnet.1179
Nationalsozialistische Erziehungsinstitutionen beeinflussen sein Selbstbild und seine individuellen Zukunftserwartungen: Die Aktivitäten in der Gemeinschaft der Hitlerjungen bestimmen ab dem zehnten Lebensjahr das Leben des Heranwachsenden und sozialisierten ihn mit Angeboten musischer, technischer und sportlicher Art.1180
Ziel der Mitgliedschaft in den politischen und weltanschaulichen NS-Jugendorganisationen für Jungen war es, ein starkes Kriegskind zu werden, „hart wie Kruppstahl und zäh wie Leder“. Schwäche zu zeigen war unzulässig, stattdessen standen Stärke, Disziplin und Drill im Mittelpunkt, eine Vorbereitung auf das Soldatenleben mit seinem blinden Gehorsam, verbunden mit dem Versprechen von jugendlicher Freiheit und Auserwähltheit. Eine emotionalisierende Wirkung blieb nicht aus: Körperliche Ertüchtigung mit Aufmärschen, Fackelzügen und Lagerfeuerromantik begeisterten und ließen das Gefühl der Gemeinschaft erleben. Männermarsch-Lieder vermittelten Kraft und Opferbereitschaft, ihr Gesang beim Marschieren hatte eine starke irrationale Bedeutung und prägte die Stimmung und die Einstellung der jungen Männer: „Dem überzeitlich-anthropologischen, gewissermaßen Hin- und Hergerissensein des 15-20jährigen Heranwachsenden zwischen Begeisterungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft einerseits, Melancholie und Selbstzweifeln andererseits vermittelten unter den spezifischen mentalen Verhältnissen der 20er und 30er Jahre […] Männerbundlieder eine heroisch-melancholische Gefühlswelt, in der man sich jenseits der tristen Alltagsverhältnisse emotional einrichten konnte.“1181 Hinzu kamen Symbole, wie z.B. die Fahne, und Begriffe wie Blut, Volk und Treue, sie formten eine nationalsozialistische Nationalkultur und erzogen Heranwachsende zur Treue zum Regime.
Die NS-Propaganda prägte die eigenen Rollenvorstellungen1182 und die Sichtweise vom Krieg, dieser galt als eine „Bewährung der jungen Generation“.
Um das Gefühl der Wichtigkeit zu haben und ein aktives Mitglied in der Gesellschaft zu sein, war Peter in die HJ eingetreten, positive Erwartungen, Abenteuerlust, persönliche Begeisterung und die Faszination des Krieges führten dazu, dass er sich freiwillig zur Wehrmacht meldete und sehnsüchtig seinen Einsatz erwartete.
Der klassische Patriarchalismus mit der Pflicht zum Gehorsam war in den 50er Jahren nur noch in der Oberschicht existent1183 und zeigt sich in Richards väterlichen Erziehungsstil. Traditionell bleibt bis ins späte 20. Jahrhundert die geschlechtsspezifische Rollenverteilung der Erziehung. Erst in der jüngeren Generation wandeln sich erzieherische Aspekte. In den Romanen sind Frauen die zentralen Bezugspersonen, sie übernehmen die Erziehung, während sich Männer als Vollbringer von Leistungen verstehen. Spielten in der Zeit des Bürgertums die Dienstboten und ältere Geschwister eine wichtige Rolle bei der Erziehung, sind es von nun an nur zwei Bezugspersonen: Mutter und Vater, wobei die Mutterbeziehung die exklusivere ist.
Dass die familiale Sozialisation sich überhaupt veränderte, lag an dem neuen Menschenbild, das, aus den USA der 40er Jahre kommend, das Kind nicht mehr als asoziales, tyrannisches Wesen sah, sondern als eines, das „von Natur aus“ perfekt ausgestattet war. Die sozialen Beziehungen in der Familie standen nun im Mittelpunkt, mit der zentralen Bedeutung des Kindes als einen emotionalen und psychischen Befriedigungsfaktor. Der Wert von Kindern liegt seitdem in der emotional-psychischen Ebene und nicht im instrumentell-materiellen Bereich. Kinder bedeuten nun, wie im Bürgertum Lebenserfüllung und Glück.1184
(AG)
Ingrid empfindet ihre Kinder als immens wichtig, sinngebend und als zentral in ihrem Leben.
S. 259
Das einzig Gute, was dabei herausgekommen ist, sind die Kinde…
Wie ihre Mutter lässt sich Ingrid auf das kindliche Verhalten ein und beweist Einfühlungsvermögen in die kindliche Psyche. Sie spielt die Spiele der Kinder mit und wird selber dabei zum ausgelassen Jugendlichen:
S. 255-261
Wer Lust habe, sich auszulüften, solle bis in fünf Minuten gerichtet sein. …
- Türkenschanzpark oder Schönbrunn? fragt Ingri…
- Schönbrunn, tönt es einhellig. …
Doch da Philipp das Weinen vergisst, kann auch Ingrid über die Situation lachen. Am liebsten würde sie Sissi den Rat geben, sich diese Art für ihre späteren Männer zu bewahre…
Kurz darauf übernimmt Ingrid das Ziehen des Bobs, weil Philipp allmählich die Puste ausgeht. Na bitte, da ist die Welt für ihn wieder hei…
- Du bist die beste Mama, keucht er…
Augenblicke später biegen Jugendliche in Ingrids Gesichtsfeld, die sich auf italienisch unterhalten. zwei Paare bilden sich. Ohne Musik tanzen sie im Walzerschritt die Allee herunter. … Ingrid hat eine riesige Freude, sie strahlt mit den Jugendlichen, wirft ihren roten Schal, der gut zu ihren vielen Haaren passt, zurück über die Schulter und dreht sich ebenfalls zweimal. Mit einem Luftpartner und der Zigarette in der Han…
Durch die Kritik der 68er Generation an der „bürgerlichen Gesellschaft“ und der „bürgerlichen Familie“ mit der Forderung kam es zur Gleichberechtigung von Söhnen und Töchtern. Die demokratischen Vorstellungen etablierten sich in den Familien und statt des Oben-Unten-Schemas entstand das partnerschaftliche Modell in der Familie.
In der Erziehung bewirkt nunmehr die Koedukation bei Kindern beiderlei Geschlechts eine gemeinsame und gleichartige Erziehung, die geschlechtsspezifische Erziehung wurde obsolet.
(AG)
Das Sich-Einfügen in geschlechtsspezifische Handlungsmuster ist bei Sissi und Philipp nicht mehr erkennbar.
S. 259
Philipp rast hinter seiner lachenden Schwester her wie Mord und Brand. Dies ist ihm nicht zu groß zum Raufen. Er schrei…
- Du blödes Viec…
Beim gemeinsamen Waschen in der Badewanne spielen Sissi und Philipp, wie bereits Ingrid und Otto mit ihrer Mutter, Tauchspiele - ohne Scheu.
S. 265
Gleich wird Philipp hochschießen, dass das Wasser an alle Wände spritzt, und keuchen, ganz erschöpft und enttäuscht, dass ihn Sissi schon wieder geschlagen ha…
Die Erziehungsziele und -praktiken wandelten sich hin zu liberalen Umgangsmustern. Setzte Richard noch auf Ge- und Verbote, wurden nun Erklärungen und Diskussionen zum Mittel der Erziehung.1185 Das bürgerliche Erziehungsideal, das bis in die Sechziger Jahre aus Liebe und Strenge und den Erziehungszielen der Höflichkeit, Sauberkeit, Ordnung und Lernbereitschaft Bestand hatte, veränderte sich in Richtung einer stärkeren Autonomie des Individuums. Es sollte fähig sein, Eigenverantwortung und Selbstbewusstseins zu zeigen, weg von Gehorsam und sozialer Konformität, hin zu mehr Selbständigkeit mit den sozialen Kompetenzen Hilfsbereitschaft und Rücksicht.
(AG)
Im Alter hinterfragt Alma die traditionale autoritäre Erziehung. Sie bedauert, mit Angst und Strenge erzogen zu haben und erkennt, wie sehr sich die sozialen Regeln in der
Erziehung veränderten. Der antiautoritäre Erziehungsstil nach dem Ende des 2. Weltkriegs war für sie zunächst ein „Kulturschock“, später durchaus nachvollziehbar:
S. 350 (1989)
… und später die Holländer von der Unilever.., die lachten, als ihr Bub vom ersten Schultag nach Hause kam und am Klo an die Wand pinkelte, da gab es kein Strafknien oder dass der Kampus nur Kartoffeln und Kohlen bringt, damit das Kind nicht übermütig wird, da hieß es, die Kinder haben eine geschäftige Phantasie, die soll sich ausleben, damit später etwas aus ihnen wird, da wurde eher das Kindermädchen zurechtgestutzt wegen unnötiger Strenge. So Begriffe hatten die, für mich war das anfangs ein kleiner Kulturschock, aber dann habe ich schnell verstanden, in welcher Richtung es weitergehen mus…
Almas Überlegungen zur veränderten Erziehung belegen, dass unter den heutigen Lebensbedingungen nicht mehr nur die Jüngeren von den Älteren lernen, sondern ebenso die Älteren von den Jüngeren.
S. 350
… da hieß es, die Kinder haben eine geschäftige Phantasie, die soll sich auslebe…
Jugendliche entwickelten im Zuge des gleichberechtigten Denkens in der Familie ein Bedürfnis nach persönlicher Autonomie, Familie wurde zu einem Moment des Erwachsenenwerdens mit dem Weg hinaus in die Selbständigkeit und zu größerer Verantwortung.
(AG)
Wie sehr die Neigung, sich einer persönlichen Hierarchie zu unterwerfen, nachließ, lesen wir bereits 1955 bei Ingrid: Ihr Aufbegehren gegen Regeln ist eine Rebellion gegen die autoritäre Elterngeneration. Sie teilt nicht mehr Richards Familienbild und sieht ihn in der Rolle eines Gefängniswärters.
S. 148
Sie ist nicht die Zukunft ihrer Eltern. Sie ist ihre eigene Zukunf…
Ihre und Peters Generation hatte in der Kindheit noch nicht die Möglichkeit, die traditionalen Inhalte der Erziehung und die Macht der Eltern zu durchbrechen, sind aber diejenigen, die als Eltern versuchen, eine neue Form von Erziehung umzusetzen. Durch eigene Erziehungserfahrungen wird bei ihnen der Wunsch geweckt, andere Erziehungsinhalte und eine kindgemäßere Erziehung zu praktizieren.
So wechseln die Aspekte der Erziehung, die sie an der Erziehung ihrer Eltern kritisierten und die sie als lebensgeschichtliche Erfahrungen in der Kindheit machten, wie z.B. Unterordnung, große Distanz und Verregeltheit, hin zu neuen Inhalten und einem neuen Erziehungsmodell.1186 Als Elterngeneration führen sie manche selbsterfahrene Erziehungs- und Verhaltensmuster weiter, entwickeln aber gleichzeitig eine andere Haltung gegenüber ihren Kindern. Erziehung wird kindzentrierter und kindorientierter, mit einem Zugeständnis an Freiheit und Selbständigkeit.1187
Diese Freiheit und Unabhängigkeit der Kinder schließt Arbeit im Familienalltag scheinbar aus, denn auch, wenn Ingrid als Mutter beruflich stark engagiert ist, ist von einer kindlichen Mithilfe im Familienalltag nichts zu lesen. Erfahrungsgemäß korreliert diese mit der Höhe der familiären sozialen Stellung, d.h. je höher die soziale Stellung, desto geringer die Mithilfe.1188
S. 254
- Es wäre leichter, wenn das Essen nicht wäre. Einen Augenblick später steht er, ohne zu fragen, vom Tisch auf und steigt in den oberen Stock hinauf. Sissi nutzt die Gelegenheit und steht ebenfalls au…
Ingrid badet die Hände im Abwaschwasser, schichtet die Teller in den Reiter zum Abtropfen. Mitunter wenn sie einen schlechten Tag erwischt, kommen ihr diese Kleinigkeiten schlimmer vor als Krieg und Winte…
Geigers Roman gibt Beispiele dafür, dass die emotionale Nähe und das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter besonders eng ist:
Die Mutter-Tochter-Beziehung von Alma und Ingrid ist bis in die spätere Zeit durch eine größere Initimität und Emotionsbeladenheit geprägt als die Beziehung zwischen Vater und Tochter.
S. 367
Einmal ging Alma rüber ins Bad, Ingrid saß völlig verschlafen am Klo, da war Ingrid bereits siebzehn oder achtzehn. Alma streichelte Ingrids Kopf und drückte ihn gegen ihren Bauch, es war wie in alten Zeite…
Alma verspürt trotz des Konflikts von Ingrid und Richard eine Verpflichtung und Nähe zu ihrer Tochter und unterstützt als Teil einer Elterngeneration materiell und immateriell die junge Familie mit Sachleistungen zur haushalts- und wohnmäßigen Versorgung.
5. 207f
- Ich bitte dich, Richard, egal, wie Ingrid sich anstellt, vergiss nicht, dass du nur diese eine Tochter has…
- Ich wer’mir Mühe gebe…
Alma kommt ihm zu Hilfe und leitet auf das eigentliche Thema des Besuchs über: dass etwas mehr Luft vor allem in den unteren Räumen längst fällig sei. Die meisten Zimmer, sagt sie, ersticken an ihren Möbel…
Freie Zeit hat in der Familie Erlach einen Kompensationseffekt und wird intensiv für die Freizeitgestaltung genutzt. Ingrid nimmt als Mutter mehr als ihr Mann an den Freizeitbeschäftigungen ihrer Kinder teil und integriert sie in das Familienleben. Es herrscht eine positive Grundstimmung in der Freizeit. Die wichtigsten Spielpartner sind Geschwister:
S. 247
Die Kinder werden nicht das erste Mal allein zu Hause sein. Ich habe den hartnäckigen Verdacht, sie beschäftigen sich auch heute ohne elterliche Anleitun…
Der Freizeit- und Spielbereich hat sich in den hundert Jahren seit Tony Buddenbrooks Kindheit verändert:
Die äußere Umwelt der Kinder ist geprägt durch Straßen- und Wohnungsbau, so dass Spielen unter der Kontrolle eines Erwachsenen in den kultivierten Grünanlagen stattfindet.
Ingrid sieht sich in der Pflicht, den Bereich des unmittelbaren Erlebens der Kinder zu verstärken und der Verhäuslichung des Spiels vorzubeugen.
S. 255
Da sieht sie Philipp mit seinem Matchbox-Traktor auf dem oberen Treppenabsatz sitzen und vor sich hinstarren. Er tut ihr leid…
Deshalb sucht sie mit ihm und Sissi einen städtischen Spielort auf:
S. 256
Auch Ingrid ist Schönbrunn lieber, weil dort die Wege besser geräumt sind und das Gehen leichter fällt. Sie packt Kinder und Hund in den Wagen …
Beide Kinder spielen mit nachbarschaftlichen Spielgruppen:
S. 250
Sissi gehorcht bereitwillig in gespielter Ahnungslosigkeit, anschließend erzählt sie, dass Philipp beim Rodeln, als er bei einem gewissen Hansi mitfahren durfte, sich um zehn Zentimeter Breite fast den Schädel entzweigeschlagen hätt…
In der Mediennutzung unterscheidet sich das heutige Freizeitverhalten von dem der früheren Familie gewaltig. Massenmedien entwickelten sich seit den 60er Jahren zum vorherrschenden Informations- und Unterhaltungsmedium und binden viel Zeit der Kinder. (AG)
Die Allgegenwart der Medien, besonders des Fernsehens, als heimlicher Erzieher ist in der Familie von Philipp und Sissi zu erleben; auch wenn das Massenmedium nicht das familiäre Freizeitverhalten in Gänze bestimmt, wird es machtlos und stillschweigend geduldet.
S. 250
- Morgen muss der Pyjama gewaschen werden, sagt Ingri…
Sie hilft Philipp hinein, fordert ihn auf, mit nach unten zu kommen und sich im Fernsehen die Mama anzuschauen, wie sie als Mädchen in Schwarzweiß und im Schürzenkleid ausgesehen ha…
Erziehung ist in der Gegenwart durch Individualisierung geprägt. Kinder werden aufgrund ihrer charakterlichen Eigenheiten/ihrer Individualität unterschiedlich gefördert und erzogen, man bringt ihnen Respekt entgegen und schätzt ihre individuellen Fähigkeiten. Die Bedürfnisse des Individuums mit seiner Selbständigkeit und Selbstbestimmung stehen heute vor denen der Familie, Unabhängigkeit ist das primäre Ziel.
(AG)
Dies zeigt eine Episode 1978, als Peter alleinerziehender Vater ist:
S. 290
Solange er sich keine Sorgen macht (dieses Recht werden sie ihm hoffentlich zubilligen), redet er den Kindern nicht drein. … vor gut zwei Stunden, als Philipp und er zur Abfahrt bereit waren, nahm er es hin, dass die Waschmaschine noch eine Dreiviertelstunde brauchte … Er nimmt diese Dinge hin, manchmal mit einem Gefühl der Beklemmung. Aber dann redet er sich zu, dass Sissis Art auch ihre guten Seiten hat, zum Beispiel, wenn er selber später dran ist, als er versprochen hat, und Sissi es gar nicht bemerk…
Angesichts Philipps späterer Isolation und Einsamkeit ist Unabhängigkeit aber als Erfolgskriterium einer gelungen Erziehung und Entwicklung zu hinterfragen.1189
Kinder besitzen heute mehr Selbstbewusstsein, ihr Verhalten ist geprägt von Selbständigkeit statt von Schüchternheit, Unmündigkeit, Fremdbestimmung und Unterwerfung. Man gewährt ihnen einen größeren Raum der Selbstgestaltung und gibt ihnen das Recht auf die freie Entfaltung der eigenen Fähigkeiten und Neigungen, ohne der Familientradition verpflichtet zu sein. Indem sie Entscheidungen selber in die Hand nehmen, verlieren gleichzeitig die Eltern das Recht, in die Lebensplanung der Kinder einzugreifen. Die Emanzipation der Kinder führte dazu, dass diese wirtschaftlich unabhängiger wurden und die väterliche/elterliche Autorität an Bedeutung verlor.
(AG)
Wie sehr Kinder Selbständigkeit und Selbstverantwortung einfordern, zeigt sich im Verhalten von Sissi, das schon früh zur Unabhängigkeit führt:
S. 323
- Ich gehe bis zur Grenze zu Fuß, sagt Siss…
Und weg ist si…
Peter blickt ihr hinterher mit einem Gefühl des schleichenden Verlusts. … Und das sie sich nicht umdreht. ..obwohl er weiß , es ist das, was sie jetzt braucht, anderthalb Stunden, in denen sie ihrer Familie entrinnt und auf sich selbst gestellt ist ein Gefühl (die konkrete Erfahrung der Freiheit?), das ihre Sehnsucht mildert und sie der Antwort auf die Frage näher bringt, ...: ,Wo nur bin ich in diesem Stro…
Bis heute aber konfrontieren Eltern ihre Kinder mit Bildungs- und Aufstiegsaspirationen, (AG)
So erlebt es Ingrid 1955:
S. 148
Es wird ihr langsam zuviel, alle Erwartungen von Jugend und Aufschwung und besseren Zeiten in ihrer Person konzentriert zu sehe…
Und eben so erleben es Philipp und Sissi 1978:
S. 293
Dabei ist die Erleichterung darüber, wie die Zeugnisse ausgefallen sind, bei allen große, auch bei Peter, der angesichts der vielen Schularbeiten, die er nie zum Unterschreiben vorgelegt bekommen hat, unangenehme Überraschungen nicht ausgeschlossen hätte. Sissi hat etliche Dreier im Zeugnis und einen Vierer in Mathe, von dem sie behauptet, dass er vermeidbar gewesen wäre …
Philipp hingegen ist während des halben Schuljahres grün im Gesicht. .. Die letzte Schularbeitenrunde hat er komplett verhaut, da ist ihm die Puste ausgegangen, auch, weil Cara, sein Liebling, Anfang Juni eingeschläfert werden musste. ..Philipp ist auch der einzige in der Klasse, der es glaubwürdig schafft, den Nachmittagsunterricht zu vergessen. .. Ja wahrlich, ein kleiner Dep…
Gleichberechtigte Umgangsformen ließen das Kind in der modernen Familie zum Partner der Eltern werden, das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern veränderte sich zu einem Vertrauensverhältnis mit weniger Informalisierung und mehr Intimität. Autoritative Erziehungsmuster verbinden Konsequenz mit emotionaler Wärme. Die so erzogenen Kinder verfügen über hohe kognitive und soziale Kompetenzen und im Jugendalter über Selbstwertgefühl und soziale Fertigkeiten.1190 (AG)
Peter als alleinerziehender Vater im Jahre 1978 versucht auf diese Art seine Kinder zu erziehen:
Erziehung funktioniert nun nicht mehr nach dem Befehl-Gehorsam-Prinzip, sondern verlangt von ihm als Vater Toleranz, Rücksichtnahme, Einsicht und Verhandlungen1191 - ein Wandel vom Befehls- zum Verhandlungshaushalt.
Das Gespräch ist ein Grundpfeiler der Eltern-Kind-Beziehung, und mit seinen Erklärungen und Diskussionen nimmt es heute Zeit und Energie in Anspruch.1192 Konflikte werden nicht mehr autoritativ gelöst, sondern mit Heranwachsenden, die sich wie erwachsene Subjekte fühlen dürfen, thematisiert und ausgehandelt.
(AG)
Sissi demonstriert ihren Widerwillen offen gegen den gemeinsamen Urlaub und äußert klar und deutlich Kritik dem Vater gegenüber:
S. 288
- Nur mich fragt wieder mal keine…
- Ich brech gleich in Tränen aus. Du wirst Spaß haben, und außerdem wirst du dich erhole…
- Wenn meine Erholung deine einzige Sorge is…
- Es ist zumindest eine, mein Got…
- Ich würde mich aber besser erholen ohne euc…
- Indem du im Zug zwischen Innsbruck und Neapel am Gang schläfst. Nach meiner bescheidenen Meinu…
- Es gibt noch andere Gründe, warum mir dieser Urlaub schaden wird. Weil Familienleben die Persönlichkeit zerstör…
- Jetzt hör aber auf. …
Von den Eltern wird eine hohe sprachliche Kompetenz verlangt, um zu Lösungen und Kompromissen zu kommen, und dass Kinder oft den Vernunftargumenten der Erwachsenen nicht gewachsen sind und schon deshalb mit Abwehr reagieren, kann durchaus passieren.1193 Empathie prägt die Beziehungsstrukturen zwischen Peter und seinen Kindern.
Es herrscht Gleichberechtigung zwischen Vater und Tochter. Peter praktiziert mit den adoleszenten Kindern einen Umgang des Verhandelns, auf freundschaftlicher, partnerschaftlicher und egalitärer Basis. Seine Haltung ist demokratisch orientiert mit Toleranz und Flexibilität. Die Kommunikation zwischen ihm und den Kindern ist symmetrisch, die Kinder sind ernstgenommene und gleichberechtigte Partner und bekommen Entscheidungsräume. Es fehlt jede Form von Disziplinierung von Seiten Peters, er schilt die Kinder nicht und ist sehr nachgiebig.
S. 317
Da die Kinder nicht reagieren, lenkt Peter den Wagen in die Nische einer Bushaltestelle und lässt die Kinder balgen, bis ihr Zorn von selbst erlahmt…
Peter sagt, fast ohne die Stimme zu hebe…
- Sissi, du brauchst deinen Grant nicht an Philipp auslasse…
Im anderen Deutschland unterschied sich die Erziehung aufgrund politischer Vorgaben.
22.3.3 Erziehung in der DDR
Im Mittelpunkt der ,antifaschistisch-demokratischen’ Schulreform in der DDR stand die Erziehung der Jugend im Geiste des Friedens und der Demokratie. Die kommunistische Utopie zielte auf den aufopferungsvollen, ehrlichen, gesunden Menschen, der Heimat, Partei und Volk liebte.1194 Das erklärte Erziehungsziel der Bildungs- und Erziehungspolitik war, den sozialistischen Menschen /die sozialistische Persönlichkeit als „aktiven und guten Staatsbürger“ zu formen. Dies ging einher mit der Bekämpfung des westlichen Denkens und Verhaltens. Begriffe/Floskeln wie ,Solidarität’, ,Internationalismus’, ,Leitbild der sozialistischen Persönlichkeit’ und ,Hass auf den Klassenfeind’ prägten die Ziele dieses Erziehungskonzepts.1195 Erziehung lehnte sich an den sowjetischen Pädagogen Makarenko an, der die Auffassung vertrat, dass erzieherische Ergebnisse durch Kontrolle und Erziehungsarbeit geplant werden könnten. Schlechte Erziehung galt als vom Erzieher verschuldet und Abweichungen oder normwidriges Verhalten von Jugendlichen schrieb man Fremdeinflüssen zu. Statt Eigeninitiative erwartete man vom Kind Einordnung und Disziplin und ließ dabei biographische oder psychologische Dispositionen, differenzierte Realitätswahrnehmungen und Autonomiebedürfnisse außer acht.
Die sog. sozialistische Persönlichkeit löste das individualistische Streben ab und ging in der Gemeinschaft auf, indem sie den für das Gemeinwohl kollektiven Zielen Vorrang gab und nicht wie im Westen das Streben nach persönlichem Glück in den Vordergrund stellte. Kollektivbildung und Engagement in der Gesellschaft statt des westlichen Individualismus mit Eigeninitiative sollten den jungen Menschen prägen. Persönliche und private Fragen, Mode und Lebensstil, alles war politisch.
Die propagierte Erziehung zum demokratischen (später: „sozialistischen“) Patriotismus, in die sowohl politische Einstellungen, Sozialismusverständnis, Demokratieverständnis als auch bürgerliches Denken einflossen, stellte hohe Anforderungen sowohl an die Lehrer als auch an die Eltern. Beide hatten sich in ihrer Aufgabe pädagogisch zu unterstützen und zusammenzuarbeiten, sei es durch Elternseminare, Besuche oder eingerichtete Elternbeiräte an Schulen. Diese Pflege der Beziehung zwischen Elternhaus und Schule oblag SED-Genossen/-innen, oft die ideologisch „Hundertprozentigen“, und zielte darauf, die Eltern politisch zu beeinflussen. Das stieß nicht selten bei den Eltern auf Kritik.
Ab Mitte der 50er Jahre standen Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt der ideologischen Offensive: Schule und Freizeit hatten lückenlos zu loyalen Staatsbürgern zu erziehen. DDR-Erzieher galten hierbei mit ihrem Expertenwissen zunächst als der Familie überlegen, sie sollten ein Gegengewicht zur familiären Erziehung sein. Die Qualität der elterlichen Erziehung schätzte man unterschiedlich ein. Je nach politischer Aktivität und der Einstellung zu Arbeit und Staat brachten sie eventuell auch Skepsis gegenüber dem Regime zum Ausdruck und übten damit negative Einflüsse auf die Kinder aus.1196 Es wurde zum erklärten politischen Ziel, die Wertevermittlung durch Familie und Kirche zu verhindern und deren Einfluss auszuschalten.
In den späteren Jahren revidierte man diese Auffassung und räumte der Familienerziehung einen hohen Stellenwert ein, sichtbar in der Einführung des „Babyjahres“.1197
Im Familiengesetzbuches war der staatlicher Erziehungsanspruch und die Vergesellschaftung familiärer Funktionen in gesellschaftliche und staatliche Einrichtungen verankert.
Von Beginn der 60er Jahre an ergänzten Kinderkrippen, -gärten, (Vor-)Schule, Horte, FDJ und Pioniere die Familienerziehung. Der Ausbau vollzog sich in großem Maße. „Die Normen der sozialistischen Erziehung“ drangen zügig in die Familie ein, da die Kinder den größten Teil des Tages der „erzieherischen Einwirkung … ausgesetzt [waren].“1198 (ER)
Sascha, dessen Geburtsjahr 1954/1955 ist (S.80:Er war ja erst vier.) gehört als Teil der älteren Kohorte zu den Kindern, die Betreuungseinrichtung besuchen und institutionell betreut werden. Seine Betreuung obliegt daneben auch noch anderen Personen, wie den Eltern oder den Großeltern, diese Form der Erziehung wurde zur Seltenheit, privat bezahlte Betreuung, z.B. Tagesmütter, gab es in der DDR nicht.
S. 76
Alexander lag auf seiner Pritsche und träumte davon, bis unendlich zu zählen…
Dann bekam er ein Buch auf den Kopf. Das war Frau Remschel, sie passte auf, dass man schlie…
Der Roman zeigt, wie groß, trotz der staatlichen Erziehungseinrichtungen die Bedeutung von Eltern und Familie für die Erziehung und wie eng die Beziehung zwischen Irina und ihrem Sohn war. Sascha ist das Objekt einer liebevollen Fürsorge seiner Mutter und der Großmutter. Irina fällt es schwer, den Sohn aus der engen Eltern-Kind-Beziehung freizugeben.
Sascha erlebt eine behütete Kindheit und tiefe Liebe von Seiten der Eltern, S. 134
Aber Alexander sagte: - Ich will Auto fahre…
- Nachher fahren wir ja wieder zurück, sagte Kurt. Doch das Kind war nicht umzustimmen: Auto fahren! Irina sagt…
- Na, dann farren wir nach Cecilienho…
- Das ist zu kurz, entschied Alexander. Ihr habt gesagt Autotou…
Saschas Vater ist in der Erziehung involviert. Über das Moment des Argumentierens wird die Selbstverpflichtung des Sohnes angesprochen und deutlich, dass die Eltern hohe Bildungsanforderungen und hohe Erwartungen an ihre Kinder haben.
Das Schachspiel von Vater und Sohn hat das Ziel, bei Sascha wichtige Fähigkeiten, wie Kreativität und strategisches Denken zu entwickeln und stellt in seiner Komplexität eine Leistungsanforderung dar.
Die Beziehung zwischen den Generationen bleibt trotz der Migration von Sascha bestehen.
Von staatlicher Seite entwickelte sich eine „familienersetzende Vollbetreuung“.1199 Bereits die Kindergartenplätze waren Ganztagsplätze mit flexiblen Öffnungszeiten und ÜberMittag-Betreuung. Zu einer Reformierung des pädagogischen Programms und der Ausbildung des Personalas kam es, als man in den 60er Jahren Entwicklungsrückstände bei Krippenkindern im Vergleich zu Familienkindern beobachtete.
Anders als im Westen, wo man seit Ende der 60er Jahre der Selbstfindung und -entfaltung der Jugendlichen große Bedeutung beigemessen hat, sozialisierte die DDR ihre
Jugendlichen in Massenorganisationen (Pioniere, Freie Deutsche Jugend) in Hinblick auf die Anpassung an die Parteierwartungen und dem Ziel der sozialistischen Persönlichkeit. Man versuchte, möglichst jeden Einzelnen in den staatlichen Gruppen zu erfassen und die Mitgliedschaft mit Privilegien zu verbinden. Demokratische Partizipation und Rechtsstaatlichkeit existierten nicht.1200 Die Kontrolle und Planung der Freizeit durch die staatlich gelenkten Jugendgruppen hatte das Ziel, den Freiraum der Jugendlichen einzuschränken, aus Angst, er könne vom „Feind“ besetzt werden.
Bereits 1947 wurde die Freie Deutsche Jugend (FDJ) als staatliche Jugendorganisation gegründet. Sie erkannte die führende Rolle der SED an und sah ihre Aufgabe in der politisch-erzieherischen ideologischen Überzeugungsarbeit, unterstützt durch die Jugendweihe. Die Ansprache der Jugendlichen erfolgte über Sport- Musik-, Tanz- und Diskussionsveranstaltungen.
Ihre Tätigkeit war in den Unterrichts- und Lehrbetrieb integriert. In dieser Organisation sahen sich Jugendliche eher selten repräsentiert,1201 passten sich aber an und entzogen sich ihr nicht, weil sie wussten, eine Nonkonformität konnte Folgen für die Zukunft haben. Und so prägte sie trotz dieser empfundenen Distanz das Alltagsleben der jungen Menschen, weil man wusste: Das FDJ-Kollektiv hat Einfluss auf das Vorwärtskommen und die Karriere, es beurteilt das „gesellschaftliche Engagement“ des Einzelnen und entscheidet über die Vergabe von Studienplätzen. Auf diese Art verstärkten sich Anpassung und Heuchelei.
Pionierarbeit, bei den Schulanfängern anerkannt und beliebt, gestaltete die Freizeit und die Ferien der Kinder.
(ER)
S. 197
Er steckte der Pionierleiterin den Hundertmarkschein ins Dekollet…
- Dann nehmen wir es für die Klassenkasse, sagte die Pionierleiteri…
Ihr Gesicht hatte rote Flecken bekommen. Sie dirigierte die Kinderschar aus dem Garte…
Freizeitgestaltung beinhaltete für junge Menschen die Teilnahme an von der Politik organisierten Aktivitäten oder der Besuch von Konzerten und anderen kulturellen Veranstaltungen. Es gab mehrere tausend Klubs, von der SED und FDJ unterstützte Orte, an denen sich eine große Anzahl von Jugendlichen in ihrer Freizeit zu Tanzveranstaltungen und Konzerten traf. Die DDR Führung kanalisierte auf diese Art die Interessen der Massen zwecks politischer Kontrolle.
(ER)
Sascha besucht ihre Veranstaltungen, findet sie trist und deprimierend:
S. 225
Vor dem , Berg'stand wie immer ein Pulk von Leuten, die allesamt keine Karten hatten. Eine Flasche Wodka ging rum. Man wiegte sich zu der sich leicht überschlagenden, durch Fenster und Wände dringenden Musik...und der Türsteher stellte sich auf die Zehenspitzen und vollzog mit unbewegtem Gesicht das Ritual, das schlicht darin bestand, dass er seinen Zeigefinger über die Menge kreisen ließ und mit einem knappen Du, Du und Du drei oder vier Glückliche bestimmte.…
Die Gesellschaft für Sport und Technik (GST) bekam bei der Erziehung der Jungen zur Wehrtüchtigkeit eine wichtige Aufgabe: Die Jugendlichen hatten schon vor der Einführung des Wehrkundeunterrichts in einer vormilitärischen Ausbildung in GST-Lagern Krieg zu spielen und das Militärleben auszuprobieren.
Das Bild vom Jugendlichen als sozialistische Persönlichkeit wurde vom MfS (Ministerium für Staatssicherheit) durch Äußerlichkeiten vorgeschrieben: adrette Jugendliche mit militärischem Fassonschnitt, ordentlich gekleidet mit FDJ-Hemd.
Dieses Bild bekam jedoch Ende der 60er Jahre, zu Beginn der 70er Jahre Risse, denn trotz Verboten und Kontrollen war die Zahl derer, die Westsender hörten und die Popkultur des Westens ersehnten und als ihr Vorbild sahen, groß. Die westliche antiautoritäre Lebenskultur bekam Einfluss auf die Jugend in der DDR, und schon bald waren lange Haare, Bärte und Kleidung wie z.B. Jeans und Parka angesagt. Jugendliche kopierten Beatbands in ihrer Kleidung und ihrer Frisur - auch wenn die SED dies als „dekadente moralisch-ethische Einstellung“ einstufte, weil westliche Mode, Kleidung, Frisur, Musik nicht ihrem gewünschten staatsjugendlichen Erscheinungsbild entsprach und sie den Einfluss der kapitalistischen Lebensweise zu unterdrücken versuchte. Dabei griff sie zu drastischer Kritik an den „Gammlern“ und „Faulenzern“ mit dem „schmutzigen Kleidungsstil“, und versuchte die junge Generation wieder an offizielle Angebote der Freizeitbeschäftigungen von Jugendorganisationen heranzuführen. Es kam sogar so weit, dass in manchen Fällen die Parteiführung entschied, dass Jugendliche wegen ihres „dekadenten Äußeren“ zu Aussprachen ins MfS bestellt werden sollten.1202 (ER)
Familie Umnitzer hat keine widersprüchliche Einstellung zur öffentlichen Erziehung, unterstützt deren Methoden und Ziele:
S. 175f
- Ich habe dir immer erlaubt, sagte Kurt, deine Musik zu hören -oder nicht? Sascha stocherte im Rotkoh…
- Oder nicht, wiederholte Kurt. Ja, sagte Sasch…
- Aber wenn deine Begeisterung für diese Beatmusik dazu führt, dass du Gammler werden willst, dann muss ich dir sagen, dass deine Lehrer recht haben, wenn sie so was verbieten. Trägst du das Ding auch in der Schul…
Sascha stocherte im Rotkoh…
- Ich frage dich: Trägst du das Kreuz auch in der Schule? Kurt merkte, wie der Ärger erneut in ihm aufstie…
- Bist du denn wirklich so dämlic…
Kurt … betrachtete seinen Sohn, … die schwer dressierbaren Locken, die von ihm, von Kurt, stammten (und derentwegen es in der Schule immer wieder Ärger gab, weil ein hundertprozentig linientreuer Direktor bei jedem Millimeter, der an den Ohren überstand, den Einfluss einer westlich dekadenten Jugendkultur witterte…
Das Gammlerkeuz, wie Kurt es provokant nennt, ist für Sascha ein Symbol der Suche nach Selbstgewissheit und Identität. Er ist unsicher und ahnt, was er nicht will, ohne konkret zu wissen, was er will:
S. 173
- Du wirst Gammler! Mein Sohn wird Gammle…
Für schwererziehbare Kinder und Jugendliche, die sich nicht in die sozialistische Gesellschaft integrieren (wollten), entstanden Spezialheime, die der Umerziehung von Minderjährigen dienten. Wir lesen dazu im Gesetzesblatt der DDR Teil II Nr.53 (Ausgabetag 17. Mai 1965): „In den Spezialheimen werden schwererziehbare und straffällige Jugendliche sowie schwererziehbare Kinder aufgenommen, deren Umerziehung in ihrer bisherigen Erziehungsumgebung trotz optimal organisierter erzieherischer Einwirkung der Gesellschaft nicht erfolgreich verlief. Der Aufenthalt im Spezialheim stellt eine Etappe im Prozess der Umerziehung dieser Kinder und Jugendlichen dar. Die Erziehungsarbeit erfolgt unter Einbeziehung der Kinder- und Jugendorganisation und der Betriebe auf der Grundlage der sozialistischen Schulpolitik und Pädagogik mit dem Ziel der Heranbildung vollwertiger Mitglieder der sozialistischen Gesellschaft und bewusster Bürger der Deutschen Demokratischen Republik. (3) Der Prozess der Umerziehung stützt sich auf die Festlegung sinnvoller persönlicher Perspektiven für diese Kinder und Jugendlichen. Er vollzieht im Heim im Rahmen der Allgemeinbildung, der berufstheoretischen und berufspraktischen Ausbildung, der Arbeitserziehung, der staatsbürgerlichen Erziehung, einer sinnvollen Freizeitgestaltung und einer straffen Ordnung und Disziplin... Die Spezialheime gliedern sich in: 1. Aufnahmeheime; 2. Spezialkinderheime; 3. Jugendwerkhöfe.“ Letztere gliederten sich in zwei Typen: Zunächst a) für Jugendliche, die nur kurzfristig dort untergebracht wurden, weil sie gute Voraussetzungen für eine Wiedereingliederung zeigten und b) für Jugendliche, die aufgrund ihrer Entwicklung und ihres Verhaltens eine längere Umerziehungszeit benötigten.1203
Als in den 70er Jahren nur mehr eine kleine Minderheit der Jugend sich mit den sozialistischen Zielen verbunden fühlte, sich ein Großteil passiv und schweigsam und eine starke Minderheit unangepasst verhielt,1204 gestand man ihnen von politischer Seite mehr Verantwortung zu, verwehrte nicht mehr die kleinen Freiheiten, wie z.B. westliche Musik und Kleidung.1205 (ER)
Sascha, aufgewachsen in den 50/60er Jahren in der DDR, gehörte zu den Erwachsenen der 70er Jahre. Er vollzieht seinen Lebens- und Entwicklungsweg vollständig im Sozialismus mit den darin geltenden normativen und gesellschaftlichen Bedingungen. Die staatliche und politische Gängelung in der DDR stört ihn bereits früh, er sehnt sich nach individueller Freiheit:
S. 212
… .niemals würde er die Rolling Stones live erleben, niemals würde er Paris oder Rom oder Mexiko sehen, niemals Woodstock, noch nicht einmal Westberlin mit seinen Nacktdemos und seinen Studentenrevolte…
Saschas Eintritt in die NVA (Nationale Volksarmee) soll die Einordnung in eine feste Gesellschaftsordnung und in die klare Struktur einer DDR-Elite fördern und ist das Gegenteil einer Erziehung zu gesellschaftlicher Autonomie:
S. 228
Um elf zog er, ohne ein Wort zu verlieren, die Uniform an, und sie stellten sich zusammen vor die Haustür.…
- Mein Junge, sage die Om…
- Na, siehst du, sagte Kur…
- Er sieht aus wie deutsche Soldat, sagte Irina und wischte sich, bevor sie Gas gab, eine Träne aus dem Aug…
Der disziplinierende und politische Einfluss der FDJ auf die Jugend reduzierte sich im Laufe der Jahrzehnte, und von Vorbildhaftigkeit konnte oftmals nicht mehr die Rede sein. Wehrpflichtige der NVA zeigten politische Gleichgültigkeit und eine Haltung, die das Feindverhältnis zu Westdeutschland leugnete und das Schießen auf Deutsche im Ernstfall verweigerte.1206
S. 218
- Wenn die Arschlöcher mir wirklich an die Grenze lassen, hau ick a…
Während im Westen Jugendkultur und Musik ihre Stile wechselten, entstanden auch in der DDR neue Subkulturen und Mentalitäten, dafür sorgten Westkontakte und Westfernsehen. So kam es, dass immer mehr junge Menschen staatliche Vorgaben ablehnten und sich Ende der siebziger Jahre und Anfang der achtziger Jahre in Bezirken älterer Stadtzentren eine Kultur andersdenkender Künstler etablierte. Sie versuchten einen alternativen Lebensstil des Zusammenlebens, meist in katastrophalen Wohnverhältnissen.
(ER)
Die nicht legalisierte Wohnung und der ärmliche Lebensstil in Berlin waren für Sascha eine bewusste, provokante soziale Desintegration bzw. Provokation:
S. 291f
Kurt betrat eine leere Wohnung.. ein brutal kahler Flur. Eine Küche ohne ein einziges Möbel, alle Küchenutensilien standen auf einer alten Kochmaschine herum. Das Zimmer_ blanke Dielen von roter Fußbodenfarbe. Eine nackte Birne an der Decke. Ein Schrank. Eine Matratze … Sascha wies auf den einzigen Stuhl im Zimmer. …
- Du willst sagen, du bist hier eingebroche…
- Vater, die Bude steht leer. Da kümmert sich kein Mensch dru…
Sascha demonstriert so eine intellektuelle und soziale Distanz und religiöse Offenheit:
S. 237
… und er erinnert sich an das Danach, an ein Gefühl der Erlösung, der Einsicht …
Diese empfundene Erfahrung provoziert und distanziert seinen Vater:
S.302f:
… dass Sascha neuerdings in er Bibel las. Dass er sogar irgendwie, so hatte Melitta behauptet, an Gott glaube …
Für eine große Anzahl junger Menschen der DDR wurde Konsumdenken und Individualismus in Bezug auf die Erfüllung von Alltagshoffnungen persönlich wichtiger als die Erfüllung von idealistischen, sozialistischen Zukunftsplänen oder Projekte für die Gemeinschaft. Gesellschaftliches Engagement und die Identifikation mit dem Sozialismus ließen stetig nach, und die Forderung des Staates nach Konformität und Engagement stieß auf den Wunsch nach Eigeninitiative. Obgleich die Staatsführung versuchte, schöpferische Impulse zu ersticken, formten Individualismus und internationale kulturelle Trends in den Freizeitmustern verstärkt die Haltungen der DDR-Jugendlichen.
Sie sahen die Unzulänglichkeiten des Regimes und sympathisierten mit der Massenkultur des Westens. Darin unterschied sie sich von der Generation der Nachkriegszeit, die noch idealistischen Träumen (statt einem Pragmatismus) nachhing - jetzt siegte der Wunsch nach persönlicher Freiheit über die utopischen Träume.
Konsumwünsche nahmen in Form eines Wochenendhäuschen und eines eigenen Autos Gestalt an.
Saschas Wunsch nach Selbstverwirklichung und befriedigender Arbeit wird in der DDR erstickt. Er glaubt nicht mehr an einen gelingenden Sozialismus wie Kurt (S. 184 f) oder an die politische Utopie von Wilhelm und Charlotte, damals bei ihrer Ankunft aus Mexiko (Kap 2, S.50).
Es endet für ihn in der politischen Verweigerung, er kapituliert vor dem System und flieht in den Westen.„Die Flucht aus der DDR war die radikalste Form der Absage an den verhassten Staat.“1207 Sie zeigt die Unfähigkeit des Regimes, einer Jugend sozialistische Werte glaubwürdig zu vermitteln.
Dann kam die deutsche Wiedervereinigung und die jungen Menschen mussten mit einer neuen Gesellschaftsordnung zurecht kommen, auf die ihre Sozialisation sie nicht vorbereitet hatte.
Der Autoritäts- und Glaubwürdigkeitsverlust vieler Eltern und Lehrer infolge des gesellschaftlichen Umbruchs 1989 führte zu einem veränderten Verhältnis zwischen Kindern und Eltern. Die Diskussion zu Weihnachten zeigt dies bei Familie Umnitzer ebenso wie die Konflikte zwischen Markus und seinen (Stief)eltern.
Markus erlebt den Einfluss der in Westdeutschland geltenden Rahmenbedingungen am stärksten von allen Familienmitgliedern in der Familienbiographie. Für ihn als ostdeutschen Jugendlichen hatten zentrale Lebensabschnitte in der DDR stattgefunden, nun aber ist er von der bundesrepublikanischen Marktwirtschaft betroffen und hat das Problem, seinen Berufseinstieg zu bewältigen. Die Wiedervereinigung bedeutet zwar Freiheit, mit neuen begrenzten Chancen, aber auch Unsicherheit: Wie sollte es nach der Schule und Ausbildung weitergehen? (S. 371 - 382) Angesprochen wird in diesem Kapitel die Neo-Naziwelle, auch sie rührte von der Desorientierung und den sozialen Brüchen der Wendezeit her. Bei seinem Stiefvater sind Überzeugung und Lenkung die angewandten Erziehungsmittel zur Pädagogisierung. Der Grundpfeiler der Erziehung ist das Gespräch, das jedoch zumeist im Streit endet.
Statt seine Individualisierungschancen und den Wohlstand nach der Wende zu nutzen und seine Privilegien zu erkennen, wirkt Markus orientierungslos und einsam.
S. 373
Klaus, der neuerdings versuchte, auf Vater zu machen, legte Wert darauf, dass Markus mit seinem Lehrgeld auskam. Kaum vermeiden ließ sich dagegen der anschließende „Familientag“, mal schön zusammen kochen, solche Sachen, oder, ganz übel, Ausstellung zusammen besuchen - wenn nicht gerade der sogenannte Familienrat tagte, Deckname für Anschiss, weil er irgendwelche Pflichten wieder mal nicht erfüllt hatte …
23. Die Psychologie von Geschwisterbeziehungen
„Geschwisterbeziehungen können, wenn sie tragen, Menschen ein Leben lang mit beiläufigem Glück versorgen…
(vgl. Sitzler, Susann: Geschwisterbeziehungen, S. 1…
In Literatur und Kunst wurde und wird Geschwisterbeziehungen generell viel Aufmerksamkeit gewidmet, und so ist es nicht verwunderlich, dass in den Familienromanen des 19. und 20. Jahrhunderts ebenfalls von beispielhaften Geschwisterbeziehungen und -Interaktionen zu lesen ist.
Das Definitionskriterium zur Bestimmung von Geschwisterschaft ist die genetische Abstammung, die übereinstimmende biologische Herkunft.
Die Begriffe „Schwester“ /„schwesterlich“ und „Bruder“ /„brüderlich“ enthalten von sich aus positive Konnotationen, sind nicht selten Metaphern für eine besondere Nähe zwischen zwei Personen und spiegeln nicht nur eine gegenseitige Verpflichtung wider; bedingt durch tägliches Zusammenleben verbindet Geschwister eine tiefe Emotionalität. (Auch im Tierreich verhalten sich Lebewesen erwiesenermaßen altruistisch, wenn sie den anderen als verwandt einstufen.1208)
Man verbindet mit Geschwisterbeziehungen Werte wie Verlässlichkeit und Beständigkeit, und meist stellen sie die längste und oft auch dauerhafteste Bindung im Lebenslauf eines Menschen dar.1209
„Geschwister müssen sich nicht lieben, aber Geschwisterlichkeit bedeutet, dass man zusammengehört, ohne sich lieben zu müssen.“1210
Negative Gefühle, die Geschwister im Streit entwickeln, vergehen oftmals wieder, so dass plötzlicher Hass und Emotionen, die in einer Freundschaft oder in einer Liebesbeziehung zur Trennung führen würden, wieder zu Zuneigung werden können.
Stets sind Geschwister in ihrem Einfluss auf die kindliche Entwicklung essentiell: Der Umgang miteinander ist Bestandteil der Sozialisation und wirkt sich auf ihr (soziales) Verhalten in allen Lebensbereichen aus.1211
Ein in dieser Hinsicht entscheidende Lernerfahrung hat Philipp mit seiner Schwester gemacht:
(AG)
S. 315
Philipp verzieht das Gesicht. Die Lektionen der letzten Zeit raten ihm, Komplimente von Sissi zu ignorieren. Mit Lob fängt man Narre…
Geschwister beeinflussen die Entwicklung des Charakters, sind oft Vorbild für soziale Beziehungen und prägen die Ansprüche auf Partnerschaft.1212 Nicht selten bilden Geschwister ein eigenes Subsystem in der Familie, das die Eltern evtl.in der Betreuung entlastet, aber auch eine Koalition den Eltern gegenüber bilden kann.
Da man sich Geschwister nicht aussuchen kann, haben Geschwisterbeziehungen immer auch etwas Schicksalhaftes und ein Höchstmaß an Intimität: Man ist „in einem Nest“ aufgewachsen1213 und hat durch die gemeinsame Kindheit die gleichen Erfahrungen und eine immense Vertrautheit.
In den vorliegenden Romanen erleben wir „vollbürtige“ Geschwister von gemeinsamen Eltern in ambivalenten und idealen Geschwisterbeziehungen. Wir lesen von einer Reduzierung der Kinderzahl auf 3 bis 4 Kinder im 19. Jahrhundert und wie sie sich weiterhin im 20. Jahrhundert auf 2 Kinder bzw. auf ein Kind reduzierte.
„Im 18. und 19. Jahrhundert stellte man sich die idealen Geschwister als ein gemischtgeschlechtliches Paar mit einem älteren, führenden und vorsorgenden Bruder und einer dienenden Schwester vor.“1214
Das Preußische Landrecht schrieb noch eine Unterhaltspflicht zwischen den Geschwistern vor, Eine solche gilt zwar heute nur noch in wenigen Ländern, aber dass Geschwister sich gegenseitig unterstützen und helfen, diese Erwartung ist durchaus noch heute in der Gesellschaft anzutreffen.
(TM)
Somit erklärt sich Thomas Verpflichtung seiner Schwester gegenüber, z.B. als es um die Planung eines Ausflug mit ihrem vermeintlich zukünftigen zweiten Ehemann geht: S. 344
„. wir Alle haben Ursache, dem Herrn Permaneder ein bisschen den Hof zu machen. Ich zweifle nicht, dass du die Situation übersiehst. Es entwickelt sich da etwas, und es wäre schade, ganz einfach schade, käme es nicht zustande…
Im Bürgertum stellte die Geschwisterbeziehung in den ersten Jahren der Kindheit eine Gegenwelt zur Erwachsenenwelt dar, eine Gemeinschaft mit Exklusivcharakter, in der sich ganz persönliche Verbindungen herausbildeten.1215 Bürger-Kinder verbrachten viel Zeit miteinander und besaßen allein durch die gemeinsamen Erlebnisse ein Gefühl der Zusammengehörigkeit.
(TM)
S. 63
Sie kletterte, gemeinsam mit Thomas, in den Speichern der Trav…
S. 91
Tony hatte den Kopf in beide Hände gestützt und las versunken in Hoffmanns „Serapionsbrüdern“, während Tom sie mit einemGrashalm ganz vorsichtig im Nacken kitzelte, was sie aus Klagheit aber durchaus nicht bemerkt…
Nähe und Verbundenheit der Geschwister entsteht durch die aufeinander bezogenen Bedingungen: den gleichen familiären Kontext, das gemeinsame Elternhaus/ Kinderzimmer, geteilte Normen und Werte.
S. 384f
sind wir Buddenbrooks Leute, die nach außen hin ,tip-top‘ sein wollen, wie ihr hier immer sagt, und zwischen unseren vier Wänden dafür Demütigungen hinunterwürgen? Tom, ich muss mich wundern über dich! Stelle dir Vater vor, wie er sich heute verhalten würde und dann urteile in seinem Sinne! Nein, Sauberkeit und Offenheit muss herrschen. Du kannst täglich aller Welt deine Bücher zeigen und sagen: Da. Anders darf es mit Keinem von uns sein…
S. 387
„.Ja, Tom, wir fühlen uns als Adel und fühlen einen Abstand und wir sollten nirgend zu leben versuchen, wo man nichts von uns weiß, und uns nicht einzuschätzen verste…
Der Topos der Geschwisterliebe entsprach dem bürgerlichen Familienbild und dem zeitgenössischen Leitbild:
(TM)
Das geschwisterliche Verhältnis in einer Bruder-Schwester-Beziehung besitzt eine besonders affektive Nähe; Hilfe und Unterstützung kommt von Seiten des älteren Bruders Thomas, und er wiederum erntet Bewunderung von Seiten seiner Schwester.
S. 389
Sie streckte die Hand nach ihm aus und legte den Kopf auf die Schulte…
„Komm her, Tom. Deine Schwester hat es nicht sehr gut im Leben. Alles kommt auf sie herab. Und sie hat in diesem Augenblick wohl niemanden, der zu ihr steht.“ Er kehrte zurück und nahm ihre Hand…
Eine Geschwisterbeziehung wie zwischen Tony und Thomas Buddenbrook ist das Idealbild des Bürgertums und konstituiert die bürgerlichen Ideale des 19. Jahrhunderts. Die Loyalität und Verbundenheit von Geschwistern mit ihrer Herkunftsfamilie diente nicht zuletzt der Stabilisierung des familiären Unternehmens und der Familie. Sind es in der Familie Buddenbrook zunächst die Eltern, die die Familiensolidarität aufrecht und den Kontakt der Geschwister am Leben erhalten, nimmt später der älteste Sohn Thomas diese Rolle ein.
Im 20. Jahrhundert lockerten sich die familiären Beziehungen und damit auch die Geschwisterbeziehungen, aber bis in die Gegenwart gelten Geschwisterbeziehungen als wesentlich für die Verbundenheit von Familien. Durch sie wird der Familienverband zusammengehalten.1216 Dennoch basieren Geschwisterverhältnisse heute mehr denn je auf einer freien Entscheidung, man geht seine eigenen Wege und Rechte, und Privilegien des Erstgeborenen, wie bei den Buddenbrooks gibt es nicht mehr, seit die Frauenbewegung die Rechte der Frauen/Schwestern angeglichen hat. Der soziale und familiäre Wandel in Form von Familiengröße, Mütterberufstätigkeit und, ganz wichtig:,die geographische Mobilität in der mobilen Gesellschaft der Gegenwart, wirken sich gravierend in der heutigen Zeit auf die Geschwisterbeziehung aus und führen nicht selten zum Abbruch der Beziehung.
Dafür ist die Geschwisterbeziehung zwischen Philipp und Sissi ein Beispiel:
(AG)
Zum Zeitpunkt des Romans gibt es zwischen Philipp und Sissi keinen Kontakt mehr. Die Beziehung zwischen Philipp und Sissi scheint nach dem Wegzug in die USA nicht mehr existent, Philipp verliert kein Wort über sie, auf seinem fiktiven Klassenfoto der Familie ist sie nicht anwesend:
S. 16
Und der da, in der ersten Bank der Fensterreihe: Das bin ic…
Die entscheidende Variable, die die Kontakthäufigkeit zwischen Geschwistern beeinflusst, ist in diesem Fall die geographische Nähe, denn sie erleichtert häufige physische Kontakte und verstärkt das gegenseitige Vertrauen. Die Loslösung von der Familie geschah anscheinend nicht aufgrund von Konflikten, eher ohne große Gefühlsbeteiligung, so, als wäre es etwas, was in der Entwicklung zum Leben einfach dazu gehörte.
Jede Geschwisterbeziehung ist individuell und verändert sich durch ihre Kontaktintensität je nach Lebensphase. Geschwisterforscher sprechen von einer U-Kurve der Beziehung im Laufe des Lebens: In der Kindheit und Jugend verbringen Geschwister doppelt so viel Zeit miteinander wie mit ihren Eltern1217 und haben einen dementsprechend großen gegenseitigen Einfluss. Veränderungen in der Persönlichkeit eines Jugendlichen in der Adoleszenz führen stets zu Veränderungen der Geschwisterbeziehungen. „Große Nähe in der Kindheit, Loslösung in der Pubertät, am größten ist die Distanz normalerweise, wenn jeder mit Beruf, Partner und eigenen Kindern beschäftigt ist. Im Alter wird die Beziehung dann oft wieder eng.“1218 In einem bestimmten Lebensalter bedingt eine stärkere Hinwendung zum eigenen Ehepartner und zu den Kindern die Abnahme der erlebten Nähe zu den Geschwistern, so dass zwischenzeitig der Kontakt oft nur auf einem symbolischen Niveau erfolgt (Briefe, Telefonate und gelegentliche Besuche). Im höheren Lebensalter dann nimmt die Bedeutung der Geschwister füreinander wieder zu. Mehrheitlich sind Schwestern für die positive Qualität von Geschwisterbeziehungen im Alter wichtiger als Brüder, weil sie an zwischenmenschlichen Beziehungen mehr interessiert sind.1219 (TM)
Die Geschwisterbeziehung zwischen Tony Buddenbrook und ihrem Bruder bleibt eng bis zu dessenTod.
Tony B. hatte, als sie mit Grünlich in geographischer Entfernung zu Lübeck, in Hamburg, lebte, keine räumliche Nähe zu ihrem Bruder. Eine Familie wird gegründet, bei Thomas kommt es aus beruflichen Gründen zur Verknappung zeitlicher Ressourcen, so reduziert sich der Kontakt. Als Tony nach der Scheidung ins Elternhaus zurückzieht, gewinnt die Geschwisterbeziehung an Intensität. Die Heirat von Thomas stärkt die Beziehung zwischen ihnen obendrein: Seine Ehepartnerin Gerda wird von ihrer Herkunft, ihren Werten und Interessen her als passend erlebt und hat alle die Merkmale und Qualitäten, die dem Erwartungsniveau von Tony entsprechen.
S. 292
Die Verlobung ihres verehrten Bruders, die Tatsache, dass ausgemacht ihre Freundin Gerda die Erwählte war, das Glänzende dieser Partie, die den Familiennamen und die Firma mit neuem Schimmer bestrahlte, … das alles trug dazu bei, sie in einen Zustand beständiger Entzückung zu versetzen. Dreimal stündlich zum Wenigsten umarmte sie ihre zukünftige Schwägerin mit Leidenschaf…
„Oh, Gerda“, rief sie. „Ich liebe dich, weißt du, ich habe dich immer geliebt! Ich weiß ja, du kannst mich nicht leiden, du hast mich immer gehasst, aber…
„Aber ich bitte dich, Tony!“ sagte Fräulein Arnoldsen. „Wie sollte ich wohl dazu gekommen sein, dich zu hassen?…
(AG)
Peter hat in seiner Kindheit einen engen Bezug zu seinen Schwestern, insbesondere zur jüngeren Ilse; sie waren seine Spielgefährtinnen und auf sie richten sich die Gedanken während seiner Flucht, Bilder einer sorglosen Kindheit:
S. 126
Eine Polsterschlacht mit Ilse, der jüngeren Schwester, die bis vor zwei Jahren das Zimmer mit ihm geteilt ha…
Wie Ilse sich die Finger verbrannte, als sie einen sengenden Bombensplitter aus dem Küchenkasten ziehen wollt…
S. 128
Das Bild, das er am liebsten mag, zeigt etwas Harmloses: Er und seine um zwei Jahre ältere Schwester Hedi am Ziegelteich, wo sie im Sommer Lehmrutschen bauten. Wie er mit viel Anlauf und in hohem Bogen … in die Lehmrinne springt, in die Hedi gerade einen Eimer Wasser geschüttet ha…
Ingrids Erinnerungen an den toten Bruder umfassen ebensolche intim-geschwisterlichen Momente in der Kleinkindphase:
S. 156f
Manchmal als Kind hatte sie einen runden Bauch, prall wie eine Trommel. Otto machte sich einen Spaß daraus, nach dem Essen die Bespannung zu prüfen. Sie legten sich auf das Sofa im Wohnzimmer oder in den Garten, der Himmel über ihnen und die Glücksempfindung, weil dort keine Feindbomber rumorten. Otto trommelte auf ihrem Bauchfel…
Seine Stimme hat sie noch im Oh…
Ich werde mich als Freiwilliger zum Reichskolonialbund melden, Kisuaheli lernen und zehn Negerfrauen heirate…
Das war lustig, sie haben viel gelach…
Zwischen Philipp und seiner Schwester ist die Kontaktintensität in dem Lebensabschnitt der Kleinkindphase intensiv, auch sie sind jeweils die Hauptspielgefährten des anderen.
S. 263
Die Kinder halten sich die Nasen zu und saugen auf ,Fertig!Los!‘ mit aufgerissenen Mündern die Luft ein. … Sie wiederholen das Spiel mehrmals. …
Geschwisterbeziehungen pendeln zwischen den Polen von Geschwister-Liebe, -Unterstützung und Geschwisterrivalität und -kampf und werden in den Romanen keinesfalls nur harmonisch stilisiert.
„Die Wahrnehmung von Ähnlichkeiten und Unterschieden ist ein wesentliche Bestandteil der Geschwisterbeziehung“.1220 Der Sinn solcher Unterschiedlichkeit zwischen Geschwister begründet sich evolutionär: unterschiedliche Talente und Fähigkeiten verstärken die Überlebenschancen einer Familie, Eltern nehmen diese Unterschiede wahr und fördern dadurch die Individualisierung.1221
Auf jedes Kind entfallen elterliche Projektionen, Wünsche und Hoffnungen, die das Kind versucht zu erfüllen, um die elterliche Gunst zu erhalten.
(TM)
Thomas und Christian:
S. 92
„Na, Tom“, sagte der Konsul gutgelaunt und nahm die Cigarre aus dem Mund: „die Roggenangelegenheit mit van Henkdom&Comp., von der ich dir erzählte, arrangiert sich…
„Was gibt er?“ fragte Tom interessiert und hörte auf, Tony zu plage…
„Sechzig Taler für tausend Kilo, nicht übel, wie…
„Das ist vorzüglich!“ Tom wusste, dass dies ein sehr gutes Geschäft wa…
S. 172
Möchte es doch, nachdem Christian sich entschlossen, den wissenschaftlichen Beruf fahren zu lassen, noch nicht zu spät für ihn sein, bei seinem Prinzipale Mr. Richardson etwas Tüchtiges zu lernen und möchte seine merkantile Laufbahn von Erfolg und Segen begleitet sei…
Tony:
S. 105
und dass diese Heirat genau das ist, was Pflicht und Bestimmung dir vorschreiben.…
Sie hatte den Beruf, auf ihre Art den Glanz der Familie und der Firma „Johann Buddenbrook“ zu fördern, indem sie eine reiche und vornehme Heirat eingin…
Tom arbeitete dafür im Comptoi…
(AG)
Peter spürt als Knabe in der NS-Zeit die Verschiedenheit der Geschwister und eigene Defizite im Vergleich zu seinen Schwestern.
S.111
Oft beneidete er seine Schwestern, die durch hauswirtschaftliche Ertüchtigung im Rahmen des BDM im Vorteil waren, die geschickter und entschlossener vorgingen und zweckmäßiger dachten: Wenn sie der Mutter Niveacreme auf die trockenen Lippen streichen durften und ihr nebenher,…
Als Kinder sind Philipp und Sissi dem gegenseitigen, nicht nur schulischen Vergleich, von Seiten ihres Vaters ausgesetzt:
S. 239
Sissi hat etliche Dreier im Zeugnis und einen vierer in Mathe . Sie hat keine Fehlzeiten, geht also gerne zur Schule . Philipp hingegen ist während des halben Schuljahres grün im Gesicht…
Peter bezeichnet seinen Sohn als ,kleinen Depp‘, ,ungeschickt‘ und nicht geschäftstüchtig’ (S. 294)
(ER)
Zwischen Kurt und seinem Bruder Werner existiert eine von Kurt erkannte Verschiedenheit und Rangfolge.
S. 185
… sein großer kleiner Bruder, der Stärkere, immer, der Schönere von beiden…
Geschwister selber suchen eine besondere Nähe zu Geschwisterkindern mit besonderen Persönlichkeitsfaktoren, wie z.B. den sozial hoch bewerteten Attributen der Selbstsicherheit und Klugheit oder der körperlichen Schönheit - Unansehnlichkeit kann ein Grund für Ablehnung sein.1222 (TM)
Christian Buddenbrook ist bereits als Kind keine ansehnliche Erscheinung und auffällig im Verhalten:
S. 67
Christian dagegen erschien launenhaft, neigte einerseits zu einer albernen Komik und konnte andererseits die gesamte Familie auf die sonderbarste Weise erschrecke…
S. 260
Christian hatte sich durchaus nicht verschönt. Er war hager und bleich. Die Haut umspannte überall straff seinen Schädel, zwischen den Wangenknochen sprang die große, mit einem Höcker versehene Nase scharf und fleischlos hervor, und das Haupthaar war schon merklich gelichte…
Sein Hals war dünn und zu lang, und seine mageren Beine zeigten eine starke Krümmung nach außen. Übrigens schien sein Londoner Aufenthalt ihn am nachhaltigsten beeinflusst zu haben, und da er auch in Valparaiso am meisten mit Engländern verkehrt hatte, so hatte seine ganze Erscheinung etwas Englisches angenommen, was nicht übel zu ihr passt…
Thomas und Tony dagegen sind äußerlich attraktiv:
S. 74
Die Ähnlichkeit mit dem Großvater hatte sich bei Thomas stark entwickelt wie bei Christian diejenige mit dem Vater; besonders sein rundes und festes Kind und die feingeschnittene, gerade Nase waren die des Alten. Sein seitwärts gescheiteltes Haar, das in zwei Einbuchtungen von den schmalen und auffällig geäderten Schläfen zurücktrat, war dunkelblond, und im Gegensatz dazu erschienen die langen Wimpern und die Brauen, von denen er gern die eine ein wenig emporzog, ungewöhnlich hell und farblos. Seine Bewegungen, seine Sprache sowie sein Lachen, das seine ziemlich mangelhaften Zähne sehen ließ, waren ruhig und verständi…
S. 60
Sie war höchst niedlich, die kleine Tony Buddenbrook. Unter dem Strohhut quoll ihr starkes Haar, dessen Blond mit Jahren dunkeler wurde, natürlich gelockt hervor, und die ein wenig hervorstehende Oberlippe gab dem frischen Gesichtchen mit den graublauen, munteren Augen, einen Ausdruck von Keckheit, der sich auch in ihrer graziösen kleinen Gestalt wiederfand, …
Bei der Gegenüberstellung von Geschwisterbeziehungen sind indirekte Einflüsse wie Altersabstand, Geschlecht und Position in der Geschwisterreihe, und die äußeren Faktoren, wie die sozialen und ökonomischen Einflüsse durch das Elternhaus, zu beachten.1223 Sie entscheiden über die gesellschaftlichen Erwartungen und haben Einfluss auf die Intensität der Geschwisterbeziehung, Die Romane unterstreichen die These, dass die genealogische Stellung innerhalb der geschwisterlichen Geburtenfolge im großen Maße die individuelle Persönlichkeit bestimmt.1224
Die Psychologie differenziert zwischen Geschwistern mit „hohem“ und „niedrigem Zugang“: Ein geringer Altersunterschied - heute häufiger zu finden wegen der schnellen Eingliederung der Mutter in den Berufsprozess - lassen ebenso wie Gleichgeschlechtlichkeit und Zwillinghaftigkeit einen „hohen Zugang“ entstehen, bei dem sich Geschwister gegenseitig in ihrem Umgang mit Gefühlen und Problemen eminent beeinflussen. Dies verstärkt sich durch den Besuch der gleichen Schule, gemeinsame Freunde und Bekannte. In der Zwei-Kind-Familie ist das Potential für eine intensive Beziehung eher gegeben als in Familien mit mehreren Kindern, da das Geschwisterkind oft der einzige Bezugspunkt für den anderen ist.1225 (TM)
Zwischen den Geschwistern Thomas, Tony und Christian Buddenbrook besteht allein durch ihren geringen Altersunterschied ein „hoher Zugang“, was mit größerer Intimität und intensiven Kontakten korreliert:
S. 7
Und die kleine Antonie, achtjährig und zartgebaut, …
5. 15f
Er (Christian) war ein Bürschchen von sieben Jahren, das schon jetzt in beinahe lächerlicher Weise seinem Vater ähnlich wa…
Thomas, dem solche Begabung abging, stand neben seinem jüngeren Bruder und lachte neidlos und herzlic…
(AG)
Zwischen Sissi und Philipp besteht ein größerer Altersunterschied, d.h. sie haben unterschiedliche Schulzeiten und unterschiedliche Freunde und auch die Konstellation „große Schwester-kleiner Bruder“ birgt Konflikte. Die Geschwisterposition großer und kleiner Bruder, ältere und jüngere Schwester impliziert zumeist ein Moment des Ungleichgewichts, z.B. eine Hierarchie, die Überlegenheit und Dominanz aufweist. Positiv drückt sich dies aus in der tätigen Hilfe, der Fürsorge und Unterstützung (AG)
Wegen des Altersabstandes und der damit einhergehenden Entwicklungsunterschiede hat Sissi als ältere Schwester eine belehrende und betreuende Rolle und erlebt sich als mächtiger und mit einem höheren Status versehen: S. 297
- Dein Bruder ist nicht so geizig mit Auskünften. Dem muss man nicht jedes Wort vom Mund abkaufe…
- Weil er nichts zu erzählen ha…
- Woher willst du das wissen? protestierte Philipp: natürlich hab ich was zu erzähle…
- Hast du nicht. - Hab ich doch. - Lappalien. Einen großen Haufen Nichts....S. 316
- Du bist hübsch, aber ein bisschen klein, und leider befürchte ich, dass du nicht mehr wachsen wirst. Du wirst so klein bleiben, wie du bist. …
- Man nennt das Wachs-tums-hor-mon-mangel. Das lässt sich bei dir nicht mehr beheben, dafür bist du schon zu alt, weil du bald diesen Flaum auf der Oberlippe bekommst. Aber sei nicht traurig, Schönheit ist nicht alles. …
Er(Peter)muss daran denken, wie sehr sich Sissi in den letzten Jahren um Philipp gesorgt hat und wie oft sie deshalb eingespannt war. Peter hat immer den Hut vor ihr gezogen und ihr deshalb auch manches nachgesehe…
Ältere Schwester werden Fortsetzer der elterlichen Erziehungstätigkeit und nehmen ihren jüngeren Geschwistern gegenüber die Rolle einer Betreuungsperson ein. Sissi ergreift die Rolle der Lehrenden und Bestimmenden und erfüllt damit die helfende Funktion einer Mutter.
Wie Erziehung in diesem Fall abläuft, zeigt die Szene im Auto: S. 298 -Bleib auf deiner Seit…
- Was kann ich dafür? Dort hast du einen Haltegriff, benutz ih…
Philipps rechte Hand geht nach oben zu dem kunststoffbezogenen Griff über dem Fenster …
Aggressives Verhalten des jüngeren Kindes wird von dem älteren Geschwisterkind in die Schranken verwiesen. Im Laufe der Jahre reagiert Philip abwehrend und widerwillig auf die ältere Schwester. Er möchte, dass sie ihn als einen gleichberechtigten Interaktionspartner akzeptiert.
Gemischtgeschlechtliche Geschwister haben meist einen höheren emotionalen Zugang und ein entspannteres Verhältnis als gleichgeschlechtliche Geschwister. Eine besonders harmonische Konstellation besteht zwischen einem großen Bruder und der kleinen
Schwester. Hier kann der Junge seine männlichen Eigenschaften als großer Bruder ausleben und das Mädchen bringt die weiblichen Eigenschaften in die Rolle der kleinen Schwester ein - Rollenstereotypen, die oftmals von den Eltern gefördert werden.1226 (TM)
Die enge emotionale Beziehung zwischen Tony und Thomas Buddenbrook zeigt sich, als Tony Abschied von Travemünde und von ihrer Liebe Morten nehmen muss und Trost von ihrem Bruder bekommt:
S. 154
… In ihren Winkel gedrückt, hielt sie das Taschentuch mit beiden Händen vors Gesicht und weinte bitterlic…
Thomas, seine Cigarette im Munde, blickte ein wenig ratlos auf die Chaussee hinau…
„Arme Tony!“ sage er schließlich, indem er ihre Jacke streichelte. „Du tust mir herzlich leid. ich verstehe dich so gut, siehst du! Aber was ist da zu tun? Dergleichen muss durchgemacht werden. Glaube mir nur … ich kenne das auch…
Als älterer Bruder verhält Thomas B. sich kompetitiv der jüngeren Schwester gegenüber, zeigt brüderliche Überlegenheit und Empathie.1227 Konträre Eigenschaften und Fähigkeiten zwischen ihm und seiner Schwester führen nicht zu Konflikten, sondern werden als komplementäre Ergänzung positiv bewertet, sowohl von den Eltern als auch von den Kindern selber. Thomas signalisiert Unterstützung und ist ein verlässlicher und vertrauensvoller Gesprächspartner für seine Schwester. Sie erhält stützendes Potential von ihm bei der Bewältigung ihrer kritischen Lebensereignisse.
Thomas nimmt die Mentoren- und Beschützerrolle ernst. Als er selber in einer krisenhaften Situation ist und nicht die erwartete Souveränität und Stärke zeigt, irritiert es seine Schwester:
S. 672
Aber man ruht an der weiten Einfachheit der äußeren Dinge, müde wie man ist von der Wirrnis der inneren…
Frau Permaneder verstummte so eingeschüchtert und unangenehm berührt, wie harmlose Leute verstummen, wenn in Gesellschaft plötzlich etwas gutes und Ernstes ausgesprochen wird. Dergleichen sagt man doch nicht, dacht sie, indem sie fest ins Weite sah, um seinen Augen nicht zu begegnen. Und um ihn in der Stille abzubitten, dass sie sich für ihn schämte, zog sie seinen Arm in den ihrige…
(AG)
Richard Sterk und seine Schwester Nessi bilden eine Koalition. Sie haben ein überaus vertrauensvolles Verhältnis, wie Alma aus der Korrespondenz erfährt: Nessi wird Richards Vertraute, als dieser ein Verhältnis mit seiner Sekretärin hat.
S. 355f
Aus der Korrespondenz zwischen Richard und Nessi, die sich in Richards Schreibtisch gefunden hat, geht hervor, dass er 1970 nicht nur mit seiner Verwandtschaft, sondern auch mit Christl Ziehrer in Gastein wa…
… das würde sie doch gerne wissen, was ihn dazu bewogen hat, sie zu hintergehen und dabei seine Verwandtschaft ins Vertrauen zu ziehen.…
Im Alter hat Nessi offensichtlich eine Kontovollmacht und erhält für ihre Kinder finanzielle Unterstützungsleistungen von Richard, zum Ärger Almas, die das als Erbschleicherei einstuft:
S. 33
… dass sie (Nessi) eine Erbschleicherin ist und ständig zugunsten ihrer Kinder Richards Konten plünder…
Die Erinnerung Richards an seine Schwester ist so stark, dass er sie, schwer an Demenz erkrankt, mit seiner Frau Alma verwechselt:
S. 345
- Nessi? fragt er und meint seine Anfang des Jahres verstorbene Schwester, die ihn ohnehin nur besuchte, solange die Möglichkeit bestand, etwas beiseite zu schaffe…
- Ich bin’s Alma, deine Fra…
Bei drei Kindern wird eines der Geschwister für ein Geschwisterkind wichtiger ist als das andere. Nähe und Verbundenheit von Geschwistern hängen hier insbesondere auch mit den Traditionen und Werten innerhalb der Familie zusammen und führen je nach deren Akzeptanz zu besonderer Nähe oder zu Distanz zwischen den Geschwistern.
(TM)
Die Beziehung zwischen Tony und Thomas ist symbiotisch, in ihrem Fall ist es die Familienloyalität und das Hochhalten der Firma, die die Harmonie der Bruder-SchwesterBeziehung fördert und sie stabil, loyal und respektvoll gestaltet. Wie sehr sich Tony mit ihrem Bruder identifiziert, zeigt sich, als sie die politische Wahl ihres Bruders miterlebt.
S. 408ff
Der Konsul hatte einen Moment das listige Lächeln seiner Schwester erwidert und dann dem Gespräche eine andere Richtung gegeben. Er wusste, dass man in der Stadt den Gedanken aussprach, den Tony glückselig in sich bewegt…
O Gott, Tom! wenn du es wirst. wenn unser Wappen in die Kriegsstube im Rathause kommt. ich sterbe vor Freude! ich falle um und bin tot, du sollst sehen…
S. 417
Da nimmt die Dame ihren Abendmantel zusammen und läuft davon. Sie läuft, wie eine Dame sonst eigentlich nicht läuft.…
sie ruft dem öffnenden Mädchen zu: „Sie kommen, Kathrin, sie kommen!“ sie nimmt die Treppe, stürmt droben ins Wohnzimmer, woselbst ihr Bruder, der wahrhaftig ein bisschen bleich ist die Zeitung beiseite legt und ihr eine etwas abwehrende Handbewegung entgegen macht. sie umarmt ihn und wiederhol…
„Sie kommen, Tom, sie kommen! Du bist es, …
Christians Identifikation mit der Familie dagegen ist gering. Er sucht sich seine Nische außerhalb der Familie und der Firma, ist in der Welt des Theaters zu Hause - dies schädigt in den Augen seines älteren Bruders und auch nach Auffassung seiner Schwester die Firma und führt zu einer größeren Distanz zwischen ihnen:
S. 320
„Also, das siehts du ein!“ rief Thomas, indem er stehen blieb und die Arme auf der Brust kreuzt…
Bist du denn ein Hund, Christian? Man hat doch seinen Stolz, Herr Gott im Himmel! man führt doch nicht ein Leben fort, das man selbst nicht einmal zu verteidigen wagt!. Aber du kompromittierst uns, uns Alle, wo du gehst und stehst! Du bist in Auswuchs, eine ungesunde Stelle am Körper unserer Familie! Du bist vom Übel hier in dieser Stadt, und wenn dies Haus mein eigen wäre, so würde ich dich hinausweisen, da hinaus, zur Türe hinaus!“ schrie e…
Geschwisterhierarchie ist demzufolge immer auch gekennzeichnet durch eine besondere Verantwortung der älteren männlichen Geschwister den jüngeren gegenüber. Sie haben die Rolle als Lehrer und Erklärer und verkörpern durch ihr männliches Geschlecht die rationale und moralische Überlegenheit. Von Beziehungen zwischen älteren und jüngeren Geschwistern wird erwartet, dass der jüngere die Leistung des Älteren anerkennt und bewundert. Insbesondere jüngere Geschwister neigen dazu, die älteren Geschwister zu imitieren und ihnen nachzueifern, wenden sich als Lernende mit Bitten um Hilfe und Trost an sie, und machen in Identifikationsprozessen das ältere Kind zu einem Vorbild und Modell, das ihnen kognitives und soziales Lernen ermöglicht.
(TM)
Bei den Buddenbrooks entsteht eine enge Bindung und eine starke Geschwisterhierarchie durch Geschlecht und Altersrangfolge. Die Brüder besitzen einen Machtvorsprung, den Tony akzeptiert.
Sie ordnet sich schon aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit Thomas unter und bewundert ihn: die Stärke ihres Bruders wird ein Teil von ihr und stärkt ihr Selbstbewusstsein und ihren Familienstolz. Die missglückten Ehen empfindet sie als Makel und als Verstoß gegen den Familienkodex, umso größer fällt die Identifikation mit dem Bruder aus.
Thomas als ihr Vorbild ist für Tonys Entwicklung, ebenso wie ihre Position in der Geschwisterreihe als jüngere Schwester von älteren Brüdern mitentscheidend.
S. 234
Sie liebte und verehrte diesen Brude…
S. 341
Weißt du, wie Tom denkt? Er denkt: Jeder! Jeder, der nicht absolut unwürdig ist.‘ . Tom ist ein Politiker und weiß, was er will. Wer hat Christian an die Luft gesetzt?. Und warum? Weil er die Firma und die Familie kompromittierte, und das tue ich in seinen Augen auch, Ida, nicht mit Taten und Worten, sondern mit meiner bloßen Existenz als geschiedene Frau. Das, will er, soll aufhören, und damit hat er recht, und ich liebe ihn darum bei Gott nicht weniger und hoffe auch, dass das auf Gegenseitigkeit beruht.“S. 459
„Gut“, sagte sie dann und stand auf. „Du sollst recht haben, Tom, und wie ich schon sagte, ich will nicht in dich dringen. Du musst wissen, was du zu tun und was du zu lassen hast, und damit Punktum. Wenn du mir glaubst, dass ich in guter Absicht gesprochen hab…
S. 553
Und an seinen Arm gelehnt, den er besänftigend um sie gelegt hatte, weinte si…
Durch ihre höhere Interaktionskompetenz initiieren ältere Kinder Angebote, auf die die jüngeren Geschwister oftmals eingehen, diese aber auch, je nach der Größe des Altersabstands als Konkurrenzverhalten ansehen können.1228 Andersherum lassen sich Feindseligkeiten von Seiten des älteren Geschwisterkinds auf Eifersuchtsgefühle zurückführen, denn es befürchtet eine Entthronung durch einen neu geborenen Rivalen und die damit geringere Verfügbarkeit der Eltern bzw. der Mutter.
(TM)
Kritisch wird Christian von Thomas beim Eintritt in die Firma beäugt:
S. 265
Der Chef der Firma „Johann Buddenbrook“ hatte seinen Bruder bei dessen Ankunft mit einem längeren, prüfenden Blick gemessen, er hatte ihm während er ersten Tage eine ganz unauffällige und beiläufige Beobachtung zugewandt, und dann, ohne dass ein Urteil auf seinem ruhigen und diskreten Gesicht zu lesen gewesen wäre, schien seine Neugier befriedigt, seine Meinung abgeschlossen zu sein. Er sprach mit ihm im Familienkreise mit gleichgültigem Tone über gleichgültige Dinge und amüsierte sich wie die Übrigen, wenn Christian irgend eine Vorstellung ga…
Und letztendlich stand sein abschätziges Urteil fest:
S. 310f
… die Stimmung im Hause bedurfte dringend der Aufmunterung, und zwar aus dem Grunde, weil das Verhältnis zwischen dem Firmenchef und seinem jüngeren Bruder sich im Verlauf der Zeit nicht gebessert, sondern in trauriger Weise verschlimmert hatte. … Mehr und mehr aber entwickelte sich in dem Älteren eine gereizte Verachtung gegen den Jüngeren, die dadurch nicht beeinträchtigt wurde, dass Christian ihre gelegentlichen Äußerungen ohne Gegenwehr und mit nachdenklich umherwandernden Augen entgegennah…
S. 314
Die gehässige Verachtung, die Thomas auf seinem Bruder ruhen ließ, und die dieser mit einer nachdenklichen Indifferenz ertrug, äußerte sich in all den feinen Kleinigkeiten, wie sie nur zwischen Familienmitgliedern, die auf einander angewiesen sind, zu Tage treten. Kam zum Beispiel das Gespräch auf die Geschichte der Buddenbrooks, so konnte Christian in Stimmung geraten, die ihm allerdings nicht sehr gut zu Gesichte stand, mit Ernst, Liebe und Bewunderung von seiner Vaterstadt und seinen Vorfahren zu reden. Alsbald beendete der Konsul mit einer kalten Bemerkung das Gespräch. Er ertrug das nicht. Er verachtete seinen Bruder so sehr, dass er ihm nicht gestattete, dort zu lieben, wo er selbst liebt…
Ältere Geschwister orientieren sich häufiger an den Eltern, sind angepasster und konservativer und zeigen ein dominanteres und machtorientierteres Sozialverhalten als jüngere Geschwister.
Thomas steht in der Geschwisterhierarchie als ältester Sohn und zukünftiger Firmeninhaber an oberster Stelle und bekommt von Eltern und Familienfreunden schon früh die Favoritenrolle zugeschrieben und wird als der Firmennachfolger gesehen.1229 S. 14
„.. Prächtige Burschen - Frau Konsulin? Thomas, das ist ein solider und ernster Kopf; er muss Kaufmann werden, darüber besteht kein Zweifel. Christian dagegen scheint mir ein wenig Tausendsassa zu sein, wie? ein wenig Incroyable.…
S. 65
Thomas, der seit seiner Geburt bereits zum Kaufmann und künftigen Inhaber der Firma bestimmt war und die realwissenschaftliche Abteilung der alten Schule mit den gotischen Gewölben besuchte, war ein kluger, regsamer und verständiger Mensch, …
Die Familie weist auf die Schwächen der anderen Kinder hin und führt ihnen das Verhalten des älteren Sohnes als Bewertungsmaßstab vor Augen. Geschwister übernehmen die Sicht der Eltern und Thomas ist, empfänglich für die Werte und Standards der Eltern, in seiner Rolle präsent.1230
S. 253
Thomas Buddenbrook, in so jungen Jahren bereits der Chef des großen Handlungshauses, legte in Miene und Haltung ein ernstes Würdegefühl an den Tag…
S. 256
Die Sehnsucht nach Tat, Sieg und Macht, die Begier das Glück auf die Kniee zu zwingen, flammte kurz und heftig in seinen Augen auf. Er fühlte die Blicke aller Welt auf sich gerichtet, erwartungsvoll, ob er das Prestige der Firma, der alten Familien zu fördern und auch nur zu wahren wissen werd…
Als Erwachsener umgibt er sich als der Erstgeborene und zukünftige Firmeninhaber mit den Insignien der Normalität, hat aber insgeheim eine Affinität zu seinem Bruder, der die verbotenen Gefühle und Verhaltensweisen der Kindheit und Jugend auslebt. Der Kontakt mit Christian erinnert ihn stets an sein „gestörtes“ Ich. Aus diesem Grund ist sein Verhalten ihm gegenüber von Überlegenheit und Herablassung geprägt.
S. 580
„Ich bin geworden wie ich bin“ sagte er endlich, und seine Stimme klang bewegt, „Weil ich nicht werden wollte wie du. Wenn ich dich innerlich gemieden habe, so geschah es, weil ich mich vor dir hüten muss, weil dein Sein und Wesen eine Gefahr für mich ist. ich spreche die Wahrheit…
Dagegen lässt die exklusive Beziehung zu seiner Schwester ihn persönlich-private und wirtschaftliche Problemsituationen in Augenhöhe mit ihr besprechen, er billigt ihren Einfluss und richtet sich nach ihren Ratschlägen. Die Grundvertrautheit zwischen Tony und ihrem Bruder ist von Nutzen für das gemeinsame Ziel: dem Erfolg der Familienfirma. Thomas mag ihre Heiterkeit und Cleverness, auch wenn sie für ihn stets die „Kleine“ bleibt: S. 309
„Sie ist unbezahlbar, Mutter! Wenn sie heucheln will, ist sie unvergleichlich! Ich schwärme für sie, weil sie einfach nicht imstande ist, sich zu verstellen, nicht über tausend Meilen weg.“S. 469
„Man begegnet einem Vorschlage nur dann mit Erregtheit, wenn man sich in seinem Widerstande nicht sicher fühlt“.Eine verteufelt schlaue Person, diese kleine Ton…
Bedeutsam werden Geschwister insbesondere in Notfällen, denn dann zeigt sich geschwisterliche Allianz und die Qualität der Geschwisterbeziehungen: Jüngere Kinder können sich an die älteren Geschwister wenden und umgekehrt, Geschwister werden zu Vertrauenspersonen und bekommen Trost. Im Idealfall werden Probleme gemeinsam bewältigt.
Strukturelle familialer Veränderungen wie z.B. der Tod eines Familienmitglieds oder die Trennung/
Scheidung sind kritische Lebensereignisse und verändern Geschwisterbeziehungen. So fordert der Tod der Eltern von den Geschwistern Entscheidungen, die sonst von den Eltern gefällt wurden. In diesem Fall kann ihre Beziehung eine besondere positive stützende Qualität haben. Sie können sich einen Teil von der elterlichen Geborgenheit und Wärme geben und sich nützen und zusammenrücken.
(TM)
In Krisen- und Notzeiten ist die Beziehung bei den Buddenbrook-Geschwistern ein soziales Netzwerk, über alle Lebensphasen hinweg. Bruder oder Schwester sind beim Tod eines Elternteils die letzten verlässlichen Personen, die die Erinnerungen der Kindheit teilen können, sind Zeugen der Kindheit, halten die Erinnerungen der Familie am Leben und geben sich elterliche Wärme.
Tony erzählt von der Vergangenheit, und dieses Sich-Erinnern an glückliche Zeiten lässt Nähe und Verbundenheit entstehen.
S. 585
„. Mutters Haus, dies Haus hier war mein ,Mal‘ im Leben, Tom. Und nun. und nun. verkaufen…
Sie lehnte sich zurück, verbarg ihr Gesicht im Schnupftuch und weinte bitterlic…
Er zog eine ihrer Hände herunter und nahm sie in die sein…
„Ich weiß es ja, liebe Tony, ich weiß es ja Alles! Aber wollen wir nun nicht ein wenig vernünftig sein? Die gute Mutter ist dahin. wir rufen sie nicht zurück.. Und deine Familie hast du doch immer noch, Gerda und mich und Buddenbrooks in der Breitenstraße und Krögers und auch Mademoieselle Weichbrodt.. ohne von Klothilde zu reden, von der ich nicht weiß, ob ihr der Umgang mit uns genehm ist; seit sie Klosterdame geworden, ist sie ein wenig exklusiv.“ Sie stieß einen Seufzer aus, der halb ein Lachen war, wandte sich a…
Der Tod der Eltern kann aber unter Geschwistern statt zu gegenseitiger Unterstützung auch zu einem Aufbrechen alter Wunden und Konflikte führen. Statt geschwisterliche Allianz kommt es dann zu Geschwisteraggressionen und zu Konflikten als Ausdruck von lang schon bestehender Rivalität.1231 (TM)
Zwischen Thomas und seinem Bruder brechen alte Wunden auf, als Thomas nach dem Tod der Mutter eine Aufsichtsfunktion und einflussreiche Rolle bei der Nachlassverteilung einnimmt.
In dieser Situation bricht Christians Verletztheit auf und das Gefühl des Zukurzgekommenseins nimmt überhand; und auch Thomas hat noch eine Rechnung mit Christian offen:
S. 575
„Meine Absichten sind dieselben geblieben“, sagte Christian, immer ohne Jemanden anzusehen und immer mit dem gleichen Gesichtsausdruc…
„Das. ist doch wohl unmöglich. Du hättest Mutters Tod abgewartet, um…
„Ich habe diese Rücksicht genommen, ja. Du scheinst der Ansicht zuzuneigen, Thomas, dass du allein alles Takt- und Feingefühl der Welt in Pacht hast…
S. 577
Ich bin frei, ich bin mein eigener Herr…
„Ein Narr bist du! Der Tag der Testamentseröffnung wird dich lehren, wie weit du dein eigener Herr bist. Es ist dafür gesorgt, verstehst du mich, dass du nicht Mutters Erbe verlodders…
(AG)
Peter hat nach der kritischen Lebenssituation im 2. Weltkrieg, offensichtlich keine engeren Kontakte mehr zu seinen Schwestern, so dass man davon ausgehen kann, dass durch den Verlust der Mutter und die Inhaftierung des Vaters die Familie auseinanderbrach.
Bei Philipp und Sissi aktiviert der frühe Verlust der Mutter intensive Geschwisterbeziehungen 1232 und starke Loyalität und Solidarität mit dem Vater; der ist seinen Kindern gegenüber eine verlässliche und vertrauensvolle Bezugsperson und mildert so etwas den Verlust.
S. 290
Seit Ingrids Tod hat er sich ein paar Strategien zurechtgelegt, wie er mit den Kindern über die Runden kommt. …
Er bemüht sich, seinen Kindern innerhalb vernünftiger Grenzen den größtmöglichen Spielraum zu gewähre…
S. 316
Er muss daran denken, wie sehr sich Sissi in den letzten Jahren um Philipp gesorgt hat und wie oft sie deshalb eingespannt wa…
Jede Geschwisterbeziehung aber bietet an sich Konfliktpotential. Wenn unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale und Eigenschaften aufeinandertreffen, kann sich eine negative Gefühlsbeziehung entwickeln. (Wenn Eltern, wie Peter und Ingrid Erlach, ihre Kinder egalitär und individualistisch behandeln, reduziert sich Rivalität.) Zu Rivalität und zu Konflikten kommt es am häufigsten, wenn das Geschwisterkind als Vergleichsperson gilt: oft geht es dabei um persönlichen Besitz und um dessen Gebrauch oder um territoriale Fragen.1233
Prinzipiell sind Geschwister in Bezug auf den Umgang mit Konflikten und Streit für die Entwicklung wichtig. Sie bieten die Möglichkeit streiten zu lernen, Recht zu haben und Konkurrenz zu erleben. Bei der Suche nach Widerspruch und Übereinstimmung folgt die Auseinandersetzung. Man traut sich, Widerspruch anzubringen, weil man sich auf sie weniger angewiesen fühlt als auf die Eltern.1234
Die Rivalität der Buddenbrooks-Brüder untermauert die These, dass gleichgeschlechtliche Geschwisterpaare häufiger Konflikte und Streit haben als ungleichgeschlechtliche.1235 Anforderung und Wettbewerb, Eltern, die den Erfolg hoch bewerten, lassen die Konkurrenz untereinander wachsen. Vergleichsmöglichkeiten hierzu bieten sich im Bereich der Leistung und des Erfolgs, der Sexualität und Schönheit und der sozialen Beziehungen außerhalb der Familie.1236
(TM)
Es ist das Motiv der feindlichen Brüder, das wir im Roman „Buddenbrooks“ finden. Es hat ebenso wie das der Geschwisterliebe eine große Signifikanz und führt in der Literatur mit ihrer gegensätzlichen Darstellung und in der Kulturgeschichte nicht selten zu einem Konflikt und zu offen ausgetragener Konkurrenz sowie Aggression.1237
Die Rivalität um die Gunst, die Anerkennung und Zuneigung der Eltern, um Macht und Ansehen in der Geschwisterreihe führten bereits in der Kindheit zu Konflikten. Vergleiche zwischen Thomas und Christian wurden durch den Großvater initiiert („Christian der Affe“), die Thomas mit seiner der Intelligenz, Reife und zwischenmenschlichen Kompetenz stets gewinnt. Ihre Geschwistergemeinschaft ist von klein auf gekennzeichnet durch Konkurrenz und birgt viel Konfliktpotenzial; die Ungleichheit in den Anlagen und der Entwicklung führt zu gegenseitiger geringer Akzeptanz und - typisch für männliche Geschwister: Ihre Rivalität bezieht sich auf den ausgeübten Beruf, der als Vergleichsmaßstab fungiert. Beide Brüder kämpfen um Vormacht und Abgrenzung, wobei Thomas leistungsorientierter und erfolgreicher ist und seine Stellung in der Firma wahrt:
S. 267
Die „Persönlichkeit“ im Geschäfte aber, darüber bestand kein Zweifel, war dennoch der jüngere der beiden Compagnons. Das zeigte sich schon darin, dass er es war, der mit den Bediensteten des Hauses, mit den Kapitänen, den Geschäftsführern in den Speicher-Comptoirs, den Fuhrleuten und den Lagerarbeitern zu verkehren wusst…
Thomas Buddenbrook, ganz voll von dem Wunsche, der Firma Glanz zu wahren und zu mehren, der ihrem alten Namen entsprach, liebte es überhaupt, im täglichen Kampf um den Erfolg, seine Person einzusetzen, denn er wusste wohl, dass er seinem sicheren und eleganten Auftreten, seiner gewinnenden Liebenswürdigkeit, seinem gewandten Takt im Gespräche manch gutes Geschäft verdankt…
Christian erkennt die übermächtige professionelle Etablierung von Thomas an:
S. 321
Ich habe dich immer beneidet, wenn ich dich sitzen sah und arbeiten, denn es ist eigentlich gar keine Arbeit für dich; du arbeitest nicht, weil du musst, sondern als Herr und Chef, und lässt Andere für dich arbeiten . Das ist ganz etwas Anderes…
Gut, Christian; hättest du das nicht schon früher sagen können? Es steht dir doch frei, dich selbständig oder selbständiger zu machen. Du weißt, dass Vater dir so gut wie mir ein vorläufiges Erbteil von 50 000 Courantmark ausgesetzt hat, ..Es gibt, in Hamburg oder wo auch immer, sicher aber beschränkte Geschäfte genug, die einen Kapitalzufluss gebrauchen können, und in denen du als Teilhaber eintreten könntes…
Wertdifferenzen zwischen den Brüdern, bezogen auf Lebensstile und Moralauffassungen, vertiefen aber die gegenseitige Abneigung. Christian, für sein schauspielerisches und komisches Talent im Klub beliebt, findet dort Gönner, die ihn aushalten. Er verkehrt in Schauspieler- und Theaterkreisen und ist der Vater eines unehelichen Sohnes.
S. 577
„Du bist so sehr jeden Schamgefühles bar“, fuhr der Senator fort, „Dass du es über dich gewinnst., nein, dass es dich gar keine Überwindung kostet, an dieser Stelle und unter diesen Umständen diesen Namen zu nennen! Dein Mangel an Takt ist abnorm, er ist krankhaft…
„Ich begreife nicht, warum ich Alines Namen nicht nennen soll…
Räumliche Trennung kann zunächst ein Sicherheitsventil in der Brüderbeziehung Thomas- Christian sein, denn durch sie wird der direkte Kontakt und Vergleich vermieden. Später dann, nach einem weiteren finanziellen Ruin, wendet sich Christian von einer beruflich erfolgreichen Laufbahn ganz ab.
S. 663
Die Sache war die, dass Christian jetzt mehr als jemals Herr seiner Zeit war, denn wegen schwankender Gesundheit hatte er sich genötigt gesehen, auch seine letzte kaufmännische Tätigkeit, die Champagner- und Cognac-Agentur, fahren zu lassen. . Aber mit der periodischen „Qual“ in seiner linken Seite war es womöglich noch schlimmer geworden,…
Nach dem Tod der Mutter appelliert die Schwester an ihre Brüder, Konflikte zum Wohle der Familie beizulegen und die Einheit wiederzufinden. Sie hat die Hoffnung der Eltern auf eine gute Geschwisterbeziehung und auf Familiensolidarität nicht aufgegeben: S. 576
„Aber Tom. Aber Christian. Und Mutter liegt nebenan…
S. 582
„Und Mutter liegt nebenan. Und Mutter liegt nebenan…
Christian, der sich schon während der letzten Repliken im Zimmer hin und her bewegt hatte, räumte endlich den Kampfplat…
„Es ist gut! Wir werden ja sehen!“ rief e…
(AG)
Rivalitäten und Kämpfe um die Zuneigung der Eltern, Neid und kleinere Streitigkeiten kennzeichnen ebenfalls die Geschwistergemeinschaft zwischen Sissi und Philipp: S. 250
Ingrid zieht ihn aus, frottiert ihn ab, schleppt ihn in sein Zimmer, wo er darauf besteht, seinen ,Universitätspyjama‘ auch tagsüber zu tragen. Seit dem Heiligen Abend hat er zu Hause nichts anderes mehr angehabt als seinen ,Universitätspyjama‘, auch tagsüber, da er auf Sissi mit ihrem Universitätspullover neidisch ist, wohingegen Sissi, damit sie nachts nicht nachsteht, sich im Universitätspullover niederleg…
Je nachdem ob ein Kind erstes oder zweites Kind ist, findet es unterschiedliche Beziehungsnetze in der Familie vor; oftmals ist der Verlust an Aufmerksamkeit von Seiten der Eltern für das Erstgeborene ein Grund für Konflikte. (Adlers Entthronungstrauma) Die eigene Macht und Befehlskraft über die Eltern werden bedroht, weil diese den jüngeren Kindern mehr Aufmerksamkeit und Kontrolle entgegen bringen und ihnen gegenüber responsiver sind.
(AG)
Auch Sissi als die ältere Schwester musste ihre Rolle erst begreifen lernen, ihre Eifersucht auf das jüngere Geschwisterkind führt zu minimal-negativen Verhaltensweisen, wie im folgenden Fall:
S. 250
Sissi gehorcht bereitwillig in gespielter Ahnungslosigkeit, anschließend erzählt sie, dass Philipp beim Rodeln, als er bei einem gewissen Hansi mitfahren durfte, sich um zehn Zentimeter Breite fast den Schädel entzweigeschlagen hätt…
Aggression zwischen Geschwistern ist ein Kontakt, der auch eine beruhigende Qualität haben kann. Angriff und Gegenangriff sind normale Muster im Alltag von Kindern. Mit ihren eigenen Waffen kontrollieren sie die aggressiven Handlungen und sehen diese als positiven Teil ihrer Geschwisterbeziehung. Kompetente Eltern lassen Kinder ihre Streitereien unter sich ausmachen und akzeptieren ein gewisses Maß an Aggression.
(AG)
S. 317
Da die Kinder nicht reagieren, lenkt Peter den Wagen in die Nische einer Bushaltestelle und lässt die Kinder balgen, bis ihr Zorn von selbst erlahmt. Zum Ausklang bedenken die Kinder einander mit den üblichen banalen Schimpfwörtern.. Dann setzen sie sich stocksteif in ihre Ecken und starren geradeau…
Erfahrungsgemäß geraten Geschwister im Alter zwischen drei und sieben Jahren 3,5 Mal pro Stunde aneinander, nicht selten also, und das ist, wie wir bei A. Geier lesen, anstrengend für die Eltern. Kindern jedoch vermittelt es soziale und emotionale Kompetenz. Während die Eltern eher zum Nachgeben bereit sind, stehen die Geschwister gleichberechtigt nebeneinander und müssen in der Kommunikation Verhandlungs- und
Konfliktfähigkeit lernen. Dafür brauchen sie wiederum Intuition und lernen, sich in die Gefühle und Gedanken des anderen zu versetzen.1238 Streit und Abgrenzung führen immer zu einer Entwicklung innerhalb der Geschwisterbeziehung.1239 Mit dem Aussprechen ihrer Gefühle und Gedanken erziehen sie sich auf diese Art gegenseitig.
Im Kindheitsalter erfolgt die Beendigung von Streit durch kurzfristige Trennung, oft von Seiten der Eltern, die helfen soll, Aggressionskontrollen, Kameradschaftlichkeit und positives Miteinander zu entwickeln. Kinder interpretieren dieses Verhalten meist als Benachteiligung oder Bevorzugung.
Das wiederum führt, auch wenn die Kinder altersgerecht-individuell behandelt werden und versucht wird, eine positive Wirkung auf das Geschwisterverhältnis auszuüben, oft zum In- Schutz-Nehmen des Kleineren von Seiten der Eltern:
(AG)
z.B. als es um die Höhenangst Philipps geht und um dessen Körpergröße:
S.295
- Du bist mir eine schöne Flasche von einem Bruder, sagt Siss…
- So war das jetzt nicht gemeint, wirft Peter ein: Du hast einen ganz großartigen Bruder, Sissi. Du hast allen Grund, stolz auf ihn zu sei…
S. 317f
- Jetzt sei doch nicht so gemein, sagt Pete…
Peter sagt, fast ohne die Stimme zu hebe…
- Du brauchst deinen Grant nicht an Philipp auslasse…
Erst ab einer bestimmten Altersphase sehen die Eltern das jüngere Kind nicht mehr als schutzbedürftig an und überlassen das Austragen der Konflikte den Geschwistern.
Ingrid fehlt die Zeit für die Beobachtung des kindlichen Verhaltens, ihr Verhalten ist konfliktvermeidend - Stress bedingt. Sie greift mit Spiel-Vorschlägen ein, um eine sich entwickelnde Aggression zu unterbinden.1240
S. 251
- Kannst du nicht ein einziges mal für fünf Minuten dein Mundwerk schonen, bittet Ingri…
S. 263
… überredet sie die beiden zu einem Wettbewerb, wer länger tauchen ka…
Der Streit im Auto zeigt eine wechselseitige Vertrautheit zwischen Sissi und Philipp und die Einfühlung in die Position des anderen.
Phillip als jüngerer Bruder rächt sich auf verdeckte Weise.
S. 291
- Mach dich nicht so breit, sagt Siss…
- Ic…
- Schau, dass du dein Bein auf deine Seite bekommst. Nimm deinen Fuß we…
- Ach, halt dochs Mau…
- Blöde Ku…
… nach einiger Zeit lacht er, ein wenig hinterhältig, wie ein Gno…
Sissi beklagt sic…
- Papa, das Schwein furzt, mir kommt gleich das Blut aus der Nas…
- Kann ich was dafür? fragt Philip…
Manchmal sind Geschwisterbeziehungen kein verwandtschaftliches Band über Raum und Zeit, und trotz der dauerhafte verbrachten Zeit entwickeln Geschwister weniger intensive und nicht dauerhafte Beziehungen. Die Ursache dafür liegt in kritischen, oft nicht voraussagbaren Ereignissen.1241 (AG)
Bei den Geschwistern Sissi und Philipp kommt es zur Entfremdung, obwohl man doch denken müsste, dass die Lücke einer nicht zugänglichen Mutter durch die Geschwister gefüllt wird.
Entfremdung als Folge negativer Erinnerungen? Oder trifft es zu, dass, je intensiver die emotionale und physische Beziehung zu den Eltern ist/war, desto geringer die Geschwisterloyalität und die Beziehung zwischen den Geschwistern ist.1242
Für Sissi und Philipp ist es wichtig, sich von der Familie abzugrenzen, um mehr Unabhängigkeit zu gewinnen. Beziehungen zu anderen Personen, außerhalb der Familie, Freundschafts- und Liebesbeziehungen reduzieren die Bindung an die Herkunftsfamilie.
Doch so wenig eine Geschwisterbeziehung eine nicht freiwillig eingegangene Beziehung ist, sondern den Menschen aufgezwungen wird, lässt sie sich auflösen, auch nicht, wenn es keinen Kontakt mehr gibt: Philipp und Sissi bleiben Bruder und Schwester. Ob der Beziehungsabbruch auf Dauer ist, ist nicht gesagt, da vielleicht schon, z.B. aus rechtlichen Gründen, ein Kontakt in der Zukunft wieder hergestellt werden könnte...
In den Romanen begegnen wir auch dem Tod von Geschwistern. Er verändert die Struktur in einer Familie und führt dazu, dass die wesentlichste menschliche Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart verloren geht. Familienmitglieder fühlen sich, als hätte man einen Teil seiner selbst verloren.
(TM)
Der Tod ihres Bruders für Tony bedeutet für sie personelle Unersetzbarkeit:
S. 682
„Tom!“jammerte sie. „Erkennst du mich nicht? Wie ist dir? Willst du von uns gehen? Du willst doch nicht von uns gehen? Ach, es darf nicht sein.!“S. 685
Da warf sich Frau Permaneder an dem Bett in die Knie, drückte das Gesicht in die Steppdecke und weinte laut, …
(ER)
Kurt erinnert sich an die grausame Lagerhaft (174, 182 ff.), die bis zum Ichverlust führt. In Gedanken erwägt er, für seinen Bruder, dessen Schicksal ihn unermesslich schmerzt, mit zu leben, eine Ich-Dopplung, die er auch zuvor in der erotischen Begegnung mit Irina verspürte.
Kurt berührt der Tod seines Bruders bis ins hohe Alter. Dieses vorzeitige Sterben hat zwar das Leben des Bruders beendet aber nicht die Beziehung von Kurt zu ihm, denn entscheidend ist das Verbundenheitsgefühl zwischen den Brüdern :
S. 185
Es war wunderbar am Leben zu sein. Wunderbar - und verwunderlich auch. Und wie so oft in diesen Momenten, wenn er es kaum fassen konnte, dass er tatsächlich lebte, dachte er zugleich daran, dass Werner nicht mehr lebte: sein großer kleiner Bruder, der stärkere, immer, der Schönere von beide…
Die Reifung durch solch einen Schicksalsschlag lässt ein Pflichtgefühl entstehen, man will Verantwortung übernehmen für das eigene Leben oder für das von anderen. Formen der Selbstbestrafung und Schuldgefühle können zur (kreativen) Kraft werden.
Der Verlust des Bruders greift in Kurts Leben ein und er hat den Wunsch, sich mit der verlorenen Hälfte zu vereinigen und zu verschmelzen, eine Fusion der Identitäten. Auf diese Art lässt er den Toten auferstehen und kommuniziert mit ihm.
S. 185
Was ihn schmerzte, war nicht so sehr der Tod, sondern das ungelebte Leben Werners. Zugleich aber empfand er es plötzlich als Trost, dass er an Werner denken, sich an ihn erinnern konnte, dass sein Bruder, solange er, Kurt, lebte, nicht völlig verschwunden war, dass er … seinen Bruder in sich bewahrte, ihn vor der endgültigen Vernichtung bewahrte, und er verstieg sich … zu der Vorstellung, er könne für seinen Bruder mitleben, mitatmen, mitriechen, ja sogar - und jetzt fiel ihm seine wundersame Verdopplung ein - sogar mitficken, dachte Kurt … Mitficken, dacht Kurt, im Namen seines ermordeten Bruder…
Die Umstände des Todes und dessen Vermeidbarkeit, womöglich durch das überlebende Geschwisterkind, sind entscheidend für den Umgang mit dem Tod. War die Beziehung sehr eng, wird der Tod wie der Verlust des eigenen Selbst wahrgenommen.1243 Der Geist Werners lebt für Kurt weiter, auch wenn niemand mehr seinen Tod erwähnt und eine scheinbare Schweigepflicht besteht. Spekulativ ist, ob eine offene Erinnerung nach dem Tod stattfand oder Traurigkeit und Kommunikation über den Toten unterdrückt wurden. „Eingeschlossen in ...[eine] Verschwörung des Schweigens, versucht die Familie ihr Gleichgewicht wiederzufinden. Das Leben geht seinen normalen Gang unter der Vorspiegelung, dieser Tod hätte nie stattgefunden.“1244
S. 136
- Ich verstehe dich nicht, sagte Kurt, und obwohl er gedämpft sprach, klang seine Stimme scharf, und er betonte jedes Wort, als er sagte: Dein Sohn ist in Workuta ermordet worden.
Charlotte sprang auf, bedeutete Kurt mit der Hand zu schweigen. - Ich möchte nicht, dass du so etwas sags…
Der Tod des Bruders führt zu einer Stärkung der Allianzen innerhalb der restlichen Familie, insbesondere der Bande zwischen Kurt und seiner Mutter.
S. 119
Sie ging hinunter in den Salon und rief Kurt a…
- Gut, sagte Kurt, dann bis morge…
- Bis morge…
- Autotour, sagte Kur…
- Herrgott ja, ich freue mich, sagte Charlott…
(AG)
Anders als bei Kurt berührt die Erfahrung des Brudertodes Ingrid nicht emotional. Wenn auch.
S. 157
… die Trauer um Otto immer präsent wa…
ist die damalige Zeit für Ingrid überlagert mit Erinnerungen von den vielen anderen zukunftsentscheidenden Ereignissen, politischer Art (Rotarmisten, britische Soldaten, Besatzung, Eingesprühtwerden mit DDT...) und in persönlicher Hinsicht: Schulwechsel, Urlaub, Peter ...
S. 158
Und ehe man sich versah, war Otto ein Jahr to…
Der Tod Ottos als begeisterter Hitlerjunge ist kein wichtiges Gesprächsthema in der Familie, er scheint fast vergessen.
S. 157
Ihr Mitleid mit der Amsel ist Ingrid stärker in Erinnerung als ihre Trauer um Otto. Vielleicht, weil Otto auch davor oft weg war, auf Lagern und mit den Kanute…
In Alma jedoch lebt die Erinnerung des Sohnes weiter.
Ingrid freut sich, als sie 1962 beim Besuch ihres Elternhauses die Möbel aus Ottos Kinderzimmer wiedersieht und ...
S. 216
… bittet um die komplette Einrichtung, den kleinen in blassem Türkis gestrichenen Schrank, … das Bubenbet…
Sind es ihre Erinnerungen oder der preiswerte Nutzen, der sie dafür einnimmt, wo doch die übrige Einrichtung in ihren Augen veraltet ist.
Im Gedächtnis ist ihr das gemeinsame Baden mit ihrem Bruder:
S. 263
An Otto erinnert sich Ingrid nicht mehr sehr gut. Aber sie weiß noch, dass ihre Mutter Otto Waschbär nannte und sie (Ingrid, Gitti) ,Iltis…
Mit dem Rückgang der Geburtenzahlen stieg die Zahl der Ein-Kind-Familien bzw. der Einzelkinder - und diese Veränderung der Familiengröße hatte Auswirkungen auf die Interaktionen in der Familie. Sie sind individueller und nun noch mehr auf das Kind bezogen. Oftmals wird das Kind zum Partner der Mutter/des Vaters, mit dem das Aushandeln von Bedürfnissen möglich ist,1245 insbesondere nach Ehescheidungen - die bei Ein-Kind-Familien erwiesenermaßen öfter vorkommen als bei Mehrkinder-Familien.1246 Einzelkindern fehlen im Vergleich zu Kindern mit Geschwistern bestimmte soziale Erfahrungen, sie sind mehr auf einen Elternteil als Ansprechpartner angewiesen, erleben nicht die Kooperation und Hilfsbereitschaft, Koalitionen, wechselseitige Loyalität und das Gegengewicht zu den Eltern von Seiten der Geschwister, aber andererseits auch nicht den Neid und die Konkurrenz zwischen Geschwistern.
(TM)
S. 436
Und zwischen zwei Kriegen, unberührt und ruhevoll in den Falten seines Schürzenkleidchens und dem Gelock seines weichen Haares, spielt der kleine Johann im Garten am Springbrunnen oder auf dem „Altan“, der eigens für ihn durch eine kleine Säulenestrade vom Vorplatz der zweiten Etage abgetrennt ist, die Spiele seiner 4 1/2 Jahre. Diese Spiele, deren Tiefsinn und Reiz kein Erwachsener mehr zu verstehen vermag, und zu denen nichts weiter nötig ist als drei Kieselsteine oder ein Stück Holz.. vor allem aber die reine, starke, inbrünstige, keusche, noch unverstörte und uneingeschüchterte Phantasie jenes glückseligen Alters, wo das Leben sich noch scheut, uns anzutasten, …
Dafür lernen Einzelkinder aber auch nicht durch Geschwister die Grenzen ihres Handelns kennen, wie es das Spiel zwischen Sissi und ihrem Bruder vorführt.
(AG)
S. 259
Philipp läuft zu der Stelle, wo das Tier verschwunden ist, schaut hinein, und Sissi gibt ihm einen Stoß gegen das Hinterteil, so dass er kopfüber in die Hecke fällt. Sehr hoppadatschig. Ingrid weist Sissi zurecht. Philipp rast hinter seiner lachenden Schwester her wie Mord und Brand. Die ist ihm nicht zu groß zum Raufen. Er schrei…
- Du blödes Vie…
Das Einzelkind hat keine Geschwister, mit dem es Freud und Leid teilen kann und ist stets der einzige Bezugspunkt der Eltern; so ist der Wunsch von Thomas Buddenbrook verständlich, aus Hanno seinem einzigen Kind:
(TM)
S. 508
… einen echten Buddenbrook, einen starken und praktisch gesinnten Mann mit kräftigen Trieben nach Außen, nach Macht und Eroberung …
zu machen.
S. 512
Diese träumerischen Schwäche aber, dieses Weinen. Dieser vollständige Mangel an Frische und Energie war der Punkt, an der der Senator einsetzte, wenn er gegen Hannos leidenschaftliche Beschäftigung mit der Musik Bedenken erho…
(ER)
Ebenso ist Sascha Umnitzer der Mittelpunkt seiner Familie:
S. 79
- Und dan…
- Habe ich Mama kennengelern…
- Und dan…
- Haben wir dich gebore…
S. 63
… aber einmal im Jahr, dachte sie, sollte es möglich sein, dass Sascha allein nach Hause kam. Einmal im Jahr wollte sie mit Sascha Pelmeni essen wie frühe…
S. 263
Sascha nahm Irina an den Schultern, zog sie hoch und drückte si…
- Ach, Saschenka, sagte Irin…
Schön war es, einen so großen Sohn zu haben - der immer noch roch wie ein Kleinkin…
Er trägt die ganze Bürde der Hoffnungen und Träume und der elterlichen Projektionen:
S. 173
-Mein Leben lang, sagte er, versuche ich dich zum Arbeiten zu erziehen. Und du ...
S. 294
- Entschuldige, aber ich finde, wir, als deine Eltern, haben ein gewisses Recht, zu erfahren, was los ist. Du verschwindest einfach für Wochen, du meldest dich nicht... Kannst du dir wirklich nicht vorstellen, was bei uns zu Hause lost war? Baba Nadja weint den ganzen Tag. Deine Mutter ist vollkommen erledig…
Markus, Saschas Sohn, ebenfalls Einzelkind, wird zunächst in partnerschaftlicher Weise von seiner Mutter und später, mit mehr Strenge, auch vom Stiefvater erzogen:
S. 272
- Markus, es ist sein Neunzigster. vielleicht ist es sein letzte…
- Mir doch egal, sagte Markus und pustete den Traumfänger an, der über ihm am Lattenrost des oberen Bettes hin…
- Das macht mich ein bisschen traurig, dass du so redest, sagte Muddel…
S. 380
- Wenn du nicht sofort umkehrst, Markus, dann müssen auch wir irgendwann …
- O Mann, sagte Marku…
- Du hörst jetzt zu, schrie Muddel…
24. Beziehungen zwischen den Generationen - füreinander, miteinander, gegeneinander
„Familie ist der Ort, an dem sich Generationen dauerhaft und nachhaltig begegnen…
(Filipp, S.-H. : Beziehungen zwischen den Generationen im Erwachsenenalter in: Krappmann/Lepenies(Hg.) S. 23…
Im Zentrum der Familienromane stehen stets Generationenbeziehungen in einer Familie. Was genau unter einer Generation zu verstehen ist, hat der Soziologe Mannheim definiert: Er spricht von einem Generationenzusammenhang zwischen Menschen, die an einem gemeinsamen Schicksal einer historisch-sozialen Einheit partizipieren.1247
Der Begriff „Generation“ ist eine Verallgemeinerung: Aus der Vielzahl von Einzelschicksalen und Erfahrungen wird ein „Generationenzusammenhang“, eine „Generationseinheit“ (Mannheim) durch ihre Gemeinschaftserfahrung. Somit gehören Menschen einer bestimmten biologischen Generation bzw. Alterskohorte an, deren Schicksal und historische Erfahrungen, Verhaltensnormen, Wert- und Sinnvorstellungen ähnlich oder sogar identisch sind.1248
Die Unterscheidung einer Generation von der anderen hängt von ihrer besonderen ,Erlebnisschichtung’ ab.1249 Als Beispiel wird von Karl Mannheim die Kriegsgeneration genannt: Sie ist geprägt durch Erlebnisse des Krieges und kann der nachfolgenden Generation von Kindern und Enkeln die vielfach traumatischen Erfahrungen, die sie erlebt hat, sprachlich nicht vermitteln und selber nicht bewältigen.1250 Der Generationenroman wird hier zu einem Aufarbeitungsort einer „verdrängten Verstrickung mit dem Nationalsozialismus oder einer Reaktion auf die sich auflösende Sozialform der Familie als Thematisierung sozialer Umbrüche.“1251 Ein Aspekt, der in Arno Geigers Roman Bedeutung gewinnt und den ich im Verlauf der Arbeit ansprechen werde.
Was genau eine Generation ist, erklärt Karl Mannheim damit, dass sie jeweils einen ,neuen Zugang’ zum ererbten Kulturgut hat.1252
Ein „neuer Zugang“, das meint Lebenshaltungen, die durch Milieueinwirkung weitergegeben und sich in der Jugendzeit bis zum 25. Lebensjahr bilden und das Weltbild festlegen. Verändern sich die Umstände, werden die Gehalte reflexiv.
Familiale Generationenbeziehungen beinhalten stets den direkten Kontakt einer Generation zur anderen. Sie tragen dazu bei, dass kritische Lebensereignisse bei Jüngeren und Älteren gemeistert werden, in „Solidarität“, mit gegenseitiger Unterstützung, ohne feste Verpflichtung und ohne Aussicht auf Rückzahlung.1253
Familienromane erforschen Generationenbeziehungen, die „heutigen kulturellen Verhältnisse zwischen Jung und Alt, Eltern und Kindern, Lebenden und Toten, Vergänglichkeit und Zukunft“. 1254 In der Großfamilie der Buddenbrooks verlaufen die transgeneratioalen Beziehungen horizontal und vertikal, in der Kleinfamilie von Sterk/ Erlach und Umnitzer nehmen die vertikalen transgenerationalen Beziehungen angesichts der sinkenden Geburtszahlen, der wenigen Geschwister und der hohen Lebenserwartung der Familienangehörigen zu.
Der Wandel von Brauchtum und Sitte, von sozialen Verhältnissen, der Wandel der Geschlechterrollen und der Rollen von Eltern und Kind und der Eltern-Kind-Beziehung haben das Konzept der Generationen in der Familie in den vergangenen Jahrzehnten verändert. Die zeitliche Dauer des Kontaktes zwischen den Generationen nimmt zwar mit der zunehmenden gemeinsamen Lebenszeit zu, aber betrifft dies auch ihre emotionale Bedeutung, wo doch Aufbau und Pflege der intergenerationalen Beziehungen stets mit emotionalen und zeitlichen Aufwand verbunden sind? Die Romane geben eine Antwort.
24.1. Transgenerationelle Übertragungen und Weitergaben
Verwandtschaft und Generationen verbindet sich im Familienroman mit der Vorstellung von transgenerationeller Übertragung. Geiger sagt konkret bzgl. seiner Protagonisten:: „Neu war für mich die Frage: woher kommt der [Philipp] eigentlich? Wie kann ich ihm eine geografische Tiefe und historische Plausibilität geben. Mir war klar, ich kann diesen Menschen nur erklären, wenn ich seine Eltern mit einbeziehe und dann lag für mich auf der Hand, ich brauche auch die Großeltern.“1255
Es gibt also noch ein anderes als ein greifbares materielles Erbe des Sach- und Geldtransfers, nämlich das Erbe des Charakters, des Verhaltens, der Persönlichkeit und Intelligenz.
Familie hat im transgenerationellen Bereich mehr Prägekraft als Freunde und Lehrer, denn ihr biologisches Erbe erscheint in Form der transgenerationalen Weitergabe von Beziehungsmustern und psychosozialen und kulturellen Elementen. Zu ihrem kulturellen Erbe gehören keinesfalls nur die genetischen Gemeinsamkeiten sondern auch materielle, psychosoziale Lebensgewohnheiten, der Lebensstil der Eltern und deren Leitbilder. Dies alles prägt das eigene Handeln und die Vorstellungen über Partnerschaft und Familie und wird transgenerationell an die nächste Generation weitergeben.
Übertragungen durch intergenerationelle Beziehungen beeinflussen das menschliche Verhalten:
Familiale Interaktion ist nicht nur auf die Generationenbeziehung zwischen Eltern und Kinder beschränkt, sondern umfasst drei Generationen, wovon jede ihre speziellen Familienthemen bearbeitet, mit Erziehungsinhalten vermischt und so auf das Handeln und die Identität bestimmter Familienmitglieder Einfluss nimmt.1256 Aufgrund ihres Alters haben Generationen in der Familie unterschiedliche Aufgaben, Pflichten und Rechte, die die Generationenbeziehungen in den verschiedenen Lebensphasen verändern.
So wie Eltern in vielerlei Hinsicht als Modell für das eigene Verhalten gelten und die Persönlichkeit der Kinder beeinflussen, solange sie leben und darüber hinaus, prägen auch Großeltern ihre Enkel, nehmen auf das Erziehungsverhalten und die Erziehungstechniken der Eltern Einfluss und stellen Rollenmodelle für junge Eltern und Kinder dar.1257 Besonders deutlich wird dies in der Zeit der Familiengründung durch die Kinder, wenn (Groß)Eltern eine neue Bedeutung erhalten. (Dies wird im späteren Teil meiner Arbeit noch thematisiert.)
Eine lebenslange und damit enge Bindung an die Familie verstärkt dieses psychosoziale und kulturelle Kapital, und kann frei nach Marie von Ebner-Eschenbach auch bedeuten: „Ganz aufgehen in der Familie, heißt ganz untergehen.”
Wie stark ist menschliches Verhalten biologische Disposition, die auf die Gene zurückgeht und wie sehr wird es durch Kultur und Erziehung bestimmt? Der Familienroman gibt dazu eine Antwort:
„Die Kenntnis der familiären Vergangenheit lässt die Enkelfiguren als ,bedingtes Selbst’ erscheinen.“1258 Es gibt sie, die intergenerationelle Übertragung von Persönlichkeitsmustern/Charaktermerkmalen von Eltern auf die Persönlichkeit der Kinder.1259 Diese Ähnlichkeiten von Persönlichkeitsmerkmalen beeinflussen in der Folge die Familienkultur.
Familienromane sprechen Vererbung und konservative Erbfolge an und führen uns vor Augen, wie sehr genetisch bedingte Ähnlichkeiten die Figuren charakterisieren. Unbewusst erscheint die Erbschaft negativer Eigenschaften als Gegenpol zum „Subjektideal der Selbstkreation“.1260 (TM)
Thomas Mann verweist in seinem Roman auf genetisch bedingte Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Thomas Buddenbrook und den Ahnen. Ein echter Buddenbrook ist für Tom stark und praktisch gesinnt, ein Mann:
S. 508
… mit kräftigen Trieben nach Außen, nach Macht und Eroberun…
S. 618
Sein Familiensinn, dieses ererbte und anerzogene, rückwärts sowohl wie vorwärts gewandte, pietätvolle Interesse für die intime Historie seines Hause…
S.469
Stand Thomas Buddenbrook mit beiden Beinen fest wie seine Väter in diesem harten und praktischen Leben? Oft genug, von jeher, hatte er Ursache gehabt, daran zu zweifeln! Oft genug, von Jugend an, hatte er diesem Leben gegenüber sein Fühlen korrigieren müssen. Härte zufügen, Härte erleiden und es nicht als Härte, sondern als etwas Selbstverständliches empfinden - würde er das niemals vollständig erlerne…
Hanno zeigt genetisch bedingte äußere Ähnlichkeiten mit der väterlichen und der mütterlichen Familie:
S. 423
Schon begannen die Familienähnlichkeiten sich vollkommen erkennbar bei ihm auszuprägen. Von Anbeginn besaß er ganz ausgesprochen die Hände der Buddenbrooks: breit, ein wenig zu kurz, aber fein gegliedert; und seine Nase war genau die des Vaters und Urgroßvaters, wenn auch die Flügel noch zarten bleiben zu wollen schienen. Das ganze längliche und schmale Untergesicht jedoch gehörte weder den Buddenbrooks noch den Krögers, sondern der mütterlichen Familie - wie auch vor allem sein Mund, der frühzeitig - schon jetzt - dazu neigte, sich in zugleich wehmütiger und ängstlicher Weise verschlossen zu halten. mit diesem Ausdruck, dem später der Blick seiner eigenartig goldbraunen Augen. mit den bläulichen Schatten sich immer mehr anpasst…
S. 508
Aber sollte nun das Kind, dieser lange vergebens ersehnte Erbe, der doch äußerlich und körperlich manche Anzeichen seiner väterlichen Familie trug,…
Seine Empfindsamkeit und Sensibilität sind in seinem Vater angelegt:
S. 470
Denn nochmals gefragt: War er ein praktischer Mensch oder ein zärtlicher Träume…
Ob sein Vater, sein Großvater, sein Urgroßvater die Pöppenrader Ernte auf dem Halme gekauft haben würde? Gleichviel!. Gleichviel!. Aber dass sie praktische Menschen gewesen , dass sie es voller, ganzer, stärker, unbefangener, natürlicher gewesen waren, als er, das war es, was feststand…
….. und tragen letztendlich zur Auflösung der Familie und der Firma bei:
S. 512
Diese träumerische Schwäche aber, dieses Weinen, dieser vollständige Mangel an Frische und Energie war der Punk…
S. 524
Und der kleine Johann, zurückweichend, stammelte, indem er mit der Hand nach seiner Wange fuh…
„Ich glaubte. ich glaubte. es käme nichts mehr…
(AG)
In Geigers Roman wird deutlich, dass sich bestimmte Erkrankungen, Verhaltensmuster und Umgangsformen in früheren Generationen bereits gezeigt haben und nun weitergegeben werden.1261
Richards Demenz-Erkrankung ist eine genetische Veranlagung, wie sein Vater erkrankt auch er im Alter daran. Alma erinnert sich:
S. 18
… wann wird Richard fragen, ob ,Der Wolf und die sieben Geißlein' eine Geschichte von Kindsmord ist. So Sachen hat sein Vater gegen Ende gefasel…
Alma hat insofern die Gene von ihrer Mutter geerbt, dass sie ebenso wie diese ein hohes Alter erreicht:
S. 18
… begriff sie, dass ihre Mutter fast hundert Jahre gelebt hatte. Hundert Jahre. Muss man sich durchs Gehirn laufen lasse…
Als Alma im Jahre 2001 stirbt, ist sie weit über 90 Jahre alt:
S. 50
Er (Philipp) isst Champagnerpralinen, die seine Großmutter zu ihrem letzten, dem dreiundneunzigsten Geburtstag geschenkt bekommen ha…
Die Tochter Ingrid begegnet ihrem Vater mit dem gleichen „Starrkopf“ in kompromisslosen Auseinandersetzungen, eine Versöhnung nach ihrer Heirat ist zwischen ihnen zunächst nicht möglich:
S. 28
Ingrid, ganz Tochter des Vaters, stellte ebenfalls auf stu…
S. 146
Dann schaltet Ingrid ebenfalls auf stur, ihr geht nichts ab, es kann ruhig bleiben, wie es ist, nach dem Motto, magst du mich nicht, mag ich dich nicht. Sie holt es sich woander…
Wie ihre Mutter heiratet auch sie einen älteren Mann:
S. 15
Sie hat sich für einen sechs Jahre älteren Burschen entschieden und sich dessentwegen mit ihren Eltern überworfe…
Peter und sein Sohn Philipp haben ähnliche genetische Dispositionen in Bezug auf ihr Naturell: Beide sind konfliktscheu und zeigen einen mangelnden Realitätsbezug.
Peter flüchtet sich in den Keller, um Auseinandersetzungen und evtl. Aufgaben innerhalb er Familie aus dem Weg zu gehen. Ingrid versucht schon in frühen Jahren, dies durch ihre Ansprache zu verändern:
S. 164f (1955)
Peter verdrückt sich verlegen zu seiner Arbeit, und Ingrid sieht ihm zu, wie er eingegangene und eingeholte Bestellungen mit einer ihr finster anmutenden Ausdauer für den Versand vorbereitet; von dieser Tätigkeit wie anästhetisiert. …
Dann, … redet sie sich ihren Frust von der Seele …
S. 254 (1970)
Peter … setzt sich bei dieser Gelegenheit ab, in den Kelle…
Der achtundvierzigjährige Peter wird beschrieben als ein...
S. 307
… stiller, nachdenklicher Charakter, der vom Leben nie etwas Besonderes verlangt hat. Vielleicht, dass man ihn in Frieden lasse. .. wo man ihn lässt, neigt er zur Zurückgezogenheit. Ein Einzelgänger, wenn man so wil…
Die genannten Merkmale und die Antriebslosigkeit bei Philipp sind eine Erbschaft seines Vaters.1262
S. 294(1978)
Geschäftstüchtig ist er auch nicht…
Er besitzt keinen Ehrgeiz, weder im Sport noch bei den Mädchen …
S. 50 (2001)
Den ganzen Vormittag bringt Philipp nichts zustand…
S. 187
Du lässt dich mit Vorliebe auf Dinge ein, die harmlos sind und ungefährlich. - auf alles, was sich nicht lohnt. … Dein Vater hat sich die Aufgabe zum Beruf gemacht, die Wahrscheinlichkeit von Verkehrsunfällen zu minimieren, und du versuchst dasselbe in deinem Privatlebe…
Er scheitert als Schriftsteller ebenso wie sein Vater als Spieleproduzent.
Ähnlichkeiten in den äußeren Merkmalen erkennt Richard in seiner Enkeltochter Sissi:
S. 215
Richard fühlt sich angezogen von Sissis Blick. Mit plötzlichem Herzklopfen gewahrt er, dass auch er Spuren in diesem Mädchen hinterlassen ha…
Alma sieht bei Philipp die dominanten Gene Richards sowohl im äußeren Erscheinungsbild als auch in seinen Neigungen:
S. 353f
… er hat Ähnlichkeit mit dir, er ähnelt dir, du hast die dominanteren Gene als ich, der Mund, die Augenpartie, die Kopfform, das kommt aus deiner Linie, auch das politische Engagement, stell dir vor, er hat gegen Spekulanten und für mehr Wohnraum demonstrier…
Sogar in Bezug auf einen frühen Tod der Mutter gibt es in der Romanfamilie Geigers einen Wiederholungszwang1263: Peter und Philipp verlieren früh ihre Mutter als Bezugsperson und müssen beide deren schmerzlichen Tod und die Trennung von Angehörigen bewältigen. Das Fehlen einer mütterlichen Bezugsperson hat einen zentralen lebenslangen Stellenwert für die weiteren sozialen Beziehungen der beiden Protagonisten.
(ER)
Eugen Ruge greift in seinem Roman auf die Weitergabe der Befähigung/des Talents im Bereich der Sprachen als Schriftsteller und auf die bürgerliche literarische Dimension des Bühnenschriftstellers zurück: Charlotte ist als Chefredakteurin in Mexiko tätig, als Institutsleiterin und als Rezensentin, ihr Sohn Kurt bekommt für seine Arbeiten/Bücher als Historiker Orden und Auszeichnungen in der DDR und dessen Sohn Sascha studiert zunächst auch Geschichte.
Bedeutsam ist weiterhin die transgenerationale Weitergabe von Beziehungsmustern.1264 In der Psychologie spricht man von einer Übereinstimmung des elterlichen Bindungsmodells mit dem Freundschafts- und Partnerschaftsmodell der Kinder. Beziehungen im Erwachsenenalter sind stets von vorherigen Erfahrungen in der Herkunftsfamilie geprägt: Waren die Beziehungen gut, gibt es ein Beziehungsmuster von Sicherheit und Wärme, ist es jedoch so, dass sich Störungen und Konflikte in den Familien wiederholen, können sich frühe familiale Spannungen negativ auf die Persönlichkeit der Kinder auswirken.1265 Erzählt wird von dieser Art der transgenerationalen Weitergabe zwischen Kurts Vater an Kurt und der wiederum an seinen Sohn Sascha:
S. 163:
Kurt fragte sich nicht zum ersten Mal, ob seine Schwäche in Bezug auf Frauen eher - wozu er als Marxist neigte - aus den Verhältnissen zu erklären sei … oder ob sie angeboren war, ob er sie tatsächlich von seinem Vater, den Charlotte als unglaublichen Schwerenöter darstellte (S. 46: … bügeln für Herrn Oberstudienrat Umnitzer, der sie mit seinen Schülerinnen betrog), geerbt hatte.Sascha: S. 26
Hatte eine unbestimmte Anzahl Frauen gevögelt (deren Namen er nicht mehr zusammenbrachte). Hatte sich - nach einer Zeit des Umherstreunens - wieder auf so etwas wie eine feste Beziehung eingelasse…
Die Art und die Qualität der Kommunikation im Elternhaus, das familiäre Leben mit seinen gelebten Werten und Normen haben Modellcharakter für die Folgegeneration. Familienrollen erleben durch die Folgegeneration1266 entweder eine Zustimmung oder Ablehnung, stets beeinflusst und bestimmt durch den zeitgeschichtlich-gesellschaftlichen Kontext.
Solch eine Anpassung an den historischen Wandel findet bei den Buddenbrooks nicht statt - und führt letztendlich zur Auflösung.
In der Beziehung zwischen Tony und ihrer Tochter Erika ist erkennbar: Die Erfahrungen Erikas mit ihrer Mutter beeinflussen ihr Anspruchsniveau und ihre Entscheidungen, ihre (unglückliche) Heirat belegt die Ähnlichkeit bzgl. Bindung, Rolle und Position, die sog. „Status-Ähnlichkeit“ mit ihrer Mutter.1267
(AG)
Ingrid vertritt in den Anfängen ihrer Beziehung mit Peter Leitbilder und materielle Lebensgewohnheiten, die ihr ihre Eltern transgenerational weitergegeben haben, lehnt aber später in den 70er Jahren das Ehegatten-Rollen-Modell der elterlichen Ehe ab.
Sie, die Teil der Nachkriegsgeneration ist, teilt das Wertesystem ihres Vaters, wie ihr Monolog beweist:
S. 166
Schatz, ich denke da an einen Spruch von Papa, dass man immer bestrebt sein soll sich über dem Durchschnitt zu halten, und das nicht nur in moralischer Hinsich…
Für Philipp ist die dauernd affektiv ausgetragene Auseinandersetzung seiner Eltern und die konfliktreiche Zeit in seiner Kindheit prägend und beeinflusst seine Einstellung zur Ehe. S. 10f
Die Ehe meiner Eltern war nicht das, was man glücklich nenn…
Schließlich ist es nicht seine Schuld, dass man vergessen hat, ihn in puncto Familie rechtzeitig auf den Geschmack zu bringe…
Eine gestörte Paarbeziehung bringt oft Störungen in Eltern-Kind-Beziehungen mit sich.1268 Das elterlich unsicher-distanzierte Bindungsmodell überträgt sich auf die Kinder, die in Folge eine geringe Neigung haben, feste Bindungen einzugehen.1269 Die Familienpsychologie stützt die Annahme, dass männliche Personen, die eine distanzierte oder gestörte Paarbeziehung haben, bei ihren Eltern eine ähnliche Paarbeziehung erlebt haben.1270 Philips Unsicherheit und ,partnerschaftliche Minderbegabung’ ist ein Erbe seines Vaters (AG S. 261). Sie gehen auf Interaktionen und die konfliktgeladene Beziehung seiner Eltern zurück. Er befürchtet die Beziehungsmuster und Fehler seiner Eltern zu wiederholen.
(ER)
Saschas Reise signalisiert die bedeutsame Prägung durch die Großmutter. Sie erzählt ihm von ihrem Aufenthalt in Mexiko in der Zeit der Hitlerdiktatur:
S. 85
Zwischen Kakteen und Gummibäumen standen und lagen Dinge herum, die Omi aus Mexiko mitgebracht hatte: Korallen, Muscheln …
Sie setzten sich auf Bett … und Omi begann zu erzählen. Sie erzählte von ihren Reisen; von tagelangen Reittouren …
S. 104
Ich bin in Mexiko, weil ich … Ja, was? Auf den Spuren der Oma …
24.2 Beziehungen zwischen Jung und Alt - ein einvernehmliches und konfliktreiches Miteinander
Die Generationenbeziehung zwischen Eltern und Kindern (in den Familienromanen) verdient eine genauere Betrachtung über die Jahrhunderte hinweg.
So finden sich im Allgemeinen Preußischen Landrecht 1794 neben den „Mutterpflichten“ noch die Verpflichtungen der erwachsenen Kinder gegenüber ihren Eltern: §63 „Sie sind verbunden, die Eltern in Unglück und Dürftigkeit nach ihren Kräften und Vermögen zu unterstützen, und besonders in Krankheiten deren Pflege und Wartung zu übernehmen.“1271 Demnach waren in der bürgerlichen Gesellschaft Kinder in der Pflicht, ihre Eltern ökonomisch und sozial zu unterstützen. Eine Gleichrangigkeit der Generationen gab es nicht, Diskussionen und verbale Auseinandersetzungen mit Eltern waren außerhalb der Vorstellungskraft. Die christliche Erziehung beinhaltete Respekt gegenüber Eltern und Großeltern und die Anerkennung hierarchischer Strukturen, verbunden mit Pflichterfüllung, Nächstenliebe und Wahrhaftigkeit. Überhaupt war die christliche Lebensführung ein zentrales Orientierungsmuster, geprägt durch das biblische 4. Gebot, „Du sollst die Eltern ehren“. Es umfasste Dankbarkeit gegenüber den Eltern, diese wiederum hatten dem Kind unter Verzicht auf eigene Befriedigung, selbstlos, eine gute Erziehung, Ausbildung und Startchancen zu geben.
Solch eine traditionelle Machtbalance, in der die (Groß-)Eltern als Respektpersonen auftreten, finden wir in den Romanen, insbesondere bei den Buddenbrooks im 19. Jahrhundert:
(TM)
S. 8
Alle hatten in sein Lachen eingestimmt, hauptsächlich aus Ehrerbietung gegen das Familienoberhaup…
Für Jean, Thomas und Tony Buddenbrook ist ihre Familie die Orientierung und der Halt ihres Lebens.
Im 20. Jahrhundert entwickelten sich große Unterschiede und Distanzen im Umgang zwischen den Generationen, bedingt durch Veränderungen im Lebensstil, fehlende Kriegserfahrungen und eine kulturelle Entwicklung, die gekennzeichnet ist durch Arbeitsteilung und den Verlust der sozialen Geborgenheit. Werte und Orientierungen, die das soziale Zusammenleben und die kulturelle Entwicklung seit dem 19. Jahrhundert prägten, wurden fragwürdig. Verstädterung und die weitgehende Orientierung am materiellen Wohlstand veränderten Brauchtum, Sitte, soziale Verhältnisse, die Geschlechterrollen und die Rollen von Eltern und Kind bzw. die Eltern-Kind-Beziehung. Das Konzept der Generationen in den Familien wurde ein anderes und führte zur Entfremdung und zu geringem Kontakt und spärlicher Kommunikation, besonders in der Beziehung zwischen Großeltern und Enkeln, obwohl doch gerade sie eine Brücke zur familiären Herkunft, zur Vergangenheit und zur kulturellen Tradition darstellen. Junge Menschen verbringen die Zeit lieber mit Altersgleichen „so dass eine psychosozial gespaltene Gesellschaft entsteht.“1272
Die neueren Romane zeigen diesen Wandel innerhalb der Generationenbeziehungen auf.
Entscheidend dann für die große Veränderung waren die 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts: Die Jugendlichen rebellierten gegen die Generation ihrer Eltern, die wiederum aufgrund des Alters und ihrer Position das Zusammenleben bestimmen wollten.1273 Kommunikationsstörungen strapazierten die Beziehungen zwischen den Generationen so sehr, dass man vom ,Generationenkonflikt‘ sprach, verursacht einerseits durch den mangelnden Respekts der jungen Menschen gegenüber den Älteren und/oder andererseits infolge der Einmischung der Eltern/Großeltern in die Belange der jungen Generation.
Generationskonflikte, insbesondere Vater-Sohn-Konflikte, traten gewissermaßen bereits bei den Buddenbrooks auf, wurden aber angesichts der Machtposition des Vaters nie offen ausgehandelt.
Die heutige Autorstätproblematik spiegelt die unterschiedliche Wertorientierung zwischen den Generationen wider: Wuchsen früher die Kinder in das Weltbild ihrer Familie hinein, gestalten Jugendliche im weltanschaulichen Pluralismus des 20. Jahrhunderts nun ihr Weltbild eigenständig.
Innerfamiliäre Konflikte zeigten das neue Selbstverständnis der Jugendlichen und waren ein Protest gegen die paternalistische Ordnung. Ihr Ausbruch aus der Familie erfolgte durch „die Aneignung eines Rechts auf Sexualität.“1274
Die Ethnopsychoanalyse spricht davon, dass in der Adoleszenz des Jugendlichen der Antrieb angelegt ist, die Kultur zu verändern und sich nur dadurch Gesellschaft und Kultur wandeln.1275 „Fortschritt, so scheint es, ist nur über Normbruch denkbar“.1276 Die (bürgerliche) Familie wandelte sich so wie die gesamte Gesellschaft. Die Machtbalance zwischen den Generationen verschob sich, man fing an, das eigene Verhalten zu reflektieren und die Möglichkeiten des Verhandelns zu vergrößern.
(AG)
Geiger zeigt, wie oberflächlich eine intergenerationelle Kommunikation bleibt, wenn die Machtposition des Vaters zu stark ist und in dieser Hinsicht sich keine Veränderung zeigt. S. 143
Er nimmt für sich in Anspruch, in allem Recht zu haben. Papa omnipoten…
Die Eltern legen Ingrid bezüglich des Nachtausgangs Beschränkungen auf, doch Ingrid akzeptiert diese hausväterliche Autorität nur äußerlich:
S. 150
-Dann kann ich mich darauf verlassen, dass du mir keine weiteren Dummheiten machs…
Sie findet, dass es Ansichtssache ist, was man unter Dummheiten versteht, und so nickt sie …
Sie lehnt das bürgerliche Leben ihrer Eltern ab.
S. 148
Sie ist ihre eigene Zukunf…
…und verzichtet auf Sicherheit:
S. 160
Und: Weil sie sich mehr nach Vitalität sehnt als nach jener Sicherheit, die jahrelang und keineswegs nur unter dem Eindruck ihres Vaters auf dem Wunschzettel ganz oben stan…
Der Generationskonflikt bei Familie Sterk äußert sich in intensiven familiären Interaktionen, einem Merkmal der modernen Familie, die die Familien belasten und zur Individualisierung ihrer Mitglieder führt.
Als erwachsene Frau und Mutter von zwei Kindern weckt die konfliktreiche Beziehung zu ihren Eltern bei Ingrid Schuldgefühle:
S. 268 (1970)
Ingrid stellt sich derweil unter die Dusche und hat Schuldgefühle, weil sie innerlich zumacht, sowie sie mit ihren Eltern zu tun bekommt. Es ist, als hätte sie ein abnormes Interesse daran, dass zwischen ihr und ihren Eltern alles bleibt, wie es ist. . Diese Schuldgefühle führen dazu, dass sie ihren Fehler gutmachen will . jetzt zum Beispiel: Beschließt sie, sofort nach dem Duschen unter einem Vorwand zurückzurufen und freundlicher zu sei…
Eine Generation weiter hat sich die Gestaltung der persönlichen Beziehungen zwischen der Elterngeneration Ingrid/ Philipp und deren Kindern eklatant verändert, das beweist Sissis Bemerkung auf die Erklärung ihres Vaters zu den revolutionären Gruppen in Südamerika:
S. 317
-Das verstehst du eben nicht, dazu bist du zu alt. Die Generation von Sissi Kinder und Enkel weiß nichts Genaues über die politischen Funktionen und Rollen der Eltern oder der Großeltern in ihrer jeweilen historischen Epoche, hat aber ihre eigene Lesart der Vergangenheit, es kommt zu Neuinterpretatione…
Der Generationskonflikt äußert sich in der Wahrnehmung des Schuldthemas: Ihm als Teil der Kriegsgeneration werden Schuld und Verdrängung angelastet. Sissi als Angehörige der Enkelgeneration geht von einem generalisierten Bild der Elterngeneration aus. Die Kriegsgeneration besteht für sie aus Nazis, Übeltätern und Feiglingen. Die Älteren treten selber den Rückzug durch Schweigen an:
S. 289
-Sie waren Nazis, sagt Siss…
Obwohl der Vorwurf auch ein wenig ihm zu gelten scheint und obwohl er es satt hat, sich wegen seiner Geburt und seines Jahrgangs und seiner wie in einem Giftschrank weggesperrten Kindheit schuldig zu fühlen, lässt Peter den Vorwurf auf sich sitzen. Er will nicht schon auf der Hinfahrt mitSissi zusammenkrachen.
Die Tochter schreibt ihrem Vater eine negative abwertende Akteursrolle während des Kriegs und der NS-Diktatur zu und verweigert Empathie1277. Peter nimmt dies kommentarlos hin, bezeichnet sich selber sogar als „alten Nazi“ (S. 317) Es ist zu vermuten, dass Sissi Informationen über die NS-Zeit besitzt, selber setzt sie aber keinen Dialog diesbezüglich in Gang, um dem familieninternes Wissen hinzuzufügen.1278
Schuld und Scham gehören zusammen: Peter leidet als Kind der Kriegsgeneration unter Schuldgefühlen und befürchtet die Missbilligung seiner Tochter, mit gesundem Menschenverstand widerspricht er zwar ihren ideologischen Einwürfen, beginnt aber kein Gespräch über seine eigenen traumatischen Erfahrungen. Vielleicht weiß er um ihre Verständnislosigkeit oder fürchtet Desinteresse. Dabei war er in den 30er und 40er Jahren in einem Alter, das ihm nicht die Möglichkeit ließ, ein distanziert-kritisches Verhältnis zum Nationalsozialismus zu entwickeln und kann damit moralisch nicht verurteilt werden, anders als sein Vater, der ein voll ausgebildetes Urteilsvermögen hatte, den Nationalsozialismus unterstützte und von ihm profitierte. Für die Generation der Kriegsenkel jedoch sind all diese Erlebnisse nicht mehr nachvollziehbar, sie bewerten die Konfrontation mit der Vergangenheit als eine Zumutung, obgleich gerade hinter einem Wiederholungszwang des Erzählens von Seiten der Eltern „auch ein Selbstheilungsversuch der Psyche stecken kann.“1279
Statt der Traumata erzählt Peter scheinbar Nebensächliches, wichtig wird, was danach und drumherum geschah,1280 keine Kriegsgeschichten, sondern anekdotische Erlebnisse mit seinem ersten Auto und der „Ferienarbeit beim Bau des Kraftwerks Kaprun“.
S. 295f
-Sissi, du weißt ja gar nicht, was ich erzählen wil…
- Nur z…
- Die Alarmanlage, die ich im ersten Jahr …
- Bei der immer, wenn man eine der Türen geöffnet hat, die Hupe losgegangen ist.…
Die familiale Interaktion reduziert sich, man ist sich der Existenz von Eltern und Großeltern zwar bewusst, grenzt sich jedoch von ihnen ab, nimmt Abstand zur vorhergehenden Generation, da Zukunftswünsche, Lebensziele, Wertmaßstäbe und ihr Zukunftsglaube sich von den Älteren unterscheiden. Diese Generation markiert ihre Identität im Kontrast zur vorhergehenden Generation.1281 Sissi heiratet früh in die USA:
S. 353
… was sie nur so lange in New York macht mit der halben Erdkugel zwischen sich und Wien, sie ist in New York, Richard, sie ist Journalistin, Soziologin, wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, sie hat eine Tochter …
Wie wenig Tiefe die Beziehung zu seinem Vater hat, lesen wir in Philipps Telefonat: Floskeln bestimmen das Gespräch und Unkenntnis über das Leben des anderen:
S. 379- Erlach. - Hallo Papa, ich bin’s Philipp. - Was für eine Überraschung. Ich staune. Ich staune. - Wei geht es di…
- Ich kann nicht klagen. Und dir…
- Und sei mir nicht böse, dass ich nicht komm. Es riecht irgendwie nach Rege…
- Das sagt auch Johann…
- die Johanna von vor -…
- Ja, di…
- Siehst du sie hin und wieder? …
Der Verlust der Mutter bedeutete im Fall Philipp auch den Verlust engerer Familienbande, und in Folge familiäre Unambitioniertheit’, denn Generationenbeziehungen zu pflegen und in sie zu investieren, wurde und wird verstärkt von Frauen praktiziert (schon aufgrund ihrer in der Regel längeren Lebenserwartung als die Väter).
24.3 Generationenbeziehungen in der DDR
Offiziell verkündete man in der DDR die Wertschätzung älterer Menschen, insbesondere bezogen auf die Aufbaugeneration und stellte Aktivistinnen der 20er und 30er Jahre als leuchtende Vorbilder und als Zeitzeugen für die jungen Menschen dar. Sie galten als die „Veteranen“, deren Leistungen und besondere Verdienste man untermauern wollte.1282 Diese Erziehergeneration, die den Nationalsozialismus im Widerstand oder im Exil verbracht hatte, erlebte über ihre politischen Funktionen einen sozialen Aufstieg. Für sie war die Ideologie lebensbestimmend, sie suchten Zeit ihres Lebens Anerkennung von der Partei.
Im Zuge der historischen Generationenfolge zeigt sich, dass diese älteste Kohorte der Geburtsgänge 1929-31 eine wirkliche Aufstiegsgeneration war, sich für die weiteren Generationen (1951-53 und 59-61) aber die Chancenstruktur hingehend zu geringeren Aufstiegschancen veränderte, Arbeiter und Bauern eingeschlossen.1283 In den vier Jahrzehnten des Bestehens der DDR standen sich Generationen durchaus ablehnendkritisch mit Unverständnis gegenüber. Wie sehr sich die politischen/gesellschaftlichen Standpunkte der Generationen aus den 30er, 50er und 70er Jahren unterschieden, wird in Ruges Roman deutlich:
Wilhelm und Charlotte sind Verfolgte des Nazi-Regimes und politisch engagiert, sie setzten sich für den Aufbau der sozialistischen Gesellschaft ein, erleben ein „Wirtschaftswunder“, lebten für DDR-Verhältnisse elitär in einem großen Haus und waren finanziell gut gestellt.
Wilhelm Bewusstsein ist geprägt durch die führende Rolle der Arbeiterklasse und die ideologische Hochschätzung der Arbeit/der Arbeiter und ihrer Partei, in all den Jahrzehnten bleibt dies unangefochten.
Als Generation der Antifaschisten haben beide andere Jugenderfahrungen, Bedürfnisse und Ausdrucksformen als die nachfolgende Generation, deren historische Erfahrungen und Wertorientierungen sich von den ihrigen unterscheiden.
Kurt zollt der älteren Generation Respekt, steht aber der Elterngenerationen auch durchaus skeptisch gegenüber: z.B. während der Ordensverleihung an Wilhelm, bei der er Wilhelms Rolle in der früheren Zeit kritisch sieht:
S. 341
Eigentlich, dachte Kurt, … war Wilhelm - ganz objektiv betrachtet - persönlich mitverantwortlich, dass die linken Kräfte sich während der zwanziger Jahre gegenseitig zerrieben und der Faschismus in Deutschland am Ende siegreich gewesen wa…
Der Generationenkonflikt bezieht sich auf unterschiedliche politische Ansichten:
S. 136
- Mutti, hier geht es doch um eine politische Kampagne, sagte Kurt. Hier versuchen Leute, einen härteren Kurs durchzusetze…
- Aber das Buch ist schlecht, wandte Charlotte ei…
- Dann lies es nich…
Kurt plötzlich ungewohnt schrof…
S. 203f
Kurt kam mit Nadjeshda Iwanowna, aber ohne Irin…
- Irina ist krank, sagte Kur…
- Und Alexande…
- Alexander ist auch krank, mischte Charlotte sich ei…
Defätistenfamilie. Von Irina mal abgesehen. Und abgesehen, natürlich, von Nadjeshda Iwanowna. … Kurt kriegte es sowieso nicht auf mit seinen Intellektuellenfingern …
Beiden Generationen steht mit Sascha ein Vertreter der mittleren Generation gegenüber, er wurde in die DDR hineingeboren, protestiert innerhalb der Schranken des Sozialismus und setzt sich mit der Entwicklung in der DDR und der Geschichte auseinander. Sascha geht in Distanz zum Sozialismus und sieht vieles kritisch.(S. 183-185)
Zwischen Kurts Generation und Sascha bestehen differierende Auffassungen hinsichtlich der gesellschaftlich-politischen Normen: S. 172f
Als er das Haus betrat, drang aus Saschas Zimmer laute Musik: Beatmusik, die er neuerdings hörte. Kurt klopfte an, trat ein. Sascha drehte die Musik ein wenig leiser. Er saß am Schreibtisch, das Tonbandgerät stand direkt vor ihm, das Lehrbuch darangelehnt, er war gerade dabei, irgendwas in ein Schulheft zu schreibe…
- Du kannst bei dem Lärm keine Hausaufgaben machen, sagte Kurt. … Gewiss bestand keine akute Gefahr, dass Sascha „Gammler“ wurde. Aber seine lasche Haltung, seine Faulheit, sein Desinteresse für alles, was er, Kurt für wichtig und nützlich hielt … Wie konnte man dem Jungen nur begreiflich machen, worauf es anka…
Als Jugendlicher der 60er Jahren fühlt sich Sascha nur zu einem geringen Teil mit den sozialistischen Zielen verbunden. Seine Generation erlebt eine ambivalente Atmosphäre zwischen pragmatischem Opportunismus und Aufbruchstimmung. Nach der Trennung von seiner Frau orientiert sich Sascha an bestimmten Merkmalen der bundesdeutschen 68er Bewegung: z.B. in Aussehen und den Wohnverhältnissen und adaptiert Verhaltensweisen und Einstellungen der in der DDR als bürgerlich begriffenen Studentenbewegung der Bundesrepublik.
Manches in seinem Leben empfindet er als Einschränkung und Begrenzung:
S. 212
… niemals würde er die Rolling Stones live erleben, niemals würde er Paris oder Rom oder Mexiko sehen, niemals Woodstock, noch nicht einmal Westberlin mit seinen Nacktdemos und seinen Studentenrevolten, seiner freien Liebe und seiner Außerparlamentarischen Opposition …
Er sehnt sich nach der Freiheit des Westens und fort aus diesem Land der Restriktionen. Die Rebellion gegen die Familie geht einher mit der Rebellion gegen das gesellschaftliche System.
S. 299f
-Hast du deine Diplomarbeit ferti…
- Ich schreibe meine Diplomarbeit nicht ferti…
- Sag mal, drehst du jetzt vollkommen durch? …
- Ich will nicht mein Leben lang lügen müsse…
- So ein Quatsch, sagte Kurt. Willst du sagen, ich lüge mein Leben lang…
Und doch kann man die Beziehung zwischen Sascha und seinen Eltern, typisch für die Kind-Eltern-Beziehung in der DDR, als eng ansehen, insbesondere die Beziehung zu seiner Mutter ist intensiv und emotional.1284
Und auch Kurt ist Zeit seines Lebens eng mit seiner Mutter verbunden:
S. 60
Das Telefon klingelt…
Wieder knarrten Kurts Schritte über sechs Meter Parkett. .. Vorbei an dem Lümmelsofa. Dicht an der Schlafzimmertür entlang, und dann, endlich, seine Stimme: - Ja, Mutt…
Unglaublich, dachte Irina, wie freundlich, wie geduldig Kurt mit Charlotte wa…
Nadjeshda Iwanowna wird von ihrer Tochter Irina zu sich genommen, als diese aus Russland (zeitweilig) übersiedelt.
Als Republikflüchtling steht Sascha der politischen und gesellschaftlichen Einstellung der Eltern skeptisch gegenüber, schwankt zwischen Ablehnung und Zustimmung.1285 Seine Wohnsitzverlagerung in die neuen, weit entfernten Bundesländer bringt nicht nur seelische Belastungen für seine Familie mit sich, sondern spiegelt einen Generationenkonflikt der Ideologien wider:
S. 367
- Na, Gott sei Dank, dass du in deinem Scheißsozialismus über Alternativen nachdenken durftes…
- Du bist ja wirklich schon vollkommen korrumpiert, sagte Kur…
- Korrumpiert? Ich bin korrumpiert? Du hast vierzig Jahre lang geschwiegen, schrie Sascha. vierzig Jahre lang hast du es nicht gewagt, über deine großartigen sowjetischen Erfahrungen zu berichten…
- Aha, sagte Kurt, darf man jetzt also nicht mehr über Alternativen zum Kapitalismus nachdenken! Wunderbar, das ist also eure Demokratie …
- Das mache ich schon noch …
An Sascha/Alexander Umnitzer ist erkennbar, wie sehr die DDR die generationelle Ablösung durch die Realisierung der Lebensentwürfe von Seiten der Jungen versäumt hat. Die Individualisierungschancen der jungen Menschen waren zu gering als dass sie Loyalität mit dem System empfinden konnten.1286
Zwischen Sascha und seinem Sohn Markus, dem Vertreter der nachfolgenden Generation, ist die Beziehung durch emotionale Distanz geprägt, die ebenfalls in Bezug steht zur Zeitgeschichte.
S. 19
Wieder musste er an Markus denken: an seinen Sohn. Musste sich vorstellen, wie Markus hier umging, mit Kapuze und Kopfhörern in den Ohren - so hatte er ihn das letzte Mal, vor zwei Jahren, gesehen - musste sich vorstellen, wie Markus vor Kurts Bücherwand stand und die Regalbretter mit den Stiefelspitzen anstupste; wie er die Dinge, die sich in vierzig Jahren angesammelt hatten, durch seine Hände gehen ließ und auf Gebrauchswert oder Verkäuflichkeit prüfte: Kaum jemand würde ihm den Lenin abkaufen; für das klappbare Schachbrett bekam er womöglich noch ein paar Mark, …
Markus betitelt alte Leute als „Dinosaurier“ und beschreibt damit ironisch seine Sicht der Geburtstags-Gesellschaft. In gewisser Weise versucht er, sich ihnen anzunähern, ohne dabei besondere emotionale Verbindung zu seinen Großeltern oder Urgroßeltern zu haben. Mit Unkenntnis und Unverständnis blickt er auf die Lebensgeschichte der UrGroßeltern:
S. 280
… eine Saurierversammlung mit Kaffee und Kuchen, dachte Markus, aber so aufgeregt durcheinander krächzend, als hätte man sie gerade alle aus ihrer prähistorischen Starre geweck…
S. 284
… und erinnerte sich, während der Schuldirektor Wilhelms Lebenslauf ausbreitete, dass auch Wilhelm damals, als er in seiner Klasse gewesen war, vom „Kap-Putsch“ erzählt hatte und dass er dabei verwundet worden war, und obwohl er gar nicht wusste, wie es dort aussah, hatte Markus seinen Urgroßvater schon damals am Kap Hoorn gesehen, mit Sombrero und gezücktem Trommelrevolver zum Angriff reitend … Oder war das Foto aus der Nazizeit, als Wilhelm, wie der Schuldirektor berichtete, illegal tätig gewesen war, und Wilhelm hatte sich als SA-Mann verkleide…
24.4 Alte Menschen im Familienroman
Das Verhältnis von Markus (ER) zur Generation seiner Großeltern und Urgroßeltern ist eine von mehreren divergenten Optionen in den Familienromanen: Wie ist der Vergleich der älteren Menschen mit Dinosauriern einzuordnen? In dem Kontext einer witzigen Metapher?
Bereits in der Antike lesen wir von unterschiedlichen Altersbildern: Aristoteles zeichnet ein negatives Bild des Alters mit vielen Defiziten und Gebrechen, für Cicero dagegen ist Alter etwas Positives: frei von Belastungen und mit der Möglichkeit der persönlichen freien Bildung. Idealisierend wird das Alter als eine Lebensphase gesehen, in der der Mensch sich in der „freien Zeit“, die er hat, seinen Wünschen und Bedürfnissen widmen kann, mit Hilfe der im Laufe des Lebens gewonnenen Macht und Kompetenzen.
Welches Bild davon begegnet uns in den drei Familienromanen?
Generell ist in den Familienromanen und in der Literatur eine vermehrte Darstellung alternder Familienangehöriger zu beobachten, was beweist, dass das Bewusstsein für das Thema „Alter“ und den demographischen Wandel an Präsenz gewonnen hat.1287 Diese Altersbilder in der Literatur zeigen oftmals eine Wahrnehmung des Alters als Defizit- und Chancenmodell.1288 Das fragile Alter mit Abhängigkeiten und notwendigen Hilfen reflektiert dabei ein kuratives Alter.
In diesen drei Romanen finden sich alte Frauen und Männer, deren Körper- und Erscheinungsbilder bereits Altersmerkmale tragen, wie z.B. die grauen Haare oder das Nachlassen des Erinnerungsvermögens und der Kräfte. Diese Altersbilder gehen einher mit Wandlungen und Statusveränderungen und werden je nach Jahrhundert unterschiedlich ins Familienleben integriert.
In der bürgerlichen Familie des 19. Jahrhunderts erfolgte das Zusammenleben in der steten wechselseitigen Sorge füreinander. Die finanzielle Unterstützung der Eltern speiste sich aus dem Einkommen der Kinder und von selbständigen Erwerbsverhältnissen.
(TM)
In einem Handelshaus wie dem der Buddenbrooks im 19. Jahrhundert gibt es keine Freistellung von Menschen ab einem bestimmten Lebensjahr, eine Entlastung folgt im Einzelfall durch den Erben als dem Firmennachfolger, wobei der Hausherr als alter Herr immer noch Einfluss nimmt und respektvoll um Rat gebeten wurde:
S. 44
Der Konsul hatte sich ein wenig seitwärts bis zur Wand, wo die Stühle standen, zurückgezogen; aber er setzte sich nicht, da sein Vater stand, sondern erfasste nur mit einer nervösen Bewegung eine der hohen Lehnen, während er den Alten beobachtet…
S. 48
Eine Familie muss einig sein, muss zusammenhalten, Vater, sonst klopft das Übel an die Tür…
„Flausen, Jean! Possen! Ein obstinater Junge…
… „Was machst du, Jean?“ fragte Johann Buddenbrook…
„Ich rechne“, sagte der Konsul trocken…
„Ich muss Ihnen abraten, nachzugeben!“…
„Na also! Punktum! N’en parlons plus!…
In moralischen Wochenschriften des späten 18. Jahrhunderts war das zeitgenössische Altersbild des alten Mannes positiv, nämlich das eines weisen Oberhaupts in einer weit verzweigten Familie, der bei jungen Frauen eine sittlich-erzieherische Funktionen einnahm. 1289 (TM)
Johann Buddenbrook, Tonys Großvater, entspricht diesem Bild:
S. 8
Sein rundes, rosig überhauchtes und wohlmeinendes Gesicht, dem er beim besten Willen keinen Ausdruck von Bosheit zu geben vermochte, wurde von schneeweiß gepudertem Haar eingerahm…
S. 13
Tony ließ den Kopf hängen und blickte von unten herauf den Großvater an, denn sie wusste wohl, dass er sie, wie gewöhnlich, verteidigen werd…
Für die Frau begann das „Alter“ in damaliger Zeit bereits mit 40 Jahren, in der Zeit des Klimakteriums, mit dem Beginn des sog. Matronenalters, wenn sie Schönheit, Weiblichkeit und Fruchtbarkeit „verlor“.
Zu diesem Zeitpunkt erwartete man von ihr weiterhin ein normgerechtes Verhalten, was hieß, dass sie statt der in der Jugend äußerlich gezeigten Weiblichkeit nun eine dezente Erscheinung zeigen sollte und mit dem familialen Lebensentwurf der Versorgung der Kinder und Enkel bis zu ihrem Lebensende ausgefüllt war. Seelen- und Geistesbildung standen für sie im Vordergrund. Die gesammelten Erfahrungen im Alter ermöglichten ihr einen umfassenden Blick, mit dem sie weise, abgeklärt und leidenschaftslos Hilfe und Ratschläge geben konnte.
Es entstand das positive Bild der alten Frau als „hilfreiche Alte“ mit den typischen Eigenschaften der Herzensbildung, der Geduld, Milde und Zuversicht trotz so mancher Schicksalsschläge, die sie hatte erleben müssen. Diese „dienende Liebe“ als Großmutter ließ sie von sich selber absehen, andere verstehen und verzeihen - und dafür zollte man ihr Respekt.
Durch die Altersdifferenz erlebten viele Bürgerfrauen den Tod ihres Mannes; im anderen Fall hatten die Männer in Situationen der schweren Erkrankung und des Sterbens der Ehefrau sie moralisch zu unterstützen, zu begleiten und dabei Haltung zu wahren: (TM) S. 69f
Droben saß Johann Buddenbrook am Krankenbette und blickte, die matte Hand seiner alten Nette in der seinen, mit erhobenen Brauen und ein wenig hängende Unterlippe stumm vor sich hi…
Und als dann Madame Buddenbrook ihren letzten, ganz kurzen und kampflosen Seufzer getan hatte, . da weinte er nicht einmal, aber dies leise, erstaunte Kopfschütteln blieb ihm und dies beinahe lächelnde „Kurios!“ wurde sein Lieblingswor…
Eine Generation weiter: Die Konsulin Buddenbrook lebt als Witwe so, wie es den Erwartungen entspricht, bringt neue Energien und Triebkräfte für die Religiosität auf.
S. 277
Todesfälle pflegen eine dem Himmlischen zugewandte Stimmung hervorzubringen und Niemand wunderte sich, aus dem Munde der Konsulin Buddenbrook nach dem Dahinscheiden ihres Gatte diese oder jene hochreligiöse Wendung zu vernehmen, die man früher nicht an ihr gewohnt gewesen wa…
Bald jedoch zeigt es sich, dass dies nichts Vorübergehendes war, und rasch war in der Stadt die Tatsache bekannt, dass die Konsulin gewillt war, das Andenken des Verewigten in erste Linie dadurch zu ehren, dass sie, ., nun seine fromme Weltanschauung vollends zu der ihren macht…
Weibliche ältere unverheiratete Verwandte hatten im 19. Jahrhundert die Rolle der Ratschläge gebenden Person inne, die den Übermut und die Konzentration auf das Äußere bei jungen Frauen abmildern sollten.1290 Als unverheiratete Frauen entzogen sie sich ihrer Bestimmung; ohne Ehe und Familie gab es für sie in der Gesellschaft keinen Platz. Solche alten Jungfern bilden den Topos der bornierten, lächerlich moralisierenden Figur, oftmals mit den Attributen Neid und Lieblosigkeit. Sie waren das feste Inventar der Häuser, wenn sie z.B. ihre Dienste als Magd verrichteten, als Geschichtenerzählerin und als moralische Instanz auftraten. Sie blieben bis zum Lebensende in der Familie, abhängig von der Mildtätigkeit der anderen.
(TM)
Klothilde, die Tochter eines Neffen des alten Herrn Buddenbrook, und die unverheirateten Cousinen von Tony nehmen diese Rollen im Roman „Buddenbrooks“ ein:
S. 274
… und hier war es, wo die Damen Buddenbrook aus der BreitenstraOe mit ungezwungner Vorliebe die Rede auf Tonys verflossene Ehe brachten, um Madame Grünlich zu einigen großen Worten zu veranlassen und sich dabei kurze, spitzige Blicke zuzusenden. oder wo sie allgemeine Betrachtungen darüber anstellten, welche unwürdige Eitelkeit es doch sein, sich das Haar zu färben.Sie gaben der armen unschuldigen und geduldigen Klothilde, der Einzigen, die sich in d…
Tat auch ihnen noch unterlegen fühlen musste, einen Spott zu kosten, der durchaus nicht harmlos war. Sie moquierten sich über Claras Strenge und Bigotteri…
Tonys Angst zeigt die Angst alter Frauen , die sich nicht rechtzeitig ihren Ort in einer Familie sichern, um mit ihrem Mann eine harmonische Einheit zu bilden; sie fühlt sich überfüssig und nutzlos:
S. 301
Du bist eine alte Frau mit einer großen Tochter, und das Leben liegt hinter dir. Du hast einmal während einiger Jahre daringestanden, aber nun kannst du siebenzig und achtzig Jahre alt werden und werde hier sitzen und Lea Gerhardt vorlesen hören. Der Gedanke ist mir so traurig, Tom, dass er mit hier in der Kehle sitzt und drück…
Das Alter bei unverheirateten Frauenohnedie Familie als Sicherungsform war oftmals so prekär, dass eine Berufstätigkeit sie gezwungenermaßen selbständig sein ließ: Als ,alte Fräuleins’ arbeiteten sie seit den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts meist als Lehrerin oder waren finanziell durch Stiftungen gesichert, die sie mit Mühe vor der Armenpflege bewahrten.1291 Sesemi zeigt das Bild der merkwürdigen, seltsamen Frau, die die Hüterin von Anstand und Sitte und Glauben ist.
S. 83ff
Therese Weichbrodt war bucklig, sie war so bucklig, dass sie nicht viel höher war als ein Tisch. Sie war 41 Jahre alt, aber da sie niemals Gewicht auf äußere Wohlgefälligkeit gelegt hatte, so ging sie gekleidet wie eine Damen von 60 bis 70 Jahre…
Therese Weichbrodt war ein belesenes, ja beinahe gelehrtes Mädchen und hatte sich ihren Kinderglauben, ihre positive Religiosität und die Zuversicht, dort drüben einst für ihr schwieriges und glanzloses Leben entschädigt zu werden, in ernstlichen kleinen Kämpfen bewahren müsse…
Im Laufe des 20. Jahrhundert führte die höhere Lebenserwartung, die geringe Anzahl der Kinder und deren früher Wegzug zu einer längeren Nach-Eltern-Phase und andere Lebensphasen schrumpften und veränderten die Lebensuhr - mit weitreichenden Konsequenzen: Verbrachte früher die Frau die Hälfte ihrer Lebenszeit in ihrer Herkunftsfamilie mit Eltern und Geschwistern und die andere Hälfte mit ihrem Mann und ihren Kindern, lebt sie in der heutigen Zeit in der längeren Phase der nachelterliche Gefährtenschaft mit ihrem Partner nach dem Auszug der Kinder im „empty nest“, mit getrennter Haushaltsführung von Eltern und erwachsenen Kindern.
Diese nachelterliche Phase dehnte sich auf einen Zeitraum von über 40 Jahren aus: Die Familienphase mit Pflege und Versorgung der Kinder/des Kindes hat sich aufgrund der geringeren Kinderzahl und der höheren Lebenserwartung verkürzt; „diese Zeitspanne macht nur noch 1/4 der gesamten Lebenszeit aus; vor 100 Jahren betrug ihr Anteil noch mehr als die Hälfte.“1292 Im Anschluss folgt aufgrund der höheren Lebenserwartung eine lange Zeit des Alleinlebens.1293 (AG)
Für Alma und Richard beginnt der zeitliche Abschnitt der nachelterlichen Gefährtenschaft nach dem frühen Auszug ihrer Tochter. Sie erleben deren Unfalltod, und das, nachdem bereits ihr Sohn Otto als 15jähriger im Volkssturm ums Leben gekommen war. Der Verlust ihrer Kinder und Enkel führt zu einer Reduzierung von Almas Aufgaben und ist für sie eine emotional schwierigere Zeit, da sie nun auf die häusliche Sphäre beschränkt ist und eine lange gemeinsame Zeit zu zweit mit Richard anfängt.
1989 beginnt für Alma die Phase des Alleinlebens:
S. 368
Ja, die alten Zeiten. Die glorreichen alten Zeiten, in denen man so leicht versack…
Und jetz…
Jetzt stillen die Rosen ein letztes Mal in diesem Jahr ihren Durs…
Jetzt knickt der wind die Blumen auf den Gräbern, sofern die Blumen nicht aus Plastik sin…
Ganz ähnlich frieren die Dinge in der Erinnerung ein.…
Das Altersbild wandelte sich in den letzten hundert Jahren vom Positiven zum Negativen. Weil der Modernisierungsprozess den Begriff der Energie auf die Lebensenergie bezog, galt der junge Menschen als wertvoller und effizienter. Damit initiierte man den Jugendkult und eine Mentalität, die Erfolg und Rationalität an die erste Stelle rückte, und für die der alte Mensch ein Mängelwesen darstellt.1294 (TM)
Bereits bei den Buddenbrooks lesen wir, wie Gebrechlichkeit und schwindende Kraft den alternden Konsul Buddenbrook zur Übergabe von Funktionen und zur Distanzierung von weltlichen Gütern bewegen:
S. 240
… denn leider machte das Befinden des Konsuls jetzt weitere Kur-Reisen notwendi…
„Man weiß nicht, was es heißt, alt zu werden!“ sagte er. „Ich bekommen einen Kaffeefleck in mein Beinkleid und kann nicht kaltes Wasser daraufbringen, ohne sofort den heftigsten Rheumatismus davonzutragen. Was konnte man sich früher erlauben?“ Auch litt er manchmal an Schwindelanfälle…
Thomas fühlt sich subjektiv alt und schwach in eigentlich noch jungen Jahren:
S. 650
Denn es war an dem, dass Thomas Buddenbrook, achtundvierzig Jahre alt, seine Tage mehr und mehr als gezählt betrachtete und mit seinem nahen Tod zu rechen began…
Sein körperliches Befinden hatte sich verschlechtert. Appetit- und Schlaflosigkeit, Schwindel und jene Schüttelfröste, zu denen er immer geneigt hatte, zwangen ihn mehrere Male, Doktor Langhalszu Rate zu ziehen.
(AG)
In den modernen Familienromanen liest man vermehrt von Menschen, die unter den körperlichen und geistigen Folgeerscheinungen des Alters leiden.
Richards Demenzerkrankung zeigt sich in Ausfallerscheinungen und Vergesslichkeit: S. 17
Ihr Mann hat vor drei Tagen, als sie mit dem Kulturkreis in Kalkwang war, einen halben Liter Milch acht Stunden lang gekocht. …
Der Nagelzwicker im Kühlschrank, das schmutzige Unterleibchen, das Richard ausziehen sollte, unter dem übergestreiften frischen. Die Pizza mitsamt der Plastikhülle im Backroh…
S. 31
-Vergiss bitte nicht, dass auf deiner Kraftfahrzeugssteuerkarte die Steuermarken für den letzten und diesen Monat nicht geklebt sin…
Seine Augen wurden wieder gro…
- Auf deiner KFZ-Karte! die Steuermarken! wiederholte Al…
S. 33
Richard verzeiht ihr nicht, dass er sich ihr nie an vertraut hat und und jetzt krampfhaft seine Vergesslichkeit vor ihr verbergen mus…
Altersstarrsinn geht einher mit autoritärem Auftreten. Ein Widerspruch von Alma wirkt für ihn wie ein Verstoß gegen die moralische Ordnung:
S. 27
Gib sie mir zurück, du verstehst nichts davo…
S. 31
Es gelang ihr nach einigem Hin und Her, ihm die zweite Anzugjacke abzujage…
Die Willensschwäche Richards ist ein weiteres Symptom seiner Demenzerkrankung :
S. 29
Auf Almas Nachfragen rückte er damit heraus, dass er im Bett bleiben wolle, er fühle sich nicht besonders. Nähere angaben zur Art dieses Unwohlseins machte er nicht, und er ließ sich auch nicht dazu bewegen, seine Tür zu öffne…
Es war nicht das erste Mal, dass Richard seine Pläne wegen eines plötzlichen Anflugs von Willensschwäche unter dubiosen Vorwänden aufscho…
Sie weiß all diese Krankheitssymptome zu erklären und in den Anfängen noch damit umzugehen, wohl wissend, dass die das Gehirn zerstörende Entwicklung ihren Fortgang nehmen wird.
Sie ist die Bezugs- und Hilfsperson ihres Mannes.
S. 27
Da er sich so stur und unfreundlich gebärdete, hatte auch sie wenig Grund, netter zu sein. Er soll sich gefälligst zusammenreißen. Aber gleichzeitig erinnerte sie sich daran, was für ein armer Kerl er war und dass er die Dinge niemals mehr so sehen würde wie sie. Die Zeit des Begreifens war für ihn vorbei, statt dessen gab es jetzt Verunsicherung und, was schwerer wog, Zorn über diese Verunsicherun…
S. 17
Gut, mag sein, sie sieht das zu pessimistisch, mag sein, sie ist überempfindlich, weil ihr diese Dinge zu.Bewusstsein bringen, dass es irgendwann nicht mehr weitergehen wir…
… Und trotzdem: beängstigend, grauenvoll kommt ihr das vor , weil anzunehmen ist, ass es schlimmer werden wir…
Trotz der Schicksalsschläge erreicht sie ein hohes Alter in geistiger Gesundheit mit altersbedingten körperlichen Einschränkungen.
Sie beobachtet auch an sich selber die Zeichen des Alters, zunächst im Aussehen:
S. 22
Vor dem Spiegel? Das soll ,ich‘ sein? Aber ja. Ja ja ja. Schau sich das einer an. Also schön: vor dem Spiegel muss man klein beigeben … Sich anmalen ist ja doch nichts Stabiles und macht die Wahrheit nicht erträgliche…
Dann spürt sie:
- Müdigkeit und nachlassende Leistungsfähigkeit:
S. 352
… der Zahn der Zeit findet auch an mir genug zu nagen, mehr als mir recht ist, all diese Wehwehchen, und speziell die ewige Müdigkeit, die macht mir am meisten zu schaffen, weißt du, dass immer alles viel mehr Zeit in Anspruch nimmt, als ich dafür veranschlage, was ich früher im Vorbeigehen erledigt habe, ist mittlerweile zu einer Prozedur geworden … kaum je, dass ich das Plansoll, das ich mir am Morgen setze, erfülle …
- geistige Überforderung bzw. Konzentrationsschwäche:
S. 365
… und eine Dokumentation zur Entstehung des Lebens wiederum ist zu hoch für sie, obwohl das Thema sie interessier…
- und registriert bei sich Emotionslosigkeit:
S. 365
So starrt sie erwartungslos in sich hinein, ohne glücklich oder unglücklich zu sein, ohne schlafen zu können …
Alma akzeptiert altersbedingte Veränderungen und wählt eine dementsprechende Lebensweise.
Sie übt und trainiert die Leistungen ihres Gedächtnis, das Beispiel ihres Mannes vor Augen:
S. 365
Vielleicht niedergeschlagen, ja, ein wenig niedergeschlagen, weil die Möglichkeit, Wissen zu erwerben, auch für sie nachgelassen ha…
S. 378
Sie (Philipp und Johanna) redeten über Philipps Großmutter, die im hohen Alter ihr Englisch noch mal aufgefrischt hatt…
(ER)
Im DDR-Familienroman ist es Wilhelm, der 1989 im Alter von 90 Jahren unter den Folgen des Alters leidet, er ist nicht mehr in der Lage sich zu artikulieren:
S. 187f
Manchmal vergaß er, was zu tun wa…
Es kam ihm so vor, als sei er über Nacht erstarr…
Er litt zunehmend am grauen Star. Schon des Öfteren hatte er sich versehentlich ein Stück Bart wegrasier…
S.196
Aber um mit Charlotte zu streiten, war seine Zunge zu schwer und sein Kopf zu träg…
S. 199
Er redete leise und umständlich, die Worte lösten sich langsam aus ihm heraus, so langsam, dass Wilhelm das letzte Wort schon vergessen hatte, bevor das nächste aus dem Mann herauska…
S. 207
Und worin das Problem bestand, hätte er gern gesagt, aber seine Zunge war zu schwer, und sein Kopf zu alt, um aus dem, was er wusste, Worte zu mache…
Kurts Demenz entwickelt sich nach seinem 80. Lebensjahr und äußert sich schleichend im Verlust seines Redetalents, d a s prägende Instrument zur Gestaltung seines Lebens. Er, der früher ein eloquenter Erzähler war (S.10), wird sprachlos und kommunikationsunfähig, eine „... außer Rand und Band geratene Herz-Kreislauf-Maschine, die sich selbst in Betrieb hielt“ (S.11). Er lebt nun in einer eigenen Welt (S. 10f) und benötigt intensive Betreuung von Pflegekräften eines Pflegedienstes, nicht in einer Pflegeeinrichtung, sondern in seinem eigenen Haus. Kurts geistiger Verfall und die Bedeutungslosigkeit seines literarischen Werks symbolisieren das Scheitern des sozialistischen Systems der DDR. (S. 21)
S. 11
Kurt hatte alle überlebt. Er hatte Irina überlebt. Und nun bestand die reale Chance, dass er auch ihn, Alexander überleben würd…
S. 11
Das einzige … , wofür er sich wirklich interessierte und worauf er sein letztes bisschen Schlauheit verwendete, war essen. ..Kurt aß, um zu leben. Essen - Leben, diese Formel, dachte Alexander, hatte er im Arbeitslager gelernt…
Das war das letzte, was von Kurt übrig geblieben wa…
Für die Autoren der modernen Romane stellt sich das Einbeziehen der Altersproblematik anders dar als man es aus dem traditionellen Familienroman kennt. Arno Geiger sieht für sich das Altern und das Vergehen der Zeit als das große Thema der Literatur: „Wer Romane schreibt, ohne sich der besonderen Rolle der Zeit bewusst zu sein, an dem geht ein Teil des Wunderbaren dieser Gattung vorbei.“1295 (AG)
Loslassen und Abdanken im Alter ist schwierig und mit Frustration und Kränkung verbunden, das zeigt die Person von Richard Sterk: Richard fühlt den sozial defizitären Charakter dieser Lebensphase. Das Ausscheiden aus dem Berufsleben und der politischen Arbeit stellen für ihn eine Zäsur da, unter der sein Selbstwertgefühl leidet.
Richard steht vor der Entwicklungsaufgabe, den Austritt aus dem Berufsleben nicht mehr nur als Statusverlust zu sehen, sondern sich an den Ruhestand anzupassen und mit den individuellen Potentialen nach einer neuen Betätigung zu suchen. Mit seinen bisherigen Handlungsmöglichkeiten findet er gesellschaftlich keine Berücksichtigung mehr.
Es kommt zur Krise trotz eigentlicher Befreiung und Entlastung. Davon tangiert werden sowohl die Partnerbeziehungen, die Freizeitgestaltung und der Kontakt zum eigenen Kind und zum Enkelkind.
S. 198
Mit schlaff am Körper liegenden Armen und geöffneten Beinen liegt Richard im heißen Wasser und sagt sich, dass Alma ihn sowenig braucht wie die Partei ihn noch brauch…
Der neue Lebensabschnitt bringt psychologische Probleme, die bisher gezeigte Leistung hat keine Bedeutung mehr und die nachlassende Kraft und Vitalität bereiten Sorgen;
S. 198
Schieben ihn aufs Abstellgleis ohne ein einziges sachliches Argument. …
Hohlköpfe samt und sonders. .. ein düpierter, gedemütigter, ausgetrickster Vollidiot.…
S. 202
Er hat geglaubt, dass seine eigene Zukunft eng genug mit der Zukunft der Republik verknüpft sein wird und dass sich daraus ganz von selbst Effekte auch für ihn ergeben werde…
S. 203
Er weiß, seine Person verliert an Bedeutung, und nicht nur an Bedeutung, auch an Elan und Willenskraft, an Attraktivität, an geistiger Aufnahmefähigkei…
All das versucht er mit Dominanz zu überspielen:
S. 27 (Es geht um die Erneuerung seiner Prothese)
Gib sie mir zurück, du verstehst nichts davo…
S. 192
Was er hingegen sehr gut verstanden hat, ist, dass Alma es nicht der Mühe wert findet, seinetwegen ihre Zimmertür zu öffne…
Er tendiert zum passiven Versorgtwerden:
S. 29
Alma erinnert ihn ihn mit Klopfen an seine Tür an den Arzttermin ..Auf Almas nachfragen rückte er damit heraus, dass er im Bett bleiben wolle, er fühle sich nicht besonders. doch da Richard sich seit einigen Jahren immer einsperrte, bekam es Alma mit der Angst zu tun. . Dr. Wenzel traf zwanzig Minuten später ein,…
Die Beziehung mit seiner Frau Alma ist stabil, beide wünschen sich die Dauerhaftigkeit der Beziehung und sehen die Sicherheit und das Füreinanderdasein als selbstverständliche und lebenslange Aufgabe an, doch fällt es Richard schwer, diese Gefühle in Worte zu fassen:
5. 194f
Er sollte so vieles sagen, und - durch ein plötzliches Entsetzen ahnt er die Wahrheit - vor allem sollte er wieder anfangen, sich Alma mitzuteile…
Wie noch selten kommt Richard zu Bewusstsein, dass der Großteil des Glücks, das in diesem Leben für ihn bestimmt war, in Alma verkörpert ist . Doch statt seine Hilflosigkeit zu bekennen oder schlicht zu sagen, dass er seine Frau nach wie vor liebt, nach all den Jahren, und dass es ihm nicht schwerfällt, sich das einzugestehen, fragt e…
-Wie kommt es eigentlich, dass du dich mir seit Monaten nicht mehr genähert has…
Um das Alter als einen gelungen Weg in diese Lebenssituation zu erleben, dafür gibt es Strategien, die auch in den Romanen zum Ausdruck kommen:
- die Selektion,d.h., zu akzeptieren, dass manche Ziele nicht mehr erreicht und manche Aufgaben nicht mehr ausgeübt werden können;
(AG)
S. 203
Für einen Augenblick, während er diesen Gedanken hat, kann er sich sogar vorstellen, dass er die geänderte Situation genießen wir…
- die Kompensation, d.h. das Zurückgreifen auf neue Ressourcen, wenn ein Ziel nicht mehr wie bisher erreicht werden kann; neue Präferenzen zu suchen, um dem Alter einen Sinn zu geben;
(AG)
S. 202
Vielleicht sollte er einfach versuchen, das Beste daraus zu machen, und die naturwissenschaftlichen Interessen, die er als junger Mensch hatte, wieder mehr pflegen. Die perfide Mischung aus Ehrenämtern und nichts als Privatleben ließe sich mit etwas trockener Materie vielleicht entschärfen. Zum Beispiel könnte er der Frage nachgehen, ob bereits jemand herausgefunden hat, warum Wasser zuweilen vergisst zu gefrieren. . Das heißt, eigentlich ist es ihm egal, mal abgesehen davon, dass darin ein Keim jener Hoffnung steckt, ein Nachholen von Dingen, die man irgendwann versäumt hat, könnte möglich sei…
- die Optimierung, d.h. der Versuch, als alter Mensch die eigenen Fähigkeiten und verbliebenen Kompetenzen zu verbessern und zu stabilisieren.1296
(AG)
S. 203
Und weil er ein methodischer Mensch ist, nimmt er dieses Projekt sogleich in Angriff, und zwar anhand dessen, worum es in seinem Leben, wie er meint, momentan vor allem geht: der Zeit. … und fragt sich dabei, ob die Zeit tatsächlich arbeitet. … Ob man einen Wettlauf mit der Zeit gewinnen kann. …
S. 378
Sie reden über Johannas Arbeit beim Fernsehen und über Philipps Großmutter, die im hohen Alter ihr Englisch noch mal aufgefrischt hatt…
Literatur hat bei Frauen und Männern im Alter eine herausragende Bedeutung:
(AG)
Besinnung bietet Alma die Lektüre der Romane von G. Keller: So wie dieser Autor die Einsamkeit beim Anschauen der Natur lobte, ist für Alma das Lesen Ruhe und Meditation und gleichzeitig ein Ersatz für Sozialkontakte.1297 Einsamkeit scheint eine Quelle des Glücks zu sein, die Kraft geben kann.1298 (ER)
Charlotte zieht sich zum Lesen in ihr „Turmzimmer“ zurück:
S. 405
Eine Weile las sie Oliver Twist von Charles Dickens. Zwar kannte sie das Buch bereits, hatte es vor vierzig Jahren schon einmal gelesen, aber in letzter Zeit las Charlotte am liebsten Bücher, die sie schon kannte und mochte, und am allerliebsten solche, die sie kannte und mochte und doch wieder vergessen hatte, sodass sie in den Genuss unverminderter Spannung ka…
Kurt verfasst sein letztes Buch, eine Optimierung der verbliebenen schriftstellerischen Kompetenz:
S. 22
Aber dann hatte sich Kurt noch einmal auf seinen katastrophalen Stuhl gesetzt, mit schon fast achtzig, und hatte klammheimlich sein letztes Buch zusammengehämmer…
Frauen altern anders als Männer. Dafür ist Alma ein Beispiel:
Für sie ist die Anpassung an den Ruhestand des (Ehemannes) mit der Suche nach neuen Formen der Beschäftigung und Bestätigung verbunden, gleichzeitig beginnt eine Zeit der Autonomie und der freien Zeit, funktionell ausgelastet durch ihren Haushalt und ihre Hobbys (das Imkern und das Lesen).
S. 344
Sie schlüpft in die schiefgelaufenen Gartenschuhe und geht nach draußen, um in aller Gemächlichkeit das Bienenhaus auszukehren, ihre emotionale Aufwärmstub…
Wenn mit den alten Menschen Krankheit, Siechtum und Tod in die Familie treten, fordert dies immer Hilfe und unterstützend-solidarisches Handeln.
In der Zeit des Bürgertums erfolgten Pflege und Sterben im Kreise der Familie. Enkel erlebten den Prozess des Altwerdens und Sterbens mit und bekamen damit die Einsicht in für sie neue Lebensbereiche. Das Sterben eines Großelternteils, meist des Großvaters, war für ein Kind des 18. Jahrhunderts oft die erste Begegnung mit dem Tod.
(TM)
Das Sterben der Großmutter wird ausführlich geschildert und zu einem Familienzeremoniell mit emotionaler Ergriffenheit und Anteilnahme. Die alte Frau Buddenbrook ist im Alter und im Sterbeprozess von einer Anzahl verwandter Personen unterschiedlichen Alters umgeben, das familiale Netz der Buddenbrook-Familie funktioniert: Mit einer großen Selbstverständlichkeit übt man solidarisches Handeln in Form von Geben und Nehmen, Für-einander-Sorgen und dem Übernehmen von Verantwortung, wie tägliche Besuche bei Kranken, Pflege und Betreuung von Kleinkindern. Die Verpflichtung, im Fall der Pflegebedürftigkeit, die Pflege zu übernehmen wird in dieser Kaufmannsfamilie umgesetzt.
S. 565
Als der Senator und seine Frau das Zimmer betraten, ., waren die Ärzte schon zugegen. Auch Christian war aus seinem Zimmer heruntergeholt worden und saß irgendwo.. Man erwartete den Bruder der Kranken, Konsul Justus Kröger, … Frau Permaneder und Erika Weinschenk hielten sich leise schluchzend am Fußende ihres Bette…
S. 558f
Die Ärzte gingen, und Senator Buddenbrook wandte sich, um noch einmal in das Krankenzimmer zurückzukehre…
Frau Permaneder saß an dem Himmelbett, dessen Verhänge zurückgeschlagen waren, und hielt die Hand ihrer Mutter, die, von Kissen gestützt den Kopf dem Eintretenden zuwandt…
Denn die Konsulin verlangte beständigen Dienst an ihrem Bett…
Die Kinder Thomas und Tony und das Personal leisten zunächst die Pflege der alten Konsulin. Im Endstadium übernimmt die Pflegearbeit eine professionelle kirchliche Schwester/Diakonisse. Diese Art der Pflege stand damals unter kirchlicher Führung und wurde als karitativ-christliche Tätigkeit gesehen, von Ordensschwestern ausgeführt, wie z.B. von den erwähnten Töchter der Barmherzigkeit, (gegr.1634). Im Mittelpunkt der Anforderungen an diesen rein weiblichen Krankenpflegeberuf standen nicht die Ausbildung, sondern höchste Priorität hatten die persönlichen Eigenschaften der Pflegerinnen: Selbstaufopferung, Pflichtbewusstsein, Verantwortungsbewusstsein, Gehorsamkeit.
Die Arbeitszeiten dieser Pflegerinnen belaufen sich auf zum Teil 16 Stunden am Tag, die Bezahlung war oftmals Gotteslohn.
S. 560
Und Schwester Leandra kam. . und ging, während der Rosenkranz, der an ihrem Gürtel hing, leise klapperte, mit sanften und freundlichen Worten und Bewegungen an ihre Arbeit. Sie pflegte die verwöhnte und nicht immer geduldige Kranke Tag und Nacht und zog sich dann stumm und fast beschämt über die menschliche Schwäche, der sie unterlag, zurück, um sich von einer anderen Schwester ablösen zu lassen, zu Hause ein wenig zu schlafen und dann zurückzukehre…
Nach dem Tod trauert man mit der Unterstützung der Angehörigen und gedenkt der Toten, ohne dass jemand in Einsamkeit seinen seelischen Schmerz tragen muss, z.b. beim Tod von Thomas Buddenbrook:
S. 686f
Dann stand er(Christian),zwischen Schwester und Schwägerin, am Sterbebette…
Andere Besucher, die alten Krögers, die Damen Buddenbrook aus der Breitenstraße, der alte Herr Markus, stellten sich ein. Auch die arme Klothilde ka…
In dergleichen Solidarformen zeigt sich im modernen Familienroman ein starker sozialer Wandel: War die Familie früher der Ort, wo man Hilfeleistungen anbieten und erbitten konnte, wuchs die Ablehnung des Frauenmodells der „Fürsorglichkeit“ und „Aufopferung“; stattdessen entwickelte sich eine Vorstellung von Autonomie im Familienleben ohne jegliche geschlechtsspezifische Zuschreibungen. Nur selten zeigen Kinder oder Enkel Unterstützung in Fällen von Krankheit, Verwitwung oder Pflegebedürftigkeit. Sie fühlen sich keineswegs zur Solidarität verpflichtet - auch wenn das Verantwortlichkeitsgefühl zwischen Kindern und Eltern aufgrund der emotionalen Binnenstruktur innerhalb der Familie, immer noch groß sein sollte.1299 (AG)
Richard Sterk wird während seiner Demenzerkrankung, so wie Zweidrittel der Pflegebedürftigen, von einem weiblichen Familienmitglied zu Hause gepflegt: Alma ist während ihres „Altersmatriarchats“1300 seine alleinige Bezugsperson, trotz eigener psychisch-seelischer und körperlicher Belastungen. Als Richards Autonomie und Selbständigkeit verloren geht, nimmt seine Abhängigkeit und Angewiesenheit auf Alma zu. Alma verändert ihre eigenen Lebensgewohnheiten und stellt Ihre eigenen Bedürfnisse zurück, ohne Unterstützung und Entlastung von Familienangehörigen zu empfangen.
Peter sieht sich als Schwiegersohn nicht in der Verantwortung für die Schwiegereltern. Es existiert für ihn keine familiale Solidarität, die ihn stellvertretend für die verstorbene Ingrid zu Hilfe verpflichtet:
S. 304
… (und als nächstes fallen ihm Ingrids Eltern ein, die verdammten Alten…
Der Kontakt zwischen Philipp und seinen Großeltern ist abgerissen, er wird von seinem beruflichen und persönlichen Leben vollständig absorbiert. Da er bereits den Tod bei seiner Mutter erlebte, für ihn ein einschneidendes Erlebnis, ist er vom Tod seiner Großmutter nur wenig emotional getroffen.
S. 11
- Ich beschäftige mich mit meiner Familie in genau dem Maße, wie ich finde, dass es für mich bekömmlich is…
- Schaut aus wie Nulldiä…
- Wonach immer es ausschau…
S. 13
Keine Antwort, somit auch kein Interesse, nicht anders als für deine Verwandtschaf…
Die zurückgehende und mangelnde innerfamiliäre Solidarität wurde ersetzt durch wohlfahrtsstaatliche Maßnahmen und Einrichtungen in der Pflege und ließ die Bedeutung des staatlich unterstützten Altenheims steigen.
Im 20. Jahrhundert stehen Institutionen wie Krankenhäuser und Seniorenheime als außerfamiliale Institution für die Pflege alter Menschen zur Verfügung.
(AG) ..
Der Verbleib Richards zu Hause ist nicht mehr möglich, und die Überweisung ins Pflegeheim wird notwendig, ein schwerer Schritt für Alma.
S. 340
Auf Anraten von Dr. Wenzel hat Alma Richard vor drei Jahren in ein Pflegeheim gegeben, im Sommer 1986 … Die damalige Entscheidung kam nicht unvorbereitet, es war schon länger klar, dass es irgendwann nicht mehr gehen wird. Trotzdem kann Alma diesen Schritt noch immer nicht ganz verwinden. Wieder und wieder sieht sie Richards große angstvolle Augen …
S. 341
Anfangs hat sie ihn öfters tagweise mit nach Hause genommen, manchmal auf sein inständiges Bitten hin. Aber selbst zu Hause findet er sich nicht mehr zurecht, so stark hat er abgebau…
Bei ihren Besuchen während Richards Krankenhausaufenthalt gibt Alma ihrem Mann Trost und liebevolle Hilfe:
S. 346
Sie schiebt Richard die Bügel hinter die großen, knorpeligen Ohren, dabei gibt sie acht, dass sie keine Wunden berührt. Richard strahlt, weil er wieder besser sieh…
S. 357ff
Ist schon gut, Richard. Lass gut sein. Mach dir keine Sorgen. …
Sie streichelt seine Stir…
Im Gespräche mit Richard passt sie sich seinen Kommunikationsregeln an und versucht seine Welt zu verstehen:
S. 345
- Nessi? fragt er und meint seine Anfang des Jahres verstorbenen Schwester,, …
- Ich bin’s Alma, deine Fra…
- Er wendet sich ihr zu und schaut sie an, als wäre sie aus dem Zoo entsprungen. Nach einer Weile lächelt er und sagt mühsa…
- Obacht. …
Wenig später sagt er deutlich ,gut‘ und ,ja‘, dann formuliert er noch ,warum‘ und etwas im Zusammenhang mit ,weiß‘, was Alma aber nicht versteht. .. Auch diesmal gelingt es ihr nicht zu vertuschen, wie wenig von dem, was Richard gesagt hat, bei ihr angekommen ist. .. Richard wird unwirsch. Sie nimmt alle Schuld auf sich und bittet ihn, er solle es ihr noch einmal sagen, weil in letzter Zeit ihre Ohren so schlecht sein, dass sie aufs erste Mal nicht alles hör…
In Richards Krankenhaus unterminiert eine im Ansatz diskriminierende Kommunikation zwischen altersungleichen Personen, in diesem Fall der Krankenschwester und ihm, die Selbständigkeit älterer Menschen und enthält demütigende sprachliche Elemente, wie vereinfachte Wortwahl, vermehrte Wiederholungen, kürzerer Satzbau, Paternalisierungen (Verkindlichungen, von oben herab):1301
S. 343
-Bis in sechs Wochen haben w i r das ausgestanden, Herr Doktor, beruhigte ihn die Krankenschweste…
(ER)
In der Sorge und Pflege Saschas um seinen dementen Vater wird die Familie zur Solidargemeinschaft als ein Überbleibsel des früheren sozialen Systems. Sascha kann seinem Vater die Liebe nicht verweigern und versucht, sie ihm, der ihm sein Leben lang Sicherheit und Zuneigung schenkte, zurückzugeben.
S. 8f
Alexander schloss auf, umarmte seinen Vater, obwohl ihm die Umarmung seit langem unangenehm war. Kurt roc…
Alexander machte Kurts Essen warm. Mikrowelle, Sicherung einschalten …
S. 16
Nachdem Alexander seinen Vater geduscht, ins Bett gebracht und den Badfußboden gewischt hatte, war sein Kaffee kal…
Als Sohn besitzt er nun eine Machtstellung gegenüber dem hilflosen Vater, dessen Krankheit uns, dem Leser, mit aller Offenheit vermittelt wird, mit all den traurigen Auswirkungen wie z.B. Autonomieverlust,Verfall, Altersschwäche, Urinieren auf dem Wohnzimmerboden.
Die Alzheimererkrankung und die Veränderung des Vaters belastet den Sohn psychischseelisch und führt zur emotionalen Distanz, veranschaulicht durch eine nüchterndrastische Sprache (parataktischer Satzbau, Ellipsen, Ein-Wort-Sätze).
S. 10f
Miserable Quote: Ein Stückchen Gulasch hatte Kurt bisher geschafft. Jetzt griff er zu: mit den Fingern. Schaute schräg von unten zu Alexander herauf, wie ein Kind, das die Reaktion seiner Eltern prüft. Stopfte das Stück in den Mund. Und noch eins. Und kaute. …
Kurt konnte nichts mehr. Konnte nicht sprechen, sich nicht mehr die Zähne putzen. Nicht einmal den Arsch abwischen konnte er sich, man musste froh sein, wenn er sich zum Scheißen aufs Klo setzt…
Die modernen Romane zeigen uns die Andersartigkeit des heutigen Sterbens im Vergleich zu früher:
Vor zweihundert Jahren erfolgte das Sterben wesentlich häufiger innerhalb kurzer Zeit in jüngeren Jahren, so dass die nachfolgende Generation auch früher nachrücken musste. (TM)
S. 248
Man flog die Treppe hinunter, durchs Frühstückszimmer, ins Schlafzimme…
Aber Johann Buddenbrook war schon to…
S. 253
Thomas Buddenbrook, in so jungen Jahren bereits der Chef des großen Handlungshauses, legte in Miene und Haltung ein ernstes Würdegefühl an den Ta…
Heute zögert sich der Sterbeprozess mit einem langen Dahinsiechen und Leiden und nachlassenden geistigen Fähigkeiten bis ins hohe Alter hin.
(ER)
Wilhelm stirbt an seinem 90. Geburtstag, bei ihm beginnt der geistige Verfall Jahre zuvor, Charlottes geistige Verwirrtheit wird danach für alle erkennbar.
Zwei Jahre später, Charlotte ist inzwischen weit über achtzig, lebt sie im Altersheim und erkennt ihren Sohn bereits nicht mehr, so dass man nach Auskunft des Arztes bald mit dem Tod rechnen müsse.
Die Wandlungen in der Familienstruktur brachte eine Einsamkeit im Alter mit sich. Durch die geringe Anzahl von Kindern und deren örtlichen Wegzug tritt eine Isolierung der nun alten Eltern ein. Der früher übliche traditionelle Respekt vor dem Alter wird ihnen heute versagt - es herrscht der „juvenilistische (jugendliche) Zeitgeist“ und dieser beschleunigt die Schwächung der Kontaktfähigkeit.
Die emotionale Stütze dreht sich nun um:
(ER)
- Eltern warten auf ihren Sohn:
S. 74f
- Was ist denn, wo ist e…
- In Gießen, sagte Kurt leis…
Ihr Körper reagierte sofort - als wäre ihm ein Schlag versetzt worden, während ihr Kopf lange brauchte, um zu verstehen, was das bedeutet: Gieße…
S. 353f
Eigentlich hatte sie gehofft, dass der Fall der Mauer Sascha wieder in ihre Nähe bringen würde.. Aber anstatt zurückzukommen, war Sascha noch weiter weggezogen. …
Die kurze Zeit, die Sascha in Neuendorf verbringen würde, war zu kostbar, um sich zu streiten..Inzwischen musste man froh sein, dass er überhaupt ka…
(AG)
-Großeltern warten auf ihre Enkel:
Alma wird nicht mehr von ihren Enkelkindern besucht. Sie verbringt ihren Lebensabend allein in einer eigenständigen Wohnform, in einem Ein-Personen-Haushalt, einer Haushaltsform, die in einer Gesellschaft mit veränderten demographischen Fundaments stetig wächst und die der allgemeinen Tendenz der Individualisierung entspricht. 1302 S. 352
Sissi hat sich vor etlichen Jahren blicken lassen … und die obligate Geburtstagskarte von ihr habe ich in diesem Jahr auch nicht erhalte…
S. 354
… die wenigen Male, als er(Philipp)sich noch bei uns blicken ließ, …
Alma besitzt Erfahrungswissen und Altersweisheit und ist ein Beispiel dafür, wie ein fortgeschrittenes Alter Menschen auf das vergangene Leben mit den Höhen und Tiefen zurückblicken lässt. Emotional enge Bindungen scheinen nicht mehr vorhanden zu sein, vertraute Personen finden keine Erwähnung mehr. Dadurch dass der Familienverband und das Beziehungsgefüge sich aufgelöst haben, verringert sich mit dem Tod Richards die gesamte soziale Integration von Alma, ist es Alleinsein oder ist es Einsamkeit?
Alleinsein bezieht sich stets auf eine äußere Situation und kann durch den Besuch anderer oder eine Einladung geändert werden. Positiv gesehen ist es ein Rückzug von anderen und von der Interaktion mit ihnen, der Mensch erlaubt es sich zu entspannen und sich zu erholen. Solch ein Für-sich-sein bietet die Möglichkeit der Besinnung, Erfahrungen zu überdenken und durch Selbstreflexion und Selbstkommunikation das eigene Ich zu stabilisieren.1303 Einsamkeit dagegen ist eine Befindlichkeit des Auf-sich-selbst-gestellt- Seins. Sie fördert nicht die Entspannung und ähnelt nicht selten einer Depression.1304 Alma Sterk lebt am Ende ihres Lebens zwar nur noch für sich allein in der großen Familienvilla, fühlt sich aber nicht einsam. Sie besitzt innere Stärke und verfällt nicht in Selbstmitleid.
S. 365
In dieser Stellung lauscht Alma auf die vertrauten Geräusche im Haus, friedlich, sanft liegt sie da, geduldig, auf nicht unangenehme Weise einsam, also nicht einsam, sondern allei…
Almas Kontakte zu Nachbarn reduzierten sich im Alter, auf eigenen Wunsch hin hat sie die Tendenz, sich im Alter zurückzuziehen: S. 364. weil sie keine Besuche mehr wil…
Zustände trauriger Verstimmtheit und Enttäuschung, Trauer und Selbstvorwürfen wechseln sich bei ihr ab. Sie meint, nicht genug getan zu haben, solange es möglich war, setzt sich mit dem auseinander, was nicht gesagt oder gelebt (Otto, Ingrid) worden ist, was also möglicherweise versäumt oder von ihr verschuldet wurde.
Ihr Alter ist für sie eine Zeit, um Lebensbilanz zu ziehen. Einsamkeit wird bei ihr zur Quelle der Besinnung und der Selbsterkenntnis.1305
S. 371
Im bereits ausgekühlten Fernseher, wenn er liefe, wenn das richtige Programm eingestellt wäre (wäre wäre wäre), antwortete ein vor drei Jahren verstorbener russischer Regisseur auf die Fage, was das Leben se…
- Eine Katastroph…
Was man ja immer ein wenig geneigt ist zu unterschlage…
Der Stellenwert der Rückerinnerung an die eigene Biographie und die eigenen Lebenserfahrungen vergrößert sich. Sie blickt mit ihrem Erfahrungswissen ohne Gram und mit Altersweisheit lebensbejahend auf ihr vergangenes Leben mit den Höhen und Tiefen zurück:
S. 370
Dass es in ihrer Kindheit hieß, an ihr sei ein Bub verlorengegangen. Ja? …
Der 21. Februar 1945. Als viele der wertvollen Vögel aus dem schwer getroffenen Tiergarten entkommen und in die fensterlosen Hietzinger Villen flüchten konnten. …
Trotz der Schicksalsschläge bewahrt sie eine psychologische Widerstandsfähigkeit und positive Identität.
S. 365
Sie sagt es sich auch jetzt: Das war wieder nicht mein Tag, der sollte bald kommen. Gleichzeitig nimmt sie ohne Bitterkeit zur Kenntnis, wie unsinnig ihr Wunsch ist, weil dieser Tag nicht kommen kann, sie wüsste nicht wie und womi…
Sie akzeptiert den eigenen Tod als etwas Unabdingbares und trifft angstfrei Vorkehrungen zur Vorbereitung. „Die Akzeptanz der eigenen Endlichkeit setzt Ich-Integrität und eine positive Lebensbilanz voraus.“ 1306
S. 365
So starrt sie erwartungslos in sich hinein, ohne glücklich oder unglücklich zu sei…
S. 370f
…, dass es mit dem Tod aus und vorbei ist …
Ihre sympathische Darstellung ist ein Beispiel dafür, wie sehr „die Rolle der alten Frau eine Aufwertung in der Literatur erfahren hat“.1307 Die Selbstbescheidung in der Akzeptanz des eigenen Schicksals, die Annahme der anfallenden Verluste und der eigenen Endlichkeit nimmt den Leser für sie ein.
(TM)
Ganz anders dagegen die sterbende Frau Buddenbrook, die zwar die Fürsorge der Familie erlebt, jedoch ihre Beeinträchtigungen und ihre Krankheit ganz und gar nicht annimmt und sich gegen den Tod wehrt:
S. 560f
Je mehr sich ihr Zustand verschlimmerte, desto mehr wandte sich ihr ganzes Denken, ihr ganzes Interesse ihrer Krankheit zu, die sie mit Furcht und einem offenkundigen, naiven Hass beobachtet…
Nein, die alte Konsulin fühlte wohl, dass sie trotz der christlichen Lebensführung ihrer letzten Jahre nicht eigentlich bereit war, zu sterben, und der unbestimmte Gedanke, .., erfüllte sie mit Angs…
Sie betete viel; aber fast mehr noch überwachte sie, so oft sie bei Besinnung war, ihren Zustand, fühlte selbst ihren Puls, maß ihr Fieber, bekämpfte ihren Huste…
S. 567
Um vier Uhr ward es schlimmer und schlimmer. Man stützte die Kranke und trocknete ihr den Schweiß von der Stirn…
Und dann begann der Kampf aufs Neue. War es noch ein Kampf mit dem Tode? Nein, sie rang jetzt mit dem Leben und dem To…
Der Blick auf die alte Frauen veränderte sich in weiterer Hinsicht, als Frauen das Recht auf Erwerbstätigkeit erhielten. Von da an wird sie zur „Personifikation von Schicksalsschlägen und verpassten Chancen, dient als Metapher für Vergänglichkeit, tritt auf als schlechtes Gewissen der dominierenden Personen, um, Sühne, nicht Rache fordernd, diese zur Besserung zu zwingen.“1308
Wir lesen davon im DDR-Familienroman:
(ER)
Charlotte ist im Alter ganz und gar nicht zufrieden und altersmilde. Sie lebt mit Wilhelm während seiner Demenzerkrankung zusammen, ist nicht im Einklang mit sich. Sie realisiert ihre verpassten Chancen, die Ungerechtigkeit, die ihr nicht nur im Berufsleben widerfahren ist, trauert den verpassten Gelegenheiten nach und will diese in der Zukunft noch realisieren.
S. 401f
Sie war Institutsdirektorin geworden mit vier Jahren Haushaltsschule. Zählte nur Wilhelms proletarische Ehre?…
Warum, dachte sie, während das Zischeln allmählich in ein gleichmäßiges Rauschen überging, warum war sie es immer, die den Pfeifkessel bewachte . während andere studieren durften . während andere den Vaterländischen Verdienstorden bekamen…
S. 405f
Dann war Adrian da. Sie wusste natürlich, dass es ein Traum war. . Die Tür war offen. Charlottes schritt hindurch. Nun war Adrian wieder da, lächelte. Berührte sie sanft, drehte sie um - und Charlotte spürte, wir sich ihre Nackenhaare aufrichteten.…
24.5 Altern in der DDR
Ziel ostdeutscher Altenpolitik war sowohl die gesellschaftliche Partizipation als auch die medizinische und soziale Betreuung und Fürsorge der älteren Menschen.1309 Welche Bedeutung alte Menschen in der DDR-Wirklichkeit hatten, zeigte das Reiseprivileg der Rentner: ein Zeichen und amtliche Bestätigung für die Unwichtigkeit der alten Menschen.
Die Renten waren auf niedrigem Niveau, lagen bis zu 50% niedriger als das Nettoeinkommen, und mancher Rentner wäre ohne Subventionspolitik oder Besuche und Geschenke aus Westdeutschland unter die Armutsgrenze gerutscht. Ältere Menschen, insbesondere ältere Frauen, zählten in der DDR zu den benachteiligten Gruppen und waren abhängig von der Altersrente der Sozialversicherung. Hinzu kam, dass Sonderregelungen/Ungleichheiten bzgl. der Versorgung für „Intelligenz“- Berufler und Mitarbeiter/innen staatlicher Behörden Sozialneid zwischen diesen privilegierten Gruppen und den Menschen mit niedrigen Renten mit sich brachte.
Jeder Bürger hatte das Recht auf Arbeit bis zum Rentenalter und wenn der Wunsch bestand, weil das soziale Wohlbefinden davon abhing oder Zuverdienst einfach wichtig war, um Verarmung vorzubeugen, darüber hinaus.1310 Es gab keine flexiblen Altersgrenzen für ein Ausscheiden aus dem Arbeitsprozess und lediglich bei Invalidität oder für bestimmte Berufsgruppen wie Bergarbeiter, Piloten und Tänzer war eine vorzeitige Berentung möglich.1311 Man hatte von offizieller Seite wegen des Arbeitskräftemangels nichts gegen eine Erwerbstätigkeit nach dem Erreichen des Rentenalters einzuwenden - und viele ältere Arbeitnehmer konnten nach ihrem 65. Lebensjahr ihr Renteneinkommen aufbessern oder ihr Bedürfnis nach Anerkennung und dem Wunsch, etwas Sinnvolles zu tun, befriedigen und durch berufliche Kontakte der Isolierung vorbeugen.
Charlotte ist weiterhin (1976) im literarischen Bereich tätig, rezensiert und kommentiert Bücher:
S. 266
Seit einem halben Jahr redete Charlotte von nichts anderem als von ihrem Buch, welches übrigens gar nicht ihr Buch war, denn sie hatte lediglich ein Geleitwort geschrieben, tat aber so, als sei dieses Geleitwort das Wichtigste an dem Buch …
Entscheidend für die Lebensqualität im Alter waren und sind für viele Menschen die Wohnbedingungen, ob der Haushalt selbständig weiter geführt werden und man in seinem Wohnumfeld bleiben und seinen Lebensstil beibehalten kann (so wie es die literarischen Beispiele der Frauen Alma Sterk und Konsulin Buddenbrook zeigten). In der DDR lebten viele alte Menschen in Altbauten unter unzureichenden Wohnbedingungen, mit schlechter Ausstattung und verschlissenen Zimmern, Ofenheizung und Außen-WC.
Es gab weder Tages- noch Nachtpflegestationen, und nur 1,7% (1989) nutzten mobile Pflegedienste oder das betreute Wohnen.1312 Stattdessen war es die Volkssolidarität, die Mahlzeiten austeilte, Altenclubs und Treffpunkte der Begegnung leitete; Hauswirtschaftspflegerinnen kauften für ältere bedürftige Menschen ein, kochten, putzten für sie und heizten deren Wohnungen.
Wilhelm ist bereit, Geld für die Volkssolidarität zu spenden:
S. 17
Und wo war der Kuba-Teller, den die Genossen aus dem Karl-Marx-Werk Wilhelm zum neunzigsten Geburtstag überreicht hatten, und Wilhelm, so wurde erzählt, hatte die Brieftasche gezückt und einen Hunderter auf den Teller geknallt - weil er glaubte, er werde um eine Spende für die Volkssolidarität gebeten …
In der Mehrheit waren Angehörige für die Betreuung und Pflege älterer Menschen verantwortlich, teilweise unter unzumutbaren Bedingungen, was Wohngröße und Ausstattung betraf und und ohne jegliche Hilfsmittel, wie z.B. fahrbare Gestelle.
Nadjeshda Iwanowna wurde von Irina aus Slawa nach Neuendorf geholt und lebt nun im Haushalt ihrer Tochter, in einem kleinen Zimmer.
S. 64
Im gleichen Moment öffnete sich krächzend die Zimmertür ihrer Mutter.…
- Brauche kein Frühstück, sagte Nadjeshda Iwanowna und schlurfte zum Ba…
Ihr innerer Monolog und die erlebte Rede unterstreichen ihre Einsamkeit und wie wenig sie sich in Deutschland zuhause fühlt. Erinnerungen und spontane Reminiszenzen mit Gegenwartsbezügen überlagen sich bei ihr:
S. 154
Ja, natürlich hatte sie Deutsch lernen wollen, als sie nach Deutschland kam, jeden Tag hatte sie sich hingesetzt und die deutschen Buchstaben gepaukt... Deutsch konnte sie trotzdem nich…
Ihre Sicht auf die Gegenwart steht im Zusammenhang mit der Erinnerung an Russland:
S. 158f
… und in Gedanken war sie in Slawa … Sie würde nach Slawa fahren, zu Ninas Geburtstag, das Visum hatte sie ja … Und dann würde sie sterben, ganz einfach. Dort in der Heimat würde sie sterben, dort wollte sie begraben sein, wie denn anders, ein Glück, dachte sie, während die Deutschlaute in ihren Ohren scharrten, dass ihr das jetzt noch eingefallen war …
Die Sprachbarriere führt bei Gesprächen in der Gesellschaft zu Missverständnissen, z.B. im Dialog mit Wilhelm und Markus:
S. 156
-Affidersin, sagte Nadjeshda Iwanown…
Ihr Urenkel schaute sie erstaunt an, dann schaute er zu seiner Mutter und lacht…
In den 80er Jahren verschlechterte sich die soziale Lage der älteren Menschen im Vergleich zu der anderer sozialdemografischer Gruppen immens, dies spiegelt sich im Roman insbesondere in den Wohnverhältnissen von Charlotte und Wilhelm wider:
S. 277
Schalter außer Betrieb …
S. 286
… nur der kleine Springbrunnen war außer Betrieb, und wenn man sich ganz herüberlehnte, sah man, dass das Parkett vor der Tür, die auf die Terrasse hinausführte, von einem Wasserschaden aufgequollen war, ja dass sogar Bretter fehlten. Schade, dachte Markus, nicht um den Fußboden, sondern um die schönen Sachen, die ihm plötzlich vernachlässigt und verwaist vorkamen …
Für Charlotte wird wegen der desolaten häuslichen Verhältnisse, und weil andere Betreuungsformen und -einrichtungen nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung standen, ein Aufenthalt in einer Pflegeeinrichtung notwendig.
Sie nimmt, ebenso wie in späteren Jahren Kurt, im Alter professionelle Hilfe in Anspruch und wechselt ins Pflegeheim. Irina verursacht dies Gewissensbisse, sie ist zwar ,nur’ die Schwiegertochter, sieht sich aber als Frau verantwortlich für die Familienpflege und den Familienzusammenhalt.
S. 363
Kurze Zeit später war auch Kurt wieder da. Ohne Charlotte. … Es ging Charlotte nicht gut. Sie habe ihn nicht wiedererkannt, sei kaum bei Bewusstsein. Und der Arzt habe ihm zu verstehen gegeben, na ja, dass man sich auf das Schlimmste gefasst machen müs…
Plötzlich musst sie lachen beim Gedanken an den Mülleimerhenkel, den Charlotte ihr letztes Jahr zu Weihnachen geschenkt hatte … Nein, das konnte man ihr nicht verübeln. Sie war alt und verrückt, und nun starb sie, allein, im Pflegeheim. Morgen würde sie nach ihr schauen, dachte Irina. Trotz allede…
Kurt wird während seiner Erkrankung täglich von einer Pflegerin aufgesucht, bekommt zusätzlich Besuche seines Sohnes, der ihn füttert und, falls erforderlich, wäscht:
S. 16
Der Abenddienst würde frühestens um sieben komme…
S. 30ff
Er zog Kurt an, kämmte ihn, rasierte noch rasch die Stellen nach, wo die Pflegerin Stoppeln gelassen hatte. Dann machte er Kaffee (für Kurt, aus der Kaffeemaschin…
Dann war der Spaziergang dran. … Kurt schniefend, nach vorn gebeugt, aber Schritt haltend. Hier, auf dem glatten Asphalt, waren sie früher Rollschuh gelaufen und hatten mit Kreide auf der Straße gemalt … Alexander konnte sich gerade noch daran erinnern. Dann sagten sie nichts meh…
Sie setzten sich auf die Bank und schauten lange in den allmählich sich rötenden Himme…
Irinas Verfall beginnt mit ihrem stetig sich steigernden Alkoholkonsum:
S. 24
Und tatsächlich, sobald er sich Irina vorzustellen versuchte, sah er sie auf dem Fußboden sitzen, bei ihren einsamen Orgien, wenn sie ihre krächzenden Wyssozki-Kassetten hörte und sich allmählich betran…
Ihre Alkoholsucht nimmt mit ihrem Unbehagen gegenüber der DDR, die ihr nach dem Wegzug des Sohnes kein Heimatgefühl mehr vermittelt, zu. Als Alkoholikerin wäre eine Unterbringung in einer Betreuungseinrichtung sinnvoll, sie findet aber die Bereitschaft zur Pflege bei den Angehörigen, bei ihrem Mann Kurt.
Ihre letzte Bitte, sie zu besuchen, wird von ihrem Sohn nicht erfüllt, S. 25
Vierzehn Tage später war zum Beerdigungsinstitut gefahren, um seine Mutter wieder zum Leben zu erwecken … und hatte seine Mutter zu sehen verlangt und hatte sich auch nicht davon abbringen lassen, als man ihm fachkundig riet, sie doch lieber so in Erinnerung zu behalten, wie sie ,im Leben' gewesen wa…
24.6 Großeltern im 18./19. Jahrhundert
In allen Familienromanen spielen alte Menschen als Großeltern, als Großvater bzw. -mutter, eine tragende Rolle, auch wenn sie in mancherlei Hinsicht differieren.
Die Begriffe „Großmutter“ und „Großvater“ erscheinen im Laufe des 16. Jahrhunderts im Westen und Norden des deutschen Sprachgebiets und verdrängen die Begriffe „Ahnherr“ und „Ahnfrau“. Diese werden von da an als alt konnotiert, und nur noch im Süden bis ins 18. Jahrhundert verwendet.1313 Sprachwissenschaftler sehen die Begriffe „Großvater“ und „Großmutter“ als Lehnübersetzungen aus dem Französischen von „grand-père“ und „grand-mère“. Der Wandel auf der semantischen Ebene entspricht einer gleichzeitig neuen Definition der Großeltern, sozial und emotional im familiären Kontext.
Bevor das Bürgertum den Akzent auf die Besonderheit der Familie und ihrer Familienmitglieder legte, bewertete man die Großelternschaft in Selbstzeugnissen als sehr gering und reflektierte eine Großelternbeziehung gar nicht. Großeltern traten erst in Erscheinung, so ließ es sich in Personenstandslisten nachweisen,1314 wenn Enkelkinder verwaist bzw. halbverwaist waren, dann waren sie Auffangstationen und nahmen die fürsorgende Rolle der Eltern ein.
Mit der Geburt von Enkelkindern rücken Familiengenerationen enger zusammen, und oftmals entsteht insbesondere zwischen Großeltern und Enkeln eine emotionale Verbundenheit - interessanterweise stellt das Wort „Enkel“ den Diminutiv von „Ahne“ dar, was auf der Ansicht beruhte, dass der Enkel die Wiedergeburt des Großvaters darstellte.
Großeltern wirken direkt und indirekt auf die Entwicklung ihrer Enkel ein. Als Mitglieder in der Familie, die am längsten gelebt haben und damit die meisten Erfahrungen und Eindrücke von einer Epoche besitzen, verkörpern sie die Vergangenheit bzw. sind ein Teil von ihr. Ihre Erzählungen von früher sind im Unterschied zu historischen Darstellungen privater und verbindlicher Natur und betreffen die unmittelbare Lebenswelt. Sie verkörpern Geschichtlichkeit und Entwicklung und zeigen so den Enkeln, dass Schwierigkeiten überlebt und verarbeitet werden können.Sie vermitteln ihnen, unter der Voraussetzung, dass sie sich mit ihrer jetzigen Position und Situation identifizieren, Ruhe, Kontinuität und Sicherheit.
Großeltern sind als wichtige Identifikationsfiguren der familiären Herkunft anzusehen. Durch das Kennenlernen des Lebens der Großeltern können die Enkel das eigene Leben besser reflektieren1315 und erfahren als junge Generation durch die Überlieferung der Großeltern von den eigenen persönlichen Wurzeln - und werden durch die Familiengeschichte ein Teil der Familie. Dabei begreifen sie, dass Veränderungen und Entwicklungen permanent in jedem Lebenslauf stattfinden.1316
Für die Großeltern sind Enkel die Träger familiärer Werte und Traditionen und bedeuten ein Weiterleben des eigenen Selbst in der nächsten Generation.1317 Ein Enkel kann so eine Quelle der Freude sein, Sinn und Inhalt in das Dasein bringen, kann aber auch, wie in den Romanen zu lesen ist, Kränkung verursachen.
Das in bürgerlicher Zeit konstituierte pädagogische Thema „Kindheit“ ließ die Bedeutung der Eltern-Kind- und Großeltern-Enkel-Verhältnisse zu einem ganz wichtigen Thema werden. Die intensive Beziehung zu den Eltern mit dem Ziel der Formung der Persönlichkeit ging einher mit der Schaffung einer „Enkelkindheit“ mit Ausrichtung auf die Großeltern1318 und einem intensiven Verhältnis zwischen Großeltern(teilen) und Enkelkindern.
Damit veränderte sich das Selbstverständnis und das Rollenbild der Großeltern.
(TM)
Die Großeltern mütterlicherseits, die in der nahegelegenen Gegend wohnen, werden von Tony regelmäßig besucht, sie und ihre Tochter Erika machen in ihrer Kindheit und Jugend spezifische Erfahrungen als „Enkelkind“:
S. 59
Zum Sommer, im Mai vielleicht schon, oder im Juni, zog Tony Buddenbrook immer zu den Großeltern vors Burgtor hinaus, und zwar mit heller Freud…
… die Krögers lebten auf großem Fuße…
An eine Tätigkeit im Hause oder gar in der Küche war hier niemals zu denken, während in der Mengstraße der Großvater und die Mama wohl gleichfalls nicht viel Gewicht darauf legten, der Vater aber und die Großmama sie oft genug mahnten, den Staub zu wischen und ihr die ergebene, fromme und fleißige Cousine Thilda als Muster vorhielten. Die feudalen Neigungen der mütterlichen Familie regten sich in dem kleinen Fräulein, wenn sie vom Schaukelstuhle aus der Zofe oder dem Diener einen Befehl erteilt…
S.372f
Die Konsulin erhob den Kopf nach der Glastür, und während sie mit einem Arm ihre Tochter umfing, streckte sie die freie Hand ihrer Enkelin entgegen, die dort, einen Zeigefinger am Munde, verlegen stan…
„Komm, Kind; komm her und sage guten Tag. Du bist groß geworden und siehst frisch und wohl aus, wofür wir Gott danken wollen. Wie alt bist du nun, Erika…
„Dreizehn, Großmama…
„Dausend! Eine Dame…
Und über Tonys Kopf hinweg küsste sie das kleine Mädchen, worauf sie fortfuhr: „Geh’ nun mit Ida hinaus, mein Kind, wir werden bald essen. Aber jetzt hat Mama mit mir zu reden, weißt du…
Hanno fühlt als Enkel in seiner Großmutter eine Allianz:
S. 485
Hanno richtete sich auf. . und ein wenig ermutigt durch die Milde, die ihm aus den Augen Großmamas . entgegenleuchtete, sagte er mit leiser, ein wenig harter Stimme…
Eine kritisch-gleichgültige Haltung, wie sie in den modernen Romanen zu finden ist, nimmt keines der Enkelkinder im Buddenbrook-Roman ein.
Herausragende Bedeutung hatte damals die Gratulation zu gesellschaftlichen Feiertagen, bei der ein ritualisiertes enkelkindhaftes Verhalten bei bürgerlichen Kindern zur Norm wurde. In den Geburtstagsfeiern stilisierte man die Großeltern als Ahne umfangreicher Nachkommenschaft und demonstrierte die innige Verbundenheit der Familie. Ebenso kam, wie bereits erwähnt, dem Weihnachtsfest in der Großeltern-Enkelkind-Beziehung eine besondere Bedeutung zu.
(TM)
S. 528f
Schon seit dem ersten Advent hingen in Großmamas Esssaal ein lebensgroßes, buntes Bild des Knecht Ruprecht an der Wand. eines Morgens fand Hanno seine Bettdecke, die Bettvorlage und seine Kleider mit knisterndem Flittergold bestreut.…
… den Heiligen Abend hielt die Konsulin fest in Besitz, und zwar für die ganze Famili…
S. 535
Und dann erhob sich die Konsulin. Sie ergriff die Hand ihres Enkels Johann und die ihrer Urenkelin Elisabeth und schritt durch das Zimmer. die alten Herrschaften schlossen sich an, die jüngeren folgte…
Mit der Gleichsetzung von Alter und Großelternschaft wurde dem Alter eine nützliche Aufgabe in der Familie zugedacht. In besonderem Maße positiv bewertete man, wenn alte Frauen als Großmütter in die Haushalte der Kinder integriert wurden.
(TM)
Die alte Konsulin bringt sich durchaus in Familie und Firma ein, ist aktiv am sozialen Ausgleich beteiligt und hat Einfluss auf die jüngere Generation, indem sie ihr Erfahrungswissen direkt an Kinder und Enkel weitergibt. Ein respektvoller und fürsorglicher Umgang mit ihr zeigt sich von Seiten der jüngeren Generationen.
S. 231
Die Konsulin war zwar überzeugt, dass ihr Gatte korrekt und pflichtgemäß gehandelt habe, aber sie erhob, wenn Tony zu sprechen begann, nur leicht ihre schöne weiße Hand und sagte: „Assez, mein Kind. Ich höre nicht gern von dieser Affaire…
„Großmütterlichkeit“ galt als ein besonderer „Ableger der Mütterlichkeit“, was nicht ganz abwegig war, denn das Heiratsalter der bürgerlichen Frauen betrug oft ca. 22 Jahre und damit wurden diese Frauen nicht selten um das 45. Lebensjahr erstmals zur Großmutter. Frauen hatten zwar auf allen Altersstufen familiäre Funktionen, aber Großmutterschaft wurde zu einer besonders langen Phase im Lebenslauf einer Frau und die Großmutterrolle zu einer biologisch-anthropologischen Konstante der Mütterlichkeit.1319
Die Theorie von den Geschlechtercharakteren gebot die Bestimmung der (alten) Frau im Kreis der Familie. Die Großmutter wirkte rollenverstärkend auf die Enkelinnen und stellte für sie die positive weibliche Altersfigur dar.1320 Sie galt als starke Persönlichkeit in der Familie und war in der Figur der „hilfreichen Alten“ das positive Gegenbild zur Geringschätzung des Alters und damit ein Gegenentwurf zu der erwerbstätigen und selbständigen Frau.
Als Element bürgerlicher Vorstellung wurde sie ein Stereotyp für Güte und Bescheidenheit und soziale Großmutterschaft zum normativen Anspruch - entsprach eine alte Frauen nicht diesem bürgerlichen Leitbild, beurteilte man ihre Persönlichkeit negativ.
(TM)
S. 8
Sie war eine korpulente Dame mit dicken weißen Locken über den Ohren, einem schwarz und hellgrau gestreiften Kleide ohne Schmuck, das Einfachheit und Bescheidenheit verriet, und mit noch immer schönen, weißen Händen, in denen sie einen kleinen, sammetnen Pompadour auf dem Schoße hiel…
Bürgerkinder wie die der Buddenbrooks erlebten eine verwitwete Großmutter als Matriarchin mit Machtbefugnissen. Thomas Mann konstruiert das Großmutterbild der schönen Alten:
S. 448
Die alte Konsulin kam, in grau und schwarz gestreifter Seide, einen diskreten Paatschuliduft um sich verbreitend, …
S. 561
Sie liebte es, gute Mahlzeiten zu halten, sich vornehm und reich zu kleiden, das Unerfreuliche, was um sie her bestand zu übersehen, zu vertuschen und wohlgefällig an dem hohen Ansehen teilzunehmen, das ihr ältester Sohn sich weit und breit verschafft hatt…
Literatur und Familienzeitschriften trugen zur Vermittlung dieses bürgerlichen Leitbildes bei und idyllisierten die Familiarisierung des Alters. In Folge dessen entsprachen binnen kurzen Mütter, die in den Haushalten ihrer erwachsenen Kinder lebten, dem Leitbild der
Großmütterlichkeit: Sie verhielten sich emotional, engagierten sich und widmeten sich entsprechend der Norm intensiv den Enkelkindern - nicht selten kam dann der Vorwurf des Verwöhnens und der Nachgiebigkeit auf.
Religiosität wurde ein Hauptelement in der großmütterlichen Darstellung in Literatur und Malerei.
Man ordnete Frauen das „Irrational-Sentimentale“ zu, so dass Großmütter, geprägt von ihren eigenen religiös-geschlechtsspezifischen Erziehungserfahrungen, zum religiösspirituellen Zentrum der Familie wurden1321 und die religiöse Erziehung der Enkelkinder als ihre primäre Aufgabe betrachteten.
Die Weihnachtsfeier der Buddenbrooks zeigt die Konsulin in dieser Rolle:
S. 535
Sie las die altvertrauten Worte langsam und mit einfacher, zu Herzen gehenderBetonung, mit einer Stimme, die sich klar, bewegt und heiter von der andächtigen Stille abhob. „Und den Menschen ein Wohlgefallen!“ sagte si…
So wie der Großvater die Funktion als Zeitzeuge und Erzähler vergangener Zeiten innehatte, trug auch die Großmutter mit erinnerten Geschichten aus der Vergangenheit der Familie und der Kindheit zum Familiengedächtnis bei und wirkte damit identitätsstiftend für die Familie. Beide wünschten sich, dass damit Ergebnisse und Produkte des eigenen Handelns über die eigene Lebenszeit hinaus Bestand haben.
Bürgerliche Väter gaben, so lasen wir, in der Zeit des Bürgertums viel von ihrer Emotionalität im Umgang mit den Kindern an die Mutter ab, Autorität und Distanziertheit von männlicher Seite nahmen zu. Der Großvater jedoch verlor seine strenge Rolle, hatte eine Aufgabe als Berater und Vermittler bei Familienstreitigkeiten und entwickelte sich seit Ende des 18. Jahrhundert als Verlängerung der emotionalen Vater-Tochter-Beziehung. Er galt als Respektperson, deren Urteil in Familienstreitigkeiten gefragt war, als sanfter Patriarch, aber mit nicht weniger Autorität.
Das äußerliche Erscheinungsbild der Großeltern war normiert mit faltigem Gesicht und weißem Haar.
(TM)
Thomas Mann entwarf den Großvater bei den Buddenbrooks typisch biedermeierisch:
S. 8
Sein rundes, rosig überdachtes, wohlmeinendes Gesicht, dem er beim besten Willen keinen Ausdruck von Bosheit zu geben vermochte, wurde von schneeweiß gepudertem Haar eingerahmt.und altmodisch
S.8
… und etwas wie ein ganz leise angedeutetes Zöpflein fiel auf den breiten Kragen seines mausgrauen Rockes hinab. Er war mit seinen siebzig Jahren, der Mode seiner Jugend nicht untreu geworde…
Der Großvater wird als freundliche Respektsperson geschildert und manifestiert patrilineare Vorstellungen. Er verhält sich auf bürgerlich-väterlicher Weise großzügig und liebenswürdig. Von seinem Sohn wird er mit großem Respekt behandelt, seine Autorität lässt die Enkelkinder ehrfürchtig und gehorsam sein. Tony bekommt von ihm die gleiche Aufmerksamkeit wie ihre Brüder.
S. 13
Tony ließ den Kopf hängen und blickte von unten herauf den Großvater an, denn sie wusste wohl, dass er sie, wie gewöhnlich, verteidigen werde…
„Nein, nein“, sagte er, „Kopf hoch, Tony, courage!..…
Der Novellist und Kulturhistoriker Riehl verfasste 1854 folgende Vision: „Es steht aber auch ein Bürgerhaus der Zukunft vor meinen Augen, im 20. Jahrhundert - ein etwas unregelmäßig gebautes, mäßig großes Haus […] Oben hinter den Giebelfenstern haust der Großvater und die Großmutter. Sie haben sich zur Ruhe gesetzt und ziehen selbst dann mit ihren Kindern zusammen, wenn diese zur Miete wohnen. Das ,ganze Haus’ hält zusammen.“1322
Doch die Realität sah anders aus: Bereits im Laufe des 18. Jahrhunderts entwickelten sich in den Städten Single-Haushalte von verwitweten Frauen - im 16. und 17. Jahrhundert noch keineswegs existent. Haushalte, in denen gemeinsam mit alten Elternteilen gelebt wurde, waren selten. Folgte eine Erweiterung der kernfamilialen städtischen Haushalte, waren es öfter die hochbetagten Mütter, die dort mit Elternkindern zusammenlebten.1323
In Hinblick auf die Wohnortnähe zwischen den Generationen gab es schichtenspezifische Unterschiede: Im 17. Jahrhundert hatte das reiche Stadtbürgertum eigene Alterswohnräume im Nebenhaus, es war eine Übergangsform zwischen Koresidenz und Dislokation.1324 Dislokation von Großeltern und Enkeln bedeutete in diesem Fall jedoch keine große räumliche Entfernung zwischen den Generationen, weil die Erreichbarkeit von Eltern und Großeltern lokal in allen Generationen vorhanden war.
In wohlhabenden städtischen Milieus lebten Vater- und Sohnfamilie in verschieden Wohnungen im selben Haus, in unterschiedlichen Haushalten oder in Häusern in unmittelbarer Nähe. Jede Generation führte ihren Haushalt, gleichzeitig war wegen der Nähe ein patrilinear geprägter Familienverband anzutreffen - „Intimität auf Abstand“.
Im städtisch-handwerklichen Milieu konnte eine Großmutter nach der Verwitweung in den Haushalt eines Sohnes aufgenommen werden und als einziger Großelternteil im Haushalt mit den Enkelkindern leben. Die Annahme jedoch, in frühneuzeitlicher Zeit hätten in fast allen Handwerkshaushalten Großeltern und Enkel koresident zusammengelebt, ist nicht zutreffend.1325
24.7 Großeltern im modernen Roman
Heute führt die „Radikalisierung der Individualität“, das Bemühen um Selbstentfaltung, das zum Lebensinhalt wird, dazu, dass die Orientierung an dem „Gemeinwohl“ oder der Familiensolidarität kaum anzutreffen ist.1326 Dementsprechend veränderte sich die literarische Darstellung von Großeltern und deren sozialen Umfeld im Vergleich zum 19. Jahrhundert. Die Beziehungen zwischen Enkel und Großeltern sind in den Romanen von unterschiedlicher Nähe oder Distanz geprägt, so dass die Beziehungsformen von der Grenzziehung und Nichteinmischung in das Leben der Enkel bis zur Erfüllung elterlicher Pflichten reichen. Idealerweise sind Nähe und Distanz im Verhältnis Alt und Jung produktiv ausbalanciert und nehmen Einfluss auf den Entwicklungsweg der Enkel.
Die Wahrscheinlichkeit auf ein Erleben einer Großeltern-Enkelkind-Beziehung aufgrund der demographischen Veränderung stieg, die Unterstützung und Zusammenarbeit jedoch zwischen den Generationen nahm ab.1327 Immer weniger Enkelkinder und mehr lebende Eltern und Großeltern bedeuten gleichzeitig eine „Vertikalisierung“ in den Familien. Die Veränderung der familiären Strukturen mit der sich verlängernden Lebensphase der „nachelterlichen Gefährtenschaft“ und des „leeren Nests“ sind Faktoren, die ein großelterliches Engagement ermöglichen.
Eine Großeltern-Enkel-Beziehung besteht heute durch die höhere Lebenserwartung mehrere Jahrzehnte lang, vom Säugling bis zum Erwachsenenalter. Sie umfasst beim Enkelkind die Zeit seiner zunehmenden Kompetenz und gesellschaftlichen Integration und bei den Großeltern die Zeit vom aktiven erwerbsfähigen Erwachsenen bis zum hilfsbedürftigen alten Menschen.
Urenkel zu haben ist heute nicht mehr so eine Seltenheit wie sie früher war:
(AG)
Alma erzählt Richard von der Urenkelin:
S. 353
… du hast Enkel, Sissi und Philipp, Sissi hat sich vor etlichen Jahren blicken lassen … sie hat eine Tochter, die heißt, wunder dich nicht, Parsley Sage Rosemary and Thyme‘.…
(ER)
Wilhelm und Charlotte bekommen von ihrem Urenkel zu Wilhelms 90. Geburtstag Besuch: S. 277
- Umnitzer, sagte Muddel und zeigte auf Markus: Der Urenke…
- Der Urenkel, rief der Man…
Er ergriff Markus’ Hand und schüttelte si…
- Donnerwetter, sagte der Mann. Donnerwette…
Typischerweise, so ist die Auffassung, findet Großelternschaft im letzten Lebensabschnitt statt, den Jahren, in denen man eine Bilanz des Gewesenen, des eigenen Lebens zieht. Die Beziehung zu den Enkeln stellt dann eine Erweiterung der eigenen Person über das Leben hinaus dar, sie verheißt Unsterblichkeit und bleibenden Lebenssinn.1328 (AG)
Ein Weiterleben des eigenen Selbst in der nächsten Generation erkennt Richard in Sissi:
S. 215
Richard fühlt sich angezogen von Sissis Blick. Mit plötzlichem Herzklopfen gewahrt er, dass auch er Spuren in diesem Mädchen hinterlassen ha…
(ER)
Sascha lebt in einem Drei-Generationen-Haushalt, Verhältnis zu den Großeltern bzw. zu seiner Großmutter ist kontaktintensiv:
6. 80
Es gab Erstenfreitag und Zweitenfreitag. Zweitenfreitag ging er nämlich zur Omi. …
Omi-Welt. Hier war alles ein bisschen anders. Und er sprach auch gleich anders, so ein bisschen komplizier…
- Omi, machen wir heute wieder under Geheimni…
- Selbstverständlich, mein Spätzche…
Bei Markus, der bei seiner Mutter wohnt, hat die Kontakthäufigkeit zu seinen Großeltern nach der Scheidung der Eltern nachgelassen. Er empfindet Sympathie für seinen Großvater, trotz dessen ,anstrengenden‘ und belehrenden Art, wohingegen die Erinnerung an Oma Irina wegen ihrer Alkoholsucht nicht angenehm ist:
S.. 281
… überhaupt mochte er seinen Opa, und es tat ihm immer ein bisschen leid wie Opa sich, wenn er hin und wieder seinen Großeltern zu Besuch war, mühte, ihm irgendwelche Spiele beizubringen, aus denen man etwas fürs Leben lernte. So war Opa Kurt, gutmütig aber anstrengen…
S. 377
Er hatte Oma Irina schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen, und das letzte Mal, als er seine Großeltern besucht hatte, war sie stockbesoffen gewesen und hatte die ganze Zeit geheult und behauptet, sie heule nicht, und ihm am Hals gehangen und ihn andauernd mit „Sascha“ angerede…
Bis zur Trennung von Sascha und Melitta bestand eine Beziehung von Markus zu seiner Urgroßmutter:
S. 156
Seit sie sich von Sascha hatte scheiden lassen, war Nadjeshda Iwanowna ihr weniger freundlich gesinnt … und Markus, ihr Urenkel kam auch nur noch selten, seitdem. Als er klein war, da hatte er bei ihr auf dem Schoß gesessen, wie Sascha damals, und sie hatte ihm das Lied vom Zicklein gesungen, allerdings, verstehen verstand er ja nix, verstand ja kein Russisch, der Markus, brachten sie ihm ja nicht bei. Eine zeitlang war er noch hin und wieder zu ihr ins Zimmer gekommen, um sich eine Praline zu holen, aber so was durfte sie ihm ja nicht geben, da war ja Melitta davor, als ob’s Gift wäre, und dann kam er gar nicht mehr, sie konnte sich nicht einmal mehr erinnern, wann sie Markus das letzte Mal gesehen hatte …
In einer emotionalen Beziehung zwischen Enkeln und Großeltern gibt es die Möglichkeit, die Lebenswelt des anderen kennenzulernen, so wie Sascha bei einem Besuch etwas vom Umfeld Baba Nadjas in Russland erfährt:
5. 90ff
Im Stall wohnten die Kuh und das Schwein. … Er durfte überhaupt alles. Er durfte aufs Dach. Er durfte durch riesige Pfützen waten. Nur nicht in den Wal…
… Sehr interessant: Wasser aus dem Brunnen holen. …
Einmal die Woche kam Brot. Dann stand eine lange Schlange vor dem Laden. Jeder bekam drei Laib Brot. …
- Schade, sagte Alexander, dass wir zu Hause nicht auch alle in einem Zimmer wohne…
Sascha erhält ebenfalls viele Anregungen von seiner Oma Charlotte, die ihm von Mexiko erzählt und in die Geheimnisse der aztekischen Götterwelt einführt:
S. 81
Heute erzählt Omi von den Azteken. Das letzte Mal hatte sie erzählt, wie die Azteken durch die Wüste gewandert waren …
Im Laufe des Heranwachsens nimmt der Kontakt zu den Großeltern zwar den Charakter des Besuchs an und die Interaktionsstruktur ändert sich, doch die enge emotionale Verbundenheit und hohe Beziehungsintensität führt bei Sascha zur Übernahme des Familienthemas ,Mexico’. Zur Identität der Erzählfigur gehört damit auch der Teil der Familiengeschichte, den sie zwar selber nicht bewusst erlebt hat, der aber von den damals in Mexico lebenden Großeltern repräsentiert wird. Sascha will durch die Reise in das mittelamerikanische Land die Vergangenheit seiner Großeltern aufarbeiten, ihre Ideologisierung und ihr Engagement nachvollziehen, und das zu einem Zeitpunkt, als die Ideologie, für die sie gekämpft und gelebt haben, zusammenbricht.
S. 104
Ich bin in Mexiko, weil ich .. Ja, was? Auf den Spuren der Oma …
In einer Zeit jedoch, die sich schnell wandelt, ist der Wert der Erfahrung, ein Gut der älteren Menschen, gering. Neue Lebensstile und bisher unbekannte Lebensgewohnheiten gewinnen an Bedeutung, und so klaffen die Vergangenheit der Großeltern und die Gegenwart des Enkels weit auseinander:
(ER)
S. 107
… aber auch nicht das, was er sich unter Mexico City vorgestellt hat. Menschen, donnernder Verkehr. … Über den Dächern Gerüste, gigantische Leinwände aufspannend, auf denen für 99- Pesos-Artikel geworben wir…
(AG)
Die Idylle des Alters im Bürgertum unterläuft der Autor Arno Geiger in seinem österreichischen Roman: Er distanziert sich von Klischeebildern bzgl. des Aussehens und des Verhaltens der Großeltern; traditionelle Stereotype fehlen, ebensowenig gibt es aber eine Gegenposition zu den traditionellen Rollenbildern für Großeltern. Die Bedeutung der Großeltern-Enkel-Beziehung ist eine andere geworden, ihre unterschiedlichen Lebensformen sind oft nur noch schwer vereinbar. (Sissi, Philip und Alma). Von einer integrierenden emotionalen Rolle des Alters ist nichts zu spüren. Das Gefühl der emotionalen Nähe besteht dennoch von Seiten Almas, der es gelingt, allein in ihrer Erinnerung eine Familienidentität über lange Zeiträume herzustellen.
Ihr Enkel soll das Familienerbe antreten und damit den Großeltern Unsterblichkeit verschaffen.1329
S. 354
… dass er irgendwann zur Strafe das Haus kriegt…
Koresidenz bzw. Dislokation können in diesem Fall Kategorien zur Bewertung der heutigen Beziehung Enkelkind-Großelternpaar sein und bestimmten die Qualität der Beziehung auf ihre Weise. Eine Untersuchung von 1991 in Österreich spiegelt die Kontakthäufigkeit wider: Ein Viertel der Großeltern wohnt bis 15 Gehminuten von den Enkelkindern entfernt, ein Drittel bis 30 Autominuten, 10% sechs und mehr Autostunden; täglich jedoch treffen lediglich 15% der unter 15jährigen und 6% der über 15jährigen ihre Großeltern, und 25% der über 15jährigen trafen die Großeltern nur „mindestens jährlich“1330, wobei die Kontakte zur Großmutter empirisch in der gleichen Studie eine größere Häufigkeit zeigen.
Gegenüber Vertretern der Eltern- und Großelterngeneration, besonders des gleichen Geschlechts (z.B. Philip-Großvater), ist bei jungen Menschen das Bedürfnis nach Abgrenzung vorhanden, auch in räumlicher Hinsicht.
(AG)
Geringe räumliche, aber große emotionale Distanz führen bei Philipp zur Entfremdung von der eigenen Familie. Seine verwandtschaftliche Einbindung ist gering, bereits in seiner Kindheit fanden Großeltern-Besuche nur zweimal im Jahr statt. Er begegnet ihnen, obwohl er in derselben Stadt lebt, nur (klammheimlich) nach der Zeugnisausgabe, und später virtuell (im Fernsehen).
Trotz der Distanz und der fehlenden Kontakte wird Philipp als Enkel Nutznießer erblicher, materieller Zuwendungen in Form der Villa. Die Großeltern überlassen ausdrücklich ihm den Besitz, um ihn zur Sesshaftigkeit zu bewegen.
Anstatt aber nun als Erbe der großelterlichen Immobilie die Familiengeschichte zu erforschen, wirft er Schriftstücke seiner Großeltern ungelesen fort. Dabei erinnert er sich an eine ganz spezifische Erfahrung als „Enkelkind“ mit dem Großvater, was charakteristisch ist für Jungen, die sich verstärkt zum männlichen Großelternteil hingezogen fühlen.1331 Die Begegnung ist jedoch weniger durch den regelmäßigen persönlichen Umgang geprägt als durch das harmlos alltägliche Erlebnis des Aufziehens der Standuhr. Philipp behält dies als unangenehme wichtigtuerische Handlung in Erinnerung, die er belächelt, weil sie für ihn die Machtposition des Großvaters in der Familie widerspiegelt. Von einem freundlich zugewandten Großvater wären seine Erinnerungen sicherlich andere, jedoch resultiert das Verhalten von Richard aus der schmerzvollen Erfahrung beim Ausscheiden aus dem Arbeitsprozess und seinem beruflichen und politischen Bedeutungsverlust, den er versucht zu kompensieren. Philipp fehlt jedoch die Reife, um dies reflektieren zu können.
Solch ein Nicht-Verhältnis zwischen Enkeln und Großeltern rührt oftmals daher, dass Eltern ihrem Kind ein spezielles Bild der Großeltern vermitteln: Ihre Schilderungen sind von Idealisierung oder von Verachtung geprägt und beeinflussen damit die Gefühle des Kindes.1332
Ebenso steuern Eltern den Umgang/Zugang zu den Großeltern und fördern die Beziehung ihrer Kinder zu den Großeltern, d.h. bei Beziehungsproblemen, resultierend aus der Vergangenheit, haben sie den Wunsch nach Abgrenzung und geringem Kontakt.
Ingrid und Peter lassen kein intensives Miteinander von Enkeln und Großeltern Alma/ Richard zu. Richard hat dies bereits 1962 erkannt:
S. 207
… ein Mädchen, das Sissi heißt und das seit dem letzten Mal, als Richard es gesehen hat, ebenfalls blond geworden ist. Es kann seit vier Wochen laufen …
S. 215
Einige Stufen lang ist ihm, als behalte er in seiner Enkelin recht, auch dann noch, wenn es ihn nicht mehr gibt. Aber einen Augenblick später bleibt der Stolz auf halber Treppe zurück, und ein Stich des Bedauerns erinnert ihn daran, dass er im Alltag dieses Kindes nicht oft Vorkommen wird. Zu Neujahr und zur Marillenernte, so das Wetter den Marillen gnädig wa…
Nicht selten ist das Verhältnis eines Ehepartners zu den Schwiegereltern schwierig und konfliktreich. Die Verstimmung zwischen Peter und Richard stammt aus der Zeit, als Ingrid sich von den Eltern emanzipierte und ihr Vater Peter nicht als Partner für seine Tochter akzeptierte. Ingrid löste sich im Laufe der Adoleszenz von ihren Eltern, findet ihren eigenen Weg, doch die Wunden bleiben: bei Besuchen ist von einem lebendigen Gedankenaustausch nichts zu spüren. (S. 208ff)
Aufgrund dessen ist in den späteren Jahren der Umgang zwischen dem Enkel Philipp und den Großeltern auf ein Minimum reduziert und beschränkt sich auf Oberflächlichkeiten ohne einen emotionalen Austausch.
Die frühe Heirat Sissis in die USA verhindert ebenfalls eine enge Beziehung zu den Großeltern:
S. 353
… und die obligate Geburtstagskarte von ihr habe ich in diesem Jahr auch nicht erhalten und auch keine Urlaubskarte … das es die erste von weiteren Karten ist, die nicht kommen werde…
Sissi zieht sich zwar durch ihre Auswanderung von solidarischen Austauschbeziehungen zurück, jedoch erlangt im Alter für sie die biologische und sozialisatorische Herkunft mit dem Gefühl für die Zusammengehörigkeit wieder Bedeutung1333: Sie sucht ihre Wurzeln und will ihre individuellen Lebenserfahrungen zu einem Ganzen zusammenzubringen. Dafür sucht sie den Kontakt zu ihrer Großmutter und erkennt, dass sie von den Vorfahren etwas empfangen hat und diese ihr ein Siegel ins Familiengedächtnis eingedrückt haben:1334
S. 353
Sissi hat sich vor etlichen Jahren blicken lassen und Fragen über ihre Mutter gestellt auf der Suche nach ihren Wurzeln, damit sie sich in New York wohler fühlt …
Der Anlass für Philipps Besuche bei den Großeltern war kein emotionaler sondern stets ein materieller, für Alma vermutlich eine schmerzvolle Erfahrung:
S. 354
… weißt du noch, dass er zwei- oder dreimal klammheimlich zu uns nach Hietzing kam, um für sein Zeugnis Geld einzuheimsen, notenmäßig war das noch nicht einmal aufsehenerregend … so ein hübscher kleiner Kerl, der hätte mir alles versprochen, dass er im nächsten Jahr Klassenbester sein wird. … dann hat er mir ganz gewissenhaft die Hand geschüttelt …
Aber solcherart materielle Zuwendungen spielen für Kinder keine unbedeutende Rolle. Oftmals ist für sie die Qualität der Beziehung, die sie zu ihren Großeltern haben, von Geschenken, meist materiellen Zuwendungen, abhängig, denn mit den Großeltern in Zusammenhang gebrachte Gegenstände dagegen erscheinen ihnen eher altmodisch bzw. veraltet.
Unterstützungsleistungen finanzieller Art Almas/Richards an ihre Enkel sind in der Vergangenheit stets zu verstehen als ein Wunsch nach Integration in die junge Familie, um die Bindung der Enkel an sie zu stärken und sind bereits eine Vorstufe der Erbschaft. Sie hätten eine Pflicht zum Gegenschenken etablieren und später eine Erinnerung an eine bleibende Verpflichtung darstellen können.1335 Dies erfolgt aber nicht.
(ER)
Wilhelm schenkt Markus, seinem Urenkel, das Reptil:
5. 280f
- Wenn ich tot bin, Markus, dann erbst du den Leguan dort im Rega…
- Cool, sagte Markus. …
- Oder nimm ihn am besten gleich mi…
- Jetzt gleic…
- Nimm mit, sagte Wilhelm, mit mir geht es sowieso nicht mehr lang…
Dass ihm jemand etwas „vererbte“, war ihm noch nie passiert …
Markus ging artig von einem zum anderen und ließ das immer wiederkehrende ,Der Urenkel, der Urenkel'! über sich ergehen, peinlich, klar, aber irgendwie fühlte er sich auch geschmeichel…
Ironisch erzählt der Autor von dem distanzierten Verhältnis zwischen der Enkelfigur Markus und dessen Großeltern. Die Trennung der Eltern und der mangelnde Kontakt ließ keine emotionalen Nähe zwischen ihm und dem Großvater/Urgroßvater entstehen; es gibt keine Gemeinsamkeiten, kein Verständnis für die individuellen Besonderheiten des Anderen und keine Akzeptanz.
Eine unüberbrückbare Distanz zwischen den ältesten Repräsentanten der Familiengeschichte und dem Enkel zeigt sich auf dem Familienfest: Die Protagonisten der ersten Familiengeneration wirken irritierend auf Markus, wie unheimliche Fremdkörper, ihre Erfahrungen und Erinnerungen sind völlig irrelevant für seine eigene Lebenswelt. Diese Menschen gehören einer fremdartigen Lebenswelt und, genauso wie die Innendekorationen der Wohnung, einer versunkenen Vergangenheit an, wirken aber keineswegs bedrohlich.
S. 280
….. eine Saurierversammlung mit Kaffee und Kuchen, dachte Markus, aber so aufgeregt durcheinander krächzend, als hätte man sie gerade alle aus ihrer prähistorischen Starre erweckt ...
Nur eine hockte abseits der großen Tafel, … ein Saurier, der die Wiederauferstehung nicht ganz geschafft hatte - tatsächlich erinnerte die ineinander geschobene Knochengestalt … an den fossilen Abdruck jenes ausgestorbenen Reptils, das Markus immer am meisten fasziniert hatte: Pterodactylus.
Markus’ Haltung zur familiären Vergangenheit ist nicht ausschließlich ablehnend, eher ambivalent:
S. 271
Was ihn wankelmütig machte, war der Gedanke an die Dinge, die es im Haus seiner Urgroßeltern zu besichtigen gab . Nur zu gut erinnerte er sich an die große Muschel im Flur, an die Kobrahaut im Wintergarten, … an die Säge des Sägefischs..., an den ausgestopften Katzenhai und besonders natürlich an den nicht ganz ausgewachsenen Schwarzleguan in Wilhelms Regal …
Ansonsten waren seine Urgroßeltern komische Leute. Irgendwann, es war lange her, hatten sie gegen Hitler gekämpft, illegal … Wilhelm war sogar mal in seiner Klasse gewesen und hatte von Karl Liebknecht erzählt, wie sie zusammen auf dem Balkon gesessen und die DDR gegründet hatten oder so ähnlich, verstanden hatte es keine, aber gewundert hatten sie sich doch, was für einen berühmten Urgroßvater er hatte, sogar Frickel. Ansonsten war er schon ziemlich komisch. ,Ombre', sagte er immer. ,Ombre', was soll der Scheiß, und die Uromi sagte ,Pipi machen' statt pinkeln, behandelte ihn wie einen Dreijährigen …
Sind Großeltern verstorben, stellt die Existenz eines Fotos deren ideelle Anwesenheit her. Adlige und Angehörige des Bürgertums bis ins 19. Jahrhundert vergegenwärtigten sich die Großeltern als Gemälde, später verbreitete sich dies in Form der Fotografie: „Nicht mehr persönlich erlebte Großeltern(teile) dennoch auf Abbildungen zu Gesicht zu bekommen, sollte vor allem im Lauf des 19. und 20. Jahrhunderts zu einem wichtigen Prinzip der ideellen Großeltern-Erfahrung werden.“1336 Die toten Großeltern zeigen damit ihre symbolische Präsenz und Anwesenheit, so dass der Enkel sich im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild machen kann.
(AG)
Philipp ersetzt angesichts der Fotos die Familiengeschichte durch ein Phantasma, hält aber seine Selbstverortung in der genealogischen Kontinuität für unbedeutend(s.o.): S. 15
Er malt sich ein fiktives Klassenfoto aus … ein anderer, dritte Reihe türseitig, ist Philipps Vater noch mit Milchzähnen. … Das Mädchen mit den Zöpfen, die Kleine, die wie die anderen Kinder ihre weißen Hände vor sich auf dem Pult liegen hat? Sie hat sich nie getraut aufzuzeigen, wenn sie aufs Klo musste. Sie heißt Alma …
Und der da, in der ersten Bank der Fensterreihe: Das bin ich. Ich bin auch einer von ihnen. Aber was soll ich über mich sagen? Was soll ich über mich sagen, nachdem ich über all die anderen nachgedacht habe und dabei nicht glücklicher geworden bi…
Sowohl in dem klassischen als auch in den modernen Familienromanen erleben wir Großeltern bei folgenden familiärenTätigkeiten:
- Erziehungshilfe
Großelternschaft kann eine intensive Beteiligung an der Erziehung der Kinder sein, kann aber auch gar nicht oder nur distanziert vollzogen werden, in den Romanen finden wir beide Varianten.
Oftmals liegt die Bedeutung von Großeltern in der Förderung und Ergänzung der elterlichen Erziehungstätigkeit. „Ein wesentlicher Teil großelterlicher Einflüsse ist indirekter Art, wobei die Eltern die vermittelnde Instanz darstellen.“1337
Bei Konflikten zwischen Eltern und Kind können sie Unterstützung und Sicherheit geben, oder sind Helfer, wenn äußere Umstände dazu führen, dass die Eltern verhindert sind. Statt einer „Fremdpflege“ oder eine Heimeinweisung, springen dann die Großeltern ein. (TM)
Die Enkel der Familie Buddenbrook finden in ihren Großeltern engagierte Bezugspersonen und eine elternunabhängige Bezugsgruppe, diedirektenEinfluss auf die Kinder hat. Die Großeltern-Erfahrung von Tony und Erika stellt ein Beispiel für ein damals neues Muster wechselseitiger Beziehungen zwischen den Generationen dar: Sie erleben Dominanz und Präsenz von fürsorglichen Großeltern, weil sie am selben Ort leben, zu Beginn im selben Haus, und weil sie wichtig für den Erziehungsprozess sind.
Das niedrige Alter ihrer Heirat und Mutterschaft hat für Tony ein frühes Erleben der Großelternschaft zur Folge. Während die Konsulin eine vornehme Distanz zu den Enkeln zeigt, ist Tony großmütterlich engagiert und emotional und hat die oberste Entscheidungskompetenz in Erziehungsfragen.
Für Kinder kann es eine neue Sozialerfahrung bedeuten, verwandte Menschen unterschiedlichen Verhaltens kennenzulernen und durch deren eigene, vom Alter geprägte Sicht neue Anstöße zum Nachdenken zu bekommen und so auf das Erwachsenenleben vorbereitet zu werden.
Großeltern können an der Entwicklung der Kinder einen hohen Anteil haben und „erscheinen wegen ihrer Nähe zum Kind und zugleich Verschiedenheit von den Eltern in besonderer Weise geeignet, Fähigkeiten und Erfahrungen von Heranwachsenden zu erweitern. Verlängerte Lebenszeit, geringere Zahl von Enkeln und vermehrte familienunabhängige Lebenserfahrung qualifizieren Großeltern für diese Rolle.“1338 (ER)
Charlotte ist in den Familienverband eingegliedert und eine zentrale Bezugsperson für den Enkel. Sascha verbringt Nachmittage und Abende bei ihr und erlebt die Großeltern, wie sie, eingebunden in die Sozialgeschichte der DDR, politische und gesellschaftliche Funktionen übernehmen. Er erfährt in der gemeinsam verbrachten Zeit von ihren Erlebnissen im Exils, in der Nachkriegszeit und vom Aufbau der DDR. Ihr zentrales Orientierungsmuster ist der Sozialismus. Die Großmutter ist Ansprechpartner für den heranwachsenden Enkel.
Sascha wird quasi von zwei Generationen erzogen. Solch eine Erziehung durch zwei Generationen birgt das Problem in sich, dass Großeltern andere, z.B, bürgerliche Sicht- und Lebensweisen vertreten, die nicht mit denen der Eltern übereinstimmen und zu Konflikten führen können. (Dies gilt übrigens als ein Grund dafür, dass nach der Wende an der bürgerlichen Struktur Westdeutschlands angeknüpft werden konnte.) S. 81
Die Regeln des Tischdeckens (gültig nur für die untere Etage des Hauses): Die Servietten in silberne Ringe gesteckt, lagen ganz außen. Dann das Messer, dann die Gabe…
Großeltern sind, weil sie eben nicht direkt für das Kind verantwortlich und meist im geringen Zeitrahmen eingespannt sind, gelassener und unbeschwerter im Umgang mit den Enkeln, verwöhnen sie oftmals und erlegen ihnen manchmal weniger Einschränkungen auf: (ER)
Charlotte geht als überwiegend liebevolle Person auf die Bedürfnisse ihres Enkels ein:
S. 81
Zitronencreme war Alexanders Lieblingsspeise. Er wusste auch nicht, wie das gekommen war. … Trotzdem war es nun mal seine Lieblingsspeise - bei Omi. …
Zwischendurch machten sie ihr Geheimni…
Ihr Geheimnis bestand darin, dass sie in der Küche Toastbrot aßen. Schnurpsbrot hieß das. dDe Sache war die, Wilhelm vertrug kein Schnurpsbrot. … Also mussten sie das Schnurpsbrot heimlich in der Küche essen. Mit Marmelad…
Nadjeshda Iwanowna ebenfalls:
S. 139f
… hatte schon viele Socken gestrickt, die ersten so groß wie Eierwärmer, dreißig Jahre war das nun her, aber noch heute hatte sie den Geruch seiner Nackenhaare in der Nase, wenn sie daran dachte, wie er auf ihrem Schoß gesessen hatte, und sie hatten Maltschik-Paltschik gespielt, stundenlang, oder sie hatte ihm etwas vorgesungen, das Lied vom Zicklein, das nicht auf die Großmutter hören wollte, das wollte er immer hören, wieder und wieder …
Kurt versucht, seinen Enkel Markus zu erziehen und zu fördern:
S. 281
Opa Kurt drückte ihn sogar - nicht gerade üblich, normalerweise gehörte Opa Kurt eher zu denen, die unnötigen Körperkontakt mieden, was Markus durchaus zu schätzen wusste, ..und es tat ihm immer ein bisschen leid, wie Opa sich .. mühte, ihm irgendwelche Spiele beizubringen, aus denen man etwas fürs Leben lernt…
Ingrid und Peter betreuen die Kinder ohne Mithilfe der Großeltern, herrührend aus dem nur geringen familiären Zusammenhalt. Damit hat Ingrid - auf eigenen Wunsch - keine engagierten und emotionell verfügbaren Bezugspersonen für einen Rückhalt oder zur Unterstützung im Alltag und ist darauf angewiesen, die Erziehung ohne die Großeltern zu organisieren. Dagegen belegen empirische Untersuchungen: Die heutige Elterngeneration überlässt die Betreuung des Nachwuchs den Großeltern insbesondere aus beruflichen Gründen. (1987 waren 54% aller Personen über 60 Jahren in Österreich großelterlich aktiv.)1339
-trouble-shooter
Die Familie war und ist der Zufluchtsort, wenn Familienangehörige Hilfe benötigen: bei der Pflege der Kranken, dem Spenden von Trost und dem Besprechen von Problemen, oder als Auffangbecken bei Hilfebedürftigkeit. Auf die Ressource Familie kann man zurückgreifen und die Großeltern-Enkel-Beziehung intensivieren, wenn es situativen Stress in der Generation der Eltern gibt. Dabei übernimmt oftmals die Großmutter eine zentrale Aufgabe.
(TM)
Tony kehrt nach den Scheitern der Ehe mit Grünlich zu ihren haushaltführenden Eltern zurück und findet dort Aufnahme. Die Großeltern werden zu „trouble-shootern“ und übernehmen die Sorge um das Kind. Nicht anders handelt Tony, als die Ehe ihrer Tochter scheitert, beide können sich einen Rückhalt für den erzieherischen Alltag holen.
War es im 19. Jahrhundert so, dass in Krisensituationen, wie z.B. beim Tod eines Angehörigen, die Familienbande verstärkt wurden, erfolgt dies nur bedingt in der Familie im 20. Jahrhundert im Roman:
(AG)
Es gibt eine teilweise eine Rollenübergabe an die Großeltern Alma und Richard beim Tod ihrer Tochter Ingrid. Sie übernehmen die Verantwortung, die Versorgung und die Aufnahme der verwaisten Enkelkinder und werden zum sozialen Unterstützungssystem aktiviert. In dieser furchtbaren Krise haben sie eine wichtige Funktion und sind als Verwandtschaft eine Quelle der Sicherheit.
Philipp und Sissi erleben, wie die Hinterbliebenen enger zusammen rücken und lernen Familienloyalität kennen. Ob ihnen der Wechsel des Wohnorts dorthin leicht fiel (vielleicht wegen der Status-Ähnlichkeit oder des materiellen Besitzes1340) erfahren wir nicht.
Bestätigt werden hier die empirischen Untersuchen in der Psychologie, dass die Großeltern mütterlicherseits häufig die besten Beziehungen zu den Enkelkindern haben.1341
S. 9
Er und seine Schwester Sissi, … haben in den siebziger Jahren zwei Monate hier verbracht, im Sommer nach dem Tod der Mutter, als es sich nicht anders machen lie…
Erleben wir jedoch bei Tony Buddenbrook eine vollständige Betreuungsfunktion als Großmutter, ist dies bei Familie Sterk nur in der schwierigen Zeit kurz nach dem Tod Ingrids der Fall, danach sind die Großeltern quasi nicht mehr vorhanden.
(ER)
Nach der Trennung von Alexander und seiner Frau, besucht auch Markus die Großeltern Kurt und Irina, Näheres über die Verweildauer und Häufigkeit erfahren wir nicht.
S. 293
- Melitta sagt, du willst dich scheiden lasse…
- Ihr wart bei Melitt…
- Melitta war bei un…
- Wie schön, sagte Sasch…
- Darf Melitta uns nicht mehr besuche…
- Melitta ist die Mutter unseres Enkels, sagte Kurt. Und das haben nicht wir uns ausgesuch…
25. Motive des “Verfalls“ und der Auflösung von Familien in den Romanen
„Genau wie bei uns…
Der Tod von Kindern bzw. Geschwistern bedeutet stets für die Familie einen eklatanten Einschnitt, und kann bis zur Auflösung einer Ehe (Tony und Permaneder) führen und der Grund des Zerfalls/,, Verfalls“ einer ganzen Familie sein - einer von mehreren Gründen. Familienromane gelten als Verfallsromane, wobei Verfall in dem Sinne zu verstehen ist, dass die kommenden Generationen, aus welchem Grund auch immer, schwächer sind als die vorangegangenen und es so letztendlich zur Auflösung einer Familie kommt.
Zwei große Kulturmuster prägen in diesem Zusammenhang den Familienroman: Zum einen sind es Familientragödien mit Konflikten im Inneren der Familie, durch die die Familie auseinander bricht, zum anderen sind es aufeinanderfolgende Ereignisse, die die Familie in die Tiefe stürzen. Erb- und Überlieferungsgeschehen, die sich über Generationen hinweg fortsetzen, determinieren den oder die Protagonisten1342 und löschen ihre Vitalität aus.
Beide Muster des Verfalls können auch kombiniert werden.1343 Die Reaktion auf Th. Manns großen Familienroman „Genau wie bei uns, dieser Prozess der Entbürgerlichung. der Sensibilisierung.“ beweist, dass es nicht selten zu Auflösungserscheinungen in Familien kommt.
Thomas Mann und Eugen Ruge erzählen gleichzeitig vom Untergang einer Familie u n d der Auflösung ihrer Sozialform, dem Zerfall einer alten Ordnung: der eine vom Untergang des Bürgertums und dessen Mentalität und Lebens- und Denkformen, der andere vom Zerfall der sozialen Bewegung des Kommunismus bzw. der Existenz der DDR. Arno Geigers Roman stellt den Zerfall einer Familie im 20. Jahrhundert dar. Gründe sind hier die Individualisierung, fehlender Familiensinn und fehlende familiärer Verantwortung, gepaart mit einem Unglück, das die Familie im Innersten trifft und die Bindungen der Personen zueinander löst.
25.1 Nachlassende Vitalität physischer und psychischer Art
Im Vergleich zu Freunden, Lehrern oder anderen Bekannten, wird dem Bereich der Familie generell eine besondere Prägekraft zugeschrieben.1344 Familien-Romane greifen diese Erkenntnis auf und erzählen, wie bedeutsam der biologische Faktor, genetisch bedingte Ähnlichkeiten, positive oder negative generationenübergreifende Übertragungen für die Vitalität der Familienmitglieder sind.
Der Einfluss von ererbten Anlagen scheint unausweichlich, wenn Krankheiten die Qualität der Nachkommenschaft verringern: „Die Sexualität gehört...zueinem Kapital, das in der Geschichte von Familien eingesetzt wird, und jede Abweichung, jede Krankheit und jede Schwächung der Nachkommen wird durch die unsachgemäße Verwaltung dieses Kapitals herbeigeführt.“1345 (TM)
Nachlassende Vitalität ist im Roman der Buddenbrooks in den vier Generationen bereits anhand des erreichten Lebensalters erkennbar: Johann Sigmund wird 77, Jean 56, Thomas 49 und Hanno nur 16 Jahre alt: Der kontinuierliche Verfall erstreckt sich vom vitalen Urgroßvater zum sensiblen und willensschwachen Hanno. Die Ursachen dafür sind organische Übel und Besonderheiten im psychischen und moralischen Bereich. In dem Prozess, der sich über drei Generationen zieht, wachsen Schwäche und Selbstzweifel ebenso wie psychische Krankheiten der Geschwister mit psychosomatischen Krankheitsbildern und Neurosen:1346
Der alte Konsul Johann Buddenbrook senior ist nicht nur äußerliche gesund und robust und ein Bild ungebrochener Bürgerlichkeit. Er verkörpert die kaufmännische Bodenständigkeit, indem er z.B. Plattdeutsch und Französisch spricht und Teil der sozialen Oberschicht ist.1347 Selbstbewusst stellt er sich als antiklerikaler Spötter und Freigeist dar. Anzeichen des Verfalls treten bei seinem Sohn, dem Konsul Johann, bereits äußerlich zutage: Er hat ernste und scharfe Gesichtszügen und „weniger volle [n]“ Wangen. (S.9) Erste Anzeichen von Schwäche und geringerer Aktivität, nervöse Bewegungen deuten auf die Krankheit hin, die Ende des 19. Jh als „Neurasthenie“ (Nervosität) bezeichnet wurde. Sie verbreitete sich um 1900 als männliche Psychopathologie, deren Auslösefaktoren man mit psychischen und beruflichen Belastungen diagnostizierte. Das Lexikon der damaligen Zeit nennt als Betroffene dieser Krankheit in erster Linie Männer, „denen ihre schwere
Berufspflicht, die angespannte Geistesarbeit, der rastlose Kampf ums Dasein mehr Arbeit zugemutet hat, als Körper und Geist auf die Dauer ohne Schaden ertragen können.“1348 Als Symptome der Neurasthenie nannte man „mangelnde[..] Selbstbeherrschung in Zuständen psychischer Erregung“ und „Vernachlässigung gewohnter Rücksichten auf die herrschende Etiquette und die persönliche Würde.“1349
In der nächsten Generation der Buddenbrooks kommt diese Krankheit in fast vollem Umfang zum Tragen:
Christian Buddenbrook zeigt bereits als Kind krankhafte Zeichen des Verfalls wie Nervosität und hypochondrische Furcht, (S. 34), z.B. eine Qual im Bein (S. 290) oder Schluckbeschwerden (S. 262). Selbstanalyse und Hypochondrie, Indiskretionen und Absonderliches prägen seine Erzählungen und sein Verhalten. Er beschreibt seine Krankheitssymptome im Detail und stößt damit auf Ablehnung in seiner Familie, insbesondere bei seinem Bruder. Dieser erkennt die Lebensuntüchtigkeit und Selbstbeobachtung als Züge seiner selbst, unterdrückt sie aber. Christians Äußeres, die „runden, tiefliegenden Augen über der allzu großen Nase“, korrespondieren mit dem auffälligen Verhalten und mit „unruhig hin und her wandernden Augen“.
Nach seiner Heirat wird er in eine psychiatrische Anstalt eingeliefert. Auch damit vollendet sich der Niedergang der einstmals einflussreichen Familie.
Thomas, sein Bruder, geht äußerlich konform mit den Idealen der Familie und der Firma und ist ein „loyale[r] Delegierte“ seines Vaters1350 und dessen Prinzipien. Er übernimmt die Rollenzuweisungen seiner Eltern, passt sich ihren Bedürfnissen an - auf Kosten der eigenen emotionalen Entwicklung - und zwingt sich in eine Rolle als Firmenoberhaupt hinein, für den die Prosperität der Firma erste Priorität hat. Es stellt eine große Anstrengung für ihn dar, als Firmennachfolger seine Aufgabe pflichtbewusst erfüllen zu müssen, er übt Zwang gegen sich selbst aus, um sich nicht zu verlieren. Als Folge der Überforderung zeigen sich schon früh bei ihm Krankheit und Verfall, das äußert sich z.B. in dem nervösen Hochziehen der Augenbraue und im vermehrten Konsum der „kleinen russischen Zigaretten“, sein Äußeres ist „weißlich, bleich, ohne Blut und Leben“ (S. 652). Auf seine Mitmenschen wirkt er dekadent.
Als der wirtschaftliche Abschwung der Firma nach einer Fehlspekulation einsetzt, nimmt die körperliche Entkräftung bei Thomas (S. 614) zu. Dies kaschiert er, indem er vermehrt und penibel auf ein korrektes Äußeres achtet. Er muss sich selber eingestehen, dass seine weiblich wirkende Parfümierung eine „aufreibende Schauspielerei“ (S.615) ist.
Zur gleichen Zeit verstärkt sich seine Frömmigkeit. Durch die Lektüre Schopenhauers wird er sich seiner Schwäche und des Rollenspiels bewusst und blickt nun mit Sehnsucht auf die starken und lebenstauglichen Menschen, in denen er weiterleben möchte. Sein Wunsch ist es, durch die Vererbung seiner geistigen und körperlichen Eigenschaften an seinen Sohn die eigene vergängliche Existenz über Raum und Zeit fortzusetzen, erkennt jedoch die Schwäche und das Unvermögen Hannos, sein Firmennachfolger zu werden und verfügt in seinem Testament die Auflösung der Firma. (vgl. S. 695f)
Trost findet er in Schopenhauers philosophischem Gedanken: Das große Eine, man mag es Nirwana nennen, lässt uns an jedem andern Ich partizipieren, „alle Individualität ist ein Auftauchen aus dem großen Einen..“1351
Dieser Selbsterkenntnis folgt der baldige Tod 1855, ausgelöst durch das Extrahieren eines Zahnes nach einem Zahnarztbesuch.
Seine Schwester Clara Buddenbrook trägt von Geburt an die Kennzeichen des Verfalls in sich, es ist z.B. von der gelben Farbe ihrer Gliedmaßen die Rede. (S. 57)
Clara isoliert sich von familiären Unternehmungen, steht dem Religiösen und Transzendenten sehr nahe. Ihre Gesundheit verschlechtert sich, sie stirbt im Alter von 26 Jahren an Gehirntuberkulose.
Aus der Ehe von Thomas mit Gerda Arnoldsen (ihr Verfalls-Merkmal sind die „von feinen bläulichen Schatten umlagerten Augen“) geht der Sohn Hanno hervor. In ihm erscheint das Motiv der Krankheit transgenerationell: Seine Lebensuntüchtigkeit, Kränklichkeit und körperliche Degeneration werden bereits bei seiner Geburt deutlich. Das Verfallsmerkmal seiner Mutter „die bläulichen Schatten“ (S.396) um den Augen tritt bei ihm quantitativ und qualitativ forciert auf, im Laufe der Jahre hat er Probleme mit den Zähnen und immer wiederkehrenden Krankheiten.
All das ist gleichzusetzen mit geringer Lebensenergie, es häufen sich bei ihm Angstanfälle und schlechte Träume bei Nacht, gepaart mit Traurigkeitsanfällen.1352
In seinen Selbstkommentaren schreibt Thomas Mann über Hanno:
„Ich zeichnete die Gestalt eines 16jährigen Dekadenten, des Ausläufers einer sozial, ökonomisch undphysiologischin Verfall geratenen Familie“.1353 Solch ein „Dekadent“ erwuchs aus der Dekadenzbewegung Ende des 19. Jahrhunderts. Sie sah einen engen Zusammenhang zwischen der kulturellen Verfeinerung in der Musik und den körperlichen Verfall bzw. die körperliche Schwächlichkeit. Dafür ist Hanno das beste Beispiel: Er beweist ein Übermaß an Sensibilität, erbt Gerdas „zuchtvolle Entgrenzung“ und findet sein Glück in der Musik.1354 Auf seinen Vater wirkt seine reproduktiven Kunstausübung nicht lebenstauglich.
Nach dem Tod des Vaters und der Liquidierung der Firma aktiviert Hanno keinerlei Kräfte, und als er mit 16 Jahren an Typhus erkrankt, setzt er dieser Krankheit keinen Widerstand und keinen Lebenswillen entgegen, sondern flüchtet in den Tod.
So verfällt die damals bedeutsame männliche Linie der Familie, während die mutterzentrierte Familie am Ende zwar verbleibt, aber vom Schriftsteller ausgeblendet wird.
Eine Figur hätte die Verfalls-Spirale dieser Familie stoppen können: Morton Schwarzkopf, er ist ein Beispiel für Gesundheit („ungewöhnlich gutgeformte engstehende Zähne“, S. 120), Bodenständigkeit („naive und sympathische Art“ ,S. 121) und gleichzeitiger Intelligenz (Mediziner mit späterer Praxis), eine Kontrastfigur zu Grünlich. („unnatürlich“ und „falsch“, S. 142) Eine eheliche Beziehung mit Tony B. kommt aber nicht zustande, weil die Gesellschaftsschichten zwischen ihnen zu sehr divergieren und ihr unterschiedliches Milieu eine langfristige Bindung verhindert.
Den Figuren im modernen Roman wird mehr Freiheit zugestanden, aber auch dort erleben wir den Verfall bzw. Zerfall von Familien durch nachlassende Vitalität physischer und psychischer Art. Der Verlauf der Erkrankungen wird aber nicht in der Ausführlichkeit und Detailliertheit geschildert wie bei Th. Mann.
(ER)
In Eugen Ruges Roman ist das Motiv des Zerfalls in verschiedenen Ausprägungen präsent. Das Unglück und die Tragik werden dank Ruges nüchternen Schreibstils nie allzu sehr dramatisiert und treten nur hier und da zu Tage.
Wir erleben mit, wie die scheinbar anständigen und gelungenen Existenzen der Familie Umnitzer - der Parteikader Wilhelm, der angesehene Akademiker Kurt, die Musterhausfrau Irina, der Sohn Alexander - nach Jahrzehnten zerbrechen:
Kurt ist zunächst ein vom System anerkannter und erfolgreicher Historiker, intelligent und rhetorisch brillant. Die Demenzerkrankung im Alter nimmt ihm die Sprache, sein bisheriges Machtinstrument.
S. 10
Eigentlich ein Witz, dachte Alexander, dass Kurts Verfall ausgerechnet mit der Sprache begonnen hatte. Kurt, der Redner. Der große Erzähle…
Kurt ist von nun an auf Hilfe und Pflege angewiesen, befindet sich im Stadium eines Kleinkindes, das keine Kontrolle über die Ausscheidungsorgane hat. Damit verschieben sich familiale Positionen: Der Vater wird zum Kind, sein Sohn zu seinem Pfleger und Helfer. Am Ende steht die Auslöschung der Persönlichkeit Kurts.
Kurts Sprachlosigkeit ist auf das politische System übertragbar, dessen bisherige Parolen im Volk nicht mehr ankommen, weder gehört noch akzeptiert werden.
Seine Frau Irina ist eine engagierte russische Kommunistin, die sich im Krieg mutig gegen den Feind positionierte.
S. 78
Andererseits hatte Mama im Krieg gekämpft: gegen die Deutsche…
Praktisch veranlagt organisiert sie Familie und Haus, die Zentren ihres Lebens. Im Alter verfällt ihre Persönlichkeit und erlischt durch den Alkoholismus:
S. 324
Zwar hatte Irina, anders als er selbst, schon von jeher kräftig getrunken, allerdings war es bisher immer eine Art „gesellschaftliches“ Trinken gewesen. Dass sie sich in ihr Zimmer zurückzog und sich, Wyssozki hörend, in aller Einsamkeit betrank, war eine ziemlich neuartige Erscheinun…
S.327
Ja, sie begann sogar alles, was sie einmal als erotisch und lustvoll empfunden hatte mehr und mehr abstoßend und niedrig zu finden: eine Art rückwärtsgewandte Schwarzseherei. War das auch ihre Russische Selle…
Eine weitere Person, deren Persönlichkeit durch Krankheit verfällt, ist Wilhelm. Er beharrt trotz der politischen Entwicklung weiterhin auf seiner bisherigen Ideologie und ist nicht mehr fähig und bereit, sich mit dem neuen Denken verbal und gedanklich auseinanderzusetzen:
S. 201
- Das Problem sind die Tschows, verstehst du: Tschow-Tscho…
Alexander identifiziert sich nicht mit dem System und sucht sich seinen beruflichen Weg abseits des von der Politik vorgeschriebenen Plans. Er muss sich einer Krebsbehandlung unterziehen, wird als austherapiert und mit einer unklaren Prognose über seine weitere Lebenserwartung entlassen.
S. 14
Und das alles mit dem erbärmlichen, mit dem gerade unverschämten Ergebnis, das Dr. Koch in zwei Worte gefast hatt…
- Nicht operabe…
S. 25
Es gab Laborwerte. Es war klar: Non-Hodgkin-Lymphom, langsam wachsender Typ. Gegen das es - wie taktvoll ausgedrückt! - bis heute keine wirksame Therapie geb…
Daraufhin sucht er den Ort in Mexiko auf, an dem seine Großmutter im Exil war, findet dort eine abseits gelegene Unterkunft, in die er sich zurückzieht.
(AG)
Die Protagonisten in Geigers Roman zeigen auf ihre Art Merkmale des Untergangs und des Verfalls.
Keine der Figuren erscheint glücklich, weder der dezente Patriarch Richard oder der Künstler Philipp noch die Frauen/Mütter - und keiner der Figuren geht es wirklich gut: Leidet Richard an Demenz, die Körper und Geist in Mitleidenschaft zieht, stirbt seine Tochter auf tragische Art in jungen Jahren, und ihr Mann Peter ist (zunächst) im beruflichen Leben erfolglos.
Richard entstammt einem wohlhabenden und konservativen Elternhaus mit patriarchalischen Strukturen. Er ist intelligent, studiert nach der Matura und promoviert. Sein Name „Römer“ war seiner Belesenheit, Klugheit und Souveränität geschuldet und findet sich gleichbedeutend auch im Buch „Der grüne Heinrich“, von Gottfried Keller, einem autobiographischer Roman, in dem der Protagonist von einem berühmten Kunstverständigen, Künstler und „Landschafter“1355 mit dem Namen „Römer“ in neue Studien und Techniken der Malerei eingeführt wurde und durch diesen viele neue Kenntnisse und Handfertigkeiten bekommt - in eben dieser Rolle fand sich Richard früher in seinem Kollegen- und Freundeskreis.
Er verliert jedoch den Lebenssinn, als er von der Partei nicht mehr als Kandidat für die Nationalratswahl aufgestellt wird und beruflich nicht mehr tätig ist. Die Beziehung zu seiner Tochter ist durch Unverständnis, autoritäres Recht-haben-wollen und Auseinandersetzungen geprägt und als er sich in den späteren Jahren um eine entspannten Umgang mit Ingrid bemüht, ist die Beziehung bereits zu zerrüttet, als dass sie sich noch verbessern könnte.
„Er hat für die Arbeit gelebt () während sich bei ihm zu Hause die Niederlagen summierten.“(S. 194) Nach dem Unfalltod von Ingrid beginnt er eine Beziehung mit seiner Sekretärin.
Im Alter verändert die Demenzerkrankung seine Persönlichkeit und vergrößert die Abhängigkeit von seiner Frau, die Verhältnisse zwischen ihm und Alma kehren sich um: Nun ist sie ihm geistig überlegen.
Alma Sterk ist die Stamm-Mutter, die in ihrer Familie einen Wert an sich sieht.
Nach dem Tod beider Kinder zieht sich Alma immer mehr in ihre eigene Welt der Literatur, Musik und Imkerei zurück.
Alma hat sich mit ihrem Schicksal abgefunden; nach dem Tod ihrer Kinder und wegen des fehlenden Kontakts zu den Enkeln erhält die Erinnerung für sie einen herausragenden Stellenwert.
S. 195
„Sie bewegt sich in ihrer eigenen Wirklichkeit, die sich Richard nicht erschließt, in ihrer eigenen Geschwindigkeit…
Ingrid ist eine unglückliche Frau an der Seite ihres ehemaligen Traummannes. Ingrids früher Unfalltod verändert das bisherige Familienleben. Er bedeutet eine Umkehr der natürlichen familiären Ordnung und weist damit durchaus Parallelen zum Tod von Hanno (TM) auf.
Die Parallelsetzung von Hanno und Philipp ist zulässig. So wie dessen Vater Thomas erkennt Peter, wie wenig sein Sohn den Anforderungen, die die Schule an ihn stellt, gerecht wird. Philipps Zuneigung gilt der Hündin Cara, mit der er die Tage verbringt:
S. 293
… Cara, sein Lieblin…
In späteren Jahren ist Philipp Erlach, der 36jährige Protagonist, ein erfolg- und orientierungsloser Schriftsteller, eine gescheiterte Persönlichkeit und Träumer. Ziellos und ohne Ehrgeiz, getrieben von spontanen und eigennützigen Einfällen, lebt er passiv und entschlussunfähig in den Tag hinein.
Leere und Sinnlosigkeit bestimmen sein Leben. Sein Lieblingsplatz ist die Schwelle des geerbten Hauses, dort sitzt er weder ganz draußen noch ganz drinnen und ist damit ein Mensch, der nie ganz hinein (ins Leben), nie ganz im Leben ankommt und permanent an seine Grenzen gelangt.1356
Wir finden in den modernen Familienromanen Figurenzeichnungen, die dem Verfall entgegengehen und in ihrem Unglück die Familie auflösen. Eines jedoch unterscheidet die modernen Romane von ihrem berühmten Vorgänger: Im Gegensatz zu Hannos Tod kann der Ausgang der modernen Romane als Appell gelten, das eigene Glück zu finden - und dies hinterlässt einen hoffnungsvollen Eindruck.
25.2 Ökonomisch-wirtschaftlicher Verfall
Ein weiterer Grund für das Auseinanderfallen von Familien ist ökonomisch-wirtschaftlicher Art.
Noch heute spricht man von einem „Buddenbrook-Syndrom“, wenn es bisher erfolgreichen Unternehmer-Familien über die dritte Generation hinaus nicht gelingt, ihr Geschäft weiterzuführen, weil es den Nachkommen an unternehmerischem Geist fehlt. Gründe für eine Verringerung der wirtschaftlichen Gewinne bei der Firma Buddenbrook sind: die Reduzierung des Vermögens bzw. Fehlspekulation und finanzielle Misserfolge, Ehescheidungen oder vergeudete Mitgiftsummen.1357 Der Kaufmann alten Schlages hat in der symbolischen Gestalt des Th. Buddenbrook sein Ende gefunden.
Während der ältere Buddenbrook (Johann) das Kapital noch erhöhte und die Familie unter den führenden Familien in Lübeck etabliert, festigt sein Sohn Jean das Grundkapital mit dem moralischen Grundsatz, nur solche Geschäfte zu machen, die ihn nachts ruhig schlafen lassen. Doch in die Zeit seiner Firmenleitung fallen die ersten Verluste, 80000 Mark gehen verloren und Tonys Ehe mit dem Mitgift-Jäger Grünlich wird annulliert. Jean hat sich von dem Auftreten und Lebensstil Grünlichs („gentleman like“, „verkehrt in bester Gesellschaft“, S. 111) und den Auskünften der Hamburger Kaufleute täuschen lassen, die, so Kesselmeyer alle „engagiert [waren]. Die waren ja Alle ungemein froh, dass sie durch die Heirat sicher gestellt wurden...’“(S. 228)
Carlas Ehemann nimmt das Geld aus der Mitgift an sich - eine finanzielle Einbuße für die Familie Buddenbrook.
Thomas gilt zunächst als „ein genialer, ein frischerer und unternehmenderer Geist “ (S. 266), wird später aber zum Spekulanten. Der fehlgeschlagene Getreidehandel trägt zum finanziellen Ruin bei und macht ihn zum gebrochenen Mann. (S. 494)
(ER)
Im Roman der DDR-Familie Umnitzer weist der Titel bereits metaphorisch auf ,Verdunkelung‘ hin, Aufstieg und Fall sind hier nur zum Teil dem eigenen Handeln geschuldet. Sie sind Folgen einer Politik, auf die der Einzelne keinen direkten Einfluss hat, die ihn mitreißt und quasi überrollt. Die politische Wende zum vereinten Deutschland und der Verfall des Sozialismus, in dessen System die Familie eingebettet ist und für den sie sich engagiert hat, bedeutet für die Umnitzers eine finanzielle und berufliche Unsicherheit und eine Veränderung ihrer Lebensverläufe. Der Systemumbruch wirkt sich auf das (Familien-) Leben aus, Wertvorstellung und Lebensziele verändern sich:
S. 358
Von ihrer eigenen Rente ganz zu schweigen. Plötzlich sollte sie irgendwelche Arbeitsnachweise aus Slawa erbringen … Auch ihre Zusatzrente würde sie vermutlich nicht mehr bekommen (die DDR hatte ihr eine Rente als sogenannte Verfolgte des Naziregimes zuerkannt, als Ersatz für die Ehrenrente, die sie als „Kriegsveteranin“ in der Sowjetunion bekommen hätte): kaum anzunehmen, dass die westdeutschen Behörden sie dafür belohnen würden, dass sie als Gefreite der Roten Armee gegen Deutschland gekämpft hatt…
Das Haus, ein Symbol der familiären Heimat und Lebensinhalt von Irina, steht nach der Wende zur Disposition. Eine eventuelle Übergabe bedeutet für sie einen Sinnverlust.
S. 352
… wenn man schon morgens mit einem unguten Gefühl im Bauch zum Briefkasten ging und die Post zuerst daraufhin überprüfte, ob ein gerichtliches Schreiben dabei war. …
Dumm war es gewesen, das Haus nicht zu kaufen. Andererseits: Wer weiß, ob die Kommunale Wohnungsverwaltung das Haus überhaupt verkauft hätte? Hätte sie fragen sollen? Niemand hatte gefragt. Alle Häuser der Umgebung hatten der Kommunalen Wohnungsverwaltung gehört, und kein Mensch (außer diesem merkwürdigen Harry Zenk) war auf die Idee gekommen, das Haus, in dem er wohnte, auch noch zu kaufen. Wozu, wenn man irgendwelche hundertzwanzig Mark Miete bezahlt…
S. 358f
Und wenn sie jetzt noch das Haus verloren, dann gute Nacht. Selbst wenn man sie nach der „Rückübertragung“ - auch eins der Wörter, die mit der Wende gekommen waren - weiter hier wohnen ließe, würden sie die Miete auf Dauer kaum selber bezahlen könne…
Kurt ist als Geschichtswissenschaftler besonders von der neuen bundesrepublikanischen Politik betroffen, da seine bisherige Tätigkeit der Legitimation der DDR diente und er nicht der Objektivität verpflichtet gewesen war. Diese marxistische Parteilichkeit mit ihrem Historischen Materialismus forderte zur Teilnahme am Klassenkampf auf, galt aber im vereinten Deutschland nicht mehr als opportun. Dies zieht Kurt den Boden unter den Füßen weg, so dass er seine Existenz und das seiner Familie in Frage stellt.
S. 358
Er kämpfte gegen die, wie es neuerdings hieß: „Abwicklung“ seines Instituts. Ständig war er unterwegs. Fuhr nach Berlin, öfter als früher, sogar in Moskau war er noch einmal gewesen, weil irgendein Archiv plötzlich zugänglich war. Er schrieb ständig Briefe, Artikel. Hatte sich extra eine neue Schreibmaschine gekauft: elektrisch! Vierhundert Mar…
Dabei war noch nicht einmal heraus, wie viel Rente Kurt nun, nach der Umstellung, bekommen würd…
25.3 Verlust von „bürgerlichen Tugenden und Instinkten“ (Entbürgerlichung)
Thomas Mann beleuchtet „in starken Streiflichtern(...) all die Ursachen des Niedergangs, die sich ankündigenden Anzeichen eines familiären Endes der Welt.“1358 Die bürgerliche soziale Herkunft und Mentalität mit all ihren dazugehörigen Distinktionen bestimmt das Leben der Familie Buddenbrook. Wer die bürgerlichen Lebensgewohnheiten und Denkformen aufgibt, entbürgerlicht, „Verfall“ als Entbürgerlichung, als eine Entfremdung vom Bürgerlichen. Einzelne Personen der Buddenbrooks weichen vom Pfad der Bürgerlichkeit ab und werden dadurch letzten Endes zu Außenseitern.
Viele Leser, auch außerhalb Deutschlands, sahen in dem Roman ein Abbild ihrer Erfahrungen: „Wie oft, etwa in der Schweiz, in Holland, in Dänemark, habe ich junge Leute ausrufen hören: ,Dieser Prozess der Entbürgerlichung, der biologischen Enttüchtigung durch Differenzierung, durch das Überhandnehmen der Sensibilität - genau wie bei uns!’ “1359 Als die Kritiken beim Erscheinen des Romans von einem „zersetzenden“ Buch sprachen, protestierte TM aber und nannte ihn „positiv-künstlerisch“, „behaglich-plastisch, im Innersten heiter.“1360
So wie in manchen real existierenden Unternehmer-Familien1361 entwickeln sich zwischen den Generationen Unterschiede, stehen dominierende Unternehmerväter ihren andersdenkenden Söhnen und Enkeln gegenüber: die schlichte Gradlinigkeit des älteren Buddenbrook, der weder an Religion oder Kunst, Musik Interesse zeigt, eine schlichte Sprache mit Dialekt spricht, dagegen der jüngere Buddenbrook, spiritistisch, religiös denkend; Tatmensch versus Denker/ Theoretiker/ Zweifler.
Bürger entwickelten Interesse an der Kunst, „womit gezeigt wird, dass Verfall zugleich Verfeinerung und Steigerung bedeuten kann - ein allgemeiner Weltprozeß.., der damals überall empfunden wurde.“1362
Wir lesen in der von Th. Mann 1895 verfassten Skizze von einer Verfallslinie des Romans mit autobiographischen Zügen, ursprünglich „Abwärts“ betitelt:1363 „Der Vater war Geschäftsmann, praktisch, aber mit Neigung zur Kunst und außergeschäftlichen Interessen. Der älteste Sohn (Henrich) ist schon Dichter, aber auch ,Schriftsteller’, mit starker intellektueller Begabung, bewandert in Kritik, Philosophie, Politik. Es folgt der zweite Sohn, (ich), der nur Künstler ist, nur Dichter, nur Stimmungsmensch, intellektuell schwach, ein sozialer Nichtsnutz. Was Wunder, wenn endlich der dritte, spätgeborene Sohn der vagsten Kunst gehören wird, die dem Intellekt am fernsten steht, zu der nichts als Nerven und Sinne gehören und gar kein Gehirn, - der Musik? - Das nennt man Degeneration.“1364
Die Familie der Buddenbrooks befindet sich in einen kontinuierlichen Niedergang durch eine Folge von Ereignissen, die in einem schleichenden Prozess die Familie zum Erlöschen bringt. Bereits der Familienname „Buddenbrook“, ein Name, der nicht „komisch“ und „bürgerlich“ wirken sollte, geht zurück auf die plattdeutsche Sprache („brook“ = Bruch) und bedeutet soviel wie ein „flaches Moorland“, er erinnert an „Instabilität und Unsicherheit“1365 und soll auf die Brüchigkeit der Familie verweisen.1366 Im Familienwappen spiegelt sich diese Bedeutung wieder.
Betrachten wir die Romanfamilie unter dem Aspekt der Entbürgerlichung:
Die Prinzipien und Werte von Johann Buddenbrook Senior beziehen sich auf Besitz und Ansehen. Patriarchalisch-autoritär und ohne innere Hemmungen regiert Johann Senior Firma und Familie. Die Heirat seiner zweiten Frau erfolgt aus materiellen Gründen, weil sie eine gute Partie war.
S. 54
Ja, Johann Buddenbrook musste diese erste Gattin, die Tochter eines Bremer Kaufmanns, in rührender Weise geliebt haben, und das eine, kurze Jahr, das er an ihrer Seite hatte verleben dürfen, schien sein schönstes gewesen zu sei…
S. 69f
Der Alte mochte sich erinnern, wie er vor 46 Jahren zum ersten male am Sterbebette einer Gattin gesessen hatte und mochte der wilden Verzweiflung, die damals in ihm aufbegehrt war, die nachdenkliche Wehmut vergleichen, mit der er, nun selbst so alt, in das veränderte, ausdruckslose und entsetzlich gleichgültige Gesicht der alten Frau blickte, die ihm niemals ein großes Glück, niemals einen großen Schmerz bereitet, die aber viele lange Jahre mit klugem Anstand bei ihm ausgehalten und nun ebenfalls langsam davongin…
Dieser Patriarch ist mit sich im Reinen, den Wert der Liebe, den er in der ersten Ehe als Grundlage hatte, substituiert er.
„Name und Stand gehen vor Gefühl, Geschäft und Arbeit vor Vergnügen und Muße.“1367 Seinen Sohn Gotthold verstößt er wegen dessen reiner Liebesheirat und weil für ihn Gefühl und Sinnlichkeit vor Besitz und Ansehen stehen. Aber:
„Ein Familiensystem, das in erster Linie von finanziellen und gesellschaftlichen Wertvorstellungen getragen wird, kann seine Mitglieder nur so lange integrieren, wie die Vorstellungen von ihnen geteilt werden.“1368
S. 46
„. Was seid ihr eigentlich für eine Kompanie, ihr jungen Leute, - wie? Den Kopf voll christlicher und phantastischer Flausen, und … Idealismus! und wir Alten sind die herzlosen Spötte…
Der traditionelle Glaube wird gepflegt, der Pastor zur Einweihungsfeier eingeladen und der Spruch „Dominus providebit“ zeigt, wie sehr Religion eine Stütze privat und beruflich sein kann. Johann sen. hält, so wie seine Enkelin, an Traditionen und Konventionen fest, hat dabei aber ein Standesbewusstsein, das in nichts an die Naivität von Tony erinnert.
S. 28
„Praktische Ideale. na, ja.“ ..“Praktische Ideale. ne, ich bin da gar nich für…
Die zweite und dritte Generation der Familie Buddenbrook versucht vergebens den familiären Werten gerecht zu werden.
Johann Buddenbrook der Jüngere vertritt die bürgerlichen Tugenden Sparsamkeit und Mäßigkeit, Solidität im Geschäft.
Im Konflikt mit seinem Halbbruder Gotthold weist er zwar auf den Zusammenhalt der Familie hin:
S. 48
eine Familie muss einig sein, muss Zusammenhalten, Vater, sonst klopft das Übel an die Tür…
„Flausen, Jean! Possen!.…
Aber letzten Ende führen materielle Erwägungen seinerseits doch nicht zur Unterstützung seines Stiefbruders..
Jeans Denken und Familiensinn gründen im religiösen Wertebewusstsein. Er betrachtet seine Aufgabe in der Firma als eine von Gott gewollte Aufgabe und hofft, dass er mit der Hilfe von oben„das Vermögen der Firma auf die ehemalige Höhe zurückführen kann.“(S. 79)
Sein religiöser Eifer und pietistischer Glaube unterscheidet sich von dem seines Vaters, wie seine Glaubensformeln in der Familienchronik beweisen:
S. 51
Ach, wo ist doch ein solcher Gott, wie du bist, du Herr Zebaoth, der du hilfst in allen Nöten und Gefahre…
Da ist von „heiligen, bluttriefenden Wunden“ die Rede, von Begriffen wie „Herz“ und „Seele“ „die Seele verbirgt, verkriecht oder verliert“. Jeans Verhältnis zu Gott ist sehr persönlich.
Seine Naturschwärmerei steht im Kontrast zum unsentimentalen Denken seines Vaters.
S. 30
„. welch nett Besitztum, wenn das Gras gepflegt, die Bäume hübsch kegel- und würfelförmig beschnitten wäre…
Der Konsul aber protestierte mit Eife…
„Um Gottes Willen, Papa-! Ich ergehe mich Sommers dort gern im Gestrüpp; aber alles wäre verdorben, wenn die schöne, freie Natur so kläglich zusammengeschnitten wäre…
„Aber wenn die freie Natur doch mir gehört, habe ich da zum Kuckuck nicht das Recht, sie nach meinem Belieben herzurichten…
„Ach Vater, wenn ich dort im hohen Grase unter dem wuchernden Gebüsch liege, ist es mir eher, als gehörte ich der Natur und als hätte ich nicht das mindeste Recht über sie…
Unterschiede sind ebenso in seiner Hingabe an die Familienchronik und an die Vergangenheit erkennbar: Der alte Buddenbrook hat wenig Sinn dafür und beschäftigt sich nicht viel mit der Vergangenheit, sein Sohn dagegen schon:
S. 50
Um 9 Uhr, eines Sonntag morgens, saß der Konsul im Frühstückszimmer vor dem großen, braunen Sekretär,. Eine dicke Ledermappe, gefüllt mit Papieren, lag vor ihm: aber er hatte ein Heft mit gepresstem Umschlage und Goldschnitt herausgenommen, und schrieb, eifrig darüber gebeugt, in seiner dünnen, winzig dahineilenden Schrift, - emsig und ohne Aufenthalt, es sei denn, dass er die Gänsefeder in das schere Metall-Tintenfass taucht…
Für den Zusammenhalt und den Bestand der Familie verzichten die Familienmitglieder der nächsten Generation auf ihr eigenes Glück: Tony unterdrückt ihre Gefühle zur Jugendliebe Morten Schwarzkopf, Thomas B. gibt die Liebe zum Blumenmädchen auf und heiratet die reiche Gerda, Christian Buddenbrook wird gering geachtet wegen seiner Liebe zu einer Schauspielerin und Hannos Liebe zur Musik bringt ihn in Konflikt zu seinem Vater. Alle verdrängen ihre natürlichen, aber eigentlich unbürgerlichen Gefühle und Vorlieben.
Tony Buddenbrook erscheint unverwüstlich, stark, spontan. Doch letztendlich trägt auch sie zum „Verfall“ der Familie bei, indem sie sich zweimal scheiden lässt, von Männern, von denen der eine sich mit Hilfe der Mitgift sanieren wollte, aber letztendlich doch in die Insolvenz geht, und der andere, Herr Permanenter, sich mit dem Teil der Mitgift als Privatier (S. 365) niederlässt, etwas, was ganz und gar nicht dem Ansehen der Familie förderlich ist.Tonys bürgerliche Moral zwingt sie zur Trennung von Permaneder.
Tonys Tochter Erika wiederum, von deren Ehe sich Tony Buddenbrook eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft verspricht, heiratet einen Versicherungsbetrüger - wiederum eine Stufe des Verfalls bzw. der Auflösung einer Familie.
Thomas und Christian Buddenbrook, die Söhne von Jean Buddenbrook, stellen in gewisser Weise Thomas Mann und seinen Bruder Heinrich dar, Unternehmersöhne, deren Vater die Auflösung der Firma verfügt. Er sieht in keinem der Söhne einen Nachfolger mit Geschäftssinn, da beide ihrer Neigung zur Künstlerexistenz folgen, Töchter wurden zur damaligen Zeit noch nicht als Nachfolgerinnen in Erwägung gezogen: „Die geschlechtsspezifische Konnotierung des Erbes ist immer dort besonders hoch, wo es um die intergenerationelle Nachfolge in Unternehmen und Funktionen geht.“1369
Wir erleben bei Thomas, und verstärkt bei seinem Bruder, wie sehr Empfindsamkeit zur Entfremdung von bürgerlichen Lebensformen und im Extremfall zum Ausbruch aus den bürgerlichen Verhältnissen führt.1370„Nicht-bürgerliche“ Gefühle machen es unmöglich, den an sie überlieferten Auftrag, das Kapital der Firma zu vermehren, zu erfüllen.
S. 470
War er ein praktischer Mensch oder ein zärtlicher Träume…
Beispiele einer Auflehnung von Unternehmersöhnen gegen ihren Vater gibt es nur selten.1371 Und auch Thomas Buddenbrook kämpft gegen sein Naturell, um das Leben und Werk des Vaters fortzusetzen, emanzipiert sich aber von transgenerationalen Verhaltensmustern sprachlich-kulturell und sozial und unterstreicht seine Entbürgerlichung in einer literarischen Interessiertheit, die ihn von seinen Mitbürgern unterscheidet - zitiert z.B. Heinrich Heine (S.300).
Rastlose Aktivität zeichnet ihn aus:
S. 419
Es trieb ihn vorwärts und ließ ihm keinen Frieden. Auch wenn er scheinbar ruhte, nach Tisch vielleicht, mit den Zeitungen, arbeiteten, ..tausend Pläne in seinem Kopf durcheinande…
Er neigt zur Selbstanalyse und Introspektion, missbilligt aber selber dieses Grübeln, da es zu Skrupel im geschäftlichen Handeln statt zum praktischen kaufmännischen Handeln führt.
S. 264
„.unalltägliche, unbürgerliche und differenzierte Gefühle“zeichnen den Konsul au…
Es besteht eine Diskrepanz zwischen Schein und Sein: Die Maßstäbe und Werte sind zwar bürgerlich, aber das Leben als Bürger kann Thomas Buddenbrook nicht mehr führen. Als die Bewährung im praktischen Leben immer schwieriger wird, schenkt ihm das religiöse Erlebnis mit der Schopenhauer-LektüreDie Welt als Wille und Vorstellungeine kurze Zeit der Hoffnung, gleichzeitig erkennt er dabei wiederum seine Distanz zur eigenen Familie und zu deren Werten - und schämt sich dafür.
Diese Hinwendung zur Innerlichkeit impliziert den Verfall und die degenerative Entwicklung in der Roman-Familie.
Als Thomas sich zum Schluss doch noch von der Tradition der Familie emanzipieren will und versucht, einen neuen Geschäftssinn zu praktizieren (Ernte), scheitert er.1372
Christian Buddenbrook repräsentiert das Gegenteil eines Bürgers.
Gerda bringt es auf den Punkt:
S. 451
neulich sagte sie zu mir: ,Er ist kein Bürger, Thomas! Er ist noch weniger ein Bürger als du…
Reisen erweitern seine Weltsicht und lassen ihn die Ausschließlichkeit der bürgerlichen Welt und ihre Maßstäbe anzweifeln. Sein Leben ist durch wechselnde Tätigkeiten und Unstetigkeit geprägt und anders als bei dem älteren Bruder, für den die Rolle und Aufgabe als Bürger lebensbestimmend ist, lassen seine Egozentrik, seine Zwangsvorstellungen und sein mangelndes Durchhaltevermögen keine länger andauernden Tätigkeit zu. Er wahrt weder den eigenen Ruf noch den der Familie..(„.sei doch jeder Geschäftsmann ein Gauner..“S. 324)
Letztendlich reduzierte sich von Generation zu Generation in der Familie Buddenbrook die praktische Potenz, während sich die Empfindsamkeit und das Grüblerische verstärken. Vom praktischen und zupackenden Typ seines Urgroßvaters hat Hanno, der letzte Spross, sich sehr weit entfernt, in ihm erreicht der Verfall der Familie ihren Endpunkt. Die Familiengeschichte und die damit verbundene Erwartung, später Firmenoberhaupt zu werden, ist für Hanno von Beginn an eine große Belastung, auch wenn er sich, um die Zuwendung der Eltern zu erhalten, vordergründig bemüht, den Forderungen zu entsprechen.1373 Er entwickelt aber weder ein gesundes Selbstbewusstsein noch eine stabile Selbstsicherheit.
Die Distanz zum bürgerlichen Leben kommt bei Hanno durch seine Sensibilität und Hellsicht. Er erkennt die Auflösung der Buddenbrookschen Welt und durchschaut ungeschönt die harte Wirklichkeit und die Oberflächlichkeit und Falschheit der Welt, z.B. in der Schule:
S. 738
Hanno Buddenbrook war beinahe der Einzige, den Herr Modersohn schon mit Namen kannte, und das benutzte er dazu, ihn beständig zur Ordnung zu rufen, ihm Strafarbeiten zu diktieren und ihn zu tyrannisieren. Er kannte den Schüler Buddenbrook nur deshalb, weil er sich durch stilles Verhalten von den Anderen unterschieden hatte, und diese Sanftmut nützte er dazu aus, ihn unaufhörlich die Autorität fühlen zu lassen, die er den Lauten und Frechen gegenüber nicht geltend zu machen wagte. Selbst das Mitleid wird einem auf Eden durch die Gemeinheit unmöglich gemacht, dachte Hanno. Ich nehme nicht daran teil, Sie zu quälen und auszubeuten, Kandidat Modesohn, weil ich das brutal, hässlich und gewöhnlich finde, und wie antworten Sie mi…
Als künstlerischer Dilettant flieht er in die Musik, in das Reich des Gefühls, denn „neben dem Künstler als Genie bringt die nervliche Anfechtung des Zeitalters der Dekadenz auch den Dilettanten hervor.“1374
S. 743f
„Was ist mit meiner Musik Kai? Es ist nichts damit. .. Ich kann beinahe nichts, ich kann nur ein bisschen phantasieren, wenn ich allein bi…
„Ja, ich werde wohl spielen“, sagte er, obgleich ich es nicht tun sollte. Ich sollte meine Etüden und Sonaten üben und dann aufhören. Aber ich werde wohl spielen, ich kann es nicht lassen, obgleich es Alles noch schlimmer macht…
In der Wahl von Wagners Todessehnsucht-Motiv zeigt sich seine Lebensuntüchtigkeit und wie wenig er den Anforderungen der Gesellschaft und dem bürgerlichen Erwerbs- und Familienalltag gewachsen ist. „..er versagt am Leben überhaupt .Die Kunst - ist sie nicht immer eine Kritik des Lebens, ausgeübt durch die kleinen Hanno? Die anderen, das ist offenbar, fühlen sich im Leben .ja recht wohl. - wie Hannos Kameraden in der Schule. weder die Schule noch das Leben überhaupt lassen sich so einrichten, daß die höchste sittliche und ästhetische Reizbarkeit, daß die Sensitivität und der Geist sich darin zu Hause fühlen.“1375
Hanno - der einsame Künstlertyp, voller Sehnsucht, unfähig, das Leben zu leben und der nächste Firmennachfolger zu werden. Musik ist die gefühlvollste und intensivste Kunst, „da sie am unmittelbarsten und tiefsten in die Seele dringt.“1376
S. 748ff
Es war ein ganz einfaches Motiv, das er sich vorführte, ein Nichts, … eine kurzatmige, armselige Erfindung, der aber durch die preziöse und feierliche Entschiedenheit, mit der sie hingestellt und vorgebracht wurde, ein seltsamer, geheimnis- und bedeutungsvoller Wert verschafft wurde. ..Und nun begann ein unaufhaltsamer Wechsel von Begebenheiten, deren Sinn und Wesen nicht zu erraten war, eine Flucht von Abendteueren des Klanges, des Rhythmus und der Harmonie, über die Hanno nicht Herr war,…
Hanno saß noch einen Augenblick still. Dann stand er auf und schloss den Flügel. Er ging ins Nebenzimmer, streckte sich auf der Chaiselongue aus und blieb so lange Zeit, ohne in Glied zu rühre…
Schlussendlich kann „Der , Verfall’ der Buddenbrooks[... ] über weite Strecken als das Ergebnis unterbliebener, verhinderter oder gar negierter Selbstfindungsprozesse gelesen werden“.1377 Die Protagonisten versuchten die Erwartungen ihrer Familie zu erfüllen und erheben den Fortbestand der Familie mit ihrer wirtschaftlichen Bedeutung zum Ideal. Tradition wird zum Traditionalismus, der abstrakt ist und zu Stillstand führen kann.1378
Das Motiv des Künstlertypus in der jüngeren Generation findet sich auch in Arno Geigers und Eugen Ruges Schilderungen vom Abstieg einer einst einflussreichen Dynastie.
(ER)
Im Ruges Roman ist die Figur von Alexander das Alter Ego des Autors. Er wählt für sich den Weg des Künstlers, des Schauspielers und des Schriftstellers und empfindet schon in frühen Jahren die Einschränkung durch staatliche Vorgaben und wie wenig für ihn künstlerische Entfaltung möglich ist. Er hinterfragt politische und existentielle Leitbilder - und wandert letztendlich aus in die Bundesrepublik.
S. 26
Er war abgehauen und wieder zurückgekehrt . Er hatte einen ordentlich bezahlten Job bei einem Kampfkunst-Magazin angenommen ( und wieder gekündigt). . Hatte ein Filmprojekt angezettelt (vergiss es).…
Er hatte zehn oder zwölf oder fünfzehn Theaterstücke inszeniert (an immer unbedeutenderen Theatern). War in Spanien, Italien, Holland, Amerika, Schweden, Ägypten gewesen (aber nicht in Mexico…
S. 354
Aber anstatt zurückzukommen, war Sascha noch weiter weggezogen. Anstatt wieder nach Berlin zu gehen, wo die unglaublichsten Dinge passierten, anstatt daran teilzunehmen, anstatt seine Chance zu nutzen, zog er nach Moers. . Was hätte aus ihm werden können, dachte Irina. . Und warum? Weil Catrin dort ein Engagement bekommen hatte: am Theater in Moers! Zu mehr hatte es wahrscheinlich nicht gereicht, dachte Irin…
Jahre später erkennt er aus dem Blickwinkel eines in der DDR aufgewachsenen Mannes die Bedeutung seiner Vergangenheit, die er nicht im Zuge der Wende vergessen lassen will und schreibt diesen Familienroman. In seinem Rückblick zieht Alexander eine ernüchternde Lebensbilanz des weitgehenden Scheiterns und sieht sich sogar Kurt gegenüber trotz dessen Krankheit sowohl sozial als auch im schriftstellerischen Schreiben unterlegen.
S. 22
- ein Buch, wie es Alexander nicht geschrieben hatte und nun wohl auch nicht mehr schreiben würd…
S. 27
Anders gefragt: Warum war er eigentlich nicht imstande, Marion zu lieben? …
Oder hatte Kurt Irina geliebt? Hatte dieser alte, pedantische Hund, hatte diese Maschine Kurt Umnitzer ein fertiggebracht zu ,lieben…
Das Konvolut mit den verschiedenen Aufzeichnungen Kurts scheint fast wie ein assoziativer Appell an Alexander zu wirken, die Geschichte der Familie zu bewahren:
S. 422
Was ist das? Aufzeichnungen für einen Roman? Für einen zweiten, in der DDR spielenden Teil seiner Memoire…
Er entwickelt ein neues Verhältnis zu seiner Familie und seiner DDR- Biographie, eines, das deren Bedeutung heraushebt/akzentuiert, datiert auf den „Tag von Mazunte“, benannt nach dem idyllischen Dorf am Pazifik und die Erfahrung, dass es in der Geschichte der Menschen auch positiv besetzte, erinnerungswürdige Ereignisse gibt:
S. 422
An diesem Tag- am Tag von Mazunte - wird Alexander auf eine Notiz vom Februar 1979 stoßen. Selbstverständlich erinnert er sich an diesen Winter. …
,Ist offenbar durchgedreht.' …
Ziemlich deutlich: wie Kurt plötzlich stehen bleibt und schreit...: ,In Afrika hungern die Leute…
… es folgt ein schwer zu entziffernder Satz über das Leben, das Kurt sich, wenn Alexander richtig liest, nicht versauen lassen wil…
(AG)
In Geigers Roman gibt es ebenfalls die Figur des gescheiterten Künstlers: Philipps Eigenart ist sein Anderssein, er steht in Opposition zur übrigen Gesellschaft, denkt über Buchprojekte nach, verwirklicht aber weder irgendeins davon noch einen Entwurf. Als Schriftsteller in einer Schreibkrise imaginiert er lediglich in der Phantasie Szenen, die in einem Roman verwendet werden könnten, entwirft z.B. Familienkonstellationen und Personen. Damit fügt er sich in den Künstlertyp ein, von dem Thomas Mann sagte: „Ein Dichter ist, kurz gesagt, ein auf allen Gebieten ernsthafter Tätigkeit unbedingt unbrauchbarer, einzig auf Allotria bedachter (...) Kumpan.“1379
Philipp ähnelt dem Dilettanten, einer Figur, die im Bürgertum, als der Bürger selber künstlerisch dilettierte, Konjunktur hatte. So wie Hanno sich in der Musik verliert, ist es bei Philipp die Poesie, durch die er sich in Tagträumen von seinen Pflichten entlastet, die Realität unberücksichtigt lässt und stattdessen spontan auftretenden Einfällen nachgeht. Auf der Vortreppe sitzend, versenkt er sich in Gedanken und in ein sinnliches Lebensgefühl, statt sich Unternehmungen entschlossen zuzuwenden, und ist nicht zu Leben und Tat fähig, z.B. der praktischen Erneuerung und Säuberung der Wohnung.
S. 50
Den ganzen Vormittag bringt Philipp nichts zustande. Mit den Ellbogen auf den Knien sitzt er auf der Vortreppe … Er isst Champagnerpralinen … Zwischendurch liest er, versuchsweise, unkonzentrier…
Er hat den für Künstler oft charakteristischen Wunsch, ein freies, unabhängiges Leben zu führen, nur sich selbst verpflichtet zu sein, so wie Heinrich aus G. Kellers Roman „Der grüne Heinrich“ (der Literatur von Alma). Beide geben die gesicherte Existenz im Kreis der Gesellschaft zugunsten eines gefährdenden Heraustretens aus der Gesellschaft und ihren emotionalen Beziehungen auf, ziehen in die Ferne und verweigern sich damit dem Bürgersinn. Wie Heinrich auf der Suche ist nach geistiger Kultur, um zu etwas Höherem zu gelangen, (Keller, S. 35, 38, 46, 41) und dabei die Geborgenheit der Heimat verliert, gehen für Philipp die Beziehung und sein Zuhause verloren.
Für Heinrich wird es der gescheiterte Versuch, das bürgerliche Ideal einzulösen.1380 Er erkennt, dass er kein hervorragender Maler ist und kein Genie, scheitert und verfehlt die Nützlichkeit eines Bürgers, er wird weder Künstler noch Bürger - ähnlich wie Philipp.
Die Parallele zur Familie Buddenbrook: Philipp fühlt sich einerseits wie Hanno als ein Künstler, der durch die Zwänge der Gesellschaft eingeengt wird, repräsentiert aber andererseits wie Christian Buddenbrook den heimatlos gewordenen Bürger1381 und wirkt dabei passiv und sonderbar. Er lebt in Traumphantasien und erfährt, ähnlich Christian, keinen Sinn in den von der Gesellschaft bereitgestellten Entwürfen wie Leistungskonkurrenz und Privateigentum. Bürgerliche Verhaltensweisen und Werte lehnt er ab und setzt sich über soziale Normen mit altersmäßig definierten Zeitpunkten für Veränderungen im Lebenslauf und über Leitlinien für gesellschaftlich erwünschtes Verhalten hinweg. Und genau das meint Entbürgerlichung im beruflichen und privaten Leben: fehlendes Besitzstandsdenken und eine private Lebensführung, die sich durch „familiäre Unambitioniertheit“ (S. 92), Experimentierfreudigkeit und Selbstbezogenheit auszeichnet.
Seine Beziehung zur verheirateten Johanna ist problematisch und von Vorwürfen ihrerseits geprägt. Diese nimmt er hin und notiert sie lediglich in seinen Aufzeichnungen für ein geplantes Buch.
S. 285
Eigentlich ist Philipp auf allen Mauern seines Lebens eine Randfigur, eigentlich besteht alles, was er macht, aus Fußnoten und der Text dazu fehl…
In einem Anfall von Aktivismus klettert er auf den Dachstuhl und verabschiedet sich vom Leser, um in eine neue Zukunft aufzubrechen, sitzt dort, ähnlich Baron Münchhausen und dem „Grünen Heinrich“, als für diese beiden ein neuer Lebensabschnitt beginnt,1382 auf dem Dach; er wird sich von allen Beziehungen lösen und in eine Welt der Phantasie verschwinden. Es bleibt ungeklärt, ob er eine Orientierung findet, denn bisher ..
S. 285
… .ist Phillip auf allen Mauern seines Lebens eine Randfigur…
Die unmittelbare Umwelt reagiert auf Philipp vorurteilsgeladen, abwertend. Sein Verhalten und Denken wirken auf sie absonderlich, er erscheint als ein emotional nicht reifes Individuum.
S. 335
… .als müssten seine Schwarzarbeiter unweigerlich denken, dass er eine Niete von höchster Konzentration ist, einer von der Sorte, die zu nichts anderem taugt, als Schaden in der Welt anzurichten: Du Blasengel! Du halbgarer Surrealis…
S. 382
Er schaut den Nachbarn an, gekränkt, beleidigt, voller Unbehagen,...innerlich auf Knien vor dem nachbarlichen Gegenüber, dessen Gedanken klar vor Philipps Augen stehen: Das also ist die nächste Generation, dieser kleine Spion und Abweichler, er hat das Klettern am Stammbaum einer windschiefen Familie erlernt, und jetzt nutzt er die so erworbenen Fähigkeiten, um auf Stühle zu steigen, die entlang seiner Gartenmauer stehen..…
Der Mann entfernt sich Richtung Haus. Präziser: Er lässt Philipp stehe…
Er ist der Inbegriff für die wissenschaftlich anerkannte Korrelation zwischen Kinderlosigkeit, geringen Ausbildungs- und Berufsaspirationen und einer geringen sozialen Integration.1383 Dagegen wäre die Gründung einer Familie ein Zeichen für Verantwortung und persönliche Reife,1384 denn familiales Leben stabilisiert, wirkt sozial und emotional als integratives Element. So aber bleibt Phillip gesellschaftlich eine „defizitäre“ Person.1385 Er zieht den Rückzug in die Innenwelt vor - eine Flucht in eine Lebensform, die egozentrische Selbsterfahrung und Selbstverwirklichung verheißt.
Ihre Entsprechung findet die Familie Sterck/Richard im Verfall einer Familie aus dem österreichischen Schlüsselroman „Radetzkymarsch“ von Joseph Roth, angesprochen im Kaiser-Dialog. Die Familie Trotta spiegelt beispielhaft den Verfall des Habsburger Reichs wieder, verfällt aufgrund ihrer Schwäche, Dekadenz und Lebensfremdheit in einer Welt der sozialen Veränderungen und löst sich auf dem Hintergrund des Endes der k.u.k. Monarchie auf. Im unaufhörlichen Verfall wird Kontinuität bewahrt.1386
Ein weiterer Grund für das Auseinanderfallen der Familien ist folgender:
25.4 Fehlende Kommunikation und Individualisierung (versus Familiensinn)
(TM)
Wir lesen von Konflikten und Störungen bei der Familie Buddenbrook, die letztendlich zur Auflösung führen: 1387 Da wäre zunächst Gotthold, der sich dem Willen seines Vaters widersetzte, indem er mit einer Liebesheirat keine gute Partie sondern „einen Laden“ heiratet und damit einen Bruch mit der Familie provoziert. Der Kontakt beschränkt sich seitdem auf einen Briefwechsel:
S. 57
Da waren als traurige Dokumente die bösen Briefe Gottholds an seinen Vate…
Das Verhältnis zwischen Thomas und seinem Bruder ist bereits bei der Firmenübernahme zerrüttet:
S. 273
Es gibt viele hässliche Dinge auf Erden, dachte die Konsulin Buddenbrook, geborene Kröger. Auch Brüder können sich hassen oder verachten; das kommt vor, so schauerlich es klingt. Aber man spricht nicht davon. Man vertuscht es. Mach braucht nichts davon zu wisse…
Im Streit gar droht er Thomas ihm an, ihn zu vernichten:
S. 581
„.Ich sage dir, hüte dich! Ich kenne keine Rücksicht mehr! Ich lasse dich für kindisch erklären, ich lasse dich einsperren, ich mache dich zunichte! Zunichte! Verstehst du mich?…
„Und ich sage dir.“ fing Christian an. Und nun ging das Ganze in einem Wortstreit übe, … ohne einen anderen Zweck, als den, zu beleidigen…
Zwischen Thomas und Hanno entsteht ein unterschwelliger Vater-Sohn-Konflikt, da Hanno nicht dem Bild des starken zukünftigen Firmenerben entspricht. Beiden fehlt der Mut zur ehrlichen Kommunikation, es kommt zur Entfremdung:
S. 510
Er ließ nichts merken von der Sorge, mit der er die Entfremdung beobachtete, die zwischen ihm und seinen kleinen Sohne zuzunehmen schien, und der Anschein, als bewürbe er sich um des Kindes Gunst, wäre ihm furchtbar gewesen. Er hatte ja während des Tages nur wenig Muße, mit dem Kleinen zusammenzutreffen; gelegentlich der Mahlzeiten aber behandelte er ihn mit einer freundschaftlichen Cordialität, die einen Anflug von ermunternder Härte besaß. „Nun, Kamerad“, sagte er, indem er ihn ein paar mal auf den Hinterkopf klopfte und sich, seiner Frau gegenüber, neben ihn an den Speisentisch setzte. „Wie geht’s?…
Hanno reagiert mit Scheu und Distanz auf seinen Vater, Einsamkeitsgefühle werden mit dem Rückzug in die Musik beantwortet.
S. 522
Hätte er wenigstens die Musik unterdrücken und verbannen können, die den Jungen dem praktischen Leben entfremdete, seiner körperlichen Gesundheit sicherlich nicht nützlich war und seine Geisteskräfte absorbierte! Grenzte sein träumerisches Wesen nicht manchmal geradezu an Unzurechnungsfähigkei…
Letztendlich führen die Familienmitglieder wie Tony und Thomas, Christian und Hanno, ein fremdbestimmtes Leben, ohne ihre persönlichen Bedürfnisse artikulieren zu dürfen. „Sie führen ein Leben gegen sich selbst, gegen ihre wahren Leidenschaften, verleugnen sich, verstecken sich, das geht nicht ewig gut.“1388
Ähnliches findet sich in den modernen Romanen:
Geiger und Ruge schildern in ihrem zeitgenössischen Familienromanen den Bedeutungsund Kommunikationsverlust der traditionellen Familie.
Haben wir im Roman der Buddenbrooks anfangs noch eine Familienversammlung, so ist es in den modernen Familienromanen ganz anders: Ein vereinzeltes Individuum stellt den Endpunkt einer Familie dar. Während Hannos Familie strukturell noch als Kleinfamilie besteht, ist Philipps und Saschas Familie in ihren traditionellen Strukturen zerfallen.
In den Anfängen erleben wir Familien mit Kindern in einer mutterzentrierten Form, die aber nur selten eine harmonische und sinnerfüllte Vater-Mutter-Kinder-Zelle sind. Die Familienbande schwächen sich im Folge von Generation zu Generation immer mehr ab. (AG)
Die Handlungsstränge der Personen trennen sich: Die mittlere Generation stirbt früh, Otto, der Onkel von Philipp, verliert beim Volkssturm im 3. Reich sein Leben, Ingrid kommt bei einem Bade-Unfall in der Donau um und mit Philipp ist die Familiengeschichte und der Lauf der Generationen beendet: Der Zug in die Fremde beseitigt die Spuren dieser Familie in der Heimatstadt.
Es gibt „kommunikative Störungen in der deutschen Nachkriegsfamilie“.1389 Geiger selbst erlebte solch ein kommunikatives Scheitern in vielen Familien, und es war sein Wunsch, dies zu schildern: „Väter, die am Familienleben nicht teilgenommen haben, Fragen über die Familie, auf die es keine Antworten gab.“1390„Ich wollte nicht den Niedergang einer dekadenten Sippe zeigen wie Thomas Mann in den Buddenbrooks. Mir ging es darum zu beschreiben, wie eine Familie, in der nicht gesprochen, nicht kommuniziert wird, eben dadurch zum Scheitern verurteilt ist.“1391
Familie könnte ein Ort sein, der vor dem Alleinsein bewahrt. In Geigers Familienroman jedoch ist Einsamkeit das wichtigste Motiv, und dies als eine Folge von Kommunikationsschwierigkeiten und gesellschaftlichen/historischen Veränderungen, wie die in den 70er Jahren sich entwickelnden Lebensmaximen der Selbstbestimmung und persönlichen Freiheit. In den Familien wird wenig erzählt, es wird geschwiegen.
In der Beziehung Richard-Alma:
S.70 (1938)
Oft, wenn er wüsste, was in ihr vorgeht, wäre ihm leichter, und er würde im Umgang mit ihr vielleicht mehr als nur ein paar eckige Alltäglichkeiten zustande bringe…
S. 38 (1982)
Alma dreht sich zu ihrem Mann hin. Sie würde ihm gerne von ihrem Traum erzählen, aber solche Ereignisse unterschlägt sie normalerweise, ohne dass sie einen konkreten Grund dafür angeben könnte. Vielleicht, weil es irgendwie ausgemacht ist, dass über die Kinder nicht viel geredet wird.Phrasenhaften Gesprächen zwischen Alma und ihrem Mann Richard fehlt es an Tiefe und ehrlichem Gefühl:
S. 38
Damit er kein Gespräch anfängt, macht sie viel Lärm mit den Töpfen. …
- Wie geht es dir? fragt Richard in eine Pause der Küchengeräusche hinei…
- So weit so gu…
- Als ob das eine Aussage is…
In der Beziehung Richard-Ingrid:
5. 149:
- Ich bin mit Sicherheit nicht mutwilliger als du, nur dass bei dir hinzukommt, dass du in keiner Sekunde dein Gehirn einschaltest. …
- So kannst du Mama in die Tasche stecken. Bei mir funktioniert der Trick nich…
Richards Hals hinauf schwillt eine Ader …
Der Auszug Ingrids aus dem Elternhaus folgt bereits in frühen Jahren:
S. 213
Als Ingrid wieder einmal um Mitternacht nach Hause kam und auch noch freche Antworten gab, ist ihm der Kragen geplatzt, und er hat sie eine halbe Stunde lang angeschrien und rausgeworfen. … Aber am nächsten Morgen hat er die Maßnahme zurückgenommen, er ist keiner, der seine Fehler nicht einsieht. Trotzdem ist Ingrid noch am selben Tag auf und davon …
S. 213 (1962)
Ein normales Gespräch scheint seit Jahren nicht mehr möglich. Jedes Wort ist falsch. Also schade drum. Und was nutzt es, wenn er sich ins Gedächtnis ruft, dass Ingrid ihm, als sie klein war, blind glaubt…
In der Beziehung Ingrid-Peter:
S. 271 (1970)
… nachdem er eine Weile gewartet hat, richtet er sich auf und will darüber sprechen, wie es weitergehen soll. Ingrid … antwortet freundlich, sie habe ihm vorgestern alles gesagt, es gebe nichts hinzuzufüge…
Alma hat als Mutter den Kontakt zur Familie ihrer Tochter, trotz des problematischen Schwiegervater-Schwiegersohn-Verhältnisses, aufrecht erhalten wollen:
S. 38
Alma hatte den Kontakt zu Ingrid wieder anschubsen wollen und immer gedacht, dass noch ausreichend Zeit bleib…
Dann folgt Ingrids Unfalltod und wir erleben in der Romanfamilie Ende der 70er Jahre die Vereinzelung und Einsamkeit der Familienmitglieder, ein Nebeneinander statt ein Miteinander, „womit die funktionale Geborgenheit der reinen Zweckgemeinschaft hat weichen müssen.“1392
Die Zweckgemeinschaft der Familie Sterk/Erlach scheitert durch ihre Kommunikationslosigkeit, „ diese Kommunikationslosigkeit und -unfähigkeit scheint die sonst im Genre durch Darstellung der etablierten Familienriten hervorgehobenen, identitätsstiftenden Verhaltens- und Kommunikationscodes zu ersetzen.“1393
Familiensolidarität existiert in Geigers Roman lediglich in der Figur von Alma, nicht in den Personen der jüngeren Generation.
S. 20
Die Menschen treiben aneinander vorbei, einer sieht nicht den Schmerz des andere…
In Philipp kulminiert die familiäre Beziehungslosigkeit und Gleichgültigkeit: Symbole aus der Villa, die aus der Vergangenheit erzählen und Ereignisse vergegenwärtigen könnten, weiß er nicht zur familiären Geschichte zuzuordnen.
Er ahnt zwar die Besonderheit und Bedeutung der Kanonenkugel im Treppenhaus der Villa, erklärt seine Unwissenheit von deren Herkunft aber mit dem geringen familiären Zusammenhalt.
S. 11
Schließlich ist es nicht meine Schuld, dass man vergessen hat, ihn in puncto Familie rechtzeitig auf den Geschmack zu bringe…
Als eine Ursache nennt er Verständigungsprobleme mit seinem Vater und Entfremdung:
S. 98
Nur hat der im Laufe des vergangenen Jahrhunderts das Reden verlern…
Philipp zeigt sich der Familie gegenüber
S. 136
,keimgeschützt und unbetroffen…
Johanna nennt esDesinteresse(S.8)
Philipp verzichtet auf die recherchierende Aufarbeitung und eine Wiederholung der Familiengeschichte. Seine negativen Erinnerungen und Erfahrungen in seiner Herkunftsfamilie stuft er als bedeutsam für seine familiäre Unambitioniertheit’ ein und sieht sich als ein Produkt einer problembeladenen Familie.
S. 10
Die Ehe meiner Eltern war nicht das, was man glücklich nenn…
S. 186
Als Kind in einer Ehe, die kaputt ist, sollte man zumindest eines lernen (wenn schon nicht Zärtlichkeit und die Fähigkeit zum Gespräch): Den Umgang mit Unsicherhei…
Er beginnt mit zaghaften aber letztendlich erfolglosen Suchbewegungen in Richtung Familie: Statt die Identität der Toten auf dem Foto und die Vergangenheit, das familiäre Erbe, zu erforschen, fantasiert Philipp eine Geschichte, die letztendlich in der Frage nach dem Sinn des Lebens und dem Warum der menschlichen Mühsal angesichts des Sterbens mündet.
S. 15
Er malt sich ein fiktives Klassenfoto aus … Was ist aus ihnen geworden, aus all diesen toten, die täglich mehr werde…
Und so bleibt er in beziehungsunfähiger Einsamkeit zurück, die „zu den ,Kosten‘, [gehört], die der moderne, neuzeitliche Mensch für seine individualitätsbewusste, autonome Haltung hat entrichten müssen.“1394
(ER)
Vom Gefühl des Ausgeschlossenseins und der Isolation lesen wir auch in Ruges Roman: In seiner Familie sind es die Frauen Nadeshda und Irina, beides zugewanderte Russinnen, die davon betroffen sind.
Nadjeshda hat den Wunsch, wieder in ihre Heimat zurückzukehren, da sie auch nach vielen Jahren der deutschen Sprache nicht mächtig ist und infolgedessen keine Integration erfolgt:
S. 157ff
… sie lehnte sich in ihrem Sessel zurück, ihr Blick wanderte zum großen Fenster, … es dämmerte schon, nur in den Wipfeln der Bäume war noch Licht, … und Nadjeshda Iwanowna glaubte den Abendhauch zu spüren … Bald, wenn die Ernte vorbei war, hatte Nina Geburtstag, Mitte Oktober … die richtige Zeit, um zu feiern, tags zuvor hatten sie zusammen Pelmeni gemacht, und dann wurde gesungen, getanzt ..., so war das in Slawa … Ja. Es war alles ganz einfach. Sie würde nach Slawa fahren, zu Ninas Geburtstag … Sie würde mit Nina in der Küche sitzen und Dickmilch löffeln. Sie würden zusammen Pelmeni machen, dann würden sie feiern …
Irinas Einsamkeit steht im Zusammenhang mit der Ausreise ihres Sohnes.
Zunächst bot ihr die eigene Familie mit der vertrauten Gemeinsamkeit mit Kurt und Sascha einen Geborgenheit und Wärme. Als Sascha auswandert, entwickelt sich zur geographischen Distanz eine emotionale Entfremdung, und sie sucht Trost und Flucht im Alkohol:
S. 324f
Dass sie sich in ihr Zimmer zurückzog und sich, Wyssozki hörend, in aller Einsamkeit betrank, war eine ziemlich neuartige Erscheinung. …
,Mein Sonn hat mich verratten', hieß die Formel, in der ihre Enttäuschung ihren endgültigen Ausdruck fand ..Daraufhin hatte Irina sich mit dem Rest der Flasche und der merkwürdigen Drohung, sich einen Hund anzuschaffen, in ihr Zimmer zurückgezogen …
Als nach der Wende zwischen Kurt, der ideologisch noch mit dem Sozialismus konform geht, und seinem Sohn keine sachliche Diskussion mehr möglich ist, führt die politische Auseinandersetzung und unterschiedliche ideologische Ausrichtung zwischen ihnen zum Bruch.„So, das war’s.“ (S. 370) Ein Schlusswort, was das Zerwürfnis unterstreicht.
Alexander reflektiert in Mexiko über seine Sehnsucht und das ambivalente Gefühl, irgendwo dazugehören zu wollen;
S. 410f
Am schlimmsten - am schlimmsten? - ist es nachts, wenn ich unter meinem Moskitonetz liege und durch die jämmerlichen Wände meines Verschlags die Stimmen der alte gewordenen Hippies höre … Dann denke ich besonders an dich. Warum gerade dann? Weil ich mich ausgeschlossen fühle? Weil ich das Gefühl habe, nicht dazuzugehören? Aber ich habe immer, mein Leben lang, das Gefühl gehabt, nicht dazuzugehören. Obwohl ich mein Leben lang gern irgendwo dazugehört hätte, habe ich das, dem ich hätte zugehören wollen, niemals gefunden. Ist das krank? … Oder hat das mit der Geschichte meiner Familie zu tun? Wenn ich ehrlich sein soll: Nichts zieht mich, wenn ich unter meinem Moskitonetz liege, nach draußen, an diesen Tisch. Und doch empfinde ich, wenn ich sie lachen höre, eine fast schmerzhafte Sehnsuch…
Eine weitere unter Einsamkeit leidende Person im DDR-Familienroman ist Markus, das „Wendekind“:
S. 381
Den Sonntagabend verbrachte er allein vor dem Fernseher in seiner WG und zappte sich durch …
Ihm fehlen die politischen Sicherheiten des DDR-Systems und die Integration in seiner Familie, die Autorität des Stiefvaters akzeptiert er nicht, Gesprächen und gemeinsamen Unternehmungen weicht er aus. Aber auch bei den gleichaltrigen Freunden findet er keinen Halt, da er ihre politische Ausrichtung ablehnt.
S. 374
… und Zeppelin hatte die Idee, irgendeinen Scheißtürken, der irgendeine Braut aus Zeppelins ehemaliger Klasse angemacht hatte, die Reifen von seinem Scheiß-Opel zu zerstechen, aber erstens war es noch zu früh am Tag …
Es ist nicht abzusehen, wie Markus’ weitere Entwicklung verläuft.
25.5 Traumatisierung der Kriegsgeneration
Fehlende Kommunikation zwischen den Generationen innerhalb einer Familie als ein Kriterium für deren Auflösung kann auf einer Traumatisierung der Kriegskinder und -enkel beruhen und auf der Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit, die früheren traumatischen Kriegserlebnisse zu verbalisieren.
Bereits die Bibel spricht im Buch Exodus von der Weitergabe „der Väter Missetat an die Kinder bis ins dritte und vierte Glied“ und Freud betont, dass wichtige seelische Vorgänge zwischen Generationen nicht verborgen werden können,1395 - also scheint sich subtil das Erlebte der Vergangenheit in der Familie fortzusetzen, auch wenn es nicht offen kommuniziert wird.
Gibt es demnach eine Kausalität zwischen der transgenerationalen Weitergabe traumatischer nicht kommunizierter Erlebnisse und der Auflösung der Familie?
Die Kindergeneration des 2. Weltkriegs hatte oftmals keine Möglichkeit, ihre schlimmen Erfahrungen mit Krieg, Flucht oder Vertreibung zu benennen oder gar aufzuarbeiten. Vieles versank im Schweigen, wirkte jedoch, ebenso wie z.B. der nationalsozialistische Erziehungsstil, unter der Oberfläche weiter.
„Die Eltern haben saure Trauben gegessen, und den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden“, lesen wir dazu in der Bibel beim Propheten Ezechiel im 18. Kapitel.
Negative Folgen, wie die „Traumatisierung“ einer Generation, können transgenerationell übertragen werden, ohne dass sie der bewussten Kontrolle eines Individuums unterliegen - dies kann sich z.B. auf kriegsinduzierte Traumata beziehen.1396 Von daher ist zu vermuten, dass eine nicht geringe Anzahl von Menschen in der Generation der ,Kriegsenkel‘ (die 1950 bis 1970 Geborenen) mit den Folgen dieser Verdrängungen zu kämpfen haben. Wie stellen sich die Spätfolgen dar? Welche Lebensgefühle für die Folgegeneration/en können daraus entstehen?
Es existiert, davon ist auszugehen, eine „intergenerationelle Tradierung" und Weitergabe von Erfahrungen von Seiten der Vorgängergeneration, insbesondere der Kinder der nationalsozialistischen Gesellschaft, womit sich die Traumatisierung durch Bombenkrieg, Vertreibung und Massenvernichtung auch in die gegenwärtige Kultur und soziale Wirklichkeit in Deutschland und Österreich einschreibt.1397 (AG)
Betrachten wir unter diesem Aspekt zunächst A.Geigers Roman, so lesen wir von Generationen der Kaiser-Zeit, von der Hitler-Jugendgeneration und von der KriegsenkelGeneration.
Für mehrere Generationen der Familie Sterk/Erlach spielte der Zweite Weltkrieg eine wichtige Rolle: Philipps Vater Peter, dessen Vater und Richard Sterk verbinden persönliche Erlebnisse und Erfahrungen mit dieser Zeit; deren (traumatische) Kriegserlebnisse beeinflussen ihre Biographien, das Familienleben und auch die kommenden Generationen.
Peters Vater ist ein Angehöriger der Jahrgänge 1905-1920 und damit ein Kriegskind des 1. Weltkriegs. „Psychodynamisch gesehen verfügten diese Kriegskinder des Ersten Weltkriegs nicht nur über kein sicheres inneres Bild des Vaters, sondern litten auch unter den Folgen einer mangelhaften Befriedigung ihrer kindlichen Bedürfnisse (zugewandte Versorgung, Geborgenheits- und Bindungsbedürfnisse).“1398
Ihre innere Haltung gaben sie als Eltern an die Kriegskinder des 2. Weltkriegs weiter (Peter).
Peters Vater ist bereits früh ein überzeugter Anhänger des Nationalsozialismus und übernimmt unkritisch dessen Weltanschauung. Er wird 1936 in Haft genommen, weil er im Besitz von Hakenkreuzwimpeln ist und den Anschluss Österreichs durch die Sprengung von Telefonhäuschen vorbereitete. Nach dem Anschluss Österreichs gab es für ihn die erhoffte Bevorzugung, z.B. in Form einer größeren Wohnung.
S. 126
… dass der Tisch in Zukunft reicher gedeckt werde …
Für ihn bleiben die Vorgaben der NS-Ideologie auch nach dem Krieg wirkmächtig, er nahm weder eine kritische Position ein, noch kam er beim Zusammenbruch des NS-Regimes zur Neubesinnung. Stattdessen hielt er an der Richtigkeit der bisherigen Wertvorstellungen/ Ideologie fest. Von da an erschweren die Entnazifizierungsmaßnahmen und seine Inhaftierung die private Situation in der Familie:
S. 172
Dass sich Peters Vater zweimal vor einem Volksgerichtshof zu verantworten hatte und dass er nach mehreren Monaten Ziegelschupfen zur Zwangsarbeit war für anderthalb Jahre in St. Martin am Grimming zur Verbesserung der Gesinnung, was nicht viel gebracht hab…
Kann sich sein Sohn dem Ganzen innerlich entziehen? Peter steht ebenso wie der Vater unter den Zwängen der nationalsozialistischen Ideologie, und kann als „Missbrauchter“, „Verführter“ eingestuft werden.
Man spricht heute von der „vergessenen Generation“ der Kriegskinder und -jugendlichen und erkennt in der Auseinandersetzung mit deren Schicksal im Krieg die Bedeutung dieser Zeit für ihre Entwicklung.1399 Gefühle und Erlebnisse wurden von ihnen verdrängt, führen bei einer Vergegenwärtigung zu Angst und Unsicherheit.
Die Kapitel der Jahre 1945, 1955, 1970 und 1978 in Geigers Roman spiegeln Peter als Zeitzeugen, Akteur und passiv Betroffenen in seiner Lebenswelt des 20. Jahrhunderts wieder:
Die aktive Beteiligung des Vaters am Nationalsozialismus (S.125) und die an Krebs erkrankte Mutter sind Kernpunkte der Herkunftsfamilie. (S. 111)
Er erlebt, wie jüdische Nachbarn verfolgt und deren Eigentum zerstört wird: S.126
Die Betten, die aus den Fenstern der jüdischen Wohnungenvis-à-visgeworfen wurde…
Ingrid erlebte als Mädchen in der entsprechenden NS-Jugendorganisation in der „Kinderlandverschickung“ ebenfalls die Erfahrung von Drill, Disziplin und Erniedrigung .
Sein Kampfeinsatz in Wien mit einer kleinen Gruppe von Schicksalsgenossen wird von Peter als eine persönliche Bewährung und als ein Ausdruck eines bedeutenden Erwachsenenstatus’ und der Männlichkeit wahrgenommen: Der Einsatz sollte die
Loslösung vom privaten Raum der Familie in eine hoffnungsvolle Zukunftsvision sein, denn, so seine Hoffnung, vielleicht würde durch die Einberufung zum Volkssturm und der zeitlichen, räumlichen und emotionalen Trennung1400 das Verhältnis zu seinen Eltern wieder besser.
S. 111
An allem hat der Vater etwas auszusetzen, und immer ist es Peter, der hart angepackt und gehauen wird, während seine Schwestern sich mit der Mutter zusammengetan haben, unter Fraue…
S. 129
Wie er neben der kranken Mutter von einer Ecke in die andere und schließlich an den Rand der Familie geschoben wird, weil er nur Arbeit macht und niemandem eine Hilfe ist, selbst wenn er sich nützlich machenwill.
Die Realität sah völlig anders aus als in der NSDAP Propaganda:
Herabsetzungen sind ein selbstverständlichen Teil des Alltags, wie z.B. eine Degradierung vor der Truppe, die er als furchtbare Blamage erlebt:
S. 107
Aber er: Degradiert. Im Hof vor versammelter Truppe zuerst zusammengestaucht, anschließend die Scharführer-Kordel heruntergerissen. Das war furchtbar.So eine Blamag…
Ein anderes Mal wird er als Strafe für ein Lachen in einer lustigen Situation am Heimatabend „geschliffen“ bis er sich übergeben muss.
S. 127
Exerzieren, stillgestanden, kehrt, marsch, marsch, linksum, rechtsum, Gewehrpacken, stillgestanden, hab acht.…
Als waffenschleppender Hitlerjunge begegnen ihm Menschen in Kellern, grußlos und stumm vor Todesangst, während ringsherum Häuser zusammenstürzten und Brandbomben fallen. Da wichen bei ihm schnell die Erwartungen einer nüchternen Einstellung und es offenbart sich der falsche Schein der NS-Ästhetik: Die nationalsozialistische Propaganda vom Kameradschaftsmythos mit ihren Topoi ,Gemeinschaft’ und ,Gleichheit’ ließ sich im Alltag der Fronterfahrung nicht aufrecht erhalten.1401. Es war vielmehr die Isolation „die oft ein ebenso charakteristisches Merkmal der individuellen Kriegserlebnisse bildete wie die Erfahrungen von Gemeinschaft oder soldatischer ,Kameradschaft‘ “.1402
Peter erlebt die extremen Erlebnisse des Krieges zwar mit einer Gruppe Gleichalteriger, jedoch bedeutet diese Kriegswirklichkeit stets, sich in Lebensgefahr zu befinden und eine Verdrängung der eigenen wahren Gefühle und keinesfalls ein Gemeinschaftserlebnis.1403 Damit wird die Realität des Krieges zu einer biographischen Bruchstelle für Peter, er erlebt: - Hunger
S. 107
Alle Leute sollen leben, die uns was zu essen gebe…
- Härte, Emotions- und Mitleidlosigkeit
S. 107
Man könnte ihm in die Hosen hineinschießen, schlägt Peter vor zur Wiedergutmachung dafür, dass er den Plünderer vor den Russen warnen wollt…
Er wird ein willenloses Objekt seiner Vorgesetzten: S. 118
Wir haben keine Befehle. Wenn uns niemand Befehle gibt, haben wir keine Befehl…
Insbesondere das zuletzt erzählt Kriegserlebnis führte zur „Entwertung der zuvor etablierten Selbstverortungen“1404:
Das Gefühl der Angst wird explizit, als Peter seine zweite Beobachtungsstelle einnimmt, er und seine Gefährten warten, hören Geräusche, Anspannung und Erregung ist zu spüren, gleichzeitig „sind sie in angeregter Stimmung“:
S. 105
Sie haben Angst, aber gleichzeitig sind sie in angeregter Stimmung, die teils mit dem Bewusstsein der Lebensgefahr zu tun hat, teils mit der Überzeugung, dass ihnen ihre Angst nicht anzumerken ist oder, wenn doch, sie wenigstens nicht feige sein werde…
Er wird Zeuge eines Angriffs und wie einer der Soldaten schreiend in einer Blutlache liegen bleibt. Doch nicht Mitleid, sondern Hoffnung keimt bei ihm auf, sondern der Wunsch, mit der Verpflegungsration des angeschossenen Soldaten seinen Hunger zu stillen.
Verletzt erlebt Peter in nächster Nähe durch eine Detonation einer Handgranate den Tod seines Fähnleinführeres und eines 14jährigen besonders mutigen Hitlerjungen (Otto). Konfrontiert mit seiner eigenen Sterblichkeit und der Begrenztheit seines Lebens, bildet dieser Todesfall einen wichtigen Einschnitt: Er lässt die Kindheit hinter sich. „Dieser Augenblick, in dem der Tod sie berührt, hat die größte Erfahrung von Körperlichkeit zur Folge, aber diese Erfahrung kann in dem Moment, in dem sie erfahren wird, noch nicht mental verarbeitet oder symbolisch repräsentiert werden.“1405 S. 109
Der Vierzehnjährige indes lehnt starr an dem zerschossenen Mauerstück, unmittelbar neben der Fensteröffnung, durch die sich Peter in Sicherheit gebracht ha…
S. 113f
Peter ist überrascht, wie der Bub dasteht: Das Bauchfell scheint aufgerissen, zwischen den Fetzen der blutigen Uniform kann man die ebenfalls blutigen Eingeweide sehen, die der Bub mit den Händen am weiteren Austreten hindert. …
S. 114
Es erschreckt Peter nicht, es berührt ihn nur. Eigenarti…
Zeugen von Gewalt erleben diese in der Regel so traumatisch wie die selbst Betroffenen, der Schmerz des anderen wird zu unserem Schmerz. „Jede abgeworfene Bombe erhöht das Gefühl der eigenen Nichtigkeit“,1406 doch Peter lässt diese Erfahrung noch nicht zu: „Überwältigt von einer Macht der Zerstörung, die Kindern den Blick in die Abgründe des Grauens zugemutete hatte.“1407
Die Flucht erlebt Peter: „gehetzt“, mit blutender Wunde, Schmerzen, die aber niemanden interessieren und Angst vor den nunmehr feindlichen Soldaten und davor, bestraft zu werden, als Deserteur zu gelten und vernichtet zu werden.
Gesundheitliche und psychische Folgen zeigen sich auf seinem blassem Gesicht: S. 111
Eine passende Gesichtsfarbe, wenn sie dich aufhängen, musst du dir nicht mehr einfallen lasse…
Sein Überlebenswille aber mobilisiert Kräfte, trotz aller der Bedrohung:
S. 115
… und deshalb geht Peter schweißgebadet, keuchend, mit schlurfenden, langgezogenen Schritten durch die Kahlenberger Weingärten, …
In einer Landschaft, die einem „Angsttraum“ ähnelt.
S. 116
… und voller Dreck und Material. Herumfliegendes Papier, zertrümmerte Materialkisten und weggeworfene Ausrüstungsteile. Eine Panzerabwehrkanone mit zerfetzten Lauf ist zwischen die Reben gefahren, unmittelbar davor liegen drei Hilfsfreiwillige mit asiatischem Aussehen, die sich bewußtlos getrunken habe…
Er sieht erhängte Soldaten und empfindet Grauen und Übelkeit. (S. 116)
Todesängste, Einsamkeit, Ohnmacht, Kontrollverlust und persönliche Isolationen waren seine individuellen Kriegserlebnisse.1408 Diese kumulierenden Belastungen mussten zu dauerhaften Stress führen. Sie wirkten sich körperlich aus1409, wurden zu Schatten der Vergangenheit, die Peter in seiner Biographie mit sich trägt und die zu Traumata führt bei ihm. „Traumatische Erfahrungen entstehen in Situationen, die jedes angemessene menschliche Verhaltens- und Verstehensrepertoire überfordern.“1410
Doch auch wenn die destruktiven Kräfte des Krieges Peter viel zumuten, lesen wir nichts von Tränen und Verzweiflung oder von Schmerz und Trauer, weder bei eigenen Verletzungen noch angesichts der getöteten Kameraden. Weinen hieß Schwäche zu zeigen - dabei wissen wir heute: Es ist „eine Form der Selbstregulation, denn über das Weinen findet ein Kind aus der inneren Anspannung heraus und balanciert sich neu aus.“1411 Peter bleibt in einem Ungleichgewicht. Aus der zeitlichen Distanz heraus könnte er darüber sprechen, es gibt aber niemanden, der so wie er im Schützengraben lag, zwischen ihm und Ingrid bzw. seinen Kindern verläuft stets die Grenze des Verstehens.
Peters Zukunftserwartungen sind unsicher:
S.121
… dass alles Gewohnte und Gehabte und was man ihm beigebracht hat von diesem Augenblick an nicht mehr zähl…
Die Flucht aus Wien verdichtet für Peter Kriegsende und persönliche Isolation. Sie wird zu einen Moratorium, an dem Peter über die Vergangenheit und Zukunft reflektieren kann und wo ihm die Sinnlosigkeit des Krieges und die falsche Ideologie seines Vaters offenbar wird. Es folgen „Schuld und Scham über die Verbrechen der Elterngeneration“ aber auch über die eigenen Taten.1412
Peter gehört zur Kohorte der 1930/32 Geborenen und erlebt das für sie Typische: Trennung von den Elternteilen (dies erlebten 60%), Tod der Mutter (8,7%), die Flucht und Bombardierungen und Kämpfe (89%).1413 Ihm stehen niemals schützenden Einflüsse in Kindheit, Jugendzeit zur Verfügung: eine adäquate frühkindliche Eltern-Kind-Bindung, eine dauerhaft gute Beziehung zur Mutter als primäre Bezugsperson, eine beschützende und auffangende Großfamilie, verlässliche andere männliche Bezugspersonen oder ein gutes Ersatzmilieu nach dem Verlust der Eltern.1414
Der Verlust von Heimat, Geborgenheit im Elternhaus und Sicherheit mussten verarbeitet werden, aber viele „damals betroffene Kinder/Jugendlichen hatten bekanntermaßen nie die Möglichkeit, einen Trauerprozess zu durchleben und selbst mit zu gestalten.“1415 Nicht selten wurden die eigenen negativen Erfahrungen „als Zeichen einer inneren ,Bewährung‘ und neu erarbeiteten charakterlichen Stärke “ umgedeutet.1416
Wie ergeht es Peter nach der Flucht? Wir erfahren nicht, was ihm den Impuls für einen Neuanfang gab, die zehn Jahre zwischen 1945 und 1955 lassen sich aufgrund einiger Hinweise im Jahre 1955 nur andeutungsweise darstellen.
In den 50er Jahren fanden Tötungen, die Jugendliche als Soldat an der Front begangen hatten, in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit keine Erwähnung. Man debattierte weder die emotionalen Folgen durch die aktiven und passiven Gewalterfahrungen1417 noch die Konsequenzen für die Entwicklung der Jugendlichen: „Verstörende und isolierende Gewalterfahrungen, die im Krieg erlebt worden sind, konnten in der Nachkriegszeit nicht kommuniziert und der Kern der traumatischen Erfahrung vielfach nicht verbalisiert werden..“1418 Es herrschte der Konsens, über bestimmte Erlebnisse der Vergangenheit nicht zu sprechen. „..der private Bereich der Familie [stellte] in vielen Fällen keinen Ort dar, an dem die eigenen Erfahrungen offen erinnert oder kommuniziert werden konnten.“1419 Ingrids Verweigerung sich einzufühlen und die späteren verbalen Angriffe der Tochter entsprechen dem, wie die Gesellschaft in Österreich und Deutschland mit den Erinnerungen des Krieges umging und beweist, dass die Präsenz der Massenvernichtung in der Nachkriegskultur gering bis gar nicht vorhanden war.
Für die deutsche und österreichische Nachkriegszeit spricht man von einem ,Habitus des Vergessens’1420 - um weiterleben zu können, musste vieles von den Kindern und Jugendlichen seelisch abgekapselt und ,vergessen‘ werden. Diese Sprachlosigkeit ist ein gemeinsames Mentalitätsmerkmal der Jugendjahrgänge im 2. Weltkrieg, man nennt sie: die „schweigende Generation“1421 bzw. „skeptische Generation“ (Schelsky), eine Kohorte, die später wenig Idealismus zeigen wird.1422
Wir können die Leerstellen in Peters Biographie zu dieser Zeit mit Deutungen und spekulativen Geschehnissen füllen, in dem Erziehungsratgeber „Gefährdete Jugend“ von Dr. Hanns Eyferth von 1950 ist zu lesen: „Krieg und Zusammenbruch haben Millionen Heimat und Familie, Besitz und Beruf genommen, sie [die Jugend] lange Zeit ohne Nahrung und Kleidung, ohne Kohle und Wohnung gelassen. Zehntausende wanderten planlos über die Landstraßen, hausten in Lagern, tauchten in Ruinen und Bahnhofsbunkern unter. ...Inzwischen ist manches gebessert: das nackte Leben ist aus Flucht, Hunger und Wintersport gerettet, .die verlassenen Kinder sind zunächst untergebracht. Freilich die Lehrer und Ärzte, die Fürsorger und Heimerzieher beobachten täglich, wie viel Unsicherheit und Verwahrlosung, Not und Gefährdung geblieben sind; sie sehen eine neue Generation heranwachsen, die anders ist als alle früheren, voller Wunden, die noch nicht vernarbt sind und zum Teil kaum ganz heilen werden.“
Die psychologischen Nachwirkungen durch die gebrochenen Familienbiographien1423 stellten eine persönliche Ausnahmesituation für die Jugendlichen dar; gepaart mit unzulänglichen Lebensbedingungen und einem fehlenden inneren Gleichgewicht entwickelten sich Lebensangst und Fehlentwicklungen im Verhalten.1424
Angehörige der Kriegskinderjahrgänge von 1930 bis 1945 waren noch bis vor einiger Zeit der Auffassung, dass sie kein besonderes Schicksal erlebt hätten. Ihr Gedächtnis verleugnete Erlebtes und verharmloste zum eigenen Gunsten das, was affektiv besetzte Erinnerungen betraf. Sie wussten lange Zeit nicht, dass sie kriegstraumatisiert waren, und es redete ja auch niemand darüber. Peter schließt Erinnerungen „in einen Giftschrank“: S. 290
… und obwohl er es satt hat, sich wegen seiner Geburt und seines Jahrgangs und seiner wie in einem Giftschrank weggesperrten Kindheit schuldig zu fühlen, lässt Peter den Vorwurf auf sich sitze…
Der „Kriegskinder-Generation“ schreibt man besonders viel Nüchternheit und Lebenspraxis zu.1425 Sie hielten in der Zeit nach dem Krieg die Erinnerungen durch Arbeit auf Abstand.1426 Auch Peters Orientierung galt dem beruflichen und privaten Fortkommen. Seine „Leidensgeschichte“, (S. 167) hat Peter auch Jahrzehnte später nicht überwunden. Sie wird von Ingrid rekonstruiert und verbalisiert mit den Worten: S. 258
Alle sind gegen mich, die einen schießen auf mich, und die anderen lassen mich im Stich, allen voran die Famili…
Seinen Kindern erzählt er nichts von seinen Erlebnissen in der HJ oder im Volkssturm, stattdessen werden amüsante Anekdoten zum Besten gegeben:
S. 295
-Mein erstes Auto. hab ich euch je erzählt…
-Zehn Mal, Papa. …
-Die Alarmanlage, die ich im ersten Jahr …
-Bei der immer, wenn man eine Tür geöffnet hat, die Hupe losgegangen is…
Beschuldigungen seiner Tochter lässt er an sich abprallen: S.317
- Mit einem alten Nazi und einem Friseuranwärter. Ist es das, was du sagen wills…
„Wenn sich Erlebnisse aus dem Krieg melden, so ist das verbunden mit dem Bewusstwerden vergessener und verdrängter Gefühle.“1427 Die Ähnlichkeit mit der ursprünglichen Situation aktiviert hierbei ein Wiedererleben dessen, was im Krieg erlebt wurde.
Somit könnte die Aversion gegen die Silvesterknallerei eine Prägung und Traumatisierung durch die Kriegserlebnisse beweisen, da Peters schreckhaftes Verhalten sich damit deckt, dass 18,2% der damals im Kriegseinsatz befindlichen Männer sich in Folge von Kriegstraumata als „schreckhaft“ bezeichnen.1428 Ingrid aber hinterfragt die angebliche „Silvster-Symptomatik bei ehemaligen Kriegsteilnehmern. Ihrer Meinung nach ist sie eine Hypochondrie und bietet Peter Gelegenheit zum Rückzug von den Aufgaben innerhalb der Familie, da die „Fehlzündungen der Rennautos“ ihm keine Schwierigkeiten bereiten.
(1970)
S. 241f
Ingrid kann Peters Aversion gegen das Böllerschießen nicht für voll nehmen, schließlich bereiten ihm Fehlzündungen von Rennautos schliche Freude. Ihrer Meinung nach hat Peter von der Silvester-Symptomatik bei ehemaligen Kriegsteilnehmern gelesen … Ausreden. Am zweiten Weihnachtsfeiertag hat Ingrid saubergemacht. Fenster und Türen standen zum Lüften offen, da knallte eine Tür vom Luftzug mit großer Wucht zu, und Peter, der auf dem Sofa eingeschlafen war, bekam einen solchen Schreck, dass er von Sofa fie…
Eltern geben die kulturellen Muster der Gesellschaft und das Familienkapital in Form der psychosozialen Ressourcen an die nachfolgende Generation weiter. Übertragen auf die ,transgenerationale Weitergabe’ der Kriegserfahrung in der Familie heißt das, dass die Zeitzeugen die furchtbaren Erfahrungen an die Folgegeneration, die nach der Epoche aufwächst, überliefern und ihnen damit eine lebensgeschichtliche Hypothek auferlegen.1429 Während man früher glaubte, Kinder würden die Gemütsverfassung ihrer Eltern nicht spüren, weil sie robust und umempfindsam dafür wären, weiß man heute, dass genau das Gegenteil der Fall ist. „Sie spüren selbst jenes Grauen, das ihre Eltern tief in sich vergraben und deshalb nicht mehr in ihrem Bewusstsein haben.“1430
Belastende Erfahrungen/Traumata wurden an die folgende Generation weitergegeben, an die „Generation Kriegsenkel“ (zwischen 1950 und 1970 geboren), die wiederum heute mit den Folgen der Verdrängung zu kämpfen hat. Zusätzlich hat der vom Nationalsozialismus geforderte Erziehungsstil nicht selten nachhaltig gewirkt. „Eindeutig ist, dass von der ersten kriegsbetroffenen Generation (des Ersten Weltkriegs) an bis zu den Enkeln der Kriegskinder des Zweiten Weltkriegs als vierter Generation transgenerationale Auswirkungen zu beobachten sind, die auf einer Kombination von Leitbildern, Erziehungsnormen, belastenden beschädigenden bis traumatisierenden Erfahrungen und neurotischen (Familien-) Strukturen beruhen. “1431
Peter vermacht als Vermittler eines Familiengedächtnisses an die nachfolgende Generation seiner Kindern das Dunkle seines Erlebens. „Weil das Unbewusste zeitlos ist, bleiben die verdrängten Konflikte ebenfalls zeitlos; das heißt, sie können sich durch bestimmte auslösende Momente jederzeit aktualisieren. Ähnliches geschieht mit Traumatisierungen, insbesondere Extremtraumatisierungen - wie Heimatverlust, Vertreibung, Flucht, Vergewaltigung im Krieg, Verlust der ganzen Familie oder einzelner Familienangehöriger. Wenn derartige Traumatisierungen unbearbeitet geblieben sind, werden sie der folgenden Generation auf unbewusstem Weg transmittiert.“1432
Peters Sohn Philipp ist als Kriegsenkel zwischen 1955 und ’75 geboren, gehört damit zur Generation der „Friedenskinder“, und ist betroffen von den väterlichen Traumatisierungen. Kriegsenkel haben einen geringeren Bezug zur Vergangenheit aber eine besondere Beziehung zur Kriegsgeneration, wenn „Eltern [] ihre frühen Erschütterungen und Prägungen nicht wahrnahmen“.1433 Ein Generationskonflikt, verursacht durch das Schweigen der Kriegsgeneration: „Von ihren Müttern und Vätern haben Millionen deutsche Kriegskinder Schweigen gelernt, dieses Schweigen wurde weitergegeben an die Kriegsenkel.“1434
Dies legt Philipp seinem Vater zur Last:
S. 98
Nur hat der im Laufe des vergangenen Jahrhunderte das Reden verlern…
Philipp bleibt auch als ein Kind der längsten Friedensphase, die das Land erlebt hat, der „Tätergeneration“ verbunden1435 und trägt das seelische Erbe seines Vaters. Jedoch sucht er nicht die Auseinandersetzung mit der Familiengeschichte, um Schuld oder Verstrickung aufzudecken. Sie hat für ihn, wie für viele seiner Generation keine Relevanz für das eigene Leben.1436 Nur für 8% ist diese Vergangenheit überhaupt ein Gesprächsthema, für 52% kommt sie so gut wie nie vor. „Vergangenheit ist zunehmend ein Medienfaktor geworden“ und nur noch bezogen auf Parteien, die Geschichtsbilder neu deuten und Revisionsversuche beginnen.1437
Philipp konzentriert sich auf die Zerstörung der Reste aus der familiären Vergangenheit: S. 189
Er wirft im großen Stil weg, was ihm seine Großmutter hinterlassen hat. Angesichts des neu gebrachten und sauberen Containers erscheint ihm diese Vorgehensweise weniger unanständig, wenn auch weiterhin unanständig genug, dass er sich selbst beschwichtigen muss: Denk bloß nicht drüber nach, ob du für dies oder das Verwendung hast oder irgendwann Verwendung haben könntest, …
Erinner dich daran, dass Familiengedenken eine Konvention ist, die von denen erfunden wurde, die es nicht ertragen können, zu sterben oder in Vergessenheit zu gerate…
Fakt aber bleibt: Die „vererbte“ psychische Erfahrungsgeschichte lässt sich zwar verleugnen und bagatellisieren, aber nicht auslöschen.1438
Kriegsenkel leiden nicht an konkreten materiellen Problemen, sie sind in der Wohlstandsgesellschaft groß geworden, wechseln zwischen Ruhe- und Rastlosigkeit und Stillstand. Den Indidvidualisierungsprozess in unserer Gesellschaft gestalten sie besonders intensiv. Sie haben privat mehrere Beziehungen, aber keine Kinder, haben viel gesehen und erlebt, studieren ihren Neigungen entsprechend und kritisieren das materialistische Streben.1439 Viele sehen sich als „Spätzünder“, fühlen sich als Versager und spüren Unsicherheiten.1440 Von ihnen geht eine Suche nach Sinn, nach dem eigenen Weg aus, ein Anhalten und eine Neuausrichtung nach den eigenen Bedürfnissen und Wünschen, um zufrieden zu sein. Dabei wollen sie sich „von dem Optimierungswahn in dieser Gesellschaft“ verabschieden.1441 Man beschreibt ihr Lebensgefühl als „Heimatlosigkeit, das Gefühl, sich nirgends verwurzeln zu können, die eingeimpfte Existenzangst, Bindungsschwierigkeiten, Identitätsverwirrungen und vor allem [dem] Gefühl, bei den Eltern etwas wieder gutmachen zu müssen“.1442 Dazu gehört ebenso „der Glaube, nirgendwo wirklich hin zu gehören, und schließlich die tiefe Sehnsucht, endlich irgendwo an- und zur Ruhe zu kommen.“1443
Kriegsenkel attestiert man eine diffuse Identität1444, unerklärliche Ängste und Unsicherheit bzgl. des eigenen Platzes in der Welt. Recht zu geben scheint dieser Annahme auch das vielfach bei ihnen zu beobachtende Phänomen, selbst im Alter von 40 oder 50 Jahren zwischen beruflicher Rastlosigkeit einerseits und Stillstand andererseits hin- und herzupendeln.1445„Diese Kriegsenkel haben alle geistigen Voraussetzungen, um ein erfolgreiches Leben zu führen, doch bei der Mehrzahl vermittelt sich der Eindruck: Sie sind emotional blockiert, sie stehen privat oder beruflich auf der Bremse.“1446
Transgenerationeller Traumatisierung bei Männern äußert sich in einer existentielle Scham und Verunsicherung: „Die verunsicherten Männer fürchten permanent, zu wenig zu leisten und zu viel zu wollen.“1447
Aus dem Gefühl der Verlorenheit und einem fehlenden Vertrauen heraus sind ihre Beziehungen oft instabil und werden als Last erlebt. Kriegsenkel werden mit der anwachsenden Zahl von Depressionen, Burn-out, Angst- und Panikattacken in unserer Gesellschaft in Verbindung gebracht und haben einen großen Bedarf an psychologischer Hilfe.
Das Gelesene erscheint in vielerlei Hinsicht wie eine direkte Personenbeschreibung von Philipp: Bindungsschwierigkeiten, die existentielle Suche, instabile Beziehungen1448 Was ihn antriebslos und müde auf der Vortreppe sitzen lässt und seinen Tatendrang hemmt, ist „das diffuse Gefühl einer weitreichenden, totalen Isoliertheit, die sich in Sprachlosigkeit und Desinteresse, Kälte und innerer Leere manifestiert und dauerhaftes Glück verhindert.“1449
S. 189
… ignorier die Einflüsterungen, die dir weismachen wollen, dass man’s übertreiben kann und dass einer, der sich so verhält, wie du dich verhältst, ein Leben lang ausgestoßen und einsam bleiben mus…
Ob die Familien- und Lebensgeschichte seines Vaters oder Großvaters seinen Charakter und sein familiäres Desinteresse wirklich erklärt, bleibt zu hinterfragen, das „Erkennen unbewältigter Kriegs- und Schulderfahrungen in der Familie reicht nicht aus, um zu erklären, warum man so oder so geworden ist, denn es gibt keine monokausalen Verbindungen - ein ganzes Netz an Ursachen ist vorhanden.“1450 Aber es würde mit Sicherheit zu kurz greifen, die NS-Zeit und die Folgen des Krieges völlig auszublenden. (ER)
In Ruges Familienroman personalisiert Kurt die Generation, die in der Zeit des Nationalsozialismus
traumatisierende Erfahrungen machte und insofern seine Biographie, das Familienleben und auch die kommenden Generationen beeinflusste.
Kurt flieht während der Naziherrschaft im Alter von 15 Jahren in die Sowjetunion, (war damit unwesentlich älter als Peter und Otto) wo er zwanzig Jahre, zum größten Teil im Gulag und in der Verbannung, verbrachte.
Er erlebt Lebensgefahr, Drill, Unterordnung und ganz extrem: Hunger. Die Realität des Krieges bzw. der Verbannung wird auch bei ihm zu einer biographischen Bruchstelle und wenn wir uns erinnern, dass traumatische Erlebnisse in Situationen entstehen, „die jedes angemessene menschliche Verhaltens- und Verstehensrepertoire überfordern,“1451muss man Kurts Erlebnisse dazu zählen:
S. 182
Jetzt war ihm der weiche Waldboden unter den Füßen auf einmal unangeneh…
In der Ferne glaubte er das Bellen der Bauchsägen zu hören, das unheimliche Brüllen der Baumriesen, wenn sie, sich langsam um die eigene Achse drehend, zu Boden gingen. Und nach einer Weile kamen auch Bilder, flüchtig, zusammenhanglos: Zählappelle bei dreißig Grad minus; der morgendliche Anblick der vereisten Barackendecke, ein Anblick, der verbunden war mit der Erinnerung an die dumpfe Geschäftigkeit von zweihundert Barackenbewohnern, die sich für den Tag fertig machten, an ihre Ausdünstungen, den vom Hunger verdorbenen Atem, den Gestank ihrer Fußlappen, ihres Nachtschweißes, ihrer Pisse. Schwer zu glauben, dass er das alles erlebt, dass er es überlebt hatt…
S. 174
Er hatte gehungert. Und der Hunger hatte ihn dermaßen blöd gemacht, dass er sich manchmal gefragt hatte, ob der Schaden noch reparabel war. Viel hatte jedenfalls nicht gefehlt, dachte Kurt und erinnerte sich … dunkel an merkwürdige, halb wahnsinnige Zustände, die ihn heimgesucht hatten, erinnerte sich an die Stimme, die nach und nach das Kommando übernommen hatte, unbeteiligt, gleichgültig und immer - seltsam - in der dritten Person: jetzt friert er … Jetzt tut es ihm weh … Jetzt muss er aufstehen …
Das Lateinbuch stellte damals für ihn einen Rest von Kultur und Bildung und von der eigenen Persönlichkeit dar:
S. 174
Der Krichatzki kam ihm in den Sinn.: das Lateinbüchlein, das er durchs Lager geschleppt hatte ...Und plötzlich werden die grausamen Erinnerungen wach:
S. 183
Erneut kam ihm Krichatzki in den Sinn, den er in der Brusttasche zum Arbeitseinsatz geschleppt hatte - sein letzter Privatbesitz, abgesehen von einem Löffel. Der letzte Beweis dafür, dass irgendwo da draußen noch eine andere Welt existierte. Deshalb hatte er den Krichatzki (Zigarettenpapier!) nicht gegen Brot eingetauscht, hatte ihn mitgeschleppt in diesen Winter hinein, den schlimmsten, 1942/43 als es nichts mehr zu tauschen gab, schon gar kein Brot, das jeder selbst auffraß, 600 Gramm bei Normerfüllung, das bedeutet, mit allen SchlechtwetterKoeffizienten, acht Festmeter Holz zu zweit, vierzehn Bäume täglich, alles mit der Hand. EinMeter-Bohlen, entastet, bei 90 Prozent gibt es noch 500 Gramm schlechtes, glitschiges Brot, darunter verhungerst du: Bei 400 Gramm schaffst du die 400-Gramm-Norm nicht mehr, dann geht es abwärts, irgendwann kriegst du den Blick, diesen Blick, den sie kriegen, bevor sie am Morgen steif auf der Pritsche liegen, dann tragen sie dich hinaus, so wie du die anderen hinausgetragen hast, an der Wache vorbei, wo sie kurz noch anhalten, und der Wachhabende drückt seine Machorka aus und nimmt den Hammer, Vorschrift ist Vorschrift, und schlägt dir, dem Toten, den Schädel ein…
In Slawa hat er nach der Beendigung seiner Haftstrafe sieben Jahre als ewiger Verbannter verbracht, eine für ihn nutzlose Zeit, in einer entsetzlichen Umgebung:
S. 326
… der Arsch der Welt, dachte Kurt. Es gab wohl kaum einen Ort, der dreckiger, hässlicher, unwirtlicher war als dieses verdammte Nes…
Dort lernt er seine zukünftige Frau Irina kennen und erfährt Menschlichkeit und Freundschaft bei dem jungen Leutnant Sobakin, der ihm, als ihm durch den Ast eines fallenden Baumes 1943 der Fuß zerschlagen wurde, das Leben rettet.
S. 242
… indem er dafür sorgte, dass Kurt, ohnehin am Ende seiner Kraft, nicht auf die Krankenstation kam (wo die Brotrationen noch knapper waren), sondern eine Zeitlang als Nachtwächter an den den rund um die Uhr beheizten Teeröfen arbeiten konnte - eine Beschäftigung, die zudem noch lukrativ war, weil ganz in der Nähe ein Kartoffelfeld la…
Später, nachdem Kurts Strafe in „ewige Verbannung“ umgewandelt worden war, spielten er und Sobakin, inzwischen Hauptmann, in einem Büro der Lagerverwaltung Schach, führten, wie Kurt berichtete, ungewöhnlich freimütige Diskussionen über Gerechtigkeit und Sozialismus, befreundeten sich - und entzweiten sich wieder, als sich beide in dieselbe Frau, nämlich in sie Irina Petrowna, verliebte…
Kurt erlebte das für seine Kohorte Typische: Flucht und die Trennung von den Elternteilen, den Verlust des Bruders, und damit den Verlust aller ihm zur Verfügung stehenden schützenden Einflüsse.
Mit fünfunddreißig Jahren kehrt er aus Slawa zurück, besitzlos und beschämt ob seines Aussehens, erlebt aber, anders als Peter, eine beschützende und auffangende Familie und verlässliche Bezugspersonen:
S. 160
Sie hatten sich Goldzähne machen lassen von ihrem letzten Geld, einen Schneidezahn jeweils, um anständig auszusehen in Deutschland. Ihre guten Sachen hatten sie in einem extra Köfferchen verstaut, um sie nach der tagelangen Zugfahrt erst kurz vor der Ankunft anzuziehen, aber schon als Kurt ausstieg und Charlotte und Wilhelm auf dem Bahnhof stehen sah, kam er sich schäbig vor in seinem sorgsam gestopften Jackett und den weiten Hosen …
Kurt konzentriert sich auf sein berufliches und private Fortkommen, bewältigt Ausbildung und Promotion. Anlässlich einer Reise nach Moskau im Jahre 1966, auf der ihm für sein neues Buch große Hochachtung gezollt wird und er in den Genuss so mancher Privilegien kommt, empfindet er große Genugtuung und Stolz. Er erinnert sich dabei an seine Anfangszeit in der DDR als wissenschaftlicher Schriftsteller, an die Zeit, in der er sich, älter als die anderen Mitarbeiter, sich fremd fühlend, was Umgangsformen und Verhaltensweisen betrifft, einleben und einarbeiten musste.
S. 161
… war der Neubeginn alles andere als leicht gewesen. Wahrscheinlich war er der älteste Doktorant, den das Institut je gehabt hatte. Sein Deutsch war nach zwanzig Jahren in Russland akzentgefärbt. Er wusste nicht, was erlaubt war, und wann man lachen durfte. Aus einer Welt kommend, wo man sich morgens mit dem Mutterfluch begrüßte, hatte er kein Gefühl dafür, wie man den Honoratioren gegenübertrat., geschweige denn für das feine Geflecht der Allianzen und Animositäten im sozialistischen Wissenschaftsbetrieb. … Und noch drei Jahre später war er vor allem als Dolmetscher seines Chefs mit nach Moskau gefahre…
Die verdrängten, unterbewusst gespeicherten Erlebnisse und Traumatisierungen sind zeitlos, und aktualisieren sich durch bestimmte auslösende Momente. Kurt hat sie auch Jahrzehnte später nicht überwunden, nur die längste Zeit verdrängt. Sie werden wach durch zufällige Sinneswahrnehmungen: Man bestellt Kurt in sein Institut, um über die vom ZK der SED geforderte Bestrafung des Mitarbeiters Paul Rohde zu entscheiden. Kurt trifft im Institut auf den Genossen Ernst, der in seiner Rede Schriftsteller wie Rohde zu den revisionistischen und opportunistischen Kräften zählt und dabei: S. 178
… beinahe eloquent, mit dünner, aber durchdringender Stimme (sprach), die sich, wenn er etwas hervorheben wollte, einschmeichelnd senkte - und die Art, wie er redete, kam Kurt auf einmal bekannt vor, oder war es die seltsame Angewohnheit, sein Notizbuch umzublättern, ohne hineinzuschauen …
S. 182
Und plötzlich wusste er e…
Lubjanka, Moskau 194…
Jetzt sah er ihn vor sich. Frappierende Ähnlichkeit, die schmalen Augen, der Bürstenhaarschnitt und sogar die Art, wie er den Aktenordner aufgeschlagen, wie er darin geblättert hatte, ohne hineinzuschaue…
- Sie haben Kritik an der Außenpolitik des Genossen Stalin geäußer…
Der Sachverhalt: Anlässlich des „Freundschaftsvertrags“ zwischen Stalin und Hitler hatte Kurt damals an Bruder Werner geschrieben, die Zukunft werde erweisen, ob es vorteilhaft sei, mit einem Verbrecher Freundschaft zu schließe…
zwei Jahre Lagerhaf…
Wegen antisowjetischer Propaganda und Bildung einer konspirativen Organisation. die Organisation waren: er und sein Brude…
S. 183
Kurt hatte sich an einen Baum gelehnt … Er hatte die Augen geschlossen, seine Stirn berührte die Rinde. Noch immer blitzten vereinzelte Bilder auf, aber allmählich wurde es stiller in seinem Ko…
Als Kommunist versucht er rationale Erklärungen für das Erlebte zu finden und es als eine Notwendigkeit für den Fortschritt in der Geschichte einzuordnen.
S. 184
Nein, er war hier nicht in der Taiga. ..Und war es nicht auch ein Fortschritt, wenn man die Leute - anstatt sie zu erschießen - aus der Partei ausschloss? Was erwartete er? Hatte er vergessen, wie mühsam die Geschichte sich vorwärtsbewegte? Auch die Französische Revolution hatte unendliche Wirrnis nach sich gezogen . .. Warum sollte es der sozialistischen Revolution anders ergehen? Man hatte Chruschtschow abgelöst. Irgendwann kam ein neuer Chruschtschow. Irgendwann kam ein Sozialismus, der diesen Namen verdiente - wenn auch vielleicht nicht mehr in seiner Lebenszeit, in jenem winzigen Abschnitt der Weltgeschichte, dessen Zeuge er zufällig war und den er, verdammt nochmal, zu nutzen gedachte - jedenfalls das, was davon übrig geblieben war nach zehn Jahren Lager und fünf Jahren Verbannun…
Erinnerungen an die Leidenszeit werden ebenfalls wach gehalten durch das Schachbrett und dessen Figuren:
S. 19
die irgendein namenloser Gulag-Häftling irgendwann einmal geschnitzt hatt…
…und beim Erleben der winterlichen Kälte beim Besuch seines Sohnes in Berlin 1979:
S. 303
Der Wind klirrte in den Gerüsten. Die Bügel von Kurts Brille waren so kalt, dass ihm die Schläfen schmerzten. Er nahm die Brille ab, schob den Schal vor die Nase und wunderte sich, wie er das damals ausgehalten hatte: fünfunddreißig Grad minus - das war die Temperatur, bis zu der man sie zum Arbeiten hinausgeschickt hatte in die Taig…
Bei Wind nur bis dreißi…
Kurt vermacht seinem Sohn Sascha das Dunkle seines Erlebens und transmittiert es damit an die nächste Generation, die Kriegsenkelgeneration.
Dessen Reaktion verbalisiert den Generationenkonflikt. Er ist mit dem Thema vertraut, hat jedoch nur einen geringeren Bezug zur Vergangenheit und kann seine Privilegien, die sein Vater ihm vorhält, nicht nachvollziehen:
S. 301
Wenn du mein Leben gelebt hättest, wärst du to…
- Ach, jetzt kommt das, sagte Sascha plötzlich ganz ruhi…
- Ja, jetzt kommt das, schrie Kurt. … Lebt wie die Made im Speck! Deine Mutter besorgt dir die Wohnung! Dein Vater bezahlt deine Autoversicherung …
Sascha zog einen Schlüssel von seinem Bund ab und hielt ihn Kurt vor die Nase. - Hier hast du den Autoschlüsse…
Kurt begreift sein besonderes Schicksal und plant, die affektiv besetzten Erinnerungen und Traumatisierungen seiner Umwelt und seinen Angehörigen in einem Buch mitzuteilen.
S. 174
Manchmal fiel es ihm schwer zu glauben, dass es ihn tatsächlich noch gab. Und dann kam ihm die Vergangenheit vor wie ein Loch, in das er, wenn er nicht aufpasste, wieder hineinfallen konnte. Irgendwann einmal, dachte er sich, würde er das alles Aufschreiben. Wenn die Zeit reif dafür wa…
Die Aufarbeitung der traumatisierten Erlebnisse erfolgt im Alter von achtzig Jahren nach der Auflösung der DDR:
S. 22
Aber dann hatte sich Kurt noch einmal auf seinen katastrophalen Stuhl gesetzt, mit schon fast achtzig, und hatte klammheimlich sein letztes Buch zusammengehämmert. Und obwohl dieses Buch kein Welterfolg geworden war - ja, zwanzig Jahre früher wäre ein Buch, in dem ein deutscher Kommunist seine Jahre im Gulag beschrieb, möglicherweise ein Welterfolg geworden (nur war Kurt zu feige gewesen, es zu schreiben!) -, aber auch wenn es kein Welterfolg geworden war, so war es doch, … ein einzigartiges, ein ,‘bleibendes’ Buch …
25.6 Die veränderte soziale Praxis, mit geerbten Dingen umzugehen
Beim Lesen der Familienromane wird ein Kennzeichen für den Bedeutungsverlusts und der Auflösung von Familie deutlich, wenn wir uns den Umgang der verschiedenen Generationen mit geerbten Dingen anschauen.
Erbe ist grundsätzlich etwas Überdauerndes und Kontinuierliches, etwas, was aus der Vergangenheit kommt und in die Gegenwart übernommen wird, weil es als wertvoll und als wichtig für die Existenzsicherung empfunden wird.1452
Es kann aus Geld- oder Sachtransfers oder aus Familienritualen und -orten bestehen und dient zur „Selbstvergewisserung“ und „der Erinnerung ...der familiären Identität“, es hat die soziale Funktion, einen Verlust zu bewältigen und die Familiengeschichte fortzusetzen.1453 Erbe betont Verwandtschaftsbeziehungen: Es verbindet die verstorbenen mit den lebenden Familienmitgliedern und ist als Träger des Familiengedächtnisses und der Familienidentität familienkonstitutiv.1454
Ein ,Familiengedächtnis’ präsentiert unterschiedliche Zeit- und Generationserfahrungen, gibt Erlebtes, Erinnertes weiter und stellt so den Zusammenhang zwischen Generationen verschiedener historischer Zeiten der Wir-Gruppe Familie her. Zu ihm gehören neben dem materiellen Erbe vage Geschichten und Ereignisse, episodische Fragmente aus der Familienvergangenheit und emotional bedeutsame gut unterhaltende Geschichten, oftmals in unterschiedlichen Versionen erzählt. Sie entfalten Wirksamkeit im Sinne von Tradierung und schaffen durch die Erinnerung Identität und Zugehörigkeit.1455
Gemeinsame Erinnerungen sind bedeutsam, sie halten Familien zusammen und stabilisieren eine Gruppe, weil sich die Mitglieder mit ihnen identifizieren.1456
Gemeinsames Erinnerungsinventar lässt eine Erinnerungsgemeinschaft entstehen „.oft sind es gerade die widersprüchlichen, lückenhaften und überhaupt nebulösen Erzählungen, die es den Zuhörern erlauben, sich die Geschichten zu eigen zu machen, indem sie sie mit eigenen Vorstellungen und Geschichten auffüllen und illustrieren.“1457 (TM)
Geerbte Gegenstände werden bei Familie Buddenbrook über Erzählungen bedeutsam: Die Löffel, das Silbergeschirr, wecken Erinnerungen an das Verhalten der Konsulin während Kriegs als die Franzosen in ihr Haus eindrangen.
S. 23f
„. Immer, wenn ich diese Dinge vor Augen habe“ - und er wandte sich an Madame Antoinette, indem er einen der schweren silbernen Löffel vom Tische nahm - „muss ich denken, ob sie nicht zu den Stücken gehören, die anno sechs unser Freund, der Philosoph Lenoir Sergeant Seiner Majestät des Kaisers Napoleon, in Händen hatte, und erinner mich unserer Begegnung in der Alfstraße, Madame…
„Kurz und gut, man figuriere sich: Es ist ein Novembernachmittag…
(AG)
Als Alma am Lebensende auf ihr Leben zurückblickt, repräsentieren die persönlichen Objekte auf dem Speicher/Dachboden familiäre Bindungen: Ottos Tretauto, Eislaufschuhe, Koffer, Teppiche, eine Wehrmachtsdecke. Sie vergegenwärtigen Ereignisse aus früheren Zeiten, es ...
S. 362
… verklumpen sich die abgelegten Dinge zu einem Grundstoff, einer Materie, die Materie vermengt, zu eingedickter, eingeschrumpfter, ihrer Farben beraubter Familiengeschicht…
Für Philipp bleiben sporadische Erinnerungen beim Anblick von geerbten Wohninventar, wie z.B. der Standuhr im Wohnzimmer, im 18. Jh noch ein Privileg des Landadels, ein Symbol bürgerliche Kultur, Arbeit und Pünktlichkeit. Solch eine Uhr diente wohlhabenden Händlern und Handwerksmeistern als Prestigeobjekt, das bürgerliche Rechtschaffenheit und finanzielle Solidität präsentierte. Sie ist in Philipps Erinnerung verbunden mit Handlungsritualen seines Großvaters. Sozial und emotional distanziert verspottet er dessen Ritual des Uhr-Aufziehens. Er selber lebt jenseits dieser bürgerlichen Zeitordnung, hat unendlich viel Zeit und genießt den Müßiggang, lebt die Langsamkeit.
Die Kanonenkugel weckt Erinnerungen an ein Gespräch mit seiner Großmutter:
S. 12
kVas Philipp jetzt einfällt, ist, dass ihn die Großmutter während einer der wenigen Begegnungen zurechtgewiesen hat, bei der nächsten Ungezogenheit werde man ihn auf die Kanonenkugel setzen und zu den Türken zurückschicken. Eine Drohung die ihm deutlich im Gedächtnis geblieben ist, sogar mit dem großmütterlichen Tonfall und einer Ahnung ihrer Stimm…
S. 186
- Auf dem Sandsteinpodest links von der Auffahrt ist in meiner Kindheit eine Schutzengelfigur gestanden. Möchte wissen, wo die hingekommen is…
Er wehrt sich gegen die Kenntnis von Familiengeschichten, als die Nachbarin sie ihm erzählen will: S.385 :
Sie ist grausam ausführlich in ihren Erinnerungen.. überlegt Philipp, warum er diese gattungsmäßig typischen, eher durchschnittlich anmutenden Kindheitsepisoden nicht hören will und warum sie ihm beliebig vorkomme…
Erinnerungen gehören, das darf man nicht vergessen, zum Unzuverlässigsten was ein Mensch besitzt, Affekte und Motive entscheiden, welche Erinnerungen dem Einzelnen verfügbar bleiben.1458 (ER)
Dies wird erkennbar, als Sascha zu Besuch seines dementen Vaters das Haus seiner frühen Kindheit betritt:
S. 32
Und der neu verglaste und mit allerlei Fensterschmuck ausgestattete Wintergarten sah so fremd aus, dass es Alexander schwerfiel zu glauben, dass er wirklich mit seiner Großmutter Charlotte dort gesessen und ihren mexikanischen Geschichten gelauscht hatt…
Familiäres Andenken kann/könnte gesichert und damit die Familie und das Elternhaus mit seiner Ausstattung symbolisch-kulturell aufwertet werden, doch - das zeigen die Romane - der Umgang mit dem Erbe kann unterschiedlicher nicht sein: vom Gefühl der Verpflichtung und Loyalität mit der Familie bis hin zur Ablehnung und Vernichtung.
Im Bürgertum galt es als Pflicht der Nachkommen und als ein Zeichen von Pietät, das Andenken an die Verstorbenen und dessen Zeugnisse aufrecht und im Gedächtnis zu erhalten.1459
(TM)
Thomas Buddenbrook erhält, als er mit sechzehn Jahren in das Geschäft der Familie eintritt die Insignien:
S. 74
Um seinen Hals hing die lange goldenen Uhrkette, die der Großvater ihm zugesprochen hatte, und an der ein Medaillon mit dem Wappen der Familie hing, diesem melancholischen Wappenschilde, … Der noch ältere Siegelring mit grünem Stein, den wahrscheinlich schon der sehr gut situierte Gewandschneider in Rostock getragen hatte, war nebst der großen Bibel auf den Konsul übergegange…
Erbe ist hier nicht nur das In-Besitz-Nehmen von materiellen Dingen sondern stellt eine Familienkontinuität her, indem einzelne Gegenstände zu Familienreliquien werden und ein Familiengedächtnis und eine Familientradition ausdrücken.1460
Tony Buddenbrook stellt ein Beispiel für die Inkorporation geerbter Dinge dar, die von ihr wie ein Reliquie verehrt werden.1461 Ihre Gedanken kreisen mit Lust und Zwang um die „verlorene Zeit“ und bewirken eine Verklärung der Kindheits- und Familienbilder.
S. 700
Immer, wenn Frau Permaneder bei ihrer Schwägerin vorsprach, zog sie ihren Neffen an sich, um ihm von der Vergangenheit und jeder Zukunft zu erzählen, welche Buddenbrooks, nächst der Gnade Gottes, ihm, dem kleinen Johann, zu verdanken haben sollte. Je unerquicklicher die Gegenwart sich darstellte, desto weniger konnte sie sich genug tun in Schilderungen, wie vornehm das Leben in den Häusern ihrer Eltern und Großeltern gewesen und wie Hannos Urgroßvater vierspännig über Land gefahren se…
In den Romanen begegnen wir neben der sozialen, psychologisch-emotionalen noch folgende Betrachtungsweisen das Erbe betreffend:
- den Blick auf die Funktionalität (Tauglichkeit in der Gegenwart, Benutzung),
- den ästhetischen Gesichtspunkt,
- den materiellen Gesichtspunkt.
Die Protagonisten in den Romanen berücksichtigen in ganz unterschiedlicher Weise die Semantik der geerbten Dinge, deren Image und übersubjektive Dimension (Bedeutung in der Geschichte)1462 (TM)
S. 573f
Und Thomas fuhr fort. Er fing mit den größten Gegenständen an und schrieb sich diejenigen zu, die er für sein Haus gebrauchen konnte: die Kandelaber des Esssaales, die große geschnitzte Truhe, die auf der Diele stand. …
Für Christian steht wie für seinen Bruder ebenfalls der Blick auf die Funktionalität im Vordergrund, da er sich vermählen will:
Christian hatte einige Möbelstücke, eine Empire-Stutzuhr und sogar das Harmonium bekommen, und er zeigte sich zufrieden damit. Als aber die Verteilung sich dem Silber- und Weißzeug sowie dem verschiedenen Speise-Service zuwandte, begann er zu dem Erstaunen Aller einen Eifer merken zu lassen, der sich fast wie Habsucht ausnah…
„Und ich? Und ich? fragte er. „Ich bitte doch, mich nicht ganz und gar zu vergessen…
„Ich wünsche kein Geld, ich wünsche Wäsche und Essgeschirr…
(AG)
Geigers Roman zeigt, wie sehr die heutige Generation der Erben Kontinuität und Tradition des Lebens als eine Illusion, und Erinnerung, Zeit und Gedächtnis als irrationale Hypotheken ansehen:1463
Philipp beseitigt das materielle Erbe seiner Großmutter.
(ER)
Im DDR-Roman verfährt Kurt Umnitzer ebenfalls ,unbürgerlich’: Er krempelt das Wohnzimmer, dessen Möbel an seine Frau Irina erinnerten, nach deren Tod, um, beseitigt die Vitrine, das Telefontischchen und sogar die Wanduhr, um die sich eine besondere Erinnerungsgeschichte rankt.
S. 17f
… auch Irinas Möbel hatte er ausgetauscht, die schöne alte Vitrine gegen irgendein grässliches Möbel aus MDF-Platten; selbst Irinas wunderbares, zeitlebens wackliges Telefontischchen hatte Kurt abgeschafft, und, was Alexander ihm besonders übel genommen hatte, sogar die alte Wanduhr: die freundliche alte Uhr…
Alexander erinnert sich wehmütig an die Herkunft der Uhr und wie er sie zusammen mit seiner Mutter gekauft hatte:
S. 18
… ursprünglich war es nämlich eine Standuhr gewesen. Irina hatte sie, einer Mode folgend, aus dem Kasten genommen und an die Wand gehängt, und Alexander konnte sich bis heute daran erinnern, wie Irina und er die Uhr geholte hatten und dass Irina es nicht fertiggebracht hatte, der alten Damen, die sie von der Uhr trennte, mitzuteilen, dass der Uhrkasten eigentlich überflüssig war.und wie der riesige Kasten, den sie nur zum Schein abtransportierten, aus dem Kofferraum des kleinen Trabbi herausgeragt hatte, sodass das Auto vorn fast die Bodenhaftung verlo…
Familie und Familienbesitz, ob ökonomischer Art in Form von Immobilienbesitz, oder symbolhaft ästhetischer Art, sind eng verbunden. Durch ihn zeigt sich für den Erben überhaupt erst die Existenz und der Wert der Familie; als ein „familiales Symbol“ präsentiert es die eigene Biographie und lässt die Dingwelt in einen engen Zusammenhang stehen. Es steht für die Kontinuität von Familie, indem es, wenn es an die nächste Generation vererbt wird, an die Verstorbenen erinnert.1464
Als Ort und Raum der Erinnerung, in dem sich häusliches und soziales Leben abspielte, steht das Haus stets für eine Sicherheit vor der Außenwelt und für Vertrautheit. Es ist ein wichtiger Teil des eigenen Handlungsraumes, wo man Nähe zu anderen findet, sich in zwangloser Kommunikation entspannen kann ohne erhöhte Aufmerksamkeit zeigen zu müssen (Aufmerksamkeitsentlastung).1465
Diesen Ortsbezug teilt man mit Angehörigen der Familie und je länger die Wohndauer ist, desto größer wird das Gefühl der Geborgenheit. Kommt es zu Unterbrechungen des Zusammenlebens durch Schicksalsschläge oder durch Umzüge wird dem Menschen oft erst die Ortsbindung bewusst: „Persönliche Orte stabilisieren das Selbstgefühl, die subjektive Identität einer Person.“1466
So wie bereits in der ländlichen Welt Grundbesitz durch klare Regeln intergenerationell vergeben wurde und damit ein Führungswechsel auf dem Hof stattfand und sich die Machtverhältnisse änderten - die Eltern wurden nun von den Kindern versorgt - ist es auch in unseren Romanen das Haus, sprich das Zuhause, das als ein Träger der Familientradition eine besondere intensiv affektive Bedeutung hat und im Erbprozess eine Rolle spielt.1467 Für das frühe Bürgertum blieb das eigene Elternhaus mit seinen Einrichtungsgegenständen im Gedächtnis und hatte eine feste und langfristige Verbindung zu der Familiengeschichte.
(TM)
Tony verweist in ihrer Diskussion mit Thomas auf diesen Prozess und konfrontiert ihn mit der Frage nach den Generationenbeziehungen: Das neue Haus von Thomas Buddenbrook in der Fischergrube, laut Verfasser in der parallel laufenden Beckergrube Nr. 52.1468 trägt dazu bei, dass das alte Haus mit den Geschäfts- und Wohnräumen verfällt, und verkauft wird, so dass letztlich das Gebäude als Symbol der Großfamilie aufgelöst ist. S. 582f
„Und. Tom -“ fing sie. an, indem sie zuerst in ihren Schoß blickte und dann einen zagen Versuch machte, in seiner Miene zu lesen. „Die Meubles. Du hast natürlich schon Alles in Erwägung gezogen. Die Sachen, die und gehören. das Haus, wie ist es damit?“ fragte sie und rang heimlich die Händ…
… „Das Haus?“ sagte er. „Es gehört natürlich uns Allen, dir, Christian und mir . und komischerweise auch dem Pastor Tiburtius, denn der Anteil gehört zu Claras Erbe.. ich allein habe nichts drüber zu entscheiden, sondern bedarf eurer Zustimmung. Aber das Gegebene ist selbstverständlich, so bald möglich zu verkaufen“, schloss er achselzuckend. Dennoch ging etwas über sein Gesicht, als erschräke er über seine eigenen Worte.,,…
„Das Haus! Mutters Haus! Unser Elternhaus! In dem wir so glücklich gewesen sind Wir sollen es verkaufen…
(AG)
Bereits Familie Sterk bewohnt das von Richards Eltern geerbte Haus:
S. 71 (1938)
Ein großes Haus. Das war vorhande…
Philipp wird als Teil des blutsverwandten Familienstamms Erbe des Hauses, die laut gesetzlicher Erbfolge leiblichen Kinder, die eigentlich die die Erben erster Ordnung sind, verstorben sind. So erbt der Enkel eine Villa aus dem bürgerliche Milieu als ein starkes ökonomisches Kapital der Familie. Und mit ihr tritt die Familienvergangenheit in sein Leben.
Er eignet sich die Villa jedoch nicht an, konstituiert zu ihr keine Beziehung und Zugehörigkeit. Für Philipp ist es ein Generationenort, in dem Mitglieder der Familie in einer Kette früherer Generationen gelebt haben - und damit unzeitgemäß.
Doch wenn auch Haus und Möbel keine Relevanz für ihn haben und er die Verbindungen und Informationen zwischen den Generationen vergessen will, beginnt bei ihm die Reflexion: Er hört „die Stimmen der Eltern [.| und der Großeltern.“ will das Haus von „Schäbigkeit und Moder“ befreien.
S. 226
Die Stimmen der Eltern hören und die der Großeltern, seltsam nah, aber ausgehölt und unsich…
Mit einem Haus wird Inventar vererbt. Geerbte Dinge sind Erinnerungsträger und haben einen Sinn, der über den ihrer praktischen Verwendung liegt und sie damit polysemisch sein lässt.1469 Vererbte Möbel und Nippsachen stellen nicht einfach nur Konsumgüter oder alltägliche Gebrauchsgegenstände dar, sondern sind Ausdruck eines Lebensstils. Sie tragen die Dimension des Gefühlsmäßigen, repräsentieren die Familienidentität und stellen zum eigenen Lebenslauf eine Verbindung her. Insbesondere Möbel sind nicht nur materielles Gut, sondern auch Träger des affektiven Kapitals, symbolisieren die Kontinuität von Familienbanden. Die Räume, in denen solche Dinge aufbewahrt werden, sind eine eigene kulturelle Sphäre und Kulisse.1470: (TM)
Bei den Buddenbrooks fungieren sie als Indikatoren für die soziale Position eine Erinnerungs- und selbstkommunikative Funktion, um die ausfallenden Personen zu ersetzen - und um sie, je nach Stärke der Bindung, gar als imaginäre Gesprächspartner zu benutzen.1471
Geerbtes kann für die Erben zu einem persönlichen Objekt werden1472 und, unabhängig vom vermeintlichen materiellen Wert, eine subjektive Bedeutsamkeit wegen seiner Verknüpfung von Gegenwart und Vergangenheit besitzen. Es ruft starke emotionale Reaktionen hervor, für die andere Menschen oftmals aufgrund fehlender Kenntnisse kein Verständnis haben.
S. 573f
Und Thomas fuhr fort. Er fing mit den größten Gegenständen an und schrieb sich diejenigen zu, die er für sein Haus gebrauchen konnte: die Kandelaber des Esssaales, die große geschnitzte Truhe, die auf der Diele stand. …
Christian hatte einige Möbelstücke, eine Empire-Stutzuhr und sogar das Harmonium bekommen, und er zeigte sich zufrieden dami…
(AG)
Die weitere Nutzung ihrer bürgerlich-repräsentativen Möbel wäre im Sinne von Alma, so dass es bedeuten würde, dass sie ihren Tod überdauern. Als Frau ist ihr die emotionale Funktion der Erbstücke wichtig:
S. 212
-Mir wäre lieber, wenn die Möbel im Gebrauch blieben, sagt Alm…
Solch traditionellen Symbole des bürgerlichen Wohlstandes wurden zu Zeiten der Buddenbrooks (s.o.) gerne von der nachfolgenden Generation übernommen, heute jedoch entsprechen sie nicht mehr dem modernen Lebensstil und sind ein Beispiel für die Mentalitätsunterschiede zwischen den Generationen. Für die Tochter Ingrid jedoch ist ihr Gebrauchswert gleich Null:
S. 211
… düsterer Plunder, den man früher gemocht hat, wie Klassenkameraden, die sitzengeblieben sind und mit denen man seither nicht mehr rede…
Der ästhetische Gesichtspunkt wird für sie bei der Wahl entscheidend, Richard kommentiert sachlich:
S. 212
- Du musst dich damit abfinden, dass unsere Tochter Stahlrohrmöbel bevorzug…
Geschmack differiert geschlechts- und generationsspezifisch, das zeigt sich bereits in Almas Bewertung ihrer eigenen geerbten Kunstwerke:
S. 362 (1989)
Sie stellt den Karton auf ein schmales Bett hinter dem Treppengeländer, auf mehrere andere Kartons, die von einer großen Mappe getragen werden mit (was war das?) hässlichen Stichen aus dem Besitz von Richards Eltern (Jagdszenen und französischen Modeblätter…
und zeigt sich auch in Philipps und Johannas Reaktion beim Blick auf die Wohnungseinrichtung:
S. 8
Philipp sitzt auf der Vortreppe der Villa, die er von seiner im Winter verstorbenen Großmutter geerbt hat. … Mit Daumen und Zeigefinger schnippt er beiläufig (demonstrativ?) seine halb heruntergerauchte Zigarette in den noch leeren Container und sagt: - Bis morgen ist er voll. …
Johanna streicht mehrmals mit der flachen Hand über die alte, aus einer porösen Legierung gegossene Kanonenkugel, die sich auf dem Treppengeländer am unteren Ende des Handlaufs buckelt. …
Johanna geht auf die Pendeluhr zu, die über dem Schreibtisch hängt. …
(ER)
Für Kurt als promovierten Historiker und Intellektuellen sind die großen BücherSammlungen wichtige Erinnerungsstücke aus seinem Leben: die Nachschlagewerke, die Bücher zur russischen Revolution, die Lenin-Bände und das Schachspiel aus der Zeit der Verbannung. Die Mitbringsel seiner Eltern aus Mexiko hat Kurt in die schwedische Wand in seinem Arbeitszimmer eingefügt; sie repräsentieren Alexanders Kindheit und wecken Erinnerungen:
S. 19
Das ausgestopfte Haifischbaby, von dessen rauer Haut Alexander als Kind beeindruckt gewesen war,... die furchteinflößende Maske lag noch immer mit dem Gesicht nach oben im Vitrinenfach mit den unzähligen kleinen Schnapsfläschchen; und die große, gewundene, rosafarbene Muschel ...Die von Irina gesammelten Möbel hat Kurt nach ihrem Tod Kurt entsorgt. Alexander bedauert dies, weil sie bedeutsame Teile aus der Kindheit darstellten: S. 17f
… die schöne alte Vitrine … Irinas wunderbares, zeitlebens wackliges Telefontischchen ..die freundliche alte Uhr …
Das Arbeitszimmer seines Vaters findet er unverändert vor: Schreibtisch, Sessel und Bücherwand lassen ihn eintauchen in die Zeit, als sein Vater hier produktiv war, seine Bücher schrieb und er selber als Kind die Nachschlagewerke benutzt hat. (S. 18)
Erbstücke verbinden dessen Besitzer mit Vorfahren der Familie, die er selber vielleicht gar nicht mehr erlebt hat und geben ihm nun selber einen Platz in der Generationenabfolge. Familienbesitz, an die Nachkommen vererbt „erlaubt den Versuch einer Suche nach der verloren gegangenen oder imaginierten Familienidentität.“1473 Der Schriftsteller Eugen Ruge selbst erzählt, dass er beim Auflösen der elterlichen Wohnung vieles in die Hände bekam, von dem er wusste, dass er der letzte war, der mit diesen Ablagerungen und Sedimenten der Ge-Schichte noch Erinnerungen und Assoziationen verband. Damit selber ein Teil einer Kontinuität zu sein, war für ihn sinnstiftend.1474
Oftmals erwacht das Interesse an geliebten Objekten erst in späteren Jahren, wenn persönliche Objekte neben ihrem subjektiven Bezug einen Prozess der Symbolisierung erfahren und damit Ideen und Ideale präsentieren und zu Markenzeichen der vormaligen Besitzer werden.1475 (ER)
Das Schachbrett seines Vaters erfährt für Alexander eine ganz besondere Symbolisierung: S. 19
… das aufklappbare, ramponierte Schachbrett mit den Figuren, die irgendein namenloser GulagHäftling irgendwann einmal geschnitzt hatt…
Es stammt aus Kurts Zeit in der Verbannung, und wurde bereits im Alter von vier Jahren für gemeinsame Partien zwischen dem Vater und dem Sohn genutzt.
S. 80
Später Schachspielen. Papa gab ihm zwei Türme vor, trotzdem gewann er immer.…
In den folgenden Jahren stellte das Schachspiel, zum Beispiel zu Weihnachten, eine ganz besondere Gemeinsamkeit zwischen Vater und Sohn und Irina her. Das Spiel wird zu einem familiären Ritual, das eine besonders vertraute Atmosphäre, eine kollektive Gemütlichkeit, schafft.
S. 355
… wenn sie sich in der Sitzecke niederließen wenn die Männer. noch ein, zwei Parti…
Schach spielte…
Es ist der einzige Gegenstand, den Alexander als Erwachsener beim Verlassen aus dem Elternhaus mit sich nimmt, dazu einen Packen Papiere:
S. 28
Zuerst nahm er das alte Schachbrett heraus, das links neben Lenin stand, klappte es auf. Öffnete den Ordner mit der Aufschrift PERSÖNLICH. Griff einen Packen Papiere, gerade so viel, wie in das aufklappbare Schachbrett passte. Legte ihn hinein. Holte eine große weiße Plastiktüte aus der Küche. Steckte das Schachbrett hinein. Ganz automatisch. Ruhig, sicher, als hätte er das lange geplan…
Als ein weiteres Erinnerungsobjekt hat für Eugen Ruge das Lateinbuch des Vaters, das dieser bereits im Lager besessen hatte, eine große Bedeutung. Der Autor besitzt es heute noch.
Die Objekte begleiten ihn auf seine Erinnerungsreise nach Mexiko, wo er durch das Spiel in Kontakt mit den Bewohnern der Pension kommt. Beim Öffnen des Schachbretts, er nennt es: am Tag von Mazunte findet er Kurts Notizen, Briefe, Aufzeichnungen, Erinnerungen an Erlebnisse aus der Vergangenheit. Sie rufen in ihm Bilder wach und werden Grundlage seines Familienromans:
S. 420f
Notizen - wofür? Worüber…
Es gibt auch Notizen, in denen Alexander vorkommt, wobei Kurts Erinnerungen von dem, was er selbst erinnert, erstaunlich stark abweichen …
Was ist das? Aufzeichnungen für einen Roman? Für einen zweiten, in der DDR spielenden Teil seiner Memoire…
Schachbrett und Notizen sind für ihn affektiv besetzt und stellen eine soziale FamilienIdentität her.1476 Sie werden als Repräsentanten der eigenen Herkunft zu einer historischen Verpflichtung und Beauftragung der Verwandtschaft gegenüber, die Familiengeschichte zu erzählen.
All diese erinnerten Dinge sind in sozialen Beziehungen eingebettet und ein Ausdruck kultureller Verhältnisse1477 und bekommen insbesondere dadurch eine spezielle Bedeutung für das Selbstgefühl. Solch materielle Kultur kann zu einem gelungenen Erwachsenwerden beitragen und dazu anregen, sich mit den Verstorbenen auseinanderzusetzen.
Die Voraussetzung dafür ist, dass es individuelle, geschätzte, überdauernde Objekte sind, die in Beziehung zu anderen Menschen stehen, denen sie früher einmal wichtig waren/ sind.1478 In bestimmten Lebenssituationen gewinnen die oben genannten persönlichen Objekte besonders an Bedeutung: in Umbruchsituationen und Krisen, bei kritischen Lebensereignisse, Übergängen in neue Lebensabschnitte, in neue soziale und geographische Kontexte. Es können Trennungen von anderen vertrautem geliebten Menschen oder gar Katastrophen sein. Dann dienen geliebte Objekte dazu, auf die Vergangenheit der eigenen Person und auf uns wichtige Menschen und Orte zu verweisen1479 und helfen der Bewältigung von Anforderungen und der Reorganisation der eigenen Person in der Beziehung zur Umwelt.1480
(TM)
S. 583
Für Tony ist das Haus mit seinem Interieur und den daran hängenden Erinnerungen an Menschen und Ereignisse nach dem Tod der Eltern von besonderer Bedeutung. Was wird ihr Bruder wohl damit anfangen wollen?
S. 586
„. Ja, Tom, das mit dem toten Kapital leuchtet mir ein, so viel Verstand habe ich. Ich kann nur wiederholen, dass du tun musst, was du für richtig hältst. Du musst für uns denken und handeln, denn Gerda und ich sind Weiber, und Christian. nun, Gott sei mit ihm! … Wir können dir nicht Widerpart halten, denn was wir Vorbringen können, sind keine Gegengründe, sonder Sentiments, da liegt auf der Hand.…
(AG)
Alma befindet sich in einer für sie neuen Situation, als Richard im Pflegeheim bzw. im Krankenhaus ist und sie das Haus nun im Alter alleine bewohnt. Die Erinnerungsgegenstände von früher lassen das Leben der verstorbenen Kinder auferstehen.
S. 363
Zwischen den Möbeln und dem Gerümpel hindurch, vorbei an Ottos Tretauto, schiebt sich Alma zum nach Westen gelegenen Fenster…
(ER)
Sascha Umnitzer kehrt mehrere Jahre nach dem Tod seiner Mutter, als sein Vater bereits stark an Demenz erkrankt ist, in sein Elternhaus nach Berlin zurück. Eine Krebserkrankung mit unsicherer Diagnose verändert sein Leben und seinen Blick auf Vergangenheit und Zukunft. Einrichtungsgegenstände und Reisemitbringsel in der elterlichen Wohnung wecken Erinnerungen.
S. 20
Für eine Sekunde tauchte der Gedanke auf, die Muschel mitzunehmen, um sie dort, wo sie herkam, ins Meer zu werfen - aber dann kam es ihm vor wie eine Szene aus einer Fernsehschmonzette, und er verwarf den Gedanken wiede…
Ähnlich wie er, sehen zwar viele Menschen in der heutigen Zeit die Überhöhung von Erbstücken als infantil oder sentimental an, doch gibt es erwiesenermaßen Geschlechtsunterschiede bzgl. der erinnerten Objekte: Frauen bevorzugen Aufzeichnungen wie Briefe, Tagebuch, Geschirr und Möbel und sehen darin die Verbindung zu anderen Personen; ihnen sind Erinnerungen und die emotionale Funktion der Dinge wichtig (Tony Buddenbrook übernimmt gerne die Familienpapiere, S. 757).
Männer dagegen bevorzugen technische Geräte, für sie ist die instrumentelle Funktion von Objekten wichtiger, weniger die Erinnerungsfunktion.1481 (TM) S. 574
„Wer vergisst dich denn? Ich habe dir ja. sieh doch her, ich habe dir ja schon ein ganzes TeeService mit silbernem Tablet zugeschrieben. Für das Sonntags-Service mit der Vergoldung haben doch wohl nur wir Verwendung, und…
„Das alltäglich mit Zwiebelmuster bin ich bereit zu übernehmen“, sagte Frau Permanede…
„Und ich?!“ rief Christian mit jener Entrüstung, die ihn zuweilen befallen konnte, . „Ich möchte doch an de Essgeschirr beteiligt werden! Wieviel Löffel und Gabeln bekomme ich denn? ich sehe, ich bekomme beinahe nichts!…
„Ich wünsche kein Geld, ich wünsche Wäsche und Essgeschirr…
„Aber wozu denn, um Alles in der Welt…
Jetzt aber gab Christian eine Antwort, die bewirkte, dass Gerda Buddenbrook sich ihm eilig zuwandte und ihn mit einem rätselhaften Ausdruck in ihren Augen musterte, . Er sagte nämlich: „Na, mit einem Worte, ich denke, mich über Kurz oder Lang zu verheiraten…
(AG)
Ingrid bevorzugt bei der Mitnahme aus dem Elternhaus
S. 217
….. was nicht beständig ist, Verlegenheitsmöbel, Reserveschränke, alles, was nicht sonderlich anstrengt, was zurückbleibt oder schon immer zurückgeblieben war, alles das, was keiner besonderen Aufmerksamkeit bedarf, keiner Verbundenheit (durch Leim und Krampen). Keines Respekts. Möbel als Sinnbilder für Gleichgültigkeit, zum leichtsinnigen Abwohnen, denkt Richard.
Die Einrichtung aus ihrem früheren Zimmer und aus dem ihres verstorbenen Bruders macht sie sentimental und wird deshalb zur Mitnahme bestimmt … Gegenstände aus der eigenen Kindheit ...
S. 216
… sie freut sich, die Möbel in Ottos Zimmer wiederzusehen, und bittet um die komplette Einrichtung, den kleinen in blassem Türkis gestrichenen Schrank …
Für Philipp scheint lediglich die Pendeluhr im Wohnzimmer des geerbten Hauses aus unerfindlichen Gründen - vielleicht aus Verbundenheit mit den Erinnerungen? - von einem gewissen Interesse zu sein - er vermacht sie nicht seiner Freundin, entsorgt sie aber auch nicht:
S. 11
Johanna fixiert ihn für einen Moment, dann will sie wissen, ob sie die Pendeluhr geschenkt bekommen könn…
- Meinetwege…
- Liegt dir vielleicht doch an dem Zeu…
- Nein. Nur habe ich nicht einmal Lust, es zu verschenke…
- Dann lass es, mein Gott, ich muss die Uhr nicht unbedingt habe…
- Weil du schon eine has…
(ER)
Das ,Sammelsirium’(Irina-Deutsch) ist für Sascha lediglich eine Menge an wertlosen Objekten:
S. 17
… eine wilgewachsene Sammlung abstrusester Mitbringsel und Erinnerungsstücke, die die Furniertapete mit den Jahrzehnten überwuchert hatte …
S. 17
Gegenstände, dachte Alexander … einfach bloß Gegenstände. Für den, der nach ihm kam, ohnehin bloß ein Haufen Sperrmül…
Für seinen Sohn Markus, so ist Alexanders Auffassung, zähle der Gebrauchswert und die Verkäuflichkeit der Gegenstände: Er betrachte die Gegenstände im Haus seines Vaters unter dem Gesichtspunkt der Verkäuflichkeit und des materiellen Werts, eine kapitalistische und marktwirtschaftliche Mentalität - in einer Zeit, in der alle Bereiche der Gesellschaft monetarisiert werden, lerne die junge Generation, so glaubt er, alles nach dem Preis/Geldwert einzuschätzen.
S. 19f
… musste sich vorstellen, wie Markus vor Kurts Bücherwand stand und die Regalbretter mit den Stiefelspitzen anstupste; wie er die Dinge, die sich in vierzig Jahren hier angesammelt hatten, durch seine Hände gehen ließ … Kaum jemand würde ihm den Lenin abkaufen; für das klappbare Schachbrett bekam er womöglich noch ein paar Mark. Einzig das ausgestopfte Haifischbaby und die große rosa Muschel würde ihn vermutlich interessieren, und er würde sie in seiner Bude aufstellen, ohne sich über ihre Herkunft Gedanken zu mache…
Markus aber versucht, die Geschichte der Familie zu verstehen und betont den Anregungs- und Unterhaltungswert der Objekte bei den Großeltern:
S. 271
Nur zu gut erinnerte er sich an die große Muschel im Flur, an die Kobrahaut im Wintergarten … ein bisschen war es wie im Naturkundemuseum in Berlin: Anfassen durfte man auch nicht…
Über das vorzeitige Erbe des Leguans freut er sich:
S. 280f
-Wenn ich tot bin, Markus, dann erbst du den Leguan dort im Rega…
- Cool, sagte Marku…
Dass ihm jemand etwas ,vererbte‘, war ihm noch nie passiert, und er war nicht sicher, ob man sich dafür zu bedanken hatte, ob man sich überhaupt freuen durfte. Das heiße ja, sich auf Wilhelms tod zu freuen. Aber Wilhelm sagte plötzlic…
- Oder nimm ihn am besten gleich mit…
Warum vermacht Wilhelm ein Erbstück seinem Urenkel? Welche Gründe für die Vererbung von Erbstücken gibt es generell?
Die Weitergabe von Familienbesitz ist stets ein Spiegel für die Qualität der Beziehung in der Familie.1482 Der Erbprozess produziert und reproduziert das soziale Verhältnis über die Verteilung der Dinge - wer bekommt was und wieviel?
Erbschaft ist ein Austausch zwischen den Generationen.1483 Sie trägt zum Zusammenhalt bei, „insbesondere, wenn man zusätzlich in Rechnung stellt, dass es auch um Werte geht, vorab Immobilien, die eine hohe symbolische Bedeutung haben können.“1484 (TM)
Buddenbrooks kalkulieren ganz emotionslos mit dem zukünftigem Erbe.
S. 78
„Du denkst, dass wir ja, wenn einmal deine lieben Eltern zu Gott berufen werden, noch etwas Beträchtliches zu erwarten haben, und das ist richtig.…
(AG)
Richards Schwester erhält bereits vor seinem Tod Erbschaft zugesprochen; Alma erschließt sich der Grund dazu nicht:
S. 355
Weshalb er seiner Schwester en Garten in Schottwien überschrieben hat, das hat sich ihr nie erhell…
Nicht selten ist die Übertragung von Eigentum an Bedingungen und Gegenleistungen geknüpft.1485 Dem intergenerationellen Transfer können altruistische Motive zugrunde liegen wie der Wunsch nach emotionaler Nähe, Zuneigung oder Verhaltenserwartungen gegenüber bestimmten Personen oder er geht einher mit bestimmten Vorleistungen und Verhaltensweisen.
Eine Gabe kann edelmütig wirken, aber aus Berechnung gegeben werden, was wiederum jemanden zum Schuldner machen kann, der sie dann als Last empfindet.1486 (AG)
Alma hat ihren letzten Willen im Testament fixiert (soziale Funktion des Erbes): Sie überschreibt
das Haus Philipp, um ihn zu sanktionieren bzw. zur Sesshaftigkeit zu motivieren:
S. 354
… er hat gegen Spekulanten und für mehr Wohnraum demonstriert, … was hältst du davon, dass er irgendwann zur Strafe das haus kriegt und Sissi das Gel…
(ER)
In Ruges DDR-Roman ist die finanzielle Potenz und damit auch die Quantität des Erbes eine andere: Das Vererben von Häusern und wertvollen Relikten war im Sozialismus der DDR keine Option, viele Immobilien waren Volkseigentum, der Erwerb von Häusern aufgrund der geringen Miete für viele uninteressant, so auch für die Familie Umnitzer. Dem Erbe als Zeichen der Erinnerung, wie es Wilhelm seinem Urenkel vermacht, kommt indes durchaus Bedeutung zu.
Im Erbe des Bürgertums besaß etwas eine ganz besondere Bedeutsamkeit: die Familienchronik. Bereits in den vorhergehenden Jahrhunderten gab es bei König und Adel ein Interesse an der Geschichte über die eigene Herkunft. Genealogische Legitimierung und Selbstbestimmung galt als ein Privileg. Erfolgreiche Bürger übernahmen diese Tradition und profilierten durch ihre rekonstruierte Geschichte die eigene Identität.1487
Die Chronik - eine Form von ,Gedächtnis-Kiste‘ mit kostbarem Inhalt und der Familie als Bezugsrahmen, deren Verehrung man bewahrt. Sie entreißt Erinnerungen dem Vergessen und sichert sie vor Verlust und Zerstörung.1488
Man übte mit ihr eine Form der Ahnenverehrung aus, indem relevante familiäre Ereignisse im Laufe der Generationen fixiert wurden. So wurde das Andenken an die Toten bewahrt und, indem man die soziale Beziehung zu ihnen verewigte und konstituierte, quasi die Sterblichkeit überwunden. Man holte die vergangene Familie als emotionale und ethisch verbundene Gemeinschaft zurück und machte sie sinnlich erfahrbar. Ihr Anfang, ihr Alltag und ihr Ende wird zum Beziehungssymbol und Träger normativer Orientierung.
Dieses Familienbuch ist ein Indikator für das Verrinnen der Zeit, in ihm bleiben das Vergangene und das Andenken eine bewahrender Erinnerung.
(TM)
Der Inhalt des Buddenbrookschen Familienbuchs akzentuiert ideelle Aspekte. Es repräsentiert den Traum und die Erinnerung an ein bürgerliches Familienleben mit männlichem Erfolg und weiblicher Mütterlichkeit. Gleichzeitig spiegelt es Leistung in Form von Erfolg und Gewinn wider, lässt Lebenskonstruktionen, Selbstbilder und Bilder vom Anderen auferstehen und versinnbildlicht Personen und Werte, die emotional besetzt sind und die Identität bestimmen. Letztendlich ist es eine Verehrung der Familie, schriftlich verifiziert.
S. 157
Dicht beim Tintenfass lag das wohlbekannte große Schreibheft mit gepresstem Umschlag, goldenem Schnitt und verschiedenartigen Papier. …
Was sie las, waren meistens einfache und ihr vertraute Dinge; aber jeder der Schreibenden hatte von seinem Vorgänger eine ohne Übertreibung feierliche Vortragsweise übernommen, einen instinktiv und ungewollt angedeuteten Chronikstil, aus dem der diskret und darum würdevolle Respekt einer Familie vor sich selbst, vor Überlieferung und Historie sprac…
Die Pflege der Familienchronik zeigt, wie sehr Familienmitglieder die Familiengeschichte als wesentlichen Bestandteil des Selbst ansehen.1489
Tony fühlte sich Zeit ihres Lebens verpflichtet, die Chronologie der Ereignisse fortzusetzen. Nach ihren unglücklichen Ehen überbrückt das Buch die zeitliche Distanz und symbolisiert die glückliche Zeit und eine Welt, die besser als die gegenwärtige war, und die ihr die Flucht in einen Traum erlaubt. Die Chronik wird zum Identitätssymbol1490 und gibt ihrer Biographie Kohärenz und Kontinuität.
S. 158
„Wie ein Glied in einer Kette“, hatte Papa geschrieben, ja, ja! Gerade als Glied dieser Kette war sie von hoher und verantwortungsvoller Bedeutung, - berufen, mit Tat und Entschluss an der Geschichte ihrer Familie mitzuarbeite…
Der Verlust des Elternhauses, der zentralen Personen und der vertrauten bedeutsamen Dinge stehen mit ihrem Leben in einem untrennbaren Zusammenhang und sind für sie ein „kultureller Tod“. Als all das verschwindet, ist die Chronik Beweis und Erinnerung des damaligen sozialen Raumes und lässt den Gedanken der Herkunft aus einer glanzvollen Familiengeschichte wieder auferstehen - entgegen aller Vergänglichkeit.
Praktisch hat das Buch zwar keinen Nutzen mehr, aber es wandelt sich zu einem symbolischen und autobiographischen Objekt und zeigt eine Verdichtung von Lebensgeschichte,1491 in dem die eigene Kindheit heiliggesprochen wird.
„Das einsame und stille Erinnern kann mit bestimmten Handlungen einhergehen, wie den Gegenstand aus dem Schrank zu holen, ihn in der Hand zu halten, ihn vor sich auf den Tisch zu stellen.“1492 Schon das Berühren des Buchs, das Einatmen von Gerüchen erwecken sinnliche Eindrücke und man kann von einer „Auratisierung“/Heiligsprechung dieses Artefakts sprechen, seine Verehrung gleicht dem eines wertvollen Kunstgegenstand bzw. eines Heiligtums mit bedeutungsvollen einzigartigen und kulturellen Status, das nie veräußert werden darf.1493
S. 757
„…einmal in der Woche kommt ihr zu mir zum Essen. Und dann lesen wir in den Familienpapieren -„ Sie berührte die Mappe, die vor ihr lag. „Ja, Gerda, ich übernehme sie mit Dank. -…“
Im Vergleich dazu erleben wir im modernen Roman, dass nicht alle Familien als Erinnerungsgemeinschaft funktionieren und es bei manchen keine Vergegenwärtigung der gemeinsam geteilten Vergangenheit gibt.
(ER)
Eine Gedächtnis-Kiste in dem Sinne, findet Alexander Umnitzer im Arbeitszimmer seines Vaters: ein Ordner mit der Aufschrift PERSÖNLICH, den er bereits als Jugendlicher neugierig betrachtet aber nie zu öffnen gewagt hatte. Bei seinem letzten Besuch greift er einen Teil des Inhalts, Zettel, Notizen, Kopien von Dokumenten und Briefe seines Vaters an Irina, steckt ihn in das Schachspiel - und nimmt es mit auf seine Reise. (S. 22/28)
Spuren der Vergangenheit findet der Protagonist auch in Form von Fotos. Sie zeigen ihm intime Ereignisse, verkörpern insofern Familiengeheimnisse und könnten für die Eltern kompromittierend sein. Das Wissen um diese Fotos führt bei Sascha zu einer Stärkung der Familienbande, er bemüht sich um deren Beseitigung und vernichtet sie, um den Ruf der Familie zu bewahren.
Fotos zeichnen sich per se, ebenso wie Briefe, durch eine Erinnerungsfunktion und einen Personenbezug aus. Sie enthalten als bildliche Zeichen Gesichter, informieren über das Aussehen der Personen, deuten Ereignisse an und erinnern an die Vergangenheit. Meistens kommt Fotos, an einem sichtbaren Ort platziert, eine wichtige Bedeutung im Kontext der Familie zu. Sie stützen das Gedächtnis des einzelnen in Bezug auf eine bestimmte Begebenheit, an die sich erinnert wird, oder an die Bedeutung einer Person. (AG)
Almas Erinnerungsfotos haben für sie Reliktcharakter: Sie zeigen ihre Kinder und ein bedeutsames politisches Ereignis aus Richards Ministerzeit, als er mittels Schaffung von Elektroenergie zum Wohlstand Österreichs beitrug:
S. 361
An der Wand das gerahmte Foto von Richard und der Familie Chruschtschow auf der Staumauer von Kaprun. Fotos von den Staustufen an der Dona…
Philipp findet Fragmente (Fotos), die ihn eigentlich ebenso wie die Uhr zu einer Auseinandersetzung mit der Familie anregen könnten: Familienmitglieder sind auf ihnen gruppiert wie in einer bürgerlichen Familie des 20. Jahrhunderts. Sie ziehen Philipps Aufmerksamkeit auf sich und weisen eine biographische Relevanz auf.
S. 135
Er betrachtet sich eine Weile im Spiegel. Dann geht er dazu über, sich vor die Reihen der Fotos zu stellen, die in dem Zimmer an den Wänden hängen: teilweise über dem Bett, teilweise über dem Toilettentisch, alle vor demselben Hintergrund des grünen, auf die Wände gewalzten Kartoffeldruckmusters. In ovalen, runden, viereckigen hufeisenförmigen Rahmen, von Porzellanefeu und Metallrosen umschlossen …
S. 135f
… all die vertrauten und weniger vertrauten Gesichter, die ganze zerstreute, versprengte und verstorbene Familie. Philipp erkennt sie alle, in allen Alter…
Er fragt sich, ob seine Angehörigen auch ihn erkennen würden, Philipp Erlach, sechsunddreißig Jahre alt, ledig. …
Ist ja alles schon ewig her, redet er sich zu, …
Philipp betrachtet zwei gesondert gehängte Fotos:
5. 9f
… die links und rechts der Pendeluhr arrangiert sind, ebenfalls über dem Schreibtisch. …
- Wer ist das? fragt sie zwischendurc…
- Das rechts ist Onkel Ott…
Das andere ist ein Foto seiner Mutter und es berührt ihn emotional:
Zum linken Fotos sagt Philipp nichts, Johanna muss auch so Bescheid wissen. Aber nimmt das Foto von der Wand, damit er es aus der Nähe betrachten kann. Es zeigt seine Mutter 1947, elfjährig, abseits der Dreharbeiten zum Film ,Der Hofrat Geiger', wie sie der Donau beim Fließen zusieht. …
- Wollte deine Mutter auch später noch Schauspielerin werden? fragt Johann…
- Ich war zu jung, als sie starb, dass ich mich mit ihr darüber unterhalten hätt…
Und er weiß auch nicht, wen er statt seiner Mutter fragten soll, denn sein Vater schaut ihn großäugig an, und er selbst besitzt nicht die Entschiedenheit, weiter zu bohren, vermutlich, weil er nicht bohren will. Zu unangenehm ist es ihm, dass er von seiner Mutter das allermeiste nicht weiß, beklemmend, wenn er sich den Aufwand an Phantasie ausmalt, der nötig wäre, sich auszudenken, wie die Dinge gewesen sein könnte…
In einem fiktiven Klassenfoto fügt er seine Wissensfragmente von den Familienmitgliedern zusammen und synchronisiert deren historische Zeitläufe. Dabei zeigt sich ihm die Vergänglichkeit des Lebens und es ergreift ihn. Er fühlt Leere und Haltlosigkeit. 1494
S. 15f
Er malt sich ein fiktives Klassenfoto aus …
Was ist aus ihnen geworden, aus all diesen Toten, die täglich mehr werden. Das Mädchen mit den Zöpfen, die Kleine, … Der Bursch? Den hatten wir schon, ebenfalls türseitig, in der Bank dahinter. Ein netter Kerl, wenn auch nicht ganz der richtige zum Heiraten. …
Und der da, in der ersten Bank der Fensterreihe: Das bin ich. Ich bin auch einer von ihne…
Neben den Fotos sind es zumeist Briefe, die eine Begebenheit aus der Vergangenheit vergegenwärtigen.
(AG)
Dass sie Familiengeheimnisse und eine ,dunkle‘ Seite der Familiengeschichte verkörpern können, erlebt Alma, als sie in Richards Briefen dessen außereheliches Verhältnis aufdeckt. Sie entscheidet sich aber nicht dazu, sie endgültig zu vernichten, sondern sie auf dem Dachboden, dem Ort der Erinnerung, aufzubewahren: S. 356Geheimnisse, die er gut gehütet ha…
S. 360f
Nach einer Weile wird es ihr zu bunt, und sie beschließt, der Gastein-Angelegenheit symbolisch ein Ende zu bereiten, indem sie Richards Korrespondenz mit Nessi in den Dachboden träg…
In der vierten Lade, die Alma öffnet, finden sich - zum wievielten Male? - die Briefe von Nessi und Hermann, der lieben Verwandtschaft. Ohne nochmals hineinzublättern, wirft Alma den Packen in den Karton und, damit es sich lohnt, auch diverse andere Briefe an Richard, dazu etliche Aktenordne…
Bzgl. dieser Erinnerungsobjekte ist Philipps Verhalten ambivalent: Nach der anfänglichen Entsorgung und Distanzierung folgt der Wunsch, sie zu lesen: S. 136
Er findet sogar den Mut, die Nachtkommode der Großmutter zu öffnen, die vollgestopft ist mit Papierkra…
Er zieht die Schubfächer mit einer gewissen Gleichgültigkeit heraus, in einem fast neutralen Raum, eher flüchtig und doch im Bewusstsein, dass er hier einer Möglichkeit gegenübersteht, vom Fleck zu kommen (wie Johanna es ausdrücken würde). Er hingegen würde es nicht so ausdrücke…
Als Schriftsteller denkt auch er, wie Eugen Ruge, an das traditionelle literarische Ritual, aus dem Fundus der Vergangenheit einen Roman zu rekonstruieren. Es soll ein „Roman des Vergessens“ sein, aber letztendlich verweigert sich Philipp des Schreibens. Statt Recherchen anzustellen, denkt er sich spaßeshalber eine absurde Geschichte über die Kanonenkugel im Treppenhaus aus: S. 52
Er würde die Lebensläufe der K'nder synchron entwerfen … Im ersten Raum des Kellers würde der mächtigste Schreibtisch aufgebaut, für die Lebensgeschichte eines Großvaters mit nur schwer bestimmbarer Anzahl an Ur-Präfixen. …
S. 55
Obwohl er Freude an diesen Entwürfen hat, ist Philipp unsicher, ob sie ihm weiterhelfen. Vielleicht sind es ja och nur Spinnereien, die sich auf nichts gründen …
S. 9
- Ich lese gerade, was du über deine Urgroßeltern und die Herkunft der Kanonenkugel schematisierst. … Aber ich muss dir auch ins Gedächtnis rufen, dass zumindest dein Vater noch leb…
- Nur hat der im Laufe des vergangenen Jahrhunderts das Reden verlern…
- Und deshalb drehst du dir lieber deine eigenen Geschichte…
Philipp hat zwar die Chance, geerbte Familienerinnerungen und deren Erinnerungsobjekte in seine Wirklichkeit der Gegenwart zu integrieren, ihnen einen Emotionswert zu verleihen, vergibt diese jedoch aus „familiärer Gleichgültigkeit, weil für ihn „Familiengedenken eine Konvention ist, die von denen erfunden wurde, die es nicht ertragen können, zu sterben und in Vergessenheit zu geraten.“(s.o. ) Erinnerungsarbeit zu tätigen, bleibt für in eine lästige Pflicht. So wie die Familie für ihn als Blutsverwandter keine emotional und ethisch gebundene Gemeinschaft darstellt, sind auch die geerbten Gegenstände für ihn weder affektiv besetzt noch Beziehungssymbole oder Träger normativer Orientierung, geschweige denn Träger der Familiengeschichte und identitätsbestimmendes Beziehungssymbol.
Philipp verweigert sich gänzlich der Vergangenheit, indem er historische Stücke entsorgt. „Er fühlt sich außerstande, als Familienchronist die Dokumentation einer untergegangenen Kultur zu leisten. Denn dann müsste er vielleicht sein künstlerisches Scheitern an der Realität eingestehen.“1495
Die Vergangenheit verschwimmt, die Chronologie geht bei den Protagonisten verloren, es bleibt nur noch Ungenauigkeit über den Verlauf der Vergangenheit.
S. 8
Johanna streicht mehrmals mit der flachen Hand über die alte, aus einer porösen Legierung gegossenen Kanonenkugel, die sich auf dem Treppengeländer am unteren Ende des Handlaufs buckel…
- Woher kommt die? will Johanna wisse…
- Da bin ich überfragt, sagt Philip…
- Das gibt’s doch nicht, dass die Großeltern eine Kanonenkugel am Treppengeländer haben, und kein Schwein weiß wohe…
Oftmals gibt es wie in Geigers Roman, Orte, z.B. Keller und Speicher, an denen symbolische Ressourcen zu finden sind, nutzlos gewordene Objekte aus vergangenen Zeiten aber wertvolle Erinnerungen für den Besitzer. Hier versammelt sich die Vergangenheit in symbolischer Form. Philipp findet dort Fragmente der Existenz seiner Großeltern, seiner Mutter und seines Onkels Otto.. „Das Aufräumen eines Speichers gleicht dem Kramen in Erinnerungen. Stadien der eigenen Vergangenheit und der Vergangenheit der Vorbewohner und vergangener Generationen können rekonstruiert und dem Gedächtnis wieder übereignet werden.“1496
Der Dachboden erscheint wie der „externe Speicher des Familiengedächtnisses, an dem affektbesetzte Erinnerungsstücke abgelegt werden.“1497 Die dortigen Objekte bezeugen eine Kontinuität zur Vergangenheit und tragen biographische Informationen, werden zwar nicht mehr benutzt, assoziieren aber bestimmte Ereignisse, Personen, Orte und laden zur Reflexion und zum Nachdenken und zum Erinnern ein, z.B. emotionale Erinnerungsstücke wie das rote Tretauto von Otto oder Eislaufschuhe von Ingrid.
Aber gleichzeitig befindet sich dort alles, was die Familie im Innersten zerstörte:
Richard entdeckt bei einem Besuch des Dachbodens das Bett des Hausmädchens, dessen Existenz beweist, dass der Ehebruch nie von Richard zum Ausdruck gebracht oder verarbeitet wurde1498:
S. 222
Erst jetzt fällt Richard auf, dass das Bett, neben dem er steht, aus der ehemaligen Kammer des Kindermädchens stammt. … sonderbar, dass er einen Augenblick lang auf dem Bett ein rothaariges Mädchen von zwanzig Jahren knien sieht, in völliger Nacktheit, …
Alma erinnert sich beim Anblick der Wehrmachtsdecke (S. 362) auf dem Dachboden an Ottos Mitgliedschaft in den nationalsozialistischen Jugendorganisationen und an seine tödliche Kriegsbegeisterung.
Der Dachboden der Sterkschen Villa ist im Jahr 2001 verschmutzt und kaum noch erkennbar und undurchlässig für Erinnerungen. Für Philipp verkörpern die verstaubten Gegenstände eine vergangene Zeit, die Bedeutung der Gegenstände ist ebenso verblasst wie die Familiengeschichte selber, man holt sie zwar hervor, richtet sie aber nicht her.
Der Wert des Mobiliars ist unter dem Kriterium der Funktionalität, einem wichtigen Merkmal der Konsumgesellschaft, gering „...[er] mißachtet eine Wertstruktur, die sich auf Alter, Dauer und Kontinuität stützt.“1499
S. 7
Nach einigem Zögern warf er sich mit der Schulter gegen die Dachbodentür, sie gab unter den Stößen jedesmal ein paar Zentimeter nach. Gleichzeitig wurde das Flattern und Fiepen dahinter lauter. Nach einem kurzen und grellen Aufkreischen der Angel, das im Dachboden ein wildes Gestöber auslöste, stand die Tür so weit offen, dass Philipp den Kopf ein Stück durch den Spalt stecken konnte. Obwohl das Licht nicht das allerbeste war, erfasste er mit dem ersten Blick die ganze Spannweite des Horrors. Dutzende Tauben, die sich hier eingerichtet und alles knöchel- und knietief mit Dreck überzogen hatten, Schicht auf Schicht wie Zins und Zinseszins, Kot, Knochen, Maden, Mäuse, Parasiten, Krankheitserreger …
Philipps Entrümplung und Entsorgung der Erinnerungen zeigen eine offensivpragmatische Haltung, die familiäre Vergangenheit wandert auf den Müllhaufen der gegenständlichen Geschichte.
In diesem Verhalten erkennt Philipp eine Verbundenheit mit Indianerstämmen,
S. 189
… in denen der das größte Ansehen gewinnt, der seinen Besitz am gründlichsten vernichtet…
(ER)
Neben all den erwähnten Gegenständen haben Erinnerungsorte, Städte und Länder, eine Relevanz im Familiengedächtnis. Durch deren Besuch wird in Ruges Roman die Verbindung Saschas zur Großmutter vergegenwärtigt und symbolisch aufrecht erhalten (s.o. Kapitel ,Reisen’), eine reflektierte Bindung durch erzählte Ortsbezüge. Die Erlebnisqualität jedoch bleibt an diesen Orten gering. Die Reise, die er als eine Erinnerungsarbeit unternimmt, desillusioniert ihn:
S. 105
Immer hat er sich die Stadt bunt vorgestellt. Aber das sogenannte historische Zentrum ist gra…
S. 108
… dann ist er am Ziel: die Tapachula. Eine schmale, baumlose Straße. Anstelle von Bäumen: Straßenlaternen und Masten … von dort oben hat seine Großmutter heruntergeschaut, aber auf dem Foto, obwohl es schwarz-weiß war, hat das alles irgendwie grün ausgesehen. Irgendwie tropisch und großzügi…
26. Zusammenfassung
Das Ziel meiner Arbeit war eine Gegenüberstellung der Familienromane, schwerpunktmäßig mit der Fragestellung, wieviel Bürgerliches in den (modernen) Romanfamilien und letztendlich auch in unseren heutigen Familien zu finden ist. Kam den Lesern bei all den Informationen über das Bürgertum nicht oft der Gedanke, den so mancher Rezipient nach dem Lektüre des Buddenbrooks-Romans hatte: „Genau wie bei uns, das habe ich auch in unserer Familie erlebt!“?
Die Romane sind ein Ausdruck dafür, wie sehr manche Elemente der bürgerlichen Denk- und Lebensweise lebendig geblieben oder aber auch nicht mehr vorhanden sind. Zwischen 1900 und 2000 gab es eine Verabschiedung von bestimmten Familien- und Verwandtschaftsbildern - dem bürgerlich-romantischen Ideal der stabilen Kernfamilie wird bereits bei den Buddenbrooks adieu gesagt - hin zur Entwicklung neuer familiärer Ordnungen und Strukturen durch einen Wandel der Geschlechtsverhältnisse. Die Familien in den modernen Familienromanen sehen anders aus, statt einer chronologischen Familiensage gibt es in ihnen ein Zeitgefüge, in dem Großeltern jung werden und der Verfall integriert wird, doch ihr Familienleben erlaubt durchaus einen Wiedererkennungseffekt: Glück und Unglück gehören seit jeher zur Familie, Querelen und Beziehungs- und Familiengeschichten scheinen ,normal‘ und der Mythos vom Nachfolger, der schwächer wird, ist beständig in Fiktion und Wirklichkeit anzutreffen. Trotz allem ist in der modernen Familie der „harmonische Binnenraum der Familie keineswegs endgültig ausgehöhlt oder zerstört..“1500
Familiensoziologen haben schon oft das Ende der Familie vorausgesagt, doch widerspricht solch eine pessimistische Prognose dem, dass die Familie als Lebensform trotz sozialen Wandels für viele Menschen attraktiv bleibt.1501 Wie früher wird auch heute laut Umfragen, die Vater-Mutter-Kind-Familie als ideale Norm imaginiert, als ein Ort der Harmonie, der Liebe und des Vertrauens, der gelebten Gemeinschaft, die zum Umgang mit anderen sozialisiert.1502 In der Familie allein, so ist die Auffassung der Mehrheit, kommen gegenseitiger Beistand und emotionale Zuwendung zum tragen.
Es gab und gibt eine Transformation von Mustern und Strukturen von Familien: Die Patchwork-Familien und „Fortsetzungsfamilien“ (der heutigen und früheren Zeit) zeigen zwar neue Konstellationen, ein Nacheinander von nachfolgenden Vätern und Müttern, orientieren sich aber weiterhin am Bild der bürgerlichen Familie als Gefühlsgemeinschaft. Der Einfluss bürgerlicher Werte mit dem Wunsch, einer „standesgemäßen“ Verheiratung der eigenen Kinder, nach Eigentum, insbesondere in Form eines Eigenheims oder nach Selbständigkeit. (start ups) sind allemal anzutreffen.
Die Erziehung in der Familie gilt seit dem 19. Jh. als Voraussetzung für ein Leben als Staatsbürger, und in allen Familienromanen ist sie d i e Sozialisierungsinstanz schlechthin1503 Kindern wird ans Herz gelegt, die Bedeutung von Bildung und guten Umgangsformen zu erlernen, musikalische Früherziehung und Programme, die heute jedem Kind das Spielen eines Instruments nahebringen, sollen sie letztendlich zu einem intelligenten, erfolgreichen und kulturell interessierten Menschen erziehen. All das ist ein Vermächtnis des Bürgertums!
Bürgerlichkeit wurde letztendlich zum zentralen Fundament unserer Gesellschaftsordnung, liberale politische Prinzipien haben sich ebenso durchgesetzt wie die Werte Besitz, Leistung, Selbständigkeit und Bildung.
Aufgewertet worden ist das Leistungsprinzip als ein essentieller Bestandteil der Bürgerlichkeit, was zusammenhängt mit der Aufstiegs-Orientierung durch formale Bildung und einer bürgerlichen Lebensweise - beides ist in den modernen Familienromanen erkennbar. Verbürgerlichung als ein Prozess hält heute noch an und beschreibt den Prozess, in dem ein Angelernter zum Facharbeiter und zum Meister auf lange Sicht aufsteigt1504, oder wie in den Romanen: Vom Architekturstudenten ohne Abschluss zum Experten für Straßenkreuzungen (AG) oder vom Geschichtsstudenten ohne Abschluss zum erfolgreichen Literaten (ER).
Im Arbeitsleben gelten heute wie früher die Normen einer bürgerlichen Leistungsgesellschaft: Arbeitsdisziplin, Kleiderordnung und betriebliche Hierarchie. In bürgerlichen Berufs- und Tätigkeitsbereichen haben Kinder aus wirtschafts- und bildungsbürgerlichen Elternhäusern oftmals Wettbewerbsvorteile: Die Rekrutierungmuster von Leitungspositionen in großen und mittelständischen Unternehmen sind nicht selten exklusiv für Kinder aus dem gehobenen Bürgertum und Großbürgertum, die mit den Kleidungs- und Verhaltungscodes vertraut sind, Sprachfertigkeit beherrschen und ein entsprechende persönliches Auftreten zeigen.
Traditionelle Formen von Bürgerlichkeit in Habitus und im Lebensstil mit seinen Statussymbolen haben sich im Wirtschaftsbürgertum eher als im Bildungsbürgertum, dem Protagonistenkreis der modernen Familienromane, erhalten.1505 Hier überlebte das Bürgertum als ein Lebensstil mit einem Ensemble von Werten und Orientierungen, Konventionen und Sozialisationserfahrungen, die „weiterhin einen distinkten
683 neubürgerlichen Lebensstil, vor allem einen klassenspezifischen bürgerlichen Habitus hervorbringen.“1506
Bildung hat, auch wenn sich der verbindliche Bildungskanon auflöste und bildungspolitische Reformen immer wieder der Zeit angepasste Lernziele und -kompetenzen propagieren, heute für die Menschen einen größeren Stellenwert als im 19. Jahrhundert. „Orientiert man sich am Akademikerprivileg und an den hierdurch beschriebenen bürgerlichen Berufen, steht die starke Expansion gerade in den klassischen Positionen während des 20. Jahrhunderts außer Frage. Auch durch neue, akademisch definierte Positionen gewann insofern das Bürgertum durchgehend an gesellschaftlichen Einfluss.“1507 Im Bürgertum war/ist der Wille ausgeprägt, die Kinder zur höheren Schule zu schicken und studieren zu lassen. Konnten im 19. Jahrhundert Akademiker erwarten, eine gesicherte „bürgerliche Stellung“ zu erhalten, ist gerade die heutige Bildungs-Inflation ein Grund für die Krise des Bildungsbürgertums, denn im Vergleich zur kleinen Bildungselite des 19. Jahrhunderts ist die Studierquote heute um ein wesentliches höher, wodurch die Bedeutung eines Bildungspatents sinkt. Die Mengenverschiebung führte zur Verdrängung von Nichtakademikern und verringert die Exklusivität und das Sozialprestige der Berufe (Lehrer, Pfarrer), die dem Bildungsbürgertum ehemals eigen waren.
Für Arbeitnehmer, die in der Regel in Büro- und Verwaltungsumgebungen tätig sind, die hauptsächlich auf intellektuellen Fähigkeiten basieren, gibt es inzwischen den Begriff „White Collar Workers“, er impliziert als Arbeitskleidung weiße Oberhemden bzw. generell helle, schmutzempfindliche Garderobe. Solch eine Tätigkeit ist mit einem höheren Bildungsstand und typischerweise mit höheren Gehältern und Sozialleistungen verbunden.
Eine bildungsbürgerliche Tradition in den kulturellen Bereichen setzt sich fort, es gibt weiterhin die Hochschätzung traditioneller Bildungsgüter wie Theater, Museen, Literatur.1508 Das Angebot und der Besuch von Veranstaltungen der Hochkultur, wie z.B. Theateraufführungen, Klassik-Konzerte und Kunstausstellungen oder literarische Lesungen und Buchbesprechungen werden von einem bürgerlichen Publikum wahrgenommen. Die bürgerliche Selbstorganisation der Kultur aber wurde abgelöst durch die Finanzierung von Seiten der staatlichen Kulturbürokratie. Als Staatsbürger und Steuerzahler finanziert der Einzelne die Kultur und wird zum Kunden der Kultur.
Reinlichkeit und hochpreisige (Marken-)Kleidung gehören heute wie damals zur bürgerlichen Lebensführung, ebenso der Besitz von Immobilien, „der Traum vom Eigenheim“, der inzwischen in einem Großteil der Bevölkerung eine immense Bedeutung hat und politisch gefördert wird.
Anders als früher übernimmt heute der Sozialstaat die Aufgaben im Bereich der Wohltätigkeit, die früher dem Bürgertum durch privates Engagement eigen waren; hatte die damalige Honoratiorengesellschaft freiwillig Ehrenämter übernommen, so ist heute ein derartiges Engagement im karitativen und künstlerischen Bereich gefragt.1509
Das Bürgertum überlebte im 20. Jahrhundert als ein Lebensstil, den heute auch nichtbürgerliche Schichten führen. Bürgerlichkeit selber hat sich verallgemeinert: Verhaltensformen und Denkweisen des früheren Bürgertums müssen nicht mehr status- und klassenbezogen sein sondern sind allgemein verfügbar geworden. „Entscheidend sind dabei die rechtliche Universalisierung bürgerlicher Werte zur staatsbürgerlichen Gleichheit durch den demokratischen Verfassungsstaat und die Angleichung der wirtschaftlichen Lebensverhältnisse der modernen Arbeitnehmerschaft durch den modernen Wohlfahrtsstaat.“1510
Die Zäsur von 1989/90 mit dem Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa und der Wiedervereinigung in Deutschland erscheint als ein Triumph klassisch bürgerlicher Prinzipien.1511 Privates Unternehmertum, Markt und Wettbewerb haben für Wohlstand im Westen gesorgt, die sozialistische Planwirtschaft hingegen hat versagt.
Die modernen Familienromane mit ihren Familien aus dem Bürgertum geben insofern in vielerlei Hinsicht eine bürgerliche Kultur wieder, die seit dem 19. Jahrhundert sich zwar gewandelt, erweitert hat, aber nie verschwunden ist. Insofern können wir der Reaktion der ersten Leser des Buddenbrook-Romans nur beipflichten: „... genau wie bei uns!“1512
27. Nachwort - Persönliche Anmerkungen
„Wenn du nie vergisst, woher du kommst, weißt du immer, wohin du gehen musst.“ (Jüdisches Sprichwor…
Jedes Buch beginnt mit dem ersten Satz und ist eine Expedition, deren Ziel am Anfang unendlich weit entfernt scheint. Ich wusste nicht, was mich erwarten und auf was ich stoßen würde. Aber ich wusste auch, dass man immer irgendwann ans Ziel kommt, solange man einen Satz nach den anderen und eine Seite nach der anderen setzt. Es ist alles eine Frage der Beharrlichkeit - Mein Schreiben über mehrere Jahre.
Als Gewohnheitsleserin des Genres Familienroman gaben sie mir bereits früh Lösungshilfen und das Gefühl, allgemein Menschliches zu lesen und es selber zu erleben. Während des Studiums im Fach Deutsch wurde dieses Genre und die Gegenüberstellung einzelner Familienromane zu meinem Herzensthema, dann folgte die Berufstätigkeit und mein eigenes Familienleben, und all das ließ keine Zeit, sich mit ausgezeichneten Familienromanen intensiver und auf wissenschaftlicher Basis zu beschäftigen.
Die Entscheidung, eine Arbeit dazu zu schreiben, war die Einlösung eines lang gehegten Bildungsvorhabens.Ich wollte „begreifen, was mich ergreift“. Und so habe ich mir gesagt: Ich mach das j e t z t und begann, dieses Forschungsfeld zu beackern - als Projekt und Privatgelehrsamkeit.
Ich las alle wissenschaftlichen Bücher zum Thema ,Bürgerlichkeit’ und den Generationsromanen, deren ich in den Universitäts- und Landesbibliotheken habhaft wurde. Für mich war es ein Spagat zwischen einer wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Arbeit und letztendlich habe ich mich für letzteres entschieden, mit der Tendenz zu einer analytisch-therapeutischen Bearbeitung der Romane nach einem gefühlsintensiven Lesen und mit reflektierten Schlussfolgerungen. Das Schreiben hat mir große Freude bereitet, nicht zuletzt, weil das Lesen der Romane und der Sekundärliteratur meine Weltsicht erweitert und mir neue Erkenntnis geschenkt hat - und ich bin überzeugt, den Leser/innen geht es genauso.
Für mich begann damit auch eine aktive Bewältigung der eigenen Familiengeschichte, so wie bei den Protagonisten bzw. den Autoren, auch sie beantworteten für sich existentielle Fragen nach Identität, brachten Licht in das Dunkel ihres Lebens.
Ein Buch zu schreiben ist wie ein Abenteuer: Ich bin nicht mehr der gleiche Mensch, vieles ist mir bewusst geworden und ergibt nun einen neuen Sinn. Mir wurde im Laufe der Arbeit klar, dass die eigene Erfahrungswelt bei meiner Entscheidung für das Thema und für das Umkreisen dieses Forschungsgegenstandes eine große, ja entscheidende Rolle spielte, das heißt in diesem Fall: So wie es meinen Eltern wichtig war, mir einen bestimmten Wertekanon zu vermitteln, habe ich durch diese Prägung in der Erziehung meiner Kinder diese Werte und ein bestimmtes Familienbild weiter gegeben. Mit dem Schreiben dieses Buches wollte ich erfahren, woher diese ethische Gesinnung und all diese (bürgerlichen) Normen rühren.
Mir ist bei der Arbeit aufgegangen, wie viel Bürgerliches durch die Erziehung in meinem Elternhaus in mir steckt und dass auch ich aus einer Familie stamme, die ihrerseits Auflösung bzw. Verfall durchlebte. Zitat: „ Dieser Prozess der Entbürgerlichung, der biologischen Enttüchtigung... - genau wie bei uns!“ Genaueres aber bleibt mein „Familiengeheimnis“. Bedanken möchte ich mich bei meiner Familie und bei meiner Freundin dafür, dass sie mir Mut gemacht haben und mir halfen, mein ,Projekt’ durchzuführen und es zu beenden. Danke!
Literaturverzeichnis
Agazzi, E.: Familienromane, Familiengeschichten und Generationenkonflikte. Überlegungen zu einem eindrucksvollen Phänomen, in: Cambi, Fabrizio (Hrsg.): Gedächtnis und Identität, Die deutsche Literatur nach der Vereinigung, Königshausen & Neumann, Würzburg 2008, S. 187 - 203
Alberts/Heine: Geschichte der Kindheit, Schneider Verlag Hohengehren, 73666 Baltmannsweiler 2009
Anderson, M.M.: Die Aufgabe der Familie/das Ende der Moderne: Eine kleine Geschichte des Familienromans, in: Costagli, S., Galli, M. (Hrsg.): Deutsche Familienromane, Wilhelm Fink Verlag München 2010, S. 23 - 34
Aries, Ph.: Geschichte der Kindheit, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München 1996, 12. Auflage
Assmann, A.: Unbewältigte Erbschaften. Fakten und Fiktionen im zeitgenössischen Familienroman, in: Kraft, A./Weißhaupt, M. (Hrsg.): Generationen: Erfahrung - Erzählung - Identität, UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz 2009
Assmann, A. : Erinnerungsräume, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München 1999
Attias-Donfut, C.: Familialer Austausch und soziale Sicherung, in: Kohli, M. / Szydlik, M. (Hrsg.): Generationen in Familie und Gesellschaft, Leske+Budrich, Opladen 2000, S. 222 - 237
Axen, K.-H.: Travemünde, das Seebad Lübecks, Baginski Media Travemünde 2017
Bach,A.: ,Fehltritt' oder ,Schmarotzertum'? Die Ein-Eltern-Familie in Deutschlang und Großbritannien im langfristigen Vergleich, in: Weber, W.E.J./ Herzog, M.: „Ein Herz und eine Seele“ Familie heute, W Kohlhammer GmbH Stuttgart 2003, S. 95 - 114
Bachmaier, H. Prof. Dr.: Das Alter in der Literatur, Vorlesung auf CD, Komplett Media GmbH, 2008
Badinter, E.: Ich bin Du, Beltz Taschenbuch, 2001
Bahnsen, Claudia: „Verfall“ als Folge zunehmender Identitäts- und Existenzunsicherheit, Tectum Verlag Marburg 2003
Balmer, Susanne: Töchter aus guter Familie. Weibliche Individualität und bürgerliche Familie um 1900, in: Martinec/Nitschke (Hrsg.): Familie und Identität in der deutschen Literatur, Lang GmbH, Frankfurt am Main 2009, S. 177 - 195
Banchelli, E.: Ostalgie: Eine vorläufige Bilanz, in: Cambi, Fabrizio (Hrsg.): Gedächtnis und Identität, Die deutsche Literatur nach der Vereinigung, Königshausen & Neumann, Würzburg 2008, S. 57 - 68
Bank, St.P., Kahn, M.D.: Geschwisterbindung, Jungfermannsche Verlagsbuchhandlung Paderborn 1989
Bassler, M.: Der Familienroman im Nicht-Familienroman, in: Costagli, S., Galli, M.,(Hrsg.): Deutsche Familienromane, Wilhelm Fink Verlag München 2010, S. 219 - 230
Bauer, Hans: Wenn einer eine Reise tat, Koehler & Amelang Leipzig 1967
Bauerkämper, A., Bödeker, H.E., Struck, B. (Hrsg.): Die Welt erfahren, Campus Verlag Frankfurt/New York 2004
Bausinger, Hermann: Bürgerlichkeit und Kultur, in: Kocka, J. (Hrsg.): Bürger und Bürgerlichkeit im 19. Jahrhundert, Sammlung, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1987, S. 121 - 142
Bausinger, Beyer, Korff: Reisekultur, Verlag C. H. Beck München 1991
Becker, Frank: Bürgertum und Kultur im 19. Jahrhundert, in: Lütteken, L. (Hrsg.): Zwischen Tempel und Verein, Bärenreiter-Verlag Kassel 2013, S. 14 - 34
Benesch, K.: Mythos Lesen, transcript Verlag Bielefeld 2021
Benker, Gertrud: Bürgerliches Wohnen: städtische Wohnkultur in Mitteleuropa von der Gotik bis zum Jugendstil, Verlag Callwey, München 1984
Bertram, H.: Die verborgenen familiären Beziehungen in Deutschland - Die multilokale Mehrgenerationenfamilie, in: Kohli, M./Szydlik, M. (Hrsg.): Generationen in Familie und Gesellschaft, Leske + Budrich, Opladen 2000, S. 97 - 121
Bertrand, G.: Der Diskurs der Reisenden, Einige Ansätze zu einer vergleichenden Erforschung von Stereotypen der Völker im Europa der Aufklärung, in: Bauerkämper, A., Bödeker, E., Struck, B. (Hrsg.): Die Welt erfahren, Campus Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 20014, S. 301 - 320
Beutin,W., Ehlert,K, Emmerich,W. u.a.: Deutsche Literaturgeschichte, J.B. Metzler Verlag Stuttgart 1994
Blackburn, Davi: Kommentar, in: Kocka, J. (Hrsg.): Bürger und Bürgerlichkeit im 19. Jahrhundert, Sammlung Vandenhoeck & Ruprecht, 1987, S. 281 - S. 287
Blasius, Dirk: Bürgerliche Rechtsgleichheit und die Ungleichheit der Geschlechter. Das Scheidungsrecht im historischen Vergleich, in: Frevert, Ute (Hrsg.): Bürgerinnen und Bürger, Vandenhoeck & Ruprecht, 1988, S. 67 - 84
Bode, Sabine : Kriegsenkel, Klett-Cotta 2009
Böhme, Waltraud u.a. (Hg.): Kleines politisches Wörterbuch. Berlin Dietz 1973
Borscheid, P. /Teuteberg, H.-J.: Ehe, Liebe, Tod, Zum Wandel der Familie, Coppenrath, Münster 1983,
Borscheid, P., Teutenberg, H.: Ehe, Liebe, Tod, Coppenrath Verlag Münster 1983
Bottke, D.: Recht und Billigkeit, Familien vor Gericht, in: Weber, W.E.J. / Herzog, M.: „Ein Herz und eine Seele“? Familie heute, W Kohlhammer GmbH Stuttgart , 2003, S. 81 - S. 94
Brändli, Sabina :„...die Männer sollten schöner geputzt sein als die Weiber“ Zur Konstruktion bürgerlicher Männlichkeit im 19. Jahrhundert, in: Kühne, Th. (Hrsg.): Männergeschichte - Geschlechtergeschichte, Campus Verlag Frankfurt a.M. 1996 , S. 101 - 118
Brakensiek, Stefan: Staatliche Amtsträger und städtische Bürger, in: Lundgreen, P. (Hrsg.): Sozial- und Kulturgeschichte des Bürgertums, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen, S. 138 - 172
Brake, Anna: Über Selbstbilder und Weltsichten in Ost- und Westdeutschland, in: Büchner, P, Fuhs, B., Krüger, H.-H. (Hrsg.):Vom Teddybär zum ersten Kuss, Leske + Budrich Opladen 1996, S. 67 - 98
Brake, A./Büchner, P.: Kindsein in Ost- und Westdeutschland, Allgemeine Rahmenbedingungen des Lebens von Kindern und jungen Jugendlichen, in: Büchner,P., Fuhs,B., Krüger, H.-H.(Hrsg.): Vom Teddybär zum ersten Kuss, Leske + Budrich Opladen 1996, S. 43 - 65
Brehmer/Jacobi-Dittrich/Kleinau/Kuhn (Hrsg.): Frauen in der Geschichte IV, Verlag Schwann-Bagel GmbH, Düsseldorf 1983
Brinker-von der Heyde, Helmut Scheuer (Hrsg.): Familienmuster-Musterfamilien, Peter Lang Verlag Frankfurt am Main 2004
Bronfenbrenner, U.: Generationenbeziehungen in der Ökologie menschlicher Entwicklung, in: Lüscher, K., Schulheis, F. (Hrsg.): Generationenbeziehungen in „postmodernen“ Gesellschaften, Universitätsverlag Konstanz GmbH 1993, S. 51 - 73
Brumlik, M.: Deutschland - eine traumatische Kultur, in: Naumann, K.(Hrsg.): Nachkrieg in Deutschland, Hamburger Edition HIS Verlagsges.mbH 2001, S. 409 - 418
Brunnhuber, P.: Endstation Seniorenheim. Die Thematisierung des Alters im deutschsprachigen Familienroman der Gegenwartsliteratur, in: Costagli, S., Galli, M. (Hrsg.): Deutsche Familienromane, Wilhelm Fink Verlag München 2010, S. 183- 194
Bryk, Maria: Arno GeigersEs geht uns gutaus der Sicht des zeitgenössischen Familien- und Generationsroman UDK 821.112.1(436).09-311.2 Geiger A.
Budde, Gunilla-Friederike: Auf dem Weg ins Bürgerleben, Kindheit und Erziehung in deutschen und englischen Bürgerfamilien 1840-1914, Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 1994
Budde/Conze/Rauh,(Hrsg.): Bürgertum nach dem bürgerlichen Zeitalter, Vandenhoeck & Ruprecht, 2010
Budde, Gunilla-Friederike: Bürgerinnen in der Bürgergesellschaft, in: Lundgreen, P. (Hrsg.): Sozial- und Kulturgeschichte des Bürgertums, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2000, S. 249 - 271
Bude, H.: Bürgertumsgenerationen in der Bundesrepublik, in: Hettling,M./Ulrich, B.(Hrsg.): Bürgertum nach 1945, Hamburg Edition 2005, S. 111 - 132
Bude, H.: Die biologische Relevanz der Generation, In: Kohle, M./Szydlik, M. (Hrsg.): Generationen in Familie und Gesellschaft, Leske + Budrich, Opladen, 2000, S. 19 - 35
Büchner, P, Fuhs, B.,Krüger, H.-H. (Hrsg.): Vom Teddybär zum ersten Kuss, Leske+Budrich, Opladen 1996
Büchner, P.: Vom Befehlen und Gehorchen zum Verhandeln. Entwicklungstendenzen von Verhaltensstandards und Umgangsformen seit 1945, in: Preuss-Lausitz, u.a.: Kriegskinder Konsumkinder Krisenkinder, Beltz Verlag Weinheim und Basel 4. Auflage 1995, S.196 - 212
Büchner, P./Fuhs, B.: Der Lebensort Familie, Alltagsprobleme und Beziehungsmuster, in: Büchner, P., Fuhs, B., Krüger, H.-H. (Hrsg.): Vom Teddybär zum ersten Kuss, Leske + Budrich Opladen 1996, S. 159 - 200
Büchner, P./Krüger, H.: Schule als Lebensort von Kindern und Jugendlichen; Zur Wechselwirkung von Schule und außerschulischer Lebenswelt, in: Büchner, P. Fuhs, B., Krüger, H.-H. (Hrsg.): Vom Teddybär zum ersten Kuss, Leske + Budrich Opladen 1996, S. 201 - 224
Büchner, P.: Kinder in Deutschland-Außenseiter der Gesellschaft? Einleitende Überlegungen zur empirischen Erforschung heutiger Kindheit, in: Büchner, P., Fuhs, B., Krüger, H.-H. (Hrsg.): Vom Teddybär zum ersten Kuss, Leske + Budrich Opladen 1996, S. 13 - 25
Busek, Erhard: Solidarität der Generationen in schwieriger Zeit, in: Krappmann/Lepenies (Hrsg.): Alt und Jung - Spannung und Solidarität zwischen den Generationen, Campus Verlag Frankfurt a.M., New York 1997, S. 17 - 31
Bussemer, Herrad U.: Bürgerliche Frauenbewegung und männliches Bildungsbürgertum 1860-1880 in: Frevert, Ute (Hrsg.): Bürgerinnen und Bürger, Vandenhoeck & Ruprecht 1988, S. 190-205
Buxhoeveden, v. Ch./Lindemann, M.: Periodisierung in der Geschichtswissenschaft der DDR, in: Fischer,A./Heydemann,G. (Hg.): Geschichtswissenschaft in der DDR, Band I: Historische Entwicklung, Theoriediskussion und Geschichtsdidaktik, Duncker & Humblot, Berlin 1988, S. 363 - 394
Calzoni, R.: „Du solltest im ,Familienton’ schreiben“: Walter Kempowskis Deutsche Chronik, in: Costagli, S., Galli, M. (Hrsg. ): Deutsche Familienromane, Wilhelm Fink Verlag München 2010, S. 97 - 108
Cambi, F. (Hrsg.): Gedächtnis und Identität, Königshausen & Neumann, GmbH Würzburg 2008
Cambi, Fabrizio (Hrsg.): Gedächtnis und Identität, Die deutsche Literatur nach der Vereinigung, Königshausen & Neumann, Würzburg 2008
Campe, J.H.: Väterlicher Rath für meine Tochter, Braunschweig 1789
Chilese, V.: Die Macht der Familie. Ökonomische Diskurse in Familienromanen, in: Costagli, S., Galli, M. (Hrsg.): Deutsche Familienromane, Hermann Fink Verlag München 2010, S. 121- 130
Chvojka, Erhard: Geschichte der Großelternrollen, Böhlau Verlag Wien, 2003
Cohen-Pfister, Laurel: Kriegstrauma und die deutsche Familie. Identitätsuche im deutschen Gegenwartsroman. in: Martinec, Thomas: Familie und Identität in der deutschen Literatur, Frankfurt a.M., Peter Lang Verlag 2009
Conze, W. : Sozialgeschichte der Familie in der Neuzeit Europas, Ernst Klett Verlag Stuttgart 1976
Costagli, S.: Family Plots. Literarische Strategien dokumentarischen Erzählens, in: Costagli, S., Galli, M. (Hrsg.): Deutsche Familienromane, Wilhelm Fink Verlag München 2010, S. 157 - 168
Costagli, S., Galli, M.: (Hrsg.) Deutsche Familienromane, Wilhelm Fink Verlag München 2010
Csendes, Peter: Wiener Geschichte , R. Oldenbourg Verlag München, 1981
Cyprian, G.: Väterforschung im deutschsprachigen Raum - ein Überblick über Methoden, Ergebnisse und offene Fragen, in: Mühling, T./Rost, H.(Hrsg.): Väter im Blickpunkt, Verlag Barbara Budrich, Opladen & Farmington Hills 2007, S. 23 - 48
Daiber, Jürgen: „Schlimm, dass bei uns nur die Wahl zwischen Ehe und Einsamkeit ist“. Romantische Konzepte der Paarbeziehung, in: Martinec/Nitschke (Hrsg.): Familie und Identität in der deutschen Literatur, Lang GmbH, Frankfurt am Main 2009, S. 79 - 90
Daniel A./ McMillan: „. die höchste und heiligste Pflicht.“ Das Männlichkeitsideal der deutschen Turnbewegung 1811-1871, in: Kühne, Th. (Hg.): Männergeschichte- Geschlechtergeschichte, Campus Verlag Frankfurt a.M. 1996
Danyel, Jürgen (Hrsg.): Ost-Berlin, 30 Erkundungen, Ch. Links Verlag GmbH 2019
Danyel, J.: Ost-Berlin erkunden, in: Danyel, J. (Hrsg.) Ost-Berlin, Chr. Links Verlag GmbH Berlin 2020, S. 11 - 29
Depkat, Volker: Entwürfe politischer Bürgerlichkeit und die Krisensignatur des 20. Jahrhunderts, in: Budde/Conze/Rauh (Hrsg.): Bürgertum nach dem bürgerlichen Zeitalter, Vandenhoeck&Ruprecht Göttingen 2010, S. 101 - 116
Dittmann, B.: Geschichte des Buddenbrookhauses, in: Wisskirchen, H. (Hg.): Die Welt der
Buddenbrooks, S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt a.M. 2008, S. 144 - 237
Edelstein, W., Kreppner, Kurt /Sturzbecher (Hrsg.): Familie und Kindheit im Wandel, Verlag für Berlin-Brandenburg 1996
Ecarius, J.: Familienerziehung im Wandel, Leske und Buderich Verlag Opladen 2002
Eckstaedt, A.: Liebe und Leid - Familie aus psychoanalytischer Sicht, in: Weber, W.E.J. / Herzog, M.: „Ein Herz und eine Seele“? Familie heute, W. Kohlhammer GmbH Stuttgart 2003, S. 57 - 80
Eigler, Friederike: Gedächtnis und Geschichte in Generationenromanen seit der Wende. Philologische Studien und Quellen 192 Berlin, Erich Schmidt Verlag 2005
Eickhölter, M.: Die Stadt Lübeck in Buddenbrooks, in: Wisskirchen, H. (Hg.): Die Welt der Buddenbrooks, S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt a.M. 2008, S. 61 - 113
Eickhölter, M.: Ein Lübecker wird Autor von Weltgeltung, in: Wisskirchen, H. (Hg.): Die
Welt der Buddenbrooks, S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt a.M. 2008, S. 114 - 143
Eke, N.O.: Ausschau halten nach den Toten. Marcel Beyers Spurensuche im Feld der Familie, in: Costagli, S., Galli, M. (Hrsg.): Deutsche Familienromane, Wilhelm Fink Verlag München 2010, S. 145 - 156
Emmerich: Generationen - Archive - Diskurse. Wege zum Verständnis der deutschen Gegenwartsliteratur, in: Cambi, Fabrizio (Hrsg.): Gedächtnis und Identität, Die deutsche Literatur nach der Vereinigung, Königshausen & Neumann, Würzburg 2008, S. 15 - 29
Ennulat, Gertrud: Kriegskinder, Klett-Cotta Verlag Stuttgart 2008
Erhard, Walter: Thomas Manns Buddenbrooks und der Mythos zerfallender Familien, in: Brinker-von der Heyde,Scheuer, H. (Hrsg.), Frankfurt am Main Peter Lang 2004, S. 161 - 184
Erhart, Walter: Familienmänner - Über den literarischen Ursprung moderner Männlichkeit, Wilhelm Fink Verlag München, 2001
Eßlinger, E.: Das Dienstmädchen, die Familie und der Sex, Wilhelm Fink Verlag München 2013
Eyferth, H.: „Gefährdete Jugend“, Wissenschaftliche Verlagsanstalt K.G. Hannover 1950
Fadinger, Julia: Zusammenhang von Erinnerung und Identität im neuen österreichischen
Familienroman, Diplomarbeit Universität Wien 2012 ottes.univie.ac.at/19718/
Faulstich, W. u. Grimm, G.E. (Hrsg.): Sturz der Götter?, Suhrkamp Verlag Frankfurt a.M. 1989
Ferron,I.: „Was anfangen mit der verlorenen Zeit?“ in: Georgi, S., Ilgner,J., Lammel, I. u.a. (Hrsg.) Geschichtstransformationen, transcript Verlag Bielefeld, 2015, S. 239 - 256
Filipp, S.-H.: Beziehungen zwischen den Generationen im Erwachsenenalter als Thema der verhaltenswissenschaftlichen Forschung, in: Krappmann/Lepenies (Hrsg.): Spannung und Solidarität zwischen den Generationen, Campus Verlag Frankfurt a.M.; New York, 1997, S. 229 - 242
Fischer,A./Heydemann,G. (Hrsg.): Geschichtswissenschaft in der DDR, Band I: Historische Entwicklung, Theoriediskussion und Geschichtsdidaktik, Duncker & Humblot Berlin 1988
Fischer,A./Heydemann,G.: Weg und Wandel der Geschichtswissenschaft und des Geschichtsverständnisses in der SBZ/DDR seit 1945, in: Fischer,A./Heydemann,F. (Hrsg.): Geschichtswissenschaft in der DDR, Band I: Historische Entwicklung, Theoriediskussion und Geschichtsdidaktik Duncker & Humblot, Berlin 1988, S. 3 - 30
Fitzon, Thorsten: Zwischen Familiarisierung und Desintegration. Hohes Alter., in: Martinec/Nitschke (Hrsg.): Familie und Identität in der deutschen Literatur, Lang GmbH Frankfurt am Main 2009, S. 127 - 139
Flügel, Axel: Bürgertum und ländliche Gesellschaft im Zeitalter der konstitutionellen Monarchie, in: Lundgreen, P. (Hrsg.): Sozial- und Kulturgeschichte des Bürgertums, Vandenhoeck & Ruprecht, 2000, S. 195 - 223
Fontane,Th.: Rez. über Gustav Freytag, Die Ahnen(1875), S. 316- 319, in: Steinecke H.:
Romanpoetik von Goethe bis Thomas Mann, Wilhelm Fink Verlag München 1987
Frevert, Ute: Frauen-Geschichte, Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1986
Frevert, Ute (Hrsg.): Bürgerinnen und Bürger, Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 1988
Frevert, Ute: Bürgerliche Meisterdenker und das Geschlechterverhältnis. Konzepte, Erfahrungen, Visionen an der Wende vom 18. und 19. Jahrhundert, in: Frevert, Ute (Hrsg.): Bürgerinnen und Bürger, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 1988, S. 17 - 48
Frevert, Ute: Soldaten, Staatsbürger, Überlegungen zur historischen Konstruktion von Männlichkeit, in: Kühne, Th. (Hrsg.): Männergeschichte - Geschlechtergeschichte, Campus Verlag Frankfurt a. M. 1996, S. 69 - 87
Frevert, Ute/Schreiterer, Ulrich: Treue - Ansichten des 19. Jahrhunderts, in: Hettling/ Hoffmann (Hrsg.): Der bürgerliche Wertehimmel, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 2000, S. 217 - 256
Frey, Manuel: Der reinliche Bürger, Entstehung und Verbreitung bürgerlicher Tugenden in Deutschland 1760-1860, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 1997
Freytag, G.: Soll und Haben, Leipzig 1855
Freytag, Julia: Generationentransfer und Generationenkonflikt in den Familienromanen von Dimitré Dinev, Arno Geiger und Tanja Dückers. In: Arenhövel, Mark (Hrsg.): Kulturtransfer und Kulturkonflikt. Dresden 2010 (= Germanica N.F. Bd. 2008),
Fuchs, A. : Landschaftserinnerung und Heimatdiskurs: Tradition und Erbschaft in Thomas Medicus’ „In den Augen meines Großvaters“ und Stephan Wackwitz „Ein unsichtbares Land“, in: Kraft, A./Weißhaupt,M. (Hrsg.)Generationen: Erfahrung - Erzählung - Identität. IVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz 2009, S. 71 - 92
Fugmann, Tom: In Zeiten des abnehmenden Lichts, Momento v. 13. Oktober 2011 im Internet Archive, in: NDR, aufgerufen am 20. Juni 2012
Fuhrer, Urs: Wie Erziehung in der Familie gelingen kann, in: Kauer, K. (Hrs.): Familie - Kultureller Mythos und soziale Realität, Frank & Timme Verlag Berlin 2010
Fuhs, B.: Das außerschulische Kinderleben in Ost- und Westdeutschland. Vom kindlichen Spielen zur jugendlichen Freizeitgestaltung, in: Büchner, P., Fuhs, B., Krüger, H.-H. (Hrsg.): Vom Teddybär zum ersten Kuss, Leske + Budrich Opladen 1996, S. 129 -158
Fulbrook, M.: Ein ganz normales Leben, Alltag und Gesellschaft in der DDR, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 2008
Gall, Lothar: Bürgertum in Deutschland, Sieder-Verlag 1998
Galli, M/ Cosagli, S.: Chronotopoi. Vom Familienroman zum Generationenroman, in: Costagli, S., Galli, M. (Hrsg.): Deutsche Familienromane, Wilhelm Fink Verlag München 2010, S. 7 - 20
Garbe, Christine: Sophie oder die heimliche Macht der Frauen. Zur Konzeption des Weiblichen bei Jean-Jacques Rousseau, in: Brehmer/Jacobi-Dittrich/Kleinau/Kuhn (Hrsg.): Frauen in der Geschichte IV, Schwann-Bagel GmbH, Düsseldorf 1983, S. 65 - 87
Gaus, G.: Wo Deutschland liegt, Hoffmann und Campe Verlag, München 1987
Gebhardt, Miriam: Eltern zwischen Norm und Gefühl, in: Budde/Conze/Rauh (Hrsg.): Bürgertum nach dem bürgerlichen Zeitalter, Vandenhoeck & Ruprecht 2010, S. 187 - 204
Geiger, A.: Der Schwamm ist leer, Schönstatt Verlag 2001, S. 10
Geiger, A.: Es geht uns gut, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München 2007
Geiger, A.: Grenzgehen, Drei Reden,Carl Hanser Verlag München 2011
Georgi, S., Ilgner, J., Lammel, I., Sarti, C., Waldschmidt, Chr. (Hrsg.): Geschichtstransformationen, transcript Verlag Bielefeld 2015
Gerhard, U.: Die staatlich institutionalisierte „Lösung“ der Frauenfrage. Zur Geschichte der Geschlechterverhältnisse in der DDR, in: Kaelble,H., Kocka,J., Zwahr,H. (Hrsg.): Sozialgeschichte der DDR, Klett-Cotta, Stuttgart, 1994, S. 383 - 403
Gesterkamp, Th.: Väter zwischen Laptop und Wirklichkeit, in: Mühling, T./Rost,H. (Hrsg.): Väter im Blickpunkt, Verlag Barbara Budrich, Opladen & Farmington Hills 2007, S. 97 - 114
Gestrich, Andres: Geschichte der Familie im 19.und 20. Jahrhundert, 3., um einen Nachtrag erweiterte Auflage, Oldenburg Verlag München 2013
Geulen, Christian: „Center Parcs“ Zur bürgerlichen Einrichtung natürlicher Räume, in: Hettling(Hoffmann (Hrsg.): Der bürgerliche Wertehimmel, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2000, S. 257 - 282
Giesen,B.: Ungleichzeitigkeit, Erfahrung und der Begriff der Generation, in: Kraft, A./ Weißhaut,M. (Hrsg.): Generationen: Erfahrung - Erzählung - Identität, UVK Verlagsgesellschaft GmbH Konstanz 2009 , S. 191 - 215
Gillis, John R.: Geschichte der Jugend, Beltz Verlag, Weinheim und Basel 1980
Gisbertz, A.-K., Ostheimer, M. (Hrsg.): Geschichte - Latenz-Zukunft , Zur narrativen Modellierung von Zeit in der Gegenwartsliteratur, Wehrhahn Verlag Hannover 2017
Gisbertz, A.-K.: Latenzen der Gegenwart in Arno Geigers ,Es geht uns gut’ und Eugen Ruges ,In Zeiten des abnehmenden Lichts’,in: Gisbertz, A.-K., Ostheimer, M. (Hrsg.): Geschichte - Latenz - Zukunft, Zur narraiven Modellierung von Zeit in der Gegenwartsliteratur, Wehrhahn Verlag Hannover, S. 93 - 106
Goltermann, Svenja: Figuren der Freiheit, in: Hettling/Hoffmann (Hrsg.): Der bürgerliche Wertehimmel, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2000, S. 149 - 168
Göckenjahn, G., Taeger, A.: Matrone, alte Jungfer, Tante: Das Bild der alten Frau in der bürgerlichen Welt des 19. Jahrhunderts, Archiv für Sozialgeschichte, Heft 30, S. 43 - 79, 1990 Bonn, Hannover,Bonn-Bad Godesberg, Dietz, Verlag für Lit. u. Zeitgeschehen, Verl. Neue Ges.
Gösweiner, Friederike: Einsamkeit in der jungen deutschsprachigen Literatur der Gegenwart, Studienverlag Innsbruck 2010
Grabowski, R.: Wohnungspolitik, in: Manz, G., Sachse E., Winkler, G. (Hrsg.): Sozialpolitik in der DDR, trafo Verlag Dr. Wolfgang Weist 2001, S. 227 - 242
Graf,Fr.W.: Eine Ordnungsmacht eigener Art. Theologie und Kirchenpolitik im DDR- Protestantismus, in: Kaelble,H., Kocka,J., Zwahr,H. (Hrsg.): Sozialgeschichte der DDR, Klett-Cotta Stuttgart 1994, S. 295 - 321
Grandke, A.: Veränderte Lebenssituation der Familien in den neuen Ländern, in: Jans, B. / Sering, A. (Hg.): Familien im wiedervereinigten Deutschland, Vektor-Verlag Grafschaft 1992, S. 33 - 46
Grandke, A.: Familienpolitik, in: Manz, G., Sachse E., Winkler, G. (Hrsg.): Sozialpolitik in der DDR, trafo Verlag Dr. Wolfgang Weist 2001, S. 317 - 336
Griem, Julika: Szenen des Lesens, Schauplätze einer gesellschaftlichen Selbstverständigung, transcript Verlag Bielefeld 2021
Grimm, Dieter: Bürgerlichkeit im Recht, in: Kocka, J. (Hrsg.): Bürger und Bürgerlichkeit im 19. Jahrhundert, Sammlung Vandenhoeck & Ruprecht 1987, S. 149 - 188
Großbölting, Th.: Entbürgerlichte die DDR? Sozialer Bruch und kultureller Wandel in in der ostdeutschen Gesellschaft, in: Hettling/Ulrich (Hrsg.) Bürgertum nach 1945, Hamburg 2005: Hamburger Edition, HIS Verlag.S. 407 - 432
Großbölting, Th.: Erosion und Resilienz: Bürgertum, Bürgerlichkeit und Entbürgerlichung in SBZ und DDR seit 1945, in: Sachsen und Anhalt, ZDB,Heft 27, 2015
Gysi, Jutta: Familienleben in der DDR, Akademie-Verlag Berlin 1989
Habermas, T.: Geliebte Objekte, Suhrkamp Verlag 1996
Habermas, R.: Rituale des Gefühls, in: Hettling/Hoffmann (Hrsg.): Der bürgerliche Wertehimmel, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 2000, S. 169 - 191
Habeth, Stephanie: Die Freiberuflerin und Beamtin (Ende 19. Jahrhunderts bis 1945), in Pohl/Treue (Hrsg.): ZfU Die Frau in der Wirtschaft, Bd 35, Steiner Wiesbaden GmbH 1985, S. 155 - 170
Hacke, Jens: Bürgerlichkeit und liberale Demokratie, in: Budde/Conze/Rauh(Hrsg.): Bürgertum nach dem bürgerlichen Zeitalter, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 2010, S. 117 - 131
Häring, A., Stoye, K., Klein, Th., Stauder, J.: 20 Jahre nach der Wende. Der Partnermarkt junger Erwachsener in Ost- und Westdeutschland, in: Huinink, J. Kreyenfeld, M., Trappe, H. (Hrsg.): Familie und Partnerschaft in Ost- und Westdeutschland, Verlag Barbara Budrich Opladen, Berlin &Toronto 2012, S. 257 - 274
Hagemann, Karen: „Heran, heran, zu Sieg oder Tod!“ Entwürfe patriotisch-wehrhafter Männlichkeit in der Zeit der Befreiungskriege, in: Kühne, Th. (Hrsg.): Männergeschichte - Geschlechtergeschichte, Campus Verlag Frankfurt a.M. 1996, S. 51 - 68
Hahn, Hans-Joachim: Beobachtungen zur Ästhetik des Familienromans heute, in: Martinec, Thomas: Familie und Identität in der deutschen Literatur, Frankfurt Peter Lang Verlag 2009, S. 275 - 292
Hahn, Ines: Ein Fundstück und die Wogen der Erinnerung, in: Danyel, J. (Hrsg.) Ost- Berlin, Ch.Links Verlag GmbH Berlin 2020, S. 31 - 47
Haider, Edgard: Wien im Wandel, Böhlau Wien 1996
Hartung, H., Reinmuth, D., Streubel, Ch., Uhlmann, A. (Hrsg.): Graue Theorie; Die Kategorien Alter und Geschlecht im kulturellen Diskurs, Böhlau Verlag GmbH & Co, Köln Weimar Wien 2007
Hausen, Karin: „... eine Ulme für das schwanke Efeu“. Ehepaare im Bildungsbürgertum. Ideale und Wirklichkeiten im 18. und 19. Jahrhundert, in: Frevert, Ute (Hrsg.): Bürgerinnen und Bürger, Vandenhoeck & Ruprecht 1988, S. 85 - 117
Hausen, K.: Die Polarisierung der „Geschlechtscharaktere “- Eine Spiegelung der Dissoziation von Erwerbs- und Familienleben, in: Conze, W. (Hg.): Sozialgeschichte der Familie in der Neuzeit Europas, Ernst Klett Verlag Stuttgart 1976, S. 363 - 393
Hein, Dieter: Bürgerkultur und ihre Organisationsformen im 19. Jahrhundert, in: Lütteken, L. (Hg.): Zwischen Tempel und Verein, Bärenreiter-Verlag Kassel 2013, S. 35-51
Hein, D. : Bürgerliches Künstlertum. Zum Verhältnis von Künstlern und Bürgern auf dem Weg in die Moderne, in: Hein,D./Schulz,A. (Hrsg.): Bürgerkultur im 19. Jahrhundert, C.H.Beck München 1996, S. 102 -120
Hein,D./Schulz,A. (Hrsg.): Bürgerkultur im 19. Jahrhundert, C.H.Beck München 1996
Heine, Claudia: Im Spannungsfeld zwischen Unterhaltung und Sakralisierung in: Lütteken, L. (Hg.): Zwischen Tempel und Verein, Bärenreiter-Verlag 2013, S. 92-115
Hertle, H.-H./Wolle, St.: Damals in der DDR, C. Bertelsmann Verlag, München 2004
Hess-Lüttich, E.W.B., von Maltzan, C., Thorpe, K. (Hrsg.): Gesellschaften in Bewegung, Peter Lang GmbH Frankfurt am Main 2016
Hettling, M./Hoffmann, St. (Hrsg.): Der bürgerliche Wertehimmel, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2000
Hettling,M./Hoffmann,Stefan-L.: Einleitung: Zur Historisierung bürgerlicher Werte, in: Hettling/Hoffmann (Hrsg.): Der bürgerliche Wertehimmel, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2000, S. 7 - 21
Hettling, M./Ulrich, B.(Hrsg.): Bürgertum nach 1945, Hamburg Edition HIS Verlagsges.mbH 2005
Hettling, M.: Bürgerlichkeit im Nachkriegsdeutschland, in: Hettling,M./Ulrich,B. (Hrsg.) Bürgertum nach 1945, Hamburger Edition 2005, S. 7 - 37
Hettling, Manfred: Die persönliche Selbständigkeit. Der archimedische Punkt bürgerlicher Lebensführung, in: Hettling/Hoffmann (Hrsg.): Der bürgerliche Wertehimmel, Vandenhoeck& Ruprecht, Göttingen 2000, S. 57 - 78
Hettling, M. / Ulrich, B.: Formen der Bürgerlichkeit, in: Hettling, M./Ulrich,B. (Hrsg.): Bürgertum nach 1945, Hamburg Edition 2005, S. 40 - 60
Hettling, Manfred: Bürgerliche Kultur - Bürgerlichkeit als kulturelles System, in: Lundgreen, P. (Hrsg.), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2000 , S. 319 - 339
Hobsbawm, Eric J.: Kultur und Geschlecht im europäischen Bürgertum 1870-1914 in: Frevert, Ute (Hrsg.): Bürgerinnen und Bürger, Vandenhoeck & Ruprecht 1988, S. 175 -189
von Hoedenberg, Christina: Der Fluch des Geldsacks. Der Aufstieg des Industriellen als Herausforderung bürgerlicher Werte, in: Hettling /Hoffmann (Hrsg.): Der bürgerliche Wertehimmel, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2000, S. 79 - 104
Hölscher, Lucian: Die Religion des Bürgers: bürgerliche Frömmigkeit und protestantische Kirche im 19. Jahrhundert, HZ Berlin Jg. 250 (1990), de Gruyter Oldenbourg, 1990
Hofäcker, D.: Väter im internationalen Vergleich, in: Mühling, T./Rost,H. (Hrsg.): Väter im Blickpunkt, Verlag Barbara Budrich Opladen & Farmington Hills 2007, S. 161 - 204
Hoffmann, Stefan-Ludwig: Unter Männern, in: Hettling/Hoffmann (Hrsg.): Der bürgerliche Wertehimmel, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2000, S. 193 - 216
Hopfner, Johanna: Mädchenerziehung und weibliche Bildung um 1800 im Spiegel der populär-pädagogischen Zeit, Erlanger Pädagogische Studien, Verlag Julius Klinkhardt Bad Heilbrunn/Obb. 1990
Höpflinger, F, Charles, M., Debrunner, A. : Familienleben und Berufsarbeit , Seismo Verlag Zürich, 1991
Höpflinger, F. : Weibliche Erwerbsbiographien und Abhängigkeiten zwischen den Generationen, in: Lüscher, K., Schultheis, F. (Hg.): Generationenbeziehungen in „postmodernen “ Gesellschaften, Universitätsverlag Konstanz GmbH 1993, S. 299 - 309
Huinink, J, Eugen Kreyenfeld, M., Trappe, H. (Hrsg.): Familie und Partnerschaft in Ost- und Westdeutschland, Verlag Barbara Budrich Opladen, Berlin & Toronto 2012
Hull, Isabel V.: ,Sexualität’ in der bürgerlichen Gesellschaft, in: Frevert, Ute, (Hrsg.): Bürgerinnen und Bürger, Vandenhoeck & Ruprecht 1988 S. 49 - 66
Hurrelmann, K.: Jugendliche Lebenswelten. Familie, Schule Freizeit, in: Jugend 2006.
Hrsg. von der Shell Deutschland Holding. Bonn 2006,
Hussein, Nahla: Phasen des Übergangs, Eugen Ruges In Zeiten des abnehmenden Lichts und Der Ausgang. Alis Brief, der voller unerwarteter Freude ist von Ezz El-Din Shokry Fashir, in: Hess-Lüttich, v. Maltzan, C., Thorpe, K. (Hrsg.): Gesellschaften in Bewegung, Peter Lang GmbH Frankfurt am Main 2016, S. 145 - 155
Jacobi, J.: Religiosität und Mädchenbildung, in: Kraul/Lüth, Chr. (Hrsg.): Erziehung der Menschen-Geschlechter, Deutscher Studien Verlag Weinheim 1996,
Jacobi-Dittrich, J./Kleinau, E.: „Wissen heißt leben.“ Beiträge zur Bildungsgeschichte von Frauen im 18. und 19. Jh., in: Brehmer/Jacobi-Dittrich/Kleinau/Kuhn (Hrsg.): Frauen in der Geschichte IV, Verlag Schwann-Bagel GmbH, Düsseldorf 1983
Jaeger, H.: Der Unternehmer als Vater und Patriarch, in: Faulstich, W. u. Grimm, G.E. (Hrsg.): Sturz der Götter? Suhrkamp Verlag Frankfurt a.M. 1989, S. 98 - 120
Jahn, B.: Familienkonstruktionen 2005. Zum Problem des Zusammenhangs der Generationen im aktuellen Familienroman, in: Zeitschrift für Germanistik 2006
Jans,B./Sering, A. (Hrsg.): Familien im wiedervereinigten Deutschland, Vektor-Verlag, Grafschaft 1992
Janz, Oliver: Bürger besonderer Art, Evangelische Pfarrer in Preußen 1850 - 1914, De Gruyter 1994
Janz, Oliver: Kirche, Staat und Bürgertum in Preußen in: Schorn-Schütte/Sparn (Hrsg.): Evangelische Pfarrer, Kohlhammer Verlag Stuttgart 1997, S. 128 - 147
Jelavich, Peter: „Darf ich mich amüsieren?“ in: Hettling/Hoffmann (Hrsg.) Der bürgerliche Wertehimmel, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2000, S. 283 - 303
Jens, Walter: Die Buddenbrooks und ihre Pastoren, Verlag der Buchhandlung Gustav Weiland Nachf. Lübeck 1993
Kaelble,H., Kocka,J., Zwahr,H. (Hrsg.): Sozialgeschichte der DDR, Klett-Cotta Stuttgart 1994, S. 31 - 61
Kalisch, Volker: Studien zur „bürgerlichen Musikkultur“, Sofortdruck Anton Brenner, Tübingen 1990
Kaplan, Marion: Freizeit-Arbeit. Geschlechterräume im deutsch-jüdischen Bürgertum 1870-1914 in: Frevert, Ute (Hrsg.): Bürgerinnen und Bürger, Vandenhoeck & Ruprecht 1988, S. 157-174
Kaschuba, W.: Die Fußreise - Von der Arbeitswanderung zur bürgerlichen Bildungsbewegung, in: Bausinger u.a. (Hg.): Reisekultur, Verlag C.H. Beck München 1991
Kasten, H. Die Geschwisterbeziehung, Band 1, Hogrefe-Verlag , Göttingen, 1993
Kauer, Katja(Hrsg.): Familie-Kultureller Mythos und soziale Realität, Frank & Timme Verlag, Berlin 2010
Kaufmann, F.-X. : Generationenbeziehungen und Generationenverhältnisse im Wohlfahrtsstaat, in: Lüscher, K., Schultheis, F. (Hg.): Generationenbeziehungen in „postmodernen“ Gesellschaften, Universitätsverlag Konstanz GmbH 1993, S. 95 - 108
Keilhauer, Annette: Altern als mimetische Praxis im autobiographischen Schreiben von Frauen, in: Hartung, H. u.a.(Hrsg.) Graue Theorie, Böhlau Verlag GmbH &Cie, Köln Weimar Wien 2007, S. 151 - 173
Keller, Gottfried: Gesammelte Werke - Der grüne Heinrich, Nymphenburger Verlagshandlung GmbH, München 1981
Keppler, A.: Tischgespräche, Suhrkamp -Taschenbuch Frankfurt am Main 1994
Kessel, Martina: „Der Ehrgeiz setzte mir heute wieder zu.“. Geduld und Ungeduld im 19. Jahrhundert, in: Hettling/Hoffmann (Hrsg.): Der bürgerliche Wertehimmel, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2000, S. 129 - 148
Kill, S.: Wach geküßt von der Poesie. Eine Strategie weiblicher Emanzipation in der westfälischen Provinz, in: Hein,D./Schulz,A. (Hrsg.): Bürgerkultur im 19. Jahrhundert, C.H.Beck München 1996, S. 53 - 65
Kleinhenz, G.: Der Austausch zwischen den Generationen, in: Krappmann/Lepenies (Hg.): Alt und Jung - Spannung und Solidarität zwischen den Generationen, Campus Verlag Frankfurt/New York 1997
Kleßmann, Ch.: Relikte des Bildungsbürgertums in der DDR, in: Kaelble,H., Kocka,J., Zwahr,H. (Hrsg.): Sozialgeschichte der DDR, Klett-Cotta, Stuttgart 1994, S. 254 - 270
Klosinski, G.: Verschwistert mit Leib und Seele - beglückt oder bestraft? in: Klosinski, G. (Hg.): Verschwistert mit Leib und Seele, Attempto Verlag Tübingen 2000, S. 9 - 18
Klugkist, Thomas: 49 Fragen und Antworten zu Thomas Mann, Fischer Verlag 2003
Kocka, Jürgen (Hg.): Bürger und Bürgerlichkeit im 19.Jahrhundert, Sammlung Vandenhoeck&Ruprecht Göttingen 1987
Kocka, Jürgen: Bürgertum und Bürgerlichkeit als Probleme der deutschen Geschichte vom späten 18. zum frühen 20. Jahrhundert , in: Kocka, J. (Hg.) Bürger und Bürgerlichkeit im 19. Jahrhundert, Vandenhoeck&Ruprecht Göttingen 1987 S. 21 - S. 63
Kocka, Jürgen: Bürgertum und Sonderweg, in: Lundgreen, P. (Hg.) Sozial- und Kulturgeschichte des Bürgertums, Vandenhoeck&Ruprecht, 2000, S. 93 - S. 110
Kohli, M: Die DDR als Arbeitsgesellschaft? Arbeit, Lebenslauf und soziale Differenzierung, in: Kohli, M./Szydlik, M. (Hrsg.): Generationen in Familie und Gesellschaft, Leske +Budrich, Opladen 2000
König, Gudrun M.: Eine Kulturgeschichte des Spaziergangs, Böhlau Verlag Wien,Köln,Weimar 1996
Kötters, C./Krüger, H.-H./Brake, A.: Wege aus der Kindheit, Verselbständigungsschritte ins Jugendalter, in: Büchner, P., Fuhs, B., Krüger, H.-H. (Hrsg.): Vom Teddybär zum ersten Kuss, Leske + Budrich Opladen 1996, S. 99 -128
Kondylis, P.: Der Niedergang der bürgerlichen Denk- und Lebensform, Weinheim VCH, Acta Humaniora, 1991
Korff, Gottfried: Puppenstuben als Spiegel bürgerlicher Wohnkultur in: Niethammer, Lutz (Hg.): Wohnen im Wandel, Peter Hammer Verlag Wuppertal 1969, S. 28 - S. 43
Kort, Susanne: Unmöglichkeiten. Vater-Tochter-Dramen im 18. und 19. Jahrhundert, in: Matinec/Nitschke (Hrsg.) : Familie und Identität in der deutschen Literatur, Lang GmbH Frankfurt am Main 2009, S. 105 -125
Kraft,A./Weißhaupt,M. (Hg.): Generationen: Erfahrungen - Erzählung - Identität, UVK
Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz, 2009
Kraft,A:/Weißhaupt,M. (Hg.) Erfahrungen - Erzählung - Identität und die „Grenzen des
Verstehen“:Überlegungen zum Generationenbegriff, in: Kraft,A./Weißhaupt,M.(Hg.): Erfahrung - Erzählung - Identität, a.a.O., S.17 - 47
Kraft,A./Weißhaupt,M. Hrsg.): Generationen: Erfahrung - Erzählung - Identität, UVK Verlagsgesellschaft mbH Konstanz 2009
Kraft, A.: Geerbte Räume der Erinnerung in Mac Buhls Roman „Das Billardzimmer“, in: Kraft, A./Weißhaupt,M (Hg.): Generationen: Erfahrung - Erzählung - Identität, UVK Verlagsgesellschaft mbH Konstanz 2009, S. 147-165
Krökel, Fritz: Nachwort in: Stifter, A.: Nachsommer, Winkler Verlag München 1949, S. 735-750
Krappmann, L., Lepenies, A. (Hg.): Alt und Jung - Spannung und Solidarität zwischen den Generationen, Campus Verlag Frankfurt/New York, 1997
Krappmann, S.: Brauchen junge Menschen alte Menschen? in: Krappmann/Lepenies (Hg.) :Alt und Jung - Spannung und Solidarität zwischen den Generationen, Campus Verlag Frankfurt a.M.; New York, 1997 S. 185 - S. 204
Kraul,M./Lüth,Chr.(Hrsg.): Erziehung der Menschen-Geschlechter, Deutscher Studien Verlag Weinheim 1996
Krüger, Christine: In der Tradition der bürgerlichen Wohlfahrt? in: Budde/Conze/Rau (Hrsg.): Bürgertum nach dem bürgerlichen Zeitalter, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen, 2010, S. 53 - 67
Krüger, H. /Born, C.: Vom patriarchalen Diktat zur Aushandlung - Facetten des Wandels der Geschlechterrollen im familialen Generationenverbund, in: Kohli, M./Szydlik, M. (Hrsg.): Generationen in Familie und Gesellschaft, Leske + Budrich Opladen 2000, S. 203-221
Krüger, H.-H.: Wege aus der Kindheit in Ost- und Westdeutschland, Bilanz und Perspektive, in: Büchner, P., Fuhs, B., Krüger, H.-H. (Hrsg.): Vom Teddybär zum ersten Kuss, Leske + Budrich Opladen 1996, S. 225-235
Kruse, Lenelis/Thimm, C.: Das Gespräch zwischen den Generationen, in: Krappmann/ Lepenies (Hg.): Alt und Jung - Spannung und Solidarität zwischen den Generationen, Campus Verlag Frankfurt a.M., New York 1997, S. 112 - 136
Kühne, Thomas (Hrsg.): Männergeschichte - Geschlechtergeschichte, Männlichkeit im Wandel der Moderne, Campus Verlag Frankfurt a.M. 1996
Kühne, Thomas: „... aus diesem Krieg werden nicht nur harte Männer heimkehren“ Kriegskameradschaft und Männlichkeit im 20. Jahrhundert, in: Kühne, Th. (Hrsg.): Männergeschichte - Geschlechtergeschichte, Campus Verlag Frankfurt a.M. 1996 S. 174 - 192
Kuhlemann, Frank-Michael: Bürgertum und Religion, in: Lundgreen, P. (Hrsg.): Sozial- und Kulturgeschichte des Bürgertums, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 2000, S. 293 - 318
Kuhlemann, F.: Bürgerlichkeit und Religion, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 2002
Kujath, H.-J.: Wohnbedürfnisse der Familie, in: Jans, B./Sering, A. (Hrsg.): Familien im wiedervereinigten Deutschland, Vektor-Verlag, Grafschaft 1992
Kurzke, H.,/Stachorski, St.(Hg.): Thomas Mann: Im Spiegel. in: Essays, Bd.1: Frühlingssturm 1893-1918, Frankfurt a.M.1993,
Labouvie, Eva: Vom Paar zur Familie, von der Konvergenz zur Liebe, in: Kauer, K.(Hrsg.): Familie-Kultureller Mythos und soziale Realität, Frank & Timme Verlag, Berlin 2010
Ladj-Teichmann, Dagmar: Erziehung zur Weiblichkeit durch Textilarbeiten, BeltzVerlag Weinheim und Basel 1983
Ladj-Teichmann, D.: Weibliche Bildung im 19. Jahrhundert: Fesselung von Kopf, Hand und Herz? in: Brehmer/Jacobi-Dittrich/Kleinau/Kuhn (Hrsg.): Frauen in der Geschichte IV, Schwann-Bagel GmbH Düsseldorf 1983, S. 219 - 243
Lämmert, Eberhard: Bürgerlichkeit als literarhistorische Kategorie, in: Kocka, J. (Hrsg.): Bürger und Bürgerlichkeit im 19. Jahrhundert, Sammlung Vandenhoeck & Ruprecht 1987 , S. 196 - 219
Lang, F.R., Baltes, M.M.: Brauchen alte Menschen junge Menschen? Überlegungen zu den Entwicklungsaufgaben im hohen Alter, in: Krappmann/Lepenies (Hrsg.); Alt und Jung - Spannung und Solidarität zwischen den Generationen, Campus Verlag Frankfurt a.M.; New York 1997, S. 161 - 184
Langbein, U.: Geerbte Dinge, Böhlau Verlag GmbH &Cie Köln 2002
Langendorf, Uwe, Kurth, Winfried u.a:. Gespaltene Gesellschaft und die Zukunft von Kindheit , Mattes Verlag Heidelberg 2013
Laslett, Peter: Familie Unabhängigkeit im Spannungsfeld zwischen Familien- und Einzelinteressen, in: Borscheid (Hg.): Ehe, Liebe Tod, zum Wandel der Familie, Coppenrath, Münster 1983,
Lauer, Gerhard (Hrsg.): Literaturwissenschaftliche Beiträge zur Generationsforschung, Wallstein Verlag Göttingen 2010
Lee, Nam-Ok: Transgenerationale Beziehungsmuster in Familien, 2005, Oldenburg
Lempp, R.: Geschwisterbeziehung in der Forschung, in: Klosinski, G. (Hrsg.:) Verschwistert mit Leib und Seele, Attempto Verlag Tübingen 2000, S. 220 - 232
Lempp, R.: Die Rolle des Vaters und ihre Veränderung im 20. Jahrhundert, in: Faulstich, W u. Grimm, G.E. (Hrsg.): Sturz der Götter? Suhrkamp Verlag Frankfurt a.M. 1989 , S. 176 - 189
Lenz, Karl (Hrsg.): Handbuch persönlicher Beziehungen, Juventa-Verlag Göttingen 2009
Leo, Annette: Stadtlandschaft mit Spuren, in: Danyel, J. (Hrsg.): Ost-Berlin, Ch. Links Verlag GmbH Berlin 2020, S. 81 - 95
Lepsius, M.: Zur Soziologie des Bürgertums und der Bürgerlichkeit, in: Kocka, J. (Hrsg.): Bürgertum und Bürgerlichkeit im 19. Jahrhundert, Sammlung, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 1987, S. 79 - 100
Liegle, L.: Geschwister und ihre erzieherische Bedeutung, in: Klosinski, G. (Hrsg.): Verschwistert mit Leib und Seele, Attempto Verlag Tübingen 2000, S. 84 - 97
Limmer, R.: Mein Papa lebt woanders - Die Bedeutung des getrenntlebenden Vaters für die psycho-soziale Entwicklung seiner Kinder, in: Mühling, T./Rost,H. (Hrsg.): Väter im Blickpunkt, Verlag Barbara Budrich, Verlag Opladen & Farmington Hills 2007, S. 243 - 268
Lindtke, Gustav: Die Stadt der Buddenbrooks, Verlag Max Schmidt-Römhild, Lübeck 1981
Lingelbach, Gabriele: Bürgerliche oder bürgerschaftliche Philanthropie? In: Budde/Conze/ Rauh (Hrsg.): Bürgertum nach dem bürgerlichen Zeitalter, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen, 2010, S. 69 - 79
Linke, Angelika: Sprachkultur und Bürgertum, Verlag J.B. Stuttgart Weimar 1996
Linnemann, Kai Arne: Die Sammlung der Mitte und die Wandlung des Bürgers, in: Hettling, M./Ulrich,B.(Hrsg.): Bürgertum nach 1945, Hamburg Edition 2005, S. 185 - 220
Loewnstein, B.: Auf der Suche nach der bürgerlichen Gesellschaft, in: Hettling, M./Ulrich,B. (Hrsg.) Bürgertum nach 1945, Hamburg Edition 2005, S. 61 - 84
Lohre, Matthias: Das Erbe der Kriegsenkel, Penguin Verlag 2018
Lublinski, Samuel: Thomas Mann. Die Buddenbrooks, in: Berliner Tageblatt, Jg. 31, H. 466, 13.9.1902
Lüscher, Kurt: Postmoderne Herausforderungen an die Generationenbeziehungen, in: Krappmann/Lepenies: Alt und Jung - Spannung und Solidarität zwischen den Generationen, Campus Verlag Frankfurt a.M.; New York, 1997, S. 32 - 48
Lüscher, K.: Generationenbeziehungen - Neue Zugänge zu einem alten Thema, In:
Lüscher, K. , Schultheis, F. (Hrsg.): Generationenbeziehungen in „postmodernen“ Gesellschaften, Universitätsverlag Konstanz GmbH 1993
Lüscher, K.: Die Ambivalenz von Generationenbeziehungen - eine allgemeine heuristische Hypothese, in: Kohli, M./Szydlik, M.(Hrsg.): Generationen in Familie und Gesellschaft, Leske + Budrich, Opladen 2000, S. 138 -161
Lundgreen, Peter (Hrsg.): Sozial- und Kulturgeschichte des Bürgertums, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2000
Lundgreen, P.: Bildung und Bürgertum, in: Lundgreen, P. (Hrsg.): Sozial- und
Kulturgeschichte des Bürgertums, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen, 2000, S. 173 - 195
Lutosch, Heide: Ende der Familie - Ende der Geschichte. Zum Familienroman bei Thomas Mann, Gabriel G. Marquez und Michael Houellebecq, Bielefeld, Aisthesis Verlag 2007.
Lütteken, Laurenz(Hrsg): Zwischen Tempel und Verein, Bärenreiter-Verlag Kassel, 2013
Lützeler, Paul M.: Kommentar, in: Kocka, J. (Hrsg.): Bürger und Bürgerlichkeit im 19. Jahrhundert, Sammlung Vandenhoeck& Ruprecht 1987 , S. 220 - 226
Lutz, B.: Integration durch Aufstieg, in: Hettling, M./Ulrich,B.(Hrsg.): Bürgertum nach 1945, Hamburg Edition 2005, S. 284 - 309
Maar, Michael: Die Schlange im Wolfspelz, Rowohlt Verlag Hamburg 2020,
Maentel,Th.: Zwischen weltbürgerlicher Aufklärung und stadtbürgerlicher Emanzipation. Bürgerliche Geselligkeitskultur um 1800, in: Hein,D./Schulz,A. (Hrsg.): Bürgerkultur im 19. Jahrhundert, C.H.Beck München 1996, S. 140 -154
Mann, Thomas: Lübeck als geistige Lebensform, Otto Quitzow Verlag, Kom.-Ges., Lübeck, 1926
Mann, Thomas: Buddenbrooks, Fischer-Verlag, Frankfurt am Main, 2018
Mann, Thomas: Gesammelte Werke Band X, Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1974
Mann, Thomas: Im Spiegel. In: Essays, Bd.1: Frühlingssturm 1893-1918. Hg. von Hermann Kurzke/Stephan Stachorski, Frankfurt a.M.1993, S. 101
Mann, Thomas: Selbstkommentare, Fischer-Verlag 1990
Mannheim, K. : Das Problem der Generationen 1928. In: Aufsätze zur Wissenssoziologie. hrgsg. von K.H. Wolff. Darmstadt/Neuwied 1964, S. 509-565; Zitat S. 517, in: Emmerich,W : Generationen-Archive-Diskurse. Wege zum Verständnis der deutschen Gegenwartsliteratur, in: Cambi, F.: Gedächtnis und Identität, Königshausen & Neumann, GmbH Würzburg 2008
Manning, Till: „.mit üblem geistig-seelisch-materiellen Mittelstand“ auf Reisen, in: Budde/ Conze/Rauh (Hrsg.): Bürgertum nach dem bürgerlichen Zeitalter, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 2010, S. 239- 254
Manz, G., Sachse E., Winkler, G. (Hrsg.): Sozialpolitik in der DDR, trafo Verlag Dr. Wolfgang Weist 2001
Manz, G.: Einkommens- und Subventionspolitik, in: Manz, G., Sachse E., Winkler, G. (Hrsg.): Sozialpolitik in der DDR, trafo Verlag Dr. Wolfgang Weist 2001, S. 179 - 198
Martin/Olson, S.: Die Übertragung von Interaktionsmustern zwischen Generationen, in: Edelstein, W.u.a.: Familie und Kindheit im Wandel, Verlag für Berlin-Brandenburg 1996
Martinec, Th./Nitschke, C. (Hrsg.): Familie und Identität in der deutschen Literatur, Regensburger Beiträge, Peter Lang GmbH Frankfurt 2009
Marx, W.: Familienkatastrophen. Über die Erzählfigur des Familienfestes in der Gegenwartsliteratur, in: Costagli, S., Galli, M. (Hrsg.): Deutsche Familienromane, Wilhelm Fink Verlag München 2010, S. 131-141
von Matt, P.: Verkommene Söhne, Missratene Töchter, Carl Hanser Verlag München Wien 1995
Matthias, Klaus : Studien zum Werk Thomas Mann, Schmidt-Römhild Lübeck 1967
Matzner, M.: Alleinerziehende Väter - eine schnell wachsende Familienform, in: Mühling, T /Rost, H. (Hrsg.): Väter im Blickpunkt, Verlag Barbara Budrich, Opladen & Farmington Hills 2007, S. 225 - 242
Max, Katrin: Bürgerlichkeit und bürgerliche Kultur in der Literatur der DDR, Wilhelm Fink Verlag, ein Imprint der Brill Gruppe, Brill Deutschland GmbH, Paderborn 2018
Mayer, Karl Ulrich, Schulze, Eva: Die Wendegeneration, Campus Verlag Frankfurt, New York 2009
Mayer, Karl-Ulrich: Familie im Wandel in Ost und West am Beispiel Deutschlands, in: Edelstein,W./Kreppner,K./Sturzbecher,D. (Hrsg.) Familie und Kindheit im Wandel, Verlag Für Berlin-Brandenburg, GmbH, Potsdam, 1996, S. 13-29
Mazohl, B.: Vom Tod Karls VI. bis zum Wiener Kongress (1740-1815), in: Winkelbauer, Th. : Geschichte Österreichs, Reclam Stuttgart 2015, S. 290 - 358
Mazohl, Brigitte: Die Zeit zwischen dem Wiener Kongress und den Revolutionen von 1848/49, in: Winkelbauer, Th. Geschichte Österreichs, Reclam Stuttgart 2015, S. 359 - 390
Mazohl, B.: Die Habsburgmonarchie 1448-1918, in: Winkelbauer, Th.: Geschichte Österreichs, Reclam Stuttgart 2015, S. 391 - 476
McLeod, Hugh: Weibliche Frömmigkeit - männlicher Unglaube? Religion und Kirchen im bürgerlichen 19. Jahrhundert, in: Frevert, Ute (Hrsg.): Bürgerinnen und Bürger, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 1988, S. 134 - 156
McMillan, Daniel A.: „. die höchste und heiligste Pflicht.“ Das Männlichkeitsideal der deutschen Turnbewegung 1811-1871, in: Kühne, Th. (Hrsg.): Männergeschichte - Geschlechtergeschichte, Campus Verlag Frankfurt a.M. 1996, S. 88 - 100
Menck, Peter: Geschichte der Erziehung, Auer Verlag GmbH Donauwörth, 2. erweiterte Auflage 1999
Mennemeier, F.N.: Literatur der Jahrhundertwende II, Verlag Peter Lang AG Bern 1988
Merkel, I.: Leitbilder und Lebensweisen von Frauen in der DDR, in: Kaelble,H., Kocka,J., Zwahr,H. (Hg.): Sozialgeschichte der DDR, Klett-Cotta, Stuttgart, 1994, S. 359 - 382
Mettele, G.: Der private Raum als öffentlicher Ort. Geselligkeit im bürgerlichen Haus, in: Hein,D./Schulz,A. (Hg.): Bürgerkultur im 19. Jahrhundert, C.H.Beck München, 1996
Metzler Lexikon Literatur, Dieter Burgdorf, Christoph Fassender, Burkhard Moennighoff, (Hrsg.), Stuttgart 2007
Meyer, S.: Die mühsame Arbeit des demonstrativen Müßiggangs. in: Hausen, K.(Hrsg.): Frauen suchen ihre Geschichte, C.H. Beck 1983, S. 172 - 194,
Mittenzwei, W.: Die Intellektuellen, Verlag Faber& Faber Leipzig 2001
Mitterauer/Sieder: Vom Patriarchat zur Partnerschaft, 4. Auflage München Beck 1991
Mommsen, Hans.: Die Auflösung des Bürgertum seit dem späten 19. Jahrhundert, in: Kocka, J. (Hrsg.): Bürger und Bürgerlichkeit im 19. Jahrhundert, Sammlung Vandenhoeck & Ruprecht 1987, S. 288 - 315
Möckel, Benjamin: Erfahrungsbuch und Generationsbehauptung, Wallstein Verlag Göttingen 2014
Möckel, Sebastian: Abenteuer und Initiation, in: Martinec/Nitschke (Hrsg.): Familie und Identität in der deutschen Literatur, Lange GmbH Frankfurt am Main 2009, S. 57 - 77
Moeller, Bernd: Pfarrer als Bürger, Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 1972
Möller, F.: Zwischen Kunst und Kommerz. Bürgertheater im 19. Jahrhundert, in: Hein,D./ Schulz,A. (Hrsg.): Bürgerkultur im 19. Jahrhundert, Verlag C.H.Beck München 1996, S. 19 - 33
Möller, Horst: Geschichte im demokratischen Pluralismus und im Marxismus-Leninismus, in: Fischer,A./Heydemann, G. (Hrsg.): Geschichtswissenschaft in der DDR, Band I: Historische Entwicklung, Theoriediskussion und Geschichtsdidaktik, Duncker & Humblot Berlin 1988, S. 33 - 43
Moen, Phyllis: Generationenbeziehungen in der Sichtweise einer Soziologie des Lebenslaufes - Das Verhältnis von Müttern zu ihren erwachsenen Töchtern als Beispiel, in: Lüscher, K,Schultheis,F.(Hrsg.): Generationenbeziehungen in postmodernen Gesellschaften, Universitätsverlag Konstanz GmbH, 1993, S. 249 - 263
Morré, Jörg: Karlshorst - mehr Villenvorort als Berliner Kreml, in: Danyel, J. (Hrsg.): Ost- Berlin, Ch. Links Verlag GmbH Berlin 2020, S. 203 - 218
Mühling, T./Rost, H.(Hrsg.): Väter im Blickpunkt, Verlag Barbara Budrich, Opladen & Farmington Hills 2007
Mühling, T.: Wie verbringen Väter ihre Zeit? Männer zwischen „Zeitnot“ und „Qualitätszeit“, in: Mühling, T./Rost, H. (Hrsg.): Väter im Blickpunkt, Verlag Barbara Budrich, Opladen & Farmington Hills 2007, S. 115 - 160
Müller, Sven Oliver: Ein fehlender Neuanfang, in: Budde/Conze/Rauh (Hrsg.): Bürgertum nach dem bürgerlichen Zeitalter, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 2010, S. 255 - 269
Naumann, K.: Schlachtfeld und Geselligkeit, in: Hettling,M./Ulrich,B.(Hrsg.): Bürgertum nach 1945, Hamburg Edition 2005, S. 310 - 346
Naumann, K. (Hrsg.): Nachkrieg in Deutschland, Hamburger Edition HIS Verlagsges.mbH 2001
Nave-Herz, R. (Hg.): Wandel und Kontinuität der Familie in der Bundesrepublik Deutschland, Pp. 145-172, Stuttgart: Enke 1988
Nave-Herz, R. und Markefka, M. (Hrsg): Handbuch der Familien- und Jugendforschung 1, Luchterhand Verlag, Neuwied und Frankfurt/M 1989
Nave-Herz, R.: Familie heute, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Primus Verlag Darmstadt 1994
Nave-Herz, R./ Sander, D.: Heirat ausgeschlossen? Ledige Erwachsene in sozialhistorischer und subjektiver Perspektive, Campus Verlag Frankfurt/Main 1998
Nave-Herz, R.: Familie heute, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Primus Verlag Darmstadt, 3. überarbeitete und ergänzte Auflage 2007
Nave-Herz, R.: Geschwisterbeziehungen in: Lenz, K. (Hrsg.): Handbuch persönlicher Beziehungen, Juventa-Verlag Göttingen 2009, S. 337 - 352
Nayhauss v. Graf, H.Chr.: Deutschsprachige Literaturen nach der Wende 1989 Kontinuität oder Neubeginn? in: Hess-Lüttich, E.W.B., v. Maltzan, C., Thorpe, K.: Gesellschaften in Bewegung, Peter Lang GmbH Frankfurt am Main 2016, S. 127- 143
Negt, Oskar: Überlebensglück, Steidl, Göttingen 2006
Nehring, Holger: Bürgerlichkeit als Protest in: Budde/Conze/Rauh (Hrsg.): Bürgertum nach dem bürgerlichen Zeitalter, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 2010, S. 133 -147
Neugebauer, Wolfgang: Vom Sport frei! zum Techno, in: Danyel, J. (Hrsg.): Ost-Berlin, Ch.
Links Verlag GmbH Berlin 2020, S. 247 - 254
Neuhäußer-Wespy, U.: Aspekte und Probleme der Umorientierung in der Geschichtswissenschaft der DDR von 1971/72, in: Fischer,A./Heydemann,G. (Hrsg.): Geschichtswissenschaft in der DDR, Band I: Historische Entwicklung, Theoriediskussion und Geschichtsdidaktik, Duncker& Humblot, Berlin 1988, S. 77 - 102
Neumann, Thomas W.: Der Bombenkrieg, in: Naumann, K. (Hrsg.): Nachkrieg in Deutschland, Hamburger Edition HIS Verlagsges.mbH 2001, S. 319 - 342
Neun, O.: Zur Kritik am Generationenbegriff von Karl Mannheim, in: Kraft,A./Weißhaupt,M. (Hrsg.): Generationen: Erfahrung - Erzählung - Identität, UVK Verlagsgesellschaft GmbH Konstanz 2009, S. 217 - 242
Neuschäfer, Markus: Vom doppelten Fortschreiben der Geschichte, Familiengeheimnisse im Familienroman, in: Lauer, G. (Hrsg.): Literaturwissenschaftliche Beiträge zur Generationsforschung, Wallstein Verlag Göttingen 2010, S. 164 - 203
Neuschäfer, Markus: Das bedingte Selbst, Familie, Identität und Geschichte im zeitgenössischen Generationenroman, epuli GmbH Berlin 2013
Neutsch, C., Witthöft, H.: Kaufleute zwischen Markt und Messe, in: Bausinger, Beyer, Korff: Reisekultur, Verlag C. H. Beck München 1991
Niederstätter, Alois: Geschichte Österreichs, Verlag W. Kohlhammer 2007
Niethammer, Lutz: Wohnen im Wandel, Peter Hammer Verlag Wuppertal 1979
Nipperdey, Th.: Kommentar: „Bürgerlich“ als Kultur, in: Kocka, J. (Hrsg.): Bürger und Bürgerlichkeit im 19. Jahrhundert, Sammlung, Vandenhoeck & Ruprecht 1987
Nipperdey, Th.: Wie das Bürgertum die Moderne fand, Reclam Berlin 1998, Wolf Jobst Siedler Verlag GmbH Berlin 1988
Obertreis, Gesine: Familienpolitik in der DDR 1945 - 1980, Opladen Leske und Budrich 1986
Ochs, Eva: Viele Männer überlebten kaum ihre Pensionierung, Interview von Nora Schareika, in Wirtschaftswoche, 26.Juni 2020
Ottmüller, Uta: Die Dienstbotenfrage, verlag frauenpolitik gmbH 1978
Peikert, I.: Zur Geschichte der Kindheit im 18. und 19. Jahrhundert, in: Reif, Heinz (Hrsg.):
Die Familie in der Geschichte, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 1982
Pieske, Christa: Wandschmuck im bürgerlichen Heim um 1870, in: Niethammer, L. (Hg.): Wohnen im Wandel, Peer Hammer Verlag Wuppertal 1979, S. 252- 270
Pikulik, Lothar: Leistungsethik contra Gefühlskult, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 1984
Pitrou, A.: Generationenbeziehungen und familiale Strategien, in: Lüscher, K, Schultheis, F. (Hrsg.): Generationenbeziehungen in „postmodernen“ Gesellschaften, Univesitätsverlag Konstanz GmbH 1993, S. 75 - 93
Pohl, H./Treue,W. (Hrsg.): Zeitschrift für Unternehmensgeschichte,Beiheft 35, Die Frau in der deutschen Wirtschaft, Steiner Verlag Wiesbaden GmbH Stuttgart 1985
Poiger, Uta G.: Krise der Männlichkeit, in: Naumann, K. (Hrsg.): Nachkrieg in Deutschland, Hamburger Edition HIS Verlagsges.mbH 2001, S. 227 - 263
Pokrywka, R.: Der Generationenroman als Figuration historischer Übergänge, May 2015;
Studia Germanica Posnaniensia. DOI:10.14746/sgp.2013.34.a.a.O.
Pollack, D.: Von der Volkskirche zur Minderheitskirche. Zur Entwicklung von Religiosität und Kirchlichkeit in der DDR, in: Kaelble, H., Kocka ,J., Zwahr, H. (Hrsg.): Sozialgeschichte der DDR, Klett-Cotta, Stuttgart 1994, S. 271 - 294
Potthoff, Marie-Christine: Traditionelle Bürgerlichkeit im internationalen Kontext: Rotary und Lions Clubs nach 1945, in: Budde/Conze/Rauh(Hrsg.): Bürgertum nach dem bürgerlichen Zeitalter, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 2010, S. 81 - 98
Pragal, Peter: Vertraute Femde, in: Danyel, J. (Hrsg.): Ost-Berlin, Ch. Links Verlag GmbH
Berlin 2020, S. 383 - 396
Prahl, H.-W./ Steinecke, A.: Der Millionen-Urlaub, Luchterhand Verlag 1979
Prein, Philipp: Bürgerliches Reisen im 19. Jahrhundert, LITVerlag Münster 2005
Preuss-Lausitz, Ulf u.a.: Kriegskinder Konsumkinder Krisenkinder, 4. Auflage Beltz Verlag Weinheim und Basel 1995
Preußler, H.-P.: Vom Roman zu Film und Doku-Fiktion sowie retour.Die BuddenbrooksundDie Manns,in: Costagli, S., Galli, M. (Hrsg.): Deutsche Familienromane, Wilhelm Fink Verlag München 2010, S. 85- 96
Rabe, Anneliese: Das weibliche Erziehungsideal und die Stellung der Frau in der Gesellschaft, Philosoph. Fakultät Münster 1925
Rabe, Anne: Die Möglichkeit von Glück, Klett-Cotta Stuttgart 2023
Radebold, Bohleber, Zinnecker (Hrsg.): Transgenerationale Weitergabe kriegsbelasteter Kindheiten - Interdisziplinäre Studien zur Nachhaltigkeit historischer Erfahrungen über vier Generationen, Juventa Verlag Weinheim und München 2008
Radebold, Hartmut: Die dunklen Schatten unserer Vergangenheit, Stuttgart 2009
Rapoport, Ingeborg: Meine ersten drei Leben, 1. Auflage Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage GmbH, Berlin 2021
Rathkolb, Oliver: Erste Republik, Austrofaschismus, Nationalsozialismus (1918-1945) in:
Winkelbauer, Th.: Geschichte Österreichs, Reclam Stuttgart, S. 477 - 524
Rathkolb, O.: Die Zweite Republik, in: Winkelbauer, Th. (Hg.): Geschichte Österreichs, reclam Stuttgart 2015, S. 525 - 594
Raulff, U. u. Strittmatter, E. (Hrsg.): Thomas Mann in Amerika, Deutsche Schillergesellschaft Marbach am Neckar 2018
Rehm, Walter: Der Dichter und die neue Einsamkeit, Aufsätze zur Literatur um 1900, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 1969
Reif, H. (Hrsg.): Die Familie in der Geschichte , Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 1982
Reulecke, Jürgen: „Wir reiten die Sehnsucht tot“ oder: Melancholie als Droge, Anmerkungen zum bündischen Liedgut, in: Kühne, Th. (Hrsg.): Männergeschichte - Geschlechtergeschichte, Campusverlag Frankfurt a.M. 1996, S. 155 - 173
Reulecke, J.: Kriegskindergenerationen im 20. Jahrhundert: zwei Väter- und Söhnegenerationen im Vergleich, in: Kraft,A./Weißhaupt,M. (Hrsg.): Generationen: Erfahrung - Erzählung - Identität , UVK Verlagsgesellschaft mbH Konstanz 2009, S. 243 - 260
Richter, Daniela: „Lasset die Kinder Menschen werden.“ in: Martinec/Nitschke (Hrsg.): Familie und Identität in der deutschen Literatur, Lang GmbH Frankfurt am Main 2009, S. 141-159
Richter, Dieter: Das fremde Kind, S. Fischer Verlag GmbH 1987
Richter, J.Th:. Sippenhaft: Amerikanische Familienromane der Gegenwart zwischen Gattungsdiskurs und Sozialreferenz, in: Costagli, S., Galli, M. (Hrsg.): Deutsche Familienromane, Wilhelm Fink Verlag München 2010, S. 207- 218
Rieger, Eva: Die geistreichen aber verwahrlosten Weiber - Zur musikalischen Bildung von Mädchen und Frauen, in: Brehmer/Jacobi-Dittrich/Kleinau/Kuhn (Hrsg.): Frauen in der Geschichte IV, Schwann-Bagel Düsseldorf 1983, S. 397 - 406
Riehl, Wilhelm Heinrich: Die Familie, Stuttgart: J.G. Cotta’scher Verlag 1861 Riehl, W.H.: Die Naturgeschichte des Volkes als Grundlage einer deutschen Sozialpolitik. Dritter Band: Die Familie, 12. Auflage Stuttgart u. Berlin 1904,
Rolff, Hans.-G.: Massenkonsum, Massenmedien und Massenkultur - Über den Wandel kindlicher Aneignungsweisen, in: Preuss-Lausitz, U. u.a.: Kriegskinder Konsumkinder Krisenkinder, Verlag Beltz Weinheim und Basel 1995 4. Auflage, S. 153 -167
Rosenthal, Gabriele (Hrsg.): Die Hitlerjugend-Generation, verlag die blaue eule 1986
Rosenthal, Gabriele, Pilzer, Harald: Die nationalsozialistishe Weltanschauung - das nationalsozialistische Deutungsmuster, in: Rosenthal, G. (Hrsg.): Die HitlerjugendGeneration, verlag die blaue eule 1986, S. 35 - 45
Rosenthal, G., Rummler, M., Schmidt, S.: Die Erziehung zur unpolitischen Hausfrau und Mutter, in: Rosenthal, G. (Hrsg.): Die Hitlerjugendgeneration, verlag die blaue eule 1986, S. 55 - 72
Rost, H.: Der Kinderwunsch von Männern und ihr Alter beim Übergang zur Vaterschaft, in: Mühling, T./Rost,H.(Hrsg.): Väter im Blickpunkt, Verlag Barbara Budrich, Opladen & Farmington Hills 2007, S. 77 - 96
Rosenbaum, H.: Formen der Familie, Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1996, 7. Auflage
Rousseau, J.-J. : Emile Bd 1, Paderborn 1910
Rousseau, J.-J. : Emile oder über die Erziehung, Ausgabe Reclam Stuttgart 1963,
Roth, R.: Von Wilhelm Meister zu Hans Castorp. Der Bildungsgedanke und das bürgerliche Assoziationswesen im 18. und 19. Jahrhundert, in: Hein,D./Schulz,A. (Hrsg.): Bürgerkultur im 19. Jahrhundert, C.H.Beck München 1996, S. 121 -139
Rudolphi, T: Gemälde weiblicher Erziehung, Heidelberg 1807, ND Lage: Beas 1998 in Richter, Daniela: „Lasset eure Kinder Menschen werden“. Das Engagement deutscher Bürgertumsfrauen in der Kindererziehung des 19. Jh. in: Martinec, Th./Nitschke, C. (Hrsg): Familie und Identität in der deutschen Literatur, Peter Lang GmbH Frankfurt a.M. 2009
Rüschemeyer, Dietrich: Bourgeoisie, Staat und Bildungsbürgertum. Idealtypische Modelle für die vergleichende Forschung von Bürgertum und Bürgerlichkeit, in: Kocka, J. (Hrsg.): Bürger und Bürgerlichkeit im 19. Jahrhundert, Sammlung, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 1987 S. 101-120
Rüsen,J./ Vasicek,Z.: Geschichtswissenschaft zwischen Ideologie und Fachlichkeit. Zur Entwicklung der Historik in der DDR, in: Fischer,A./Heydemann,G. (Hrsg.): Geschichtswissenschaft in der DDR, Band I: Historische Entwicklung, Theoriediskussion und Geschichtsdidaktik, Duncker & Humblot Berlin 1988, S. 307 - 331
Ruge, Eugen: In Zeiten des abnehmenden Lichts, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg, 2012
Rumpler, H.: Parteilichkeit und Objektivität als Theorieproblm der Historie in der DDR, in: Fischer,A./Heydemann,G. (Hrsg.): Geschichtswissenschaft in der DDR, Band I: Historische Entwicklung, Theoriediskussion und Geschichtsdidaktik, Duncker& Humblot Berlin1988, S. 333 - 362
Sandberger, Wolfgang: Musik als bürgerliche Lebenswelt , Die Idee der deutschen Musikfeste und Musikvereine an ausgewählten Beispielen, in: Lüttgen, L. (Hrsg): Zwischen Tempel und Verein, Bärenreiter-Verlag Kassel 2013, S. 51 - 70
Sczesny, A.: Projektionen und Wirklichkeiten - Die Familie und das Fernsehen, in: Weber, W.E.J./Herzog, M.: „Ein Herz und eine Seele“? Familie heute, W. Kohlhammer Verlag Stuttgart 2003, S. 129 - 147
Schäfer, M.: Geschichte des Bürgertums, UTB Stuttgart 2009,
Schellong, Dieter: Bürgertum und christliche Religion, Chr. Kaiser Verlag München 1975
Schelsky, H.: Die skeptische Generation, Eugen Diedrichs Verlag Düsseldorf 1957
Scheurer, H.: „Autorität und Pietät“ - Wilhelm Heinrich Riehl und der Patriarchalismus in der Literatur des 19. Jahrhundert, in: Brinker-von der Heyde/Scheurer (Hrsg.): Familienmuster-Musterfamilien, Frankfurt a.M., Lang 2004, S. 135 -160
Schindler, J.: Panikmache - Wie wir vor lauer Angst unser Leben verpassen, Fischer Verlag Frankfurt am Main 2016
Schmuhl, Hans-Walter: Bürgertum und Stadt, in: Lundgreen, P.: Sozial- und Kulturgeschichte des Bürgertums, Vandenhoeck & Ruprecht 2000, S. 224 - 249
Schneider, Norbert F.: Familie und private Lebensführung in West- und Ost-Deutschland, Ferdinand Enke Verlag Stuttgart 1994
Schneider,Ulrike/Völkening, Helga/Vorpahl, Daniel (Hrsg.): Zwischen Ideal und Ambivalenz, Geschwisterbeziehungen in ihren soziokulturellen Kontexten, Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften Frankfurt 2015
Schneider Taylor, Barbara: Jean-Jacques Rousseaus Konzeption derSophie,Verlag Dr. Kovac Hamburg 2006
Schnor, Christine: Trennungsrisiko von Paaren mit Kindern: Der Einfluss der Religion in West- und Ostdeutschland, in: Huinink, J., Kreyenfeld, M., Trappe, H. (Hrsg.:) Familie und Partnerschaft in Ost- und Westdeutschland, Verlag Barbara Budrich Opladen, Berlin & Toronto 2012, S. 229 - 256
Schön, Claudia: Protokollstrecke, in: Danyel, J. (Hrsg.): Ost-Berlin, Chr. Links Verlag GmbH Berlin 2020, S. 57 - 68
Schorn-Schütte. L., Sparn, W. (Hrsg.): Evangelische Pfarrer, Kohlhammer Verlag Stuttgart1997
Schorn-Schütte, L.: „Das Predigtamt ist nicht ein hofe diener oder bauernknecht“ Überlegungen zu einer Sozialbiographie protestantischer Pfarrer in der Frühzeuzeit, in: Wolfenbütteler Forschungen: Problems in the Historical Anthropology of Early Modern Europe, Harrassowitz Verlag Wiesbaden 1997, S. 263 - 286
Schütterle, Juliane: Der Duft der großen weiten Welt in: Danyel, J. (Hrsg.:) Ost-Berlin, Ch. Links Verlag GmbH Berlin 2020, S. 133 - 146
Schütze, Yvonne: Mutterliebe - Vaterliebe. Elternrollen in der bürgerlichen Familie des 19. Jahrhunderts in: Frevert, Ute (Hrsg.): Bürgerinnen und Bürger, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 1988, S. 118 - 133
Schütze, Yvonne : Vereinbarkeit von Familie und Beruf, in: Jans, B. /Sering, A. (Hrsg.): Familien im wiedervereinigten Deutschland, Vektor-Verlag Grafschaft 1992, S. 87 - 93
Schütze, Y: Generationenbeziehungen im Lebenslauf - eine Sache der Frauen? in: Lüscher, K., Schultheis, F. (Hrsg.): Generationenbeziehungen in „postmodernen“ Gesellschaften, Universitätsverlag Konstanz GmbH 1993, S. 287 - 298
Schütze, Y./Geulen: D. Die „Nachkriegskinder“ und die „Konsumkinder“: Kindheitsverläufe zweier Generationen, in: Preuss-Lausitz u.a.: Kriegskinder Konsumkinder Krisenkinder, Beltz Verlag, 4. unveränderte Auflage Weinheim und Basel 1995
Schütze, Yvonne: Generationenbeziehungen: Familie, Freunde und Bekannte, in: Krappmann/Lepenies (Hrsg.): Alt und Jung - Spannung und Solidarität zwischen den Generationen, Campus Verlag Frankfurt a.M. ; New York 1997, S. 97 - 111
Schultz, H. J. (Hrsg.): Einsamkeit, Kreuz Verlag Stuttgart, 5. Auflage 1986
Schulz, Hermann, Radebold, Hartmut, Reulecke, Jürgen: Söhne ohne Väter, Ch. Links Verlag Berlin 2. erweiterte Auflage 2007
Schulze, Hans-Michael: Wege nach „Oberschweineöde“, in: Danyel, J. (Hrsg.): Ost-Berlin, Ch. Links Verlag GmbH Berlin 2020, S. 221 - 228
Schumann, Wolfgang: Jedem (s)eine Wohnung? Wohnen in Marzahn, in: Danyel, J. (Hrsg.): Ost-Berlin, Ch. Links Verlag GmbH Berlin 2020, S. 185 - S.200
Schwitzer K.-P.: Senioren, in: Manz, G., Sachse E., Winkler, G. (Hrsg.): Sozialpolitik in der DDR, trafo Verlag Dr. Wolfgang Weist 2001, S. 337 - 356
Schwob, Peter: Großeltern und Kinder - Zur Familiendynamik der Generationsbeziehung, Roland Asanger Verlag Heidelberg1988
Schwöbel, Christoph: Die Religion des Zauberers, Mohr Siebeck Tübingen 2008
Seegers, Lu: Prominenz und bürgerlicher Wertewandel in der Bundesrepublik 1965-1980, in: Budde/Conze/Rauh (Hrsg.): Bürgertum nach dem bürgerlichen Zeitalter, Bandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2010, S. 271 - 284
Segalen, M.: Die Familie, Campus Verlag Frankfurt/New York 1990
Segalen, M.: Die Tradierung des Familiengedächtnisses in den heutigen französischen Mittelschichten, in: Lüscher, K., Schultheis, F. (Hg.) : Generationenbeziehungen in „postmodernen“ Gesellschaften, Universitätsverlag Konstanz GmbH 1993
Seidler, M.: Zwischen Demenz und Freiheit; Überlegungen zum Verhältnis von Alter und Geschlecht in der Gegenwartsliteratur, in: Hartung, H. u.a. (Hrsg.): Graue Theorie, Böhlau Verlag GmbH&Cie Köln Weimar Wien 2007, S.195 - 212
Seifert, Th.: Wachstum im Alleinsein: Singles und andere, in: Schultz:, H.-J. (Hg.), a.a.O.
Einsamkeit, Kreuz Verlag Stuttgart, 5. Auflage 1986, S. 157
Shortt, L.: „Verortete Identität“: Generationen- und Heimatdiskurs in Angelika Overaths „Nahe Tage“ in: Kraft,A./Weißhaupt,M. (Hrsg.): Generationen: Erfahrung - Erzählung - Identität, UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz 2009, S. 115 - 145
Siebel, Walter: Wohnen und Familie in: Handbuch der Familien- und Jugendforschung, 1996
Sieder, Reinhard: Sozialgeschichte der Familie, Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1987
Sitzler, Susann: Geschwister, Klett-Cotta 2014
Sobania,M.: Vereinsleben. Regeln und Formen bürgerlicher Assoziationen im 19. Jahrhundert, in:Hein,D./Schulz,A. (Hrsg.): Bürgerkultur im 19. Jahrhundert, C.H.Beck München 1996, S. 170-190
Sombart, Nicolaus: Männerbund und Politische Kultur in Deutschland, in: Kühne, Th. (Hrsg.): Männergeschichte - Geschlechtergeschichte, Campus Verlag Frankfurt a.M. 1996, S. 136 - 154
Sperber, Manes: Von Not und Nutzen der Einsamkeit, in: Hans Jürgen Schultz, H.-J. (Hg.): Einsamkeit, Kreuz Verlag Stuttgart, 5. Auflage 1986
Steinecke, H.: Romanpoetik von Goethe bis Thomas Mann, Wilhelm Fink Verlag München 1987
Stifter, A.: Nachsommer, Winkler Verlag München 1949
Stiehler, S.: Alleinerziehende Väter, Juventa Verlag Weinheim und München 2000
Streubel, Christiane: Wir sind die Geschädigten, Lebenseindrücke von Rentnern in Eingaben an die Staatsführung der DDR, in: Hartung, H, u.a. (Hrsg.): Böhlau Verlag GmbH &Cie, Köln Weimar Wien, 2007, S. 241 - 263
Sylvester, Regine: Berlin-Mitte in: Danyel, J. (Hrsg.): Ost-Berlin, Ch. Links Verlag GmbH Berlin 2020, S. 107 - 115
Sywottek, A.: „Marxistische Historik“: Probleme und Scheinprobleme, in: Fischer,A./ Heydemann,G. (Hrsg.): Geschichtswissenschaft in der DDR, Band I: Historische Entwicklung, Theoriediskussion und Geschichtsdidaktik, Duncker& Humblot Berlin1988, S. 255 - 268
Szinovacz, E.: Lebensverhältnisse der weiblichen Bevölkerung in Österreich, Schriftenreihe zur sozialen und beruflichen Stellung der Frau 9. 1070, 21
Tenfelde, K.: Dienstmädchengeschichte, in: Pohl, H. /Treue, W. ZfU Beiheft 35, Die Frau in der deutschen Wirtschaft, Steiner Verlag Wiesbaden, Stuttgart 1985, S. 105 - 119
Tenorth, Heinz-Elmar: Geschichte der Erziehung, Juventa Verlag Weinheim und München, 5. Auflage 2010
Tholen, Toni: Heillose Subjektivität. Zur Dialektik von Selbstkonstitutionen und Auslöschung in Familienerzählungen der Gegenwart, in: Martinec/Nitschke (Hrsg.): Familie und Identität in der deutschen Literatur, Lang GmbH Frankfurt am Mai 2009, S. 35 - 54
Tietze, G.: Die Spezifik der Sozialpolitik in den Betrieben, Territorien und Organisationen, in:
Manz, G., Sachse E., Winkler, G. (Hrsg.): Sozialpolitik in der DDR, trafo Verlag Dr. Wolfgang Weist 2001, S. 53 - 82
Trappe, H.: Emanzipation oder Zwang? Frauen in der DDR zwischen Beruf, Familie und Sozialpolitik , Akademie Verlag Berlin 1995
Tremp, Peter: Rousseaus Emile als Experiment der Natur und Wunder der Erziehung, Leske + Budrich Opladen 2000
Trepp, Anne-Charlott: Männerwelten privat: Vaterschaft im späten 18. und beginnenden 19. Jahrhundert, in: Kühne Th. (Hrsg.): Männergeschichte - Geschlechtergeschichte, Campus Verlag Frankfurt a.M. 1996, S. 31 - 50
Trepp, A.-Ch.: Sanfte Männlichkeit und selbständige Weiblichkeit. Frauen und Männer im Hamburger Bürgertum zwischen 1770 und 1840, Vandenhoeck & Ruprecht 1995,
Trepp,Anne-Charlott: Emotion und bürgerliche Sinnstiftung oder die Metaphysik des Gefühls: Liebe am Beginn der bürerlichen Zeitalters, in: Hettling/Hoffmann (Hrsg.): Der bürgerliche Wertehimmel, Vandenhoeck & Ruprecht ,Göttingen 2000, S. 23 - 55
Vagnet, Hans. Rudolf: Thomas Mann und die amerikanische Literatur. Eine Skizze in: Raulff, U. u. Strittmatter, E. (Hrsg.): Thomas Mann in Amerika Deutsche Schillergesellschaft Marbach am Neckar 2018, S. 25-39.
Vierhaus, Rudolf: Der Aufstieg des Bürgertums vom späten 18. Jahrhundert bis 1848/49 in: Kocka, J. (Hrsg.): Bürger und Bürgerlichkeit im 19. Jahrhundert, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 1987, S. 64 - 78
Völkening, Helga: „Dann sei dir darüber im Klaren, dass du auch ein Bruder bist“. Prämissen, Implikationen und Funktionen geschwisterbezogener Terminologie, Rezeption und Metaphorik - Versuch einer disziplinübergreifenden Systematisierung, in: Schneider/ Völkening/Vorpahl (Hrsg.): Zwischen Ideal und Ambivalenz, Peter Lang GmbH Frankfurt, 2015, S. 15 - 64
Völkening, Helga: Themen, Kontexte und Perspektiven sozial- und individualpsychologischer Geschwisterforschung, in: Schneider/Völkening/Vorpahl (Hrsg.): Zwischen Ideal und Ambivalenz, Peter Lang GmbH Frankfurt 2015, S. 65 - 82
Vogtmeier, Michael: Die Familien Mann und Buddenbrook im Lichte der Mehrgenerationen-Familientherapie, Untersuchungen zu Thomas Manns „Buddenbrooks. Verfall einer Familie“, Peter Lang Frankfurt am Main, 1987,
Walter, Jens: Die Buddenbrooks und ihre Pastoren, Weiland Verlag 1993
Warnke, Martin: Ein Motiv aus der politischen Ästhetik, in: Kocka, J. (Hrsg.): Bürger und Bürgerlichkeit im 19. Jahrhundert, Sammlung Vandenhoeck& Ruprecht Göttingen 1987, S. 227 - 238
WAZ (Westdeutsche Allgemeine Zeitung): Steinmeier nennt AfD „antibürgerlich“, 14.09.2019
WAZ: 14.01.2023, Felix Müller: Anne Wills Abschied von der Talkshow-Bühne
Weber, W. E.J./Herzog, M. (Hrsg.): „Ein Herz und eine Seele“? Familie heute, Verlag W. Kohlhammer GmbH Stuttgart 2003
Weber, W.E.J.: Familie heute - Historische Grundlagen und Erscheinungsformen, Perspektiven und Probleme, in: Weber, W.E.J./ Herzog, M. (Hrsg.): „Ein Herz und eine Seele“? Familie heute, W. Kohlhammer GmbH Stuttgart 2003, S. 117 - 128
Weber-Kellermann, Ingeborg: Die gute Kinderstube. Zur Geschichte des Wohnens von Bürgerkindern, in: Niethammer, Lutz: Wohnen im Wandel, Peter Hammer Verlag Wuppertal 1979, S. 44 - 64
Weber-Kellermann, Ingeborg: Die deutsche Familie, Suhrkamp-Verlag 1974
Wehler, Hans-Ulrich :Wie bürgerlich war das Deutsche Kaiserreich? In: Kocka, J.(Hg.): Bürger und Bürgerlichkeit im 19. Jahrhundert , Sammlung Vandenhoeck& Ruprecht, 1987 , S. 243 - S. 280
Wehler, Hans-Ulrich: Die Zielutopie der „Bürgerlichen Gesellschaft“ und die „Zivilgesellschaft“ heute, in: Lundgreen, P. (Hg.):Sozial- und Kulturgeschichte des Bürgertums, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2000, S. 85 - 92
Wehler, H.-J.: Deutsches Bürgertum nach 1945: Exitus oder Phönix aus der Asche? SBR Bochum 2001
von Weymarn-Goldschmidt, Denise: Adlige Geschwisterbeziehungen im 18. und 19. Jahrhundert - Ideale und gelebte Praxis, in: Schneider/Völkening/Vorpahl (Hrsg.): Zwischen Ideal und Ambivalenz, Peter Lang GmbH Frankfurt 2015, S. 159 - 175
Weichelt, Th.: Bürgerliche Villenkultur im 19. Jahrhundert, in: Hein,D./Schulz,A. (Hrsg.): Bürgerkultur im 19. Jahrhundert, C.H.Beck München 1996, S. 234 - 251
Weidermann, Volker: Mann vom Meer, Kiepenheuer&Witsch Köln 2023
Welzer, Harald: Schön unscharf: über die Konjunktur der Familien- und Generationsromane, Hamburger Edition HIS Verlagsges.mbH 2004
Welzer, H.: Krieg der Generationen, in: Naumann, K. (Hrsg.): Nachkrieg in Deutschland, Hamburger Edition HIS Verlagsges.mbH 2001, S. 552 - 571
Wienfort, Monika: Recht und Bürgertum, in: Lundgreen, P. (Hrsg.): Sozial- und Kulturgeschichte des Bürgertums, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen, 2000, S. 272 - 292
Wierling, D.: „Ich habe meine Arbeit gemacht - was wollte sie mehr?“ Dienstmädchen im städtischen Haushalt der Jahrhundertwende, in: Hausen, K. (Hrsg.): Frauen suchen ihre Geschichte, C.H. Beck München1983, S. 144 - 171
Wierling, Dorothee: Mädchen für alles, Verlag J.H.W. Dieth Nachf. GmbH Berlin Bonn 1987
Wierling, D.: Die Jugend als innerer Feind. Konflikte in der Erziehungsdiktatur der sechziger Jahre, in: Kaelble,H., Kocka,J., Zwahr,H. (Hrsg.): Sozialgeschichte der DDR, Klett-Cotta Stuttgart 1994, S. 404 - 425
Wildt, M.: Konsumbürger, in: Hettling,M./Ulrich,B.(Hrsg.): Bürgertum nach 1945, Hamburg Edition 2005, S. 255 - 283
Wilk, L: Großeltern und Enkelkinder, in: Lüscher, K., Schultheis, F.(Hrsg.): Generationenbeziehungen in „postmodernen „ Gesellschaften, Universitätsverlag Konstanz GmbH 1993, S. 203 - 214
Wilms, G.: Gleiche Bildungsmöglichkeiten für alle - Bildung in der DDR, in: Manz, G., Sachse E., Winkler, G. (Hrsg.): Sozialpolitik in der DDR, trafo Verlag Dr. Wolfgang Weist 2001, S. 243 - 262
von Wilpert, Gero: Das Bild der Gesellschaft. In: Buddenbrooks-Handbuch, hrsg. von :Ken Mulden und Gero von Wildert, Stuttgart 1988
von Wilpert, Gero: Sachwörterbuch der Literatur, Stuttgart, A. Kröner 1989
Winkelbauer, Th. (Hrsg): Geschichte Österreichs, Reclam, Stuttgart 2015
Wippermann, C., Calmbach, M., Wippermann, K.: Männer: Rolle vorwärts, Rolle rückwärts? Verlag Barbara Budrich, Opladen Farmington Hills, MI 2009
Wirsching, A.: Die Familie in der Moderne - Eine Krisengeschichte? in: Weber, W.E.J./ Herzog, M. (Hrsg.): „Ein Herz und eine Selle“? Familie heute, W. Kohlhammer GmbH Stuttgart 2003, S. 45 - S. 56
Wirth, G.: Zu Potsdam und anderswo, in: Hettling, M./Ulrich, B. (Hrsg.): Bürgertum nach 1945, Hamburg Edition 2005, S. 85 - 110
Wisskirchen, H.: Die Familie Mann, 4. Auflage,, Reinbek 2002
Wisskirchen, Hans: Die Welt der Buddenbrooks, S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2008
Wisskirchen, H.: Buddenbrooks - Die Stadt, der Autor und das Buch, in: Wisskirchen, H. : Die Welt der Buddenbrooks, S. Fischer Verlag GmbH Frankfurt a.M. 2008, S. 15 - 60
Wolbring, B. : „Auch ich in Arkadien!“ Die bürgerliche Kunst- und Bildungsreise im 19. Jahrhundert, in: Hein,D./Schulz,A. (Hrsg.): Bürgerkultur im 19. Jahrhundert, C.H.Beck München 1996
Wolfenbütteler Forschungen: Problems in the Historical Anthropology of Early Modern Europe, Harrassowitz Verlag Wiesbaden 1997
Wolle, Stefan u. Hertle,H.: Damals in der DDR, Bertelsmann München 2004
Wolle, Stefan: Die heile Welt der Diktatur, Ch. Links Verlag GmbH Berlin, 3. Auflage 2009
Wolle, Stefan: Ost-Berlin, Biografie einer Hauptstadt, Ch.Links Verlag Verlag GmbH 2020 Wünsch, Marianne: Moderne und Gegenwart, Erzählstrukturen in Film und Literatur, Belleville Verlag München 2012
Wünsch, Marianne: Vom späten „Realismus“ zur „Frühen Moderne“ In: Modelle des literarischen Strukturwandels, hrsg. von Michael Titzmann, (Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur, Bd 33). Tübingen 1991, S. 187 - 203
Zeh, Juli: Spieltrieb, Schöffling & Co, 2014
Zeiher, H.: Die vielen Räume der Kinder. Zum Wandel räumlicher Lebensbedingungen seit 1945, in: Preuss-Lausitz, U. u.a. Kriegskinder Konsumkinder Krisenkinder, Beltz Verlag Weinheim und Basel, 4. unveränderte Auflage 1995, S. 176-195
Ziegler, D: Das wirtschaftliche Großbürgertum, in: Lundgreen, P.(Hg.): Sozial- und Kulturgeschichte des Bürgertums , Vandenhoeck&Ruprecht Göttingen, 2000, S. 113 - S. 137
Zinn, Hermann: Entstehung und Wandel bürgerlicher Wohngewohnheiten und Wohnstrukturen, in: Niethammer, Lutz (Hg.): Wohnen im Wandel, Wuppertal Peter Hammer Verlag 1979, S. 13 - 27
Zinnecker, J.: Die ,transgenerationale Weitergabe der Erfahrung des Weltkriegs in der Familie, in: Radebold/Bohleber/Zinnecker (Hrsg.): Transgenerationale Weitergabe kriegsbelasteter Kindheiten - Interdisziplinäre Studien zur Nachhaltigkeit historischer Erfahrungen über vier Generationen, Juventa Verlag Weinheim und München 2008
Zwahr, H.: Umbruch durch Ausbruch und Aufbruch: Die DDR auf dem Höhepunkt der Staatskrise 1989, in: Kaelble,H., Kocka,J., Zwahr,H. (Hrsg.): Sozialgeschichte der DDR, Klett-Cotta, Stuttgart 1994, S. 426 - 465
Baier, T.: Die längste Liebe des Lebens, in: http://www.sueddeutsche.de/wissen/ geschwisterforschung-
Bauer, Ulrike, Interview mit Eugen Ruge, in: Literaturtest https://www.google.de/url? sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL4bjYyuHg AhWIsRQKHX_6DaQQFjAJegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fimages-eu.ssl-images- amazon.com%2Fimages%2FI%2F61343RqXLlS.pdf&usg=AOvVaw3VeVNnD7cjaP4RWR _RE8kv
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. https://www.google.de/url? sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUi7mhw7v Ah WYgP0HHQV3DPwQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bmbwf.gv.at%2FTheme n%2Fschule%2Fschulpraxis%2Fschwerpunkte%2Fkulturvermittlung%2Fschach.html&usg =AOvVaw08ncpMaPBuR8b1WE2k9NdE).11.06,2023
Fadinger, J.: Zusammenhang von Erinnerung und Identität im neuen österreichischen Familienroman, Diplomarbeit Universität Wien 2012 ottes,univie.ac.at/19718, S. 15
Feßmann,: „Leidenschaft und Geduld“ Laudatio zu Arno Geiger https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHqqHiu8L-AhUG7aQKHbZXD8MQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.kas.de%2Fc%2Fdocument_library%2Fget_file%3Fuuid%3Dc199819b-4856-3219-b796-97f90740ad5a%26groupId%3D252038&usg=AOvVaw2Oxl6qYxzset9mcPHSg9jo
http://www.litrix.de/de/buecher.cfm?publicationId=708 Arno Geiger Es geht uns gut
Fleischer, J.: Rezension des Romans „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ von Eugen Ruge, in: Leipziger Volkszeitung, 10.10.2011, http://www.lvz.de/Nachrichten/Kultur/ Rezension-des Romans-In-Zeiten-des-abnehmenden-Lichts
Fugmann, T.: In Zeiten des abnehmenden Lichts, Memonto vom 13. 10. 2011 im Internet Archive, in: NDR am 10.10.2011, aufgerufen am 20. Juni 2021
Kegel, Sandra, Ein deutsches Jahrhundert im Roman. Der Untergang des Hauses Ruge, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26.8.2011, http: //www. faz.net/aktuell/feuilleton/ buecher/ein-deutsches-jahrhundert-im-roman-der-untergang-des-hauses- ruge-11125457.html,aufgerufen am 27.02.2019 https://www.sueddeutsche.de/wissen/geschwisterforschung-die-längste-liebe-des-lebens7.5.2012,
Köhler, A./Köhler,D. Im Gespräch mit Eugen Ruge. In: Die Berliner Literaturkritik, 11.2.12 http://www.berlinerliteraturkritik.de/detailseite/artikel/im-gespräch-mit-eugen-ruge.html, 27.02.2019 https://presto.amu.edu.pl>sgp>article>view
Pokrywka, Rafael: Der Generationenroman als Figuration historischer Übergänge. Arno Geiger ,Es geht uns gut’, Studia Gemanica, Posnanlensia, 2013, http://www. Literaturhaus . at/index.php?id=5232
http://literaturkritik.de/id/1072715.0617 Matthias Prangel : Komplexer als ein Wirtshaus; Arno
Geiger spricht über das Problem, einen Roman über das Familienleben zu schreiben
http://www.deutschlandfunk.de/neun_tage_fuer_ein_halbes_jahrhundert Michaela Schmitz15.06.17
vgl. https: // www.stern.de lifestyle Leben 17.12.2021, aufgerufen 18.12.23
www.tagesspiegel.de Tagesspiegel Berlin, 30.07.2018, Buchpreissträger Ruge im Gespräch „Ich fühle mich wie der verlorene Sohn“ Interview mit Lena Schneider
Eugen Ruge im Interview: „Das Beste an Lenin ist sein Bart.“ https:// www.tagesspiegel.de.
Eugen Ruge: Buchpreisträger verliebt sich., https.//www.welt.de
Eugen Ruge im Gespräch in: Berliner Literaturkritik,11.02.12, www.berlinerliteraturkritik.de.
Vedder, Ulrike im Programm der Konferenz ,Am Nullpunkt der Familie’: Generationen und Genealogien in der Gegenwartsliteratur, vom 15./16.2.2008 im Zentrum für Literatur- und Kulturforschung Berlin.http://www.zfl.gwz-berlin.de/veranstaltungen/veranstaltungen///259?cHash-cddd716ae5.
www.zeit.de.Kultur „Die elementare Struktur der Verwandtschaft“ zeit online, Ilse Radisch
Quellenangaben
[...]
1http://www.spiegel.de/spiegel/a-371760.html 12.06.17
2https://presto.amu.edu.pl>sgp>article>view Pokrywka, Rafael: Der Generationenroman als Figuration historischer Übergänge. Arno Geiger ,Es geht uns gut’, Studia Gemanica, Posnanlensia, 2013, S. 150
3Jahn, B. : Familienkonstruktionen 2005. Zum Problem des Zusammenhangs der Generationen im aktuellen Familienroman. In: Zeitschrift für Germanistik“. Neue Folge, XVI 3/2006, S. 581-596 in Agazzi, E., in: Campi, F.(Hrsg.). Gedächtnis und Identität, Die deutsche Literatur nach der Verinigung, Königshausen & Neumann, Würzburg, S. 187 - 203, S. 194
4Kauer, K.: Familie-Kultureller Mythos und soziale Realität, Frank & Time GmbH Verlag für wissenschaftliche Literatur, Berlin 2010, S. 12
5www.zeit.de.Kultur „Die elementare Struktur der Verwandtschaft“ zeit online, Ilse Radisch
6vgl. Friederike Eigler: Gedächtnis und Geschichte in Generationenromanen seit der Wende, Philologische Studien und Quellen 192 Berlin, Erich Schmidt Verlag 2005, S.9
7Claudia Bahnsen „Verfall“ als Folge. S. 7 zitiert vgl. Kurt Martens: Die Gebrüder Mann: In Leipziger Tageblatt , Nr. 154 21.03.1906
8Samuel Lublinski : Thomas Mann. Die Buddenbrooks, in Berliner Tageblatt, Jg 31, H. 466, 13.9..1902
9vgl. Wißkirchen,Hans „Er wird wachsen mit der Zeit..“ in: Thomas Mann, Jahrbuch Band 21 2008, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, S. 102
10Nipperdey, Th.: Wie das Bürgertum die Moderne fand, Reclam Berlin 1998, Wolf Jobst Siedler Verlag GmbH Berlin 1988, S. 70
11Weidermann, V.: Mann vom Meer, Kiepenheuer&Witsch 2023, S. 141
12Mann, Th. : Lübeck als geistige Lebensform, GW XI, S. 383
13Lutosch, Heide, Ende der Familie-Ende der Geschichte, Zum Familienroman bei Thomas Mann, Gabriel G. Marquez und Michael Houllebecq, Aisthesis Verlag Bielefeld 2007, S. 10
14http://www. Literaturhaus . at/index.php?id=5232 S. 4 vgl.
15Erhart, W.: Familienmänner - über den literarischen Ursprung moderner Männlichkeit, Wilhelm Fink Verlag München 2001, S. 403
16Gero von Wilpert: Sachwörterbuch der Literatur, Stuttgart A. Kröner 1989, S. 259
17vgl. Anderson, M.M.: Die Aufabe der Familie/das Ende der Moderne: Eine kleine Geschichte des Familienromans, in: Costagli,S./ Galli,M. (Hrsg.) Deutsche Familienromane, Wilhelm Fink Verlag München 2010, S. 23
18Griem, Julika: Szenen des Lesens, Schauplätze einer gesellschaftlichen Selbstverständigung, transcript Verlag Bielefeld 2021
19vgl.Steinecke, H.: Romanpoetik von Goethe bis Thomas Mann, Wilhelm Fink Verlag München 1987, S. 84
20vgl. Max, K.: Bürgerlichkeit und bürgerliche Kultur in der Literatur der DDR, Wilhelm Fink Verlag, ei Imprint der Brill Gruppe, Brill Deutschland GmbH, Paderborn 2018, S. 334
21vgl. Neuschäfer, M.: Vom doppelten Fortschreiben der Geschichte, Familiengeheimnisse im Familienroman, in: Lauer, G. (Hg.) Literaturwissenschaftliche Beiträge zur Generationsforschung, Wallstein Verlag Göttingen 2010, S. 164 - 203, S. 165
22Neuschäfer, M.: Das bedingte Selbst, Familie, Identität und Geschichte im zeitgenössischen Generationenroman, epuli GmbH Berlin 2013, S. 231
23Heinrich Mann: Briefe an Karl Lemke 1917-1949, Berlin 1963, S. 174, zitiert nach Aust, in: Steinecke, a.a.O., S. 179
24Eigler, F., a.a.O., S. 10
25vgl. Fuchs, A.: Landschaftserinnerung und Heimatdiskurs bei Medicus und Wackwitz, in: Kraft,A./Weißhaupt,M.(Hg.): Generationen: Erfahrung - Erzählung - Identität, UVK Verlagsgesellschaft mbH Konstanz 2009, S. 73
26vgl. Welzer, H.: Schön unscharf: über die Konjunktur der Familien- und Generationsromane, Hamburger Edition HIS Verlagsges.mbH 2004, S. 53-64
27vgl. Neuschäfer, M.: Das bedingte Selbst, a.a.O., S. 40
28vgl. Pranger, Matthias: Komplexer als ein Wirtshaus; Srno Geiger spricht über das Problem, eine Roman über das Familienleben zu schreiben In: http://literaturkritik.de/id 10727 15.06.17, 5, Mai 2007
29vgl. Galli, M / Costagli, S.: Chronotopoi. Vom Familienroman zum Generationenroman, in: Costagli,S./Galli,M. (Hrsg.) Deutsche Familienromane, Wilhelm Fink Verlag München 2010, S. 15
30Fuchs, A.: Landschaftserinnerung und Heimatdiskurs in Thomas Medicus „In den Augen meines Großvaters“ und Stephan Wackwitz, „Ein unsichtbares Land“, in: Kraft, A./Weißhaupt,M. (Hg.):Generationen:Erfahrung-Erzählung-Identität, IVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz 2009, S. 72
31Assmann, A. Fakten und Fiktionen im zeitgenössischen Familienroman, in: Kraft.A./ Weißhaupt,M. (Hg.), a.a.O., S. 60
32März, Ursula, „Erforschen oder Nacherzählen“, in:Die Zeit, 19/2003
33Kraft,A./ Weißhaupt,M.: Erfahrung-Erzählung-Identität, a.a.O., S. 42f
34vgl. Lutosch: Ende der Familie-Ende der Geschichte., a.a.O., S. 9
35Metzler Lexikon Literatur, Burgdorf/Fassender, Moenninghoff (Hrsg.)Stuttgart 2007, S. 229f
36vgl. Costagli, S./G. Matteo )Hrsg.): Deutsche Familienromane, Wilhelm Fink Verlag München 2010, S. 7-20, S. 16
37Fadinger, J.: Zusammenhang von Erinnerung und Identität im neuen österreichischen Familienroman, Diplomarbeit Universität Wien 2012 ottes,univie.ac.at/19718, S. 15
38Werkstattgespräch mit Arno Geiger: Der Schwamm ist leer, Schönstatt Verlag 2001, S. 10
39vgl. Neuschäfer, Markus, a.a.O., S. 42
40Assmann, A. Unbewältigte Erbschaften. Fakten und Fiktionen im zeitgenössischen Familienroman, in: Kraft,A./Weißhaupt,M. (Hg.) Generationen: Erfahrung-Erzählung-Identität, UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz 2009, S. 49
41Assmann, A. Generationsidentitäten und Vorurteilsstrukturen in der neuen deutschen Erinnerungsliteratur, Wiener Vorlesungen 117, Wien 2006, S. 26-27 in: Agazzi, E. : Familienromane, Familiengeschichten und Generationenkonflikt. Überlegungen zu einem eindrucksvollen Phänomen, in: Cambi, F.: Gedächtnis und Identität, a.a.O., S. 190
42Cohen-Pfister, Laurel: Kriegstrauma und die deutsche Familie. Identitätssuche im deutschen Gegenwartsroman, in: Martines, Thomas: Familie und Identität in der deutschen Literatur, Frankfurt a.M., Peter Lang Verlag 2009, S. 246
43http://www. Literaturhaus . at/index.php?id=5232
44vgl. v. Nayhauss, H.-Chr. „Deutschsprachige Literaturen nach der Wende 1989, zititert: März, U.: „Ewige Mittelstandsparty“,(Teil 2 der Zeitserie über den Zustand unserer Gegenwartsliteratur in: Die Zeit 41 v. 07.10.2010:62), in: Hess-Lüttich, E.W.B. / von Maltzan, C./ Thorpe, K. (Hrsg.): Gesellschaften in Bewegung, Peter Lang GmbH Frankfurt am Main 2016, S. 139
45vgl. Agazzi, E. : Familienromane, Familiengeschichten und Generationenkonflikte, in: Cambi, F. (Hg.) Gedächtnis und Identität,a.a.O., S. 194
46Neuschäfer, M. Familiengeheimnisse im Generationenroman, in: Lauer, G. (Hg.): Literaturwissenschaftliche Beiträge zur Generationsforschung, a.a.O., S. 20
47Eugen Ruge in Berliner Literaturkritik, 11.02.12, www.berlinerliteraturkritik.de..
48http://literaturkritik.de/id/10727 15.06.17, S. 1, Geiger
49Assmann, A. Fakten und Fiktionen im zeitgenössischen Familienroman in: Kraft,A./Weißhaupt,M. (Hg.) Generationen,,S. 50
50Toni Holen, Heillose Subjektivität, in Martinic/Nitschke, . S. 37
51vgl. Keilhauer, A. Altern als mimetische Praxis in: Hartung, H. u.a. (Hg.) Graue Theorie, S. 158
52Assmann, A. Fakten und Fiktionen im zeitgenössischen Familienroman, in: Kraft, A.Weißhaupt,M. (Hg.), a.a.O., S. 59
53Thomas Mann: Lübeck als geistige Lebensform, Otto Quitzow Verlag, Kom.-Ges.,Lübeck 1926, S. 9.
54Wißkirchen, H.: Buddenbrooks - Die Stadt, der Autor und das Buch, in: Wißkirchen, H. Die Welt der Buddenbrook, S. Fischer Verlag GmbH Frankfurt a.M. 2008, S. 56f
55Mann, Th.: Bilse und ich., a.a.O.
56Vogtmeier M.: Die Familien Mann und Buddenbrook im Lichte der MehrgenerationenFamilientherapie, Untersuchungen zu Thomas Manns „Buddenbrooks. Verfall einer Familie“, Peter Lang Frankfurt am Main, 1987, S. 45
57Weidermann, V.: a.a.O., S. 65
58Vogtmeier, M.: a.a.O., S. 68
59vgl. Eickhölter, M.: Ein Lübecker wird Autor von Weltgeltung, in: Wisskirchen, H.: Die Welt der Buddenbrook, a.a.O., S. 143
60Vogtmeier, a.a.O., S. 51
61Mann,Th.: Gesammelte Werke Bd X Fischer Verlag Frankfurt/M 1974, S. 239
62Mann,Th.: Gesammelte Werke Bd X Fischer Verlag Frankfurt/M 1974, S. 239
63Mann, Thomas: Selbstkommentar 1953, Fischer Verlag Frankfurt am Main, 1990, S. 134 Brief an Karl Huber
64vgl. Preußler, H.-P.: Vom Roman zu Film und Doku-Fiktion sowie retour.Die Buddenbrooksund dieMannsin: Costagli,S., Galli, M. (Hrsg.): Deutsche Familienromane, Wilhelm Fink Verlag München 2010, S. 92
65Mann,Thomas: Selbstkommentare, a.a.O., S. S. 35, 1906 Widmung an William Sawitzky
66Mann, Thomas: Selbstkommentare, a.a.O., S. 14 Brief an Heinrich Mann
67vgl. Vogtmeier, M., a.a.O., S. 178f
68Mann, Thomas: Lübeck als geistige Lebensform, a.a.O., S. 30
69literaturkritik.de Komplexer als ein Wirtshaus.S. 1
70Werkstattgespräche, a.a.O., S. 17
71Geiger, A.: Grenzgehen, Drei Reden, Carl Hanser Verlag München 2011, S. 71
72Geiger, A.: Grenzgehen, a.a.O., S. 68
73Geiger, A.: Grenzgehen, a.a.O., Laudatio von F. von Lovenberg S. 60
74Fadinger, Julia, a.a.O., S. 95
75vgl.Agazzi, E. : Familienromane, Familiengeschichten und Generationenkonflikte. Überlegungen zu einem eindrucksvollen Phänomen, in: Cambi, F. (Hg.) Gedächtnis und Identität, S. 192
76Geiger, A.: Grenzgehen, a.a.O., S. 9, Rede zur Verleihung des Literaturpreises der Konrad Adenauer Stiftung 2011
77Fugmann, Tom: In Zeiten des abnehmenden Lichts, Momento v. 13. Oktober 2011 im Internet Archive, in: NDR am 10.10.20122, aufgerufen am 20. Juni 2012
78vgl. Eugen Ruge: Buchpreisträger verliebte sich in seine Mathelehrerin, in: htttps://www.welt.de/ kultur...S. 1
79vgl. Kegel, S.: Der Untergang des Hauses Ruge, in: FAZ 26.8.2011, www.faz.net/aktuell..
80vgl. Eugen Ruge im Interview: „Das Beste an Lenin ist sein Bart...“ https:// www.tagesspiegel.de.. .S. 2
81vgl. Eugen Ruge: Buchpreisträger verliebt sich., https.//www.welt.de, S. 2
82Eugen Ruge im Gespräch in: Berliner Literaturkritik,11.02.12, www.berlinerliteraturkritik.de.
83Shortt, L.: „Verortete Identität“, Generationen- und Heimatdiskurs in Angelika Overaths „Nahe Tage“, in: Kraft,A./Weißhaupt,M.(Hg.), a.a.O., S. 118
84Banchelli, E. : Ostalgie - eine vorläufige Bilanz, in: Cambi, F. (Hg.): Gedächtnis und Identität, a.a.O., S. 63
85Krauss,H. : Das Vergangene erzählen - Erinnerungsdiskurse nach 1989, in: Cambi, F. (Hg.): Gedächtnis und Identität, a.a.O., S. 55
86Mann, Thomas: Selbstkommentare, a.a.O., S. 24f, 1902 Brief an Paul Rache'
87Mann, Thomas: Selbstkommentare, a.a.O., S. 122f, 1950 Meine Zeit
88Mann, Thomas: Selbstkommentare, a.a.O., S. 47, 1916 Betrachtungen eines Unpolitischen XII 115
89Wünsch, M.: Moderne und Gegenwart, Erzählstrukturen in Film und Literatur, Belleville Verlag München 2012, S. 9
90Bahnsen, Claudia: „Verfall“ als Folge zunehmender Identitäts- und Existenzunsicherheit, Tectum Verlag Marburg 2003, S. 17f
91Wünsch, a.a.O., S. 19
92Bahnsen, a.a.O., S. 101
93Wünsch, a.a.O., S. 25
94Fontane,Th., Rez. über Gustav Freytag, Die Ahnen(1875), S. 316- 319 in Steinecke, a.a.O., S. 171
95Steinecke, a.a.O., S. 163
96Steinecke, a.a.O., S. 82
97Fontane, Th. : Sämtliche Werke, Bd.1 hg. Jürgen Kolbe. München 1969 .- darin: Unsere lyrische und epische Poesie seit 1848 (1853)S. 242, in: Steinecke,a.a.O., S. 168
98Mann, Th.: Lübeck als geistige Lebensform., a.a.O. S. 38
99Steinecke,H.: a.a.O., S. 191
100Mann, Th. :Selbstkommentare, Brief an Grauton S. 20 1901
101Mann, Th.: Selbstkommentare, S. 17, Brief von Thomas Mann an H. Mann 1901
102Mann, Th.; Selbstkommentare S. 45,1916 Betrachtungen eines Unpolitischen, Kap. :Einkehr
103vgl. Matthias, Klaus: Studien zum Werk Thomas Mann, Schmidt-Römhild Lübeck 1967, S. 27
104Lutosch, a.a.O., S. 48
105Maar, M.: Die Schlange im Wolfspelz, Rowohlt Verlag Hamburg 2020, S. 348f
106Steinecke,H.: a.a.O., S. 154ff
107Metzler, Deutsche Literaturgeschichte, 2019, S. 341
108Mann, Th.: Selbstkommentare, a.a.O., S. 92, 1932 an Erwin Ackerknecht
109Mennemeier, F.N. : Literatur der Jahrhundertwenden II, Verlag Peter Lang AG Bern 1988, S. 165ff
110Mann, Th.: Selbstkommentare, a.a.O., S. 29, Brief an Eugen Kalkschmidt
111vgl. Maar, Michael: Die Schlange im Wolfspelz, Rowohlt Verlag Hamburg, 2020, S.36
112Maar, M. a.a.O., S. 87
113Thomas Mann/Agnes E. Meyer, Briefwechsel 1937-1955, hrsg. von Hans Rudolf Vagnet, Frankfurt a.M. 1992,S. 789, in: Vagnet, Hans. Rudolf: Thomas Mann und die amerikanische Literatur. Eine Skizze in: Raulff, U. u. Strittmatter, E. (Hrsg.) Thomas Mann in Amerika, S. 31, Deutsche Schillergesellschaft Marbach am Neckar 2018
115Lutosch, H.: a.a.O., S. 61 zitiert Thomas Mann: Rede und Antwort S. 67, in: Gesammelte Werke in Einzelbänden (Frankfurter Ausgabe), Hrsg. Peter de Mendelsohn, Band 16, Frankfurt a.M. 1983
116Lutosch, H.: a.a.O., S. 61 zitiert Thomas Mann: Rede und Antwort S. 67, in: Gesammelte Werke in Einzelbänden (Frankfurter Ausgabe), Hrsg. Peter de Mendelsohn, Band 16, Frankfurt a.M. 1983
116Ferron I.: „Was anfangen mit der verlorenen Zeit?“ in: Georgi, S., Ilgner, J, Lammel, I. u.a. (Hg.) Geschichtstransformationen, transcript Verlag Bielefeld 2015, S. 248
117Ferron, I. „Was anfangen mit der verlorenen Zeit, in: Georgi, A. Ilgner, J., Lammel, I. u.a. Geschichtstransformationen, S. 249
118vgl. Eigler, Friederike: a.a.O., S. 10
119Kegel, S.: Ein deutsches Jahrhundert im Roman, in: FAZ, 26.8.20111, www.faz.net
120vgl. Gisbertz, A.-K.: Latenzen der Gegenwart bei Arno Geigers ,Es geht uns gut’ und Eugen Ruges ,In Zeiten des abnehmenden Lichts' in: Gisbertz, A.-K./ Ostheimer, M. (Hrsg.) Geschichte- Latenz-Zukunft, Zur narrativen Modellierung von Zeit in der Gegenwartsliteratur, Wehrhahn Verlag Hannover, 2017, S. 95
121vgl.Richter, J.Th.: Sippenhaft: Amerikanische Familienromane der Gegenwart zwischen Gattungsdiskurs und Sozialreferenz, in: Costagli, S., Galli, M. (Hrsg.) Deutsche Familienromane, a.a.O., S. 211ff
122vgl. Jahn, B.: Die Familie als erzählerisches Problem in: Kauer, K. (Hg.): Familie - Kultureller Mythos und soziale Realität, Frank & Timme Verlag Berlin, 2010, S. 147
123Assmann, A.: Fakten und Fiktionen, in: Kraft, A./Weißhaupt,M. (Hg.): a.a.O., S. 67
124Neuschäfer, M: Das bedingte Selbst, a.a.O., S. 362
125vgl. Hahn, H.-J. Beobachtungen zur Ästhetik des Familienromans heute, in: Martinec/Nitschke (Hg.): Familie und Identität in der deutschen Literatur, Regensburger Beiträge, Peter Lang GmbH, Frankfurt 2009, S. 292
126http: Literaturkritik de., a.a.O., S. 2
127Mann, Th.: Werke-Briefe-Tagebücher, Heftrich, E., (Hg.) u.a., Frankfurt a.M., Fischer Verlag 2002., Bd 5,1, S. 9
128Hahn, H.-J., a.a.O., S. 290ff
129vgl. Literaturkritik de, a.a.O.
130literaturhaus at, a.a.O.
131http literaturkritik de, a.a.O., S. 4
132vgl.Literaturhaus at, a.a.O., S. 3
133literaturkritik de, a.a.O.,
134vgl. Hahn, H.J.: Beobachtungen zur Ästhetik des Familienromans heute, in: Martinic/Nitschke (Hg.), a.a.O., S. 291
135Werkstattgespräch mit Arno Geiger, a.a.O., S. 16
136vgl. Werkstattgespräch mit Arno Geiger, a.a.O., S. 16
137Werkstattgespräch mit Arno Geiger, a.a.O., S. 15
138Geiger, A.: Grenzgehen, a.a.O., Laudatio M. Feßmann, S. 32
139Geiger, A.: Grenzgehen, a.a.O., Laudatio Meike Feßmann, S. 28f
140Geiger, A. : Grenzgehen, a.a.O., Laudatio , Konrad Meike Feßmann, s. 28
141vgl. Geiger, A.: Grenzgehen, a.a.O., Laudatio M. Feßmann, S. 31
142http. Literaturkritik, a.a.O., S. 2
143vgl. Literaturkritik, Komplexer als ein Wirtshaus, a.a.O., S. 2
144vgl. Literaturkritik, a.a.O., S. 2
145Julia Freytag: Generationentransfer und Generationenkonflikt in den Familienromanen von Dimitré Dinev, Arno Geiger und Tanja Dückers. In: Arenhövel, Mark (Hrsg.): Kulturtransfer und Kulturkonflikt. Dresden 2010 (= Germanica N.F Bd. 2008), S. 211-224, S. 114f
146vgl. Lutosch, H,: Ende der Familie - Ende der Geschichte, Bielefeld 2007, S. 9
147vgl. Gösweiner,F.: a.a.O., S. 177
148Lutosch, H.: a.a.O., S.9
149Matthias, Klaus: “Studien zu Thomas Mann“, zur Erzählweise, a.a.O.
150vgl. Vogtmeier, M.: a.a.O., S. 88
151Matthias, Klaus,: a.a.O., S. 21
152Wisskirchen, H: a.a.O., S. 12
153Pikulik, L.: Leistungsethik contra Gefühlskult, Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 1984, S.
154Eickhölter, M.: Die Stadt Lübeck in Buddenbrooks“, in: Wisskirchen, H. Die Welt der Buddenbrooks, a.a.O., S. 103
155Vogtmeier. M., a.a.O., S. 26f zitiert: Crüger,C: 1834: Handelsgeographie oder Beschreibung der Erde, was sie für den Kaufmann ist. BdII. Hamburg(Herold)
156Vogtmeier, M., a.a.O., S. 31
157Lindtke, Gustav,: Die Stadt der Buddenbrooks, Verlag Max Schmidt-Römhild, Lübeck 1981, S. 29
158Eickhölter, : : Die Stadt Lübeck in Buddenbrooks“, in: Wisskirchen, H. Die Welt der Buddenbrooks, a.a.O., S. 112
159Mazohl, B.: Vom Tod KarlsVI. bis zum Wiener Kongress (1740-1815), in: Winkelbauer,Th. (Hrsg.): Geschichte Österreichs, Reclam, Stuttgart 2015, S. 347
160Mazohl, B. : a.a.O., in: Winkelbauer, Th., a.a.O., S. 353
161Mazohl, B. : Die Zeit zwischen dem Wiener Kongress und den Revolutionen von 1848/49 in: Winkelbauer, a.a.O., S. 365
162Mazohl, B. Die Habsbugmonarchie 1848-1918, in : Winkelbauer, Th. Geschichte Österreichs (Hrsg.), a.a.O., S. 470
163vgl. Mazohl, B. :Die Zeit zwischen dem Wiener Kongress und den Revolutionen 1848/49, in: Winkelbauer, Th. (Hrsg.) Geschichte Österreichs, a.a.O., S. 384f
164vgl. Niederstätter, A.: Geschichte Österreichs, Verlag Kohlhammer 2005, S. 179
165Mazohl, B.: Die Habsburgmonarchie 1848-1918, in: Winkelbauer, Th., Geschichte Österreichs, a.a.O., S. 449
166Pokrywka, a.a.O., S. 160
167Werkstattgespräche Arno Geiger, a.a.O., S. 36
168http://www. Deutschlandfunk .de /neun_tage_fuer_ein_halbes_jahrhundert 15.06.17
169vgl. Werkstattgespräche Arno Geiger, a.a.O., S. 36
170Ansprache Christine Lieberknecht zur Verleihung des Konrad-Adenauer-Preise an Arno Geiger
171Niederstätter,A., a.a.O., S. 234
172vgl. Niederstätter, A., a.a.O., S. 235
173Rathkolb, O.: Erste Republik, Austrofaschismus, Nationalsozialismus (1918-1945) in: Winkelbauer, Th., Geschichte Österreichs, a.a.O., S. 482
174vgl. Niederstätter, A., a.a.O., S. 233
175Trepp, A.-Ch.: Sanfte Männlichkeit und selbständige Weiblichkeit. Frauen und Männer im Hamburger Bürgertum zwischen 1770 und 1840, Vandenhoeck & Ruprecht 1995
176Rathkolb, O.: Erste Republik...in: Winkelbauer, Th., a.a.O., S. 514
177vgl.Bryk, M., a.a.O., S. 143
178Rathkolb, O.: Die Zweite Republik (seit 1945) in: Winkelbauer, Th., a.a.O., S. 537
179vgl. Niederstätter, A., a.a.O., S. 242
180vgl. http deutschlandfunk de, a.a.O., S. 5
181Niederstätter, A., a.a.O., S. 247
182Rathkolb, O.:Die zweite Republik, in: Winkelbauer, Th.:Geschichte Österreichs, a.a.O., S. 567
183Rathkolb, O.: Die Zweite Republik, in: Winkelbauer, Th. Geschichte Österreichs, a.a.O., S. 559f
184Graf v. Nayhauss, H.Chr.: Deutschsprachige Literaturen nach der Wende 1989, in: Hess- Lüttich, E.W.B./ von Maltzan, C./ Thorpe, K. (Hrsg.) Gesellschaften in Bewegung, a.a.O., S. 127
185vgl. Fleischer, Fleischer: www.lvz.de
186Hertle,H.-H./Wolle, St.: Damals in der DDR, Bertelsmann Verlag, München 2004, S. 10
187vgl. Graf v. Nayhauss, H.-Chr.: Deutschsprachige Literaturen nach der Wende 1989, in: Hess- Lüttich, E.W.B./ von Maltzan, C./ Thorpe, K. (Hrsg.), a.a.O., S. 139
188vgl. Hertle, H.-H., /Wolle, St.: Damals in der DDR, a.a.O., S. 11
189vgl. Mittenzwei,: Die Intellektuellen, S. 535
190Rabe, A., a.a.O., S. 354
191Hertle, H.-H./Wolle, St.: Damals in der DDR, S. 20
192vgl. Mittenzwei, W.: Die Intellektuellen, Verlag Faber & Faber Leipzig 2001, S. 151 ff
193vgl. Hertle, H.-H./Wolle, St.: Damals in der DDR, a.a.O., S. 57
194vgl. Fulbrook, a.a.O., S. 113 f
195vgl. Fulbrook, M.: zitiert Young-sun Hong, cigarette Butts and the Buildung of Socialism in East Germany, in: Central European History 35 (2002), S. 327-344, hier S. 334, in: Ein ganz normales Leben, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 2008, S. 118
196vgl. Hertle, H.-H. /Wolle, St.: Damals in der DDR, a.a.O., S. 75
197Hertle,H.-H./Wolle, St.: Damals in der DDR, a.a.O., S. 86
198Wolle, St.: Die heile Welt, a.a.O., S. 90
199Wolle, St.: Die heile Welt, a.a.O., S. 95
200Wolle, St.: Damals in der DDR, a.a.O., S. 141f
201Max, K.: Bürgerlichkeit und bürgerliche Kultur, a.a.O., S. 232
202vgl. Hertle, H.-H./Wolle, St.: Damals in der DDR, a.a.O., S. 167
203Wolle, St., a.a.O., S. 64
204Wolle, St., a.a.O., S. 66
205Manz, G. Einkommens- und Subventionspolitik, in: Manz,G., Sachse,E., Winkler,G. (Hg.): Sozialpolitik in der DDR, trafo Verlag Dr. Wolfgang Weist, 2001, S.191ff
206vgl. Hertle, H.-H./Wolle, St., a.a.O., S. 222f
207Schneider, N.F.: Familie und private Lebensführung in West- und Ostdeutschland, Ferdinand Enke Verlag Stuttgart 1994, S. 249
208Fulbrook, M., a.a.O., S. 73
209Pragal, P.: Vertraute Fremde in: Danyel, J. (Hg.): Ost-Berlin, C Links Verlag GmbH Berlin 2020, S.395
210Merkel,A. Leitbilder und Lebenseisen von Frauen in der DDR, in: Kaelble, H., Kocka,J., Zwahr,H. (Hg.) Sozialgeschichte der DDR, Klett-Cotta Stuttgart 1994, S. 375
211Wolle, St., a.a.O., S. 74
212Wolle, St., a.a.O., S. 444
213Mittenzwei,W.:Die Intellektuellen, a.a.O., S. 338
214vgl. Wolle, St., a.a.O., S. 430
215Mittenzwei, W, a.a.O., S. 383
216Hertle, H.-H./Wolle, St., a.a.O., S. 145
217Mittenzwei,W.,a.a.O., S. 420
218Mittenzwei,W.,a.a.O., S. 528
219Mittenzwei,W.,a.a.O., S. 5
220Zwahr, H.: Die DDR auf dem Höhepunkt der Staatskrise 1989, in: Kalble,H:, Kocka,J., Zwahr,H. (Hg.): Die Sozialgeschichte der DDR, a.a.O., S. 434
221Zwahr, H.: Die DDR auf dem Höhepunkt der Staatskrise 1989, in: Kaelble,H., Kocka,J., Zwahr,H. (Hg.): Die Sozialgeschichte der DDR, a.a.O., S. 439f
222vgl. Wolle, St., a.a.O., S. 389
223Negt, Oskar: Überlebensglück, Steidl, Göttingen 2006, S. 51
224Negt, Oskar: Überlebensglück, a.a.O., S. 51
225Mann, Thomas: Selbstkommentare, a.a.O., S. 26
226Mann, Thomas: Lübeck als geistige Lebensform , a.a.O., S. 32
227Mann, Thomas: Selbstkommentare, a.a.O., 1913 , S. 40 Brief an Ida Boy-Ed
228vgl. Lindtke, G.: Die Stadt der Buddenbrooks, Verlag Max Schmidt-Römhild, Lübeck 1981, S. 17
229vgl. Lindtke, G.: Die Stadt der Buddenbrook, a.a.O., S. 33
230Csendes, Peter: Geschichte Wiens, R. Oldenbourg München 1981, S. 101
231Csendes, Peter Geschichte Wiens, a.a.O., S. 137
232Csendes, Peter: Geschichte Wiens, a.a.O.
233Jahn, B.: Familienkonstruktionen 2005. Zum Problem des Zusammenhangs der Generationen im aktuellen Familienroman, in: Zeitschrift für Germanistik 2006, S. 592
234Haider, Edgard: Wien im Wandel, Böhlau Wien, 1996, S. 155
235Haider, E., a.a.O.,S. 157
236Csendes, P.: Wiener Geschichte, a.a.O., S. 167
237Tagesspiegel Berlin, 30.07.2018,Interview mit Eugen Ruge
238Wolle, Stefan: Ost-Berlin, Biografie einer Hauptstadt, Ch. Links Verlag Berlin 2020, S. 14
239vgl.Leo, A.: Stadtlandschaft mit Spuren, in: Danyel, J. (Hg.) Ost-Berlin, a.a.O. S. 83
240Wolle, St.: Der Weltgeist im Kaffeehaus, in: Danyel, J. (Hg.), a.a.O., S. 120
241Wolle, Stefan: Ost-Berlin, a.a.O., S. 20
242Hahn, Ines: Ein Fundstück und die Wogen der Erinnerung, in: Danyel, J.: Ost-Berlin,(Hg.), a.a.O., S. 37
243Leo, A.: Stadtlandschaft mit Spuren, in: Danyel, J. (Hg.): Ost-Berlin, a.a.O. S. 84
244vgl. Danyel, J.: Ost-Berlin erkunden, in Danyel, J. (Hg.): Ost-Berlin, a.a.O., S. 13ff
245Wolle, Stefan: Ost-Berlin, a.a.O. S. 139
246Wolle, Stefan: Ost-Berlin, a.a.O., S. 143
247Morré, J.: Karlshorst - mehr Villenvorort als Berliner Kreml, in: Danyel, J. Ost-Berlin, a.a.O., S. 209
248Morré, H.: Karlshorst- mehr Villenvorort als Berliner Kreml, in: Danyel, J. Ost-Berlin, a.a.O., S. 216
249Schön, Claudia: Protokollstrecke, in: Danyel, J. (Hg.): Ost-Berlin, a.a.O. S. 57
250vgl. Sylvester, R. : Berlin-Mitte, in: Danyel, J. (Hg.): Ost-Berlin, a.a.O., S. 108
251vgl. Wolle, Stefan: Ost-Berlin, a.a.O., S. 171
252Schütterle, J.: Der Duft der großen weitern Welt, in: Danyel, J.: Ost-Berlin, a.a.O., S. 137f
253vgl. Pragal, P.: Vertraute Fremde, in: Danyel, J.: Ost-Berlin, a.a.O., S. 388
254Wolle, Stefan: Ost-Berlin, a.a.O., S.182
255Danyel, Jürgen: Ost-Berlin erkunden, in: Danyel,J. (Hg.): Ost-Berlin, a.a.O., S. 12
256vgl. Schumann, W.: Jedem (s)eine Wohnung?, in: Danyel, J.: Ost-Berlin, a.a.O., S. 187
257Wolle, Stefan: Ost-Berlin, a.a.O., S.193
258vgl. Pragal, P.: Vertraute Fremde, in: Danyel, J.: Ost-Berlin, a.a.O., S. 390f
259Schulze, H.-J.: Wege nach „Oberschweineöde“, in: Danyel, J.: Ost-Berlin, a.a.O., S. 228
260Gröscher, A.:Kraut und Unkraut, in: Danyel, J. Ost-Berlin, a.a.O., S. 238
261Neugebauer, W.: Von Sport frei! zum Techno, in: Danyel, J.: Ost-Berlin, (Hg.)a.a.O., S. 249
262Neugebauer, W. Von Sport frei! zum Techno, in: Danyel, J.: (Hg.) Ost-Berlin, a.a.O., S. 254
263Wolle, Stefan: Ost-Berlin, a.a.O. S. 254
264Scheurer , H.: Autorität und Pietät - Wilhelm Heinrich Riehl und der Patriarchalismus in der Literatur des 19. Jahrhunderts, in: Brinker - von der Heyde/Scheurer (Hg.) in : Familienmuster - Musterfamilien, zitiert Riehl: Die Familie, 12. Auflage Stuttgart und Berlin 1904, S. 147
265Riehl, W.H.: Die Naturgeschichte des Volkes als Grundlage einer deutschen Sozialpolitik. Dritter Band: Die Familie, 12. Auflage Stuttgart u. Berlin 1904, S. 188
266Gero von Wildert: Das Bild der Gesellschaft, in: Buddenbrook-Handbuch, hrsg. von Ken Mulden und Gero von Wilpert, Stuttgart 1988, S. 247
267Vogtmeier, M, a.a.O., S. 35
268Korff, G. : Puppenstuben als Spiegel bürgerlicher Wohnkultur, in: Niethammer, L.: Wohnen im Wandel, Peter Hammer Verlag Wuppertal 1979, S. 31
269Zinn, Hermann: Entstehung und Wandel in: Niethammer, L. Wohnen im Wandel, a.a.O., S. 18
270Siebel Walter, zitiert Niethammer: Wie wohnten Arbeiter im Kaiserreich, Peter Hammer Verlag Wuppertal 1979, in: Wohnen und Familie, in: Handbuch der Familien- und Jugendforschung, S.
271Gestrich, A.: Geschichte der Familie im 19, und 20. Jahrhundert, Oldenburg Verlag München 2013, S. 20ff
272vgl. Rosenbaum, H.: Formen der Familie, Suhrkamp Verlag Frankfurt a.M. 1996, 7. Auflage, S. 307
273vgl. Siebel, Walter: Wohnen und Familie in: Handbuch der Familien- und Jugendforschung, 1996 a.a.O., S. 269
274vgl. Siebel, Walter: Wohnen und Familie in: Handbuch der Familien- und Jugendforschung, 1996 a.a.O., S. 269
275vgl. Korff, G.: Puppenstuben als Spiegel bürgerlicher Wohnkultur, in: Niethammer, L.: Wohnen im Wandel, a.a.O., S. 34
276Budde,G-F.: Bürgertum nach dem bürgerlichen Zeitalter, Vandenhoeck & Ruprecht, 2010, S. 79
277Pieske, Christa: Wandschmuck im bürgerlichen Heim um 1870, in: Niethammer, L. Wohnen im Wandel, a.a.O., S. 262
278vgl. Benker, G.: Bürgerliches Wohnen, Verlag Callwey, München 1984, S. 52
279vgl. Pieske, Christa: Wandschmuck im bürgerlichen Heim um 1870, in: Niethammer, L.: Wohnen im Wandel, a.a.O., S. 253ff
280vgl. Benker, G.: Bürgerliches Wohnen, a.a.O., S. 45
281Langbein, U.: Geerbte Dinge, Böhlau Verlag GmbH & Cie Köln 2002,S. 155 zitiert: Bourdieu, P. : Eine sichere Geldanlage für die Familie. Das Einfamilienhaus In: Bourdieu, P u.a. 1998, S. 29
282Kraft,A.: Geerbte Täume der Erinnerung, in: Kraft,A./Weißhaupt,M.(Hg.), a.a.O., S. 147
283Assmann, A.: Erinnerungsräume, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München 1999, S. 301
284RIchter, D.: Das fremde Kind, S. Fischer Verlag GmbH 1987, S. 326
285Weichel, Th. : Bürgerliche Villenkultur im 19. Jahrhundert, in: Hein,D./Schulz,A. (Hg.) Bürgerkultur im 19. Jahrhundert, C.H. Beck München 1996, S. 242ff
286vgl. Grabowski, R. Wohnungspolitik, in: Manz,G., Sachse,E., Winkler,G. (Hg.) Sozialpolitik in der DDR, a.a.O., S. 229
287vgl. Gysi, J.: Familienleben in der DDR, Akademie Verlag Berlin 1989, S. 140
288vgl. Ferron, I. „Was anfangen mit der verlorenen Zeit?“ in: Georgi, S., Ilgner, J., Lammel, I. u.a. (Hg.) Geschichtstransformationen, transcript Verlag Bielefeld 2015, S. 245
289vgl. Max, K., a.a.O., S. 382ff
290Kujath, H-.J. : Wohnbedürfnisse der Familie, in: Jans, B./Sering, A. (Hrsg.): Familien im wiedervereinigten Deutschland, Vektor-Verlag Grafschaft 1992, S. 142
291vgl. Max, K.: Bürgerlichkeit und bürgerliche Kultur in ..., a.a.O., S. 258f
292Max, K.: Bürgerlichkeit und bürgerliche Kultur ..,a.a.O., S. 264
293vgl. Ecarius, J.: Familienerziehung im Wandel, Leske und Buderich Verlag Opladen 2002, S.
294vgl. Hertle, H.-H./Wolle, St.: Damals in der DDR, a.a.O., 179f
295vgl. Wolle, St.: Die heile Welt, a.a.O., S. 256
296vgl. Hertle, H.-H./Wolle, ST.: Damals in der DDR, a.a.O., S. 185
297Grabowski, R.: Wohnungspolitik, in: Manz,G., Sachse,E., Winkler,G. (Hg.): Sozialpolitik in der DDR, a.a.O., S. 235ff
298vgl. Steinmeier nennt AfD „antibürgerlich“, WAZ, 14.09.19
299vgl. https: // www.stern.de lifestyle Leben 17.12.2021, aufgerufen 18.12.23
300vgl. Max, K., a.a.O., S. 20
301Kocka,J. (Hg.): Bürger und Bürgerlichkeit im 19. Jahrhundert, Sammlung Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 1987, S. 23
302Gall, L.: Bürgertum in Deutschland, Sieder-Verlag 1998, S. 44
303vgl. Schmuhl, H-W. : Bürgertum und Stadt, in: Lundgreen, P (Hrsg.): Sozial- und Kulturgeschichte des Bürgertums, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2000, S. 230ff
304Großbölting, Th.: Entbürgerlichte die DDR? in: Hettling/Ulrich (Hg.): Bürgertum nach 1945, Hamburg Edition, HIS Verlag 2005, S. 104
305Mann,Th.: Lübeck als geistige Lebensform, a.a.O., S. 70
306vgl. Rüschemeyer, D.: Bourgeoisie, Staat und Bildungsbürgertum, in: Kocka, J. (Hg.): Bürger und Bürgerlichkeit im 19. Jahrhundert, a.a.O., S. 117
307Gall S., a.a.O., 159
308vgl. Hacke, Jens: Bürgerlichkeit und liberale Demokratie, in: Budde/Conze/Rauh (Hrsg.): Bürgertum nach dem bürgerlichen Zeitalter, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 2010, . S. 131
309vgl. Schäfer, M.: Geschichte des Bürgertums, UTB Stuttgart 2009, S. 74
310vgl. Schäfer, Michael: Geschichte des Bürgertums, a.a.O., S. 29
311Kuhlemann, Frank-Michael: Bürgerlichkeit und Religion, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 2002, S. 22
312Lepsius, R. : Zur Soziologie des Bürgertums und der Bürgerlichkeit, in: Kocka, J. (Hrsg.), a.a.O., S. 90
313vgl. Kill,S.: Wach geküsst von der Poesie, in: Hein,D./Schulz,D. (Hg.): Bürgerkultur im 19. Jahrhundert, a.a.O., S. 58
314vgl.Gall, L., a.a.O., S. 182
315vgl.Gestrich, A, a.a.O., . S. 120
316Lämmert, E.: Bürgerlichkeit als literaturhistorischer Kategorie; in: Kocka, J., a.a.O., S. 203
317Mann, Th: Lübeck als geistige Lebensform, a.a.O., S. 25
318Vogtmeier, M., a.a.O., S. 86
319Mann, Thomas: Selbstkommentare , a.a.O., S. 48f: Betrachtungen eines Unpolitischen XII 144
320vgl. Grimm, D.: Bürgerlichkeit im Recht , in: Kocka, J., a.a.O., S. 150
321vgl. Gall, L., a.a.O., S. 360
322Vierhaus, R. : Der Aufstieg des Bürgertums vom späten 18. Jahrhundert bis 1848/49, in: Kocka, J. (Hg.), a.a.O., S. 69
323Wehler, H.-J.: Wie „bürgerlich“ war das Deutsche Kaiserreich? in: Kocka, J. (Hg.), a.a.O., S. 255
324vgl.Kocka, J., a.a.O., S. 33
325vgl.Kocka, J., a.a.O., S. 33
326Gall, L., a.a.O., S. 387
327Kocka, J., a.a.O., S. 23
328Wehler, H.-J.: Wie „bürgerlich“ war das Deutsche Reich? in: Kocka, J., a.a.O., S. 248
329Schäfer, M.: Geschichte des Bürgertums, a.a.O., S. 93
330vgl. Lundgreen, P.: Bildung und Bürgertum in: Sozial- und Kulturgeschichte des Bürgertums, a.a.O., S. 176
331Kocka, J.: Bürgertum und Sonderweg, in: Lundgreen, P.: Sozial- und Kulturgeschichte des Bürgertums, a.a.O., S. 105
332Lundgreen: Bildung und Bürgertum in: Lundgreen, P., a.a.O., S. 185
333vgl. Hettling, M.: Bürgertum nach 1945, Hamburg Edition HIS Verlagsgesellschaft mbH 2005, S. 244 ff
334vgl. Schäfer, M.: Geschichte des Bürgertums, a.a.O., S. 192
335Mommsen, H.: Die Auflösung des Bürgertums seit dem späten 19. Jahrhundert in: Kocka, J., a.a.O., S. 292
336Mommsen, H.: Die Auflösung des Bürgertums seit dem späten 19. Jahrhundert, in : Kocka, J., a.a.O., S. 299
337vgl. Kondylis, P. Der Niedergang der bürgerlichen Denk- und Lebensform, Weinheim: VCH, Acta Humaniora, 1991, S. 24
338vgl. Kondylis, P. Der Niedergang der bürgerlichen Denk- und Lebensform, a.a.O., S. 133
339Jelavich, P.: Bürgertum und früher Film, in: Hettling/Hoffmann (Hg.): Der bürgerliche Wertehimmel, Vandenhock & Ruprecht Göttingen 2000, S. 303
340Benesch, K.: Mythos Lesen, transcript Verlag Bielefeld 2021, S. 65, zitiert Reckwitz A.: “Kleine Genealogie des Lesens“ als kulturelle Praxis, S. 37
341Jelavich, P: Bürgertum und früher Film, in: Hettling/Hoffmann (Hg.): Der bürgerliche Wertehimmel, a.a.O., S. 288
342Kondylis, P., a.a.O. S. 256
343Depkat, V. : Entwürfe politischer Bürgerlichkeit, in: Budde/Conze/Rauh. (Hg.), a.a.O., S. 112
344vgl. Wehler, H.-H.: Deutsches Bürgertum nach 1945: Exitus oder Phönix aus der Asche? SBR Schriften Bochum, 2001, S. 10
345vgl. Kocka, J.: Einleitung, in: ders( Hg.) : Bürger undBürgerlichkeit im 19. Jh.,a.a.O., S. 16.
346vgl. Schäfer, M.: Geschichte des Bürgertums, a.a.O., S. 209
347vgl. Gunilla Budde, Eckart Conze,Cornelia Rauh: Einleitung: Bürgertum und Bürgerlichkeit nach 1945 in: Bürgertum nach dem bürgerlichen Zeitalter, a.a.O., S. 9
348vgl. Mommsen, H.: Die Auflösung des Bürgertums seit dem 19. Jahrhundert, in: Kocka, J., a.a.O., S. 305
349Wehler, H.-U.: Die Zielutopie der „Bürgerlichen Gesellschaft“ und die „Zivilgesellschaft“ heute, in: Lundgreen, (Hg.) Sozial- und Kulturgeschichte des Bürgertums, a.a.O., S. 90
350Hettling, M zitiert: Noelle u. Neumann (Hg.), Jahrbuch der öffentlichen Meinug 1957, Allensbach 1957, S. 118 in: Bürgerlichkeit im Nachkriegsdeutschland, in: Hettling/Ulrich (Hg.): Bürgertum nach 1945, S. 18
351Krüger, Ch.: In der Tradition der bürgerlichen Wohlfahrt? zitiert Archiv der Diakonie Neuendettelsau, D5/2-2, Abschrift Bayerischer Rundfunk, Kirchenfunk, Samstag 13.10.1954, 17.10-17.25 in: Budde/u.a.: Bürgertum nach dem bürgerlichen Zeitalter, a.a.O., S. 59
352Schütze, Y.: Vereinbarkeit von Familie und Beruf, in: Jans, B./ Sering,A. (Hrsg.: ) Familien im wiedervereinigten Deutschland, Vektor-Verlag Grafschaft 1992, S. 89f
353Hacke, J.: Bürgerlichkeit und Liberale Demokratie,S. 121, in Budde/u.a.: Bürgertum nach dem bürgerlichen Zeitalter, a.a.O., zitiert Habermas: Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, Frankfurt 1973
354Lutz, B.: Integration durch Aufstieg, in: Hettling,M./Ulrich,B.: Bürgertum nach 1945, a.a.O., S. 309
355vgl. Schäfer, M.:Geschichte des Bürgertums, a.a.O., S. 234
356vgl. Hettling, M.: Bürgerlichkeit im Nachkriegsdeutschland, in: Hettling M./Zlrich,B. (Hg.): Bürgertum nach 1945, a.a.O., S. 9
357Bude, H.: Bürgertumsgenerationen in der Bundesrepublik, in: Hettling/Ulrich (Hg.): Bürgertum nach 1945, a.a.O.,S. 115
358Flügel, A.: Bürgertum und ländliche Gesellschaft, in: Lundgreen,P.: Sozial- und Kulturgeschichte, a.a.O., S. 223
359vgl. Wildt, M.: Konsumbürger, in: Hetlting, M./Ulrich, B. (Hg.): Bürgertum nach 1945, a.a.O., S.257ff
360Wildt, M.: Konsumbürger, in: Hettling, M./Ulrich,B. (Hg.) Bürgertum nach 1945, a.a.O., S. 273
361Ziegler, D.: Das wirtschaftliche Großbürgertum , in: Lundgreen,P., a.a.O., S. 136f
362vgl. Hettling, M.: Bürgerlichkeit im Nachkriegsdeutschland, in: Hettling/Ulrich (Hg. ): Bürgertum nach 1945, a.a.O., S. 19
363vgl. Hacke,Jens: Bürgerlichkeit und liberale Demokratie, in: Budde/u.a.: Bürgertum nach dem bürgerlichen Zeitalter, a.a.O., S. 131
364Nehring, H.: Bürgerlichkeit als Protest, in: Budde/u.a.: a.a.O., S. 136ff
365Nipperdey,Th.: a.a.O., S. 76
366Hettling, M.: Bürgerliche Kultur - Bürgerlichkeit als kulturelles System, in: Lundgreen, a.a.O., S. 339
367vgl. Wolle, St.: Die heile Welt, a.a.O., S. 13
368Schneider, N.: Familie und private Lebensführung in West- und Ost-Deutschland, a.a.O., S. 52 zitiert Grundberg, A.: Bewusstseinslagen und Leitbilder in der DDR, in: Weidenfeld, W./ Zimmermann, H. (Hg.): Deutschland-Handbuch, München, S. 221-238
369Kleßmann, Ch.: Relikte des Bildungsbürgertums in der DDR, in: Kaelble,H., Kocka,J., Zwahr,H., (Hg.): Sozialgeschichte der DDR, Klett-Cotta Stuttgart 1994, S. 254
370Kleßmann, Ch.: Relikte des Bildungsbürgertums in der DDR, in: Kaelble,H., Kocka,J., Zwahr,H., (Hg.): Sozialgeschichte der DDR, Klett-Cotta Stuttgart 1994, S. 254
371vgl. Max, K., a.a.O., S. 23
372Max, K., a.a.O., S. 4
373Max, K., a.a.O., S. 107f
374Grossbölting, Th.: Erosion und Resilienz: Bürgertum, Bürgerlichkeit und Entbürgerlichung in SBZ und DDR seit 1945, in: Sachsen und Anhalt, ZDB, Heft 27, S. 107
375vgl. Hertle, H.-H./Wolle, St.: Damals in der DDR, a.a.O., S. 169
376vgl. Wolle, St.: Die heile Welt, a.a.O., S. 273
377Neugebauer, W.: Von Sport! frei zum Techno, in: Danyel, J. (Hg.): Ost-Berlin, a.a.O., S. 251
378Großbölting: Entbürgerlichte die DDR? in: Hettling/Ulrich (Hg.): Bürgertum nach 1945, a.a.O., S. 430-432
379vgl. Mittenzwei, W.: Die Intellektuellen, a.a.O., S. 35f
380vgl. Mittenzwei, W.: Die Intellektuellen, a.a.O., S. 79
381Max, K., a.a.O., S. 53
382vgl.Fulbrook M., a.a.O., S. 221f
383vgl. Ecarius, J.: a.a.O., S. 150
384vgl. Max, K. a.a.O., S. 41 zitiert Engler, W. : Die Ostdeutschen. Kunde von einem verlorenen Land. Berlin: Aufbau, 1999, S. 194.197-200
385Böhme, W. u.a. (Hg): Kleines politisches Wörterbuch, Berlin: Dietz 1973, S. 364
386Fulbrook, M., a.a.O., S. 224
387vgl. Max, K., a.a.O., S. 93, zitiert: Ernst, Anna-Sabine: Vom „Du“ zum „Sie“. Die Rezeption der bürgerlichen Anstandsregeln in der DDR der 1950er Jahre, in: Mitteilungen aus der kulturwissenschaftlichen Forschung 16 (1993), H. 33, S.190
388vgl. Merkel, I.: Leitbilder und Lebensweisen von Frauen in der DDR, in: Kaelbe,H. Kocka,J., Zwahr,H., (Hg.): Sozialgeschichte der DDR, a.a.O., S. 366
389Mittenzwei, W.: Die Intellektuellen, S. 14 zitiert Pierre Bourdieu, Die Internationale der Intellektuellen, in: Berliner Zeitung vom 10./11. Juni 2000
390Mittenzwei, W.: Die Intellektuellen, S. 12 f zitiert Theodor Geiger: Aufgabe und Stellung der Intelligenz in der Gesellschaft, Stuttgart 1949, S. 63, und Said, E.W.: Götter, die keine sind, Berlin 1997, S. 29f
391Mittenzwei, W.: Die Intellektuellen, a.a.O., S. 535
392Mittenzwei, W.: Die Intellektuellen, a.a.O., S. 543
393Möller, H.: Geschichte im demokratischen Pluralismus und Marxismus-Leninismus, in: Fischer,G./Heydemann,G.: Geschichtswissenschaft in der DDR, Band I, S. 34
394vgl. Fischer, A.: Gleichschaltung der Geschichtswissenschaft in der SBZ 1945-1949, in: Fischer,A./Heydemann,G. (Hg.): Geschichtswissenschaft in der DDR, Band I, S. 46ff
395Fischer,A. Gleichschaltung der Geschichtswissenschaft in der SBZ von 1945-1949, in: Fischer,A./Heydemann,G.(Hg.) Geschichtswissenschaft in der DDR, Band I,S. 59
396vgl. Sywottek, A.: „Marxistische Historik“:Probleme und Scheinprobleme, in: Fischer, A./ Heydemann, G. (Hg.): Geschichtswissenschaft in der DDR, Band I, S. 258
397vgl. Rüsen,J./Vasicek,Z.: Geschichtswissenschaft zwischen Ideologie und Fachlichkeit, in:Fischer,A./Heydemann,G. (Hg.): Geschichtswissenschaft in der DDR, Band I, S. 308f
398vgl. Fischer, A. Gleichschaltung der Geschichtswisssenschaft in der SBZ 1945-1949, in: Fischer,A./Heydemann,G. (Hg.): Geschichtswissenschaft in der DDR, Band I, S. 71
399Fischer, A: Gleichschaltung der Geschichtswissenschaft in der SBZ 1945-1949, in: Fischer,A./ Heydemann,G.(Hg.): Geschichtswissenschaft in der DDR, Band I, S. 55 zitiert: Georg v. Rauch, Grundlinien der sowjetischen Geschichtsforschung im Zeichen des Stalinismus, in: EA, 5. Jg. (1950), S. 3493
400Rumpler, H.: Parteilichkeit und Objektivität als Theorieproblem der Historie, in: Fischer,A./ Heydemann,G. (Hg.): Geschichtswissenschaft in der DDR, Band I, 357
401vgl. Neuhäußer-Wespy, U.: Umorientierung in der Geschichtswissenschaft der DDR von 1971/72, in: Fischer,A./Heydemann,G.(Hg.): Geschichtswissenschaft in der DDR, Band I, S. 79
402vgl. Rüsen,J./Vasicek,Z.: Geschichtswissenschaft zwischen Ideologie und Fachlichkeit, in: Fischer, A./Heydemann,G. (Hg.): Geschichtswissenschaft in der DDR, Band I., S. 318
403vgl. Fischer,G/Heydemann,G.: Weg und Wandel der Geschichtswissenschaft und des Geschichtsverständnisses in der SBZ/DDR seit 1945, in: ders.: Geschichtswissenschaft in der DDR, Band I, S. 3ff
404v. Buxhoeveden,Ch./Lindemann,M.: Periodisierung in der Geschichtswissenschaft der DDR, in: Fischer,A./Heydemann,G.(Hg.) Geschichtswissenschaft in der DDR, Band I; S. 364
405vgl. Mittenzwei, W.: Die Intellektuellen, S. 537 zitiert: Fisch, A./Heydemann, G. (Hg.): . Geschichtswissenschaft in der DDR. 2. Bände.Berlin 1988/90
406vgl. Grimm, D. : Bürgerlichkeit im Recht ; in: Kocka, a.a.O., S. 150
407vgl.Rosenbaum, H.: Formen der Familie, Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 7. Auflage 1996, S. 259
408Blackbourn, D.: Kommentar in: Kocka J., a.a.O., S. 283
409v. Nayhauss, H.-Chr. Deutschsprachige Literaturen nach der Wende 1989 zitiert Vischer, Fr. Th. 1857: Ästhetik III Teil. Die Kunstlehre.II. Abschnitt: Die Künste, V. Heft, Stuttgart: Mäcken, in: Hess- Lüttich, E.W.B./ von Maltzan, C./ Thorpe, K. (Hrsg.): Gesellschaften in Bewegung, S. 135
410vgl. Max, Katrin: a.a.O., S. 412
411vgl. Steinecke, H.: Romanpoetik von Goethe bis Thomas Mann, a.a.O., S. 68
412Max, K., a.a.O., S. 32, zitiert Max Weber: Die protestantische Ethik
413Gall, L., a.a.O., S. 87
414Pikulik, L: Leistungsethik contra Gefühlskult, Vandenhoeck& Ruprecht Göttingen 1984, S. 141
415Gall, L., a.a.O., 46ff
416vgl.Hettling,M.: Die persönliche Selbständigkeit , in: Hettling/Hoffmann (Hg.): Der bürgerliche Wertehimmel, a.a.O., S. 64
418vgl. Mitterauer, M./ Hareven, T.: Entwicklungstrends der Familie in der europäischen Neuzeit, Picus Verlag 1996, S. 192
419vgl. Jaeger, H.: Der Unternehmer als Vater und Patriarch, in: Faulstich, W., Grimm, G.E.: Der Sturz der Götter, Suhrkamp Verlag Frankfurt a.M. 1989, S. 102
420vgl. Hettling, M.: Die persönliche Selbständigkeit, in: Hettling/Hoffmann (Hg): Der bürgerliche Wertehimmel, a.a.O., S. 78
421vgl. Huinink, J., Kteyenfeld, M.u.a.: Familie und Partnerschaft in Ost- und Westdeutschland, Verlag Barbara Budrich Opladen, Berlin und Toronto 2012, S. 21
422Kohli, M.: Die DDR als Arbeitsgesellschaft? Arbeit, Lebenslauf und soziale Differenzierung, in: Kaelble, H., Kocka,J., Zwahr, H. (Hg.): Sozialgeschichte der DDR, a.a.O., S. 49f
423Tenorth, H.-E.: Geschichte der Erziehung, Juventa Verlag Weinheim und München, 5. Auflage 2010, S. 323
424vgl. Wolle, St.: Die heile Welt, a.a.O., S. 312
425vgl. Rabe, Anne: die Möglichkeit von Glück, Klett-Cotta Stuttgart 2023, S. 176
426vgl. Max, , a.a.O., S. 408
427Mayer, K.U., Schulze, E: Die Wendegeneration, Campus Verlag Frankfurt, New York 2009, S. 106
428Naumann, K. : Schlachtfeld und Geselligkeit, in: Hettling, M. /Ulrich, B. (Hg.), a.a.O., S. 337
429vgl. Max, K., a.a.O., S. 34
430Habermas, T.: Geliebte Objekte, Suhrkamp Verlag 1999, S. 243
431Sabina Brändli „... die Männer sollten schöner geputzt sein als die Weiber“, in: Kühne, Th. (Hg.): Männergeschichte - Geschlechtergeschichte, Männlichkeit im Wandel der Moderne, Campus Verlag Frankfurt a.M. 1996, S. 103ff
432Frey, M.: Der reinliche Bürger, Entstehung und Verbreitung bürgerlicher Tugenden in Deutschland 1760 - 1860, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 1997, S. 213
433vgl. Habermas T.: Geliebte Objekte, a.a.O., S. 244 zitiert: Prentice, D.A. (1987): „Psychological correspondance of possessions, attitudes, and values", in: Journal of Personalty and Social Psychology 53, S. 993-d1004
434Frey, M., a.a.O., S. 182 zitiert: Renner, K.L. ,Lehrsätze über die Bestimmung und Veredlung des weiblichen Geschlechts, oder: Wie soll sich eine Jungfrau würdig bilden? Wien 1826, S. 12f
435vgl. Frey, M. a.a.O., S. 102f
436Frey, M., a.a.O., S. 163
437Campe, J.H.: Väterlicher Rath für meine Töchter, Verlag Leipz S. 210
438Frey, Manuel: Der reinliche Bürger, a.a.O., , S. 16, zitiert Schmidt, K.A. (Hg.): Enzyklopädie des gesammelten Erziehungs- und Unterrichtswesens, Bd.7, Gotha 1869, S. 1
439Lutosch, H., a.a.O., S. 29
440Frey, Manuel,: Der reinliche Bürger, a.a.O. S. 42f
441Frey, Manuel,: Der reinliche Bürger, a.a.O. S. 42f
442Frey, M. a.a.o., S. 115 zitiert: Ferro, PJ:. Vom Gebrauch des kalten Bades, Wien 1790, S. 75-128
443Frey, M. a.a.O., S. 281
444vgl. Frey, M. a.a.O., S. 126 zitiert Vom Nutzen der Reinlichkeit, Hamburg 1757, S. 25-32
445Frey, M. a.a.O., S. 134
446vgl.Hettling, M.: Politische Bürgerlichkeit, a.a.O., S. 9
447Hettling, M, a.a.O., S. 228
448vgl. Schäfer, M.: Die Geschichte des Bürgertums, a.a.O., S. 42
449Schäfer, M., a.a.O., S. 58
450vgl. Brakensieck, St.: Staatliche Amtsträger und städtische Bürger, in: Lundgreen,a.a.O., S. 142
451Schmuhl, H.-W.: Bürgertum und Stadt, in: Lundgreen, a.a.O., S. 235
452vgl. Hettling,M., a.a.O., S. 26ff
453Schäfer, M., a.a.O., S. 58
454Hettling, M., a.a.O., S. 31
455vgl. Schäfer, M., a.a.O., S. 143
456Schmuhl, H.-W., a.a.O., in: Lundgreen,P., a.a.O., S. 236
457Wienfort, M.: Recht und Bürgertum, in: Lundgreen, a.a.O., S. 281
458vgl. Hettling, M.: Politische Bürgerlichkeit, a.a.O., S. 310
459vgl. Lindtke, G.: Die Stadt der Buddenbrook, Verlag Max Schmidt-Römhild, Lübeck, 1981, S. 24
460vgl. Max, K., a.a.O., S. 35
461vgl. Hettling,M., a.a., S. 163
462vgl. Wienfort, M., a.a.O., in: Lundgreen,P., a.a.O., S. 279
463Hettling, M.: Politische Bürgerlichkeit, Vandenhoeck & Ruprecht 1999, S. 3
464Brakensieck, St.: Staatliche Amtsträger id städtische Bürger, in: Lundgreen,P. a.a.O., S. 168
465Hettling, M., a.a.O., S. 150ff
466vgl. Schäfer, M., a.a.O., S. 160
467vgl. Hettling, M., a.a.O., 136ff
468vgl. Linnemann, Kai Arne : Die Sammlung der Mitte und die Wandlung des Bürgers, in: Hettling/ Ulrich (Hg.):Bürgertum nach 1945, Hamburg Edition 2005, S. 196ff
469Fulbrook, M., a.a.O., S. 299
470vgl. Hertle, H.-H./Wolle, St. : Damals in der DDR, a.a.O., S. 238f
471vgl. Hertle, H.-H./Wolle, St. : Damals in der DDR, a.a.O., S. 238f
472vgl. Trepp, A.-Ch.: Emotion und bürgerliche Sinnstiftung, in: Hettling/Hoffmann (Hrsg.): Der bürgerliche Wertehimmel, a.a.O., S. 51
473Budde, G.: Auf dem Weg ins Bürgerleben, Kindheit und Erziehung in deutschen und englischen Bürgerfamilien 1840 - 1914, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 1994, S. 386
474Kuhlemann, F.-M.: Bürgerlichkeit und Religion, a.a.O., ..S. 200
475Kuhlemann, F.-M.: Bürgertum und Religion, in: Lundgreen, P., a.a.O., Sozialgeschichte.. S.299ff
476vgl. Hölscher,L.: Die Religion des Bürgers: bürgerliche Frömmigkeit und protestantische Kirche im 19. Jahrhundert, HZ Berlin Jg 250 (1990), de Gruyter Oldenbourg 1990, S. 53
477Walter, Jens: Die Buddenbrooks und ihre Pastoren, Weiland Verlag 1993, S. 14
478Schwöbel,Chr.: Die Religion des Zauberers, Mohr Siebeck Tübingen 2008, S. 62
479vgl. Kuhlemann, F.-M., a.a.O., in: Lundgreen,P., a.a.O., S. 305
480Max, K., a.a.O., S. 32: zitier: t Weber,Max: Die protestantische Ethik
481Kuhlemann,F.-M., a.a.O., S. 366
482vgl. Pikulik, L.: Leistungsethik contra Gefühlskult, a.a.O., S. 185
483Schellong, D.: Bürgertum und christliche Religion, Chr. Kaiser Verlag München 1975, S. 7
484vgl. Schellong, D., a.a.O., S. 101
485Jens, W., a.a.O., S. 17
486vgl. Jens, Walter, a.a.O., S. 11
487Jacobi, J.: Religiosität und Mädchenbildung, in: Kraul/Lüth, Chr. (Hrsg.): Erziehung der Menschen-Geschlechter, Deutscher Studien Verlag Weinheim 1996, S. 115
488vgl. Hölscher, L., a.a.O., S. 617
489Hölscher, L., a.a.O., zitiert Schleiermacher, F.: Der christliche Glaube, nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhang dargestellt. Berlin 1821/22, §9; S. 619
490Schwöbel, Chr.: Die Religion des Zauberers, Mohr Siebeck Tübingen 2008, S. 15
491vgl. Hölscher, L., a.a.O., S. 603
492Hölscher, L.: Die Religion des Bürgers: bürgerliche Frömmigkeit und protestantische Kirche im 19. Jahrhundert, HZ, Jg.250(1990), de Gruyter Oldenburg, 1990, S. 589
493Jens, W, a.a., S. 8
494vgl. Kuhlemann, F., a.a.O.,S. 234
495Kuhlemann, F., a.a.O., S. 306
496Habermas, R.: Rituale des Gefühls, in: Hettling/Hoffmann (Hg.): Der bürgerliche Wertehimmel, a.a.O., S. 171
497Hölscher, L.,a.a.O., zitiert: Rothe, Ausgewählte Schriften, Hrsg. Th. Schneider, Halle o.B. (1899), S. 621
498Tenorth, H.-E.: Geschichte der Erziehung, S. 164, zitiert :K. Erlinghagen: Katholisches Bildungsdefizit in Deutschland, Freiburg/Basel/Wien 1965; M.Klöcker. Das katholische Bildungsdefizit in Deutschland. Eine historische Analyse. In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 32 (1981), S. 79-98
499Schellong, D.: Bürgertum und christliche Religion, a.a.O., S. 86
500Budde, G., a.a., S. 382
501vgl. Janz, Oliver: Bürger besonderer Art, Evangelische Pfarrer in Preußen 1850 - 1914,De Gruyter 1994, S. 241
502Janz, Oliver,a.a.O., S. 259ff
503Janz O.: Staat und Bürgertum in Preußen, in: Schorn-Schütte,Sparn (Hrsg.): Evangelische Pfarrer, Kohlhammer Verlag Stuttgart 1997, S. 140
504vgl. Pikulig,L., a.a.O., S. 194
505vgl. Janz O., a.a.O., in: Schorn-Schütte, Sparn (Hrsg.), a.a.O., S. 136
506vgl. Lindtke, G.:Die Stadt der Buddenbrooks, a.a.O., S. 43
507vgl. McLeod, H.: Weibliche Frömmigkeit-männlicher Unglaube? in: Frevert, U. (Hrsg.) : Bürgerinnen und Bürger, Vandenhoeck & ruprecht Göttingen 1988S. 134f
508Gestrich, A., a.a.O., S. 109, zitiert: H. McLeod, Weibliche Frömmigkeit-männlicher Unglaube? in: U. Frevert(Hrsg.): Bürgerinnen und Bürger, Göttingen 1988, 134-156
509Habermas, R.: Rituale des Gefühls, in: Hettling/Hoffmann (Hg.) Der bürgerliche Wertehimmel, S. 179 ,zitiert Aloys Bauer (Hg.): Die Jungfrau im häuslichen und öffentlichen Lebens, Stuttgart 1830, S. 216
510Hölscher , L.: „Weibliche Religiosität“? in: Kraul/Lüth (Hrsg.):Erziehung der Menschengeschlechter, a.a.O., S. 49f
511Kuhlemann, F._M., a.a.O., in: Lundgreen, P., a.a.O., S. 310
512vgl. Kuhlemann, F.-M., a.a.O., S. 152
513vgl. Oliver Janz: Kirche, Staat und Bürgertum, in: Schorm-Schütte/Sparn (Hrsg.): Evangelische Pfarrer, Verlag Kohlhammer Stuttgart, 1997, S. 130
514vgl. Oliver Janz: Kirche, Staat und Bürgertum, in: Schorm-Schütte/Sparn (Hrsg.) Evangelische Pfarrer, Verlag Kohlhammer Stuttgart, 1997, S. 130
515vgl. Kuhlemann F.-M., a.a.O., S. 159
516vgl. Janz, Oliver, a.a.O., S. 233
517vgl. Kuhlemann, F.-M, a.a.O., S. 216
518Kuhlemann F.-M., a.a.O., S. 444f
519Janz, O., a.a.O., S. 306
520vgl. Kuhlemann, F.-M., a.a.O., S. 27
521vgl. McLeod, H. Weibliche Frömmigkeit - männlicher Unglaube? in: Frevert, U. (Hg.): Bürgerinnen und Bürger, a.a.O., S.151
522vgl. Janz, O., a.a.O., S. 145
523vgl. Kuhlemann, F.-M., a.a.O., S. 181
524Schwöbel, Chr., a.a.O., S. 17
525Maar, M., a.a.O., S. 329
526vgl. Janz, Oliver, a.a.O., S. 78
527vgl. Rathkolb, O.: Die Zweite Republik, in: Winkelbauer, Th., a.a.O., S. 589
528Trepp, A.-Ch.: Emotion und bürgerliche Sinnstiftung, in: Hettling/Hoffmann (Hg.) Der bürgerliche Wertehimmel, a.a.O., S. 55
529Hölscher, L., a.a.O., S. 613f
530Moeller, Bernd: Pfarrer als Bürger, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 1972, S. 24
531Wolle, St.: Die heile Welt, a.a.O., S. 348
532Rabe, A., a.a.O., S. 357
533Rabe, A., a.a.O. S. 207
534Pollack, D.: Religiosität und Kirchlichkeit, in: Kaelble,H. Kocka,J., Zwahr,H. (Hg.): Sozialgeschichte der DDR, a.a.O., S. 289
535vgl. Graf, F.W.: Theologie und Kirchenpolitik im DDR-Protestantismus, in: Kaelble;H. Kocka,J.,Zwahr,H. (Hg.): Sozialgeschichte der DDR, a.a.O., S. 300
536Graf, F.W.: Theologie und Kirchenpolitik im DDR-Protestantismus, in: Kaelble, ,H., Kocka,j., Zwahr,H. (Hg.) Sozialgeschichte der DDR, a.a.O., S. 314
537vgl. Rabe, A., a.a.O.,S. 207
538vgl. Pollack,D.: Von der Volkskirche zur Minderheitskirche. Zur Entwicklung von Religiosität und Kirchlichkeit in der DDR, in: Kaelble, H., Kocka, J., Zwahr, H. (Hg.): Sozialgeschichte der DDR, a.a.O., S. 279
539Hertle, H.-H./Wolle, St.: Damals in der DDR, a.a.O.,S. 129
540vgl. Pollack,D.: Von der Volkskirche zur Minderheitskirche. Zur Entwicklung von Religiosität und Kirchlichkeit in der DDR, in: Kalble,H., Kocka,J., Zwahr,H. (Hg.):Sozialgeschichte der DDR, a.a.O., S. 271ff
541vgl. Wirth, G.: Zu Potsdam und anderswo, in: Hettling, M., Ulrich, B. (Hg.): Bürgertum nach 1945, a.a.O., S. 107
542Kleßmann, Ch.: Relikte des Bildungsbürgertums, in: Kaelble, H.; Kocka,J., Zwahr,H., (Hg.) Sozialgeschichte der DDR, S. 266
543Pollack, D.: Religiosität und Kirchlichkeit, in: Kaelble,H., Kocka,J., Zwahr,H. (Hg.) Sozialgeschichte der DDR, a.a.O., S. 286f
544Hertle, H.-H./Wolle, St.: Damals in der DDR, a.a.O., S. 268
545Wirth, G. : Zu Potsdam und anderswo, in: Hettling/Ulrich (Hg.): Bürgertum nach 1945, a.a.O., S. 108
546Wirth, G. : Zu Potsdam und anderswo, in: Hettling/Ulrich (Hg.): Bürgertum nach 1945, a.a.O., S. 108
547vgl. Wolle, St.: Die heile Welt,a.a.O., S. 369
548Großbölting, Th.: Erosion und Resilienz: Bürgertum, Bürgerlichkeit und Entbürgerlichung in SBZ und DDR seit 1945, in: Sachsen und Anhalt, ZDB,Heft 27, S. 115f, 2015
549Schnor, Chr.: Trennungsrisiko von Paaren mit Kindern: Der Einfluss der Religion in West- und Ostdeutschland, in: Huinink, J., Kreyenfeld, M., Trappe, H. (Hrsg.) Familie und Partnerschaft in Ost- und Westdeutschland, S. 233
550vgl.Schnor, Ch.: Trennungsrisiko von Paaren mit Kindern Der Einfluss der Religion in West- und Ostdeutschland, in: Huinink, J., Kreyenfeld, M., Trappe, H. (Hrsg.): Familie und Partnerschaft in Ost- und Westdeutschland, a.a.O., S. 248
551Rabe,A.: Die Möglichkeit von Glück, Klett-Cottta 2023, S. 154
552Rabe, A.,a.a.O., S. 155
553Hertle, H.-H./Wolle,St.: Damals in der DDR, a.a.O., S. 235ff
554vgl. Wolle, St.: Die heile Welt, a.a.O., S. 142
555Hertle, H.-H./Wolle, St.: Damals in der DDR, a.a.O., S. 253
556Wolle, St.: Die heile Welt, a.a.O., S. 156
557Wolle, St.: Die heile Welt, a.a.O., S. 204ff
558Roth, R.: Von Wilhelm Meister zu Hans Castorp, in: Hein,D./Schulz,A. (Hg.): Bürgerkultur im 19. Jahrhundert, a.a.O., S. 123
559vgl. Hettling, M.: Bürgerliche Kultur - Bürgerlichkeit als kulturelles System, in: Lundgreen,P., a.a.O., S. 331
560vgl. Hettling, M. /Hoffmann, St: Zur Historisierung bürgerlicher Werte, in: Hettling, M./Hoffmann, St.-L. (Hg.): Der bürgerliche Wertehimmel, Vandenhoeck&Ruprecht, Göttingen, 2000, S. 12
561Hopfner, J.: Mädchenerziehung und weiblichen Bildung um 1800 im Spiegel der populärpädagogischen Zeit, Erlanger Pädagogische Studien, Verlag Justus Klinkhardt Bad Heilbrunn/Obb. 1990, S. 7
562vgl. Budde, G-F.: Bürgerinnen in der Bürgergesellschaft, in: Lundgreen, P., a.a.O., S. 250
563vgl. Karen Hagemann: „Heran, heran, zu Sieg oder Tod!“ in: Kühne, Th. (Hg.): Männergeschichte-Geschlechtergeschichte, Campus-Verlag Frankfurt a.M. 1996 S.
564Hausen, K.: Die Polarisierung der „Geschlechtscharaktere“ - Eine Spiegelung der Dissoziation von Erwerbs- und Familienleben, in: Conze, W. :Sozialgeschichte der Familie in der Neuzeit Europas, Ernst Klett Verlag Stuttgart, 1976, S. 368
565Menck, P.: Geschichte der Erziehung, Auer Verlag GmbH Donauwörth, 2. Auflage 1999, S. 155, zitiert: Rousseau, J.: Emile, a.a.O., S. 775
566vgl. Schneider-Taylor, B.: Jean-Jacques Rousseaus Konzeption der Sophie, Verlag Dr. Kovac Hamburg 2006, S. 18
567vgl. Schneider-Taylor, B.: J.-J. Rousseaus Konzeption..S. 66, zitiert Rang(Hg.): Emile oder Über die Erziehung, Stuttgart 1963, S. 719ff
568vgl. Garbe, Ch.: Sophie oder die heimliche Macht der Frauen, zitiert: Rousseau, J.J.: Julie oder Die neue Heloise, München 1978, S. 613, in: Brehmer/Jacobi/Dittrich/Kleinau/Kuhn (Hrsg.): Frauen in der Geschichte IV, Verlag Schwann-Bagel GmbH Düsseldorf 1983, S. 83
569vgl. Garbe, Ch.: Sophie oder die heimliche Macht der Frauen. Zur Konzeption des Weiblichen bei J.-J. Rousseau, in: Brehmer/Jacobi-Dittrich/Kleinau/Kuhn (Hrsg.): Frauen in der Geschichte IV, a.a.O., S. 73
570vgl. Garbe, Ch. Sophie oder die., zitiert Rousseau: Emile oder über die Erziehung. Hrsg. von M. Rang, Stuttgart 1978, S. 471 in: Brehmer /Jacobi-Dittrich/Kleinau/Kuhn (Hrsg.) Frauen in der Geschichte IV, a.a.O., S. 77
571Schneider-Taylor: J.-J. Rousseaus Konzeption der Sophie, S. 58, zitiert: Hartmut von Hentig. Rousseau oder Die wohlgeordnete Freiheit. München 2003, S. 65
572Hopfner, J., a.a.O., S. 51, zitiert: Pockels Versuch einer Charakteristik des weiblichen Geschlechts. Ein Sittengemälde des Menschen, des Zeitalters und des geselligen Lebens, 5 Bde., Bd 1 Hannover 1797-1802, S. 65
573Hausen, K.: Die Polarisierung der „Geschlechtscharaktere“- Eine Spiegelung der Dissoziation von Erwerbs- und Familienleben, zitiert: Meyer, J.: Das große Conversations-Lexikon, 1. Abt. 12. Bd Hildburghausen 1848, S. 748, in: Conze, W.: Sozialgeschichte der Familie in der Neuzeit Europas, S. 367
574vgl. Schneider-Taylor, B.: Jean-Jacques Rousseaus Konzeption der Sophie, a.a.O.,S. 102
575Kord, S.: Unmöglichkeiten, Vater-Tochter-Dramen im 18. und 19. Jahrhundert, zitiert Fichte J.G. : Deduction der Ehe, in: Grundlage des Naturrechts nach den Principien der Wissenschaftslehre, in: Johann, G.: Fichtes Sämtliche Werke, 8 Bde., Berlin: Veit, 1845-46, Bd. 3 (1845), S. 304-317, hier S. 310f in: Martinec/Nitsche (Hg.): Familie und Identität in der deutschen Literatur, a.a.O., S. 109
576Rudolphi, T: Gemälde weiblicher Erziehung, Heidelberg 1807, ND Lage: Beas 1998 in Richter, Daniela: „Lasset eure Kinder Menschen werden“. Das Engagement deutscher Bürgertumsfrauen in der Kindererziehung des 19. Jh. in: Martinec, Th/Nitschke, C. (Hrsg): Familie und Identität in der deutschen Literatur, Peter Lang GmbH Frankfurt a.M. 2009, S. 147
577Hopfner, J., a.a.O., S. 43, zitiert: Glatz, J.: Aureliens Stunden der Andacht, ein Erbauungsbuch für Töchter aus den gebildeten Ständen, Frankfurt/Main 1820, S. 192f
578Riehl, Wilhelm Heinrich: Die Familie, Stuttgart: J.G. Cotta’scher Verlag 1861
579vgl. Tremp, Peter: Rousseaus Emile als Experiment der Natur und Wunder der Erziehung, Leske + Buderich Opladen 2000, S. 140 zitiert: Mitterauer, M., Sieder, R.: Vom Patriarchat zur Partnerschaft: Zum Strukturwandel der Familie, München: Beck 1991, S. 25-26
580Menck, P.: Geschichte der Erziehung, a.a.O., S. 74, zitiert: Humboldt, W.v.: Bildung und Sprache. Eine Auswahl aus seinen Schriften. Hrsg. Clemens Menze, Paderborn 1959, S. 239
581Tenorth, H.-E.: Geschichte der Erziehung, a.a.O., S. 127
582Tenorth, H.-E.: Geschichte der Erziehung, a.a.O:, S. 143
583vgl. Daniel A./ McMillan: „. die höchste und heiligste Pflicht.“ Das Männlichkeitsideal der deutschen Turnbewegung 1811-1871, in: Kühne, Th. (Hg.): Männergeschichte- Geschlechtergeschichte, a.a.O., S. 89
584Rousseau, J.: Emile Bd 1, Paderborn 1910, S. 197f
585Rousseau, J.J.: Emil oder über die Erziehung,T. 1, Braunschweig 1789, S. 194-198
586vgl. Goltermann, Svenja: Figuren der Freiheit, in: Hettling/Hoffmann (Hg.): Der bürgerliche Wertehimmel, a.a.O., S. 153f
587vgl. Daniel A./ Mc.Millan: „... die höchste und heiligste Pflicht...“ in: Kühne, Th. (Hg.): a.a.O., S. 98
588Goltermann, S.: Figuren der Freiheit, in: Hoffmann/Hettling (Hg.): Der bürgerliche Wertehimmel, a.a.O., S. 168
589vgl. Weidermann, V.: Mann vom Meer, a.a.O. S. 4
590Tenorth, H.-E.:Geschichte der Erziehung, a.a.O.,S. 162
591Max, K., a.a.O., S. 24
592Hopfner, J. , a.a.O., S. 31, zitiert: Pockels, C.: Versuch einer Charakteristik des weiblichen Geschlechts, Hannover 1797-1802, 5 Bde., Bd. 1, S. 58f
593Hopfner, J., a.a.O., S. 93, zitiert: Hensel, J.D.: System der weiblichen Erziehung, besonders für den mittleren und höheren Standes, 1787, S. 48-54
594Hopfner, J., a.a.O., S. 92, zitiert Hillebrand, J.: Über Deutschlands National-Bildung, Frankfurt/ a.M. 1818, S. 232
595Budde, G: Bürgerkinder, in: Budde (Hg), Conze (Hg.), Rauh (Hg.):Bürgertum nach dem bürgerlichen Zeitalter, a.a.O., S. 342
596vgl. Jacobi-Dittrich, J.: „Hausfrau, Gattin und Mutter“ Lebensläufe und Bildungsgänge von Frauen im 19. Jahrhundert, in: Brehmer/Jacobi-Dittrich/ u.a., a.a.O., S. 273ff
597Hopfner , J. , a.a.O., S. 201, zitiert: Sonntag, K.G.: Sittliche Ansichten der Welt und des Lebens für das weibliche Geschlecht, In Vorlesungen, 2 Bde., Riga 1818-1820
598Hopfner,J., a.a.O., S. 42
599vgl. Hopfner, J., a.a.O., S. 40f
600Hopfner, J., a.a.O., S. 36, zitiert: Hensel: J.D. System der weiblichen Erziehung, besonders für den mittleren und höheren Standes, S. 189, Thiele, Halle 1787-1788
601vgl. Hopfner, a.a.O., S. 112
602Jacobi, J.: Religiosität und Mädchenbildung im 19. Jahrhundert in : Kraul/Lüth(Hrsg.): Erziehung der Menschen-Geschlechter, S. 109, zitiert: Spender (Hrsg.): The Education Papers , 1987 S. 171f: zitiert: Maria Grey 1871
603Ladj-Teichmann, D.: Erziehung zur Weiblichkeit durch Textilarbeiten, Beltz Verlag Weinheim und Basel 1983, S. 110, zitiert: Damen-Konversationslexikon 5. Bd. 1835, S. 148
604vgl. Ladj-Teichmann, D., a.a.O., S. 91
605Ladj-Teichmann, D. : Weibliche Bildung im 19. Jahrhundert: Fesselung von Kopf, Hand und Herz? in: Bremer/Jacobi-Dittrich , u.a. (Hrsg.), a.a.O., S. 221
606vgl. Ladj-Teichmann, D.: Weibliche Bildung im 19, Jahrhundert, a.a.O., S. 223
607vgl. Ladj-Teichmann,D.: Weibliche Bildung im 19. Jahrhundert: Fesselung von Kopf, Hand und Herz? a.a.O., S. 220
608vgl. Ladj-Teichmann, D., a.a.O., S. 238
609Ladj-Teichmann, D., a.a.O., S. 95
610Ladj-Teichmann, D., Weibliche Bildung im 19. Jahrhundert: Fesselung von Kopf, hand und Herz zitiert Meier: Über weibliche Bildung in öffentlichen Anstalten, Lübeck,1826, S. 155, in: Bremer/ Jacobi-Dittrich,/ u.a. (Hrsg.), a.a.O., S. 225
611Ladj-Teichmann, D, a.a.O., S. 149
612Ladj-Teichmann, D., a.a.O., in: Brehmer/Jacobi-Dittrich/ u.a.(Hrsg.), S. 233
613Ladj.Teichmann, D., a.a.O., zitiert Jean Paul: Levana oder Erziehlehre, 3. Band,1807 in: Jean Paul’s sämtliche Werke, Bd. 34, Berlin 1827, in: Brehmer/Jacobi-Dittrich/u.a. (Hrsg.): S. 234
614Ladj-Teichmann, a.a.O., zitiert: Pinoff,M: Reform der weiblichen Erziehung als Grundbedingung zur Lösung der sozialen Frage der Frauen, Breslau 1867, S. 57, in: Brehmer/u.a. (Hrsg.), S. 211
615vgl. Ladj-Teichmann, D., a.a.O., S. 129
616Ladj-Teichmann, D., a.a.O., zitiert: Ebhardt, F.(Hrsg.): Der gute Ton in allen Lebenslagen, 1884, Berlin, in: Brehmer/Jacobi-Dittrich. S. 231
617Ladj-Teichmann, D., a.a.O., S. 192
618Ladj-Teichmann, D., a.a.O., S. 204 zitiert Alberg,S.: Briefe über Mädchenbildung, Leipzig 1852, S. 57
619Ladj-Teichmann, D. , a.a.O., S. 126, zitiert :v.Raumer: Die Erziehung der Mädchen, Stuttgart 1853, S. 136
620Ladj-Teichmann, D., a.a.O., 104
621Ladj-Teichmann, D., a.a.O., S. 152
622Ladj-Teichmann, D., a.a.O., S. 208 zitiert Westkirch,L.: Das Paradies meiner Kindheit. In: Als unsere großen Dichterinnen noch kleine Mädchen waren. Selbsterzählte Jugenderinnerungen. Leipzig/Berlin 1912, S. 143
623vgl. Ladj-Teichmann, D., a.a.O., S. 201f, zitiert: Meier, Johann H.: Über Bildung durch öffentliche Anstalten, Lübeck 1826, S. 97ff
624Ladj-Teichmann, D., a.a.O., S. 229, zitiert: Meier, 1826, 97ff. und Pinoff, M, : Reform der weiblichen Erziehung als Grundbedingung zur Lösung der sozialen Frage der Frauen, Breslau, 1867, S.26
625Hopfner, J.,a.a.O., S. 116, zitiert: Ehrenberg, Fr.: Blätter dem Genius der Weiblichkeit geweiht, Berlin 1809, S. 129
626Hopfner, J., a.a.O., S. 115
627Hopfner, J., a.a.O., S. 129
628Hopfner, J., a.a.O., S. 120, zitiert: Ehrenberg, Fr.:Reden an Gebildete aus dem weiblichen Geschlecht, Verlag Elberfeld, 1829, S. 207
629Frevert, U., a.a.O., S. 67, zitiert: Otto-Peters, Frauenleben im Deutschen Reich, Leipzig 1876, zitiert bei Gerhard, S. 284
630Kord, S.: „Unmöglichkeiten. Vater-Tochter-Dramen im 18. und 19. Jahrhundert“ zitiert Kant,I. Werkausgabe in 12 Bänden, hrsg. v. Wilhelm Weichedel, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1968. Bd. 11, S. 55, in: Martinec/Nitschke (Hg.), a.a.O., S. 107
631Campe, J. H.: Väterlicher Rath für meine Tochter, a.a.O., S. 23f
632Hausen, K., a.a.O., S. 376
633Hobsbawn, E.: Kultur und Geschlecht im europäischen Bürgertum 1870-1914 in: Frevert, U. (Hg.): Bürgerinnen und Bürger, a.a.O., S. 175
634vgl. Bussemer, H.: Bürgerliche Frauenbewegung und männliches Bildungsbürgertum 1860-1880, in: Frevert, U. (Hg.), a.a.O., S. 196
635Habeth, St.: Die Freiberuflerin und Beamtin (Ende des 19. Jahrhunderts bis 1945), in: Pohl/ Treue (Hg.), ZfU Band 35: Die Frau in der Wirtschaft, S. 158
636Hausen, K., a.a.O., in: Conze, W.: Sozialgeschichte der Familie in der Neuzeit Europas, Ernst Klett Verlag Stuttgart 1976, S. 380
637vgl.Frevert, U, a.a.O., S. 124
638Tenorth, H.-E.: Geschichte der Erziehung, S. 270 zitiert: Zitate nach dem Abdruck der entsprechenden Passagen in: H. Kanz (Hrsg.): Deutsche Pädagogische Zeitgeschichte. Bd. 1, Ratingen 1975, S. 29ff
639Mayer, K.U., Schulze, E.: Die Wendegeneration, a.a.O., S. 40
640Obertreis, G.: Familienpolitik in der DDR 1945 - 1980, Opladen Leske und Budrich 1986, S. 225, zitiert nach: Die Schulkonferenz der SED, in: SBZ-A-W58, S. 147/148
641vgl. Wilms, G. : Gleiche Bildungsmöglichkeiten für alle - Bildung in der DDR, in: Manz, G., Sachse,E., Winkler,G. (Hg.: ) Sozialpolitik in der DDR, a.a.O., S. 249
642Mayer/Schulze, a.a.O., S. 87
643Tenorth, H.-E., a.a.O., S. 276
644Wilms, G.: Gleiche Bildungschancen für alle - Bildung in der DDR, in: Manz,G., Sachse,E., Winkler,G. (Hg.): Sozialpolitik in der DDR, a.a.O., S. 245
645vgl. Wilms, G., a.a.O., in: Manz,G., Sachse,E., Winkler,G. (Hg.): Sozialpolitik in der DDR, a.a.O., S. 258
646vgl.Tenorth, H.-E., a.a.O., S. 289
647vgl.: Wilms, G., a.a.O., in: Manz, G., Sachse,E., Winkler,G.(Hg.): Sozialpolitik in der DDR, a.a.O., S. 255
648Max, Katrin., a.a.O., S. 47
649vgl. Kohli, M.: Die DDR als Arbeitsgesellschaft? Arbeit, Lebenslauf und soziale Differenzierung, in: Kaelble,H., Kocka,J., Zwahr,H. (Hg.): Sozialgeschichte der DDR, a.a.O., S. 54
650Mayer/Schulze, a.a.O.,S. 46
651Linke, A.: Sprachkultur und Bürgertum, Verlag J.B. Stuttgart Weimar 1996, S. 126
652Linke, A., a.a.O., S. 123ff
653Bausinger, H. : Bürgerlichkeit und Kultur, in: Kocka, J., a.a.O., S. 124ff
654Linke, A., a.a.O., S. 12
655vgl. Linke, A., a.a.O., S. 239
656Linke, A., a.a.O., S. 255
657vgl. Wolle, St.: Die heile Welt, a.a.O., S. 27
658Max, Katrin, a.a.O., S. 181
659vgl. WAZ, 14.01.2023, Felix Müller: Anne Wills Abschied von der Talkshow-Bühne
660vgl. Linke, A., a.a.O., S. 53ff
661Weidermann, V., a.a.O., S. 302
662vgl. Linke, A., a.a.O., S. 184
663vgl. Linke, A., a.a.O:, S. 285
664Keppler, A.:Tischgespräche, Suhrkamp-Taschenbuch Frankfurt am Main 1994, S. 268
665Keppler, A., a.a.O., S. 50
666Keppler, A., a.a.O., S. 14
667Keppler, A., a.a.O., S.9f
668Keppler, A., a.a.O., S.280
669Keppler, A., a.a.O., S. 27
670Keppler, A., a.a.O., S. 13 zitiert: Kant, I., Anthropologie in pragmatischer Absicht, in: ders., Werke in zwölf Bänden, hg. v. W. Weischedel, Frankfurt/M. 1968, Bd. XII, S. 620f
671Keppler, A., a.a.O., S. 93
672Keppler, A., a.a. O., S. 78
673vgl. Mettele, G. : Der private Raum als öffentlicher Ort, in: Hein,D./Schulz,A. (Hg.): Bürgerkultur im 19. Jahrh., a.a.O., S. 160
674Keppler, A., a.a.O., S. 168
675Linke, A., a.aO., S. 203, zitiert: Franken,Constanze: Katechismus des guten Tons und der feinen Sitten. 16. Auflage, Leipzig
676Budde, G.-F.: Bürgerinnen in der Bürgergesellschaft, in: Lundgreen, P. (Hrsg.), a.a.O., S. 261
677Keppler, A., a.a.O., S. 118
678vgl. Keppler, A., a.a.O., S.280
679vgl. Janina Fischer, Rezension des Romans „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ von Eugen Ruge, , www.lvz.de..S. 4
680vgl. Pikulik, L., a.a.O., S. 323
681vgl. Budde, F.: Auf dem Weg ins Bürgerleben, a.a.O., S. 127
682vgl. Roth, R. : Von Wilhelm Meister zu Hans Castorp, in: Hein,,D./Schulz,A. (Hg.): Bürgerkultur im 19. Jahrhundert, a.a.O., S. 128
683Max, Katrin, a.a.O., S. 79
684Stifter, A.: Der Nachsommer, Nachwort von Fritz Krökel, Winkler Verlag München 1949, S. 735
685Stifter, A., a.a.O., S. 742
686Stifter, A., a.a.O., S. 742f
687Stifter, A, a.a.O., S. 7
688Stifter, A., a.a.O., S. 10
689Stifter, A., a.a.O., S. 14
690Max, Katrin: Bürgerlichkeit und bürgerliche Kultur, S. 59 zitiert: Berger, M. u.a. (Hg.): Kulturpolitisches Wörterbuch. Berlin: Dietz 1978, S. 429,459
691Graf v. Nayhauss: Deutschsprachige Literaturen nach der Wende, in: Hess-Lüttich, E.W.B./ von Maltzan, C./Thorpe, K. (Hrsg.): Gesellschaften in Bewegung, zitiert: Rolf Schneider und Stalin, S. 134
692Wolle, St.: Die heile Welt, a.a.O., S. 194
693Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. https://www.google.de/url? sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUi7mhw7v AhWYgPO HHQV3DPwQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bmbwf.gv.at%2FThemen%2Fschule%2 Fschulpraxis%2Fschwerpunkte%2Fkulturvermittlung%2Fschach.html&usg=AOvVawO8ncpMaPBu R8b1WE2k9NdE
694Freytag, G.: Soll und Haben, Leipzig 1855, S. 331
695Hein, D.: Bürgerkultur und ihre Organisationsformen im 19. Jahrhundert, in: Lütteken, L. (Hrsg.): Zwischen Tempel und Verein, Bärenreiter-Verlag Kassel 2013, S. 42f
696vgl. Nipperdey, Th.: Kommentar „Bürgerlich“ als Kultur, in: Kocka, J., a.a.O., S. 148
697vgl.Linke, A., a.a.O., S. 26
698Becker, F.: Bürgertum und Kultur im 19. Jh, in: Lütteken, L. (Hrsg.), a.a.O., S. 14f
699Nipperdey, Th., a.a.O., in: Kocka, J., a.a.O., S. 147
700vgl.Gall, L., a.a.O., , S. 202 ff
701Nipperdey, Th.: Wie das .Bürgertum die Moderne fand, a.a.O., S. 38 ff
702Nipperd Th., a.a.O., S. 23
703Nipperdey, Th., a.a.O., S. 24
704Hettling, M., a.a.O., in: Lundgreen, P., a.a.O., S. 335
705Nipperdey, Th., a.a.O., S. 27
706vgl. Hein, D.:Bürgerliches Künstlertum, in: Hein,D./Schul,A. (Hg.) :Bürgerkultur im 19. Jahrhundert, a.a.O., S. 109f
707Nipperdey, Th., a.a.O., S. 54 ff
708vgl. Kalisch, V.: Studien zur „bürgerlichen Musikkultur", Sofortdruck Anton Brenner, Tübingen 1990, S. 22 ff
709vgl. Kalisch, V., a.a.O., S. 3
710vgl. Rieger, E.: Die geistreichen aber verwahrlosten Weiber - Zur musikalischen Bildung von Mädchen und Frauen, in: Brehmer/Jacobi-Dittrich/Kleinau/Kuhn (Hrsg.): Frauen in der Geschichte IV, Schwann-Bagel Düsseldorf 1983, S. 397
711vgl. Kalisch, V., a.a.O., S.38 f
712Sven Oliver Müller: ein fehlender Neuanfang. Das bürgerliche Musikleben in der Bundesrepublik, in: Budde/ Conze/ Rauhe (Hrsg.), a.a.O., S. 261
713Kalisch, V., a.a.I., S. 144
714Heine, Claudia: Im Spannungsfeld zwischen Unterhaltung und Sakralisierung , in: Lütteken, L. (Hrsg.), a.a.O.,S. 106ff
715vgl. Nipperdey, Th., a.a.O., S. 18
716Weidermann, V., a.aO., S. 56
717Sven Oliver Müller, a.a.O., S. 261
718Schulz,A.: Der Künstler im Bürger, zitiert: Art.Dillettant, in: Allgemeine deutsche RealEncyclopädie für die gebildeten Stände (Conversations-Lexicon). Dritter Band. Fünfte OriginalAusgabe. Leipzig 1819, 194f, in: Hein,D./Schulz,A. (Hg.): Bürgerkultur im 19. Jahrhundert, a.a.O., S. 35
719Lindtke, G., a.a.O., S. 49
720Gall, L., a.a.O., S. 501 zitiert: Thomas Mann
721vgl. Budde, G.-F., a.a.O., S. 138
722vgl. Becker, F., a.a.O., in Lütteken, L., (Hrsg. ), a.a.O., S. S. 17
723Becker, F.: Bürgertum und Kultur, in: Lütteken, L. (Hrsg.), a.a.O., S. 26
724Sandberger, Wolfgang: Musik als bürgerliche Lebenswelt, in: Lütteken, L., a.a.O., S. 59f
725Hein D.: Bürgerkultur und ihre Organisationsformen im 19. Jahrhundert, zitiert: Fahlbusch: Räume der Musik , S. 257 In: Thorau et al (Hrsg.): Musik, Bürger, Stadt , in: Lütteken, L. Zwischen Tempel und Verein, S. 45
726Schulz,A.: Der Künstler im Bürger, in: Hein,D./Schulz,A.(Hg.), a.a.O.,S. 51
727Sven Oliver Müller, a.a.O., S. 266
728Möller, F : Zwischen Kunst und Kommerz, in: Hein,D./Schulz,A.(Hg,): Bürgerkultur im 19. Jahrhundert, S. 31
729Rieger, E.: Die geistreichen aber verwahrlosten Weiber- Zur musikalischen Bildung von Mädchen und Frauen, in: Brehmer/Kacobi-Dittrich/Kleinau/Kuhn (Hrsg.): Frauen in der Geschichte IV, a.a.O., S.400
730vgl. Bauer, H.: Wenn einer eine Reise tat, Koehler & Amelang Leipzig 1967, S. 98
731vgl. Neutsch, C., Witthöft, H.: Kaufleute zwischen Markt und Messe, in: Bausinger, Beyer, Korff: Reisekultur, Verlag C. H. Beck München 1991, S. 80
732Prein, Philipp: Bürgerliches Reisen im 19. Jahrhundert, LitVerlag Münster 2005, S. 1
733Prein, Ph., a.a.O., S. 25f
734Kaschuba, W.: Die Fußreise - Von der Arbeitswanderung zur bürgerlichen Bildungsbewegung, in: Bausinger u.a. (Hg.): Reisekultur, S. 169
735Budde, G.-F, a.a.O., S. 217
736Weber-Kellermann, I., a.a.O., S. 117, zitiert: Aller, Karl: Sexualität und Sitte, 1966
737Bauerkämper, A.: Räume und Zeiten des Reisens, Einführung, in: Bauerkämper, A., Bödeker, H.E., Struck, B. (Hg.) Die Welt erfahren, Cmpus Verlag Frankfurt/New York 2004, S. 33
738vgl. Prein, Ph., a.a.O., S. 229
739vgl. Richter, D.: Die Angst des Reisenden, die Gefahren der Reise, in: Bausinger u.a. (Hg.) Reisekultur, a.a.O., S. 105
740vgl. Wolbring, B.: „Auch ich in Arkadien!“, in: Hein,D./Schulz,A. (Hg.), a.a.O., S. 83
741Prein, Ph., a.a.O., S. 73f
742Harbsmeier, M.: Wilde Völkerkunde - Deutsche Entdeckungsreisende der frühen Neuzeit , in: Bausinger u.a. (Hg.): Reisekultur, a.a. O., S. 100
743vgl. Bauer, H., a.a.O., S. 145
744Prahl/Steine>745Weidermann, V., a.a.O., S. 51
746König, G.: Eine Kulturgeschichte des Spaziergangs, Böhlau Verlag Wien, Köln, Weimar 1996, S. 220ff
747Prein, Ph, a.a.O., S. 117
748Pelz, Annegret: Reisen Frauen anders? in: Bausinger u.a. (Hg.), a.a.O., S. 177
749vgl. Prein, Ph., a.a.O., S. 141ff
750Trepp, A.-Ch.: Sanfte Männlichkeit und selbständige Weiblichkeit. Frauen und Männer im Hamburger Bürgertum zwischen 1770 und 1840, Vandenhoeck & Ruprecht 1995, S. 201
751König, G., a.a.O., S. 236
752vgl. König, G., a.a.O., S. 254
753vgl. Prein, Ph., a.a.O., S. 238
754Frey, M., a.a.O., S. 108, zitiert: Scherer, J.A.: Geschichte der Luftprüfungslehre, Bd. 2, S. 75-78, Wien 1785
755vgl. Bauer, H., a.a.O., S. 140
756Prein, Ph., a.a.O., S. 156
757vgl. Prahl, H.-W./Steinecke, A., a.a.O., S.15
758Weidermann, V., a.a.O., S. 7
759vgl. Prahl/Steinecke, a.a.O., S. 33
760Axen, K.-H.: Travemünde, das Seebad Lübecks, Baginski Media Travemünde 2017, S. 11
761vgl. Manning, T.:Touristische Emanzipation vom bürgerlichen Reiseideal, in: Hettling/Ulrich (Hrsg.), a.a.O., S. 240f
762Till Manning , Touristische Emanzipation vom bürgerlichen Reiseideal, zitiert: Enzensberger,H.M.: Theorie des Tourismus, S. 189, in: Einzelheiten I. Bewusstseinsindustrie, Frankfurt, 1962, in: Hettling/Ulrich (Hrsg.), a.a.O., S. 240
763Bausinger, H.: Grenzenlos? Ein Blick auf den modernen Tourismus, in: Bausinger u.a. (Hg.), a.a.O., S. 347
764Costagli, S.: Family Plots. Literarische Strategien dokumentarischen Erzählens. in: Costagli, S., Galli, M. (Hrsg.): Deutsche Familienromane, Wilhelm fink Verlag München 2010, S. 168
765vgl. Bödeker, H.E., Bauerkämper, A., Struck, B.: Einleitung, Reisen als kulturelle Praxis, S. 10f in: Bauerkämper, A., Bödeker, H.E., Struck, B. (Hg.) : Die Welt erfahren, Campus Verlag 2004
766vgl. Cohen-Pfister, L.: Kriegstrauma und die deutsche Familie, in: Martinec/Nitschke (Hg.), a.a.O., S. 245
767Bertrand, G.: Der Diskurs der Reisenden, in: Bauerkämper, A., Bödeker, H.E., Struck, B. (Hg.),a.a.O., S. 301
768Mettele, G.: Der private Raum als öffentlicher Ort, in: Hein,D./Schulz,A. (Hg.), a.a.O., S. 155
769Trepp, A.-Ch.: Sanfte Männlichkeit, a.a.O., S. 386
770Trepp, A.-Ch.: Sanfte Männlichkeit, a.a.O., S. 373
771vgl. Marx, F.: Familienkatastrophen. Über die Erzählfigur des Familienfestes in der Gegenwartsliteratur, in: Costagli, S., Galli, M. (Hrsg.), a.a.O., S. 132
772Keppler, A., a.a.O., S. 161
773vgl. Weber-Kellermann, I.: Die deutsche Familie, Suhrkamp-Verlag 1974, S. 226f
774Keppler, A., a.a.O., S. 29
775vgl. Richter, D.: Das fremde Kind, S. Fischer Verlag GmbH 1987, S. 270
776vgl. Trepp, A.-Ch.: Sanfte Männlichkeit, a.a.O., S. 176 zitiert: Mitterauer, M.: Die Familie als historische Sozialform, in: Mitterauer/Sieder: Vom Patriarchat zur Partnerschaft, a.a.O., S. 13-37
777Weber-Kellermann, I., a.a.O., S. 222
778vgl. Chvojka, E.: Geschichte der Großelternrollen, Böhlau Verlag Wien 2003, S. 261
779Schneider, N.F., a.a.O., S. 255
780vgl. König, G, a.a.O., S. 216
781vgl. König, G., a.a.O., S. 27ff
782vgl. König, G., a.a.O., S. 51
783König, G., a.a.O., S. 232f
784Geulen, Chr.: Center Parcs - Zur bürgerlichen Einrichtung natürlicher Räume im 19. Jahrhundert, in: Hettling/Hoffmann (Hg.): Der bürgerliche Wertehimmel, a.a.O., S. 273
785Nave-Herz, R.: Familie heute, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Primus Verlag Darmstadt, 3. Auflage, 2007, S. 90
786vgl.Frevert, U., a.a.O., S. 35
787vgl. Hein, D.: Bürgerkultur und ihre Organisationsformen im 19. Jahrhundert ,in: Lütteken, L. (Hrsg.), a.a.O., S.41
788vgl. Sobania, M.: Vereinsleben, Regeln und formen bürgerlicher Assoziationen im 19. Jahrhundert, in: Hein,D./Schulz,A. (Hg.): Bürgerkultur im 19. Jahrhundert, a.a.O., S. 183
789vgl. Maentel, Th.: Zwischen weltbürgerliche Aufklärung und stadtbürgerlicher Emanzipation, in: Hein,D./Schulz,A. (Hg.): Bürgerkultur im 19. Jh., a.a.O., S. 145
790vgl. Marie Christine Potthoff: Traditionelle Bürgerlichkeit im internationalen Kontext ,in : Budde, G, u.a. (Hrsg.), a.a.O.,S. 82ff
791vgl. Maentel, Th.: Weltbürgerliche Aufklärung, stadtbürgerliche Emanzipation, in: Hein,D./ Schulz,A. (Hg.), a.a.O., S. 145
792Sobania, M. :Vereinsleben, in: Hein,D./Schulze,A. (Hg.), a.a.O., S. 171f
793Vgl. Sobania, M.: Vereinsleben, in: Hein,D./Schulz,A. (Hg.), a.a.O., S. 176f.
794vgl. Roth, R.: Von Wilhelm Meister zu Hans Castorp, in: Hein,D./Schulz,A. (Hg.), a.a.O., S. 133
795Trepp, A.-Ch.: Sanfte Männlichkeit, a.a.O., S. 278
796Tenfelde, K.: Dienstmädchengeschichte zitiert Hoffmann, W., Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, Berlin/Heidelberg/New York 1965, S. 172-174, 204-206, 210, in : ZfU Band 35, Pohl/Treue (Hg.): Die Frau in der Wirtschaft, Steiner Verlag Wiesbaden, Stuttgart 1985, S. 111
797vgl.Nipperdey, Th., a.a.O., in. Kocka, J., a.a.O., S. 145f
798vgl. Frevelt, U., a.a.O., S. 68
799vgl. Tenfelde, K.: Dienstmädchengeschichte, in: ZfU, Bd 35, Pohl; H./Treue,W. (Hg.), a.a.O., S. 106
800vgl.Ottmüller, Uta,: Die Dienstbotenfrage, verlag frauenpolitik gmbh 1978, S. 21
801vgl. Wierling, D.: „Ich habe meine Arbeit gemacht - was wollte sie mehr?“ , in: Hausen, K. (Hg.): Frauen suchen ihre Geschichte, C.H.Beck München 1983, S. 146
802vgl. Wierling, D.: Mädchen für alles, Verlag J. H. W. Dieth Nachf. GmbH Berlin Bonn 1987 S. 171f
803Tenfelde, K., a.a.O.: in: Pohl/Treue (Hg.), a.a.O., S. 115ff
804vgl. Wierling, D.: Mädchen für alles, a.a.O., S. 251ff
805vgl. Wierling, D.: Mädchen für alles, a.a.O., S. 17
806vgl. Weber-Kellermann, I., a.a.O., S. 122
807vgl. Ottmüller, Uta, a.a.O., S. 119
808Tenfelde, K, a.a.O.,S. 111
809Pikulik, L., a.a.O., S. 152
810Pikulik, L., a.a.O., S. 152
811Pikulik, L., a.a.O., S. 152
812Lindtke, G., a.a.O., zitiert A. Grube „Kindheitserinnerungen“(Lüb. Blätter 1926, S.6), S. 38
813Frevert, Ute, a.a.O., S. 18
814vgl. Riehl, W.H., a.a.O., Die Familie, S. 90 ff
815Eßlinger, Eva: Das Dienstmädchen, die Familie und der Sex, Wilhelm Fink Verlag München 2013, S. 123
816vgl. Mitterauer/Sieder, a.a.O., S. 159ff
817Eßlinger, Eva, a.a.O.,S. 258 zitiert Freud : Briefe an Wilhelm Flies 1887-1904, Ungekürzte Ausgabe, hg. v. Jeffrey Moussaieff Masson, dt. Fassung bearb. v. Michael Schröter, Frankfurt, a.M. 1986, S. 255
818Wierling, D., a.a.O.,S. 231 zitiert : Oscar Stilich: Die Lage der der weiblichen Dienstboten in Berlin, in: Freies Wort, Jg. 1906, S. 251
819vgl. Wierling, D., a.a.O., S. 142 f
820Labouvie, Eva : Vom Paar zur Familie in: Kauer, K., a.a.O., S. 68
821vgl. Borscheid, P. /Teuteberg, H.-J.: Ehe , Liebe, Tod, zum Wandel der Familie, Coppenrath, Münster 1983, S. 117
822Trepp, Anne-Ch.: Emotion und bürgerliche Sinnstiftung, zitiert Brockhaus von 1865: Kapl- Blume,E.:Liebe im Lexikon, Mag.-Arbeit Bielefeld 1985, S. 111, in: Hettling/Hoffmann (Hg.): Der bürgerliche Wertehimmel, a.a.O., S. 39
823vgl. Trepp, A., a.a.O., S. 131
824Frevert, U., a.a.O., S. 59
825Hopfner, J., a.a.O., S. 150 zitiert Brandes, Betrachtungen, Hannover 1802, S. 220f
826vgl. Borscheid, P, a.a.O., S. 114
827vgl. Trepp, A.-Ch.: Sanfte Männlichkeit und selbständige Weiblichkeit, a.a.O., S. 25f
828Borscheid, P.: Geld und Liebe, in: Borscheid, P /Teuteberg, H.-J.: Ehe , Liebe, Tod, zum Wandel der Familie, Coppenrath, Münster 1983, S. 112
829Vogtmeier, M., a.a.O., S. 38
830Daiber, J.: „Schlimm, dass bei uns nur die Wahl zwischen Ehe und Einsamkeit ist.“ in: Martinec/ Nitschke, (Hg.),a.a.O., S. 80f
831Borscheid, P., a.a.O., S. 130
832vgl. Borscheid, P., a.a.O., S. 134
833vgl. Rosenbaum, H.:Formen der Ehe, Suhrkamp Verlag Frankfurt a.M. 1996, 7. AuflageS. 334
834Borscheid, P., a.a.O., S. 124
835Trepp, Anne-Charlott,:Emotion und bürgerliche Sinnstiftung oder die Metaphysik des Gefühls: Liebe am Beginn des bürgerlichen Zeitalters ,in: Hettling/Hoffmann (Hg.), a.a.O., S. 30
836Trepp, Anne-Charlott,:Emotion und bürgerliche Sinnstiftung oder die Metaphysik des Gefühls: Liebe am Beginn des bürgerlichen Zeitalters ,in: Hettling/Hoffmann (Hg.), a.a.O., S. 30
837Langbein, U., a.a.O., S, 22 zitiert Hauser, A.: Dinge des Alltags. Studien zur historischen Sachkultur eines schwäbischen Dorfes. Tübingen 1994 S. 351
838Frevert, Ute: Frauen-Geschichte: Zwischen bürgerlicher Verbesserung und neuer Weiblichkeit, Frankfurt/M. 1986, S. 42
839Hopfner, J., a.a.O., S. 151f zitiert Pockels, K.F.: Versuch einer Charakteristik des weiblichen Geschlechts 3. Band, S. 278
840vgl. Labouvie, Eva: Vom Paar zur Familie, von der Konvergenz zur Liebe, in: Kauer, K., a.a.O., S. 73
841Trepp, A.-Ch.: Emotion und bürgerliche Sinnstiftung, in: Hettling/Hoffmann (Hrsg.): Der bürgerliche Wertehimmel, a.a.O., S. 42ff
842Labouvie, Eva, : Vom Paar zur Familie, von der Konvergenz zur Liebe, in Kauer, Katja,a.a.O., S. 66
843vgl. Blasius, D.: Bürgerliche Rechtsgleichheit und die Ungleichheit der Geschlechter, in: Frevert, U. (Hg.), a.a.O., S. 70
844Ottmüller, U., a.a.O., S. 35
845Hausen, K.: „... eine Ulme..“ in Frevert, U.: Bürgerinnen und Bürger, a.a.O., S. 95
846von Matt, P.: Verkommene Söhne, Missratene Töchter, Carl Hanser Verlag München Wien 1995, S. 244
847van Matt, P., a.a.O., S. 246
848Rabe, A., a.a.O., S. 52
849vgl. Sieder, R.: Sozialgeschichte der Familie, Suhrkamp Verlag Frankfurt a.M. 1987, S. 262
850vgl.Kord, S.: Unmöglichkeiten. Vater-Tochter-Dramen, zitiert Lawrence Stone: The Family, Sex and Mariage in England 1500-1800: Weidenfeld and Nicholson, London 1977, in: Martinec/ Nitschke, a.a.O., S. 115
851vgl. Mitterauer, a.a.O., S. 166
852Nave-Herz, R.: Heirat ausgeschlossen? Campus Verlag Frankfurt/Main 1998, S. 43, zitiert: Oppenheimer 1988 in South, S.J. /Lloyd, K.M. (1992): Marriage Opportunities an amily Formation: Further Implications of Imbalanced Sex Ratios, In: Journal of Marriage and the Family, S. 440-451 Seegers, Lu: Prominenz und bürgerlicher Wertewandel in der Bundesrepublik, in: Budde, G. u.a. (Hrsg.), a.a.O., S. 273
853Sieder, R. a.a.O., S. 256ff
854Sieder, R. a.a.O., S. 256ff
855Mitterauer, a.a. O.,S. 74
856Schneider, N.F., a.a.O., 177
857Häring, A., Stoye, K., Klein, Th., Stauder, H. : Der Partnermarkt junger Erwachsener in Ost- und Westdeutschland, in: Familie und Partnerschaft in Ost- und Westdeutschland, a.a.O., S. 260ff
858Daiber, J.: „Schlimm, dass bei uns nur die Wahl zwischen Ehe und Einsamkeit ist.“ in: Martinec/ Nitschke (Hg.), a.a.O., S. 81
859Möckel, Sebastian: Abenteuer und Initiation, in: Martinec/Nitschke (Hg.), a.a.O., S. 76
860vgl. Hopfner, J., a.a.O., S. 160f
861vgl. Trepp,A., a.a.O., S. 64
862Rosenbaum, H., a.a.O.,, S. 348
863vgl. Trepp, A.-Ch., a.a.O., S. 167
864Hull , I. V.: Sexualität in der bürgerlichen Gesellschaft, zitiert: Fichte, J.G.: Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre (1796), Hamburg 1979, S. 300, 304, 306, 307 in: Frevert, U. (Hg.), a.a.O., S. 62
865Hull, I.V., a.a.O., zitiert :Rousseau: versch. Schriften z.B. ,Emile‘ in: Frevert, U. (Hg.), a.a.O., S.
866Hopfner, J., a.a.O., S. 164 zitiert: Sonntag, K.G.: Sittliche Ansichten der Welt und des Lebens für das weibliche Geschlecht, In Vorlesungen, 2. Bde, Riga 1818-1820, S. 360
867Frevert, U., a.a.O., S.130
868Schütze,Y./Geulen,D.: Die „Nachkriegskinder“ und die „Konsumkinder“: Kindheitsverläufe zweier Generationen, in: Preuss-Lausitz,u.a: Kriegskinder Konsumkinder Krisenkinder, Reihe Pädagogik Beltz, Beltz Verlag, Weinheim und Basel, 1995 4. Auflage, S. 41
869vgl. Schütze,Y./Geulen,D.: Die „Nachkriegskinder“ und die Konsumkinder“: Kindheitsverläufe zweier Generationen, in: Preus-Lausitz,U. u.a. Kriegskinder Konsumkinder Krisenkinder, a.a.O., S. 51
870Wirsching, A.: Die Familie in der Moderne, in: Weber E.J/Herzog, M. „Ein Herz und eine Seele“? W. Kohlhammer GmbH Stuttgart 2003, , S. 50, zitiert: Svarez, Carl. G.: Vorträge über Recht und Staat, hrsg. von Hermann Conrad/ Gerd Kleinheyer, Köln/Opladen 1960, S. 316. /Vgl. Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794. Textausgabe mit einer Einführung von Hans Hattenhauer, Frankfurt a.M./Berlin 1970, 345ff. (Von der Ehe)
871vgl.Frevert, U., a.a.O., S. 64
872Gestrich, A., a.a.O., S. 33
873Gestrich, A., a.a.O.,S. 33
874vgl.Frevert, U., a.a.O., S. 55
875Blasius, D.: Bürgerliche Rechtsgleichheit und die Ungleichheit der Geschlechter. Das Scheidungsrecht im historischen Vergleich, in: Frevert, U. (Hg.), a.a.O., S. 76
876Nave-Herz, R., a.a.O., S. 100
877vgl.Frevert,U.,a a.a.O., S. 297
878Badinter, E.: Ich bin du, Beitz Taschenbuch 2001, S. 237
879Nave-Herz, R.: Familie heute, a.a.O., S. 121
880Gysi, P., a.a.O., S. 219
881vgl. Sieder, R., a.a.O.,S. 263
882Tenorth, H.-E.: Geschichte der Erziehung, a.a.O., S. 317 zititert: Schäfers, 7. Auflage Kindheit im Transformationsprozess, In: S.E. Hormuth u.a.: Individuelle Entwicklung, Bildung und Berufsverläufe. Opladen, 1998, S. 144, Tab. 10
883Trappe, H.: Emanzipation oder Zwang Frauen. in der DDR zwischen Beruf, Familie und ozialpolitik, Akademie Verlag Berlin 1995, zitiert: Familiengesetzbuch der DDR 1965 § 10
884Schneider, N.F.:, a.a.O., S. 191
885vgl.Gysi,J., a.a.O., S. 262
886Schnor, Chr.: Trennungsrisiko von Paaren mit Kindern: Der Einfluss der Religion in West- und Ostdeutschland, in: Huinink, J., Kreyenfeld, M., Trappe, H. (Hrsg.) Familie und Partnerschaft in Ost- und Westdeutschland, a.a.O., S. 236
887vgl.Gysi, J., a.a.O., S. 261
888Martinec/Nitschke (Hg.): Familie und Identität in der deutschen Literatur, a.a.O,, S. 10
889Tholen, T.: Heillose Subjektivität, in: Martinec/Nitschke (Hg.), a.a.O., S. 38
890vgl. Schneewind, Klaus, u.a.: Eltern und Kinder, Umwelteinflüsse auf das familiäre Verhalten, Stuttgart Kohlhammer 1983
891vgl.Vogtmeier, M., a.a.O., S. 14, zitiert: Boszormenyi-Nagy und Spark: Unsichtbare Bindungen. Die Dynamik familiärer Systeme.Stuttgart Klett-Cotta 1981
892vgl. Vogtmeier, M., S. 12, zitiert: Boszormenyi-Nagy und Spark, a.a.O.,
893vgl.Vogtmeier, M., S. 13 zitiert: Jackson: Familienregeln. Das eheliche quid pro quo. In: Watzlawick, P.: Interaktion, Weakland Verlag, Bern (Huber), 1980, S. 47-69
894vgl. Tholen, T.: Heillose Subjektivität. Zur Dialektik von Selbstkonstitution und Auslöschung in Familienerzählungen der Gegenwart, in: Martinec/Nitschke (Hg.), a.a.O., S. 37
895Gestrich, A., a.a.O., S. 4
896vgl. Riehl, W.H., Die Familie, 4. unveränd. Auflage, 1856, S.147
897Scheurer, H.: „Autorität und Pietät“ - Wilhelm Heinrich Riehl und der Patriarchalismus in der Literatur des 19. Jahrhunderts, in: Claudia Brinker-von der Heide /Scheurer, H. (Hg.) Familienmuster-Musterfamilien, a.a.O., S. 136ff
898vgl. Sieder, R., a.a.O., S. 292
899vgl. Neuschäfer, M., a.a.O., S. 102
900vgl. Mitterauer/Sieder, a.a.O., S. 36
901Mitterauer/Sieder, a.a.O., S. 27
902vgl. Gestrich, a., a.a.O., S. 58, zitiert: Pierre-Guilllaume-Frédéric Le Play Les Ouvriers europeens. Etudes sur les travaux, Paris 1855
903vgl.Laslett, P. in: Borscheid, P., a.a.O., S. 159f
904vgl. Rosenbaum, H. : Formen der Familie, a.a.O., S. 275
905Baumgartner, K.: Die Familie als politische Identität in den historischen Romanen von Autorinnen des 19. Jh., zitiert: Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Bd. 4, München 1987, in: Martinec/Nitschke (Hg.), a.a.O., S. 162
906Frevert, U., a.a.O., S. 39
907Frevert, U., a.a.O., S. 39
908Weber-Kellermann, I., a.a.O., S. 107
909vgl. Scheurer, H.: „Autorität und Pietät“, in: Brinker-von der Heyde, C., Scheuer, H. (Hg.), a.a.O., S. 140f
910Vogtmeier, M., a.a.O., S. 40
911Lutosch, H, a.a.O., S. 14
912vgl. Mitterauer, M., a.a.O., S. 181
913Mitterauer, M., a.a.O., S. 65
914vgl. Erhart, W., a.a.O., S. 26
915vgl. Peikert, I.: Zur Geschichte der Kindheit im 18. und 19. Jahrhundert, in: Reif, Heinz (Hrsg.): Die Familie in der Geschichte, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 1982, S. 126
916vgl. Borscheid,P., zitiert: Schwab, Dieter, in: Brunner/Conze/Koselleck Geschichtliche Grundbegriffe 1975, S. 290f in: Ehe, Liebe, Tod, a.a.O., S. 117
917vgl. Laslett, Peter: Familie Unabhängigkeit im Spannungsfeld zwischen Familien- und Einzelinteressen, in: Borscheid: Ehe, Liebe Tod, a.a.O., S. 153
918Riehl, W.H., a.a.O.
919Gall, L., a.a.O.,S. 400
920Kocka, J., a.a.O., S. 44
921vgl. Neuschäfer, M., a.a.O., S. 396f
922Sitzler, S.: Geschwister - die längste Beziehung des Lebens, Klett-Cotta 2014 S. 154
923Mitterauer/Sieder , a.a.O., S. 44
924vgl. Mitterauer, a.a.O., S. 49
925Mitterauer/Sieder, a.a.O., S. 27
926vgl. Höpflinger, Charles,Debrunner: Familienleben und Berufsarbeit, Seismo Verlag Zürich 1991, zitiert : Lüschen, G.: Familien-verwandtschaftliche Netzwerke, in: Nave-Herz, R. (Hg.): Wandel und Kontinuität der Familie in der Bundesrepublik Deutschland, Pp. 145-172, Stuttgart: Enke 1988, S. 68
927vgl. Beise, A.: Imaginative Konstante, in: Kauer, K. S. 107
928vgl. Brinker-von der Heyde, C. in: Familienmuster-Musterfamilien, a.a. O., S. 7f
929Mitterauer, M., a.a.O., S. 87
930vgl. Sieder,R., a.a.O., S. 253, zitiert: Rosenmayr u.E. Köckeis: Umwelt und Familie aller Menschen, Neuwied 1965
931vgl. Laslett, P., a.a.O., zitiert „Nuclear is not independent“ Organization of a household in the pays bigoudin at the present Day, 1981 in: Borscheid, a.a.O., S. 155)
932Badinter, E., a.a.O., S. 241
933Neuschäfer, M., a.a.O., S. 117
934Neuschäfer, M., a.a.O., S. 117
935vgl.Mitterauer/Sieder, a.a.O., 115ff
936Wirsching, A.: Die Familie in der Moderne, in: Weber, W./ Herzog, M. (Hrsg.): „Ein Herz und eine Seele“?, Verlag W. Kohlhammer GmbH Stuttgart 2003, S. 53
937Vogtmeier, M., .a.a.O., S. 9, zitiert: Koopmann, H.: Thomas Mann. Konstanten seines literarischen Werks. Göttingen Vandenhoeck&Ruprecht 1975, S. 10
938vgl. Erhart, W., a.a.O.,S. 401
939Erhart, W., a.a.O., S. 8
940vgl. Gestrich, A., a.a.O., S. 101
941vgl. Ute Frevert : Soldaten, Staatsbürger, in: Kühne, Th. (Hg.): Männergeschichte- Geschlechtergeschichte, Campus-Verlag 1996, S. 81f
942vgl. Mühling, T./Rost, H. (Hrsg.): Väter im Blickpunkt, Verlag Barbara Budrich, Opladen & Farmington Hills 2007, Einleitung, S.9
943vgl. Erhart, W., a.a.O., S. 86
944vgl. Wippermann,C., Calmbach,M., Wippermann, K.: Männer: Rolle vorwärts, Rolle rückwärts, Verlag Barbara Budrich, Opladen Farmington Hills, MI 2009, S. 17
945vgl. Trepp, A.-Ch., a.a.O., S. 224
946vgl. Erhart, W., a.a.O., S. 47
947von Hoedenberg, Ch.: Der Fluch des Geldsacks, in: Hettling/Hoffmann (Hg), a.a.O., S. 99
948Erhard, W.: Thomas Manns Buddenbrooks und der Mythos zerfallender Familien, in: Brinker- von der Heyde, Scheuer; H. (Hrsg.), a.a.O., S. 175
949Rousseau, J.-J,.: Emile oder über die Erziehung, Ausgabe Reclam Stuttgart 1963, S. 130
950vgl. Erhart, W., a.a.O., S. 58
951vgl. Erhart, W., a.a.O., S. 288
952Kord, Susanne: Vater-Tochter-Dramen im 18. und 19. Jahrhundert, in: Martinec/Nitschke (Hrsg.), a.a.O., S.110
953vgl. Erhart, W. , a.a.O., S. 292
954Erhart, W., a.a.O., S. 291
955Ochs, Eva: Work-Life-Balance „Viele Männer überlebten kaum ihre Pensionierung“ im Interview mit: Wirtschaftswoche, 26. 06.2020
956vgl. Thomas Kühne: Männergeschichte als Geschlechtergeschichte, in: Kühne, Th. (Hg.), a.a.O., S. 16
957Lempp, R.: Die Rolle des Vaters und ihre Veränderung im 20. Jahrhundert, in: Faulstich, W., Grimm, G.E. Sturz der Götter? Suhrkamp Verlag Frankfurt a.M. 1989,S. 178
958vgl. Reulecke, J.: Kriegskindergeneration im 20. Jahrhundert: zwei Väter- und Söhnegenerationen im Vergleich, in: Kraft,A./Weißhaupt,M. (Hg.), a.a.O., S. 245f
959vgl. Reulecke, J.: Kriegskindergeneration im 20. Jahrhundert: zwei Väter- und Söhnegenerationen im Vergleich, in: Kraft,A./Weißhaupt,M. (Hg.), a.a.O., S. 245f
960vgl. Scheurer, H.: Autorität und Identität, a.a.O., S. 153f, zitiert R. Lempp: Die Rolle des Vaters und ihre Veränderung im 20. Jahrhundert, in: W. Faulstich u. G.E. Grimm(Hrsg.): Sturz der Götter? Vaterbilder im 20. Jahrhundert, Frankfurt a.M. 1989, S. 176-189
961vgl. Badinter, E.,a.a.O., S. 194, zitiert:Margaret Mead: Mann und Weib, Das Verhältnis der Geschlechter in einer sich wandelnden Welt, Hamburg 1962, S. 10
962Scheuer, H.: „Autorität und Pietät“, in: Brinker-von der Heyde, C., Scheuer, E. (Hg.), a.a.O., S. 160
963vgl.Schelsky, H.: Die skeptische Generation Eine Soziologie der deutschen Jungend, Eugen diederichs Verlag Düsseldorf/Köln 1957, S. 86
964vgl. Thomas Kühne, „... aus diesem Krieg werden nicht nur harte Männer heimkehren“, in: Kühne, Th. (Hg.), a.a.O., S. 187ff
965vgl. Reulecke/Stambolis: Kindheiten und Jugendzeiten im zweiten Weltkrieg, in: Radebold/ Bohleber/Zinnecker: Transgenerationale Weitergabe kriegsbelasteter Kindheiten, Juventa Verlag Weinheim und München 2008, S. 26
966vgl. Nave-Herz, R., a.a.O., S 49
967vgl. Badinter, E., a.a.O., S. 207f
968vgl.:Lempp, R.: Die Rolle des Vaters und ihre Veränderung im 20. Jahrhundert, in: Faulstich, W., Grimm, G.E., a.a.O., S. 188f
969Nave-Herz, R., S. 67
970vgl. Thomas Kühne: Männergeschichte als Geschlechtergeschichte, in: Kühne, Th. (Hg.), a.a.O., S. 16
971vgl. Cyprian,G.: Väterforschung im deutschsprachigen Raum, in: Mühling, T./Rost, H. (Hrsg.), a.a.O., S. 27
972vgl. Wippermann, C., Calmbach,M., Wippermann, K., a.a.O., S. 59
973vgl. Gesterkamp, Th.: Väter zwischen Laptop und Wickeltisch, in: Mühling, T./Rost, H. (Hrsg.), a.a.O., S. 109
974vgl. Wippermann, Cambach,Wippermann, a.a.O., S. 137
975Limmer, R.: Mein Papa lebt woanders - Die Bedeutung des getrenntlebenden Vaters für die Psycho-soziale Entwicklung seiner Kinder, zitiert: Köhler, Th. (Hrsg.) : Das Werk Sigmund Freuds. Band 1.Heidelberg, 1990, in: Mühling, T /Rost,H. (Hrsg.), a.a.O., S. 245
976vgl. Limmer, R.: Mein Papa lebt woanders, in: Mühling, T /Rost, H. (Hrsg.), a.a S. 249f
977vgl. Cyprian, G. : Väterforschung im deutschsprachigen Raum, in: Mühling, T./Rost,H., (Hrsg.), a.a.O., S. 25
978vgl. Limmer, R.: Mein Papa lebt woanders, in: Mühling, R./Rost,H. (Hrsg.), a.a.O., S. 255
979Kocka, J.: Vorwort, in :Frevert, U. (Hg.) Bürgerinnen und Bürger, a.a.O:, S. 9
980Budde, G., a.a.O., S. 416
981vgl. Hopfner, J., a.a.O., S. 189, zitiert: Ehrenberg, Fr.: Weiblicher Sinn und weibliches Leben. Charakterzüge, Gemälde und Reflexionen, Berlin 1809 S. 83f
982vgl. Hopfner, J., a.a.O., S. 189, zitiert: Ehrenberg, Fr.: Weiblicher Sinn und weibliches Leben. Charakterzüge, Gemälde und Reflexionen, Berlin 1809 S. 83f
983vgl.Schütze, Y. : Mutterliebe-Vaterliebe, in : Frevert, U. , a.a.O., S. 124f
984vgl.Gall, L., a.a.O., S. 165
985vgl. Schneider-Taylor: B. Jean-Jacques Rousseaus Konzeption der Sophie, Verlag Dr. Kovac 2006, S. 99
986Hopfner, J., a.a.O., S. 183
987Frevert, U., a.a.O., S. 106
988vgl. Kaplan, M.: Freizeit-Arbeit, Geschlechterträume im deutsch-jüdischen Bürgertum 1870 - 1914, in: Frevert, U. (Hg.), a.a.O., 158
989vgl. Frevert, U., a.a.O., S. 43
990Hopfner, J., a.a.O., S. 131, zitiert Ehrenberg, F: Reden an Gebildete des weiblichen Geschlechts, a.a.O., Verlag Elberfeld, Schönian 1829, S. 190f
991vgl. Meyer, S.: Die mühsame Arbeit des demonstrativen Müßiggangs, in: Hausen, K., a.a.O., S.175f
992vgl. Schäfer, M., a.a.O., S. 122
993vgl. Meyer, S.: Die mühsame Arbeit des demonstrativen Müßiggangs, in: Hausen, K.: Frauen suchen ihre Geschichte, C.H. Beck 1983, S. 184
994Hausen, K.: „...eine Ulme..“, in: Frevert, U. (Hg.): Bürgerinnen und Bürger, a.a.O., S. 109
995vgl. Trepp, A.-Ch., a.a.O., S. 244 zitiert Freudenthal, M: . Gestaltwandel der städtischen, bürgerlichen und proletarischen Hauswirtschaft unter besonderer Berücksichtigung des Typenwandels von Frau und Familie, vornehmlich in Südwest-Deutschland zwischen 1760 und 1933 1: 1760-1910. Universität Frankfurt a.M. Philosophische Fakultät 1934 (Masch.)
996Frevert, U., a.a.O.,S. 83
997vgl. Frevelt, U., a.a.O., S. 103
998Riemann, I/Simmel, M: Bildung zur Weiblichkeit durch soziale Arbeit, in: Bremer/Jacobi-Dittrich, u.a. (Hrsg.), a.a.O., S. 139
999Frevert, U.: Soldaten, Staatsbürger, in: Kühne, Th. (Hg.), a.a.O., S. 70
1000Frevert, U., a.a.O., S. 194
1001Frevert, U., a.a.O., S. 201
1002Frevert, U., a.a.O., S. 208, zitiert: Tagebuchnotiz Goebbels in: Kuhn/ Rothe: Frauen im deutschen Faschismus, I, S. 60
1003vgl. Budde,G., a.a.O., S. 176
1004Krüger, H., Born, C.: Vom patriarchalen Diktat zur Aushandlung, in: Kohli, M./Szydlik, M.(Hrsg.) Generationen in Familie und Gesellschaft, Leske + Budrich,Opladen 2000, S. 214
1005Hahn, H.-H.: Beobachtungen zur Ästhetik des Familienromans heute, in: Martinec/Nitschke (Hg.), a.a.O., S. 282,
1006Frevert, U., a.a.O., S. 227
1007Frevert, U., a.a.O., S. 227
1008Frevert, U., a.a.O., S. 254
1009Krüger, Chr.: In der Tradition der bürgerlichen Wohlfahrt? in: Budde/u.a. (Hrsg.), S. 59, zitiert: Archiv der Diakonie Neuendettelsau, D5/2-2, Abschrift Bayerischer Rundfunk, Kirchenfunk, Samstag 13.10.1954, 17.10-17.25
1010vgl. Deutschlandfunk S. 6
1011vgl.Mitterauer, a.a.O., S. 122
1012Nauck, B.: Familiäres Freizeitverhalten, in: Nave-Herz, R .u. Marefke, M: Handbuch der Familien- und Jugendforschung, Neuwied, Luchterhand, 1989S. 337
1013vgl. Frevert, U., a.a.O., S. 259
1014vgl. Weber, W. E.J.: Familie heute - Historische Grundlagen und Erscheinungsformen, Perspektiven und Probleme, in: Weber, W.E.J., Herzog, Markwart (Hrsg.), a.a.O., S. 12
1015vgl. Höpflinger, Charles, Debrunner, a.a.O., S. 100
1016vgl. Gerhard,U.: Zur Geschichte der Geschlechterverhältnisse in der DDR, in: Kaelble,H., Kocka,J., Zwahr,H. (Hg.), a.a.O., S. 393
1017vgl. Höpflinger, Charles, Debrunner, a.a.o.,S. 143, zitiert: Hoffmann-Nowotny, H.-J.; Höpflinger, F. u.a. 1984 Planspiel Familie. Familie, Kinderwunsch und Familienplanung in der Schweiz, Diessenhofen:Rüegger
1018vgl. Frevel, U., a.a.O., S. 302
1019vgl. Sieder, R. :Sozialgeschiche der Familie, a.a.O., S. 24)
1020vgl. Szinovacz, E.: Lebensverhältnisse der weiblichen Bevölkerung in Österreich, Schriftenreihe zur sozialen und beruflichen Stellung der Frau 9. 1070, 21
1021vgl. von der Lippe,Holger/Franziska Fuhrmann : Neue Vaterschaft: Mythos oder Realität? In: Kauer, Katja, a.a.O., S. 50
1022vgl. Segalen, M.: Die Familie, Campus Verlag Frankfurt/New York 1990, S. 316
1023Sczesny,: A. Projektionen und Wirklichkeiten - Die Familie und das Fernsehen, in: Weber/ Herzog (Hrsg.), a.a.O., S. 132
1024vgl. Höpflinger, Charles, Debrunner : Familienleben und Berufsarbeit, Seismo Verlag Zürich 1991, S. 42f
1025Badinter, E., a.a.O., S. 246
1026Nave-Herz, R., a.a.O., S. 45
1027vgl. Nave-Herz, R., a.a.O., S.119
1028Nave-Herz, R., a.a.O., S. 118
1029Nauck, Bernhard: Familiäres Freizeitverhalten in: Nave-Herz, R./Marefke, a.a.O., S. 336
1030Gysi, Jutta, a.a.O., S. 164
1031vgl. Nave-Herz, R., a.a.O., S. 116
1032Grandke, A.: Veränderte Lebenssituation der Familie in den neuen Bundesländern, in: Jans; B. / Sering, A. (Hrsg.), a.a.O., S. 33
1033Schneider, N.F., a.a.O., S. 18
1034Tenorth, H.-E., a.a.O., S. 314, zitiert: Geissler, R.: Die Sozialstruktur Deutschlands. Opladen 1992, S. 267
1035vgl. Gysi, J., a.a.O., S. 73, zitiert: T. Hahn, Die Festigung der Wechselbeziehung von sozialistischer Lebensweise und sozialistischem Bewusstsein, in: Lebensweise und Sozialstruktur. Materialien des 3. Kongresses der marxistisch-leninistischen Soziologie, Berlin 1981, S. 122
1036vgl. Obertreis, G., a.a.O., S. 21
1037vgl. Obertreis, G., a.a.O., S. 14, zitiert: K. Marx/F. Engels, Deutsche Ideologie, in: MEW Bd.3,Bln (DDR) 1962, S. 164
1038vgl. Obertreis, G., a.a.O., S. 17, zitiert: K. Marx, Ökonom.-philosoph. Manuskripte, in: Marx/ Engels, Studienausgabe, Bd.II (Polit. Ökonomie), Ffm 1979, S. 79
1039vgl. Obertreis, G., ,a.a.O. S. zitiert: L. Liegle: Familienerziehung und sozialer Wandel in der Sowjetunion, Bln (W) 1970, S. 21
1040vgl. Obertreis, G., a.a.O., S. 256ff, zitiert: A.Grandtke/H.Kuhrig: Zur Situation und zur Entwicklung er Familien in der DDR, in: NJ 1965, S. 231
1041vgl. Poiger, Uta G.: Krise der Männlichkeit, in: Naumann, K. (Hg.): Nachkrieg in Deutschland, Hamburger Edition 2001, S. 238
1042vgl. Schneider, N.F., a.a.O., S. 114
1043Schneider, N.F., a.a.O., S. 56
1044vgl. Mayer/Schulze, a.a.O., S. 178
1045Verfassung der DDR vom 7.Oktober 1949, hrsg. v. Amt für Information der Regierung der DDR, Art 33, zitiert von Gysi, a.a.O.,S. 27
1046vgl. Fulbrook, a.a.O.,S. 139 zitiert: Wierling, D.: Geboren im Jahre Eins. Der Jahrgang 1949 in DDR. Versuch einer Kollektivbiographie (Berlin 2002), S. 329-334
1047Semmelmann, D.: Neue Heimat Stalinstadt,S. 134-141, in: Fulbrook, M., a.a.O.,
1048Gaus, G.: Wo Deutschland liegt, Hoffmann und Campe Verlag München 1987, S. 117ff
1049vgl. Schneider, N.F., a.a.O., S. 25
1050vgl. Ecarius, J.:Familienerziehung im Wandel, Leske und Budrich Verlag Opladen 2002, S. 141
1051vgl.Gysi, J., a.a.O., S. 55f
1052vgl. Gysi, J., a.a.O., S. 115
1053vgl. Gysi, J., a.a.O., S. 221
1054vgl. Schneider, N.F.: Familie und private Lebensführung in West- und Deutschland, S. 15, zitiert Gysi, J. (Hg.), a.a.O.,
1055vgl. Gysi, J., a.a.O., S. 10f
1056vgl. Gysi, J., a.a.O., S. 61
1057vgl. Gysi, J., a.a.O., S. 61
1058vgl. Merkel, I.: Leitbilder und Lebensweisen von Frauen in der DDR, in: Kaelble, H., Kocka,J. Zwahr,H. (Hg.), a.a.O., S. 363f
1059vgl. Ecarius, J., a.a.O., S. 257, zitiert: Nave-Herz, (1984): Familiale Veränderungen in der Bundesrepublik Deutschland seit 1950. In: ZSE, 4. Jg. Heft 1, S. 45-64
1060vgl. Obertreis, G., a.a.O., S. 40f
1061vgl. Obertreis, G., a.a.O., zitiert: Hilde Benjamin: Wer bestimmt in der Familie, in: Beil. zu ND Nr. 28 vom 1.2.1958
1062vgl. Obertreis,G., a.a.O., S. 146
1063vgl. Obertreis, G., a.a.O., S. 85
1064vgl. Trappe, H., a.a.O., S. 38
1065vgl. Trappe, H., a.a.O., S. 40ff
1066vgl. Wippermann, C.,Calmbach, M., Wippermann, K., a.a.O., S. 43
1067vgl. Trappe, H., a.a.O., S. 85
1068vgl. Obertreis, G., a.a.O., S. 171
1069vgl. Wolle, St., a.a.O., S. 239
1070Gerhard, U.: Zur Geschichte der Geschlechterverhältnisse in der DDR, zitiert: Anita Grandke, Zur Entwicklung von Ehe und Familie, in: Kuhrig, Speigner, Gleichberechtigung, S. 24, in: Kaelble,H., Kocka,J., Zwahr,H. (Hg), a.a.O., S. 390
1071Gerhard, U., a.a.O., in: Kaelble, H., Kocka,J., Zwahr,H. (Hg.), a.a.O., S. 388ff.
1072Fulbrook, M., a.a.O., S. 190
1073vgl. Obertreis, G., a.a.O.,S. 54ff
1074Obertreis, G., a.a.O., S. 316, zitiert: A. Grandtke, Festigung der Gleichberechtigung und Förderung bewußter Elternschaft, in: NJ 1972,
1075vgl. Obertreis, G., a.a.O., S. 312, zitiert: A. Grandtke: Der Verfassungsgrundsatz der Gleichberechtigung von Mann und Frau und seine Verwirklichung, in: StuR 1968, S. 1136
1076vgl. Obertreis, G., a.a.O., S. 308 zitiert: H. Albrecht: 15 Mrd. Stunden für Hausarbeit in der DDR, Informationen des wiss. Beirats „Die Frau in der sozialistischen Gesellschaft“, H. 4/1972, S.3
1077vgl. Schneider, N.F., a.a.O., S. 216
1078vgl. Grandke, A.: Die Familienpolitik der DDR auf der Grundlage der Verfassung von 1949 und deren Umsetzung durch die Sozialpolitik, in: Manz, G. Sachse, E., Winkler,G. (Hg.), a.a.O., S. 319f
1079vgl. Merkel, I.: Leitbilder und Lebensweisen von Frauen in der DDR, in: Kaelble, H., Kocka,J., Zwahr,H. (Hg.), a.a.O., S. 375
1080Gysi, J., a.a.O., S. 43 zitiert:I. Lange, Die Frauen - aktive Mitgestalter der sozialistischen DDR, in: Einheit 4-5/1986, S. 331
1081vgl. Grandke, A., a.a.O., in: Manz,G., Sachse,E. Winkler,G. (Hg.), a.a.O., Sozialpolitik in der DDR, S. 330
1082vgl. Grandke, A., a.a.O., in: Manz,G., Sachse,E. Winkler,G. (Hg.), a.a.O., Sozialpolitik in der DDR, S. 330
1083vgl. Wolle St., a.a.O., S. 233 zitiert: Winkler, G. (Hg.): Frauenreport 90, Berlin 1990 , S. 95
1084vgl. Trapp, H., a.a.O., S. 175
1085vgl. Schneider, N.F., a.a.O., S. 78, zitiert: Geißler, R. (1991): Soziale Ungleichheit zwischen Frauen und Männern im geteilten und vereinten Deutschland. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zu: Das Parlament, B14-15,13-24
1086vgl. Gysi, J., a.a.O., S. 87
1087vgl. Trappe, H., a.a.O., S. 163
1088vgl.. Schneider, N.F., a.a.O., S. 276
1089vgl., Fulbrook, M., a.a.O., S. 178
1090vgl. Nave-Herz, R., a.a.O., S. 69,
1091vgl. Mayer, Schulze:, a.a.O., S. 143
1092Wolle, St., a.a.O., S. 240
1093vgl Hurrelmann, K.: Jugendliche Lebenswelten. Familie, Schule Freizeit. In: Jugend 2006. Hrsg. v.on der Shell Deutschland Holding. Bonn 2006, S. 29ff
1094vgl. Neuschäfer, M.: Familiengeheimnisse im Generationenroman, in: Lauer, G. (Hg.): Literaturwissenschaftliche Beiträge zur Generationsforschung S. 17, zitiert Deutsche Shell (Hg.) Jugend 2002. Zwischen pragmatischem Idealismus und robustem Materialismus, 5. Aufl., Frankfurt a.M. 2004, S. 55 ff
1095vgl. Nave-Herz, R., a.a.O., S. 7
1096Gysi,J., a.a.O., S. 266
1097Schneider, N. F., a.a.O., G., S. 294
1098Bach, A.: ,Fehltritt‘ oder ,Sozialschmarotzertum‘, in: Weber/Herzog (Hrsg.), a.a.O., S. 102, zitiert Franz Rothenbacher, Historische Haushalts und Familienstatistik von Deutschland 1815-1990, Frankfurt a.M. 1997, 317f
1099Bach, A.: ,Fehltritt‘ oder ,Sozialschmarotzertum‘ , in: Weber/Herzog (Hrsg.), a.a.O.,S. 96, zitiert: Statistisches Bundesamt, Haushalte und Familien, Fachserie 1, Reihe 3, Stuttgart 1999
1100vgl. Schneider, N.F., a.a.O., S. 127
1101Nave-Herz, R., a.a.O., S. 106
1102vgl. Stiehler, S.: Alleinerziehende Väter, Juventa Verlag Weinheim und München 2000, S. 28
1103Stiehler, S., a.a.O., S. 91
1104vgl. Nave-Herz,R., a.a.O., 3. Auflage, S. 108
1105vgl. Stiehler, S., a.a.O., S. 56
1106Matzner, M.: Alleinerziehende Väter - eine schnell wachsende Familienform, zitiert: Arlt, I. (1929): Vormundschaft für mutterlose Kinder!, i: Zentralblatt für Jugendrecht und Jugendwohlfahrt, XXI Jg., Nr.9, S. 314-316, in:„Alleinerziehende Väter-eine schnell wachsende Familienform“ , in: Mühling, T /Rost, H. (Hrsg.), a.a.O., S. 226
1107Matzner, M.: Alleinerziehende Väter - eine schnell wachsende Familienform, zitiert: Arlt, I. (1929): Vormundschaft für mutterlose Kinder!, i: Zentralblatt für Jugendrecht und Jugendwohlfahrt, XXI Jg., Nr.9, S. 314-316, in:„Alleinerziehende Väter-eine schnell wachsende Familienform“ , in: Mühling, T /Rost, H. (Hrsg.), a.a.O., S. 226
1108Matzner, M.: Alleinerziehende Väter - eine schnell wachsende Familienform, zitiert: Arlt, I. (1929): Vormundschaft für mutterlose Kinder!, i: Zentralblatt für Jugendrecht und Jugendwohlfahrt, XXI Jg., Nr.9, S. 314-316, in:„Alleinerziehende Väter-eine schnell wachsende Familienform“ , in: Mühling, T /Rost, H. (Hrsg.), a.a.O., S. 226
1109vgl. Nave-Herz/ Sander, D., : Heirat ausgeschlossen? Ledige Erwachsene in sozialhistorischer und subjektiver Perspektive, Campus Verlag Frankfurt/Main 1998 S.18
1110vgl. Schneider, N.F., a.a.O., S. 26
1111vgl. Lüscher, K. : Generationenbeziehungen - Neue Zugänge zu einem alten Thema, in: Lüscher, K., Schultheis, F. : Generationenbeziehungen in „postmodernen“ Gesellschaften, Universitätsverlag Konstanz GmbH 1993. 40
1112vgl. Schindler, J.: Panikmache - Wie wir vor lauer Angst unser Leben verpassen, Fischer Verlag Frankfurt am main 2016, S. 79
1113Rost, H.: Der Kinderwunsch von Männern und ihr Alter beim Übergang zur Vaterschaft, in: Mühling, T., Rost, H.(Hrsg.), a.a.O., S. 85
1114Nave-Herz, R./ Sander, D., a.a.O., S. 46
1115vgl. Höpflinger, Charles, Debrunner, Familienleben und Berufsarbeit, a.a.O., S. 77, zitiert: Houseknecht, Sharon K Reference Group Support for Voluntary Childlessness: Evidence for Conformity , Journal of Marriage and the Family, 39: 285-292, 1977
1116vgl. Schneider, N.F., a.a.O., S. 22
1117vgl Bode, S.: Kriegsenkel, Klett-Cotta 2009, S. 20
1118vgl. Neuschäfer, M., a.a.O., S. 377
1119vgl. Kaufmann, F.-X.: , Generationenbeziehungen und Generationenverhältnisse im Wohlfahrtsstaat, in: Lüscher, K., Schultheis, F., a.a.O., S. 107
1120vgl. Neuschäfer, M., a.a.O., S. 75
1121vgl. Neuschäfer, M.: Vom doppelten Fortschreiben der Geschichte - Familiengeheimnisse im Generationenroman , in: Lauer, G. (Hg.), a.a.O., S. 176
1122vgl. Nave-Herz, R./ Sander, D., a.a.O., S. 56 zitiert Coombs, R.H. (1991): Maritual Status and personal well-being: A literature review, in: Family Relations, S. 97-102
1123Zeh, Juli: Spieltrieb, Schöffling & Co 2004, S. 318f
1124vgl. Tremp, P., a.a.O., Rousseaus Emile, S. 135
1125Richter, D.: Das fremde Kind, Fischer Taschenbuch 1987, S. 28, zitiert: Keller, G. Der grüne Heinrich, a.a.O., S.I,9
1126Tremp, Peter, a.a.O., S. 101, zitiert: Rousseau, J.-J. Emile oder Über die Erziehung. Paderborn; München; Wien; Zürich: Schöningh 1991, II, S. 67
1127Tremp, P., a.a.O., S. 118, zitiert: Brief an Philibert Cramer vom 13.Oktober 1764
1128Menck, P., a.a.O., S. 148, zitiert: Rousseau, Émile S. 111
1129vgl. Tremp, Peter: Rousseaus Émile als Experiment der Natur und Wunder der Erziehung, Leske + Budrich Opladen 2000 S. 57f
1130Tremp, P., a.a.O., S. 73, zitiert :Rousseau, J.-J.: Emile oder Über die Erziehung. Paderborn; München; Wien; Zürich: Schöningh 1991, S.I, S. 9
1131Tremp, P., a.a.O., S. 73, zitiert :Rousseau, J.-J.: Emile oder Über die Erziehung. Paderborn; München; Wien; Zürich: Schöningh 1991, S.I, S. 9
1132vgl. Tremp, P., a.a.O., S. 131
1133vgl. Menck, P., a.a.O., S. 148, zitiert: Rousseau, J-J: Emile. Oder über die Erziehung, in: Rang, M. (Hrsg.). Rousseaus Lehre vom Menschen, Stuttgart 1963
1134vgl. Gillis, John R.: Geschichte der Jugend, Beltz Verlag Weinheim und Basel 1980, S. 79
1135Schneider-Tayler, B. J.-J.: Rousseaus Konzeption der Sophie, S. 82, zitiert: Rang, M. (Hg.) Emile oder die übel der Erziehung, Stuttgart 1963, S. 375f
1136vgl. Tremp, P., a.a.O., S. 154f
1137vgl. Richter, D.: „Lasset eure Kinder Menschen werden.“ in: Martinec/Nitschke (Hg.), a.a.O., S. 144
1138vgl. Menck, P., a.a.O., S. 137, zitiert: Pestalozzi: Grundlehren über Mensch, Staat, Erziehung. Seine Schriften in Auswahl. In Verbindung mit Max Zollinger hrsg. von Hans Barth, Stuttgart 1956, S. 317-320
1139vgl. Nyssen, E.: Geschichte von Kindheit - Streiflichter. In: Fritz, A., /.u.a. (Hg).: Handbuch Kindheit und Schule Verlagsgruppe Beltz, Weinheim u. Basel, in: Alberts/Heine: Geschichte der Kindheit, Schneider Verlag Hohengehren, 73666 Baltmannsweiler 2009
1140vgl. Sieder, R., a.a.O., S. 128f
1141vgl. Richter, D., a.a.O., S. 27
1142vgl. Peikert, I.: Zur Geschichte der Kindheit im 18. und 19. Jahrhundert, in Reif, H., a.a.O., S.116f
1143vgl. Peikert, I., a.a.O., in: Reif, H. (Hrsg.), a.a.O., S. 122
1144vgl. Richter, D., a.a.O., S. 589
1145vgl. Richter, D., a.a.O., S. 223
1146vgl. Gestrich, A., a.a.O., S. 36ff
1147von Hentig, H.:, Vorwort, in: Aries, Ph.: Geschichte der Kindheit, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co KG, München 1996, 12. Auflage, S. 10
1148vgl. Budde, G., a.a.O., zitiert: Gruber, Matthias, Scupin; Daheim 14, 1877, „Pädagogische Zeitfragen“, S. 54
1149vgl. Ecarius, J., a.a.O., S. 30
1150vgl. Eclasius, J., a.a.O., S. 54
1151vgl. Höpflinger, Charles,Debrunner, a.a.O., S. 68, zitiert: Lüschen, G.: Familienverwandtschaftliche Netzwerke, in: Rosemarie Nave-Herz, R., (Hg.): Wandel und Kontinuität der Familie in der Bundesrepublik Deutschland, Pp. 145-172, Stuttgart: Enke 1988
1152vgl. Anne-Charlott Trepp: Männerwelten privat: Vaterschaft im späten 18. und beginnenden 19. Jahrhundert, in: Kühne, Th. (Hg.), a.a.O., S. 32
1153Wierling, D., a.a.O.,S. 102
1154vgl. Kessel, M.: „Der Ehrgeiz setzt mir heute wieder zu...“ Geduld und Ungeduld im 19. Jahrhundert, in: Hoffmann/Hettling (Hg.), a.a.O., S.139
1155vgl. Kessel, M.: „Der Ehrgeiz setzt mir heute wieder zu...“ Geduld und Ungeduld im 19. Jahrhundert, in: Hoffmann/Hettling (Hg.), a.a.O., S.139
1156vgl. Weber-Kellermann: Die deutsche Familie, Frankfurt 1974, S. 108
1157vgl. Gestrich, A., a.a.O., S. 94, zitiert: Schlumbohm, J.. Straße und Familie, in : ZfPäd 25 (1979) 697-726
1158vgl. Trepp, A.-Ch., a.a.O., S. 321, zitiert: Hausen, K.: „...eine Ulme für das schwankende Efeu“. Ehepaare im Bildungsbürgertum. Ideale und Wirklichkeiten im 18. und 19. Jahrhundert, in: Frevert, U. (Hrsg.), a.a.O., “, S. 113ff
1159Weidermann, V., a.a.O.,S. 44
1160vgl. Weidermann, V., a.a.O., S. 44
1161vgl. Ecarius, J., a.a.O., S. 16
1162vgl. Trepp, A.-Ch., a.a.O., S. 335
1163vgl. Balmer, S.: Töchter aus guter Familie. Weibliche Individualität und bürgerliche Familie um 1900, in: Martinec/Nitschke (Hg.), a.a.O., S. 178
1164Rabe, A.: Das weibliche Erziehungsideal und die Stellung der Frau in der Gesellschaft, S. 8ff, Philosoph. Fakultät Münster, 1925
1165Schneider-Taylor, B. J.-: Rousseaus Konzeption der Sophie, zitiert Rang,M.(Hg.): J.-J. Rousseau: Emile oder Über die Erziehung, Stuttgart 1963, S. 733
1166Riehl, W.H., S. 102, in: Brinker-von der Heyde/ Scheurer, a.a.O.,
1167Riehl, W.H., S. 129, in: Brinker-von der Heyde/Scheurer, a.a.O.,
1168vgl. Schneider-Talor, B. , a.a.O., S. 100
1169vgl. Rabe, A., a.a.O., S. 13
1170vgl. Campe, J.H., a.a.O., S. 17
1171vgl. Rapoport, Ingeborg: Meine ersten drei Leben, S. 61,1. Auflage Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage GmbH, Berlin 2021
1172vgl. Karin Hausen „.eine Ulme für das schwanke Efeu“. Ehepaare im deutschen Bildungsbürgertum, zitiert: Knigge, Werke, Bd. 16 (Briefe über Erziehung), S. 155-61; Bd. 17 (Journal aus Urfstädt), S. 43-68, 549-55, in: Frevert, U. (Hg.) S. 91
1173Hopfner, J., a.a.O.,S. 63, zitiert: Ehrenberg, Fr.: Reden an Gebildete aus dem weiblichen Geschlecht, Leipzig 1808 2. Aufl. Bd. 1, S. 48
1174Hopfner, J., a.a.O., S. 127 zitiert Pockels, K.-F.: Versuch einer Charakteristik des weiblichen Geschlechts, 1806, S. 22
1175Hopfner J., a.a.O., S. 70f
1176Hausen, K., a.a.O., in: Frevert, U. (Hg.), a.a.O., S. 101
1177vgl. Hopfner, J., a.a.O., S. 81 zitiert Ehrenberg, Fr.: Reden an Gebildete aus dem weiblichen Geschlecht, Leipzig 1808 S. 239
1178Ecrius, J., a.a.O., S. 224
1179vgl. Gebhardt, M.: Eltern zwischen Norm und Gefühl, in: Hettling/Ulrich (Hg.), a.a.O., S. 192f
1180vgl. Reulecke, Stambolis: Kindheit und Jugendzeit im Zweiten Weltkrieg, Erfahrungen und Normen der Elterngeneration und ihre Weitergabe, in: Radebold/ Bohleber (Hg.): Transgenerationale Weitergabe kriegsbelasteter Kindheiten, a.a.O., a.a.O:, S. 20
1181Jürgen Reule>1182vgl.Möckel, B.: Abenteuer und Initiation, in: Martinec/Nitschke (Hg.), a.a.O., S. 48
1182Jürgen Reule>1182vgl.Möckel, B.: Abenteuer und Initiation, in: Martinec/Nitschke (Hg.), a.a.O., S. 48
1183vgl. Nave-Herz, R., a.a.O., S. 49
1184vgl. Wilk, L.: Großeltern und Enkelkinder, in: Lüscher,K., Schultheis, F., a.a.O., S. 207
1185Nave-Herz, R., a.a.O., S. 62, zitiert: Teichert, V.: Familie und Gesellschaftsstruktur; in: Junge Familien in der Bundesrepublik, hrsg. v. V. Teichert, Opladen, 1990, S. 11-25
1186vgl. Ecarius, J., a.a.O., S. 261
1187vgl. Ecarius, J., a.a.O., S. 18
1188vgl. Nave-Herz, R., a.a.O., S. 52
1189Schwob, P.,zitiert: Boszormenyi-Nagy : Unsichtbare Bindungen, Stuttgart Klett-Cotta 1981, in: Großeltern und Enkelkinder S. 15
1190vgl. Fuhrer, Urs: Wie Erziehung in der Familie gelingen kann, in: Kauer, K. (Hg.), a.a.O., S. 174ff
1191vgl. Ecarius, J., a.a.O., S. 15
1192vgl. Nave-Herz, R., a.a.O., zitiert: Büchner, P :(Schul-)kindsein heute zwischen Familie, Schule und außerschulischen Freizeiteinrichtungen - zum Wandel des heutigen Kinderlebens in der Folge von gesellschaftlichen Modernisierungsprozessen; in: Materialien zum 5. Familienbericht, Bd.4: Aspekte von Entwicklung und Bildung, hrsg. v. Deutschen Jugendinstitut, München, in: Familie heute, S. 67, 3. Auflage
1193vgl. Nave-Herz,R., a.a.O.,zitiert Ecarius, J. : Familienerziehung im historischen Wandel - Eine qualitative Studie über Erziehung und Erziehungserfahrungen von drei Generationen, Opladen 2000
1194vgl. Wolle, St., a.a.O., S. 244
1195vgl. Tenorth, K.-E.,a.a.O., S. 322, zitiert: Die ,10 Gebote der sozialistischen Moral“ von W. Ulbricht vom V. Parteitag der SED 1958
1196vgl. Obertreis, G., a.a.O., S. 202 zitiert: E. Mannschatz: Der gute Lehrer und die schwierigen Eltern, in: DLZ Nr. 38 vom 20.9.1963, S. 4
1197vgl. Trappe, H., a.a.O., S. 124
1198Obertreis, G., a.a.O., S. 221, zitiert: Tagesheimschule als Schulversuch in der Deutschen Demokratischen Republik, in: Päd. 1958, S. 843
1199vgl. Schneider, N.F., a.a.O., S. 163
1200vgl. Streubel, Ch.: Wir sind die Geschädigten, in: Hartung, H./Reinmuth, D./u.a. (Hg.):Graue Theorie: die Kategorien Alter und Geschlecht im kulturellen Diskurs, Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln, Weimar, Wien 2007, S. 246
1201vgl. Streubel, Ch.: Wir sind die Geschädigten, in: Hartung, H./Reinmuth, D./u.a. (Hg.):Graue Theorie: die Kategorien Alter und Geschlecht im kulturellen Diskurs, Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln, Weimar, Wien 2007, S. 246
1202vgl. Hertle, H.-H./Wolle,St., a.a.O., S. 147
1203Gesetzesblatt der DDR Teil II Nr. 53, in: Rabe, A. a.a.O.,S. 91f
1204vgl. Wierling,D.: Konflikte in der Erziehungsdiktatur der 60er Jahre, in: Kaelble,H., Kocka,J., Zwahr, H.(Hg.) Sozialgeschichte in der DDR, S. 420
1205vgl. Hertle, H,-H./Wolle, St. :Damals in der DDR, S. 125
1206vgl. Wierling, D.: Die Jugend als innerer Feind. Konflikte in der Erziehungsdiktatur der sechziger Jahre, in: Kaelble,H., Kocka,J., Zwahr,H. (Hg.), a.a.O., S. 416
1207Hertle, H.-H./Wolle, St., a.a.O., S. 294
1208vgl. Sitzler,S., a.a.O., S. 205
1209vgl. Völkening, H.: Dann sei dir darüber im Klaren, dass du auch ein Bruder bist“ , zitiert: Schmidt-Denter, Soziale Beziehungen, S. 65, in: Themen, Kontexte und Perspektiven, in: Schneider/Völkening/Vorpahl (Hrsg.): Zwischen Ideal und Ambivalenz, Geschwisterbeziehungen in ihren soziokulturellen Kontexten, Peter Lang GmbH internationaler Verlag der Wissenschaften Frankfurt 2015, S. 70
1210vgl. SItzler, S., a.a.O.,
1211vgl. Kasten,H.: Die Geschwisterbeziehung, Band 1, Hogrefe Verlag Göttingen 1993S. 38
1212vgl.Liegle,L.: Geschwister und ihre erzieherische Bedeutung, in: Klosinski, G. (Hg.): Verschwistert mit Leib und Seele, Attempto Verlag Tübingen 2000, S. 84f: zitiert Schütze,Y.: Geschwisterbeziehungen, in: Nave-Herz, R./Markefka, M. (Hg.): Handbuch der Familien- und Jugendforschung, Band 1: Familienforschung, Neuwied 1989, S. 311-324
1213vgl. Nave-Herz, R., „Geschwisterbeziehungen, in: Psych D 224/C, S. 349
1214v. Weymarn-Goldschmidt,: Adlige Geschwisterbeziehungen im 18. und 19. Jahrhundert, in: Schneider/Völkening/Vorpahl (Hrsg.), a.a.O., S. 171
1215vgl. Nave-Herz. R., a.a.O., in: Psych D 224/C S. 342
1216vgl. Lempp, R. : Geschwisterbeziehung in der Forschung, in: Klosinski, G. (Hg.), a.a.O., S. 228
1217vgl. Kasten, H., a.a.O., zitiert: Bank& Kahn: Geschwister-Bindung, a.a.O., S. 21
1218Baier, T.: Die längste Liebe des Lebens, in: http://www.sueddeutsche.de/wissen/ geschwisterforschung- zitiert Franz Neyer: Persönlichkeitspsychologe an der Universität Jena, S. 1
1219vgl. Kasten, H. zitiert Gold, D.T. 1989a, Sibling relationships in old age: A typology. International Journal of Aging and Human Development, 28, 37-51, S. 158
1220Bank, St..P., Kahn, M.D.: Geschwisterbindung, Jungfermannsche Verlagsbuchhadnlung Paderborn 1989, S. 72
1221vgl. Sitzler S., a.a.O., S. 109, zitiert die Geschwisterforscherin Inés Brock, Die Bereicherung familiärer Erziehung durch Geschwister. in: Frühe Kindheit. Zeitschrift der deutschen Liga für das Kind Nr. 5, S. 29-33,
1222vgl. Bank, St.P., Kahn,M.D., a.a.O., S. 56f
1223vgl. Bank, St.P., Kahn,M.D., a.a.O., S. 56f
1224vgl. Völkening,H. zitiert Adler, Alfred: Menschenkenntnis, Köln 2008, in:Themen, Kontexte und Perspektiven sozial- und individualpsychologischer Geschwisterforschung - ein Überblick, in: Schneider/Völkening/Vorpahl (Hrsg.): a.a.O., S. 66
1225vgl. Bank, St., Kahn, M., a.a.O., S. 15ff
1226Baier, T. Die längste Liebe … in: http://...zitiert: Familienforscher Kasten
1227vgl. Sitzler, S., a.a.O., S. 298, zitiert Schmid, C.: Der Einfluss von Geschwistern auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. In: familienhandbuch.de (online)
1228vgl.Schütze, Yvonne: Geschwisterbeziehungen, in: Handbuch der Familien- undJugendforschung, a.a.O., S. 318ff
1229vgl. Völkening, H., zitiert: Schmidt-Denter, Soziale Beziehungen im Lebenslauf. Lehrbuch der sozialen Entwicklung, Weinheim. Basel, 2005, S. 53 in: Themen, Kontexte und Perspektiven, in: Schneider/Völkening/Vorpahl (Hrsg.), a.a.O., S. 68
1230vgl. Klosinski, G.:Verschwistert mit Leib und Seele -beglückt oder bestraft -, in: Klosinskis, G. Verschwistert mit Leib und Seele, Attempto Verlag 2000, zitiert: Sulloway, F. : Der Rebell der Familie. Siedeler-Verlag, Berlin 1997, S. 11
1231vgl. Kasten, H., a.a.O., S. 76
1232vgl. Bank, St./.Kahn.M.D., a.a.O., S. 24
1233vgl. Kasten, H., a.a.O.,, S. 47, zitiert: Prochaska&Prochaska ,1985, childrin’s views of the causes and „cures“ of sibling rivalry, Child Welfare, 64, 427-433,
1234vgl. Krappmann, L. : Brauchen junge Menschen alte Menschen?, in: Kappmann/Lepenies (Hg.): Alt und Jung, Campus Verlag Frankfurt/New York, 1997, S. 193
1235vgl. Kasten, H. , a.a.O., zitiert Minett et al. The effects of sibling status on siblin intersaction: Influence of birth order, age spacing, sex of child, and sex of sibling, Child Development, 54, 1064-1072, in: Die Geschwisterbeziehung, S. 44
1236vgl. Bank, St.P., Kahn, M.S., a.a.O., S. 199, zitieren Ross, H. u. Milgram,J. Effects of Fame in Adult Sibling Relationships. Journal of Individual Psychology 38
1237vgl. Völkening, H.: „Dann sei dir darüber im Klaren, dass du auch ein Bruder bist“. Prämissen, Implikationen und Funktionen geschwisterbezogener Terminologie, Rezeption und Metaphorik - Versuch einer disziplinübergreifenden Systematisierung. in: Schneider/Völkening/ Vorpahl (Hrsg.) Zwischen Ideal und Ambivalenz, Peter lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften Frankfurt, 2015, S. 35
1238vgl. Baier, T.: Die längste Liebe des Lebens, in: http:// www.sueddeutsche.de/wissen/ geschwisterforschung-die.zitiert: Laurie Kramer von der University of Illinois in Urbana , S. 2
1239vgl. Sitzler, S., a.a.O., S. 253, zitiert: Kasten, H.: Der aktuelle Stand der Geschwisterforschung. In: familienhandbuch.de (online)
1240vgl. Bank, St.P., Kahn, M.D., a.a.O., S. 182ff
1241vgl. Kasten, H., a.a.O., S. 123, zitiert: Ross und Milgram, 1982, Effects of fame in adult sibling relationships. Individual Psychology Journal of Adlerian Theory, Research and Practice, 38, 72-79, in: Die Geschwisterbeziehung, S. 123
1242Bank, St.P.,Kahn,M.D., a.a.O.,S. 240
1243Bank, St.P.,Kahn,M.D., a.a.O.,S. 240
1244Bank, St.P.,Kahn,M.D., a.a.O.,S. 240
1245Nave-Herz,R., a.a.O., S. 70, 3.
1246vgl. Nave-Herz, R., a.a.O., S. 72 zitiert: Toman,W.: Psychoanalytische Erklärungsansätze in der Familienforschung; in: Handbuch der Familien- und Jugendforschung, Nave-Herz , R., und M. Markefka (Hrsg.), a.a.O., S. 81-94
1247vgl. Emmerich, W.: Generationen - Archive - Diskurse. Wege zum Verständnis der deutschen Gegenwartsliteratur, zitiert Mannheim, K.: Das Problem der Generationen 1928.In: ders.: Aufsätze zur Wissenssoziologie. Hg.: von K.H. Wolff. Darmstadt/Neuwies 1964, S. 542f, in: Cambi, F. (Hg.): Gedächtnis und Identität, S. 20
1248Mannheim, K. : Das Problem der Generationen (1928. In: Ders.: Aufsätze zur Wissenssoziologie. Hg. von K.H. Wolff. Darmstadt/Neuwied 1964, S. 509-565; Zitat S. 517 in Emmerich,W. : Generationen-Archive-Diskurse. Wege zum Verständnis der deutschen Gegenwartsliteratur , in: Cambi, F., S. 20
1249Kraft,A./Weißhaupt,M., a.a.O., S. 40
1250Kraft, A./Weisshaupt,M.: Generationen: Erfahrung-Erzählung-Identität und die „Grenzen des Verstehens“: Überlegungen zum Generationenbegriff, in: Kraft,A./Weisshaupt ,M. (Hg.) Generationen: Erfahrung-Erzählung-Identität, S. 17 zitieren Mannheim,Karl: Das Problem der Gnenerationen. In: ders.: Wissenssoziologie. Auswahl aus dem Werk, Hrsg.: von Kurt H.Wolff, Luchterhand, Neuwied, 1964, S. 509-565
1251vgl. Lauer, Gerhard (Hrsg.): Literaturwissenschaftliche Beiträge zur Generationenforschung, Göttingen Wallstein Verlag 2010, S.8f
1252vgl. Mannheim, K.: Das Problem der Generationen, 1964, S. 538
1253vgl. Lüscher, K.: Postmoderne Herausforderungen, zitiert Keeton u. Robinson (1995), in: Krappmann/Lepenies (Hg.): Alt und Jung - Spannung und Solidarität zwischen den Generationen, Campus Verlag Frankfurt/ New York 1997, S. 45
1254Ulrike Vetter im Programm der Konferenz „Am Nullpunkt der Familie: Generationen und Genealogien in der Gegenwartsliteratur“ vom 15./16.2.2008 im Zentrum für Literatur- und Kulturforschung Berlin http://www.zftlgwz-berlin.de..
1255Reinhold Weiterer zitiert Arno Geiger in „Kräftiges Ausholzen im Familiendickicht, in: Kleine Zeitung, Graz, 17.09.2005, S. 104
1256vgl. Ecarius, J., a.a.O., S. 46
1257vgl. Martin, P Olson, S: Die Übertragung von Interaktionsmustern zwischen Generation en in: Edelstein, W.u.a.: Familie und Kindheit im Wandel, Verlag für Berlin-Brandenburg 1996, 291ffvgl.
1258Neuschäfer, M. Das bedingte Selbst, S. 419
1259vgl. Martin,P.&Olson, S., a.a.O., S. 287ff,
1260Neuschäfer, M., a.a.O., S. 194
1261vgl. Neuschäfer, M., a.a.O., S. 399
1262vgl. Neuschäfer,., a.a.O., S. 193
1263vgl. Nam-Ok Lee: Transgenerationale Beziehungsmuster in Familien, S. 11ff , Oldenburg, 2005,
1264vgl. Lee, N.L., a.a.O., S. 143
1265vgl. Clausen, J. : Kontinuität und Wandel in familialen Generationenbeziehungen, in: Lüscher, K./Schultheis, F. (Hg.), a.a.O.,, S. 119
1266vgl. Lee, O.-L., a.a.O., S. 11-14
1267vgl. Moen, Ph.: Generationenbeziehungen in der Sichtweise einer Soziologie des Lebenslaufes - Das Verhältnis von Müttern zu ihren erwachsenen Töchtern als Beispiel, in: Lüscher,K., Schultheis, F. (Hg.), a .a.O., S. 252
1268vgl. Lee, O.-L., a.a.O., S. 141
1269vgl. Lee, O.-L., a.a.O., S. 25
1270vgl. Lee, O.-L., a.a.O., S. 173
1271Schütze, Y :Generationenbeziehungen: Familie, Freunde und Bekannte, in: Krappmann/ Lepenies (Hg.), S. 103, zitiert Schlumbohm, J.(hrsg.) (1983). Kinderstuben. Wie Kindern zu Bauern, Bürgern, Aristokraten wurden 1700-1850, München DTV, S. 48
1272Schwob, Peter: Großeltern und Enkelkinder - Zur Familiendynamik der Generstionenbeziehung, Roland Asanger Verlag Heidelberg 1988, S. 7
1273vgl. Lüscher, K.: Generationenbeziehungen - Neue Zugänge zu einem alten Thema, in: Lüscher,K., Schultheis, F. (Hg.), a.a.O., S. 21
1274Gestrich, A., a.a.O., S. 45
1275vgl. Elisabeth Schmid, Engelhard und Dietrich: Ein Freundespaar soll erwachsen werden, in Brinker-on der Heyde u.a., a.a.O., S. 35
1276Brinker-von der Heyde u.a., a.a.O., S. 11
1277vgl. Welzer, Harald, Schön unscharf: über die Konjunktur der Familien - und Generationsromane, Hamburger Edition HIS-Verlagsges., 2004, S. 57zitiert: Konitzer, W. : verweigertes Mitleid und nachholende Empathie, Vortragsmanuskript, 25. Mai 2003, S. 57
1278vgl. Zinnecker, J.: Die ,transgenerationale Weitergabe der Erfahrung des Weltkriegs in der Familie, in: Radebold/Bohleber/Zinnecker (Hrsg.): Transgenerationale Weitergabe kriegsbelasteter Kindheiten - Interdisziplinäre Studien zur Nachhaltigkeit historischer Erfahrungen über vier Generationen, Juventa Verlag Weinheim und München 2008, S. 144
1279Ennulat, G: Kriegskinder, Klett Cotta Verlag Stuttgart 2008, S. 33
1280vgl. Lohre, M.: Das Erbe der Kriegsenkel, Penguin Verkag 2018, zitiert: Werner Bohleber, S. 62
1281vgl. Giesen,B.: Ungleichzeitigkeit, Erfahrung und der Begriff der Generation, in: Kraft,A./ Weißhaupt,M. (Hg.), a.a.O., S. 212
1282vgl. Streubel, Chr.: Wir sind die geschädigte Generation, in: Hartung, H. u.a. (Hg.), a.a.O., S. 251
1283vgl. Kohli, M.: Die DDR als Arbeitsgesellschaft? Arbeit, Lebenslauf und soziale Differenzierung, in: Kaelble,H., Kocka,J., Zwahr,H., a.a.O., S. 53
1284vgl. Mayer, Karl U.: Familie im Wandel in Ost und West am Beispiel Deutschlands, zitiert: Szydlik, M.: (1994) Die Enge der Beziehung zwischen erwachsenen Kindern und ihren Eltern - und umgekehrt. Forschungsbericht Nr. 45 der Forschungsgruppe Altern und Lebenslauf). Berlin: Freie Universität, in: Edelstein, W./ Kreppner, K. Sturzbecher, D.(Hrsg.), a.a.O., S. 20
1285vgl. Hussein, N., a.a.O., in: Hess-Lüttich/u.a., a.a.O., S. 151
1286vgl. Kohli, M.: Die DDR als Arbeitsgesellschaft) Arbeit, Lebenslauf und soziale Differenzierung, in: Kaelble,H.,Kocka,J., Zwahr,H. (Hg.), a.a.O., S. 54f
1287vgl. Seidler, M.: Zwischen Demenz und Freiheit, in: Hartung, H, u.a. (Hg.), a.a.O., S. 199
1288Bachmaier, H.: Das Alter in der Literatur, Vorlesung auf CD, Komplett Media GmbH, 2008
1289vgl. Göckenjan, G/Taeger: Matrone, alte Jungfer, Tante: das Bild der alten Frau in der bürgerlichen Welt des 19. Jahrhunderts, S. 46f
1290vgl. Göckenjan,G./Taeger,A.: Matrone, alter Jungfer, Tante: DAs Bild der alten Frau on der bürgerlichen Welt des 19. Jahrhunderts, Archiv für Sozialgeschichte, Heft 30, Bonn, Hannover, Dietz Verlag für Lit. und Zeitgeschehen Verl. Neue Ges, 1990 S. 50
1291vgl.Göckenjan,G./Taeger,A., a.a.O.,S.62
1292Nave-Herz, R., a.a.O., S.26
1293vgl. Imhof, A.E.: Unsere Lebensuhr, Phasenverschiebungen im Verlaufe der Neuzeit, in Borscheid, P., a.a.O., S. 181
1294vgl. Bachmaier, H., a.a.O., Das Alter in der Literatur, a.a.O.,
1295Prangel, M: Komplexer als ein Wirtshaus, Arno Geiger spricht über das Problem, einen Roman über das Familienleben zu schreiben. In: „literaturkritik.de., 5. Mai 2007
1296vgl. Lang, F.R./Baltes, M.M: Brauchen alte Menschen junge Menschen? zitieren Baltes/Baltes (1990) Psychological perspectives on successful aging: the model of selective optimization with compenstion, in P.B. Baltes& M.M. Baltes (Eds.), Successful aging. Perspectives from the behavioral sciences (pp. 1-34). New York: Cambridge University Press, in: Krappmann/ Lepenies(Hg.), a.a.O., S. 163
1297vgl. Rehm, W.: Der Dichter und die neue Einsamkeit, Aufsätze zur Literatur um 1900, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 1969, S. 17
1298vgl. Riemann, F.: Flucht vor der Einsamkeit, in: Schultz, H.-J. (Hg.) : Einsamkeit, Kreuz Verlag Stuttgart, 5. Auflage, 1986, S. 30
1299vgl. Schütze, Y.: Generationenbeziehungen im Lebensverlauf - eine Sache der Frauen? zitiert: Rossi u.Rossi (1990). Of human bonding: Parent-child relationbs across the life course. New York, in: Lüscher, K., Schultheis,F. (Hg.), a.a.O., S. 292
1300vgl. Mitterauer, M., a.a.O., S. 168
1301vgl. Filipp, S.-H.: Beziehungen zwischen den Generationen im Erwachsenenalter, in: Krappmann/Lepenies (Hg.), a.a.O., S. 237
1302vgl. Pitrou, A.: Generationenbeziehungen und familiale Strategien, in: Lüscher, K., Schultheis, F (Hg.), a.a.O., S. 84
1303vgl. Habermas,T.: Geliebte Objekte, Suhrkamp Taschenbuch 1996, S. 143
1304vgl. Sperber, Manes: Von Not und Nutzen der Einsamkeit, in: Hans Jürgen Schultz, H.-J. (Hg.), a.a.O., S. 19
1306Lang, F.R./Baltes,M.: Brauchen alte Menschen junge Menschen? in: Krappmann/Lepenies (Hg.), a.a.O., S. 168
1307Brunnhuber, P.: Endstation Seniorenheim, in: Galli/Costagli (Hg.): Deutsche Familienromane, a.a.O.
1308Göckenjan,G./Taeger,A., a.a.O., S. 54
1309vgl. Streubel, Ch., a.a.O.,in: Hartung, H./ u.a., (Hg.) , a.a.O., S. 243
1310vgl. Tietze, G.: Die Spezifik der Sozialpolitik in den Betrieben, Territorien und Organisationen, in: Manz,G., Sachse,E., Winkler,G. (Hg.), a.a.O., S. 68
1311vgl. Schwitzer, K.-P.: Altenpolitische Leitlinien und sozialpolitische Konzepte, in: Manz, G., Sachse,E., Winkler,G. (Hg.), a.a.O., S. 340ff
1312Schwitzer, K.-P.: Senioren - Wohnbedingungen, in: Manz,G., Sachse, E. Winkler,G. (Hg.), a.a.O., S. 345
1313vgl. Chvojka, E: Geschichte der Großelternrollen, Böhlau Verlag Wien, 2003, S. 98, zitiert Müller, Ernst Erhard: Großvater, Enkel Schwiegersohn. Heidelberg 1979 S. 18
1314vgl. Chvojka, E., a.a.O., 50ff
1315vgl.Schwob, P., a.a.O., S. 9
1316vgl. Schwob, P.:, a.a.O., S. 56
1317vgl. Wilk,L., a.a.O., in: Lüscher, K.,Schultheis, F. (Hg.), a.a.O., S. 213
1318vgl. Chvojka, E., a.a.O., S. 160
1319vgl. Chvojka, E., a.a.O., S. 16
1320vgl. Göckenjan, G./Taeger,A., a.a.O., S. 74
1321vgl. Fitzon, Th., a.a.O., in: Martinec/Nitschke (Hg.), a.a.O., S. 129
1322Riehl, W.H., a.a.O., S. 287f
1323vgl. Chvojka, E., a.a.O., S. 119
1324vgl. Chvojka, E., a.a.O:, S. 40
1325vgl. Chvojka, E., a.a.O., S.34f
1326vgl. Lüscher, K., a.a.O., in: Lüscher, K., Schultheis, F (Hg.), a.a.O., S. 40
1327vgl. Wilk, L., a.a.O., zitiert: Cherlin, A.J. u. Furstenberg, F.F.J. (1986) The new American Grandparent. A place in the family, a life apart, New York, in: Lüscher, K., Schultheis, F (Hg.), a.a.O., S. 203
1328vgl. Schwob, P., a.a.O., zitiert : Timberlake, E.M. The value of grandchildren to grandmothers, Journal of Gerontological Social Work, 1980, 3(1), 63-76, S. 27
1329vgl. Schwob, P., a.a.O., S. 68
1330vgl. Schwob, P., a.a.O., S. 68
1331vgl. Krappmann, L., a.a.O., in: Krappmann/Lepenies (Hg.), a.a.O., zitiert: Moch & Lüscher, (1994) Bedeutungen materieller Transfers zwischen geschiedenen Eltern und ihren erwachsenen Kindern, System Familie,7, 234-245; S. 188
1332vgl. Schwob P., a.a.O., P. S. 81
1333vgl. Kasten, H., a.a.O., S. 173
1334vgl. Segalen,M.: Die Tradierung des Familiengedächtnisses in den heutigen französischen Mittelschichten, in: Lüscher, K., Schultheis, F. (Hg.), a.a.O., :S. 158
1335vgl. Habermas, T., a.a.O.,S. 189 zitiert: Mauss, M. (!924): Die Gabe, Frankfurt a.M. : Suhrkamp 1968
1336Chvojka, E., a.a.O., S. 132
1337Wilk, L., a.a.O., in: Lüscher,K., Schultheis, G.(Hg.), a.a.O., S. 212
1338Krappmann, L., a.a.O., in: Krappmann/Lepenies (Hg.), a.a.O:, S. 198
1339vgl. Chvojka, E., a.a.O., S. 13
1340vgl. Schwob, P., a.a.O., S. 45
1341vgl. Lee, O.-L., a.a.O., S. 93,
1342vgl. Bassler, M.: Der Familienroman im Nicht-Familienroman, in: Costagli, S., Galli, M. (Hrsg.) Deutsche Familienromae, Wilhelm Fink Verlag München 2010S. 219
1343vgl. Erhard, W.: Thomas Manns Buddenbrooks und der Mythos zerfallender Familien, in : Brinker- von der Heyde u.a. (Hg.), a.a.O., S. 164f
1344vgl. Neuschäfer, M., a.a.O., S. 169
1345Erhart, W.: Familienmänner, a.a.O., S. 109
1346Vgl. Vogtmeier, M., a.a.O., S. 155
1347vgl. Erhart, W.: Thomas M Buddenbrooks und der Mythos zerfallener Familien, in: Brinker-von der Heyde, C., Scheuer, H. (Hg.), a.a.O., S. 171
1348Bahnsen, C., a.a.O., S. 35, zitiert: Meyers Konversations-Lexikon. Eine Ecyklopädie des allgemeinen Wissens, 4. Aufl. Bd 12: Nathusius-Pflegmone, Leipzig 1889
1349Erhart, W, a.a.O., in: Brinker- von der Heyde u.a. (Hg.), S. 287, zitiert: Loewenfeld, L.: Pathologie und Therapie der Neurasthenie und Hysterie, Wiesbaden 1894, S. 109
1350Vogtmeier, M., a.a.O., S. 119
1351von Matt, P., a.a.O., S. 243
1352vgl. Bahnsen, C., a.a.aO., S. 93f
1353Mann, Thomas: Selbstkommentare „Buddenbrooks“, Frankfurt a.M. 1990, S. 22
1354vgl. Preußler, H.-P.: Vom Roman zu Film und Doku-Fiktion sowie retour. Die Buddenbrooks und Die Manns, in: Costagli, S. / Galli, M. (Hrsg.), a.a.O., S. 89
1355Keller, Gottfried, a.a.O., S. 16 ff.
1356Keller, Gottfried, a.a.O., S. 16 ff.
1357Ziegler, D.: Das wirtschaftliche Großbürgertum, in: Lundgreen, P. (Hg.) , a.a.O., S. 130
1358Pokrywka, R.: Der Generationenroman als Figuration historischer Übergänge,May 2015; Studia Germanica Posnaniensia. DOI:10.14746/sgp.2013.34.a.a.O., S. 149,
1359Mann, Th.: Lübeck als geistige Lebensform, a.a.O., S. 24...
1360Mann, Th.:Selbstkommentar, S. 34, Brief an Kurt Martins
1361vgl. Jaeger, H.: Der Unternehmer als Vater und Patriarch, in: Faulstich,W., Grimm,G.E. (Hg.), a.a.O., S. 98
1362Mann, Th.: Selbstkommentare, a.a.O., S. 106,f on myself
1363Mann, Th.: Selbstkommentare, a.a.O., S. 7
1364Mann, Th.: Selbstkommentare, a.a.O., S. 51, Brief an Otto Grautoff, Ende Mai 1895,
1365Mann, Th.: Selbstkommentare , a.a.O., S. 125, Brief an Heinrich von Buddenbrook
1366vgl. Bahnsen, C., a.a.O., S.8
1367Pikulik, L., a.a.O., S. 18
1368Bahnsen, C., a.a.O., S. 32
1369Gestrich, A., a.a.O., S. 123
1370vgl. Pikulik, L., a.a.O., S. 308
1371vgl. Jaeger, H., a.a.O., in: Faulstich, W., Grimm, G.E. (Hg.), a.a.O., S. 115
1372vgl. Lutosch, H., a.a.O., S. 27f
1373vgl. Keppler, L.:: Die verborgene Einsamkeit des Kindes, in: Schultz, H.-J., (Hg.), a.a.O., S. 185
1374Preusser, H.-P., a.a.O., in: Costagli, S. / Galli, M. (Hrsg.), a.a.O., S. 88
1375Mann, Th.: Selbstkommentare, a.a.O., S. 56 Betrachtungen eines Unpoltischen , XII574 Ironie und Radikalismus
1376Pikulik, L., a.a.O., S. 271
1377Bahnsen, C., a.a.O., S. 100
1378vgl. Lutosch, H., a.a.O., S. 18ff
1379Kurzke, H., /Stachorski, St. (Hg.):Thomas Mann: Im Spiegel. In: Essays, Bd.1: Frühlingssturm 1893-1918, Frankfurt a.M.1993, S. 101
1380vgl. Hettling,M., a.a.O., S. 303f
1381vgl. Pikulik, L., a.a.O., S. 47
1382vgl. Keller, G., a.a. O., „Der grüne Heinrich“ S. 29, Erster Band
1383vgl. Höpflinger, Charles, Debrunner , a.a.O., S. 77 zitiert: Proebsting, H. : Kinderzahl verheirateter deutscher Frauen nach Ehedauer, Einkommen des Mannes und Erwerbstätigkeit der Frau 1986, Wirtschaft und Statistik, 1: 23-25, 1988
1384vgl. Höpflinger, Charles, Debrunner , a.a.O., S. 77 zitiert: Proebsting, H. : Kinderzahl verheirateter deutscher Frauen nach Ehedauer, Einkommen des Mannes und Erwerbstätigkeit der Frau 1986, Wirtschaft und Statistik, 1: 23-25, 1988
1385vgl. Höpflinger, Charles, Debrunner, a.a.O., S. 166
1386vgl. Deutschlandfunk, S. 7
1387vgl. Erhart, W., a.a.O., in: Brinker-von der Heyde, C., Scheuer, H. (Hg.), a.a.O., S. 172f
1388Weidermann, V.,a.a.O. S. 102
1389Fuchs, A.: Landschaftserinnerung und Heimatdiskurs: Tradition und Erschaft in Thomas Medicus’ "In den Augen meines Großvaters" und Stephan Wackwitz „Ein unsichtbares Land“, in: Kraft, A./Weißhaupt,M.(Hg.), a.a.O., S. 72
1390literaturkritik de
1391http://www. general-anzeiger-bonn.de/news/kultur-und-medien/12.06.17
1392Sczesny, A.: Projektionen und Wirklichkeiten, in: Weber/Herzog (Hrsg.), a.a.O., S. 137
1393Bryk, :, a.a.O., S. 149
1394Rehm., Walter: Der Dichter und die neue Einsamkeit., a.a.O.
1395vgl. Radebold,Bohleber, Zinnecker (Hg.), a.a.O., S. 9
1396vgl.Neuschäfer, M., a.a.O., S. 176
1397vgl. Brumlik, M.: Deutschland - eine traumatische Kultur, in: Naumann, Klaus (Hrsg.):, a.a.O., S. 409 - 418
1398Brumlik, M.: Deutschland - eine traumatische Kultur, in: Naumann, Klaus (Hrsg.), a.a.O., S. 409 - 418
1399Ennulat, G., a.a.O., S. 9
1400vgl. Möckel, B., a.a.O., S. 152
1401vgl. Möckel, B., a.a.O., S. 105
1402Möckel, B., a.a.O., S. 290
1403vgl. Möckel, B.: Erfahrungsbruch und Generationsbehauptung Die ,Kriegsjugendgeneration‘ in den beiden deutschen Nachkriegsgesellschaften Wallstein Verlag Göttingen 2014, S. 13
1404Möckel, B., a.a.O., S. 49
1405Giesen, B., a.a.O., in: Kraft,A./Weißhaupt,M. (Hg.), a.a.O., S. 290
1406Ennulat, G., a.a.O., S. 20
1407Ennulat, G., a.a.O., S. 15
1408vgl. Möckel, Benjamin: Erfahrungsbruch und Generationsbehauptung, Wallstein Verlag Göttingen 2014 S. 13
1409vgl. Schulz/Radebold/ u.a., a.a.O., S. 118
1410Brumlik, M.: Deutschland - eine traumatische Kultur, in: Naumann, K. (Hg.), a.a.O., S. 410
1411Ennulat, G., a.a.O., S. 30
1412Ennulat, G., a.a.O., S. 30
1413vgl. Radebold, H.: Fakten und Forschungsergebnisse in: Schulz, Radebold: Söhne ohne Väter, a.aO., S. 116
1414vgl. Radebold, H.: Fakten und Forschungsergebnisse, in: Schulz, Radebold, a.a.O., S. 117ff
1415Radebold, H., ebd., in: Schulz/Radebold, a.a.O., S. 122
1416Möckel, B., a.a.O., S. 69
1417vgl. Möckel, B., a.a.O., S. 188
1418Bohleber, W.: Wege und Inhalte transgenerationaler Weitergabe, in: Radebold, Bohleber, Zinnecker (Hg.), a.a.O., S. 107
1419Möckel, B., a.a.O., S. 241
1420vgl. Möckel, B., a.a.O., S. 248
1421Möckel, B., a.a.O., S. 26
1422vgl. Schelsky, H.: Die skeptische Generation,Eugen Diedrichs Verlag Düsseldorf 1957, S. 89ff
1423vgl. Möckel, B., a.a.O., S. 251
1424Eyferth, H.: „Gefährdete Jugend“, Wissenschaftliche Verlagsanstalt K.G. Hannover 1950, S. 3ff
1425vgl. Möckel, B., a.a.O., S. 289
1426vgl. Reulecke, J.: ,Vaterlose Söhne in einer „vaterlosen Gesellschaft“’ in: Schulze/Radebold u.a., a.a.O., S. 158
1427Ennulat,, G., a.a.O., S. 9
1428vgl. Radebold, H.: Fakten und Forschungsergebnisse, in: Schulz, Radebold, a.a.O., S. 121
1429vgl. Zinnecker, J.: Die transgenerationale Weitergabe der Erfahrung des Weltkriegs in der Familie, in: Radebold, Bohleber, Zinnecker (Hg.), a.a.O., S. 142
1430Bode, S., a.a.O., S. 23
1431Radebold, Bohleber, Zinnecker (Hg.), a.a.O., S. 11
1432Eckstaedt, A.: Liebe und Leid, in: Weber, W.E.J., Herzog,M. (Hrsg.): „Ein Herz und eine Seele“? Kohlhammer Verlag Stuttgart 2003 S. 61
1433Bode, S., a.a.O., Kriegsenkel S. 17
1434Lohre, M., a.a.O., S. 131
1435Welzer, Moller, Tschuggnall: „ Opa war kein Nazi.“ Frankfurt a.M., Fischer Taschenbuchverlag, 2002, in: Cohen-Pfister,L.: Kriegstrauma und die deutsche Familie. Identitätssuche im deutschen Gegenwartsroman, in: Martinec/Nitschek, a.a.O., S. 243
1436vgl. Neuschäfer, M., a.a.O., S. 373
1437vgl. Rathkolb, O. Die Zweite Republik, in: Winkelbauer, Th.: Geschichte Österreichs, reclam Stuttgart 2015 S. 591
1438vgl. Radebold, H.: Die dunklen Schatten der Vergangenheit, Stuttgart 2009 S. 234
1439vgl. Meyer Legrand,I.: Die Kraft der Kriegsenkel, Europa-Verlage 2022 , S. 167ff
1440vgl. Bode S. 274
1441vgl. Meyer-Legrand, I., Stop & Grow - eine ganz eigene Strategie der Kriegsenkel, positiv mit ihrem besonderen Erbe in einer in Gewinner und Verlierer gespaltenen Gesellschaft umzugehen? in: Jahrbuch für psychohistorische Forschung Band 14, Hrsg. Langender, U.; Kurt, W., u.a.: Gespaltene Gesellschaft und die Zukunft von Kindheit, Mattes Verlag Heidelberg, 2013, S. 170 in
1442Lohre, Matthias: Das Erbe der Kriegsenkel, Gütersloher Verlagshaus 2016 S. 19
1443Lohre, M., a.a.O., S. 43
1444vgl. Bode, S., a.a.O.,S. 34
1445vgl. Meyer-Legrand, I., a.a.O., S. 159
1446Bode, S., a.a.O., S. 28
1447Lohre, M., a.a.O., zitiert Baer, U.: Kriegserbe in der Seele, S. 195
1448vgl. Gösweiner, Friederike, a.a.O., S. 12
1449Gösweiner, F., a.a.O., S. 12
1450Bode, S., a.a.O., S. 247
1451Brumlik, M., a.a.O.,in: Naumann, K. (Hg.), a.a.O., S. 410
1452vgl. Langbein, U., a.a.O., S. 222
1453Langbein, a.a.O., S. 32 zitiert: Segalen/Zonabend ,Familien in Frankreich, in: Burguiére u.a. (Hg.) 1998, S. 169-209
1454vgl. Langbein, U., a.a.O., S. 17 zitiert :Szydlik, M.: Erben in der Bundesrepublik Deutschland. Zum Verhältnis von familiärer Solidarität und sozialer Ungleichheit. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 51 (1999) 1, S. 80-104
1455vgl. Langbein, U., a.a.O., S. 85 zitiert: Assmann, J.: Erinnern, um dazuzugehören. Kulturelles Gedächtnis, Zugehörigkeitsstruktur und normative Vergangenheit. In: Platt, Dabag (Hg.) 1995, S.
1456vgl. Assmann, S. Erinnerungsräume, S. 131, zitiert Halbwachs, M. Das kollektive Gedächtnis, Frankfurt, a.M. 1985, S. 72f
1457Welzer, H. Krieg der Generationen, in: Naumann, K. (Hg.) Nachkrieg in Deutschland, S. 553
1458vgl. Assmann, A., a.a.O., S. 64
1459vgl. Assmann, A., a.a.O., S. 33
1460vgl.Gestrich,A., a.a.O., S. 123
1461vgl. Langbein, U., a.a.O., S. 220f
1462vgl. Langbein, U., a.a.O., S. 59f
1463vgl. Richter, D., a.a.O., S. 263 zitiert: Horkheimer, M./Adorno, Th.W., Sociologica II, Frankfurt 1962, S. 234
1464vgl. Langbein, U., a.a.O., S. 15 zitiert: Lauterbach/Lüscher: Erben und die Verbundenheit der Lebensläufe von Familienmitgliedern. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 48 (1996) 1, S. 66-95
1465vgl. Habermas, T., a.a.O., S. 117 zitiert: Goffman,E: Das Individuum im öffentlichen Austausch. Mikrostudien zur öffentlichen Ordnung, S. 336ff Frankfurt am Main, Suhrkamp 1974
1466Habermas, T., a.a.O., S. 153
1467vgl. Segalen, Martine: Die Tradierung des Familiengedächtnisses in den heutigen französichen Mittelschichten, in: Lüscher,K., Schultheis, F.,(Hg.), a.a.O., S. 165
1468vgl. Mann, Thomas: Selbstkommentare, a.a.O., S. 38 in einem Brief an Julius Bab,1910
1469vgl. Langbein, U., a.a.O., S. 53/ S. 13 zitiert: Barthes, R. :Das semiologische Abenteuer. Frankfurt/M.1988 S. 189
1470vgl. Langbein, U., a.a.O., S. 58
1471vgl. Habermans, T., a.a.O., S. 491
1472vgl. Habermas, T., a.a.O., S. 495f
1473Hahn, H.J., a.a.O.,, in: Martinec/Nitschke (Hg.), a.a.O., S. 276
1474vgl. Bauer, Ulrike: Interview mit Eugen Ruge, Literaturtest, S. 1
1475vgl. Langbein, a.a.O., S. 218
1476vgl. Habermas, T., a.a.O., S. 292
1477vgl. Habermas, T., a.a.O., S. 21
1478vgl. Habermas, T., a.a.O., S. 7f
1479vgl. Habermas, T., a.a.O., S. 328
1480vgl. Habermas, T., a.a.O.,S. 506
1481vgl. Habermas, T., a.a.O., S. 462
1482vgl. Langbein, U., a.a.O., S. 35 zitiert: Simmel, G. Schriften zur Soziologie, Eine Auswahl. Eingeleitet von Heinz Jürgen Dahme und Otthein Rammstedt, Frankfurt/M. 1992a S. 215
1483Kleinhenz, G.: Der Austausch zwischen den Generationen, in: Krappmann/Lepenies, S.71
1484Lüscher, Kurt: Postmoderne Herausforderungen an die Generationenbeziehungen, in: Krappmann/Lepenies (Hg.), a.a.O., S. 44
1485vgl. Langbein, U., aa.a.O., S. 28 zitiert: Medick/Sabean: Emotionen und materielle Interessen, Göttingen 1984, S. 48
1486vgl. Langbein, U., a.a.O., S. 36
1487vgl. Assmann, A., a.a.O., S. 49
1488vgl. Assmann, S.: Erinnerungsräume, a.a.O, S. 119f
1489vgl. Neuschäfer, M., a.a.O.,S. 408
1490vgl. Habermas, T., a.a.O., S. 328
1491vgl. Habermas, T., a.a.O., S. 290
1492vgl. Habermas, T., a.a.O., S. 290
1493vgl. Langbein, U., a.a.O., S. 22
1494vgl. Gisberts, A.-H.: Latenzen der Gegenwart bei Arno Geiger und Eugen Ruge, in: Gisbertz, A- K./ Ostheimer, M. (Hg.), a.a.O., S. 101
1495deutschlandfunk, a.a.O., S. 8
1496Habermas, T., a.a.O.,S. 121 zititert: Korosec-Serfaty,,P: „The home from attic to cellar,“ in: Journal of Environmental Psychology 4, S. 303-321
1497Jahn, B., a.a.O., S. 592
1498vgl. Fadinger, J.,a.a.O., S. 65
1499Assmann, A., a.a.O., S. 302
1500Erhart, W., a.a.O., in: Brinker-von der Heyd e, C., Scheuer,H. (Hg.) ,a.a.O., S. 180
1501vgl. Hurrelmann, K.: Jugendliche Lebenswelten. Familie, Schule Freizeit. In: Jugend 2006. Hrsg. von der Shell Deutschland Holding. Bonn 2006, S. 29ff
1502vgl. Brinker-von der Heyde, C..: Einführung in: Scheuer, H., Brinker von der Heyde, C., (Hg.), a.a.O.,S. 7f
1503vgl. Claudia Brinker-von der Heyde: Einführung, in: ders/Scheuer, H. (Hg.), a.a.O., S. 8
1504vgl. Wehler, H.-J.: Wie „bürgerlich“ war das Deutsche Kaiserreich? in: Kocka, J., a.a.O., S. 259
1505vgl. Schäfer, M. Geschichte des Bürgertums, S. 249
1506Wehler, H.-U.: Deutsches Bürgertum nach 1945: Exitus oder Phönix aus der Asche, S. 18
1507Lundgreen, P. (Hg.) Sozial- und Kulturgeschichte des Bürgertums, Einführung, S. 35f
1508vgl. Rüschemeyer, D. : Bourgeoisie, Staat und Bildungsbürgertum in Kocka S. 102
1509vgl. Hettling/Ulrich: Formen der Bürgerlichkeit, ein Gespräch mit Reinhart Kolleck, in: Hettling/ Ulrich (Hg.): Bürgertum nach 1945, S. 45f
1510Lepsius, R. : Zur Soziologie des Bürgertums und der Bürgerlichkeit in; Kocka , a.a.O, S. 99
1511vgl. Schäfer, M., a.a.O., Geschichte des Bürgertums, S. 239
Häufig gestellte Fragen zu Familienromanen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses HTML-Dokument enthält einen Überblick über die Analyse von Familienromanen, insbesondere unter dem Gesichtspunkt von Bürgertum und Bürgerlichkeit. Es umfasst ein Inhaltsverzeichnis, Zusammenfassungen von Kapiteln, zentrale Themen, Schlüsselwörter sowie Abschnitte über Autorenbiografien, Erzählformen, zeitgeschichtliche und räumliche Situierung, bürgerliche Normen und Kultur, Familie, Kindheit, Erziehung, Generationenbeziehungen, Motive des Verfalls und persönliche Anmerkungen.
Welche Romane werden hauptsächlich analysiert?
Die Hauptromane, die in dieser Analyse behandelt werden, sind "Buddenbrooks" von Thomas Mann, "Es geht uns gut" von Arno Geiger und "In Zeiten des abnehmenden Lichts" von Eugen Ruge.
Welche Themen werden in Bezug auf das Bürgertum in den Romanen untersucht?
Die Analyse konzentriert sich auf Themen wie Autobiographisches in den Romanen, Erzählform und Stilistik, temporale und zeitgeschichtliche Situierung, stadträumliche Situierung, das Haus als bürgerliche Wohnstätte, Bürgertum im langen 19. und 20. Jahrhundert, bürgerliche Normen und Kultur, die Bedeutung von Religion und Kirche, Bildung als bürgerlich-kulturelle Praxis, Reisen, Gesellschaftstreffen, Dienstboten, Ehe- und Liebesideale, Familie, Kindheit und Erziehung, Geschwisterbeziehungen, Generationenbeziehungen und Motive des Verfalls.
Welche Rolle spielt die Autorenbiografie in den Romanen?
Die Autorenbiografien, insbesondere von Thomas Mann, Arno Geiger und Eugen Ruge, spiegeln sich in den Inhalten der Romane wider. Fiktion und Autobiographisches verweben sich, und die Romane werden zur Erinnerungsliteratur und literarisierten Autobiografie.
Welche Bedeutung hat das Haus als bürgerliche Wohnstätte?
Das Haus wird als bürgerliche Wohnstätte, Standort und Ausdruck der Wohnkultur analysiert. Untersucht werden bürgerliches Wohnen im 19. Jahrhundert, die Villa der Familie Sterk in Wien und die Wohnsituation in der DDR.
Wie wird die Familie im Roman als Ort der Erziehung dargestellt?
Die Romane thematisieren die Familie als Ort der Erziehung und als Vermittlungsinstanz. Untersucht werden das Familienideal, die erlebte Kindheit, Jugend und Erwachsenenzeit, Erziehungsziele und die Rollen von Frauen und Müttern.
Welche Motive des Verfalls oder der Auflösung von Familien werden in den Romanen dargestellt?
Die Analyse umfasst nachlassende Vitalität, ökonomisch-wirtschaftlicher Verfall, Verlust bürgerlicher Tugenden, fehlende Kommunikation, Individualisierung, Traumatisierung der Kriegsgeneration und veränderte soziale Praxis im Umgang mit geerbten Dingen.
Wie wird die Rolle der Frau im Bürgertum dargestellt?
Die Rolle der Frau wird im Kontext von Ehe- und Liebesidealen, Familie, Bildung und den unterschiedlichen Epochen betrachtet. Untersucht werden traditionelle Rollenbilder und deren Wandel.
Was sind die Schwerpunkte der Analyse bezüglich der DDR?
Die Analyse des Bürgertums in der DDR umfasst Wirtschaftsbürgertum, Bildungsbürgertum, den Marxismus im Denken der sozialistischen Intelligenz, Geschichtswissenschaft, bürgerliche Normen und Kultur, die Bedeutung von Religion und Kirche, Bildung sowie Ehe- und Geschlechterbeziehungen.
Wie wird die Bedeutung von Religion und Kirche im Bürgertum behandelt?
Der Text analysiert Glaubensrichtungen in der protestantischen Kirche des 19. Jahrhunderts, die Feminisierung der Religion, Religion im Familienroman des 20. Jahrhunderts, Religion und religiöses Leben in der DDR sowie den Kommunismus und die Partei als Erlösungsorgan und Religionsersatz.
- Quote paper
- Ingrid Möller-Bannasch (Author), 2024, Bürgerlichkeit in Familienromanen des 19. und 20. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1489023