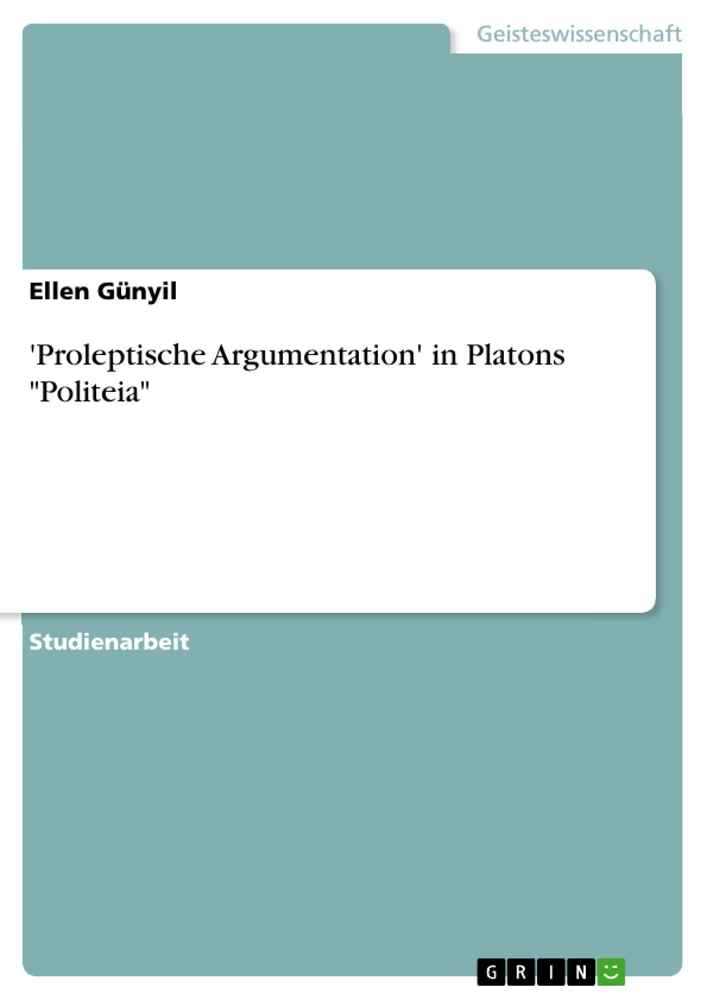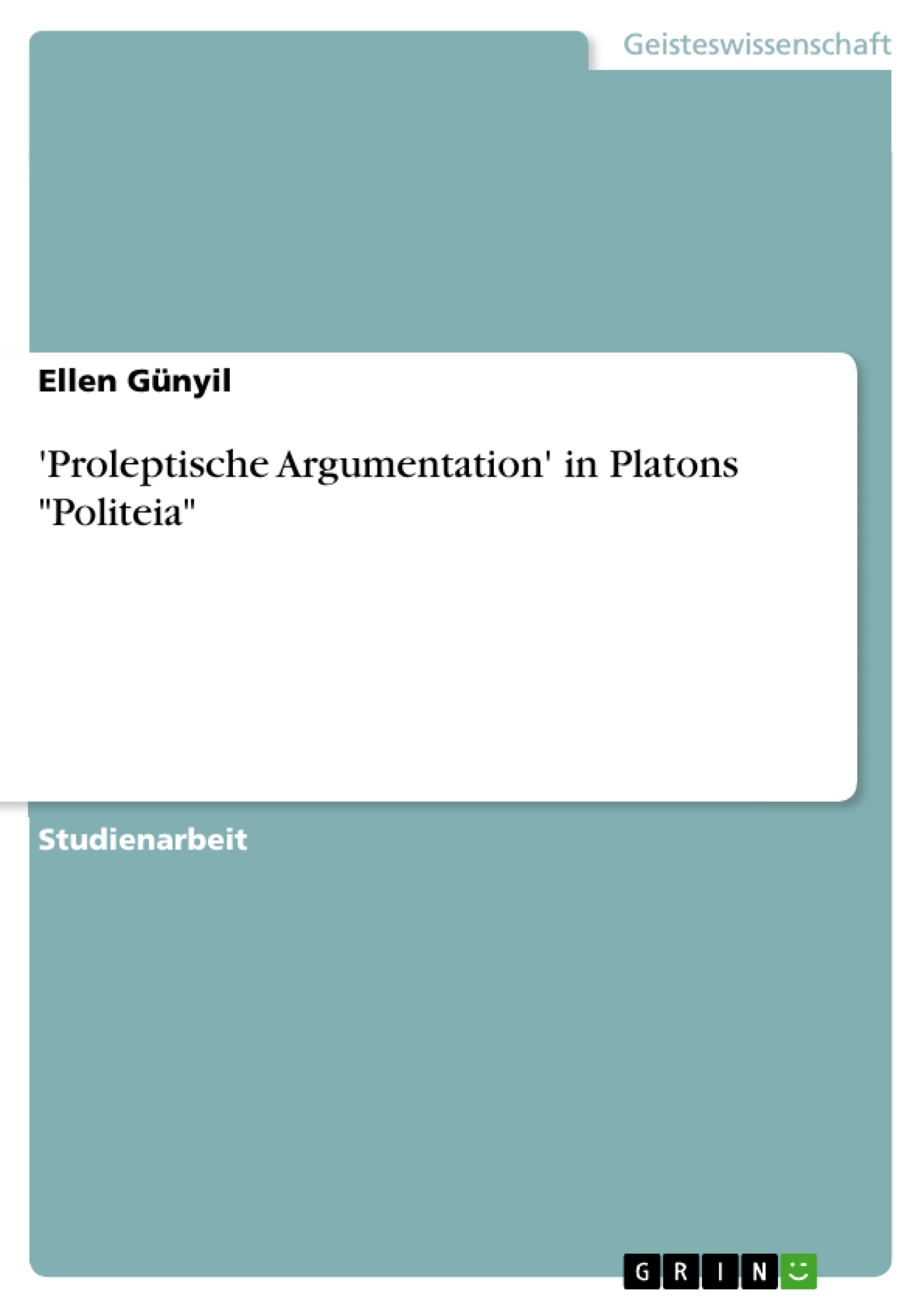In dieser Arbeit soll eine Untersuchung ausgewählter Stellen in Platons Politeia erfolgen, um daran seine proleptische, d.h. vorwegnehmende Vorgehensweise zu erläutern. Ausgehend von dem Gespräch zwischen Sokrates und Thrasymachos am Ende des ersten Buches sollen Ungereimtheiten aufgezeigt werden, welche sich ergeben, wenn man die Stelle ohne Kenntnisnahme der weiteren Ausführung durch Sokrates in folgenden Büchern der Politeia liest. Ergänzt werden viele dieser oft unschlüssigen Stellen durch ein Komplement aus anschließenden Büchern, in denen die Thematik, ohne dass ein expliziter Rückverweis erfolgt, nochmals aufgegriffen und Thesen und Beweise fortgeführt oder spezifiziert werden.
Ich will im Folgenden einige dieser Argumentationsgänge des platonischen Sokrates erläutern, an denen Sokrates nicht schlüssige, nicht ausreichend begründete und auf den ersten Blick falsche Thesen in seinen Dialog in Buch I einbindet und aufzeigen, wie er diese unzulänglichen Beweise im weiteren Gesprächsverlauf nochmals aufgreift und was sich mit diesem späteren Wissen für die Schlüssigkeit der vorangegangenen Stelle ergibt.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG.
- ANALYSE VON POLITEIA 352B - 354C ALS VOM KONTEXT ISOLIERT BETRACHTETE STELLE....
- DIE DIEBESBANDE
- DIE TUGEND EINES JEDEN DINGES.
- VIER AUFGABEN DER SEELE.
- DIE GERECHTIGKEIT ALS SPEZIFISCHE TUGEND DER SEELE.
- GUT LEBEN UND GLÜCKLICH LEBEN…..
- SPÄTERE BESTIMMUNG DER GERECHTIGKEIT 433A, B.....
- SPÄTERE BESTIMMUNG DER GERECHTIGKEIT 443B – 444A.
- POLITEIA II 368C - 369A - EINE PETITIO PRINCIPII?.
- ENTWÜRFE MÖGLICHER GRÜNDE FÜR DAS FESTGESTELLTE VERFAHREN ………………………………………..
- SCHLUSSBEMERKUNG..
- QUELLENVERZEICHNIS.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der proleptischen Argumentation in Platons Politeia. Sie untersucht ausgewählte Stellen im ersten Buch der Politeia, um zu zeigen, wie Platons Argumentation im Kontext der späteren Bücher der Politeia verstanden werden muss. Die Arbeit analysiert die Argumentationsgänge des platonischen Sokrates und zeigt auf, wie er unschlüssige Thesen im ersten Buch einbindet und diese im weiteren Gesprächsverlauf aufgreift und erweitert.
- Analyse der proleptischen Argumentation in Platons Politeia
- Untersuchung der Argumentationsgänge des platonischen Sokrates
- Erläuterung der unschlüssigen Thesen im ersten Buch der Politeia
- Bedeutung des Kontextes der späteren Bücher für das Verständnis der Argumentation
- Vergleichende Analyse verschiedener Interpretationen der proleptischen Argumentation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Analyse der Stelle Politeia 352b-354c, in der Sokrates die These aufstellt, dass selbst eine Diebesbande ein gewisses Maß an Gerechtigkeit benötigt, um überhaupt funktionieren zu können. Die Argumentation wird als unschlüssig dargestellt, da sie auf einer problematischen Übertragung von der Gruppe auf den Einzelnen beruht. Die Arbeit zeigt auf, wie diese Stelle im Kontext der späteren Bücher der Politeia verstanden werden muss, um ihre Schlüssigkeit zu erkennen.
Die Arbeit untersucht dann die spätere Bestimmung der Gerechtigkeit in den Büchern 433A, B und 443B-444A der Politeia. Sie zeigt auf, wie Platons Argumentation im Laufe des Dialogs weiterentwickelt wird und wie die im ersten Buch aufgeworfenen Fragen im Kontext der späteren Bücher beantwortet werden.
Die Arbeit analysiert auch die Stelle Politeia II 368C-369A, in der Sokrates eine petitio principii, einen Zirkelschluss, zu begehen scheint. Die Arbeit zeigt auf, wie diese Stelle im Kontext der späteren Bücher der Politeia verstanden werden muss, um ihre Schlüssigkeit zu erkennen.
Die Arbeit schließt mit einer Diskussion möglicher Gründe für das von Platon gewählte Argumentationsverfahren. Sie zeigt auf, wie Platons proleptische Argumentation als eine Methode verstanden werden kann, die den Leser zum Nachdenken anregt und ihn dazu bringt, die Argumentation selbstständig zu vervollständigen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die proleptische Argumentation, Platons Politeia, das erste Buch der Politeia, die Gerechtigkeit, die Diebesbande, die Argumentationsgänge des platonischen Sokrates, die Bedeutung des Kontextes, die spätere Bestimmung der Gerechtigkeit, die petitio principii, die Schlüssigkeit der Argumentation.
- Citar trabajo
- Ellen Günyil (Autor), 2009, 'Proleptische Argumentation' in Platons "Politeia", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148856