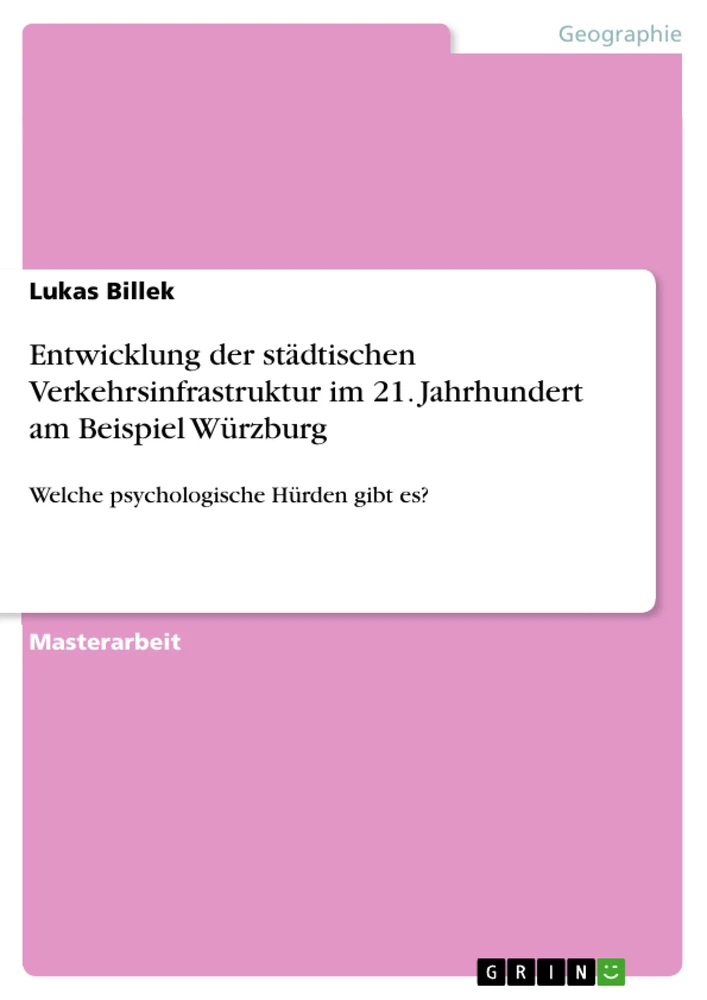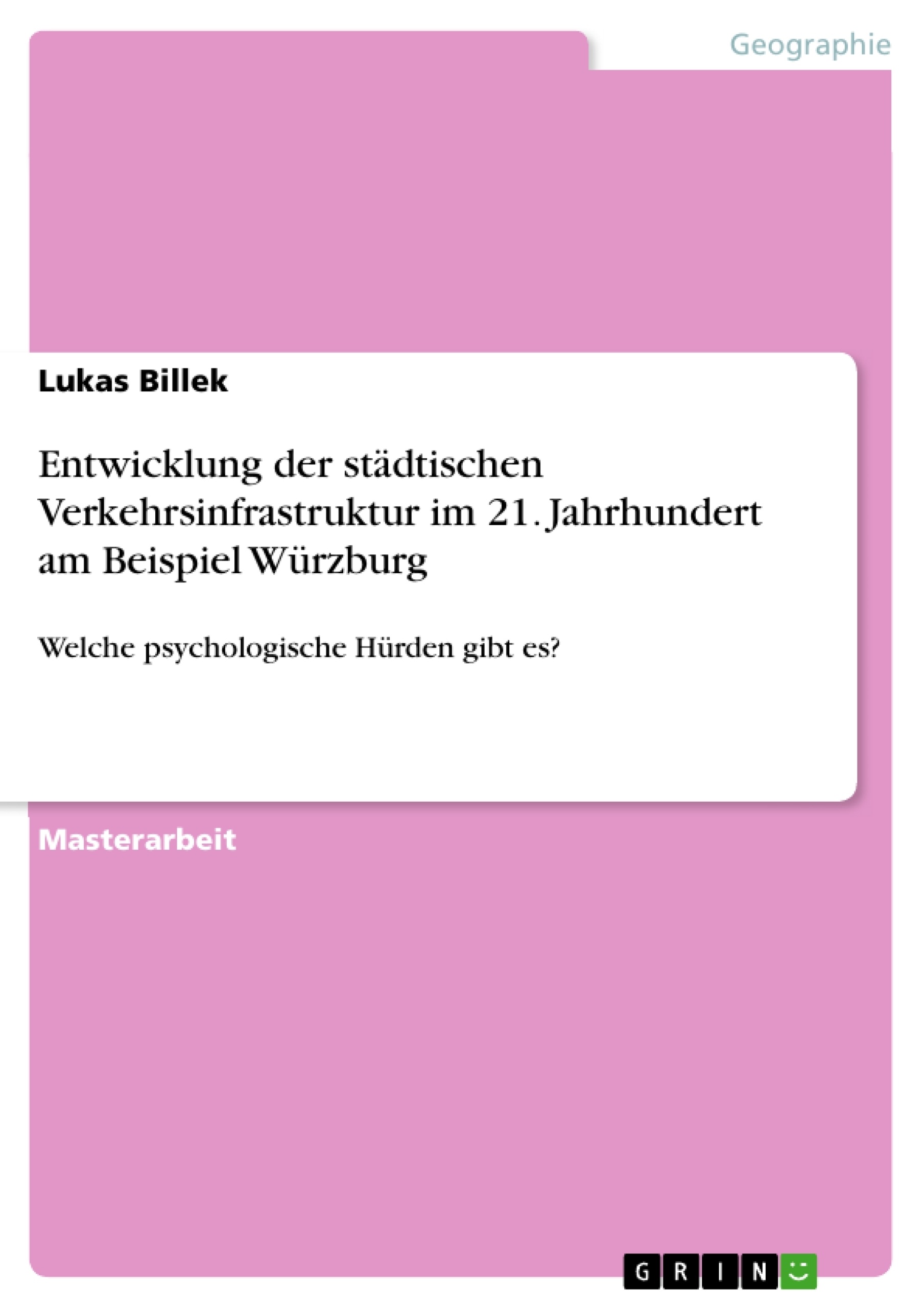Diese Master-Thesis behandelt die Thematik der Gestaltung der städtischen Verkehrsinfrastruktur unter der Berücksichtigung der Bevölkerung. Hierbei geht es vor allem um die Betrachtung von Veränderungen unter der Prämisse, dass Bürger sich anpassen müssten. Die ausgearbeitete Thesis befasst sich somit vor allem mit Möglichkeitengestaltungen und dem gleichzeitigen Einbezug der Bevölkerung. Hierbei werden Thematiken rund um die Psychologie des Menschen und dessen Gewohnheiten, Alternativen für den bestehenden motorisierten Individualverkehr sowie Alternativen, um dem expandierenden Aufkommen von Pkw entgegenzuwirken und die Abwägung von Kommunikationsmöglichkeiten, um einen sachlich wertvollen Austausch mit der Bevölkerung garantieren zu können aufgegriffen.
Inhaltsverzeichnis
1.Einleitung
2.Ziele in punctoNachhaltigkeit
2.1StädtebaulicheEntwicklungWürzburgs
2.2Einfluss des Faktors Nachhaltigkeit im 21. Jahrhundert
3.Methodik
3.1Leitfadeninterview
3.2Schriftliche Befragung
3.3Systematische Beobachtung
3.4Weitere herangezogene Daten
4.Verkehrsplanerische Anpassungen und Maßnahmen in Würzburg
4.1Aufnahme von Sachverhalten mit Handlungspotenzial
4.2Nachhaltige Gestaltung der Altstadt - Abschnitt Bischofshut
4.3Entlastungsansatz für den Würzburger Südring
4.4Investorenfindung
4.5Entstehende Vorteile für und in der Stadt
5.Betrachtung des Umgangs der Bevölkerung mit massiven Veränderungen
5.1Psychologie des Menschen - Umgang mit Veränderungen
5.1.1 Bedeutung des Begriffs „Gewohnheit“
5.1.2 Entstehung von Gewohnheiten
5.1.3 Mentale Barriere durch das Gefühl der Einschränkung
5.2Bedeutung des Autos
5.2.1 Entwicklung des Automobils
5.2.2 Nutzung von Fortbewegungsmitteln in Deutschland
5.3Umgang mit massiven infrastrukturellen Veränderungen in der Stadt
5.3.1 Haltung zur möglichen Partizipation von Bürgern
5.3.2 Umgang mit städtebaulich gestellten Veränderungen der Verkehrsinfrastruktur
6. Aufgebot an möglichen Alternativen und Perspektiven zur Umsetzung in Würzburg
6.1Integrierbare Alternativen für den bestehenden motorisierten Individualverkehr
6.1.1 Promotion für Fahrgemeinschaften und Carsharing
6.1.1.1 Möglichkeiten und Hürden bei Fahrgemeinschaften
6.1.1.2 Carsharing - Die Alternative der schnelllebigen Vermietung
6.1.2 High-occupancy vehicle lane
6.1.3 E-Zonen
6.1.4 Infrastrukturelle Anpassungen und Aufwertungen - Intelligente Gestaltung von Parkhäusern und -garagen
6.1.4.1 Neugestaltungsthematik der Talavera
6.1.4.2 Gestaltung weiterer Parkplätze in der kreisfreien Stadt Würzburg
6.1.4.3 Park & Ride Parkplätze im Landkreis Würzburg
6.2Alternativen, um dem expandierenden Aufkommen des Pkw entgegenzuwirken
6.2.1 Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs
6.2.2 Aufwertungsmaßnahmen für den nichtmotorisierten Individualverkehr
6.2.3 Attraktivitätssteigerung intermodaler Fortbewegungsmöglichkeiten
6.2.4 Nähe durch Reurbanisierung
7.Modell „Pyramide der nachhaltigen Mobilität“
8.Abwägung von Kommunikationsmöglichkeiten
9.Annährung über Smart City Entwicklungskonzepte
10.Fazit
11.Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1:Darstellung zur Ländlichkeit bayerischer Landkreise und kreisfreier Städte mit Bezug zum Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätiger und den Anteil der Einpendler an den SV Beschäftigten am Arbeitsort in % im Jahr 2019 (eigene Darstellung 2023 basierend auf INKAR 2023 B, INKAR 2023 C, INKAR 2023 D)
Abbildung 2:Die Würzburger Residenz, errichtet von 1720 bis 1744. Kupferstich von Salomon Kleiner (DER NEUE WIESENTBOTE 2023)
Abbildung 3:Organisationsplan des Baureferates (Referat IV) der Stadt Würzburg (STADT WÜRZBURG 2023 A)
Abbildung 4:Planung am Grafeneckart (STADT WÜRZBURG 2023 B: 35)
Abbildung 5:Alternativstrecke der Bundesstraße 19 durch die kreisfreie Stadt Würzburg zwischen den Anschlussstellen Würzburg/ Heidingsfeld (A3) und Würzburg/Estenfeld (A7) (eigene Darstellung 2023) 19
Abbildung 6:Privat-Pkw je 1.000 Haushalte im Jahr 2022 in den jeweiligen Stadtteilen der kreisfreien Stadt Würzburg (eigene Darstellung 2023 basierend auf STADT WÜRZBURG 2023 B)
Abbildung 7:Pflastersteinkartierung des Würzburger Bischofshuts (eigene Darstellung 2022)
Abbildung 8:Stadtbodenkonzept - Neuer Stand mit heller Oberflächenstruktur (STADT WÜRZBURG 2023 C: 43f.)
Abbildung 9:Blick in die Theaterstraße aus Richtung des Barbarossaplatzes (eigene Darstellung 2022)
Abbildung 10:Blick in die mit Autos vollgeparkte Karmelitenstraße aus Richtung der Juliuspromenade (eigene Darstellung 2022)
Abbildung 11:„Mit welchen Fortbewegungsmitteln begeben Sie sich regelmäßig zur Arbeit?" -
Ergebnis aus der Online-Umfrage (eigene Darstellung 2023)
Abbildung 12:„Mit welchen Fortbewegungsmitteln begeben Sie sich regelmäßig zur Arbeit?" -
Ergebnis aus der Würzburger Umfrage (eigene Darstellung 2023)
Abbildung 13:„Welche belastenden Faktoren spielen bei Ihnen eine signifikante Rolle, wenn Sie innerhalb kürzester Zeit nicht mehr mit dem Auto die für Sie gewohnten Ziele erreichen könnten?" - Zusammenstellung beider Erhebungen (eigene Darstellung 2023)
Abbildung 14:„ Wie wichtig ist es Ihnen, den Zeitaufwand des Arbeitsweges möglichst gering zu halten?" - Zusammenstellung beider Erhebungen (eigene Darstellung 2023)
Abbildung 15:„Könnten Sie sich vorstellen, permanente Fahrgemeinschaften zu gründen, um entsprechend nachhaltiger im Verkehr zu agieren?" - Vergleich zwischen Würzburg und dem gesamten Umfang der Umfrage (eigene Darstellung 2023)
Abbildung 16:Marktentwicklung des öffentlichen Carsharing in Deutschland seit 2012 (eigene Darstellung 2023 basierend auf BCS 2023)
Abbildung 17:Beginn der ZTL in der Via Santa Teresa an der Südseite der Kirche Santa Teresa alla Kalsa in Palermo (eigene Darstellung 2021)
Abbildung 18:„Wie hätten Sie dieses Mal, mit der erlangten Information von geplanten Umgestaltungsmaßnahmen, zu möglichen Kosten des Parkplatzes abgestimmt?" - Ergebnis aus der Würzburger Umfrage (eigene Darstellung 2023)
Abbildung 19:„Mehr Lebensqualität durch grüne Räume in der Stadt" aus dem Projekt „Talavera 2023: Ein Stadtteil entsteht" (ADAM 2023)
Abbildung 20:„Ein neuer Festplatz - Talavera" aus dem Projekt „Talavera 2023: Ein Stadtteil entsteht" (WIERLING 2023)
Abbildung 21:„Park & Ride Greinberg" aus dem Projekt „Stadt der Zukunft“ (BUCHHOLZ 2021)
Abbildung 22:„Der neue Sanderrasen" aus dem Projekt „Stadt der Zukunft“ (REYNARD2021).
Abbildung 23:„Sind Sie mit den angebotenen öffentlichen Verkehrsmitteln in Würzburg zufrieden?" - Ergebnis aus der Würzburger Umfrage (eigene Darstellung 2023).
Abbildung 24:„ Was genau stört Sie aktuell am Angebot der öffentlichen Verkehrsmittel in Würzburg?" - Ergebnis aus der Würzburger Umfrage (eigene Darstellung 2023).
Abbildung 25:„ Welche Alternativen würden Sie sich in der Stadt wünschen bzw. sollten dort ausgebaut werden? - Ergebnis aus der Würzburger Umfrage (eigene Darstellung 2023)
Abbildung 26:„Fahrradhighway und Lock & Shop-Garagen" aus dem Projekt „Stadt der Zukunft" (NIKOLAUS 2021)
Abbildung 27:Essentielle Umsteigeknoten in Würzburg mit der Hauptkomponente öffentlicher Verkehrsmittel: Einbindung von Optionen der intermodalen Fortbewegung (eigene Darstellung 2023)
Abbildung 28:„Könnten Sie sich vorstellen näher an ihren Arbeitsplatz zu ziehen, um so ein eigenes Fortbewegungsmittel zu vermeiden?" - Zusammenstellung beider Erhebungen (eigene Darstellung 2023)
Abbildung 29:Pyramide der nachhaltigen Mobilität (STA o. J.)
Abbildung 30:„Sind Sie zufrieden mit der Kommunikation zwischen Stadt, Politik und sonstigen Akteuren mit den Bürgern, wenn es um infrastrukturelle Veränderungen in der Stadt geht?" - Ergebnis aus der Würzburger Umfrage (eigene Darstellung 2023)
1. Einleitung
Städte stellen das Zentrum menschlichen Handelns dar. Schon seit Jahrtausenden entstehen Ballungsräume überwiegend an Standorten, an denen etwaige Verkehrswege und natürliche Bedingungen die Grundlage für das Handeln bilden. Unter natürlichen Bedingungen verstehen sich vorkommende Ressourcen sowie Umwelteinflüsse und -zustände. So konnte sich die Bergstadt Marienberg im Erzgebirge auf Grundlage der enormen Silbervorkommnisse im heutigen Sachsen etablieren (Wenzel 2020: 82f.). Frankfurt wiederum entstand an einer gut passierbaren Stelle des Mains. Als essentielle Handelsstandorte wuchsen Städte heran, welche stetig weitere Menschen in den urbanen Raum zogen. Insbesondere ab der Industrialisierung und der damit einhergehenden Landflucht expandierten die Städte rapide zu lebendigen Gebietskörperschaften heran. Entsprechend ist der ökonomische Einfluss großer und belebter Städte von enormer Bedeutung. Das schließt nicht nur die Stadt selbst, sondern ebenso das Umland sowie andere Agglomerationsräume ein, mit denen ein stetiger Austausch aufrechterhalten wird. So ergeben sich sukzessive aus stetig wachsenden und benachbarten Städten Verdichtungsräume wie beispielsweise dem Ruhrgebiet oder der Metropolregion Rhein-Neckar.
Einen besonders starken Einfluss haben Städte auf ihr Umland vor allem dann, wenn sie überwiegend von ländlich geprägten Räumen umgeben sind. Den dortigen Städten wird, nach dem Konzept der zentralen Orte, eine essentielle Bedeutung in puncto Versorgung und Anbindung zugeordnet (BBSR 2012: 34). Dabei geht es um eine zentrale Anordnung von typisch-ökonomischen Ausstattungen im Raum zur bestmöglichen Erreichbarkeit und Zugänglichkeit. In ländlich geprägten Regionen ist die Anzahl an Groß- und Mittelstädten eher von geringer Natur. Demgemäß wird den wenigen vorhandenen Verdichtungsräumen eine umso größere Rolle zugesprochen. Eine Großstadt, welche von überwiegend ländlich geprägtem Raum umgeben ist, ist die bayerische Residenz- und Universitätsstadt Würzburg. Diese wird Gegenstand der nachfolgenden Ausarbeitung. Mit präterpropter 130.000 Einwohnern ist Würzburg die bevölkerungsreichste Stadt Unterfrankens (Stadt Würzburg 2023 D). Als zentraler Verwaltungssitz der Region wird der Stadt eine noch stärkere Autorität zugewiesen. Umschlossen wird die kreisfreie Stadt vom gleichnamigen Kragenkreis (siehe Abbildung 1). Noch ländlicher geprägt als dieser sind die daran anschließenden Landkreise Main-Spessart, Schweinfurt, Kitzingen und Bad Neustadt an der Aisch- Bad Windsheim sowie der baden-württembergische Main-Tauber-Kreis. Im Landkreis Würzburg selbst hat die Ländlichkeit in den vergangenen 60 Jahren rasant abgenommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, spezifizierter ab den 1960er Jahren, setzte hierzulande eine bis in die Gegenwart anhaltende Suburbanisierungsphase ein (Hesse 2018: 2632). Die Bewegung des Menschen in die Peripherie der Städte wurde durch den Traum des Eigenheims sowie geringere Bodenrichtpreise im Umland stark gelenkt. Ergänzend boten bessere Lebensverhältnisse, bezogen auf psychische, physische und soziale Bedingungen wie vergleichsweise geringere Schadstoffbelastungen, weniger Lärm und ein verändertes soziales Umfeld, einen reizvollen Anhaltspunkt für den Bürger, den Schritt aus der Stadt hinauszuwagen. Diese Veränderungen sind signifikant am Beispiel Würzburg zu erkennen und zu erläutern. Sowohl im westlichen sowie im östlichen Umland stiegen die Einwohnerzahlen rasant an. Im östlichen Randgebiet kann diesbezüglich insbesondere die Gemeinde Gerbrunn betrachtet werden (LfStat 2023: 6f.). Von 1961 bis 1990 lag ein Bevölkerungswachstum von circa 1.300 auf ungefähr 6.000 Einwohner vor. Innerhalb von drei Jahrzehnten konnte sich die dortige Einwohnerzahl somit mehr als vervierfachen. Insbesondere in den ersten zehn Jahren, in denen die Suburbanisierung besonders an bürgerlichem Gefallen erlangt hatte, stiegen die Bevölkerungszahlen durch Binnenwanderungen rasant an. In den darauffolgenden zwei Jahrzehnten war der maßgebliche Faktor ein natürliches Bevölkerungswachstum. In den Dekaden nach 1990, bis in die Gegenwart, ist die Einwohnerentwicklung in Gerbrunn überwiegend stagnierend bis marginal zunehmend. Im westlichen Umland der kreisfreien Großstadt befindet sich zudem der Markt Höchberg. Dort sind simultan ähnliche Entwicklungstendenzen wahrzunehmen (LfStat 2022: 6f.). Im selbigen Zeitraum, von 1961 bis 1990, ist die dort ansässige Bevölkerung von 5.000 auf präterpropter 9.000 Einwohner angestiegen. Hierbei liegt der Akzent vor allem in den Jahren zwischen 1975 und 1985, in denen ein starker Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen ist. Heute bewegt sich die Bevölkerungszahl bei annäherungsweise 9.500. Die Stadt Würzburg selbst hat dadurch eine eher stagnierende Bevölkerungsentwicklung aufzuweisen, da sich die Nachtbevölkerung in der Peripherie niederlässt (INKAR 2023 A). Für die Tagesbevölkerung hat die Stadt dennoch ein enorm wichtiges Standing. Als Regionalzentrum und als einer der wichtigsten ökonomischen Standorte in Nordbayern dient die Universitätsstadt weiterhin als eine essentielle Lokation für Berufstätigkeiten. Anhand dieser Aspekte ist es keineswegs verwunderlich, dass es in der kreisfreien Stadt einen hohen Anteil an Einpendlern an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort gibt.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Darstellung zur Ländlichkeit bayerischer Landkreise und kreisfreier Städte mit Bezug zum Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätiger und den Anteil der Einpendler an den SV Beschäftigten am Arbeitsort in % im Jahr 2019 (eigene Darstellung 2023 basierend auf INKAR 2023 B, INKAR 2023 C, INKAR 2023 D).
Würzburg ist eine von vielen Städten, die während des Zweiten Weltkrieges durch Bombardierungen zerstört wurden. Im Zuge des Wiederaufbaus lag die Orientierung auf der separierenden Gestaltung von Arbeits-, Freizeit und Wohnorten. Dies war das Resultat eines 1933 festgelegten Maßstabes des internationalen Kongresses für neues Bauen (fr. Congrès Internationaux d’Architecture Moderne; CIAM) mit dem Namen „Charta von Athen“ (JEANNERET-GRIS 1933; 133f.). Die darin verabschiedeten Richtlinien begünstigten die Priorisierung auf den motorisierten Individualverkehr zum Überwinden der täglich zurückzulegenden Distanzen. Den daraus entworfenen und entstandenen Städten wurde bald darauf der Beiname „autogerechte Städte“ zugewiesen. Erstmals wurde diese Bezeichnung von Reichow (1959) in seinem Buch über den Ausweg aus dem städtischen Verkehrs-Chaos verwendet. In einer autogerechten Stadt ist es eine Leichtigkeit, sein tägliches Ziel mit dem Privatfahrzeug zu erreichen. Dabei werden partiell sogar Alt- und Innenstädte für den motorisierten Individualverkehr befahrbar gemacht. Sachgemäß kann eine hohe Verkehrslast erwartet werden. Im Gesamteindruck gestaltet sich ein Stadtbild mit periodisch überlasteten und nach heutigen Vorstellungen keinesfalls nachhaltigen Bedingungen. Entsprechend gilt es, die als autogerechte Städte etablierten Orte stadtplanerisch so zu überarbeiten und zu gestalten, sodass sich daraus nachhaltige und lebenswerte Städte bilden können, welche den gegenwärtigen Klimazielen gerecht werden und dem Menschen eine akzeptable Lebensqualität bieten.
Das Vorhaben der Umgestaltung ist jedoch mit einigen schwer zu überwindenden Aufgaben verknüpft. Im Mittelpunkt steht dabei der Bürger in persona. Als Gewohnheitstier tut sich der Mensch mit plötzlichen und abrupten Veränderungen besonders schwer. Vor allem für jene Bürger, die von jeher vom Personenkraftwagen Gebrauch machen, kann es ein einschneidendes Ereignis sein, sollten Städte künftig deutlich autofreier gestaltet werden. Entsprechend ist vonnöten, dass zwischen den beteiligten Akteuren sowie den Zivilpersonen eine akkurate und gepflegte Kommunikation besteht, um bei einer Umgestaltung ein ansprechendes Resultat vorweisen zu können. Folglich zielt die ausformulierte MasterThesis darauf ab, zu beleuchten, mit welchen psychologischen Hürden der Bürger bei massiven Veränderungen zu kämpfen haben könnte und wie gegen diese präventiv vorgegangen werden kann. Zudem kommt die Frage auf, welche Alternativen und Perspektiven für den Raum Würzburg in Betracht gezogen werden können, welche in der Realisierung keine signifikante Rolle spielen und wie das Ganze finanziert und umgesetzt werden soll. Es werden, neben den Zivilpersonen selbst, zusätzlich die Maßnahmen, Aufgaben und Konfliktfelder aus städtebaulicher Sicht betrachtet, welche essentiell zur Umsetzbarkeit beitragen. Weitergehend werden mögliche Ansätze von Smart City Entwicklungskonzepten betrachtet, welche ebenfalls darauf abzielen, Nachhaltigkeit einzubringen und die Bedürfnisse der Gegenwart zu befriedigen.
Als vorbereitende Handlung wurden sachlich relevante Erhebungen realisiert. Mithilfe dieser soll die Aussagefähigkeit des Elaborats, anhand ausgewählter qualitativer und quantitativer Verfahrensweisen, dokumentiert werden. Eine für diese Ausarbeitung relevante Methode sind Umfragebögen. Diese werden sowohl standardisiert als auch teilstandardisiert eingebunden. Der Kontext der Umfragebögen schließt die innerstädtischen Verkehrssituationen und aufkommenden Veränderungsprozesse ein. Zusätzlich dient ein Leitfadeninterview mit themenbezogenen Experten für den Input aus städtebaulicher Perspektive sowie eine in Würzburg durchgeführte systematische Beobachtung als Wegweiser für städtebauliche Maßnahmen in der Altstadt.
2. Ziele in puncto Nachhaltigkeit
2.1 Städtebauliche Entwicklung Würzburgs
Städte sind ständig in Entwicklung stehende Gebietskörperschaften. Demgemäß sind diese stetig an Veränderungen geknüpft. Der Wandel in Hinblick auf den Städtebau und auf stadtplanerische Herangehensweisen ist auf der ganzen Welt an unterschiedlichsten Gestaltungen zu dokumentieren. So gibt es hier in Mitteleuropa bestimmte Stadttypen, die in der Vergangenheit aufgekommen sind. Von mittelalterlichen Städten, die durch einen zentralen Marktplatz und enge Gassen geprägt waren, über frühneuzeitliche Bauweisen im Schachbrettmuster bis hin zu autogerechten Städten, die durch viel befahrene Straßen und breite Fußgängerzonen bestimmt werden. In vielen Städten sind von diesen historisch aufeinanderfolgenden Stadttypen heute noch mehrere vorzufinden. Würzburg ist einer dieser Verdichtungsräume, die eine solche Historie bietet. Im Zentrum des mittelalterlichen Würzburgs stand das links des Mains gelegene Mainviertel. Es entstand im Zuge der räumlichen Ausdehnung Würzburgs, nachdem das heute als Bischofshut bekannte Stadtgebiet mit der anderen Uferseite verbunden werden konnte. Mit einer Burg auf dem Marienberg entstand in unmittelbarer Nähe zur Altstadt eine Befestigungsanlage. Würzburg etablierte sich im Mittelalter somit als fürstliche Festungsstadt. Der Status als solche sollte in Würzburg ab der frühen Neuzeit überdacht werden. Mit dem römisch-katholischen Theologen Julius Echter von Mespelbrunn (1546-1617) wurde sich vom Stil der Festungsstadt abgewandt (Buchinger 1843: 257ff.). Der Fürstbischof ließ die Festung restaurieren und es entstand ein Schloss, welches dem Stil der Renaissance zugeordnet werden konnte. Eine erneuerte Ummauerung, welche dem Vorbild einer Zitadelle entsprach, wurde mit neuen Wehranlagen ausgerüstet. Bereits in dieser Phase konnte sich das rechtsmainische Gebiet räumlich bedeutend ausdehnen. Im Zuge des Dreißigjährigen Krieges und der Expansion wurde das rechtsmainische Stadtgebiet mit einer neuen sternenförmigen Stadtmauer ausgestattet. Diese ist heute leider nicht mehr vorhanden, anhand des vorliegenden Straßennetzes auf der Außenseite des Ringparks jedoch weitestgehend zu erahnen und der geschichtlichgestalterische Kontext identifizierbar.
Im Zuge des Barocks entschieden sich einige Fürsten, die Grundrissstrukturen der Städte auf ihre Schlösser auszulegen. Dies sollte die Präsenz des aufkommenden Absolutismus widerspiegeln. Da dies in Würzburg mit der Festung Marienberg schwer realisierbar war, musste ein neues Schloss errichtet werden (Ullrich 1819: 69f.). Unter der Führung des böhmischen Baumeisters Balthasar Neumann (1687-1753) wurde auf rechtsmainischer Seite eine neue Schlossanlage geplant (siehe Abbildung 2). Es entstand eine barocke Residenz. Unterstützend agierte dabei der Veduten-Zeichner Salomon Kleiner (1700-1761) aus Augsburg (Schoch 1990: 861f.). Dieser stellte 1725 einen akkurat angefertigten Kupferstich zur Verfügung. Sein hervorgebrachtes Kunstwerk erfreute sich derartiger Beliebtheit, dass versucht wurde, die Residenz entsprechend dieser Darstellung bestmöglich zu realisieren.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Die Würzburger Residenz, errichtet von 1720 bis 1744. Kupferstich von Salomon Kleiner (DER NEUE WIESENTBOTE 2023).
2.2 Einfluss des Faktors Nachhaltigkeit im 21. Jahrhundert
Mit der Zielsetzung der Charta von Athen kam es ab den 1950er Jahren zu einem erneuten stadtplanerischen Umdenken in Würzburg sowie in vielen anderen Städten, welche sich über den gesamten Globus verteilen. Die Umsetzungen dessen sind bis in die Gegenwart wahrnehmbar. Im Mittelpunkt stand, neben separierten Wohn-, Freizeit- und Arbeitsorten, zusätzlich die sehr gute Erreichbarkeit in der Stadt. Dabei im Fokus vor allem eine zügige und zeitsparende Fortbewegung durch den urbanen Raum. Bei der Realisierung dessen wurde versucht, dem Teilnehmer des Individualverkehrs sogar die Innenstadt so zugänglich und greifbar wie möglich zu gestalten. So steht heutzutage jedem Bürger die Option frei, mit dem eigenen Personenkraftwagen die Marktgarage in Würzburg anzufahren und lediglich wenige Schritte vom zentral gelegenen Marktplatz entfernt zu sein. Bereits in den frühen 1960er Jahren wurde, im Auftrag des britischen Verkehrsministeriums, eine erste Bilanz zu den autogerechten Städten erhoben und erläutert (Buchanan und Gunn 2019: 74ff.). Drei Jahrzehnte nach der Verabschiedung der Charta von Athen war die Konklusion, dass strikter zwischen essentiellem und willkürlichem Verkehr getrennt werden muss. Unter den essentiellen städtischen Verkehr fallen dabei alle Teilnehmer, welche der Kategorie Wirtschaft- und Geschäftsverkehr zugeordnet werden können. Dabei handelt es sich überwiegend um die Bewegung von Dienstleistungen und Verbrauchsgütern im städtischen Raum. Unter willkürlichem Verkehr versteht sich die Anteilnahme am städtischen Straßenverkehr von allem, was nicht unter die erste Kategorie des essentiellen Verkehrs fällt. Darunter allen voran der motorisierte Individualverkehr. In der Bilanz wird von einer übermäßigen städtischen Verkehrsbelastung durch die Anzahl der beliebigen Verkehrsteilnehmer gesprochen. Dies gilt es zukünftig stärker zu unterbinden beziehungsweise besser unter Kontrolle zu bringen. In den darauffolgenden Dekaden wurde sich ebenso in Deutschland kritisch mit der autogerechten Stadt auseinandergesetzt.
Mit dem 21. Jahrhundert veränderten sich erneut politische und wissenschaftliche Grundlagen. Die Begriffe Klimaschutz und Nachhaltigkeit wurden in den Fokus gerückt. In Deutschland wurde bereits in den 1990er Jahren versucht, Klimaschutzpolitik einzubinden (Deutscher Bundestag 1990: 1ff.). Im Jahr 1991 trat das sogenannte Stromeinspeisungsgesetz (StromEinspG) in Kraft. In dieser Verordnung geht es schlicht um die Förderung und Vergütung von Strom aus erneuerbaren Energien wie Sonnenenergie oder Wasser- und Windkraft. Der erzeugte Strom aus regenerativen Energien soll in das Elektrizitätsversorgungsnetz eingespeist und zu günstigen Bedingungen an den Bürger gebracht werden. Mit der Subventionierung durch den Staat wird der Umgang mit den erneuerbaren Energien gefördert. Aus dem StromEinspG resultiert das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), welches die Förderung regenerativer Alternativen weiterführt (BMWK o. J.). Dieses löste im Jahr 2000 seinen Vorgänger ab. Noch vor der Jahrtausendwende weitete sich das Thema Klimaschutz aus und die Vereinten Nationen beschäftigten sich mit den Herausforderungen (UN 1998: 1ff.). Im sogenannten Kyoto-Protokoll, benannt nach dem Verhandlungsort in Japan, wurden Maßnahmen zur Senkung der Emissionen verschiedener Gase aufgegriffen, welche zum anthropogenen Treibhauseffekt beitragen. In Kraft trat dieses nach einer längeren Prozedur erst im Jahr 2005. Aufgegliedert in zwei Phasen wurde 2012 entschlossen, die Intentionen des Protokolls weiterzuführen und die Emissionen der Treibhausgase noch effizienter zu senken. Die Ausweitung des Projekts wurde durch bereits erzielte Teilerfolge begünstigt. Im weiteren Verlauf wurde das Kyoto-Protokoll durch einen neuen Vertrag abgelöst (BMUV 2015: 3f). 2016 trat das Übereinkommen von Paris in Kraft. Für vier Jahre liefen beide Verträge parallel zueinander, bis 2020 die zweite Periode des Kyoto-Protokolls beendet wurde. Ab diesem Zeitpunkt wurde sich vollends auf die Ziele des Übereinkommens von Paris konzentriert.
Neben einigen weiteren Maßnahmen zur Klima- und Nachhaltigkeitspolitik verabschiedeten die Vereinten Nationen im Jahr 2015 17 Ziele zur nachhaltigen Entwicklung (BMZ 2023). Unter dem Namen Agenda 2030 soll weltweit nachhaltiger in puncto Ökonomie, Ökologie und Soziales agiert werden. Unter den Zielsetzungen befindet sich das nachhaltige Entwicklungsziel (SDG) elf, welches direkt an die Stadtentwicklung adressiert ist (GPF 2020: 134ff.). Darin werden grundlegende Wunschgedanken angestrebt, welche in weltweiten Städten und Siedlungen bis einschließlich 2030 bestmöglich realisiert werden sollen. Neben der Sicherung von bezahlbarem und angemessenem Wohnraum und einer gesicherten Grundversorgung für jeden Bürger wird zudem unter Ziel 11.2 der Verkehr betrachtet. Dieser soll ebenfalls nachhaltig entwickelt werden. Der Fokus liegt dabei auf der Zugänglichkeit zu bezahlbaren und nachhaltigen Verkehrssystemen sowie einer gestiegenen Sicherheit im Straßenverkehr. Ein essentielles Stichwort bringt in diesem Kontext der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) einher. Neben dem Ausbau des ÖPNV sollen ebenso nötige Bedürfnisse und behindertengerechte Elemente angepasst und entwickelt werden. Genauso wie die verkehrsplanerischen Aspekte sollen gleicherweise städteplanerische Faktoren in das Geschehen eingebunden werden. Bei Anforderung 11.3 wird eine nachhaltige und integrierte Stadtplanung in allen Ländern gefordert. Verstädterung und Zersiedelung sollen eingegrenzt beziehungsweise intelligent gehandhabt werden. Wichtig ist es in diesem Bezugsrahmen darauf zu achten, dass landwirtschaftlich genutzten Flächen und lebensnotwendigen Wäldern ein hoher Stellenwert zugesprochen wird. Die Ausbreitung des urbanen Raumes in das Umland soll möglichst gering und nachhaltig vonstatten- gehen. Weitergehend sollen Strukturen des Weltkultur- und -naturerbes bewahrt und gesichert werden. Bezüglich der auf Denkmalschutz ausgelegten Weltkulturerben ist Würzburg gefordert, dahingehend mit nachhaltig-effektiven Maßnahmen zu agieren (Wiesneth 2013: 52). Insgesamt sind in Deutschland 52 Weltkultur- und -naturstätten registriert. Mit der Residenz befindet sich in Würzburg ein Schloss, welches seit 1981 eines der in Deutschland anzutreffenden Weltkulturerben ist.
Kommt der Begriff Nachhaltigkeit auf, werden instinktiv Umweltaspekte damit assoziiert (GPF 2020: 134). In der Agenda 2030 werden diese unter den Zielen 11.6 und 11.7 thematisiert. Das Hauptaugenmerk in puncto Nachhaltigkeit der Umwelt liegt auf der innerstädtischen Verschmutzung. Dahingehend wird gefordert, dass bis 2030 die Umweltbelastung zu senken beziehungsweise einzugrenzen sei. In effectu betrifft dies die städtische Luftqualität sowie den Umgang, die Entsorgung und die richtige Trennung von Abfällen. Ergänzend soll zukünftig der Zugang zu Grünflächen, Erholungsplätzen und sonstigen öffentlichen Räumen gesichert werden. Explizit sollen diese nicht nur an zentralen Standorten vorhanden sein, sondern mit einer gewissen Erreichbarkeit an verschiedenen Lokationen in der Stadt auftreten. Es ist wichtig, dass Personen jeglicher Altersgruppen sowie Bürger mit Einschränkungen die Möglichkeit besitzen, auf naheliegende Erholungsräume zurückzugreifen. Summa summarum werden mit der Agenda 2030 einige Anforderungen gestellt, welche es in der Städteplanung zu bewältigen gilt. Da das Thema nachhaltiger und klimaneutraler Politik ein hochaktuelles ist, werden direkt verschiedene Aufgabenbereiche und Problemstellungen zeitgleich zur Umgestaltung angeführt, um umfangreich Siedlungen bestmöglich nachhaltig zu entwickeln und zu vernetzen. Mithilfe einer nachhaltigen Städteplanung und -politik sollen obendrein die ländlichen Einzugsgebiete der urbanen Räume stärker eingebunden und ökonomisch, ökologisch sowie sozial gefördert werden.
3. Methodik
3.1 Leitfadeninterview
Für die weitere Ausfertigung der Master-Thesis werden mehrere empirische Methodiken aufgegriffen. Diese wurden entweder explizit für die Ausarbeitung oder extern im Voraus durchgeführt. Die einzubeziehenden Herangehensweisen werden in zwei Klassen kategorisiert. Unterschieden wird zwischen standardisierten und nicht-standardisierten Vorgängen (Mayer 2013: 22ff.). Werden Erhebungen nicht-standardisiert durchgeführt, so wird gezielt mit Kommunikation und Interaktion zwischen den beteiligten Akteuren gearbeitet. Im Gegensatz zu standardisierten Herangehensweisen können so Informationen gezielter erfasst und verarbeitet werden. Persönliche Meinungen und das Befinden der Beteiligten können detailliert aufgearbeitet und anschließend interpretiert werden. Bei dieser Verfahrenstechnik wird von der qualitativen Sozialforschung Gebrauch gemacht. In Bezug auf die heutige Gesellschaft ist es von enormer Wichtigkeit, Unterschiede in der Lebensweise und der Darbietung des Menschen festzuhalten. Diese fällt entscheidend individueller und exklusiver aus. Die fortschreitende Digitalisierung sowie steigende räumliche Bevölkerungsbewegungen über Kulturkreise hinaus spielen dabei eine wesentliche Rolle. Dem Menschen wird die Möglichkeit dargeboten, seine Aufmerksamkeit auf verschiedene soziale Strukturen, Lebensstile, Sitten und mehr zu lenken. Ermöglicht wird, sein Dasein deutlich vielfältiger auszuleben und verschiedene kulturelle und soziale Aspekte in sein Leben zu integrieren. Mithilfe qualitativer Datenerhebungen über nicht-standardisierte Studien können Einblicke zu unterschiedlichen Denkweisen generiert werden.
Eine mögliche qualitative Methode sind Leitfadeninterviews (Mayer 2013: 37f.). Gängig sind diese ebenso unter dem Namen halbstrukturierter Interviews. Das Prinzip des hier angeführten kommunikativen Meinungsaustausches zielt darauf ab, den Befragten mit im Vorhinein formulierten Fragen zu konfrontieren. Die Fragen sollten indessen offen gestellt werden, sodass auf diese gezielt und frei geantwortet werden kann. Dafür wird im Voraus ein Leitfaden erstellt, welchem während des Interviews gefolgt wird (Spöhring 2013: 147ff.). Mithilfe des Leitfadens besitzt der Interviewer die Möglichkeit einen roten Faden in das Gespräch zu bringen, welchem er sich stetig annehmen kann. Der Leitfaden per se dient dabei allgemein jedoch nur als eine Stütze. Ihm muss nicht strikt gefolgt werden. Das bedeutet zugleich, dass für den Forschenden jederzeit die Eventualität besteht, weitere nicht festgelegte Fragen in das Gespräch einzubinden. Analog besitzt bei den halbstrukturierten Dialogen der zu Interviewende die Option vom eigentlichen Gesprächsthema abzuweichen und Inhalte in die Konversation einzubringen, die eigentlich nicht explizit erfragt worden wären. Damit kann dem Interviewer die Okkasion geboten werden, noch tiefer in Thematiken einzutauchen, welche dieser im Voraus eventuell nicht bedacht hat. Prinzipiell gibt der Fragende das Tempo in der Konversation vor. Er besitzt permanent die Option, das Gespräch wieder auf seinen Leitfaden zu begrenzen oder dem Interviewpartner die Freiheit zu geben, noch stärker abzuschweifen.
Im Kontext der Entwicklung der städtischen Verkehrsinfrastruktur des 21. Jahrhunderts in Würzburg wurde vorweg ein Leitfadeninterview durchgeführt. Der dafür erstellte Leitfaden befindet sich im digitalen Anhang der Thesis unter dem Namen „Leitfaden für Interview“. In diesem Dialog wurden drei Personen befragt. Bei den Interviewpartnern handelt es sich um Mitarbeiter des zum Würzburger Baureferat zugehörigen Fachbereichs Stadtplanung (siehe Abbildung 3). Diese setzen sich intensiv mit der innerstädtischen Entwicklung auseinander. Entstanden ist das Interview am 13. Oktober 2023 zwischen 11:00 und 13:00 Uhr. Als Veranstaltungsort wurde der zum Würzburger Rathaus gehörende Grafeneckart ausgewählt. Das Experteninterview wurde, mit der Zustimmung der beteiligten Personen, per Audioverfahren aufgezeichnet und anschließend fachlich-sachlich transkribiert. Das erstellte Transkript befindet sich in der dazugehörigen Datei im digitalen Anhang „Transkription zum Interview bei der Stadtplanung Würzburg“ dieser Thesis. Zur Aufnahme wurde ein digitales Hand-Diktiergerät herangezogen.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Organisationsplan des Baureferates (Referat IV) der Stadt Würzburg (STADT WÜRZBURG 2023 A).
Der erste der drei Interviewpartner ist Peter Wiegand. Seine Auszüge aus dem Transkript werden im Folgenden gekennzeichnet mit dem Kurzbeleg: (Interview P. Wiegand 10/2023; 1ff.). Der studierte Diplom-Ingenieur ist eingetragener Architekt und der Abteilungsleiter des Fachabteils Projektentwicklung und Stadtgestaltung des Fachbereichs
Stadtplanung. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern organisiert und koordiniert er die gegenwärtige Innenstadtgestaltung. Im Mittelpunkt steht dahingehend der Wandel hin zu einer zukunftsgerechten, nachhaltigeren und zweckmäßigeren Innenstadt. Als Fachabteilungsleiter ist er an vielen Projekten entscheidend beteiligt. So beispielsweise an der Sanierung der ehemaligen Mozartschule (Knies 2015). Der seit 2015 geplante Umbau konnte ab 2020 realisiert werden.
Der nächste Beteiligte an dem Experteninterview ist Uwe Kömpel, folgend gekennzeichnet mit dem Kurzbeleg: (Interview U. Kömpel 10/2023; 1ff.). Er ist Diplom-Ingenieur für Architektur. Er hat den Abschluss an der FH in Würzburg erworben. Ebenso wie Peter Wiegand ist Uwe Kömpel im Fachabteil Projektentwicklung und Stadtgestaltung der Stadtplanung in Würzburg tätig. Bei den dort ausgeführten Gestaltungen, welche sich überwiegend auf die Innenstadt beziehen, wird versucht, das Hauptaugenmerk zusätzlich auf Kommunikation und ein gutes Miteinander zu lenken. Er war ebenfalls schon federführend an Projekten zur Innenstadtgestaltung beteiligt. So vergleichsweise an der von 2014 bis 2018 durchgeführten Sanierung der Kaiserstraße, welche den Würzburger Hauptbahnhof mit dem Barbarossaplatz verknüpft. Gemeinsam mit Peter Wiegand wurde, zu unterstützenden Zwecken, die Kommission für Stadtbild und Architektur (KoSA) eingebracht (Interview P. Wiegand 10/2023: 1f.). In die KoSA werden sowohl interne Architekten eingebunden, welche die Stadt näher kennen, als auch externe Fachleute, um einen Input von außen erhalten zu können. Mithilfe des dadurch entstandenen Austausches soll ermöglicht werden, dass sich die städtische Architektur und Infrastruktur intelligent und nachhaltig weiterentwickelt. Um den Städtebau beziehungsweise die Umgestaltungsmaßnahmen zu fördern, verleiht die KoSA alle zwei Jahre einen Preis. Benannt wurde dieser nach Antonio Petrini, einem bedeutenden Architekten der frühen Neuzeit (Popp 2013: 3). In dieser Epoche war er eine der prägenden Personen für das Stadtbild Würzburgs. Zum Beispiel ist der Bau der Stiftskirche Haug in der Altstadt auf den Baumeister zurückzuführen. Mit dem Antonio- Petrini-Preis sollen Projekte ausgezeichnet und finanziell unterstützt werden. Betrachtet werden dabei optische, gesellschaftliche und ökonomische Aspekte, sowie städtebauliche, architektonische und nachhaltig-zukunftsorientierte Kriterien.
Als dritter Interviewpartner wurde Michael Weber herangezogen. Seine Gesprächsbeteiligungen werden im Folgenden gekennzeichnet mit dem Kurzbeleg: (Interview M. Weber 10/2023: 1ff.). Er ist ebenfalls im Fachbereich Stadtplanung im Abteil Projektentwicklung Seite | 12
und Stadtgestaltung tätig. Er hat Landschaftsarchitektur studiert und dies mit einem Bachelorabschluss beendet. Seine Arbeiten beschäftigen sich überwiegend mit planerischen und konzeptionellen Themengebieten. So ist er ebenso in das Geschehen rund um die Gestaltung in der Innenstadt, explizit dem Bischofshut, eingebunden (siehe Abbildung 4). Er ist maßgeblich an den Umgestaltungen des Teilstücks der Karmelitenstraße beteiligt, welche sich unmittelbar vor dem Rathaus befindet. Im Zuge der Umgestaltung wird dieser Part der Straße gepflastert (Interview U. Kömpel 10/2023: 5). Aufgrund der bis dato vorliegenden Asphaltierung wurden viele Autofahrer, trotz beschilderter Fußgängerzone, nicht daran gehindert, dort einzufahren. Eine neue Pflasterung soll diesen Bereich unterstützend als autofreie Fußgängerzone begleiten und bewahren. Zusätzlich sollen die bisher für Taxis genutzten Flächen mit drei Bäumen ausgestattet werden. Zudem engagiert er sich dafür, die Bevölkerung bestmöglich zu beteiligen (Stadt Würzburg 2020). Im Jahr 2020 wertete er jeweils eine Anwohnerbefragung zur Mobilität und zur Wohn- und Lebensqualität aus sowie eine durchgeführte Eigentümerbefragung.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Planung am Grafeneckart (STADT WÜRZBURG 2023 B: 35).
3.2 Schriftliche Befragung
Mit den qualitativen Verfahrensweisen wird nur ein Teil der Erhebungsmöglichkeiten abgedeckt. Das Gegenstück zu den nicht-standardisierten Elementen sind die standardisierten Bestandteile (Mayer 2013: 58ff.). Mit den quantitativen Analysemethoden wird die Sozialforschung komplettiert. In diesem Sinne werden Erhebungen durchgeführt, welche einem strikten Muster folgen und weniger Potenzial ermöglichen, vom eigentlichen Thema abzuweichen. Je nach bevorzugter Herangehensweise werden im Voraus bestimmte Kriterien aufgestellt. Unter Umständen kann es sich dabei um Fragen, einfache Entwürfe oder festgesetzte Normen handeln. Mithilfe einer solchen Regulierung sollen die Probanden beziehungsweise Beteiligten an der Forschung durch die Erhebung geleitet werden. Auf Grundlage der vorgegebenen Normen sind die Ergebnisse eines standardisierten Verfahrens sind einfacher beziehungsweise vereinheitlicht auswertbar.
Eine Möglichkeit, der quantitativen Sozialforschung nachzugehen, sind schriftliche Befragungen (Bortz und Döring 2016: 252). Bei durchgeführten standardisierten Studien dieser Art muss unbedingt ein bestimmter Überblick über die Anzahl der beteiligten Teilnehmer beigefügt werden. Prinzipiell handelt es sich hierbei um Stichprobenerhebungen. Es wird somit keine Grundgesamtheit betrachtet, sondern lediglich ein gewisser Teil dieser. Mithilfe der erhaltenen Stichprobeninformationen kann, im Anschluss an die Erhebungen, der Inhalt der Antworten ausgewertet und auf eine Grundgesamtheit hochgerechnet werden. Vor der Durchführung muss bei einer solchen Befragung festgehalten werden, auf welche Einheit sich die Grundgesamtheit bezieht. Aufbauend auf diese beantworten zufällig ausgewählte Probanden ihnen schriftlich vorgelegte Fragen. Bei schriftlichen Meinungsumfragen wird zwischen drei verschiedenen Formen unterschieden (Jacob et al. 2014: 212ff.). Bei der ersten Variante wird von den Probanden ein Fragebogen in Papierform unter der Anwesenheit eines Dritten ausgefüllt. Die Umfragebögen werden hierbei lediglich zum Ausfüllen ausgehändigt. Nach der Beendigung nimmt die durchführende Person die Fragebögen direkt wieder entgegen. Die zweite Form ist die postalische Befragung. Bei dieser Erhebung werden den ausgewählten Teilnehmern die Fragebögen zugesendet. Für die Probanden ergibt sich bei dieser Methode die Möglichkeit, die Umfrage in ihrem gewohnten Umfeld und abseits der Öffentlichkeit durchführen zu können. Komplettiert werden die Varianten der schriftlichen Befragungen von der Online-Umfrage. Dabei kann den Befragten die Meinungsumfrage mannigfaltig zugänglich gemacht werden. Neben der Zusendung mittels E-Mail oder dem zur Verfügung stellen eines Weblinks wäre dies ebenso per ausgedruckten oder digitalen QR-Code möglich.
Im Zuge der ausformulierten Thesis wurden zwei Befragungen durchgeführt. Die erste Befragung wurde nach dem Prinzip der ersten Variante als schriftliche Befragung unter Seite | 14
Anwesenheit eines Dritten abgewickelt (siehe Anhang: „Schriftliche Befragung - Würzburg“). Diese wurde zu drei verschiedenen Zeitpunkten realisiert. Die erste Erhebung wurde am Nachmittag des 17. Oktober 2023 durchgeführt. Als Standort wurde der Platz des Vierröhrenbrunnens in unmittelbarer Nähe zum Würzburger Rathaus gewählt. Der zweite Termin war der 25. Oktober 2023 zur Mittagszeit. Hierfür wurde derselbe Standort herangezogen. Die dritte Erhebung wurde extern, zwischen dem 30. Oktober und dem 03. November 2023, mit Mitarbeitern des Briefzentrums der Deutschen Post AG in WürzburgLengfeld durchgeführt. Der dazugehörige Umfragebogen wurde mit 22 Fragen gestaltet. Da hierbei eine Frage eingebunden wurde, bei welcher offen geantwortet wird und keine konkreten Antwortmöglichkeiten vorliegen, kann von einem teilstandardisierten Verfahren gesprochen werden. Die Umfrage wurde mit Personen durchgeführt, welche in Würzburg studieren oder berufstätig sind. Demgemäß wurde der Fragebogen mit Würzburgspezifischen Fragestellungen bestückt. Insgesamt beteiligten sich 47 Passanten und Mitarbeitende der Deutschen Post an der Befragung. Die zweite schriftliche Befragung wurde nach dem Prinzip einer Online-Umfrage erhoben (siehe Anhang: „Schriftliche Befragung - Allgemein). Dafür wurde der dazugehörige Weblink auf Plattformen wie Instagram zur Verfügung gestellt. Ergänzend wurde dies von der Fachschaft für Geographie und Geologie der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg unterstützt. Diese haben den Weblink zur Umfrage in einer Rundmail an alle Studierenden der Geographie untergebracht. Der Umfang des Fragebogens der Online-Befragung beträgt 20 Fragen. Hierbei wurden die Fragen allgemeiner gestellt als bei der standortspezifischen Untersuchung, da sich diese nicht nur auf den urbanen Raum Würzburgs beschränken, sondern auf das gesamte Bundesgebiet. Insgesamt haben an der Online-Erhebung 138 Freiwillige teilgenommen.
3.3 Systematische Beobachtung
Neben den schriftlichen Befragungen gibt es noch weitere Herangehensweisen der quantitativen Sozialforschung. Ein weiterer standardisierter Forschungsansatz, welcher für den Fortlauf der Master-Thesis relevant ist, ist eine systematische Beobachtung (Beer 2020: 57ff.). Bei einer solchen Erhebung wird ein expliziter Forschungsgegenstand in den Vordergrund gestellt. Im Gegenteil zu unsystematischen Forschungen wird bei strukturierten Beobachtungen im Voraus ein genauer Plan zur Durchführung erstellt. Es werden feste Kriterien beschlossen, damit die Untersuchung einem roten Faden folgen kann. Neben der
Planung zeichnet sich eine systematische Erhebung dadurch aus, dass deren Ergebnisse zielgerichtet einzusortieren sind und post festum erneut überprüft werden können. Als Forschungsgegenstand können diverse Faktoren herangezogen werden. Zum Exempel der Mensch als solcher, dessen Verhaltensweisen, die Dauer von Ampelintervallen, die Farbe von Dachziegeln und vieles mehr. Die im Voraus festgelegten Kriterien leiten den Forschenden durch die Beobachtung und ermöglichen diesem, die Daten einheitlich erfassen zu können. Auf Grundlage dessen ist entsprechend eine schnelle Auswertung möglich.
In Bezug auf die Entwicklung der städtischen Verkehrsinfrastruktur wurde im Voraus an die Master-Thesis eine systematische Beobachtung durchgeführt. Im Zuge eines Praktikums im Fachbereich Stadtplanung der Stadt Würzburg entstand diese im Zeitraum Februar bis März 2022. Bei der durchgeführten Erhebung wurde die Pflasterung beziehungsweise Asphaltierung des Straßennetzes des zur Altstadt Würzburgs gehörenden Bischofshut betrachtet. Die Erhebung wurde schlussendlich in das Stadtbodenkonzept zur Umgestaltung des Bischofshuts inkludiert (Stadt Würzburg 2023 C: 37ff.). Kategorisiert wurden vor der Durchführung der Bestandsanalyse 13 verschiedene Arten an Pflasterungsmaterialien inklusive einer für die vorhandene Asphaltierung. Im endgültigen Stadtbodenkonzept wurde dies schlussendlich auf acht eingegrenzt. Neben den wesentlichen Materialien wurden zusätzlich die räumliche Ausdehnung dieser sowie die Beschaffenheit, der Zustand und die Eignung zum Begehen der Straßen und Gassen verschriftlicht und mit Fotoaufnahmen dokumentiert.
3.4 Weitere herangezogene Daten
Im Zuge der nachhaltigen Entwicklung entstand eine Kooperation zwischen der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) sowie dem städtischen Fachabteil Projektentwicklung und Stadtgestaltung (Interview P. Wiegand 10/2023; 4.). Es handelt sich um ein Praxisseminar für die Studierenden des Studiengangs der Geovisualisierung, das wiederkehrend im Sommersemester angeboten werden soll. Diesbezüglich kreieren die Stadtplaner, allen voran Peter Wiegand und Uwe Kömpel, zu bearbeitende Themen, welche anschließend den Studierenden überlassen werden. Die Intention des gesamten Projekts ist, dass sich dadurch mit den hochaktuellen Thematiken der infrastrukturellen Gestaltung Würzburgs auseinandergesetzt wird. Im Übrigen soll geschaut werden, welche
Prozesse dabei entstehen und inwieweit sich die Studierenden den jeweiligen Aufgaben annehmen können. Obendrein stehen bei dem Projekt die Studierenden selbst im Fokus (Interview U. Kömpel 10/2023; 4). Für diese ist es wichtig, dass sie im Laufe ihres Studiums mit realitätsnahen Thematiken in Kontakt treten und sich daran selbst erproben können. Das stellt eine deutlich angenehmere Arbeitsgrundlage als exhaustiv fiktive Anwendungsaufgaben dar. Die Initiative für dieses Projekt kam von Herrn Stefan Sauer (THWS o. J.). Der studierte Diplom-Ingenieur ist eingetragener Architekt und Hochschuldozent an der Fakultät für Kunststofftechnik und Vermessung der THWS. Dort hält er Seminare für den hier eingebundenen Studiengang der Geovisualisierung.
Begonnen hat die Kooperation zwischen Hochschule und Stadt im Sommersemester 2021 und ging im Sommer 2023 somit in die dritte Durchführung. Die Ergebnisse des Seminars stellt Herr Stefan Sauer auf seiner eigens erstellten Website zur Verfügung (Sauer o. J.). Die dabei entstehenden Entwürfe werden von den städtischen Angestellten allerdings nicht als echte Konzepte betrachtet (Interview P. Wiegand 10/2023; 4). Da diese eher auf dem zeichnerischen beziehungsweise handwerklichen Maßstab der Geovisualisierung beruhen, fließt in die Umsetzung viel Fantasie mit ein. Es ergeben sich Konzepte, welche überwiegend unbrauchbar sind oder eine fehlende Umsetzungskompetenz aufweisen. Dennoch werden die Entwürfe von den Stadtplanern sowie von Oberbürgermeister Christian Schuchardt und dessen persönlichen Mitarbeiter betrachtet, um mögliche Eventualitäten und umsetzbare Alternativen aus den Entwürfen entnehmen zu können, insofern diese es zulassen. Unter den eingereichten Entwürfen befinden sich nämlich trotzdem einige wenige, die das Potenzial zu einer umsetzbaren Strategie aufweisen. Mit den daraus gewonnenen Informationen können die Stadtplaner an umsetzbaren Konzepten für die Gestaltung der Innenstadt und der städtischen Infrastruktur arbeiten. In Anbetracht dessen sind vereinzelte Entwürfe der Studierenden der Geovisualisierung von Belangen, wenn es um mögliche zukünftige Gestaltungsmaßnahmen der Verkehrsinfrastruktur in Würzburg geht. Entsprechend wurden Herr Stefan Sauer und die Studierenden der Geovisualisierung im Voraus an die Thesis kontaktiert, damit ihre Arbeiten in die Ausfertigung inkludiert werden können. Mit Herrn Stefan Sauer wurde nach einem ersten Telefonat ein Zoom-Meeting am 05. Oktober 2023 um 11:00 Uhr vollzogen, um Einzelheiten bezüglich seiner Arbeit und dem möglichen Copyright zu klären.
4. Verkehrsplanerische Anpassungen und Maßnahmen in Würzburg
4.1 Aufnahme von Sachverhalten mit Handlungspotenzial
Als autogerechte Stadt muss sich Würzburg besonders intensiv mit den Anforderungen der Agenda 2030 auseinandersetzen, welche in Kapitel 2.2 erläutert wurden. Eine Umsetzung, welche dieser gerecht wird, ist mit einem enormen Aufwand verbunden. Der motorisierte Individualverkehr ist ein essentieller Bestandteil der Fortbewegung geworden. Mit präterpropter 56.000 Einpendlern pro Tag ist in Würzburg mit einer hohen Auslastung im Straßenverkehr zu rechnen (Interview P. Wiegand 10/2023; 2). Vor allem zu den am Morgen und zum Feierabend auftretenden Hauptverkehrszeiten entstehen dabei prekäre Situationen an allen Ein- und Ausfallstraßen. Im Wesentlichen stehen hierbei der Hexenbruch (Einfahrt nach Würzburg-Zellerau über Höchberg), die Veitshöchheimer Straße (Einfahrt über die Bundesstraße 27 (B 27) aus dem westlichen Umland) und der Greinbergknoten (Knotenpunkt der überregionalen Straßenverbindung aus Bundesstraße 8 (B 8) und 19 (B 19) im Nordosten der Stadt) als solche im Vordergrund. An diesen Schnittstellen muss sich mit täglich aufkommenden Stausituationen auseinandergesetzt werden. Diese entstehen durch drei verschiedene Verkehrstypen, die den städtischen Verkehr prägen: Zum einen der täglich auftretende Berufsverkehr, der bis in die gut ausgebaute Innenstadt vorstoßen kann und maßgeblich in die Verkehrsstockungen der Stoßzeiten integriert ist. Des Weiteren kommt das periodische Einfahren in den urbanen Raum durch den Umlandverkehr hinzu. Zum Exempel kann dieser entstehen, weil aus den Vororten die Großstadt als Einkaufsstandort aufgesucht wird oder bestimmte Einzelhandels- oder Dienstleistungsangebote am Stadtrand jenseits des Stadtzentrums angefahren werden sollen. Additional kommt die dritte Komponente hinzu, welche durch den Autobahnumleitungsverkehr eingebracht wird (siehe Abbildung 5). Würzburg liegt in unmittelbarer Nähe zum Autobahnkreuz Biebelried. Verbunden werden dort zwei der meist befahrenen und längsten Autobahnen Deutschlands, die Bundesautobahnen 3 (A 3) und 7 (A 7). Mit der B 19 führt eine Fernstraße durch Würzburg, welche es ermöglicht, als Abkürzung vom Autobahnfahrer genutzt zu werden. Für viele Auto- oder Lastkraftwagenfahrer bietet sich diese an, um Kraftstoff und Zeit einzusparen. Der städtischen Verkehrssituation kommt dies grundsätzlich nicht zugute. Diese drei Komponenten beeinflussen den städtischen Verkehr im Wesentlichen. Betrachtet werden muss, um die städtische Verkehrssituation im Ganzen wahrnehmen zu können, somit nicht nur der Pendlerverkehr, sondern zusätzlich der Durchgangsverkehr über die Fernstraßen sowie die eigens produzierte Fortbewegung aus der Verflochtenheit von Stadt und Peripherie.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Alternativstrecke der Bundesstraße 19 durch die kreisfreie Stadt Würzburg zwischen den Anschlussstellen Würzburg/ Heidingsfeld (A3) und Würzburg/Estenfeld (A7) (eigene Darstellung 2023).
Die Belastung durch den Straßenverkehr ist in Würzburg angesichts dieses Umstands enorm (Interview P. Wiegand 10/2023; 3f.). Neben dem Faktor Klima, durch die hohen Emissionen im Stop-and-Go-Verkehr, wirkt sich dies generell negativ auf das Leben beziehungsweise die Lebensqualität in der Stadt aus. Sicher ist, dass in einer Stadt wie Würzburg, welche derart für den Straßenverkehr ausgebaut wurde, das Auto nicht mehr wegzudenken ist (Interview U. Kömpel 10/2023; 3). Selbst für Einwohner, die das Auto möglichst meiden und auf diverse Alternativen zurückgreifen, liegt eine große Bedeutung im Besitz eines eigenen Personenkraftwagens. Das eigene Auto verschafft jedem Individuum die Möglichkeit, auf dieses zurückzugreifen, sei es von essentiellen Belangen. Es wird ermöglicht, Einkäufe einfacher zu transportieren, Termine in der Peripherie wahrzunehmen, Ausflüge zu unternehmen und mehr. Signifikant lässt sich deuten, dass die Anzahl an eigenen Personenkraftwagen je Haushalt steigt, je weiter entfernt sich ein Bezirk vom Stadtzentrum befindet (siehe Abbildung 6). Für die Stadtteile Grombühl, Sanderau sowie die Altstadt ist festzuhalten, dass in weniger als jedem zweiten Haushalt ein Pkw vorhanden ist. Dahingegen steht in den Stadtbezirken Rottenbauer, Dürrbachtal und Versbach durchschnittlich in jedem Haushalt mindestens ein eigenes Auto zur Verfügung. Folglich wird in den äußeren Bereichen der kreisfreien Stadt häufiger auf den motorisierten Individualverkehr zurückgegriffen. Da das Auto diesen bedeutend hohen Stellenwert in der Stadtgesellschaft besitzt, ist eine Gestaltung im Sinne der Agenda 2030 äußerst kompliziert und mit einigen Problematiken verbunden.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6: Privat-Pkw je 1.000 Haushalte im Jahr 2022 in den jeweiligen Stadtteilen der kreisfreien Stadt Würzburg (eigene Darstellung 2023 basierend auf STADT WÜRZBURG 2023 B).
4.2 Nachhaltige Gestaltung der Altstadt - Abschnitt Bischofshut
In der Stadtplanung sowie in der Politik werden verschiedene Maßnahmen in Erwägung gezogen, um den festgelegten Zielen und Anforderungen gerecht zu werden. Die Stadt in toto autofrei zu gestalten ist eine Vorstellung, die lediglich der Fantasie entspringen kann. Wird das Gebiet jedoch auf den Raum der rechtsmainischen Altstadt begrenzt, dann kann dieser Gedankengang realistischer betrachtet und an eine langfristige Umgestaltung geknüpft werden. Seit 2021 läuft in Würzburg ein Projekt an, welches sich mit der Gestaltung der Altstadt auseinandersetzt (Stadt Würzburg 2023 C: 5). Im Fokus dabei nicht die gesamte Altstadt, sondern der sich zentral befindende Bischofshut. Benannt wurde das Stadtgebiet nach einer Mitra, da es aus der Obersicht daran erinnert. Die fünf Straßen, welche die Bischofsmütze eingrenzen, sind die Juliuspromenade, die Theaterstraße, die Balthasar-Neumann-Promenade, die Neubaustraße und der entlang des Mains verlaufende (obere) Mainkai. Das Projekt ist im Zuge einer vorbereitenden Untersuchung und einer Bürgerbeteiligung entstanden. Geschlussfolgert werden konnte, dass eine relativ geringe Zufriedenheit bei den Teilnehmenden vorlag sowie die Tatsache, dass einige sanierungsbedürftige Oberflächen umgehend angepasst werden müssen. Überdies kommen die Ansprüche für nachhaltige und lebenswerte Städte hinzu. Ergo müssen bei der Umgestaltung zahlreiche Faktoren beachtet und integriert werden (Interview M. Weber 10/2023: 4f.). Berücksichtigt werden beispielhaft die markante Gestaltung, der Mensch beziehungsweise der Bürger per se, der Pendler, die Klima- und Nachhaltigkeitsanpassung sowie die generelle Funktion des Bischofshut als Alt- und Innenstadt. Es muss versucht werden, sich den begrenzten Flächenressourcen anzunehmen und gleichwohl die gewünschten Faktoren unterzubringen. Aufgrund unterschiedlicher Prioritäten und Vorstellungen jedweder beteiligter Akteure kann sich daraus ein langwieriger und schleppender Prozess generieren. Sicher ist, dass am Ende irgendwo Kompromisse eingegangen werden müssen, um die funktionalen und ästhetischen Bedürfnisse im Bischofshut integrieren zu können.
Ein wichtiger Aspekt der Umgestaltung des Bischofshuts ist die vorliegende Verkehrssituation. Um einen Überblick über diese sowie die vorhandenen Straßen erhalten zu können, wurden für das Stadtbodenkonzept einige Untersuchungen vorgenommen (siehe Abbildung 7). Mithilfe der durchgeführten Pflastersteinkartierung konnte festgehalten werden, dass überwiegende Bereiche des vorliegenden Straßennetzes asphaltiert sind. Eine Situation, wie sie für autogerechte Städte typisch ist. Im Zuge der Umgestaltung können die gewonnenen Daten genutzt werden, um das Straßensystem an die gewünschten Anforderungen anzupassen. Vorrangig stehen im Fokus der Neugestaltung verkehrsberuhigte Bereiche. Das Auto respektive der motorisierte Individualverkehr und die ad hoc zur Verfügung gestellten Oberflächenparkplätze sollen aus dem Bischofshut verdrängt werden (Interview P. Wiegand 10/2023; 6). Das Parken soll überwiegend am Stadtrand beziehungsweise außerhalb der Altstadt vonstattengehen. Mit einer Umsetzung dessen könnte im Bischofs hut eine bedeutend höhere Lebensqualität eingebracht werden, welche sowohl auf die Tages- sowie Nachtbevölkerung positiv wirken könnte.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 7: Pflastersteinkartierung des Würzburger Bischofshuts (eigene Darstellung 2022).
Bei der Neugestaltung der Pflasterung der Bischofsmütze soll zukünftig auf einheitliches Material zurückgegriffen werden (siehe Abbildung 8). Simultan soll die aktuelle Hauptkomponente Asphalt gänzlich aus dem Sachgebiet ausgeschlossen werden. Die neue Substanz soll heller sein und folglich fröhlicher wirken (Krispel et. Al 2017: 34ff.). Die hellen Oberflächen sollen allerdings nicht nur die Wohlfühlkomponente ankurbeln, sondern zeitgleich nachhaltige Effekte mit sich führen. Der Schwerpunkt wird hierbei dem Stadtklima zugesprochen. In kompakten Städten sind die Temperaturen häufig ersichtlich höher als im direkten Umland. Bedingt durch die starke Versiegelung der Stadt, den hohen Luftschadstoffen und anthropogenen Wärmequellen wie Industriebetrieben, entsteht eine Wärmeinsel. Die Unterschiede sind vor allem in der Nacht signifikant. Dunkle Straßen, welche die Sonnenenergie überwiegend absorbieren, bedingen die höheren Temperaturen. Die gespeicherte Energie wird nachts, wenn die Atmosphäre allmählich abkühlt, wieder nach oben abgegeben. Dadurch bleibt die Temperatur für einen längeren Zeitraum beständig hoch. Im Gegenzug sorgen hellere Oberflächen dafür, dass die einstrahlende Sonnenenergie überwiegend unmittelbar wieder nach oben reflektiert wird. Infolgedessen soll das gesamte Verkehrsnetz im Bischofshut mit einer einheitlichen hellen Pflasterung ausgestattet werden. Um dahingehend nachhaltig zu agieren, werden für die kommende Umgestaltung regionale Produkte bevorzugt (Interview U. Kömpel 10/2023; 5). Wird die Geologie der kreisfreien Stadt Würzburg und des umschließenden Kragenkreises betrachtet, so fällt einem das hohe Vorkommen an Muschelkalk auf. Ergo werden in der Bischofsmütze kommend Kalksteine und Betonsteine mit Kalksteinoptik verbaut.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 8: Stadtbodenkonzept - Neuer Stand mit heller Oberflächenstruktur (STADT WÜRZBURG 2023 C: 43f.).
Bezüglich der Umgestaltung sind schon einige Vorhaben in Planung. Da das Neugestaltungsvorhaben den gesamten Bischofshut betrifft, werden darin ebenso die teils stark frequentierten Straßen mit einbezogen, die das Untersuchungsgebiet vom restlichen Teil der Altstadt abgrenzen. Allen voran die Balthasar-Neumann-Promenade, welche unmittelbar vor der Würzburger Residenz verläuft, sowie die Theaterstraße. Für die beiden viel befahrenen Passagen ist eine drastische Veränderung vorgesehen (Interview U. Kömpel 10/2023; 5). Die Theaterstraße wird in zwei separate Teilstücke mit unterschiedlichen Funktionen aufgeteilt. Auf der einen Seite gibt es den Abschnitt, welcher sich vom Barba- rossaplatz bis zur Kreuzung Eichhornstraße/Semmelstraße erstreckt (siehe Abbildung 9). Dieser Part, der mit einem Parkstreifen ausgestattet ist, wird infolge der Umgestaltung zu einer Fußgängerzone umfunktioniert. Der weitere Abschnitt der Theaterstraße, bis zum Residenzplatz, soll ähnlich gehandhabt werden wie die Balthasar-Neumann-Promenade. Hierbei wird auf einen Teilbereich der Passagen zurückgegriffen, um dort Raum für eine neu geplante Straßenbahnlinie zu generieren. Die dadurch eingebüßte Fläche wird dem vorhandenen Straßenverlauf entnommen. Die Teilabschnitte sollen zukünftig nur noch als Einbahnstraßen fungieren, vom Josef-Stangl-Platz bis hin zur Semmelstraße (Interview P. Wiegand 10/2023; 5). Ergo werden mit den dortigen Umgestaltungen Veränderungen einhergehen, welche den Charakter der Bischofsmütze im Wesentlichen prägen werden. Um ergänzend dafür zu sorgen, dass der Individualverkehr auf den dortigen Passagen eingegrenzt wird, werden die Zufahrtsmöglichkeiten von außerhalb des Ringparks reduziert (Interview U. Kömpel 10/2023; 6). Die Einfahrmöglichkeit vom Friedrich-Ebert-Ring über das Oegg-Tor wird für den Straßenverkehr geschlossen.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 9: Blick in die Theaterstraße aus Richtung des Barbarossaplatzes (eigene Darstellung 2022).
Primär wird im Bischofshut der Bestand an Oberflächenparkplätzen evaluiert. Die Anzahl dieser soll unbedingt eingegrenzt werden, bestenfalls komplett aus dem Untersuchungsgebiet verschwinden (Grüne Fraktion - Stadtrat Würzburg 2022). Dies geht auf einen Beschluss mehrerer politischer Parteien und Stadträte mit dem Namen „Besser leben im Bischofshut“ zurück. In diesem werden umfangreich Alternativen zur nachhaltigen Gestaltung der Bischofsmütze angebracht. Mit dem aktuell neu entstehenden Parkhaus am Würzburger Hauptbahnhof wird ein erster Schritt getätigt, um neue Parkplätze außerhalb der Altstadt zu gestalten und den Bürgern und Pendlern anzubieten. Die neu entstehende Parkgarage löst das Quellenbach-Parkhaus ab, welches im Juni 2021 aufgrund von gesundheitsgefährdenden Mängeln schließen musste. Im Zuge der kommenden Eröffnung des Parkhauses sollen Oberflächenparkplätze aus der Altstadt entfernt werden. Ähnlich wie im Teilstück der Theaterstraße, welche zu einer Fußgängerzone umfunktioniert werden soll, sind ebenso Parkplätze in der Juliuspromenade und der Karmelitenstraße vorhanden. Diese werden, im Anschluss an die Neueröffnung des Parkhauses, allmählich dem innerstädtischen Raum entzogen (Interview P. Wiegand 10/2023; 6). Die Karmelitenstraße ist fundamental für die direkte Anfahrt der Innenstadt (siehe Abbildung 10). Neben den vorhandenen Oberflächenparkplätzen verfügt die Karmelitenstraße additional über eine der beiden Zufahrten zur Marktgarage. Der Bestand dieser wird weiterhin berücksichtigt. Die Möglichkeit, auf die dort zur Verfügung gestellten zentralen Parkplätze zurückzugreifen, soll fortdauern. Dahingehend sollen die Parkstreifen an der Oberfläche weichen und neuen Raum für eine nachhaltige Umgestaltung bieten, wie sie nach den erwarteten Ansprüchen angedacht sind.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 10: Blick in die mit Autos vollgeparkte Karmelitenstraße aus Richtung der Juliuspromenade (eigene Darstellung 2022).
4.3 Entlastungsansatz für den Würzburger Südring
Neben innerstädtischen Vorhaben werden ebenso großräumige Projekte geplant und in Erwägung gezogen. Dahingehend ist die bereits thematisierte prekäre Situation auf der B 19 ein wesentlicher Bestandteil. Ein möglicher Ansatz zur Entlastung dieser wäre es, den Autobahnumleitungsverkehr auf andere Verkehrswege zu verlagern. In diesem Sinne kam bereits im Jahr 2001 der Gedanke auf, eine Bundesfernstraße westlich der kreisfreien Stadt Würzburg zu bauen (Staatliches Bauamt Würzburg o. J.). Als Verbindungsweg soll diese die A 7 ab dem Kreuz Schweinfurt/Werneck mit der A 3 bei der Anschlussstelle Helmstadt verbinden. Mittels der geplanten Umgehungsstraße könnte die B 19 nahezu gänzlich vom Autobahnumleitungsverkehr befreit werden. Dieser würde sich dadurch in die westlich gelegenen Landkreise Würzburg und Main-Spessart verlagern. Im weiteren Sinne könnte diese Verbindung zusätzlich die Kleinstadt Arnstein von stärkerem Verkehrsaufkommen befreien sowie bessere Anbindungen für Karlstadt und die umliegenden Dörfer einher bringen (Hecke 2021: 2). Im Wesentlichen soll die neue Umgehungsstraße dabei frei von Ortsdurchfahrten bleiben, städtebauliches Entwicklungspotenzial hervorbringen und Anbindungsmöglichkeiten für den Individualverkehr und den ÖPNV in ländlichen Räumen aufzeigen. Die neu geplante Route ist als Bundesstraße 26neu (B 26n) eingetragen. Vorerst war diese mit zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung angedacht. Aufgrund ökologischer und ökonomischer Aspekte wurde sich schlussendlich dafür entschieden, lediglich eine Fahrspur pro Richtung anzuführen sowie diese mit episodisch vorkommenden Überholfahrstreifen zu versehen.
Trotz langer Planungsphase konnte das Projekt bis dato noch nicht realisiert werden. Dem Planungsvorhaben stehen viele kritische Meinungen aus der Öffentlichkeit sowie einige aus der Politik entgegen (Celina 2023). Viele Kommunen, welche sich in unmittelbarer Nähe zur neu geplanten Route befinden, stehen oder standen dem Projekt eher negativ gestimmt gegenüber. Während des Planfeststellungsverfahrens im September 2022 gingen über 1.000 Einwendungen gegen die Umsetzung der Bundesfernstraße ein. Viele der beteiligten Gemeinden sowie einige kleinere Initiativen, Vereine und Verbände schlossen sich bereits 2010 zu einem eingetragenen Verein gegen den Bau der Straße zusammen. Obendrein hat die Vereinigung BUND Naturschutz in Bayern eine Studie zur Umweltverträglichkeit von neu geplanten Bundesfernstraßen durchführen lassen (Hahn et al. 2022: 10f.).
Es wurde eine Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt. Festgestellt werden konnte, dass die entstehenden Treibhausemissionen für den Bau der Umgehungsstraße deutlich höher ausfallen würden als angedacht. Der Kosten-Nutzen-Faktor würde daher deutlich niedriger ausfallen. Grund dafür ist, dass für die Errichtung der Fahrbahn zusätzlich der Bau von zwei größeren Brücken und einem Tunnel einberechnet werden muss. Aus der Politik kommt vor allem Gegenwind bezüglich der mangelnden nachhaltigen Vorgehensweise (Celina 2023). Vorrangig wird diesbezüglich der Umgang mit dem Individualverkehr per se kritisiert. Im Sinne der grünen Politik wäre die ansprechendere Alternative, um die B 19 von der starken Belastung zu befreien, sich allmählich vom motorisierten Individualverkehr abzuwenden. Die Nutzung des Autos solle demnach eingegrenzt werden. Im Gegenzug soll der ÖPNV im westlich der kreisfreien Großstadt liegenden Gebiet reaktiviert werden und die Fortbewegung dort erleichtern. Mit dem Bau der B 26n würde demnach der Verkehr lediglich nur verlagert werden sowie für Versiegelung in ländlich geprägten Räumen sorgen.
Wird der Bau der B 26n im Kontext des Verkehrsaufkommens auf der B 19 betrachtet, so ist der Ausbau des ÖPNV im Main-Spessart-Kreis vielmehr irrelevant für die städtische Verkehrssituation. Mit einem Durchfahrtsverbot für Lkw ab 3,5 Tonnen konnte bereits bewirkt werden, den Schwerverkehr auf der B 19 zu reduzieren. Dies gilt jedoch nicht für den Individualverkehr, welcher den Würzburger Südring dennoch als Autobahnumleitungsverkehr nutzt. Ergo wird dem Bau der B 26n, trotz der vielen und sachlichen Einwände, weiterhin ein hoher Stellenwert zugesprochen, um den Verkehr in der autogerechten Stadt zu dezimieren. Summa summarum kann davon ausgegangen werden, dass es beizeiten zum Bau der Umgehungsstraße kommen wird.
4.4 Investorenfindung
Die Umgestaltungsplanungen im Würzburger Bischofshut schreiten voran. In absehbarer Zeit wird es zu ersten Handlungen zur Neugestaltung kommen. Im Umgang mit derartigen Umbaumaßnahmen ist zwingend die Betrachtung der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel von essentieller Bedeutung. Das Fachabteil Projektentwicklung und Stadtgestaltung respektive der Fachbereich Stadtplanung per se ist eine Institution, welche sich in öffentlicher Hand befindet (Interview P. Wiegand 10/2023; 13). Um für die geplanten
Maßnahmen das nötige Kapital beziehen zu können, müssen somit Förderbehörden einbezogen werden. Als Verwaltungsapparat sind Förderprogramme die Grundlage des finanziellen Zuschusses. Ein wichtiger Geldgeber für die Stadtplanung ist die Städtebauförderung. Diese wird vom Bund sowie den jeweiligen Ländern der Bundesrepublik gestellt. Die Städtebauförderung stellt derweilen mehrere verschiedene Fördertöpfe zur Verfügung (BMWSB o. J. A). Mit diesen können sich jegliche Städte und Kommunen verlinken, um auf die Möglichkeit zurückzugreifen, finanziell unterstützt zu werden. Ein Städtebauförderungsprogramm läuft beispielsweise unter dem Namen „Sozialer Zusammenhalt“. Bis 2019 war dieses Programm noch unter dem Namen „Stadt und Ortsteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt“ gängig. Dieses stellt finanzielle Mittel zur Verfügung, um die Nutzungsvielfalt in Stadtteilen respektive Quartieren sowie die vorliegende Wohn- und Lebensqualität aufzustocken. In facto wurden ebenso in Würzburg Fördermittel aus diesem Förderprogramm bezogen (Stadt Würzburg 2019: 14). Dies kann zum Beispiel an den Aufwertungsmaßnahmen im linksmainischen Würzburger Bezirk Zellerau betrachtet werden. Für die geplante Neugestaltung im Würzburger Bischofshut steht bei der Städtebauförderung das Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ zur Verfügung (BMWSB o. J. B). Wesentliche Handlungsfelder dessen sind Maßnahmen zur Reduzierung von städtischen Wärmeinseln, Anpassungsschritte für verbesserte städtische Infrastrukturen sowie Verbesserungsmaßnahmen des öffentlichen Raums.
Neben den Fördermitteln wird ein geringer Teil des Kapitals versucht, aus der Stellplatzablöse zu generieren (Interview P. Wiegand 10/2023; 13). Dabei handelt es sich um Gelder, welche entstehen, wenn Bauverantwortliche sich von der Verpflichtung freikaufen, auf ihren Grundstücken Garagen oder Stellplätze anzubringen. Vor allem bei Grundstücken, in deren näheren Umgebung hohe Verkehrsauslastungen zu erwarten sind, kann diese Stellplatzablöse anfallen beziehungsweise von der Stadt eingefordert werden. Die daraus gewonnenen Gelder können infolgedessen für den Bau neuer Quartiersgaragen genutzt werden. Externe Sponsoren beziehungsweise private Investoren sind bei solchen städtischen Umgestaltungsmaßnahmen eher seltener vorgesehen. Lediglich bei vereinzelten Projekten wird dies in Erwägung gezogen. Ebenfalls bei dem Bau von Parkhäusern oder Tiefparkgaragen. Die entstehenden Parkgaragen befinden sich, bei Hinzuziehen privater Investoren, in der Hand dieser und nicht in städtischer Hand.
4.5 Entstehende Vorteile für und in der Stadt
Die Umgestaltungsmaßnahmen in Würzburg können neben ihrer Umsetzung zusätzlich inhaltlich verfolgt werden. Aus städtebaulicher Perspektive wird betrachtet, welche Auswirkungen das Handeln auf die Stadt und den Bürger hat. Im Wesentlichen werden hierbei die positiven Punkte in den Vordergrund gerückt. Wird die kommende Änderung der Pflasterung im Bischofshut beleuchtet, so hat dies definitiv erfreuliche Auswirkungen auf das Stadtklima. Die Auswirkungen einer städtischen Wärmeinsel können dezimiert werden. Neben der Reduzierung dieser bieten die hellen Oberflächen eine fröhliche und einladende Atmosphäre in der Innenstadt (Manfrahs 2020: 205ff.). Mit dem zusätzlich eingeplanten höheren Anteil an Grün wird die Aufenthaltsqualität zusätzlich bekräftigt.
Ein weiterer essentieller Sachverhalt ist der Umgang mit dem motorisierten Individualverkehr. Durch die wegfallenden Oberflächenparkplätze sowie den Übergang von Asphalt zu Pflastersteinen soll diesbezüglich ein Umdenken beim Autofahrer entstehen. Das Parken an der Oberfläche soll gänzlich verschwinden, was dem Bischofshut ein deutlich angenehmeres Stadtbild verleihen wird. Der Straßenverkehr per se soll überwiegend außerhalb der Altstadt vonstattengehen, indem dortige Parkplätze angesteuert werden. Dabei können signifikante Vorteile in Bezug auf die innerstädtische Lärmbelästigung entstehen (Ising und Maschke 2000: 5ff.). Durch die geringere Verkehrsauslastung entsteht eine entspann- tere Geräuschkulisse, da die Summe an laufenden Motoren aus dem Gebiet wegfällt. Als Folge kann sich dies positiv auf die mentale Gesundheit des Innenstadtbewohners und des generellen Innenstadtlebens auswirken. Obendrein können mit einer guten Planung stress- mindernde Faktoren für den Berufspendler aufkommen. Dadurch, dass sich der Verkehr nicht mehr auf die zentrale Innenstadt konzentrieren würde, sondern womöglich auf die ringsum liegenden Bezirke und das Umland segmentiert werden könnte, würde sich der Berufsverkehr auseinanderziehen und ein geringeres Stauaufkommen mit sich führen. In der Innenstadt könnten infolgedessen die Luftschadstoff-Emissionen gesenkt werden.
Aus städteplanerischer Sichtweise kann somit langfristig eine lebenswerte und nachhaltige Innenstadt gestaltet werden. Sowohl die Stadt als auch der Bürger können davon begleitet werden. Bezüglich der Thematik Autogerecht sei dabei jedoch gesagt, dass die Stadt Würzburg den Verkehr nicht komplett aus der Stadt verdrängt, sondern im Besonderen aus der Altstadt. Die urbane Mobilität wird somit auf den äußeren Bereich der Stadt reduziert und soll mit Anreizen zur Alternative verbunden werden.
5. Betrachtung des Umgangs der Bevölkerung mit massiven Veränderungen
5.1 Psychologie des Menschen - Umgang mit Veränderungen
5.1.1 Bedeutung des Begriffs „Gewohnheit“
Aus städtebaulicher Perspektive haben die angedachten Veränderungen definitiv ihre Sinnhaftigkeit. Ein nachhaltiges und lebenswertes Zentrum soll zukünftig den Charakter der autogerechten Stadt lenken. Andererseits muss darüber hinaus der Bürger respektive der Berufspendler betrachtet werden. Anders als die Städteplaner, welche die effektivste und plausibelste Lösung für die Umgestaltung bewirken möchten, wird der Berufspendler direkt mit den Veränderungen konfrontiert. Dieser muss sein tägliches Ziel im urbanen Raum eigenständig erreichen. Wird etwas regelmäßig verrichtet, vergleichsweise den Arbeitsweg wiederkehrend zurückzulegen, wird dies zum Automatismus. Der Mensch zeigt in der Folge bestimmte Verhaltensweisen auf, wenn es zu Veränderungen kommt.
„Der Mensch ist ein Gewohnheitstier“ ist ein altbekannter Sinnesspruch (FREYTAG 1867: 212f.). Wahrzunehmen ist das Sprichwort auf zwei Weisen. Zum einen deutet das Sprichwort an, dass zu einem Prozess, welcher zur Routine wird, eine gewisse Abhängigkeit besteht. Es kann das Gefühl zur Verpflichtung entstehen. Im Gegenzug sorgt dieses Empfinden beim Ablegen der Gewohnheit für negative Schwankungen im menschlichen Nervensystem, da der Pflicht nicht mehr sorgfältig nachgegangen wird. Des Weiteren kann die Routine Druck auf den Menschen ausüben, wenn dieser durch äußere Einflüsse nicht mehr nachgegangen werden kann. Als Beispiel kann eine Ernährungsumstellung bei einer Diabeteserkrankung angeführt werden. Die abrupte Umstellung der Ernährung kann für viele Neuerkrankte eine enorme Hürde sein. Im Allgemeinen wird das Sprichwort mit einer negativen Behaftung dargeboten, da Gewohnheiten den Menschen unvorteilhaft lenken und psychisch belasten können. Gänzlich negativ sind Automatismen dennoch nicht zu betrachtet (Schulz-Wimmer 2010: 18ff.). Gewohnheiten können ebenso positives Nutzen mit sich führen. Dies kann bereits an marginalen Einzelheiten respektive Kleinigkeiten unseres alltäglichen Lebens wahrgenommen werden. Sei es das Erlernen des selbstständigen Zubindens der Schnürsenkel oder die Errungenschaft der 10-Finger-Schreibtechnik. Die dabei entstehenden Automatismen haben ihre Vorteile und können effektiv genutzt werden. In den Fokus des Umgangs mit den eigenen Gewohnheiten rückt damit das eigene Bewusstsein und die Stärke, seine eigenen Routinen und Abhängigkeiten mit viel Geduld und Disziplin zu kontrollieren.
5.1.2 Entstehung von Gewohnheiten
Das Stichwort Veränderung ist signifikant für die negative Stellung des Gewohnheitstiers. Wenn Veränderungsprozesse auf die Routine losbrechen und Anpassungsmaßnahmen erwartet werden, dann entstehen die Schwierigkeiten. Mit den aufkommenden Veränderungen wird im menschlichen Nervensystem eine neue Reaktion verursacht (Spichtig 2008: 66 ff.). Im Zentrum der Reaktionsverarbeitung steht die Hirnrinde. Für die Entstehung von Reflexen solcher Art müssen von außen Reize ausgeübt werden, welche für eine Erregung im Kortex sorgen. Differenziert wird zwischen bedingten und unbedingten Reizen. Ein bedingter Reiz wird mit dem Vorgang des Erlernens assoziiert. Unter anderem werden bestimmte Geräusche, Geschmäcker oder Gerüche bei der Aufnahme einprägt. Das Wahrnehmen dieser Eindrücke ist ein Lernprozess, welcher sich festigt. Selbst nach Dekaden ohne unmittelbaren Kontakt zu einem derart eingeprägten Reiz kann dieser durch den vorhandenen Reflex auf der Hirnrinde wiedererkannt werden. Dahingegen ist ein unbedingter Reiz etwas, das überwiegend angeboren ist oder über bestimmte Objektprägungen angenommen wird. Als ein Reflex, welcher aufgrund angeborener Stimuli entsteht, sei diesbezüglich das Schließen des Augenlides zu erwähnen, wenn zum Beispiel ein Insekt auf das Auge zufliegt. Dies geht rein mechanisch und gedankenlos vonstatten.
Die beiden Reizeinflüsse bringen Vorgänge einher, die in unserem Nervensystem synchron zueinander vonstattengehen (Spichtig 2008: 67). Die auf der Hirnrinde eintreffenden Stimuli erzeugen jeweils einen Erregungsherd. Wenn sich sowohl die angeborenen als auch die neu erworbenen Reize festigen, dann haben sie vorerst eine sehr große Bedeutung und Wirkmächtigkeit. In der darauffolgenden Phase strahlen die Erregungen auf ihr näheres Umgebenes aus, bis die Kortexoberfläche gänzlich abgedeckt ist. Je weiter sich die Erregung dabei vom eigentlichen Erregungsherd entfernt, desto geringer wird dessen Intensität. In der Folge findet wieder ein konträrer Prozess bis hin zur maximalen Konzentration der Erregung am Erregungsherd statt. Trifft also ein bedingter Reiz auf einen bereits vorhandenen angeborenen Reiz, so generieren sich daraus bedingte Reflexe. Diese bedingten Reaktionen sind ebenso unter der Bezeichnung der klassischen Konditionierung gängig. Der erlernte Reiz koppelt sich mit dem unbedingten Stimulus. Die Reaktion, die zuvor lediglich beim angeborenen Reiz ausgelöst wurde, wird in dessen Wesensart auf den bedingten Stimulus übertragen. Werden die erworbenen bedingten Reaktionen über einen längeren Zeitraum beibehalten und getätigt, eventuell sogar von außen belobigt oder mit anderen äußeren Einwirkungen verknüpft, dann können schwerwiegende Problematiken auftreten, müssen diese Reflexe abgelegt werden. Zum Exempel ist hierbei auf die Erziehung zu verweisen. Ein Kind nimmt in seiner Entwicklung als bedingte Reize das wahr, was ihm vorgelebt und beigebracht wird. Wächst nun ein Kind in einem toxisch geprägten Haushalt auf, indem respektvoller Umgang zwischen Vater und Mutter Mangelware ist oder die Elternteile versäumen das Beibringen von respektvollem Verhalten gänzlich, dann wird sich das Kind in seiner Zukunft damit schwertun, sich diese Berührungspunkte mit Respekt anzueignen. Ähnlich ist dies bei der Weitergabe von Eigenschaften und Gedankengut zu betrachten. Exemplarisch muss sich in der Gegenwart weiterhin mit Thematiken wie Rassismus oder Antisemitismus auseinandergesetzt werden. Die Weitergabe dieser Anschauungsweisen, zum Beispiel familienintern oder im engeren Freundeskreis, sind erlernte Reize, die sich in dieser Art und Weise festigen und dadurch schwer zu lösen sind. Dies bildet ein Exempel von diversen ab, wieso derartige Diskriminierung heute noch existiert. Das Aufbessern des eigenen Selbstwertgefühls wäre ein weiterer Zusammenhang. Durch das Bilden von Gruppen und das Aufeinandertreffen Gleichgesinnter in der Gegenwart, über Plattformen wie Facebook, X oder Telegram, wird der Umgang mit dem eigenen Gedankengut zusätzlich gestärkt und verschärft. Die Menschen zu erreichen, die derart negativ behaftete Eigenschaften oder Wesensmerkmale aufweisen, ist kompliziert.
5.1.3 Mentale Barriere durch das Gefühl der Einschränkung
Sollen sich Eigenschaften, Wesensmerkmale, Angewohnheiten oder ähnliches formen und entwickeln, ist das mit einem Veränderungsprozess zu verbinden. Primär kommt jedoch häufig eine Ablehnung derjenigen auf, die etwas verändern sollen. Das ist faktisch auf die erlernten Reaktionen zurückzuführen. Die bedingten Reflexe gliedern sich als Schließungsreflexe ein (Spichtig 2008: 67). Die entstandene erlernte Reaktion, die sich über einen längeren Zeitraum gefestigt hat, verschließt sich gewissermaßen vor der Veränderung. Trifft ein neuer zu erlernender Reiz auf die bereits bestehende Kopplung aus bedingtem zu angeborenem Stimulus, wird dies abgestoßen. Der vorhandene Reflex blockt auf mentaler Ebene ab, dass dieser angegriffen oder sogar gänzlich beseitigt werden kann. Er reagiert ablehnend auf mögliche neue oder veränderte Reize. Unter solche Veränderungsprozesse fallen ebenso Vorgänge, bei denen es um Verbesserungen geht. Nicht jede Veränderung ist eine Verbesserung. Umgekehrt ist jedoch jeder Ansatz, der sich um Weiterentwicklung bemüht, eine Veränderung (Goldratt 1990: 10ff.). Insofern dies als Annahme feststeht, können wir uns als Menschen, egal ob politisch, sozial, ökologisch, ökonomisch oder prinzipiell jedes Individuum für sich selbst, schlichtweg nicht weiterentwickeln und verbessern, ohne dabei Veränderungen einzugehen. Bei diesem Punkt entstehen die Problematiken, mit denen sich gesellschaftlich auseinandergesetzt werden muss. Wird eine Weiterentwicklung respektive eine Neugestaltung im Raum angestrebt, dann wird den Planenden viel Kritik entgegengebracht. Der Ursprung dessen liegt darin, dass vermehrt der Veränderungsprozess als ein Angriff auf die eigene Sicherheit aufgefasst wird. Es werden schlichtweg Einschränkungen mit der Veränderung verknüpft. Es ist also nahezu unmöglich, bei großräumigen Veränderungen nicht auf Ablehnungen zu treffen, da nicht jeder die unmittelbare Disziplin aufweisen kann, die Reaktion des Schließungsreflexes sachlich und rational zu überbrücken. Die ungünstige Konklusion ist nicht nur die Verknüpfung des Veränderungsprozesses mit möglichen Einschränkungen, sondern zusätzlich die unvermeidliche Reaktion darauf. Steht die Möglichkeit im Raum, dass die eigene Sicherheit angegriffen werden könnte, dann reagiert der Mensch beziehungsweise dessen Nervensystem mit einem ausgeprägten emotionalen Widerstand darauf. Trifft diese Situation ein, dann sind die darauffolgenden Handlungsmöglichkeiten des betroffenen Individuums eingeschränkt. Auf emotionalen Widerstand mit Logik und Rationalität zu reagieren ist schlicht unmöglich. Der menschliche Verstand lässt in dieser Gesamtsituation gemeinhin nur noch eine mögliche Handlungsweise zu: Lediglich noch stärkere Emotionen können den emotionalen Widerstand überwinden. Die entstehende Angst vor dem Angriff auf die eigene Sicherheit durch den Veränderungsprozess wird mit stärker ausgeprägten Gemütsbewegungen wie Trauer, Wut, Aggressionen oder Verachtung überbrückt.
Summa summarum muss bei großräumigen Planungen mit Veränderungsmaßnahmen, die eine große Gesamtheit an Personen betreffen, versucht werden, diese vorurteilsfrei und wertneutral zu erreichen, bevor sich der Gedanke des Angriffs auf die eigene Sicherheit und die Einschränkung erhärtet. Auf lange Sicht muss versucht werden, den Ansatz der Verbesserung als Norm zu implementieren (Goldratt 1990: 10). Egal welche Sach- oder Arbeitsgebiete dies umfassen sollte, wird der Weiterentwicklung ein hoher Status zugesprochen. Ohne uns zu verbessern, ohne diese Form der Veränderung einzugehen, würde die Menschheit irgendwann gänzlich stagnieren und die vorhandenen Potenziale würden sich auf Dauer absentieren. Ein Stichwort, welches diesbezüglich eine essentielle Rolle einnimmt, ist die Kommunikation. Mit der richtigen, eindringlichen, frühzeitigen sowie vorbereitenden Verständigung kann versucht werden, die aufkommenden Ängste und Unstimmigkeiten präventiv zurückzuhalten und abzublocken.
5.2 Bedeutung des Autos
5.2.1 Entwicklung des Automobils
Die physische Fortbewegung ist ein essentieller Bestandteil jedes Lebewesens. Für den Menschen gilt dies in der Gegenwart sowohl für das Überbrücken von kurzen sowie großen Distanzen von bis zu tausenden von Kilometern an einem einzelnen Tag. Eine Fortbewegung, welche rascher vonstattengeht als zu laufen, ist mittlerweile allgegenwärtig. In globalisierten Ländern, in denen die Gesellschaft ein schnelles Handeln erfordert, sogar von höchster Priorität. Der Wandel, weniger Muskelkraft für die Fortbewegung aufwenden zu wollen, hat vor vielen Jahrtausenden begonnen (Brade 2023: 1). Bereits vor über 30.000 Jahren wurde damit begonnen, Pferde zu domestizieren. Mithilfe von Höhlenmalereien wurde der Umgang mit dem Tier dargestellt. Die eigentliche Intention in der Handhabung mit dem Huftier war dessen kostbares Fleisch. Als Fleischlieferant wurde mit dem Pferd eine notwendige Nahrungsquelle geliefert. Durch die bereits vorhandenen Berührungspunkte entwickelte sich viele Jahrtausende später eine gänzlich neue Beziehung zum Ross (Outram et al. 2009: 1332 f.). Bereits vor ungefähr 5.500 bis 5.700 Jahren wurde das Pferd, im nördlichen Gebiet des heutigen Kasachstan, ebenso für andere Zwecke als den Fleischkonsum genutzt. In der Botai-Kultur wurden neue Werte im Huftier entdeckt. Neben der Molkerei sowie der Gärung der gewonnenen Milch zu Kumys wurde es erstmals als ein Reittier verwendet. Die Fortbewegung durch die eurasische Steppe wurde erleichtert. Zwar wurde die Nutzung der Muskulatur beim Menschen lediglich auf andere Muskelpartien verlagert, jedoch musste kein direkter Aufwand mehr für die Fortbewegung per se getätigt werden. Darüber hinaus war es möglich, Distanzen über größere Entfernungen schneller zurückzulegen.
In den darauffolgenden Jahrhunderten versuchten sich verschiedene Völker daran, nicht nur die Fortbewegung zu verbessern, sondern darüber hinaus den Transport von Waren zu erleichtern (Reinhardt 2015: 31f.). Nach der Erfindung des Rades und dem daraus entstandenen Handwagen wurde probiert, die beiden Eigenschaften miteinander zu verknüpfen. Das Volk der Sumerer, welches im südlichen Gebiet des mesopotamischen Zweistromlandes zwischen Tigris und Euphrat lebte, entwickelte einen Wagen, welcher von Tieren gezogen werden konnte. Mit dem sumerischen Wagen, welchen es sowohl zwei- sowie vierrädrig gab, wurde präterpropter 2.800 v. Chr. zum ersten Mal die Möglichkeit eingebracht, bei der Fortbewegung nahezu gänzlich auf menschlich aufgebrachte Energie zu verzichten. Diese Arbeit wurde fortan von Zugtier und Wagen übernommen. Nach vielen weiteren Aufwertungsmaßnahmen in Ägypten, Griechenland und bei den Römern wurde sich zum Ende der Antike wieder vom gezogenen Wagen abgewendet. Bis hinein in das Mittelalter galt das Reiten als die bestmögliche und effektivste Art der Fortbewegung, da in feindlichen Territorien kleinere und schmalere Spuren hinterlassen wurden sowie leichter unebenes Gelände überwunden werden konnte. Im 15. Jahrhundert kam die Idee des Wagens in der Form der Kutsche wieder zurück (Ammon 1805: 7).
Mit der industriellen Revolution begann eine prägende Entwicklungsphase. Nach der Erforschung der Dampfmaschine versuchten einige strebsame Erfinder, diese anderweitig einfallsreich einzubinden (Karwatka 2015: 10). Neben dem Betrieb von Arbeitsmaschinen gab es Potenzial zur Anwendung bei der Fortbewegung. 1769 entwarf der Franzose Nicholas-Joseph Cugnot ein Transportmittel, welches zwecks der Dampfmaschine mit einer Wärmekraftmaschine betrieben werden konnte. Ergo wurde das Fahrzeug Dampfwagen genannt. Die generell schneller werdende Gesellschaft der Industrialisierung brachte ein ersichtlich höheres Tempo mit sich, weshalb der Umgang mit Innovationen stärker belebt wurde (Volti 2006: 152). Mit der Erfindung der Brennstoffzelle im Jahr 1839 durch den britischen Juristen und Physikochemiker William Grove wurde der Weg zum modernen Automobil geebnet. Mithilfe dieser konnten weitere Innovationen erforscht und entwickelt werden. Einen essentiellen Fortschritt brachte 1863 der Franzose Etienne Lenoir ein, als er das Hippomobile entwarf (Bonn 2022: 5). Mit diesem Fahrzeug konnte er bei seiner Fahrt neun Kilometer zurücklegen. Das Besondere an seinem Wagen war, dass in diesem erstmalig ein Verbrennungsmotor verbaut wurde. Im historischen Kontext zur Erfindung des Automobils wird dieses häufig nicht beachtet, da es keine große Aufmerksamkeit aus der Bevölkerung auf sich zog sowie keine ökonomische Relevanz aufzeigte. Es wurde lediglich zweimal produziert. In den darauffolgenden Jahrzehnten wurde von mehreren verschiedenen Erfindern, wie Carl Friedrich Benz und Henry Ford, am Verbrennungsmotor gearbeitet, um diesen tauglicher für die Fortbewegung zu machen. So konnte sowohl in Europa als auch in Nordamerika das Automobil entstehen.
5.2.2 Nutzung von Fortbewegungsmitteln in Deutschland
Der historische Kontext, sich die Fortbewegung seit Jahrtausenden erleichtern zu wollen, ist etwas, das sich über Generationen hinweg im Menschen gefestigt hat. Mittlerweile kommt das menschliche Individuum von klein auf mit den verschiedenen Transportmitteln in Berührung. Sei es der Schulbus, die Fahrt mit den Eltern zum Supermarkt oder das Spielen mit Spielzeugautos. Die Berührungspunkte mit den verschiedenen Fahrzeugalternativen, insbesondere mit dem Pkw, sind allgegenwärtig. In der Gegenwart wird immer noch probiert, das Auto weiterzuentwickeln. Dazu gehören mittlerweile einige Alternativen, welche sich gänzlich vom Verbrennungsmotor abkehren, wie unter anderem Elektromotoren. Da die Bedeutung des Autos weiterhin in der Gesellschaft wächst, haben nachhaltigere Alternativen eine ausgesprochen hohe Priorität. Anhand der Online durchgeführten (siehe Anhang: „schriftliche Befragung Allgemein - Ergebnis“) sowie der in Würzburg begleiteten (siehe Anhang: „schriftliche Befragung Würzburg - Ergebnis“) Repräsentativumfragen können wesentliche Standpunkte der Bevölkerung zum Umgang mit dem gewählten Fortbewegungsmittel getätigt werden. Dadurch, dass das Auto eine derartige Relevanz in der Allgemeinheit besitzt, ist es geradezu unmöglich, sich ausnahmslos von diesem abzuwenden (siehe Abbildung 11). Mit 55,8 % der Probanden haben über die Hälfte der Teilnehmer an der deutschlandweiten Online-Umfrage angegeben, dass sie regelmäßig den motorisierten Individualverkehr für den Arbeitsweg berücksichtigen. 52,2 % davon benutzen den Pkw, die anderen 3,6 % das Motorrad oder ein Moped. Ebenso werden gerne andere Verkehrsmittel in Betracht gezogen, jedoch nicht so häufig wie das Auto. 38,4 % benutzen regelmäßig den Bus, 29,7 % den städtischen Schienenverkehr sowie 14,5 % die Regionalbahn. Mit 31,9 % legen einige der Befragten ihren Arbeitsweg gänzlich oder zum Teil zu Fuß zurück. Gleichermaßen gibt es eine ausgewogene Quote an Fahrradnutzern mit 23,9 %. Die in Würzburg erhobenen Werte unterscheiden sich von den bundesweiten Ergebnissen (siehe Abbildung 12). Auffällig ist, dass der Pkw mit 53,2 %, ebenfalls das am häufigsten gewählte Fahrzeug ist. Dafür wird lediglich von 14,9% der Probanden auf den Bus und von 23,4% auf das städtische Schienennetz zurückgegriffen. Im Gegenzug wird mit 29,8% in Würzburg häufiger das Fahrrad verwendet.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 11: „Mit welchen Fortbewegungsmüteln begeben Sie sich regelmäßig zur Arbeit?" - Ergebnis aus der Online-Umfrage (eigene Darstellung 2023).
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 12: „Mit welchen Fortbewegungsmüteln begeben Sie sich regelmäßig zur Arbeit? " - Ergebnis aus der Würzburger Umfrage (eigene Darstellung 2023).
Der motorisierte Individualverkehr gehört für viele Bürger zum Alltag wie die Ernährung. Es bringt einen gewissen Anspruch für die Fortbewegung ein. Dass die Nutzung des Autos dermaßen angewachsen ist, ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen (Holz-Rau 2018: 1579). Zum einen wird mit dem Pkw eine gewisse individuelle Freiheit verbunden. Mit der gewonnenen Flexibilität entsteht eine Unabhängigkeit. Das strikte Verfolgen der Zeitpläne des ÖPNV entfällt. Die Abfahrtszeit vor der Arbeit kann eigenhändig und sporadisch festgelegt werden. Des Weiteren ist ein wesentliches Element der steigende Wohlstand. Mit dem Umgang der voranschreitenden Globalisierung und der konsumgesteuerten Gesellschaft entstand das Bedürfnis, sich mit Gegenständen zu profilieren. Im Mittelpunkt steht nicht mehr der Erwerb von Gütern des Grundbedarfs, sondern überwiegend Luxusgüter. Neben Unterhaltungselektronik wie dem Fernseher, dem Handy oder dem Laptop, Genussmitteln wie Schokolade oder Kaffee und etlichen Gütern exklusiver Labels gehört ebenso das Auto zu diesen Luxusgütern. Im Gegenzug wird für die Grundbedarfsgüter hierzulande lieber weniger Geld ausgegeben. Wird die Entwicklung des Motorisierungsgrades, ab 1950 bis 2022, betrachtet, bildet sich ein signifikanter Prozess heraus (errechnet nach BMVBW 2000: 105, 142; BMVI 2021: 133; Destatis 2023). Während 1950 gerade einmal 12 Personenkraftwagen je 1.000 Einwohner ermittelt werden konnten, lag dieser Wert 2022 bei mittlerweile 574 Pkw. Somit hat sich dieser in 70 Jahren nahezu verfünffacht. Im Allgemeinen ist daran gut zu erkennen, wie sehr das Ansehen des motorisierten Individualverkehrs respektive des eigenen Pkw gestiegen ist und welche unumgängliche Rolle dieses in der heutigen Gesellschaft einnimmt.
5.3 Umgang mit massiven infrastrukturellen Veränderungen in der Stadt
5.3.1 Haltung zur möglichen Partizipation von Bürgern
Der erläuterte Umgang mit Veränderungen muss ebenso bei den geplanten Umgestaltungsmaßnahmen in Städten kritisch beleuchtet werden. Geht es im Wesentlichen um die Möglichkeit, dass sich Bürger selbst nachhaltig im städtischen Umgang beteiligen, kommen einige psychologische Hürden auf, welche bezwecken, dass der Mensch die Bemühungen zum Verbessern blockiert (Appl Scorza 2021: 1). Ein fundamentales Element dessen sind die Gewohnheiten, an welche sich der Mensch koppelt und daraufhin auf massive plötzliche Veränderungen mit Abneigung reagiert, vorwiegend sogar mit verstärkten Emotionen wie Hass, Angst oder Aggressionen. Während Hass und Aggressionen sich durch strikte Ablehnung und Verachtung äußern, wirkt sich Angst überwiegend paralysierend, stressend und demotivierend aus. Dies kann im schlimmsten Fall mit einem sinkenden Selbstwertgefühl enden. Zum Exempel sind bei Anpassungsmaßnahmen, die den Klimawandel betreffen, ebenso die Bürger gefordert, selbst nachhaltiger und klimaneutraler zu agieren. Dies wird häufig, gekoppelt an die starke Angstreaktion, mit dem Gefühl begleitet, selbst nichts zur Veränderung beitragen zu können. Im Fokus steht hierbei, dass der Bürger bei den aufkommenden Neugestaltungen frühzeitig eingebunden wird, um diesen mental auf die Veränderungsmaßnahmen und mögliches Engagement einstellen zu können. Zudem muss versucht werden, die aufkommenden starken und negativ behafteten Emotionen zu überwältigen. Dies kann überwunden werden, indem den Leuten aufgezeigt wird, was sie besser machen können und wie sie die Veränderungsprozesse unterstützend begleiten können. Indem ihnen der Eindruck gegeben wird, doch etwas zur Gesamtsituation beitragen zu können, kann die negative Emotion durch eine gestiegene wahrgenommene Selbstwirksamkeit besser verarbeitet werden. In effectu kann der Mensch dadurch lernen, mit seinen eigenen Gefühlen besser umzugehen und diese zu kontrollieren.
Der Aspekt der Gewohnheiten ist bestimmend im menschlichen Umgang mit den Veränderungen. Ein weiteres mentales Hindernis wird mit psychologischen Distanzen eingebracht (Appl Scorza 2021: 1f.). Im Umgang mit der Nachhaltigkeitsgestaltung in der Stadt werden Thematiken eingebunden, welche für den Bürger nicht greifbar erscheinen. Dies kann unter Umständen auf Grundlage fehlenden Hintergrundwissens entstehen. Die Intensität der Unklarheit paart sich mit gesellschaftlicher, räumlicher und zeitlicher Ferne zu den psychologischen Distanzen zusammen. Ergo liegt eine große Bedeutung darin, nicht nur die Veränderungsmaßnahmen an sich zu erläutern, sondern zusätzlich Hintergrundinformationen zu den Aufgaben und Zielen an die Zivilisation weiterzugeben, um diese sachlich und fachlich aufzuklären. Zusätzlich entsteht bei vielen Bürgern der Umstand, dass sie sich im Umgang mit den Umgestaltungshandlungen aus der Verantwortung ziehen. Hierbei wird von der Verantwortungsdiffusion gesprochen. Es handelt sich um die Sachlage, dass genügend fähige Menschen vorhanden sind, welche selbst nachhaltig in der Stadt agieren möchten, dies jedoch schlussendlich nicht realisieren. Hintergrund dessen ist, dass diese Menschen die große Gesamtheit jener betrachten, welche das Engagement dahingehend ablehnen und abwertend über dieses reden. Der eigentlich positiv gestimmte Bürger wird aufgrund seiner eigenen Wahrnehmung zu dem Entschluss gedrängt, dass er als einzelnes Seite | 39
Individuum selbst nicht viel verändern kann. Das Potenzial des nachhaltigen Agierens kann, trotz der eigentlichen Initiative, verloren gehen. Um diesen Werdegang zu unterbinden, ist es aus städtischer Sicht sinnvoll, Plattformen oder Sitzungen zu bieten, bei denen sich Beteiligungswillige miteinander in Gruppen zusammentun können. Durch das Kommunizieren der Bürger untereinander können Informationen und Tipps miteinander ausgetauscht werden. Somit könnte eine voranschreitende Verantwortungsdiffusion unterbunden werden.
5.3.2 Umgang mit städtebaulich gestellten Veränderungen der Verkehrsinfrastruktur
Werden verkehrsinfrastrukturelle Umgestaltungsmaßnahmen in der Stadt als solche betrachtet, dann kommen einige Veränderungen auf den Bürger zu. Neben den Anwohnern werden ebenso die Berufspendler mit diesen konfrontiert. Mit den Neugestaltungen müssen sich die Autofahrer mit ungewohnten Situationen auseinandersetzen. Aufgrund des ihnen eingeprägten Alltags werden neue Reize auf die angewöhnten Reaktionen im Nervensystem ausgeübt. Mit dem bereits angedeuteten Umgang von Gewohnheiten bei Veränderungsprozessen sowie weiteren äußeren Einwirkungen kommen belastende Faktoren auf. Diese werden den Bürger bei fehlenden vorbereitenden Maßnahmen und mangelnder Kommunikation der an den Neugestaltungsmaßnahmen beteiligten Akteure während des Entwicklungsverlaufes begleiten. Solange, bis dieser sich mit dem neuen Standard zurechtfinden kann und die neuen Reize sich als gewohntes Szenario auf dem Kortex etablieren. Zu diesen belastenden Faktoren gehören unter anderem Einschränkungen der eigenen Freiheit (siehe Abbildung 13). 58,9 % aller Befragten, welche regelmäßig das Auto für den Arbeitsweg berücksichtigen, haben angegeben, dass die eigenen Freiheiten eingeschränkt werden, sollten sie ihr gewohntes Ziel nicht mehr direkt mit dem eigenen Fahrzeug erreichen können. Muss eventuell komplett oder für einen Teil der Strecke auf den ÖPNV zurückgegriffen werden, so entsteht eine gewisse Abhängigkeit. Das Benutzen der öffentlichen Verkehrsmittel ist an genaue Abfahrtzeiten geknüpft. Das Resultat ist ein Verlust der Flexibilität. Eine Gegebenheit, welche das Gewohnheitstier im Menschen angreift. Prinzipiell kann bei Thematiken, welche überwiegend die Gewohnheiten einbeziehen, gesagt werden, dass sich der Mensch ebenso an die neuen Umstände gewöhnen kann. Eine abrupte Umgewöhnung führt jedoch psychische Belastungserscheinungen mit sich. Daher ist es von enormer Wichtigkeit, dass Alternativen rund um den ÖPNV und Park & Ride im Voraus für den Bürger anschaulich präsentiert und somit greifbar gemacht werden. Eine essentielle Rolle wird von der persönlichen Komfortzone eingenommen. Mit dem Umstieg auf den ÖPNV wird ein Verlust dieser assoziiert. 51,8 % der Probanden vertreten die Meinung, dass das Wegfallen der komfortablen Mobilität auf dem Arbeitsweg eine ausschlaggebende Hürde darstellt. Sich in das eigene Auto zu setzen, womöglich noch mit Sitzheizung, eigener Musik und ausbleibenden sozialen Interaktionen, würde durch gefüllte Transportmittel, unbequemere Sitze und hohes Gedränge vieler Menschen ersetzt werden. Mit 54,5 % wurde zahlreich ein generell gestiegener Aufwand angegeben. Darunter versteht sich überwiegend, dass mehr Energie für den Arbeitsweg aufgebracht werden muss. Darunter fallen Elemente wie früheres Aufstehen, eingeschränkter Transport von eingekauften Waren sowie häufiges und mit Eile verbundenes Umsteigen bei Benutzung des ÖPNV. Dem ein oder anderen wird es schwerfallen, direkt mit diesen abrupten und intensiven Veränderungen gut umzugehen. Es kommt sowohl physischer als auch mentaler Stress auf den Menschen zu. 44,6 % der Umfrageteilnehmer sind der Auffassung, dass die Veränderungen mit Stress einhergehen werden. Der Stress wiederum bedeutet, dass die Bürger deutlich emotionaler und gereizter auftreten würden. Neben Wut und verstärkten Ängsten könnte bei anhaltendem Stress das psychische Wohlbefinden darunter leiden. Dazu gehören unter anderem das Gefühl von Hilflosigkeit oder situationsabhängige Überforderungserscheinungen. Dies könnte sich zusätzlich auf den Körper ausweiten und mit beschleunigtem Herzschlag, Schweißausbrüchen, Verspannungen und vielem mehr einhergehen. Ein weiterer Faktor, den 40,2 % der Probanden votierten, sind höhere Kosten. Mit dem Umstieg auf den ÖPNV sind Ausgaben verbunden. Es könnte argumentiert werden, dass bei einem Komplettumstieg auf den ÖPNV das Auto verkauft werden könnte und somit geringere Kosten anfallen würden. Diese Betrachtungsweise ist in der Praxis jedoch kaum realisierbar. Die Wichtigkeit des eigenen Fahrzeuges symbolisiert sich nicht nur durch die Nutzung auf dem Arbeitsweg, sondern zusätzlich im Gebrauch während der Freizeit. Viele Menschen wollen und können nicht gänzlich auf das Auto verzichten. Somit fallen neben den Instandhaltungs-, Unterhalts- und Spritkosten für den Pkw die Zahlungen für den ÖPNV zusätzlich an. Dies würde für einige bedeuten, bei den sonst schon getätigten Ausgaben eventuell Abstriche tätigen zu müssen, um den Kosten gerecht werden zu können. Für einige, welche nur geringe Geldmittel zur Verfügung stehen haben, könnten dabei prekäre Situationen entstehen. Dahingehend ist es von essentieller Bedeutung, allerlei Möglichkeiten bei der Neugestaltung abzuwägen, um ebenso dem Niedriglohnsektor
Alternativen zu vermitteln. Für 22,3 % der an der Umfrage beteiligten Teilnehmer spielen darüber hinaus mentale Hindernisse eine Rolle, welche die intensive Nutzung des ÖPNV grundlegend einschränken. Im engeren Sinne werden damit zum einen Angstzustände verbunden. Dabei fällt es Leuten schwer, sich dem Gefüge des menschlichen Treibens durch die Stadt unterzuordnen. Diese Art der Angststörung wird Agoraphobie genannt und ist eine bestimmte Form der Platzangst (Westphal 1872: 143). Konträr zur Klaustrophobie, der Angst vor engen Räumen, handelt es sich bei der Agoraphobie um die Furcht vor großen und öffentlichen Plätzen. Überdies können Menschenmengen und das Reisen in öffentlichen Verkehrsmitteln als Symptome eine Reaktion auf die Phobie auslösen. Die Einschränkung durch die Agoraphobie begrenzt die Möglichkeiten, mit dem ÖPNV umzugehen. Eine weitere genannte mentale Hürde wird durch Reizüberflutungen dargestellt. Der Mensch wird regelmäßig Reizen ausgesetzt. Es ist wichtig, dass unseren Sinnesorganen regelmäßig Reize geliefert werden. Jedoch gibt es einige Personen, welche mit zu vielen Reizen nicht umgehen können. Es kommt zur Reizüberflutung. Es handelt sich um eine Reaktion des menschlichen Nervensystems auf die Vielzahl von Reizen, die es nicht mehr komplett verarbeiten kann. Dabei reagiert er mit Stress, hektischem Verhalten und schnellerer Erschöpfung. Bei zu vielen Reizen und einer aufkommenden Reizüberflutung würde die Psyche des jeweiligen Individuums stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Dies muss bei Entscheidungen zur zukunftsorientierten Stadtgestaltung berücksichtigt werden.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 13: „Welche belastenden Faktoren spielen bei Ihnen eine signifikante Rolle, wenn Sie innerhalb kürzester Zeit nicht mehr mit dem Auto die für Sie gewohnten Ziele erreichen könnten?" - Zusammenstellung beider Erhebungen (eigene Darstellung 2023).
Am häufigsten wurde bei der berücksichtigten Frage angewählt, dass mit der Veränderung ein höherer Zeitaufwand verbunden ist. Diese Auffassung vertreten 85,7 % der Studienteilnehmer, welche regelmäßig das eigene Kraftfahrzeug für den Arbeitsweg gebrauchen. Verbunden mit dem Umstieg auf den ÖPNV müssen neben den bindenden Abfahrtzeiten ebenfalls Wartezeiten bei der Benutzung mehrerer Transportmittel auf dem zurückzulegenden Weg sowie eine längere Fahrtzeit durch Zwischenstationen an Haltestellen angemerkt werden. Ebenso muss ein zusätzlicher Fußweg für die Überbrückung zwischen den Transportmitteln sowie den Arbeits- und Wohnorten beachtet werden. Darüber hinaus wird der ÖPNV per se betrachtet. Durch fehlende Direktanbindungen sowie dürftig ausgebauten Anschlüssen an das Netz der öffentlichen Verkehrsmittel in ländlichen Räumen erweist sich die Nutzung des ÖPNV als problematisch und aktuell nur bedingt realisierbar. Für einen überwiegenden Anteil der Probanden kristallisiert sich hinzukommend heraus, dass eine hohe Relevanz darin liegt, die Fahrtzeit des Arbeitsweges möglichst gering zu halten (siehe Abbildung 14). Viele Berufspendler müssen generell einen recht weiten Arbeitsweg zurücklegen. Dieser ist häufig mit einem hohen Zeitaufwand verbunden. Demgemäß möchten viele der Pendelnden dies möglichst gering halten. Für 38 % der Befragten ist es von enormer Wichtigkeit, dass der Zeitaufwand möglichst gering bleibt. Für weitere 28 % ist es ebenso bedeutungsvoll, allerdings nicht derart ausschlaggebend wie den vorher genannten 38 %. 23 % haben eine neutrale Sicht auf den Zeitaufwand. Lediglich 10 % ist die Zeit beim Arbeitsweg überwiegend egal (7 %) oder sogar gänzlich irrelevant (3 %).
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 14: „ Wie wichtig ist es Ihnen, den Zeitaufwand des Arbeitsweges möglichst gering zu halten?" - Zusammenstellung beider Erhebungen (eigene Darstellung 2023).
Somit stellt der Umstieg auf den ÖPNV für einige eine ziemliche Herausforderung dar. Mit dem höheren Zeitaufwand müssen unter Umständen im sonstigen Alltag durchgeführte Tätigkeiten, beispielsweise Freizeitaktivitäten, gekürzt oder sogar weggelassen werden. Die genannten Aspekte sind von hoher Priorität bei der Durchführung der Neugestaltungsmaßnahmen. Der Bürger, der einige psychologische Hürden mit den Veränderungen verbindet, muss frühzeitig und sachlich an die Thematik herangeführt werden. Zwischen den Akteuren, welche an den Maßnahmen beteiligt sind, und den Bürgern, sollte es zukünftig zu einer stärkeren sozial-gesellschaftlichen Beziehung kommen. So können die Menschen in das Umgestaltungsgeschehen eingebunden und Alternativen aufgezeigt, negativ behaftetes Befinden beseitigt sowie das Risiko für auftretende mentale Hindernisse gesenkt werden.
6. Aufgebot an möglichen Alternativen und Perspektiven zur Umsetzung in Würzburg
6.1 Integrierbare Alternativen für den bestehenden motorisierten Individualverkehr
6.1.1 Promotion für Fahrgemeinschaften und Carsharing
6.1.1.1 Möglichkeiten und Hürden bei Fahrgemeinschaften
Die kreisfreie Stadt Würzburg steht vor einigen städtebaulichen Herausforderungen. Die städtische Verkehrsinfrastruktur ist lediglich eine von vielen Aufgaben. Dennoch lassen die notwendig durchzuführenden Anpassungsmaßnahmen, im Zuge klimapolitischer und nachhaltiger Aspekte, einen kommunikativ-informativen Gedankenaustausch und Diskurs zwischen beteiligten Akteuren und Bürgern herbeisehnen. Um den städtischen Bewohnern sowie den pendelnden Bürgern gerecht zu werden, gehören in der Planung verschiedene Möglichkeiten in Erwägung gezogen, um umfangreich Alternativen in Würzburg aufbieten zu können. Den Auswirkungen der psychischen Belastungsfaktoren sollte stets eine hohe Priorität zugeteilt werden. Die hohe Bedeutung des motorisierten Individualverkehrs bildet ebenfalls eine essentielle Komponente. Neben Alternativen, welche die Fortbewegung mit dem Privatfahrzeug exkludieren, gehören ebenso Maßnahmen im Bereich dessen zu beleuchten. Demgemäß gehören Möglichkeiten erläutert, bei denen das eigene Fahrzeug intelligent genutzt werden kann. In Aussicht steht dahingehend eine gemeinsame Nutzung von Pkw. Gezielt werden hierbei Fahrgemeinschaften sowie Carsharing als Möglichkeiten herangezogen.
Im Allgemeinen wird bei Fahrgemeinschaften von einer teilindividuellen Fortbewegungsmethode gesprochen (Holz-Rau 2018: 1578). Herangezogen wird hierbei das Privatfahrzeug einer Person. Dieses wird, zum Nutzen mehrerer, für weitere Pendler als Mitfahrgelegenheit zur Verfügung gestellt. Dies kann gänzlich im Privaten oder über Fahrgemeinschaftsvermittlungen durchgeführt werden. Wird vermehrt auf Fahrgemeinschaften zurückgegriffen, so kann dies positive Bilanzen mit sich führen, die im städtebaulichen Neugestaltungskontext von Relevanz sind. Fahrgemeinschaften erlauben den Schluss, dass weniger Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sind. Anstelle von vier Fahrzeugen, welche jeweils einzeln besetzt sind, könnte indes lediglich ein vollbesetzter Pkw unterwegs sein. Würden viele Menschen die Möglichkeit der Fahrgemeinschaft in Betracht ziehen, dann könnten Stausituationen im Berufsverkehr minimiert werden. Des Weiteren könnte eine Senkung der Feinstaubbelastung, durch geringere Abgasemissionen und wegfallenden Reifenabrieb, ein Resultat sein. Im Wesentlichen könnte sich die städtische Verkehrssituation aufgrund dessen gänzlich verändern und die Stadt den erforderlichen Zielen in puncto Nachhaltigkeit näherbringen.
Für den Nutzer von Fahrgemeinschaften kommen ebenso Vorteile auf (Heinitz 2020: 43 f.). Diese können als Motivation aufgegriffen werden, um auf die teilindividuelle Nutzung umzusteigen. Hierbei wird Anregungspotenzial betrachtet, welches sowohl den Umstieg vom alleinigen Nutzen eines Pkw betrifft als auch jenes, welches das Autofahren dem ÖPNV den Vorzug gewehrt. Im Wesentlichen kann mit Fahrgemeinschaften auf die Qualität des motorisierten Individualverkehrs zurückgegriffen werden, selbst wenn die nötigen finanziellen Mittel begrenzt sind und für die Anschaffung eines Autos oder höhere Mieten für das Wohnen in unmittelbarer Nähe zum Arbeitsplatz nicht aufgewendet werden können. Verbunden damit ist eine auffallende Aufwertung gegenüber öffentlichen Verkehrsmitteln. Meist gegen einen kleinen Aufpreis, der an den Fahrenden der Fahrgemeinschaft verrichtet wird, kann gleichwohl der Komfort eines Pkw genossen werden. Das Auto bringt eine Sitzplatzgarantie ein und inkludiert geringere Wartezeiten als bei der Nutzung des ÖPNV. Die Abfahrtszeiten werden im Voraus mit den anderen Teilnehmern der Fahrgemeinschaft abgesprochen oder die Mitfahrenden richten sich nach dem, was der Fahrende bereits festgelegt hat. Die dadurch entstehenden akzeptableren Fahrzeiten können zusätzlich eine Beförderung bis unmittelbar an den Arbeitsplatz beinhalten. Extra anfallender Fußweg, welcher bei der Nutzung des ÖPNV entstehen kann, entfällt. Vor allem in Regionen, in denen das Netz des ÖPNV aktuell noch nicht wie erwünscht ausgebaut ist, können Fahrgemeinschaften eine relevante Alternative darstellen. Zudem bilden mehr Privatsphäre und geringere soziale Interaktionen einen ausschlaggebenden Punkt. Auf eine verbesserte Bequemlichkeit kann demnach ebenfalls zurückgegriffen werden, wenn vom alleinigen Autofahren auf Fahrgemeinschaften zurückgegriffen wird. Auf dem Arbeitsweg muss lediglich der Fahrer stets die Konzentration beibehalten. Seine Mitfahrer können sich zwischenzeitlich zurücklehnen und zur Ruhe kommen. Bei Fahrgemeinschaften, bei denen sich die Teilnehmenden dazu entschließen, sich mit dem Fahren abzuwechseln, kann sich dies auf jeden gleichermaßen vorteilhaft auswirken. Ein weiterer essentieller Faktor sind die finanziellen Möglichkeiten, welche Fahrgemeinschaften begünstigen. Wird darauf zurückgegriffen, dann werden Spritkosten eingespart. Bei Fahrgemeinschaften mit vier Personen fallen präterpropter ein Viertel der eigentlichen Spritkosten im Vergleich zum alleinigen Fahren jedes einzelnen Individuums an. Zudem werden die nun geringer anfallenden Kosten auf die Beteiligten aufgeteilt. Der wirtschaftliche Aufwand wird auf die Insassen des Fahrzeuges gleichermaßen unterteilt, wodurch dieser für die jeweiligen Individuen geringer ausfällt. Ergänzend kann als positiv zusammengetragen werden, dass es für den Arbeitsweg per Fahrgemeinschaft ebenfalls eine Pauschale gibt, die jeder Mitfahrende beantragen kann (BMJ 2022: 749). Dabei handelt es sich um eine Vergütung, welche in der Steuererklärung geltend gemacht werden kann. Im Allgemeinen gilt hierbei, dass für jeden zurückgelegten Kilometer auf einfacher Wegstrecke 30 Cent erstattet werden, ab dem 21. Kilometer sogar 38 Cent. Vergütet wird lediglich der Arbeitsweg, welcher die kürzeste Distanz zwischen Wohnort und Arbeitsplatz misst. Jeder Bürger kann für seinen Arbeitsweg auf die Entfernungspauschale zurückgreifen. Dabei ist mittlerweile irrelevant, welche Fortbewegungsmethode herangezogen wird. Dementsprechend ist es ebenfalls möglich, auf diese zurückzugreifen, wird der Verkehrsweg in Fahrgemeinschaften zurückgelegt. Der einzige Unterschied zwischen Fahrer und Mitfahrer liegt in der maximal ausgezahlten Summe der Pauschale. Personen, welche mit ihrem Privatfahrzeug oder einem Dienstwagen den Arbeitsweg bestreiten, haben keine Obergrenze. Alle weiteren Verkehrsteilnehmer, irrelevant ob Mitfahrer, Nutzer des ÖPNV, Radfahrer oder Fußgänger, sind an eine Obergrenze von 4.500 € im Jahr gebunden. Die 4.500 € werden, bei 230 Arbeitstagen im Jahr, erst ab einer täglichen Entfernung von 56 Kilometern erreicht. Wer auf einfacher Wegstrecke weniger Kilometer zurücklegt oder nach Maßgabe weniger Tage im Jahr den Arbeitsplatz anfährt, hat somit keinerlei Nachteile im Vergleich zum alleinigen Fahren.
Fahrgemeinschaften sind jedoch nicht ausschließlich positiv behaftet. Es können einige Aspekte aufgelistet werden, welche das Fahren in Gruppen für einige Bürger zum Problem machen respektive sich nicht realisierbar gestalten lassen (Funke 2006: 169f.). Darunter fallen exemplarisch Beschäftigungen, bei denen auf wechselnde Einsatzstellen und Außendienste zurückgegriffen wird. Die Möglichkeit der regelmäßigen Nutzung von Fahrgemeinschaften würde sich durch unterschiedliche Ziele relativieren. Ein weiterer essentieller Faktor sind unterschiedliche Arbeitszeiten. Durch Schichtdienst kann die Beschäftigung zu unterschiedlichen Zeitpunkten am Tag beginnen und enden. Ähnliches gilt für Gleitzeit. Die variable Arbeitszeit ermöglicht den Arbeitern, flexibel mit dem Job zu beginnen und ebenso Feierabend zu machen. Durch unterschiedliche Prioritäten der Belegschaft kann es sein, dass dadurch keine Fahrgemeinschaft zustande kommen kann. Des Weiteren wird den Siedlungs- und Betriebsgrößen eine wesentliche Rolle zugesprochen. Befindet sich der Wohnort eines Mitarbeiters nicht auf dem Arbeitsweg eines Kollegen oder konträr dazu kein Wohnort eines Kollegen auf dem Arbeitsweg des Mitarbeiters, so ergibt sich in manchen Betrieben keine Möglichkeit zur Fahrgemeinschaft. Diese doch recht bedeutenden Aspekte werden von der Bevölkerung berücksichtigt und wahrgenommen (siehe Abbildung 15). Einige Bürger sind definitiv dazu gewillt auf Fahrgemeinschaften umzusteigen oder haben dies bereits getan. Wiederum sind andere zum aktuellen Zeitpunkt gänzlich abgeneigt oder zwiegespalten, was den Umgang mit der gemeinsamen Fahrzeugnutzung angeht. Zu den rein objektiven Hindernissen können darüber hinaus noch subjektiv wahrnehmbare aufgenommen werden, welche die Bürger zusätzlich daran hindern, auf Fahrgemeinschaften einzugehen (Reinkober 1994: 54f.). Grundsätzlich gibt es Tage, an denen vor oder nach der Arbeit noch anderen Verpflichtungen in der Stadt nachgegangen werden soll. Mit der Fahrgemeinschaft ist jedoch die Flexibilität nicht gegeben, da feste Abfahrtzeiten bestehen. Wollen vergleichsweise drei von vier Passagieren unmittelbar nach Feierabend die Heimfahrt antreten, ist es unwahrscheinlich, dass auf die vierte Person gewartet wird, weil diese Erledigungen zu tätigen hat. Im Allgemeinen kann für die Mitfahrenden eine Abhängigkeit entstehen. Zum einen der Druck durch die festen Abfahrtzeiten, an die sich gehalten werden muss. Zum anderen ein Stressfaktor, wenn der Fahrer spontan vor der Abfahrt ausfällt. Steht kein anderes Auto zur Verfügung, entsteht für die Mitfahrenden eine prekäre Situation. Eine spontane und kurzfristige Nutzung des ÖPNV ist nicht immer und überall möglich. Wiederum kann für den Fahrer einer Fahrgemeinschaft ein Verpflichtungsgefühl entstehen. Dies kann, im schlimmsten Fall, mit psychischen Belastungserscheinungen einhergehen. Weitergehend sind unterschiedliche Gewohnheiten abschreckend für einige Probanden. Dies kann im Grunde mit verschiedenen Prioritäten im Umgang mit dem Rauchen oder der eigenen Hygiene einhergehen sowie grundsätzlich bezüglich unterschiedlicher Musikgeschmäcker. Ist aus dem eigenen Bekanntenkreis niemand in der Lage, eine Fahrgemeinschaft zu gründen, gibt es Möglichkeiten, über Vermittlungen und Mitfahrerportale auf solche aufmerksam zu werden. Das recht lukrative Angebot, über Online-Plattformen und Applikationen fündig zu werden, hat aktuell ein Kriterium, welches einen Teil der Bürger abschreckt. Wird über diese Möglichkeit eine Fahrgemeinschaft gefunden, ist ungewiss, wer an dieser teilnimmt. Die Angst vor unbekannten Mitfahrern kann zukünftig über Bewertungen und Profilangaben restringiert werden.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 15: „Könnten Sie sich vorstellen, permanente Fahrgemeinschaften zu gründen, um entsprechend nachhaltiger im Verkehr zu agieren?" - Vergleich zwischen Würzburg und dem gesamten Umfang der Umfrage (eigene Darstellung 2023).
Zusammenfassend können Fahrgemeinschaften als Alternative einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Verkehrssituation in Städten beitragen. Durch einige Hemmnisse eröffnet sich diese Möglichkeit nicht für jeden. Mithilfe von Vermittlungen und Mitfahrportalen kann das Ganze zukünftig einflussreich ausgeweitet werden. Für Würzburg gilt daher, mithilfe von vorzugsweise Applikationen, stärker auf Fahrgemeinschaften aufmerksam zu machen und diese dadurch zu bewerben. Insofern könnte sich die Verkehrslage in der stark befahrenen Stadt wahrnehmbar reduzieren. Der Umgang mit solchen Mitfahrportalen ist noch relativ neu. Ein Ansatz dahingehend kann Würzburg allerdings schon aufweisen (Landkreis Würzburg 2022). Seit dem 28. Juni 2022 läuft das Mitfahrportal MAX an, welches aus einem Verbund von vier Partnern entstanden ist. Neben der Stadt Würzburg beteiligen sich der Bezirk Unterfranken, der katholische Frauenorden Kongregation der Schwestern des Erlösers sowie der Landkreis Würzburg an der Umsetzung. Mit der Unterstützung des Portals soll künftig die Fahrgemeinschaft als Alternative in der kreisfreien Stadt sowie dem Kragenkreis Würzburg verstärkt propagiert werden, damit mehr Bürger darauf zurückgreifen können. In der ersten Phase waren lediglich die vier Verbundpartner an der Realisierung beteiligt. Mit steigender Akzeptanz konnte bewirkt werden, dass ab der zweiten Phase, im Frühjahr 2023, weitere Unternehmen in Würzburg eingespannt werden konnten. Mit MAX liegt ein sehr interessanter Ansatz vor, welcher zukünftig eine fundamentale Rolle im Umgang mit dem motorisierten Individualverkehr in Würzburg einnehmen könnte.
6.1.1.2 Carsharing - Die Alternative der schnelllebigen Vermietung
Teilindividuelle Fortbewegungsmöglichkeiten werden intensiv betrachtet. Mit Fahrgemeinschaften wurde eine Alternative aufgegriffen, welche die städtische Verkehrsinfrastruktur nachhaltig entlasten könnte. Eine weitere Variante, welche der Kategorie teilindividuell zugeordnet werden kann, ist das Carsharing (Holz-Rau 2018: 1578). Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die gemeinsame Nutzung von Fahrzeugen. Differenziert wird zwischen privatem und öffentlichem Carsharing. Bei der privaten Option wird sich im gewohnten Umfeld eines Individuums ein Fahrzeug mit anderen Personen geteilt. Zum Exempel kann mit dem Nachbarn, der sein Auto nur sporadisch verwendet, beschlossen werden, dessen Auto gemeinsam zu nutzen und auf ein zusätzliches eigenes Fahrzeug zu verzichten. Im Zentrum des Carsharing steht jedoch die öffentliche Alternative über Mobilitätsdienstleister. Ähnlich wie bei E-Tretrollerleihsystemen werden über Unternehmen Fahrzeuge zum Benutzen angeboten. Dabei werden zwei verschiedene Systeme inkludiert. Bei der ersten Variante ist das angebotene Carsharing-Fahrzeug an den Standort gebunden. Wird das Fahrzeug von Bürgern verwendet, muss es zum Ende des Benutzungszeitraumes wieder am Standort der Abholung oder an einem extra dafür festgelegten Parkplatz abgestellt werden. Die zweite Option ist unter der Bezeichnung free-floating gängig (Kopp 2015: 22). Im übertragenen Sinne bedeutet dies frei herumschwebend. Die bereitgestellten Fahrzeuge sind hierbei an keinen festen Standort gebunden. Definiert wird ein Bereich, in welchem die Autos frei verwendet werden dürfen. Dies eignet sich vorzugsweise für die Überbrückung zweier nah beieinander gelegener Agglomerationsräume oder eine individuelle Verbindung zwischen Stadtzentrum und Flughafen. Um die bereitgestellten Fahrzeuge in Anspruch nehmen zu können, muss sich bei den jeweiligen Unternehmen registriert respektive eine Mitgliedschaft abgeschlossen werden (siehe Abbildung 16). Das Konzept Carsharing kann sich mittlerweile in der Gesellschaft etablieren. Innerhalb der letzten zehn Jahre ist die Anzahl der Registrierungen von präterpropter 450.000 auf inzwischen fast 4,5 Millionen angewachsen. Alleine vom 01.01.2022 auf den 01.01.2023 konnte ein Anstieg von über einer Million verzeichnet werden. Auf deren Grundlage haben die Unternehmen, welche in der Bundesrepublik die Fahrzeuge anbieten, in den letzten Jahren die Verfügbarkeit erhöht. In ganz Deutschland kann gegenwärtig auf circa 34.000 Carsharing-Fahrzeuge in 1.082 verschiedenen Städten und Kommunen zurückgegriffen werden (BCS 2023).
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 16: Marktentwicklung des öffentlichen Carsharing in Deutschland seit 2012 (eigene Darstellung 2023 basierend auf BCS 2023).
Die Beweggründe zur Nutzung von Carsharing-Möglichkeiten sind ähnlich wie jene der Fahrgemeinschaften. Eine der Hauptkomponenten ist das finanzielle Potenzial (Witzke 2015: 9). Dadurch, dass kein eigenes Fahrzeug im Besitz ist, können etliche Kosten eingespart werden. Zwar kostet die Nutzung von Carsharing-Pkw ebenfalls Geld, neben den Kosten für das Abonnement wird dies jedoch lediglich an der Entfernung bemessen und fällt nicht an, wenn nicht darauf zurückgegriffen wird. Hinzukommend entfällt zusätzlicher
Aufwand im Umgang mit dem Fahrzeug. Die nötige Pflege eines privaten Pkw sowie regelmäßige Wartungen entfallen gänzlich. Dies ist ergänzend mit einer Zeitersparnis verbunden. Das Carsharing ermöglicht dem Bürger, bei ausreichendem Angebot, ohne eigenes Auto mobil und flexibel zu bleiben. Im Gegenzug werden überwiegend Hemmnisse zur Nutzung von Bürgern erwähnt, die noch nie auf das Carsharing zurückgegriffen haben und den eigenen Pkw bevorzugen (Gerike et al. 2016: 57ff.). Die Abneigung ist auf die Gewohnheiten und den vorhandenen Standard respektive Wohlstand eines Individuums zurückzuführen. Wesentliche Aspekte sind die Unabhängigkeit, die vorhandene Flexibilität sowie die Fahrfreude mit dem eigenen Fahrzeug, die als ablehnende Begründungen aufgegriffen werden. Aus objektiver Perspektive von Carsharing-Nutzern bildet die Verfügbarkeit eine fundamentale Schwäche. Die Summe der angebotenen Autos steigt seit einigen Jahren stetig an, um diesem Konflikt entgegenzuwirken.
Im Allgemeinen ist das Carsharing eine Alternative, welche stetig an Ansehen dazugewinnt. Mittlerweile wird versucht, diese Option ebenso in Würzburg und dessen Umgebung auszubauen. Für die Stadt Würzburg gibt es explizit das Unternehmen Scouter (WVV o. J.). Dieses stellt im gesamten Gemarkungsbereich der kreisfreien Stadt Fahrzeuge zur Verfügung. Gegenwärtig sind dies 79 Pkw an 43 Standorten. Um die Nutzung der Carsharing-Autos zu fördern, befindet sich Scouter in einem Kooperationsverhältnis mit der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV). Gemeinsam mit der Stadt Würzburg ist die WVV Teilhaber an der Würzburger Straßenbahn GmbH (WSB). Diese ist für das vollständige Liniennetz des Bus- und Straßenbahnverkehrs in der kreisfreien Stadt zuständig. Bei der Kooperation wird jedem Abo-Kunden der WVV eine Sonderkondition angeboten. Die monatlichen Kosten für das Abonnement sowie für die einmalige Aktivierung des Accounts entfallen gänzlich. Eine weitere Carsharing-Alternative stellt der Autohändler Rumpel & Stark aus Unterpleichfeld zur Verfügung (APG o. J.). Aktuell werden von dem Autohaus drei Fahrzeuge im Landkreis Würzburg angeboten. Eines in Rottendorf sowie zwei in Gerbrunn. Das Unternehmen hat ebenfalls ein Kooperationsverhältnis, und zwar mit dem Kommunalunternehmen APG. Dieses koordiniert ganzheitlich den Busverkehr im Landkreis Würzburg. Die Konditionen, welche hierbei angeboten werden, gleichen jenen der WVV für die Stadt. Jeder Abo-Kunde des APG kann, nach erfolgreicher Registrierung, ohne jegliche Zusatzkosten wie monatliche Abgaben für das Abonnement, auf die Fahrzeuge zugreifen. Das aktuell vorliegende System rund um Fahrgemeinschaften und Carsharing bietet in Würzburg Potenzial für eine kommende nachhaltige Entwicklung.
6.1.2 High-occupancy vehicle lane
Fahrgemeinschaften und Carsharing sind liberale Formen des Umgangs mit dem Individualverkehr. Die Bürger werden in ihren Grundrechten nicht eingeschränkt und haben weiterhin die Wahl, wie sie mobil sein möchten. Um die Nutzung von Fahrgemeinschaften zu untermauern, können planerische und infrastrukturelle Maßnahmen in Betracht gezogen werden. In diesem Kontext wird die Option betrachtet, Fahrgemeinschaftsspuren in den Straßenverlauf zu integrieren (Vejnik 2016: 170). Ähnlich wie bei Busspuren handelt es sich bei den sogenannten High-occupancy vehicle lanes (HOV-lanes) um Fahrspuren, welche gesondert für Fahrgemeinschaften vorgesehen sind. Generell ist das Befahren der Fahrgemeinschaftsspuren für jene Pkw erlaubt, welche mehrfach besetzt sind. Wie viele Personen mindestens im Fahrzeug sein müssen, kann variieren. Es werden Carpool lanes eingebunden, auf denen sich lediglich zwei Personen im Auto befinden müssen, um die Fahrspuren entsprechend nutzen zu können. Wiederum müssen andere HOV-lanes mindestens vier Insassen aufweisen. Benutzen dürfen diese zusätzlich Busse des ÖPNV sowie der Notdienst auf Einsatzfahrten. Für diese ist das Befahren der separierten Fahrspuren ebenfalls möglich, sollten die jeweiligen Fahrzeuge vorübergehend einfach besetzt sein. Das Konzept für die Carpool lanes bildete sich in Nordamerika heraus. Die erste Variante entstand bereits 1973 auf dem Shirley Highway im Norden Virginias (Southworth und Westbrook 1986: 37). Diese ging aus einer 1969 entstandenen Busspur hervor, um den Berufsverkehr zu entlasten. In Deutschland existieren zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Fahrgemeinschaftsspuren. Das gesamte Konzept wird in Europa noch kritisch und vorsichtig betrachtet. Erste Annäherungen wurden bereits Mitte der 1990er in den Niederlanden vergeblich erprobt (Bogenberger und Schönhofer 2022: 5). Im späteren Verlauf der Dekade wurden weitere Möglichkeiten in Trondheim und Madrid begutachtet. Da dort erfolgreich erste HOV-lanes eingebunden werden konnten, weiteten sich die vorgenommenen Projekte zum Ende der 2000er auf weitere Teile Norwegens sowie Belgien und Portugal aus. Die aus den Projekten gezogene Wichtigkeit von Fahrgemeinschaftsspuren wird überwiegend als gering betrachtet. Im Vergleich zu den Varianten in den USA wurden die in Europa eingebrachten Carpool lanes überwiegend auf kürzeren Streckenabschnitten getestet. Auf ausgedehnten Teilstücken können die gesonderten Fahrspuren eine deutlich höhere Effizienz aufweisen. Diese sind, in Anbetracht der überwiegenden Verkehrsinfrastruktur in den USA, dort deutlich einfacher und individueller integrierbar.
Fahrgemeinschaftsspuren sollen städtische Verkehrsinfrastrukturen nachhaltig und bewusst lenken. Einerseits sind durch HOV-lanes bessere Anbindungsmöglichkeiten für den ÖPNV einzubringen. Im Kontext des Individualverkehrs sollen sie wiederum bewirken, dass bei Bürgern das Interesse geweckt wird, auf Fahrgemeinschaften umzusteigen (Vejnik 2016: 170f.). Die Bedeutung der Carpool lanes liegt darin, ebenso wie bei Fahrgemeinschaften per se, dass durch weniger Fahrzeuge Emissionen, Lärm und Stauaufkommen zu den verkehrsbedingten Stoßzeiten reduziert werden können. Bei dennoch aufkommenden Stausituationen wird der Nutzer einer Fahrgemeinschaft oder des straßengebundenen ÖPNV sogar belohnt. Die HOV-lanes haben den Vorteil, dass bei hoher Verkehrsbelastung die Fahrspur weniger befahren wird als die regulären Fahrstreifen. Theoretisch können dadurch Stausituationen umfahren und Zeit eingespart werden. Längerfristig könnten hierbei noch mehr Pendler darauf aufmerksam werden, wodurch bei diesen ebenfalls das Interesse an Fahrgemeinschaften geweckt wird. Eine Kettenreaktion zum Gedanken des Umstiegs auf eine gemeinsame Nutzung des Fahrzeugs könnte entstehen.
Bevor HOV-lanes eingebunden werden, müssen die möglichen Streckenabschnitte evaluiert werden. Das Komplizierte an den Fahrgemeinschaftsspuren ist, dass sich diese definitiv nicht überall einbinden lassen. Für die Nutzung der gesonderten Fahrstreifen ist von essentieller Bedeutung, dass sich der Verkehr aus einer überwiegenden Mehrheit ergibt, welche dasselbe großräumige Ziel regelmäßig anstreben. Diese Verkehrsteilnehmer könnten langfristig auf Fahrgemeinschaften umsteigen und die Chance der schnelleren Fortbewegung nutzen. Vorsicht ist allerdings bei starkem Durchgangsverkehr geboten. Straßen, auf denen eine Vielzahl an Fahrzeugen unterwegs sind, welche nicht regelmäßig das betrachtete Zentrum ansteuern oder gar nur sehr sporadisch und selten, eignen sich keineswegs für HOV-lanes. Wird zum Exempel die A 3 in der Umgebung Würzburgs betrachtet, könnte eine dort eingebundene Carpool lane verheerende Folgen mit sich führen. Auf der A 3 herrscht ein hohes Aufkommen an Verkehrsteilnehmern, welche Fahrtziele jenseits von Würzburg ansteuern. Einige Fahrzeuge, darunter Langstreckenpendler, haben größtenteils nicht die Möglichkeit, auf ihrem Fahrweg auf eine Fahrgemeinschaft umzusteigen. Kommt es dann, nach der Umnutzung einer Fahrspur zu einer HOV-lane, zu einem Stau, dann könnte sich die Stausituation exzessiv auf der Autobahn ausdehnen. Grundsätzlich müssten die Verkehrsteilnehmer, welche sich ursprünglich über drei oder gar vier Fahrspuren gestaut haben, nunmehr auf einem Fahrstreifen weniger zurechtfinden. Der eigentliche effektive Nutzen der Fahrgemeinschaftsspur wird durch einen offensichtlich erhöhten
Energie- und Zeitaufwand der restlichen Verkehrsteilnehmer gehemmt. Im Gegenzug hätten HOV-lanes beispielsweise auf Stadtautobahnen von Großstädten und Metropolen eine Möglichkeit, effektiv eingebunden zu werden.
Im Allgemeinen muss abgewogen werden, ob sich Fahrgemeinschaftsspuren in Würzburg lohnen respektive ob sich diese nachhaltig und staumindernd einbinden lassen könnten. Wie erwähnt fallen die ortsnahen Autobahnabschnitte der A 3 sowie der A 7 weg. Ähnlich muss dies auf der Passage der B 19 gehandhabt werden, welche die kreisfreie Stadt Würzburg durchzieht. Da diese, neben dem Berufsverkehr, ebenfalls einen Anteil an Durchgangsverkehr aufweist, könnte eine HOV-lane eher belastende Auswirkungen haben. Weitere großflächige Möglichkeiten sind in Würzburg dahingehend praktisch nicht vorhanden (Interview P. Wiegand 10/2023; 7). Es könnte über kleinräumige Einbindungen dessen im städtischen Raum diskutiert werden. Ob diese jedoch die gewünschte Effizienz mit sich führen könnten, sei dahingestellt. Die auf der Höchberger Straße eingebundene Busspur wäre offenkundig zu kurz, um diese zu einer HOV-lane umzufunktionieren. Da diese für Bus- und Fahrradverkehr zur Verfügung gestellt wird, wird dieser ohnehin eine verkehrsinfrastrukturelle Maßnahme mit essentieller Bedeutung zuteil. Ein zweiter Straßenverlauf, über den für die Gestaltung einer Fahrgemeinschaftsspur objektiv nachgedacht werden kann, ist der westliche Abschnitt des inneren Rings. Im Wesentlichen betrifft dies die Straßenführung der B 8 zwischen dem Berliner Platz und der Friedensbrücke. Eine HOV-lane auf dem stark frequentierten Streckenabschnitt hätte das Potenzial, dass durch die infrastrukturellen Maßnahmen das Randgebiet der Würzburger Altstadt entlastet werden könnte. Mit dem Würzburger Hauptbahnhof, einer Anbindung an das städtische Schienennetz und dem Busbahnhof befindet sich ein essentieller Knotenpunkt öffentlicher Verkehrsmittel im genannten Bereich. Eine Carpool lane könnte eine bessere Frequentierung des straßengebundenen ÖPNV garantieren. Jedoch ist eine Umsetzung dessen umstritten (Interview M. Weber 10/2023; 7). Für die Umgestaltung müssen Platzressourcen aufgewendet werden, was dem eigentlichen städtischen Vorhaben der nachhaltigen Gestaltung widersprechen würde. Teure Umbaumaßnahmen und eventuell zusätzlich versiegelte Flächen stehen dem Vorhaben im Weg. Aus Perspektive der Politik würde gemeinhin eine andere Debatte zu einem Ausschluss der Umsetzung führen (Interview P. Wiegand 10/2023; 7). In Anbetracht der angestrebten Ziele soll erreicht werden, dass mehr Menschen in der Stadt auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen. Mit den Umbaumaßnahmen zu einer HOV- lane würden zusätzliche Kosten für die Errichtung einer Alternative für den Individualverkehr am Rande des Stadtzentrums aufgewendet werden. Das würde das eigentliche Vorhaben, die Innenstadt autofreier zu gestalten, zwar nicht komplett verfehlen, allerdings deutlich geringer voranbringen als andere Möglichkeiten. Selbst die Realisierung einer möglichen Busspur auf dem untersuchten Streckenabschnitt wird als problematisch angesehen (Interview U. Kömpel 10/2023; 7).
Prinzipiell ist davon auszugehen, dass die Fahrgemeinschaftsspuren kein Durchsetzungsvermögen in der kreisfreien Stadt Würzburg haben. Das Prinzip, Fahrgemeinschaften notwendigerweise einzubinden, sollte allerdings bestehen bleiben (Interview P. Wiegand 10/2023; 7). Diese Möglichkeit kann ebenfalls anderweitig herbeigeführt werden. Die Altstadt respektive der Bischofshut sollte zukünftig möglichst geringfügig befahren sein. Um dies zu erwirken, könnte eine Alternative in Betracht gezogen werden, welche bereits in anderen Großstädten weltweit beobachtet werden kann (Mackie 2005: 288f.). Gemeint ist eine Art der Innenstadtmaut. Zum Exempel wird in London eine solche City-Maut erhoben. Bis 2006 war diese die größte Stadt, welche eine solche verpflichtend machte. Mithilfe dieser konnte bezweckt werden, dass Privatfahrzeuge Parkflächen am Stadtrand anfahren und dort auf Fahrgemeinschaften umsteigen. Die Maut wird nämlich lediglich pro Auto und nicht je Person erhoben. Somit sparen sich die Bürger, welche in die Erhebungszonen pendeln, erhebliche Kosten, wenn sie von außerhalb der Stadt die Fahrgemeinschaften einbinden. Ähnlich könnte dies ebenso im Würzburger Bischofshut gehandhabt werden (Interview P. Wiegand 10/2023; 7). Anstatt den Verkehr komplett aus der Altstadt zu verbannen, könnte mithilfe der Innenstadtmaut bezweckt werden, dass diese exklusiv in Fahrgemeinschaften angesteuert werden kann. Als Vorschlag dient dahingehend die Möglichkeit, dass die Maut lediglich verrichtet werden müsse, wenn Fahrzeuge einzeln besetzt sind, ausgenommen der straßengebundene ÖPNV und der Notdienst. Die Einnahmen könnten langfristig für weitere infrastrukturelle Maßnahmen aufgewendet werden. Vorrangig steht dabei der ÖPNV im Fokus, um diesen sachgemäß zu stärken und auszubauen.
6.1.3 E-Zonen
Das Einführen einer Innenstadtmaut würde sich grundsätzlich von den anderen Maßnahmen unterscheiden, bei denen Aufwertungen vorgesehen sind. Während die Charakteristika der Förderung von Fahrgemeinschaften und Carsharing liberal gekennzeichnet sind, würde mit der Maut eine verbindliche Einschränkung eingebunden werden. Prinzipiell konnte sich diese in anderen europäischen Städten, wie bei dem Exempel in London, bereits etablieren. Die erhobenen Gebühren werden nicht einfach von der Stadt eingestrichen, sondern werden maßgeblich der städtischen Entwicklung zugeordnet. Allerdings werden aktuell in der Bundesrepublik Deutschland Umweltzonen bevorzugt (BMUV o. J.). Hierbei werden Fahrzeuge, je nach der Intensität ihrer Emissionen, auf bestimmte Schadstoffgruppen aufgeteilt, um die Feinstaubbelastung in den Städten zu senken. In einigen Großstädten werden, in Abstimmung mit den erstellten Gruppen, die Umweltzonen in den Zentren eingerichtet. Diese dürfen dann nur von Fahrzeugen durchquert werden, welche eine der entsprechenden Schadstoffkategorien aufweisen können. Während bei der Innenstadtmaut Gebühren für definierte Fahrzeuge verrichtet werden müssen, fällt diese bei Umweltzonen nicht an. Jedoch werden bei diesen jene Kategorien, welche die festgelegten Anforderungen nicht erfüllen können, gänzlich aus den definierten Bereichen verbannt.
Im Kontext der fortschreitenden Entwicklung können mittlerweile CO2-neutrale Alternativen näher aufgegriffen werden. Unter anderem sollen Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge stärker eingebunden werden, um die Emissionen noch deutlicher zu reduzieren. In Anbetracht des Fortschrittes kann derweil über E-Zonen debattiert werden. Dabei handelt es sich um Passagen in der Stadt, welche nur von Elektrofahrzeugen respektive CO2- neutralen Verkehrsteilnehmern befahren werden dürfen. Der Tenor dessen wäre, dass einige Anwohner und Pendler, welche das Auto lediglich für überschaubare Distanzen verwenden, über einen Umstieg auf die ökologisch-nachhaltigere Version des Individualverkehrs nachdenken. Im Wesentlichen fallen im Gebrauch des Elektrofahrzeuges keine Emissionen an. Die Schadstoffbilanzen der Innenstädte könnten dadurch wahrnehmbar gesenkt werden. Darüber hinaus ist ein Elektromobil leiser. Somit würde sich eine höhere Anzahl dieser im Straßenverkehr ebenfalls positiv auf die städtische Geräuschkulisse auswirken. Dennoch wird das Elektroauto kritisch beurteilt. Der gesellschaftliche Druck einer raschen Entwicklung und die Gefahr der Einschränkung durch das Gewohnheitstier lassen dazu hinreißen, die negativen Aspekte des Elektromobils in den Fokus zu rücken. Fundamental geht es dabei vor allem um den Abbau des Lithiums für den Akkumulator sowie die Emissionen bei dessen Produktion. Wird die Herstellung eines solchen Akkus betrachtet, dann wird dies häufig mit hohen Emissionen verbunden. Dem war gewiss in den Anfangszügen der Produktion so. Mittlerweile, nach mehreren Jahren der Forschung und Entwicklung, wurde allerdings ein neuer Level in der Herstellung erreicht (Wietschel 2020: 8).
Die Annahme, dass bei der Produktion des Akkus für das Elektromobil CO2-Emissionen freigesetzt werden, welche enorm hoch sind und dem Ausstoß eines dieselbetriebenen Motors auf mehreren hunderttausend Kilometern gleichgesetzt werden kann, wurde falsifiziert. Die Herstellung funktioniert derweilen immer noch nicht CO2-neutral, ist allerdings spürbar nachhaltiger, als es in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Bereits im Jahr 2020 wurde der Amortisationspunkt für die Produktion des E-Auto-Akkumulators gegenüber dem Diesel-Motor auf ein Intervall zwischen 55.000 bis präterpropter 114.000 Kilometer bemessen. Im Verhältnis zum Benziner ist diese Spanne nochmals niedriger anzusetzen. Hierfür wurden circa 51.000 bis 105.000 Kilometer errechnet. Die große Spanne ist auf die unterschiedliche Nutzung des Pkw zurückzuführen. Im städtischen Berufsverkehr ist mit deutlich höheren Emissionen zu rechnen als auf Fernstraßen. In Bezug auf die Nachhaltigkeit in Städten tendiert daher das Elektroauto schon bei einer niedrigeren Distanz, den Emissionswert der kraftstoffbetriebenen Fahrzeuge zu unterschreiten. Anders geht die Betrachtung des Lithiumabbaus einher. In einigen Staaten gibt es noch nahezu unberührte Lithiumlagerstätten. Vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern, wie beispielsweise Bolivien oder Chile, wird der Abbau exzessiv gefördert (Haidacher 2019: 24ff.). Die dabei entstehenden Situationen können mit denen der Industrialisierung in Europa verglichen werden. Der Lithiumabbau bietet einen großen Reichtum. Der überwiegende Anteil der dort sesshaften und arbeitenden Bevölkerung lebt dennoch in großer Armut. Die Vorkehrungen rund um den Abbau sind äußerst dürftig. Soziale Ungleichheiten, Kinderarbeit oder miserable Arbeitsschutzmaßnahmen kennzeichnen den dortigen Alltag. Grund für diese Umstände ist, dass es gegenwärtig noch keine festgelegten Mindeststandards gibt. Im Vergleich dazu sind beispielsweise Gold- und Silberabbau an Qualitätsvorgaben geknüpft, wodurch solche menschenunwürdigen Verhältnisse nicht mehr zustande kommen können. Ähnliche Bedingungen sollen zukünftig ebenfalls unbedingt beim Lithiumabbau greifen.
Wird die kurze Entwicklungsphase der E-Mobilität berücksichtigt, können objektiv erkennbare Fortschritte wahrgenommen werden. Sowohl die Elektro- sowie Brennstoffzellenfahrzeuge könnten sich, wenn der Entwicklung Zeit gegeben wird, einen essentiellen Bestandteil der zukünftigen Fortbewegung ausmachen. Eventuell kann der Umfang der CO2-neutralen Alternativen im motorisierten Individualverkehr sogar noch weiter expandieren. Einen aktuellen Umstieg auf E-Autos zu erzwingen, wäre jedoch fatal. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Entwicklung der E-Mobilität noch im vollen Gange. Das bedeutet, dass dieses ebenso langsam an den Bürger herangeführt werden muss, wie die städtischen Veränderungsmaßnahmen. Damit der Mensch mit den kommenden Veränderungen nicht plötzlich und frontal konfrontiert wird, sondern schrittweise und mit Aufklärung verbunden. Im Weiteren muss die Preisgestaltung rund um E-Auto und Umstieg betrachtet werden. Qualität hat ihren Preis. Folglich ist bei dem Erwerb eines Elektrofahrzeuges mit hohen Kosten zu rechnen. Obendrein kommen möglicherweise die Beschaffungsund Installationskosten für Ladestationen dazu. Nicht jeder Bürger kann sich diesen Wechsel leisten. Ergo macht die Abwägung von E-Zonen in Innenstädten daher weniger Sinn. Elektrozonen könnten die Altstadt zwar äußerst nachhaltig prägen, würden jedoch enorme Einschränkungen mit sich führen, die wiederum als Hürde die Psyche des Bürgers beeinträchtigen könnten. Andererseits wäre es verloren gegangenes Potenzial, die Elektromobilität als Thematik in der Würzburger Altstadt gänzlich auszuschließen. Es könnte erneut die bereits erläuterte Innenstadtmaut aufgegriffen werden. Neben den mehrfach besetzten Fahrzeugen könnten zusätzlich CO2-neutrale Pkw eingebunden werden, welche in dem Bereich, in dem Mautgebühren verrichtet werden müssen, kostenfrei queren dürfen. Als Vorbild kann dahingehend die Zona a Traffico Limitato (ZTL) in Palermo dienen (siehe Abbildung 17). In dieser gilt, dass für jedes Fahrzeug, egal ob von Lieferverkehr, Anwohner oder Tourist, eine Gebühr für das eingegrenzte Gebiet verrichtet werden muss (Palermo Mobilità Sostenibile o.J.). Ausgenommen sind neben dem ÖPNV und dem Notdienst Motorräder sowie Elektrofahrzeuge. Alle E-Autos dürfen kostenfrei durch die ZTL fahren. Dies würde eine Option bieten, wie es im Würzburg integriert werden könnte. Eine Innenstadtmaut, bei welcher neben ÖPNV und Notdienst zusätzlich mehrfach besetzte- und Elektrofahrzeuge von den zu verrichtenden Gebühren befreit wären.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 17: Beginn der ZTL in der Via Santa Teresa an der Südseite der Kirche Santa Teresa alla Kalsa in Palermo (eigene Darstellung 2021).
6.1.4 Infrastrukturelle Anpassungen und Aufwertungen - Intelligente Gestaltung von Parkhäusern und -garagen
6.1.4.1 Neugestaltungsthematik der Talavera
Im Kontext der Neugestaltung scheint wohl die wesentlichste Thematik für den Nutzer des motorisierten Individualverkehrs der Umgang mit den Parkplätzen zu sein. Mit dem Ansatz, dass das Oberflächenparken gänzlich aus dem Bischofshut verdrängt werden soll, fallen einige zentrale Parkplatzmöglichkeiten weg (Interview P. Wiegand 10/2023; 6). Eine prekäre Situation, sollten nicht genügend Alternativen an anderweitigen Standorten angeboten werden. Mit dem Abriss des sanierungsbedürftigen Quellenbach-Parkhauses sowie dem Bau einer moderneren und größeren Parkgarage wurden schon erste Schritte zur Gestaltung neuer und aufgewerteter Parkplätze getätigt. Mit der Talavera gibt es in Würzburg einen weiteren Parkplatz mit enormer Bedeutung. Der großflächige Oberflächenparkplatz befindet sich im Würzburger Stadtteil Zellerau. Dieser liegt in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt und bietet viele kostenfreie Stellplätze. Folglich wird dieser von den Anwohnern der näheren Umgebung sowie von Pendlern und Touristen angefahren und genutzt. 2022 sollte beschlossen werden, dass dieser kostenpflichtig wird. Im Zuge eines Bürgerentscheids konnte dies jedoch unterbunden werden (Stadt Würzburg 2022). Mit 76,02 % stimmte eine absolute Mehrheit dafür ab, dass der großflächige Oberflächenparkplatz für alle Bürger kostenfrei bleiben sollte. Für dieses doch sehr handfeste Ergebnis gibt es eindeutige Gründe. Die geplante Veränderung wirkt sich belastend auf den Menschen und dessen Angewohnheit, den Parkplatz ohne jegliche Kosten anzufahren, aus. Es wird damit eine Einschränkung der eigenen Freiheit verbunden. Viele der Bürger würden damit einen Betrug verbinden und sich ausgenutzt fühlen. Dies wiederum ist auf die Qualität des Parkplatzes zurückzuführen (Interview P. Wiegand 10/2023; 8f.). Der Zustand des Parkplatzes ist für eine Bewirtschaftung schlichtweg zu dürftig. Auf dem gesamten Gelände sind keine Toiletten oder Wickelstationen vorhanden. Des Weiteren bietet dieser nicht die nötige Sicherheit. Da er zudem nicht ausschließlich asphaltiert ist, sondern teilweise aus einer Schotterfläche besteht, sind einige grundlegende Standards Mangelware. Diese Argumente konnten von Bürgerinitiativen genutzt werden, um das planerische Vorhaben zu unterbinden.
Im Grunde kann dabei von einem Kommunikationsproblem gesprochen werden. Kommunikation zwischen den Akteuren und den Bürgern ist die essentielle Grundlage für ein gesundes Miteinander. Es wurde zwar erläutert, dass mit den Kosten ein Ticket für den innerstädtischen ÖPNV integriert wird, Aussichten für Aufwertungsmaßnahmen des Parkplatzes per se wurden indes nicht gestellt (Interview P. Wiegand 10/2023; 8f.). Dem Bürger muss etwas angeboten werden. Er muss einen sinnvollen Nutzen in dem investierten Geld sehen, um der Bewirtschaftung Zustimmung geben zu können. Mit der geeigneten Kommunikation kann immer noch nicht jeder Bürger erreicht werden. Der Anteil jener, welche dem Vorhaben positiver entgegentreten würden, wäre allerdings auffallend höher (siehe Abbildung 18). Von den beteiligten Personen an der Umfrage in Würzburg, welche im Voraus grundlegend gegen eine gebührenpflichtige Talavera waren, waren 39 % ebenso abgeneigt, nachdem diesen erläutert wurde, welche planerischen Maßnahmen an der Talavera dadurch hätten realisiert werden können. Die Meinung der restlichen 61 % zum kostenpflichtigen Parkplatz hat sich durch die Kommunikation während der Erhebung gewandelt. 39 % der Teilnehmenden waren positiver dazu gestimmt. Teilweise mit noch einigen kleinen Bedenken, durch die entstandene Bindung und die Nähe zum Projekt jedoch mit wahrnehmbar mehr Akzeptanz verbunden. Die restlichen 22 % waren sogar gänzlich positiv gestimmt, da diese nun Klarheit über einen definierten Nutzen der Gebühren bekommen haben.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 18: „ Wie hätten Sie dieses Mal, mit der erlangten Information von geplanten Umgestaltungsmaßnahmen, zu möglichen Kosten des Parkplatzes abgestimmt?" - Ergebnis aus der Würzburger Umfrage (eigene Darstellung 2023).
Mittlerweile wird die Talavera nicht mehr als Stadtentwicklungsfläche betrachtet (Interview P. Wiegand 10/2023; 8). Der großflächige Platz soll nun eine Verfügungsfläche bleiben und größeren Events wie dem Kiliani-Volksfest dienen. Schrittweise soll diese saniert werden. Die vorhandenen Schotterflächen sollen in näherer Zukunft etappenweise asphaltiert werden. Aufwertungsmaßnahmen im Sinne der nachhaltigen Stadtgestaltung sind vorerst nicht mehr vorgesehen. Ein Unterfangen, mit dem sich die Stadt nicht zufriedengeben sollte. Die Freifläche ist groß und bietet viel Potenzial. Im Projekt „Talavera 2023: Ein Stadtteil entsteht“ haben sich die Studierenden der Geovisualisierung an der THWS möglichen Umgestaltungen angenommen. Dabei kamen einige Entwürfe zusammen, deren Gestaltungsvielfalt anregend für infrastrukturelle Maßnahmen sein könnten. Die Konzepte fallen zudem sehr unterschiedlich aus. Beispielsweise wird eine Talavera vorgeschlagen, welche keine Parkplätze mehr integriert (siehe Abbildung 19). Hierbei werden verschiedene Faktoren berücksichtigt. Zum einen soll der Platz als Erholungsraum eingebunden werden. Den Bürgern der näheren Umgebung wird ein Ruheort geboten. Dabei werden in der Oberflächengestaltung Liegewiesen und künstlich angelegte Teiche mit einem Bachlauf integriert. Zur nachhaltigen Gestaltung werden überdies Bäume sowie eine Wildblumenwiese als Vorschlag eingebracht. Allgemein soll dadurch der Stresslevel der Bewohner gesenkt werden. Der zweite Aspekt bindet Spiel und Sport für jegliche Altersgruppen ein. Für Kinder wäre ein Spielplatz mit Wasserspielen vorgesehen, während für die ältere Gesellschaft Fitnessgeräte eingebunden werden sollen. Zudem sollen Multifunktionsplätze, auf denen verschiedenen Ballsportarten nachgegangen werden kann, sowie ein Outdoor-Gymnastikplatz eingebunden werden. Der dritte Bezugspunkt bringt Events sowie Informationsmöglichkeiten einher. Dabei wären Infotafeln zur eingebundenen Flora, möglichen Praktiken rund um Meditationen und Yoga sowie Informationen zur Auswirkung auf die eigene Gesundheit vorgesehen. Eine Freilichtbühne sowie der kulturelle Biergarten am Schlösschen sollen den Platz zusätzlich aufwerten. Im Gesamtkonzept erinnert der Entwurf, durch seine Asymmetrie und den Fokus auf Ruhe und Aufmerksamkeit, an eine Abwandlung eines japanischen Gartens mit zusätzlicher Ausstattung. Da die Talavera allerdings ein essentieller Parkplatz für den Pendelverkehr ist, wäre es ausgeschlossen, dort keine Stellplätze einzubinden. Die Komponente des Ruhe- und Erholungsortes wäre hingegen eine Anregung, die mit weiteren Ideen verknüpft und eingebunden werden könnte. Obendrein wird bei diesem Konzept das Kiliani-Volksfest nicht mehr berücksichtigt. Zwar ist dieses nicht an den Platz gebunden und fand früher an anderen Standorten in Würzburg statt, da sich der Platz allerdings als Lokation etabliert hat, soll dieser weiterhin dafür erschlossen werden.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 19: „Mehr Lebensqualität durch grüne Räume in der Stadt" aus dem Projekt „Talavera 2023: Ein Stadtteil entsteht (Adam 2023).
Somit könnten bei einer eventuellen Umgestaltung der Talavera genannte Aspekte in Erwägung gezogen und kleinräumiger eingebunden werden. Immerhin bietet die Freifläche mit circa 47.000 m[2] enorm viel Platz, um nicht nur eingleisig Neugestaltungen einzubringen (Interview P. Wiegand 10/2023; 8). Wichtig ist es dennoch, dass auf zur Verfügung gestellte Parkplätze geachtet wird. Dahingehend wird ein Konzept vorgeschlagen, welches Stellplätze sowie Kiliani-Volksfest gleichermaßen berücksichtigt (siehe Abbildung 20). Bei diesem Entwurf soll die Oberfläche von primär zwei Strukturen gekennzeichnet sein. Im westlichen Bereich der Talavera soll Wohnraum erschlossen werden. Da Würzburg generell in der Erschließung neuen Wohnungsraumes aktiv tätig ist, könnte dies kleinräumig für Entlastung sorgen. Die zweite Hauptkomponente der Oberflächenstruktur wird durch Grünfläche eingebunden. Diese könnte ebenfalls, wie bei dem vorherigen Konzept, ganzjährig als Ruhe- und Erholungsort sowie weitere Freizeitaktivitäten genutzt werden. Weitergehend kann diese Fläche einen weiteren Nutzen zugewiesen bekommen. Die Grünfläche respektive nachhaltig genutzte Fläche könnte in puncto Feste, Festivals und weitere Events integriert werden. Neben Wohnraum könnte dieses Konzept Erholung und Ruhe sowie Alternativen für anderweitige Events integrieren. Hierbei bestünde Verknüpfungspotenzial mit anderen Entwürfen. Bei den Freiflächen, welche nicht für sonstige Events angedacht sind, wäre ein Verweis auf das zuvor erläuterte Konzept möglich. So könnte zum Exempel die Idee der Multifunktionsplätze übernommen werden. Bei dem hier angeführten Entwurf sind für die Oberflächengestaltung ebenfalls keine Stellplätze angedacht. Die Talavera soll gänzlich vom Straßenverkehr befreit werden. Stattdessen wird die Alternative eingebunden, eine Tiefparkgarage zu integrieren. Mit dieser sollen die benötigten Parkplätze eingebracht werden sowie zeitgleich einer nachhaltigen und nutzungsspezifischen Gestaltung auf dem Platz nicht im Wege stehen. Mit Parkgaragen ist dahingehend die Eventualität gegeben, schlussendlich noch mehr Parkplätze zur Verfügung stellen zu können als zuvor. Anhand dieser und weiteren Entwürfen wäre weiterhin die Möglichkeit gegeben, an einer Umgestaltung der Talavera festzuhalten. Überdies hätte ein grundlegendes Vorgehen wie bei der Umgestaltung der Balthasar-Neumann-Promenade integriert werden können. Mittels eines Architektenwettbewerbs hätten weitere inspirierende Ideen und Impulse gesammelt werden können, um eine wünschenswerte Umgestaltung zu präsentieren. Mit gesammelten Impulsen sowie einem sachlich-kommunikativen Austausch mit der Zivilbevölkerung zu Neugestaltungsalternativen, Ausbau der Parkplatzfläche und Einbindung der erhobenen Gebühren, könnte künftig erneuert versucht werden, die Talavera kostenpflichtig zu machen. So könnte die Talavera quantitativ und qualitativ umgestaltet werden, um in letzter Instanz Aufwertungsmaßnahmen im Kontext einer nachhaltigen Stadtentwicklung zu erhalten.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 20: „Ein neuer Festplatz - Talavera" aus dem Projekt „Talavera 2023: Ein Stadtteil entsteht" (WIERLING 2023).
6.1.4.2 Gestaltung weiterer Parkplätze in der kreisfreien Stadt Würzburg
Die Talavera gilt als einer der essentiellen Parkplätze in Würzburg. Um für alle Berufspendler sowie Anwohner Stellplätze zu bieten, reicht dieser allerdings nicht aus. Mit dem geplanten Wegfallen des Oberflächenparkens im Bischofshut muss beachtet werden, dass eine noch höhere Nachfrage auf Stellplätze generiert werden könnte (Interview M. Weber 10/2023; 9). Wenn nicht unmittelbar auf Alternativnutzungen rund um ÖPNV, nichtmotorisierter Individualverkehr, Fahrgemeinschaften oder Carsharing umgestiegen wird oder werden kann, dann verteilen sich die Fahrzeuge, welche vorwiegend die Oberflächenparkplätze des Bischofshuts genutzt haben, auf die noch zur Verfügung stehenden Nutzungsmöglichkeiten. Dementsprechend ist es erforderlich, dass in der kreisfreien Großstadt Würzburg weitere Parkhäuser und -garagen in Erwägung gezogen und integriert werden. Ein weiterer großflächiger Parkplatz wird in Würzburg am Dallenbergbad bereitgestellt (Interview P. Wiegand 10/2023; 9ff.). Aktuell kann dieser noch kostenfrei genutzt werden. In näherer Zukunft soll der Großparkplatz, ähnlich wie dies an der Talavera angedacht war, bewirtschaftet werden. Die Gebühren würden ein Ticket für den städtischen ÖPNV inkludieren. Dies wird in jedem kostenpflichtigen Parkhaus in Würzburg so gehandhabt und würde ebenso auf den Parkplatz am Dallenbergbad übertragen werden. Das Konzept mit dem implizierten ÖPNV-Ticket hat noch ein Defizit. Aktuell kann das Parkticket nur eine einzelne Person für die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Das bedeutet, dass bei Fahrgemeinschaften lediglich ein Individuum das unmittelbare Recht auf die Nutzung des ÖPNV hat. Die anderen müssten sich dennoch ein weiteres mit Kosten verbundenes Ticket ziehen. Sollen im Zuge der Nachhaltigkeitsgestaltung Fahrgemeinschaften stärker in das städtische Verkehrsgeschehen eingebunden werden, dann muss dieser Ansatz unweigerlich überarbeitet werden. Sollte dies nicht getan werden, dann könnte dies auf die Mitfahrenden der Fahrgemeinschaften wie eine Bestrafung wirken und sie wiederum von der Idee des gemeinsamen Fahrens abschrecken.
Um die Parkplatzsituation in Würzburg zu entspannen, werden weitere Standorte zur Einbindung von Stellplätzen validiert. Ein schon im Bebauungsplan festgehaltenes Projekt ist die Errichtung eines Parkhauses auf einer Freifläche am Greinberg (Interview P. Wiegand 10/2023; 10f.). Es soll eine Fläche zwischen der B 8 in Richtung Rottendorf und der B 19 in Richtung A 7/Estenfeld erschlossen werden. Mit diesem soll der Verkehr, der aus nordöstlicher und östlicher Richtung in die Stadt einfährt, entlastet werden. Explizit wird das Stauaufkommen am Greinbergknoten betrachtet. Wenn das geplante Parkhaus angesteuert wird, kann die Stausituation am Greinbergknoten verringert werden. Beachtet werden muss, dass das Parkhaus über frühzeitige Abfahrten direkt an die Fernstraßen angebunden wird. Bei Abfahrten in unmittelbarer Nähe zum Parkhaus könnte ansonsten weiterhin eine prekäre Situation erfolgen. Die Autofahrer, welche das Parkhaus ansteuern wollen, könnten ebenso in den Stau geraten. Der dichte einfahrende Verkehr in Richtung Innenstadt sowie jene für das Parkhaus würden sich überschneiden. Im Endeffekt würde sich lediglich eine minimale Entlastung für den Autofahrer aufzeigen. Der Ansatz für dieses Parkhaus wurde durch Impulse der Geovisualisierer der THWS im Projekt „Stadt der Zukunft“ eingebracht (siehe Abbildung 21). Der Tenor des Ausgangsentwurfes ist es, dass mithilfe von gut verteilten Parkhäusern und -garagen außerhalb der Innenstadt der Verkehr nicht nur entlastet wird, sondern vor allem aufgefangen wird. Wird die dortige B 19 betrachtet, kann zudem in Erwägung gezogen werden, noch weiter in die Peripherie der kreisfreien Stadt zu blicken (Interview P. Wiegand 10/2023; 11). So würde sich die Eventualität ergeben, auf den IKEA zu schauen und dort ein weiteres Parkhaus in Betracht zu ziehen.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 21: „Park & Ride Greinberg " aus dem Projekt „Stadt der Zukunft“ (BUCHHOLZ 2021).
Generell halten sich die Optionen für neue Parkhäuser und -garagen in der kreisfreien Großstadt in Grenzen. Durch die starke und flächendeckende Versiegelung, die Bedeutung des Standortes oder hohe Kosten bei Umbaumaßnahmen lassen sich die mehrstöckigen Stellplätze nur mühsam einbinden. Daher sind einige Vorschläge bereits abgelehnt worden, da sich diese nicht realisieren lassen (Interview P. Wiegand 10/2023; 10). Unter anderem galt die Tectake Arena als ein Alternativstandort für eine Tiefgarage. Dieses Vorhaben wurde schlussendlich abgelehnt, da die enorm hohen Kosten für den Umbau dafür nicht aufgewendet werden können. Ebenso wurde die Idee verworfen, am Residenzplatz eine Tiefgarage zu realisieren. Hier steht vor allem die Bedeutung und zentrale Position des Platzes im Vordergrund. Der Bischofshut grenzt den Bereich ein, welcher frei von Oberflächenparkplätzen wird sowie eine geringe Verkehrsauslastung des motorisierten Individualverkehrs aufzeigen soll. Demgemäß sollen an zentralen Standorten keine neuen Parkgaragen entstehen. Dies inkludiert ebenso die Balthasar-Neumann-Promenade und damit verbunden die Zufahrt zum Residenzplatz.
Eine Option, mit der sich aktuell beschäftigt wird, ist der Standort Bahnhof Zell (Interview P. Wiegand 10/2023; 10). Dieser befindet sich überwiegend auf der Gemarkung der kreisfreien Großstadt. Dort würde es sich ermöglichen, einen Park & Ride Parkplatz zu integrieren. Allerdings gehört dieses Grundstück der Deutschen Bahn (DB). Damit wäre für die Stadt ein Grundstückserwerb vonnöten, um dort die Stellplätze zu garantieren. Da die DB diese evaluierte Fläche eigenmächtig aufwerten möchte und somit der Preis für den Erwerb ansteigt, ist sich der Stadtrat noch nicht sicher, ob sich der Erwerb bei den Kosten zwingend lohnt. Dabei wäre dieser eine von sehr wenigen Möglichkeiten im Gemarkungsbereich Würzburgs, um eine Parkplatzalternative für das westliche Umland einzubinden. Eine Idee für eine weitere Parkgaragengestaltung, welche vom Oberbürgermeister Christian Schuchardt aufgegriffen wurde, ist erneut auf die Impulse der Studierenden der Geovisualisierung an der THWS zurückzuführen (siehe Abbildung 22). Es handelt sich um den Sanderrasen in der Sanderau. Dort befindet sich ein sanierungsbedürftiger Sportplatz, welcher in den Sommermonaten von angrenzenden Schulen in Anspruch genommen wird. Die Idee des Entwurfes ist es, die aktuelle Sportanlage abzureißen und ein Parkdeck zu errichten. Auf diesem soll eine neue und modernere Sportanlage gebaut werden. Die Parkgarage, welche am Sanderrasen eingebunden werden soll, kann grundsätzlich die sich am Mainufer befindenden Stellplätze ersetzen sowie ergänzend eine Alternative zu den wegfallenden Parkbuchten aus dem Bischofshut einbringen. Im Allgemeinen besteht in Würzburg das Potenzial, neue Parkhäuser und -garagen einzubinden. Da die Summe der Alternativen sehr gering ist, muss unbedingt an den vorhandenen Optionen festgehalten werden.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 22: „Der neue Sanderrasen" aus dem Projekt „Stadt der Zukunft“ (REYNARD 2021).
Für eine mögliche Alternative kann, im Sinne der nachhaltigen Gestaltung, erneut das CO2-neutrale Fahrzeug aufgegriffen werden. Als möglicher Entlastungsfaktor könnten, ähnlich wie in Kombination mit einer möglichen City-Maut, geringere Parkgebühren für den Nutzer aufgegriffen werden, sollte dieser die Parkhäuser und -garagen mit einem CO2- neutralen Pkw ansteuern. Die Nutzung emissionsfreier Fahrzeuge ermöglicht eine grundlegend geringere Feinstaubbelastung in Städten. Mittels geminderter Kosten für das Parken in den Städten könnte einigen Bürgern der Umstieg auf die CO2-neutrale Variante leichter fallen. Die Nutzung von Brennstoffzellen- und Elektroautos könnte dadurch durchaus an Lukrativität gewinnen.
6.1.4.3 Park & Ride Parkplätze im Landkreis Würzburg
Auf der Suche nach alternativen Standorten für Parkhäuser und -garagen in der kreisfreien Großstadt Würzburg wird sich dem Ende der Optionen genähert. Die Möglichkeiten sind nahezu komplett ausgeschöpft. Da die Anzahl der Auswahlmöglichkeiten doch sehr eingeschränkt ist, gehören weitere konstruktive Überlegungen einbezogen. Für mögliche Park & Ride Parkplätze wäre theoretisch keine Bindung an die Gemarkungsgrenzen der Stadt erforderlich. Die Art dieser Stellplatzmöglichkeit könnte sich auf den angrenzenden Landkreis Würzburg ausdehnen. Park & Ride Parkplätze, welche weiter außerhalb liegen, haben den Vorteil, dass sie aus verschiedenen Richtungen respektive von verschiedenen Standorten aus angesteuert werden können. An den Pendlerparkplätzen kann dann auf ein gemeinsames Fahrzeug oder den ÖPNV, sollte dieser ausreichend ausgebaut sein, umgestiegen werden, um die restliche Distanz bis zum gewünschten Ziel zurückzulegen. Mit diesem Angebot kann also ein Teilumstieg auf Fahrgemeinschaften und öffentliche Verkehrsmittel gefördert werden. Durch diese Herangehensweise kann das starke Verkehrsaufkommen in der Stadt zusätzlich reduziert werden. Hingegen stehen derartige Pendlerparkplätze politisch in der Kritik. Es wird befürchtet, dass diese die Zersiedelung fördern könnten. Vor allem in Regionen, in denen der ÖPNV nur schwach ausgeprägt ist, würde eine bessere Erreichbarkeit für das Umland generiert werden. Prinzipiell kann diese Problematik verhindert werden, wenn zeitgleich die Qualität und Quantität der öffentlichen Verkehrsmittel berücksichtigt. Zudem kann argumentiert werden, dass ohne Park & Ride Parkplätze das Auto sowieso intensiv genutzt wird und mit den Stellplätzen eine Reduzierung des Verkehrsaufkommens verbunden werden kann.
Im Landkreis Würzburg sind zum aktuellen Zeitpunkt einige wenige Pendlerparkplätze vorhanden. Unter anderem gibt es einen Park & Ride Parkplatz an der B 19 bei Estenfeld sowie jeweils einen an den Abfahrten Würzburg/Kist und Würzburg/Randersacker der A 3. Bei diesen handelt es sich um relativ kleine Schotterflächen. Die Anzahl der Fahrzeuge, die darauf abgestellt werden können, hält sich in Grenzen. Aus der Stadt heraus gibt es einige Überlegungen, weitere und größere Park & Ride Flächen einzubinden (Interview P. Wiegand 10/2023; 10). Auf Initiative des zweiten hauptamtlichen Würzburger Bürgermeisters Martin Heilig wurde angestrebt, einen Pendlerparkplatz in Höchberg zu integrieren. Als Position wäre dafür eine Fläche am Rewe im Süden der Kleinstadt zu vermerken. Es wäre eine Doppelnutzung vorgesehen. Ein Großparkplatz, welcher intensiv von Pendlern sowie den Besuchern des Supermarktes genutzt werden könnte. Von dort könnten sowohl Fahrgemeinschaften die Würzburger Innenstadt ansteuern als auch Leute auf den ÖPNV zurückgreifen. Weitere Vorschläge für das westliche Umland Würzburgs wären zum Exempel Standorte in Hettstadt oder Waldbüttelbrunn. In der östlichen Peripherie hätten Lokationen rund um Rottendorf, Biebelried und den Dettelbacher Weiler Neuhof Potenzial zur Kopplung. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es allerdings keine Ansätze zu einer möglichen Umsetzung. Grund dafür ist, dass sich Politik und Planung des Landkreises nicht damit auseinandersetzen wollen. Einerseits ist die Errichtung großflächiger Parkplätze mit hohen Kosten verbunden. Überdies würde ein höheres Verkehrsaufkommen rund um die gekoppelten Standorte das Ganze begleiten. Der motorisierte Individualverkehr würde vermehrt die Park & Ride Parkflächen anstelle der Großstadt ansteuern.
Summa summarum ist es wichtig, Parkplatzalternativen im Umland zu integrieren. Um dies zu verwirklichen, ist es von essentieller Bedeutung, eine sachlich-fachliche Kommunikation zum Landkreis Würzburg zu intensivieren und etliche Möglichkeiten zu evaluieren. Es sollte ebenso im Sinne der umliegenden Gemeinden und kleineren Städte sein, dass eventuell eine höhere Passantenfrequenz generiert werden könnte. Als Beispiel dient dahingehend die Überlegung im Gewerbegebiet von Höchberg. Mit einem großflächigen Parkplatz mit Doppelnutzung könnte bewirkt werden, dass mehr Bürger auf den Supermarkt sowie weitere Läden in der näheren Umgebung zurückgreifen. Zudem haben Parkplätze im westlichen Umland eine hohe Priorität, um den dort strukturschwachen ÖPNV zu unterstützen (Interview P. Wiegand 10/2023; 9).
6.2 Alternativen, um dem expandierenden Aufkommen des Pkw entgegenzuwirken
6.2.1 Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs
Mit den Ideen, welche Alternativen für den motorisierten Individualverkehr einbringen, werden gute Ansätze für eine nachhaltige Planung und Entwicklung eingebracht. Jedoch ist eine unmittelbare Umsetzung der Optionen schlicht unmöglich. Ohne die Berücksichtigung von Alternativen, welche den Bürger vom eigenen Pkw loslösen könnten, können ebenfalls die Perspektiven des motorisierten Individualverkehrs nicht vollständig realisiert werden. Im Fokus dessen die zur Verfügung stehenden öffentlichen Verkehrsmittel. Sollen die infrastrukturellen Maßnahmen mit den Überlegungen zu Parkhäusern und -garagen umgesetzt werden und die Oberflächenparkplätze im Bischofshut weichen, dann muss der ÖPNV eine relevante Alternative bieten sowie eine hohe Effizienz aufweisen. Vom ursprünglich autofahrenden Bürger kann nicht erwartet werden, auf Park & Ride Parkplätze oder gar komplett auf den ÖPNV umzusteigen, wenn dieser in umfangreichen Belangen nicht ausreichend ausgebaut ist. Im Allgemeinen scheint die Zufriedenheit mit dem ÖPNV in Würzburg vielseitig zu sein (siehe Abbildung 23). Während 15 % der Teilnehmenden an der Meinungsforschung umfassend zufrieden mit dem vorhandenen ÖPNV sind, sind 19 % gänzlich enttäuscht vom vorliegenden Angebot. Mit 49 % ist nahezu die Hälfte der Probanden lediglich teilweise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in der kreisfreien Großstadt glücklich. In Anbetracht dessen scheint es für einige Bürger noch Handlungsbedarf zu geben, bevor die Parkplatzsituation großflächig evolviert.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 23: „Sind Sie mit den angebotenen öffentlichen Verkehrsmitteln in Würzburg zufrieden?" - Ergebnis aus der Würzburger Umfrage (eigene Darstellung 2023).
Im Umgang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Würzburg gibt es definierte Konfliktfelder, welche den Unmut mit diesem herbeiführen (siehe Abbildung 24). 13 % der Probanden in Würzburg sprechen gezielt die Unpünktlichkeit an. Dies kann insofern problematisch werden, als dass dadurch Anschlussverbindungen bei Umstiegen nicht mehr erreicht werden können. Es entsteht eine Wartezeit, bis die nächste Straßenbahn oder der nächste Bus die Haltestelle anfährt. Es kann passieren, dass durch den höheren Zeitaufwand das festgelegte Ziel nicht mehr in der vorgegebenen Zeit erreicht werden kann. Der Zeitaufwand per se bildet ebenfalls ein Konfliktfeld ab. 41 % der Befragten befinden den ÖPNV als zu zeitintensiv. Vor allem der pendelnde Autofahrer tut sich dahingehend schwer, auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen. Hier greift ebenfalls wieder das Prinzip des Schließungsreflexes. Da mit dem ÖPNV grundlegend ein höherer Zeitaufwand verbunden werden muss, müssen ebenso die daran geknüpften alltäglichen Routinen angepasst werden. Früheres Aufstehen, geringere Freizeit vor und nach dem längeren Arbeitsweg sowie Verlust der Flexibilität dienen dahingehend als Exempel. Das Prinzip der Gewohnheit ermöglicht allerdings, dass die Veränderung ebenfalls, nach regelmäßiger Durchführung, zur neuen Routine werden könnte. Um den Zeitaufwand zu schmälern, wird der Taktung eine hohe Priorität zugeteilt (Interview P. Wiegand 10/2023; 6). Mithilfe einer Erhöhung des Taktungsintervalls der Straßenbahnen in Würzburg soll garantiert werden, dass die zeitlichen Abstände zwischen den Fahrzeugen geringer ausfallen. In effectu sollen dadurch die Wartezeiten verringert werden. Selbiges gilt ebenso für die Taktung der Straßenbahnen in der Nacht. 31 % der Teilnehmenden kritisieren, dass die Anbindung über den ÖPNV zur Nacht mangelhaft ist. Um dieses Problemfeld zu beheben, soll zukünftig die Taktung der Straßenbahnen in der Nacht angehoben werden (Interview M. Weber 10/2023; 11). Neben dem Würzburger Nachtleben bedingt dies ebenfalls bessere Anbindungen für Arbeitende in der Nachtschicht sowie jene, deren Frühdienst bereits in den frühen Morgenstunden beginnt. Insgesamt fallen für die Anhebung der Taktung 1,4 Millionen Euro Mehrkosten pro Jahr an (Interview P. Wiegand 10/2023; 6). Eine Summe, die kritisch betrachtet werden sollte. Grundlegend ist es von essentieller Bedeutung, dass der innerstädtische ÖPNV regelmäßig und mit geringen Wartezeiten einhergeht. Noch wichtiger sollte dahingehend jedoch die Erreichbarkeit ins Umland sein. 38 % der Probanden vertreten die Meinung, dass die Anbindung der öffentlichen Verkehrsmittel in die Peripherie nicht ausreicht. Die Verbindung zwischen der kreisfreien Großstadt und Standorten im umschließenden Kragenkreis sowie darüber hinaus ist nur dürftig ausgebaut. Während für die Verbindungen mit Kitzingen gute Erreichbarkeiten aufzuzeigen sind, stellt sich dies für andere Lokationen als augenscheinlich kompliziert dar. Neben dürftigen Anbindungen in den Landkreis Schweinfurt oder den Main-Tauber-Kreis fällt dies vor allem im westlichen Umland Würzburgs auf. In einigen kleineren Siedlungen fahren Busse nur sehr sporadisch, teilweise nur zwei oder drei Mal am Tag. Für Pendler ergibt sich häufig keine andere Möglichkeit, als auf das eigene Auto zurückzugreifen, wenn die Abfahrtszeiten nicht mit den Arbeitszeiten übereinstimmen. Andere Kommunen sind gar nicht an die Busmöglichkeiten angebunden, wodurch entsprechende Haltestellen zunächst mit dem eigenen Fahrzeug angefahren werden müssen (Interview P. Wiegand 10/2023; 9f.). Entlang der B 8 und B 27, im westlichen Umland, befinden sich allerdings keine Pendlerparkplätze respektive Schotterflächen, von denen aus auf den ÖPNV umgestiegen werden kann. Somit müssen selbst Personen, welche öffentliche Verkehrsmittel in Betracht ziehen würden, auf diese verzichten, da die Erreichbarkeit dieser dürftig ist. Dieses Konfliktfeld ist unbedingt zu überarbeiten. Die Neugestaltungsprozesse in der Innenstadt haben keinen effektiven Nutzen, werden die öffentlichen Verkehrsmittel im Voraus nicht sachgemäß ausgebaut. Die 1,4 Millionen Euro für das angehobene Taktintervall werden somit kritisch betrachtet, da Bestandteile dessen für die Aufwertung im Umland hätten genutzt werden können.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Geknüpft an den fehlenden ÖPNV und den höheren Zeitaufwand haben 69 % der Befragten geäußert, dass die Alternativen an öffentlichen Verkehrsmitteln nicht gut genug ausgebaut sind. Neben den Problemen im Umland, welche das starke Verkehrsaufkommen des motorisierten Individualverkehrs bedingen, wird ebenso der städtische ÖPNV einbezogen. Das Erreichen von einigen Standorten in den Außenbezirken aus der Innenstadt heraus ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln häufig mühselig und mit viel Anstrengung verbunden. Selbiges gilt für die entgegengesetzte Strecke. Als Beispiel kann die Verbindung innerstädtischer Lokationen mit dem östlichen Frauenland genannt werden. Der Campus Hubland wird täglich von etlichen Studierenden der JMU und der THWS angefahren. Sowohl vom Hauptbahnhof sowie von verschiedenen Wohnstandorten wird der Ort angesteuert. Zusätzlich etabliert sich das Hubland als ein neuer attraktiver Standort für Wohnsiedlungen mit zu erwartender wachsender Einwohnerzahl. Zu den Stoßzeiten der Studierenden können prekäre Situationen im Umgang mit dem ÖPNV entstehen. Überfüllte und verspätete Busse sowie zusätzliche Wartezeiten sind die Folge. Eine Situation, welche für viele nutzende Bürger ersichtlich für Unzufriedenheit sorgt. Ebenso ist es wichtig, der wachsenden Bevölkerung eine gut ausgebaute Infrastruktur an öffentlichen Verkehrsmitteln zu garantieren. Um dieser Problematik entgegenzuwirken, soll in naher Zukunft eine neue Straßenbahnlinie erschlossen werden (Interview P. Wiegand 10/2023; 15). Die Straßenbahnlinie 6 (S 6), welche seit präterpropter 15 Jahren geplant wird, soll in den kommenden Jahren realisiert werden. Die neue Linie soll künftig den Barbarossaplatz mit dem Campus Hubland verbinden. Eingebunden werden weitere essentielle Standorte wie der Wittelsbacherplatz oder das Mainfrankentheater. Im Zuge der Liniengestaltung sind die Umbaumaßnahmen in der Theaterstraße und der Balthasar-Neumann-Promenade angedacht. Mit der neuen Straßenbahn kann der Busverkehr entlastet werden, da die zur Verfügung stehenden Alternativen der vorliegenden Situation entsprechend ausgebaut werden. Ein weiterer Standort, an welchem der ÖPNV bemängelt wird, ist das Gewerbegebiet Lengfeld. Aus der Erhebung am Briefzentrum der Deutschen Post ging hervor, dass vor allem zu den betriebsspezifischen Stoßzeiten die Anbindungen zum Hauptbahnhof nur sehr dürftig sind. Einige Mitarbeiter würden gerne regelmäßig auf die Nutzung der Regionalbahn zurückgreifen. Da allerdings keine unmittelbare Umsteigemöglichkeit zur festgelegten Arbeitszeit am Hauptbahnhof vorliegt und die Weiterfahrt mit dem Bus mit einem hohen Zeitaufwand verbunden ist, erschließt sich den Beschäftigten diese Möglichkeit nicht. So müssen die Arbeitskräfte entweder viel früher das Haus verlassen und kommen verfrüht am Arbeitsplatz an oder sie erreichen diesen verspätet. Lengfeld dient nur als ein Beispiel von mehreren Standorten, an denen die individuellen Arbeitszeiten registriert werden sollten. In Anbetracht des Sachverhalts sollte versucht werden, Busse für die Stoßzeiten bereitzustellen und die eruierten Standorte vermehrt anzufahren, um den Arbeitenden eine attraktive Alternative bieten zu können. Unter Umständen sollte eine sachlich-fachliche Kommunikation zwischen der DB und der WVV forciert werden, um die Wartezeiten zu minimieren sowie die bisher überschaubar eingebundenen Standorte wirksamer zu inkludieren. Ein weiteres Kriterium, welches Bürger als ablehnend einbinden, ist die Entstehung höherer Kosten. 13 % der Beteiligten geben an, dass ihnen die öffentlichen Verkehrsmittel zum aktuellen Zeitpunkt zu teuer sind. Das wirkt mehrheitlich für Pendler abschreckend. Neben den anfallenden Kosten für das Auto, welches häufig neben dem Arbeitsweg für weitere Aktivitäten in Anspruch genommen wird und daher nicht wegzudenken ist, fallen zusätzlich zu verrichtende Zahlungen an. Mit den veränderten Kosten kommt ein Stressfaktor auf den Bürger zu. Eventuell muss im Alltag oder bei Freizeitaktivitäten eingespart werden, um den neu entstehenden Gebühren gerecht zu werden. Der Verlust des eigenen Standards respektive der Angriff auf den vorhandenen Wohlstand lässt den Menschen wiederum mit starken Emotionen reagieren. Allerdings wird der Faktor Kosten für den Pendler in den Parktickets der Parkhäuser und -garagen berücksichtigt und reguliert. Sowohl in den bereits existierenden sowie in den kommend geplanten Stellplatzanlagen. Somit fallen für den Pendler keine doppelten Kosten an, sondern lediglich die Parkplatzgebühren.
Sollen somit die Überlegungen, die Talavera und den Parkplatz am Dallenbergbad kostenpflichtig zu machen und die Oberflächenparkplätze im Bischofshut zu entfernen, durchgeführt werden, sollten vorerst handfeste Alternativen zu öffentlichen Verkehrsmitteln entstehen. Dabei stehen vor allem die Erreichbarkeiten mit dem ÖPNV vom Würzburger Hauptbahnhof in die äußeren Stadtteile sowie ein ausgebautes Netz öffentlicher Verkehrsmittel im Umland im Fokus. Werden für die Gestaltung der Verkehrsinfrastruktur die Bedeutung und Zugänglichkeit des öffentlichen Personenverkehrs stärker eingebunden und dem Bürger so eine relevante Alternative geboten, dann tun sich einige Personen leichter mit einem möglichen Umstieg. Ebenfalls bildet Kommunikation hierbei einen essentiellen Aspekt ab. Um die Bürger zu erreichen, muss frühzeitig mit diesen ausgetauscht werden, welche Alternativen eingeplant sind, welche Hürden, wie beispielsweise Kosten oder höherer Zeitaufwand, auf diese zukommen können und welche Ziele die Stadt damit verfolgt. Mittels einer rechtzeitigen Auseinandersetzung können sich die Individuen zeitnah mit den Alternativen beschäftigen und ohne auftretenden Stress Möglichkeiten für sich evaluieren. Generell muss dazu versucht werden, dem ÖPNV mehr Relevanz zu verleihen. Werden dem Bus und dem innerstädtischen Schienenverkehr eine höhere Bedeutung zuteil und diese dadurch als ein Standardfortbewegungsmittel betrachtet, dann bestünde die Möglichkeit, dass sich der Bürger intensiver mit diesem auseinandersetzt. Ein Exempel stellt der öffentliche Verkehr in der irischen Hauptstadt Dublin dar (Czowalla et al. 2017: 7f.). In der Großstadt, welche mehr als 500.000 Einwohner zählt, ist der ÖPNV, neben dem zu Fuß gehen, das relevanteste Fortbewegungsmittel. Da der ansässige Bürger die Nutzung der öffentlichen Alternativen gewohnt ist, sich dies also über einen längeren Zeitraum etabliert hat, kommt für viele das Auto als Fortbewegungsmöglichkeit in der Stadt gar nicht infrage. Ein derartiges Umdenken wäre ebenso in deutschen Großstädten möglich und realisierbar. Dieser Prozess bedarf allerdings Zeit für Entwicklung und Etablierung.
6.2.2 Aufwertungsmaßnahmen für den nichtmotorisierten Individualverkehr
Für die Bevölkerung, welche nicht allzu weit von ihrem Arbeitsplatz entfernt lebt und nicht auf den ÖPNV zurückgreifen möchte, gibt es eine weitere Alternative. Der Individualverkehr wird, neben der Komponente der motorisierten Optionen, durch die nichtmotorisierten Nutzungsmöglichkeiten komplettiert. Dazu zählen vorzugsweise das Fahrradfahren sowie das Zufußgehen. In der Vergangenheit hat der nicht-motorisierte Individualverkehr stetig an Bedeutung verloren (Vejnik 2016: 174). Mit der raschen Entwicklung des Automobils in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kam eine Alternative auf, mit der Strecken schneller und ohne aufgewendete Muskelkraft überwunden werden konnten. In den letzten Jahren, bis in die Gegenwart, hat sich dieser Trend verändert (BMDV 2023). Übergeordnet betrifft dies den Gebrauch des Fahrrads. Dieses gewinnt zunehmend an Bedeutung. Es wird wieder öfter und regelmäßiger genutzt. Dem Fahrrad liegt der Vorteil zugrunde, dass in der Stadt, bei einer gut ausgebauten Infrastruktur, der Arbeitsweg ohne Mehrkosten zurückgelegt werden kann. Stausituationen können gezielt umgangen werden. Des Weiteren fallen bei der Nutzung keine Emissionen an. Lediglich marginale Feinstaubbelastungen durch Reifenabrieb. Demgemäß ist davon auszugehen, dass Fahrradstraßen und -wege in der infrastrukturellen Entwicklung ebenso berücksichtigt werden. Wichtig ist, dass diese standortspezifisch eingebunden werden. Darunter fallen Aufwertungsmaßnahmen der vorhandenen sowie Erschließung neuer Passagen.
Eine gewisse Wichtigkeit des Fahrradfahrens liegt ebenfalls in Würzburg vor (siehe Abbildung 25). Bei der Meinungsumfrage haben 64 % der Teilnehmenden abgestimmt, dass mehr und verbesserte Fahrradstraßen und -wege in Würzburg benötigt werden. Bei Verbesserungsmaßnahmen wird primär der Fokus auf die Sicherheit gelegt. Wie sich aus der Erhebung deuten lässt, fühlen sich einige Fahrradfahrer im städtischen Verkehr nicht sicher. Als Exempel wird dahingehend der Berliner Ring aufgegriffen. Dieser ist, neben den drei Fahrstreifen für mehrspurige Fahrzeuge, mit einer zusätzlichen Fahrradspur ausgestattet. Vor allem zu den Stoßzeiten ist der Kreisverkehr besonders stark ausgelastet. Der Autofahrer wird daher stark gefordert. Mit dem vorhandenen Fahrradstreifen kommt ein weiteres Element einher, welches vom Pkw-Fahrer enorme Konzentration abverlangt. Eine Gesamtsituation, die Risiken birgt. Übersehen Autonutzer, beispielsweise durch die Hektik im starken Verkehr, einen Fahrradfahrer, so kann es zu schwerwiegenden Unfällen kommen. Beim Verlassen des Kreisverkehrs hat der Fahrradfahrer, dessen Fahrstreifen gekreuzt wird, Vorrang. Bisher ist in diesem noch kein Fahrradfahrer zu Tode gekommen. Um dafür zu sorgen, dass dies zukünftig so bleiben wird, sollte die Infrastruktur des Kreisverkehrs überarbeitet werden. Neben den Radfahrwegen und -streifen ist eine alternative Variante die Fahrradstraße. Diese ermöglicht, auf ganzen Streckenabschnitten den Radfahrer zu priorisieren und die Nutzung von Kfz-Fahrzeugen unterzuordnen. Im Würzburger Bischofshut wurden bereits die Büttner-, Peter- sowie die Münzstraße zu Fahrradstraßen mit erlaubtem Pkw-Verkehr umfunktioniert. Hier wird mehr Sicherheit geboten, da die Autos bedeutend langsamer verkehren. Ein weiterer Vorteil von Fahrradstraßen ist, dass dort E-Bikes fahren dürfen. Auf Radwegen dürfen die mit elektronischen Motoren ausgestatteten Fahrräder nur mit einer Sonderbeschilderung queren.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 25: „Welche Alternativen würden Sie sich in der Stadt wünschen bzw. sollten dort ausgebaut werden? - Ergebnis aus der Würzburger Umfrage (eigene Darstellung 2023).
Neben den bereits bestehenden Optionen sollte das Netz für den Fahrradnutzer zusätzlich ausgeweitet werden. Dazu gibt es einige Überlegungen. Betrachtet werden kann die Veitshöchheimer Straße (Interview P. Wiegand 10/2023; 12). Der Streckenabschnitt dieser, zwischen der Brücke der Deutschen Einheit und der Anbindung zum Röntgenring, soll umgestaltet werden. Aktuell besitzt die Straße zwei Fahrstreifen je Richtung. Ursprünglich war dafür angedacht, für jede Richtung eine Fahrspur zu entnehmen und diese durch Radwege zu ersetzen. Im Zuge nachhaltiger Politik wurde das Verlangen nach einem Grünstreifen groß. Weiterhin soll die Fahrbahn für zweispurige Fahrzeuge auf je einen Fahrstreifen reduziert werden. Der dadurch zur Verfügung stehende Platz soll anschließend für einen Grünstreifen sowie einen Radweg genutzt werden. Die Realisierung der Umgestaltung hat sich durch den Diskurs des Grünstreifens enorm in die Länge gezogen. Dennoch kann erwartet werden, dass dieses Vorhaben in naher Zukunft verwirklicht wird. Bei einer weiteren Idee geht es um eine mögliche Gestaltung für eine Überquerung des Mains. Gegenwärtig dienen im Süden der Stadt die Ludwigsbrücke und unmittelbar zum Bischofshut die alte Mainbrücke als Überweg. Da sich dort, sowohl auf engstem Raum als auch durch hohe Passantenfrequenz, Fahrradfahrer und Fußgänger gegenseitig behindern, sollte eine separate Fahrradbrücke in Erwägung gezogen werden. Angeschlossen an diese Umsetzung sollte die Verfügbarkeit von Radwegen im alten Mainviertel betrachtet werden, um dort eine gerechte Weiterfahrt zu garantieren. Eine Fahrradbrücke macht nur Sinn, wenn ihr Nutzen direkt nach dieser nicht endet, sondern dem Fahrradfahrer eine angemessene folgende Infrastruktur bietet. Ein weiterer Impuls kann erneut durch das Studierendenprojekt „Stadt der Zukunft“ aufgegriffen werden. Es handelt sich um die Option der High-Line für Fahrräder (siehe Abbildung 26). Im Grunde wird dabei das Fahrrad vom motorisierten Verkehr separiert, indem ein isolierter Radweg darüber entsteht. Eine solche Idee wurde in Würzburg für die Leistenstraßen aufgenommen. Aufgrund hoher Kosten und geringem Potenzial für eine gerechte Umsetzbarkeit wurde dieser Vorschlag allerdings schnell abgewiesen. High-Lines würden dafür sorgen, dass sich der Fahrradfahrer sicher fortbewegen kann. Das Konzept ist jedoch an Hürden geknüpft. Für die Würzburger Innenstadt käme eine solche Hochstraße nicht infrage. Es hätte Auswirkungen auf das Stadtbild (Interview M. Weber 10/2023; 13). Die teilweise recht alten Hausfassaden mit den modernen High- Lines zu verknüpfen, könnte das Stadtbild negativ prägen. Für den Bewohner könnte ein bedrückendes Gefühl die Folge sein. Die angehobenen Wege führen eventuell unmittelbar vor den Fenstern entlang. Zudem spielt die Sonneneinstrahlung eine signifikante Rolle. Mit High-Lines würde der Einfall des Sonnenlichts beeinträchtigt werden. Es käme zu Verschattungen, welche die mentale und physische Gesundheit des Bürgers beeinträchtigen könnten. Hohe Kosten und Platzmangel für barrierefreie Abfahrten hindern zusätzlich an einer Umsetzung dieses Impulses (Interview P. Wiegand 10/2023; 13). Aktuell besteht somit keine Perspektive, dass eine solche High-Line in Würzburg integriert wird.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 26: „Fahrradhighway und Lock & Shop-Garagen" aus dem Projekt „Stadt der Zukunft" (NIKOLAUS 2021).
Prinzipiell sollte das Fahrradnetz in Würzburg regelmäßig betrachtet und nach Ausbauoptionen evaluiert werden. Viele Bewohner der kreisfreien Stadt sowie der Kommunen, welche in unmittelbarer Nähe daran angrenzen, greifen gerne auf das Fahrrad zurück. Um ausreichend Sicherheit und eine gute Erreichbarkeit an Radwegen und Fahrradstraßen zu bieten, könnte das Fahrrad zukünftig als ein essentielles Fortbewegungsmittel in Würzburg noch stärker etabliert werden.
6.2.3 Attraktivitätssteigerung intermodaler Fortbewegungsmöglichkeiten
Mit den ausgearbeiteten Alternativen für den motorisierten Individualverkehr sowie jenen Aspekten, um sich von diesem abwenden zu können, wird einiges an Gestaltungspotenzial für die zukünftige Stadtentwicklung eingebracht. Um verschiedene Verkehrsmittel miteinander zu koppeln, kann eine neue Strategie in der städtischen Entwicklung berücksichtigt werden. Es handelt sich um die intermodale Mobilität. Unter intermodal versteht sich die Fortbewegung mit mehreren Verkehrsmitteln auf einer zusammenhängenden Wegstrecke. Das bedeutet, dass auf dem zurückgelegten Weg nicht nur ein Fortbewegungsmittel berücksichtigt wird, sondern mehrere aufeinanderfolgend kombiniert werden. Mit den Ideen zu Park & Ride Parkplätzen, beispielsweise am Greinberg oder im Gewerbegebiet Höchberg, wird diese Strategie bereits aufgegriffen. Ähnlich wäre dies mit neuen Schotterflächen im westlichen Umland, um eine Umsteigemöglichkeit für den Pkw-Nutzer auf die Busverbindungen zu ermöglichen. Im Grunde sollen dabei verschiedene Personengruppen berücksichtigt werden. Sowohl für den Autofahrer als auch für Nutzer des Fahrrads oder den Fußgänger wäre die Aufwertung öffentlicher Verkehrsmittel sinnvoll. Praktisch könnte Ähnliches als Kopplung zwischen Pkw und Fahrradweg integriert werden. Im Zuge besserer Anbindungen können Fahrradwege eingebracht werden, auf denen der Pkw-Nutzer die restliche Strecke vom Parkplatz mit dem Fahrrad oder dem E-Scooter zurücklegen kann (Interview M. Weber 10/2023; 6). Hierbei sollen allerdings keine externen Unternehmen E-Scooterleihsysteme einbringen, sondern bei Bedarf der Bürger seinen eigenen Elektroroller verwenden.
Im Kontext des intermodalen Verkehrs kann erneut das Exempel Dublin aufgegriffen werden (Czowalla et al. 2017: 7f., 92). Hier fließt eine weitere Komponente mit ein, welche die kombinierte Fortbewegung begünstigt. Es gibt Fahrradverleihsysteme, die an wesentliche Standorte geknüpft sind. Sie werden vorzugsweise dann eingebunden, wenn die Infrastruktur keine direkte Busverbindung zwischen zwei Umsteigeknotenpunkten ermöglicht oder eine hohe Auslastung der öffentlichen Verkehrsmittel vorliegt. Mittels des geliehenen Fahrrads kann die Distanz zwischen verschiedenen Haltestellen überbrückt werden. Die Einbindung standortspezifischer Fahrradleihsysteme konnte sich in Städten wie Dublin oder London etablieren und die Nutzung intermodaler Fortbewegungsmöglichkeiten fördern. Darüber hinaus konnte eine Entlastung im ÖPNV zusammengetragen werden. Einige Bürger, die bis dato regelmäßig auf die öffentlichen Verkehrsmittel zurückgreifen, steigen für die Überbrückung kleinerer Distanzen auf das geliehene Fahrrad um. Dadurch wirken die Busse, in einigen Teilbereichen der Großstädte, weniger überlastet und folglich lukrativer für Pkw-Nutzer, Touristen und mehr. Um die Fahrradverleihsysteme finanzieren zu können, kommen Sponsoren infrage. Das wird ähnlich gehandhabt wie die Namensvergabe von Fußballstadien und sonstigen Veranstaltungshallen. Beispielsweise kooperiert das Fahrradverleihsystem dublinbikes mit dem Unternehmen Coca-Cola. Im Namen des Verleihsystems wird die zuckerfreie Variante des Erfrischungsgetränks berücksichtigt. Als Exempel könnte in Würzburg auf die WVV, s.Oliver, die TecTake GmbH oder die Flyeralarm GmbH zurückgegriffen werden. Im Wesentlichen müssen Knotenpunkte berücksichtigt werden, an denen der Bürger zwischen unterschiedlichen Fortbewegungsmitteln entscheiden kann beziehungsweise an welchen verschiedene Anbindungen die Intermodalität ermöglichen.
Innerhalb der Gemarkungsgrenzen der kreisfreien Stadt Würzburg können explizit einige relevante Umsteigeknotenpunkte aufgegriffen werden (Abbildung 27). Der wohl essentiellste Umsteigeknotenpunkt ist der Würzburger Hauptbahnhof. Dort treffen etliche Fortbewegungsalternativen aufeinander. Mit dem Bahnhof wird die Option eingebracht, die Stadt mit der Regionalbahn sowie mit Fernzügen anzufahren. Mit dem neu entstehenden Parkhaus kann unmittelbar vor Ort ebenso der Pkw-Nutzer halten. Des Weiteren befinden sich am Standort Anbindungen für die öffentlichen Verkehrsmittel der Stadt. Einerseits der Würzburger Busbahnhof. Dieser ist der wichtigste Umsteigepunkt für Linien- sowie Regional- und Fernbusse. Darüber hinaus ist der Hauptbahnhof unmittelbar an das städtische Schienennetz geknüpft. Von den aktuell fünf bestehenden Straßenbahnlinien haben vier eine regelmäßige Zwischenstation am Würzburger Hauptbahnhof. Mit dem Ringpark und dem vorhandenen Fahrradweg entlang des Röntgenrings liegt ergänzend eine exzellente Erreichbarkeit für Fußgänger und Nutzer des einspurigen Individualverkehrs vor. Ebenso gibt es bereits Knotenpunkte, welche großflächige Parkplätze mit dem ÖPNV koppeln. Allen voran die erläuterten Großparkplätze am Dallenbergbad und auf der Talavera. Diese sind unmittelbar an das Straßenbahnnetz angeschlossen, wodurch eine gute Erreichbarkeit der Innenstadt entsteht. Von der Talavera aus kann die Altstadt, neben der Option des ÖPNV, in kürzester Zeit zu Fuß oder mit dem einspurigen Verkehrsmittel über die alte Main- oder die Friedensbrücke erreicht werden. Durch die Anbindung an das städtische Schienennetz ist die Altstadt ebenfalls vom Parkplatz am Dallenbergbad gut und mit geringem Zeitaufwand zu erreichen. Im Zuge dessen wäre eine Bewirtschaftung mit integriertem Ticket für den ÖPNV eine interessante Lösung für Bürger, die kein Langzeitticket der WVV besitzen sowie für Personen und Touristen, welche die Stadt lediglich vereinzelt aufsuchen. Mit einem Langzeitticket für eine regelmäßige Nutzung der Parkplätze können langfristig Kosten eingespart werden. Mit dem Barbarossaplatz und der direkt angrenzenden Juliuspromenade gibt es einen weiteren Knotenpunkt. Als Fußgängerzone ist diese aus verschiedenen Richtungen ausgezeichnet zu Fuß zu erreichen. Vor Ort kann daraufhin an den vorhandenen ÖPNV angeknüpft werden. Neben den verfügbaren Bushaltestellen kreuzen vier der fünf existierenden Straßenbahnlinien die Juliuspromenade. Mit dem geplanten Bau der S 6 wird zukünftig über die angrenzende Theaterstraße eine weitere Straßenbahnlinie an den Knotenpunkt anknüpfen. Diese wird die Innenstadt mit dem Hubland verbinden.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 27: Essentielle Umsteigeknoten in Würzburg mit der Hauptkomponente öffentlicher Verkehrsmittel: Einbindung von Optionen der intermodalen Fortbewegung (eigene Darstellung 2023).
Das Hubland bildet den fünften zu erwähnenden Knotenpunkt ab. Neben einigen kostenfreien Parkplätzen, durch die Position am Stadtrand, bietet dieses aktuell eine Anbindung an mehrere Buslinien, welche bis in die Innenstadt oder direkt an den Hauptbahnhof verkehren. Mit der S 6 wird erstmals das dortig vorhandene ÖPNV-Netz durch eine Straßenbahnlinie erweitert. Des Weiteren sind einige Straßen mit Fahrradstreifen ausgestattet und ermöglichen eine gute Erreichbarkeit mit dem einspurigen Fahrzeug. Für das Hubland ergibt sich die Perspektive, einen Park & Ride Parkplatz zwischen Hubland-Nord und Gerbrunn zu integrieren, um den einfallenden Verkehr aus dem östlichen Umland abzufangen. Dies kann grundlegend in Erwägung gezogen werden.
Summa summarum sind diese fünf Knotenpunkte wesentliche Standorte im Umgang mit dem ÖPNV und teilweise mit dem motorisierten Individualverkehr. Würzburg ist somit in der Berücksichtigung intermodaler Nutzungsoptionen grundlegend ausgestattet. Diese
Strategie hat Perspektiven zur Ausweitung. Genannt werden können die Möglichkeiten im Würzburger Landkreis. Park & Ride Parkplätze, sowie Schotterflächen an relevanten Fernstraßen, könnten den Bürger zur Nutzung der intermodalen Variante überzeugen. Mit dem geplanten Parkhaus am Greinberg, sowie dem eventuell entstehenden Parkdeck am Sander- rasen, könnten zwei weitere Knotenpunkte in der Großstadt entstehen. Der Sanderrasen ist unmittelbar an das städtische Schienennetz angebunden und könnte, ähnlich dem Prinzip der Talavera und des Parkplatzes am Dallenbergbad, für eine intermodale Fortbewegung in der Stadt genutzt werden. Das entstehende Parkhaus am Greinberg kann über Buslinien sowohl in die Innenstadt als auch weitere essentielle Standorte wie dem Gewerbegebiet Lengfeld oder das Hubland an den kombinierten Verkehr anknüpfen.
6.2.4 Nähe durch Reurbanisierung
Die wohl substanziellste Option für eine nachhaltige Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur in städtischen Räumen ist es, die zurückzulegenden Distanzen auf das Nötigste einzuschränken. Wenn der Mensch möglichst nah an seiner Arbeitsstätte wohnt, dann muss er weniger Zeit und Energie in seinen Arbeitsweg stecken. Hier soll das Prinzip der Reurba- nisierung greifen. Diese ist eine von vier aufeinanderfolgenden Phasen der Bevölkerungsbewegung von Agglomerationsräumen (Van den Berg et al. 1982: 25ff.). Die grundlegende erste Phase ist die Urbanisierung. Die Bezeichnung leitet sich vom lateinischen Begriff urbs ab und bedeutet Stadt. Charakteristisch ist für die Urbanisierung eine Bevölkerungsbewegung vom Land in die Stadt. Es kommt zur Verstädterung durch eine starke Konzentration von Wohn- und Arbeitsort innerhalb definierter Gemarkungsgrenzen (Hei- neberg 2017: 56ff.). Diese Art des rasanten Bevölkerungswachstums lässt sich primär mit der Industrialisierung erläutern. Nach der Verstädterung kam es in Deutschland zur Mitte des 20. Jahrhunderts zur Stadtflucht. Konträr zur Landflucht liegt der Fokus bei der Suburbanisierung nicht mehr in der Kernstadt, sondern fortan im Umland der Stadt. Diese Phase geht mit einer stagnierenden oder fallenden innerstädtischen Bevölkerungsentwicklung einher und lässt Ortschaften in der Peripherie entstehen respektive wachsen. Es kommt zu höherer Flächenbeanspruchung. Im gleichen Zug nimmt die Beliebtheit des motorisierten Individualverkehrs zu. Die Arbeitswege werden vermehrt mit dem eigenen Auto zurückgelegt. Anders als bei der Stadtflucht handelt es sich bei der dritten Prozessform, der Desurbanisierung, um eine absolute Abnahme der Bevölkerung eines Agglomerationsraums. Die
Bürger werden nicht mehr nur in die Peripherie gezogen. Sie verlassen den Ballungsraum gänzlich. Begleitet wird die Desurbanisierung daher mit einem fallenden Urbanisierungsgrad. Begünstigt werden dabei Zersiedelungseffekte. Die hier nun zu thematisierende vierte Phase ist die Reurbanisierung. Gleichkommend der Urbanisierung soll ein Bevölkerungswachstum in Städten verzeichnet werden. Das Ziel ist es, die Bevölkerung wieder vermehrt in der Stadt zu konzentrieren, damit weniger Verkehr anfällt sowie Zersiedelung ins Umland vermieden wird. Mit fortschreitender Zersiedelung würden verstärkt essentielle Wälder und landwirtschaftlich genutzte Flächen verloren gehen.
Es gibt verschiedene Vorgehensweisen, um sich mit der Rückwanderung in den urbanen Raum auseinanderzusetzen. Eine Variante sind Aufwertungen von Stadtteilen. Bei der sogenannten Gentrifizierung werden Bezirke derart aufgewertet, dass eine wohlhabendere Bevölkerung angesprochen wird und den Weg zurück in die Stadt bevorzugt. Mittels einer gestiegenen Attraktivität der Viertel könnte das städtische Image verbessert werden (Heineberg 2017: 194). Im Zuge dessen können ebenso die öffentlichen Verkehrsmittel aufgewertet werden. Die Beanspruchung des motorisierten Individualverkehrs könnte sinken. Für Würzburg eröffnet sich die Gentrifizierung als Maßnahme nicht. In der kreisfreien Großstadt liegt ein grundlegender Wohnungsmangel vor. Als Resultat wird der Wohnungsmarkt durch ein hohes Preisniveau gekennzeichnet. Durch die Gentrifizierung würden die ohnehin schon hohen Mietpreise noch stärker in die Höhe getrieben werden. Als Folge könnte eine Verdrängung der vorliegenden Bewohnerschaft die Aufwertungen begleiten. Stattdessen gilt in Würzburg, den Wohnungsmarkt bestmöglich zu erweitern (Interview P. Wiegand 10/2023; 14). Primär soll mithilfe von Nachverdichtungsmaßnahmen erreicht werden, dass sich die Situation des Wohnungsmarktes beruhigen kann. Die Komponente der Verkehrslast kann zusätzlich betrachtet werden. Hierbei liegt der Fokus auf einer möglichst geringen Flächenbeanspruchung. Trotzdem müssen Flächen innerhalb der Gemarkungsgrenzen neu verdichtet werden, um dem Wohnungsmangel entgegenzuwirken. Flächen, die als Erholungsflächen gekennzeichnet sind und genutzt werden, dürfen dafür nicht beansprucht werden. Neu verdichtet werden beispielsweise die großflächigen Freiräume zwischen der Großstadt und den suburbanen Räumen. Wohnsiedlungen entstehen beispielsweise am Hubland, wo Fläche zwischen Würzburg und Gerbrunn zum Residieren erschlossen wird. Für die Innenstadt werden Möglichkeiten evaluiert, Dächer aufzustocken und auszubauen. Da in der Würzburger Innenstadt viele Häuser der Kirche gehören oder in sonstiger privater Hand sind, ist die Auseinandersetzung damit ziemlich prekär. Mögliche Maßnahmen zur Aufstockung oder zum Ausbau sind an die Hauseigner geknüpft. Ebenso muss beachtet werden, dass die Häuser nicht zu hoch gebaut werden, damit keine Verschattungen entstehen sowie Frischluftschneisen verloren gehen.
Allgemein betrachtet ist die Reurbanisierung eine Thematik, deren Durchsetzungsvermögen, bezüglich der Verkehrsinfrastruktur, als recht gering einzuschätzen ist. Sowohl die Nachverdichtung durch Dachaufstockung und -ausbau, als auch der Ausbau auf ungenutzten Freiflächen zwischen der Stadt und den Vororten, ist an einige Hürden geknüpft. Viele Hauseigner können oder wollen bei möglichen Nachverdichtungsmaßnahmen keine Geldmittel aufwenden, um dies zu realisieren. Die Bewohner der suburbanen Standorte sehen indes ihre Lebensqualität bedroht (Interview P. Wiegand 10/2023; 14). Es kommt zu extremen Reibungsverlusten. Zu verstärktem Verkehr und baurechtlichen Problematiken kommen etliche Bürgerinitiativen hinzu, welche den Ausbau der Stadt eindämmen wollen. Sollte dennoch der Wohnungsmangel signifikant durch Neu- und Nachverdichtungen entspannt werden, muss zusätzlich der Umlandbewohner betrachtet werden. Eine Umsetzung der Reurbanisierung erfordert unbedingt, dass bei den Bürgern, welche damit erreicht werden sollen, das nötige Interesse geweckt wird. Im Wesentlichen ist die Bindung des Bürgers zum Wohnort stärker als zum Arbeitsort (siehe Abbildung 28). 45 % der Umfrageteilnehmer geben an, dass es für sie definitiv nicht infrage kommt, auf ein eigenes Fortbewegungsmittel zu verzichten und dafür näher an den Arbeitsplatz zu ziehen. Weitere 27 % sind der Auffassung, dass es für sie ebenfalls kaum bis keine Alternative bietet. Lediglich 3 % der Befragten wären gänzlich damit einverstanden umzuziehen, sollten sie dadurch den Arbeitsweg ohne zusätzliche Hürden und ohne das Auto bewältigen können. Hier greift erneut das Gewohnheitstier des Menschen. Um den Forderungen gerecht zu werden, müsste das gewohnte Umfeld und die eigene Komfortzone verlassen werden. Da es sich anfangs wie eine Pflicht anfühlt, setzt erneut ein Schließungsreflex auf dem Kortex ein, welcher die Option ablehnend betrachtet. Um diesem entgegenzuwirken, ist es von essentieller Bedeutung, dass das Wohnen in der Stadt intensiv beworben wird. Per direkter Kommunikation gilt zu versuchen, das Interesse der pendelnden Bewohner zu wecken.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 28: „Könnten Sie sich vorstellen näher an ihren Arbeitsplatz zu ziehen, um so ein eigenes Fortbewegungsmittel zu vermeiden?" - Zusammenstellung beider Erhebungen (eigene Darstellung 2023).
Summa summarum wird die Nachverdichtung respektive die Reurbanisierung weniger in das Geschehen eingebunden als die zuvor analysierten Alternativen. Die Thematik der Gestaltung neuen Wohnraums bezieht sich überwiegend auf den angespannten Wohnungsmarkt. Mittels Nachverdichtungen den Bewohnern des ferneren Umlands das Wohnen in der Stadt schmackhaft zu machen, würde nur begrenzt funktionieren. Wird sich zu sehr auf dieser Option fixiert und die eigentliche Verkehrsinfrastruktur der Stadt vernachlässigt, könnte daraus resultierend entstehen, dass sich Pendler von Würzburg abkehren und alternative Arbeitsplätze in der Nähe ihres aktuellen Wohnortes aufsuchen. Der Fokus sollte unbedingt weiterhin auf der Gestaltung von Fortbewegungsmöglichkeiten liegen, um eine gute und nachhaltige Verkehrsinfrastruktur in Würzburg bieten zu können sowie die Attraktivität der Stadt aufrechtzuerhalten.
7. Modell „Pyramide der nachhaltigen Mobilität“
Die ausgearbeiteten Alternativen, um die Verkehrslast in Würzburg zu reduzieren und Nachhaltigkeit im Straßenverkehr einzubringen, können unterschiedlich gewichtet werden. Eine essentielle Bedeutung liegt darin, wie effektiv sich die verschiedenen Optionen auf die Nachhaltigkeit und den Entlastungsaspekt auswirken (STA o. J.). Allgemein werden die Alternativen auf drei Hyperonyme segmentiert. Diese können in einer Pyramide dargestellt und erläutert werden (siehe Abbildung 29). Als umweltfreundlichste und nachhaltigste Form der Fortbewegung wird das Zufußgehen betrachtet. Folglich ist der erste Oberbegriff jener der Vermeidung. Damit wird assoziiert, dass auf Fortbewegungsmittel verzichtet wird. Das Optimum würde erreicht werden, indem jegliche Individuen auf den Fußverkehr zurückgreifen oder weitestgehend die Fortbewegung größerer Distanzen meiden würden. In diesem Kontext können als Alternativen der Ausbau der Städte und Vororte aufgegriffen werden. Mit einer möglichst guten Erreichbarkeit für etliche Güter der Grundversorgung im unmittelbaren Umfeld kann erreicht werden, dass für die Besorgung dieser auf keine Fortbewegungsmittel mehr zurückgegriffen werden müsse. Ebenso fallen die Möglichkeiten der Telearbeit sowie die Nutzung von Fahrgemeinschaften unter die Rubrik des Verzichts. Das Einbinden von Fahrgemeinschaften wird ebenfalls bereits unter der Vermeidung aufgegriffen, da weiterhin dasselbe Fortbewegungsmittel genutzt wird, dadurch allerdings weniger von diesen im Straßenverkehr unterwegs sind. Das Vermeiden von Verkehrsmitteln ist allerdings für die Mehrheit der Bevölkerung nicht möglich. Die moderne Gesellschaft und die gebotene Infrastruktur begünstigen, dass weitere Distanzen zurückgelegt werden sowie die Standorte des Wohnens und des Arbeitens etliche Kilometer auseinanderliegen können. Demzufolge ist es für unzählige Bürger nicht möglich, auf Fortbewegungsmittel zu verzichten. Allerdings könnten diese, insofern es die vorliegende Verkehrsinfrastruktur zulässt, den Verkehr verlagern. Mit der Verlagerung werden die Perspektiven aufgegriffen, sich vom motorisierten Individualverkehr abzuwenden und nichtmotorisierte Möglichkeiten sowie öffentliche Verkehrsmittel zu berücksichtigen. Vorzugsweise kann für mittlere Distanzen das Fahrrad respektive das E-Bike in Erwägung gezogen werden. Bei einem gut ausgebauten Netz des ÖPNV könnte dies dem Pkw vorgezogen werden. Der dritte Oberbegriff umfasst die restlichen Alternativen. Dabei liegt der Fokus darauf, den weiterhin vorliegenden motorisierten Individualverkehr nachhaltig aufzuwerten. Das Verbessern wird im Wesentlichen von Ansätzen der E-Mobilität und weiteren CO2-neutralen Varianten begleitet. Die Pyramide kann genutzt werden, um im Neugestaltungsdenken verschiedene Alternativen, entsprechend ihrem Potenzial und ihrer Wichtigkeit im Raum, spezifisch und effizient einzubinden. Zum Exempel kann der Fokus für eine ausgebaute Infrastruktur im Landkreis Würzburg zum Erreichen der kreisfreien Großstadt nicht auf der Vermeidung liegen, sondern überwiegend auf der Verlagerung sowie ergänzend auf der Verbesserung. Die Darstellung respektive das bereitgestellte Modell ermöglicht eine Orientierung in der Abwägung von Alternativen für die zukünftige Umgestaltung.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 29: Pyramide der nachhaltigen Mobilität (STA o. J.).
8. Abwägung von Kommunikationsmöglichkeiten
Ein essentieller thematischer Terminus, welcher während der bisherigen Ausarbeitung mehrfach aufgegriffen wurde, ist der Informationsaustausch. Sowohl zwischen den ganzheitlich beteiligten Akteuren als auch von diesen mit der Bevölkerung wird in der Gegenwart eine professionelle und sachlich-fachliche Kommunikation erwünscht. Der zwischenmenschliche Verkehr wird zwischen den handelnden Personen, welche in die Planungen und Umsetzungen eingebunden sind, mit einer hohen Relevanz festgesetzt. Um dafür zu sorgen, dass die geplanten Ziele zur Nachhaltigkeit erreicht werden können, müssen unbedingt fachlich begabte Personen in das Geschehen eingebunden werden. Dafür sorgt vorzugsweise die KoSA (Interview P. Wiegand 10/2023; 1f.). Dort werden, neben städtischen Mitarbeitern und Mitgliedern des Stadtrates, ebenso freiberufliche Architekten, Stadtheimatpfleger sowie Institutionen mit Bezug auf die Thematik eingebunden. Mittels sachlich-fachlicher Auseinandersetzung und der richtigen Kommunikation soll bewirkt werden, dass die zu behandelten Themen sorgfältiger und effektiver abgearbeitet werden. Des Weiteren gilt Zeit einzusparen, indem umfangreicheren Diskussionen fachlich schneller nachgegangen wird. Als ein Exempel ist dahingehend erneut die anhaltende Diskussion um den eingeplanten Grünstreifen auf der Veitshöchheimer Straße aufzugreifen.
Demgegenüber steht der kommunikative Austausch mit den Bürgern. Die Bevölkerung macht eine wesentliche Komponente der zukünftigen städtischen Entwicklung aus. Ist der Bürger unzufrieden, könnte sich dieser langfristig vom unterfränkischen Regionalzentrum abwenden. Um zu verhindern, dass durch Neu- und Umgestaltungsmaßnahmen die Attraktivität der Stadt sinkt, gehört der Bürger unbedingt in die Geschehnisse eingebunden. Wird die Bevölkerung verstärkt einbezogen, entsteht bei diesen ein Gemeinschaftsgefühl. Das gemeinsame Evaluieren von Möglichkeiten sowie die Übermittlung von entscheidenden Informationen über kommende Umgestaltungsmaßnahmen kann bei den Bürgern eine höhere Akzeptanz erzeugen. Sie fühlen sich in den Arbeitsablauf ihres unmittelbaren Umfelds integriert und können dies mit einer grundlegenden Sicherheit verbinden. Beispielsweise wurde im Voraus an die Platzumgestaltung vor der Kirche St. Albert im Stadtbezirk Lindleinsmühle ein Beteiligungsverfahren eingebunden. Der Platz, an welchen ein Kindergarten angrenzt, wurde von Mitarbeitenden des Fachbereichs Stadtplanung der Stadt Würzburg aufgesucht. Den querenden Bürgern wurden Gestaltungsmöglichkeiten für ein Spielgerät für Kinder vorgestellt, welches bei der Neugestaltung eingebunden werden soll. Die einzelnen Individuen, welche sich die Alternativen angesehen haben, durften dafür abstimmen. Zeitgleich wurde Aufklärungsarbeit zum Gesamtprojekt betrieben. Durch das Einbinden der Leute in das Geschehen konnte eine grundlegende Akzeptanz und Zufriedenheit für die aufkommenden Gestaltungsmaßnahmen wahrgenommen werden. Indem die vorliegende Bevölkerung derart einbezogen wird, fühlen sie sich somit stärker damit verbunden und nehmen die Veränderungsprozesse selbstverständlicher wahr. Daher wird mittlerweile verstärkt versucht, Bürgerbeteiligungen in Würzburg zu integrieren und zu etablieren (Interview P. Wiegand 10/2023; 14). Zum Exempel wurde stetig versucht, die Bürger bei den vorbereitenden Untersuchungen im Bischofshut bestmöglich einzubinden. Um die Bevölkerung zukünftig regelmäßig integrieren zu können, soll ein Raum im Mozart- Gymnasium gestellt werden. Dieser soll dazu genutzt werden, dass Bürgerbeteiligungen durchgeführt werden können. Des Weiteren soll dieser Raum eine grundlegende Infrastruktur für einen Informationsaustausch zwischen Bürgern und Sachbearbeitern bieten. Die Möglichkeiten zu Beteiligungen sollen verschiedenartig eingebunden werden (Interview M. Weber 10/2023; 15). Es gibt unterschiedliche Optionen, Beteiligungsverfahren durchzuführen. Dazu gehören vorzugsweise moderierte Arbeitsgruppen, Workshops oder Informationsveranstaltungen. Je nachdem, wie groß die Zielgruppe ist und welche Thematik aufgearbeitet werden soll, kann zwischen verschiedenen Möglichkeiten ausgewählt werden. Um die Öffentlichkeitsbeteiligungen noch erreichbarer zu gestalten, sollen diese über das Internet an den Menschen gebracht werden (Interview U. Kömpel 10/2023; 15). In diesem Kontext ist eine Online-Plattform entstanden. Über die Website „Würzburg mitmachen“, welche von der Stadt Würzburg gestellt wird, können verschiedene Umfragen, Beteiligungsmöglichkeiten und fachliche Informationsbeiträge abgerufen werden (Stadt Würzburg o. J. B). Über die Plattform werden die verschiedensten Projekte aufgezeigt. Es kann auf dazugehörige essentielle Informationen zurückgegriffen werden. Selbiges gilt ebenso für bereits abgeschlossene Projekte.
Werden die Meinungen der Bevölkerung zu den angebotenen Beteiligungen und dem Informationsaustausch seitens eingebundener Akteure erfragt, kommt überwiegend Unmut auf (siehe Abbildung 30). 55 % der Befragten in Würzburg haben angegeben, dass sie unzufrieden mit der Kommunikation sind und die Bürger stärker eingebunden werden müssen. Weitere 19 % sind teilweise mit dem Informationsaustausch zufrieden und verbinden ebenfalls eine nötige Aufarbeitung damit. Lediglich 2 % der Teilnehmenden haben angegeben, dass sie mit der Kommunikation zufrieden sind. Trotz der erläuterten Möglichkeiten, welche die Stadt mittlerweile bietet und weiterhin ausbauen möchte, sind die Bürger mit der aktuellen Situation ersichtlich unbefriedigt. Doch wenn von städtischer Seite ein grundlegendes Angebot vorliegt, die Menschen dennoch unzufrieden sind und sich nicht beteiligt fühlen, dann befindet sich das Problem an einer anderen Position. Im Austausch mit den Beteiligten der Umfrage konnte herauskristallisiert werden, dass mehrheitlich keine Kenntnisse zur Online-Plattform „Würzburg mitmachen“ vorliegen. Das bedeutet, dass die Strukturen zur Aufklärungsarbeit sowie den Beteiligungsmöglichkeiten stärker beworben werden müssen. Damit die Bürger etwas dazu beitragen können, müssen diese im Voraus auf die Öffentlichkeitsbeteiligungen aufmerksam gemacht werden. Viele Leute scheinen einfach nicht zu wissen, dass es diese Möglichkeiten mittlerweile gibt und erhoffen sich weiterhin, dass diese irgendwann realisiert werden. Dabei werden diese schon eingebunden. Im Sinne der partizipierenden Akteure aus Politik, Wirtschaft und Stadt, welche eine stärkere Bürgerbeteiligung bewirken wollen, sei folglich zu beachten, dass zukünftig adäquat Werbung betrieben wird. Als Plattform könnte dahingehend die WVV dienen. Die GmbH stellt eine eigene Applikation zur Verfügung. Über diese können Tickets sowie Fahrpläne abgerufen werden. Die App könnte einen zusätzlichen Nutzen bekommen, um gezielt auf die Öffentlichkeitsbeteiligungen aufmerksam zu machen. Selbiges gilt für die Busse und Straßenbahnwagen der WVV. Vor allem die Fahrzeuge des städtischen Schienennetzes werden vermehrt genutzt, um damit Werbung zu betreiben. So ist es nicht unüblich, Straßenbahnen mit dem Aufdruck von Supermärkten, Kreditinstituten, Sportvereinen und mehr zu erblicken. Diese Option könnte gezielt genutzt werden, um auf Beteiligungsverfahren sowie die Online-Plattform der Stadt Würzburg aufmerksam zu machen. Für die vorhandenen Bus- und Straßenbahnhaltestellen kann dies ebenfalls evaluiert werden. Häufig sind an diesen Schaukästen angebracht. In den Kästen befinden sich überwiegend Fahrpläne, allerdings ebenso werbende Artikel. Die Schaukästen könnten ebenfalls genutzt werden, um die Neugierde der Bürger zu wecken. Ähnlich könnte dies mit dem ÖPNV im Landkreis Würzburg gehandhabt werden. Sowohl die Busse sowie die Haltestellen in unmittelbar angrenzenden Vororten könnten der Stadt für Werbezwecke dienen. Eine weitere Option bringen Werbeschilder ein. Diese könnten an den pendelnden Autofahrer gerichtet werden. Mit einer Platzierung direkt am Straßenrand wird der Nutzer des Kfz darauf aufmerksam gemacht. Im Wesentlichen könnte sich dies auf den viel befahrenen Einfallstraßen eignen. Als Exempel könnte ein Werbeschild an der Gabelung der B 27 in Höchberg, in Richtung Ortseingang Würzburg, zur Aufklärungsarbeit dienen. Genauso können die Veitshöchheimer Straße, die B 8 aus Richtung Rottendorf sowie die durch Würzburg führende B 19 potenziell mit Werbeschildern ausgestattet werden. Von der A 3 über die B 19 nach Würzburg einfahrend befindet sich ein digitaler Bildschirm, der über verschiedene Umstände in der Stadt Aufschluss gibt. Dort werden Informationen wie vorzugsweise zu einer gesperrten Talavera oder einem stauenden Verkehr in der Stadt aufgezeigt. Der Bildschirm kann ebenfalls genutzt werden, um auf die städtische Online-Plattform hinzuweisen. Neben Werbetafeln könnten die Intensionen kleinräumiger auf Werbeplakaten und Litfaßsäulen repräsentiert werden.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 30: „Sind Sie zufrieden mit der Kommunikation zwischen Stadt, Politik und sonstigen Akteuren mit den Bürgern, wenn es um infrastrukturelle Veränderungen in der Stadt geht?" - Ergebnis aus der Würzburger Umfrage (eigene Darstellung 2023).
Im Allgemeinen ist es von essentieller Bedeutung, dass für die Beteiligungsverfahren Werbung betrieben wird. Wenn die Stadt die Möglichkeiten bietet und auf stärkere Beteiligungen hofft, dann muss der Bürger auf die Optionen gestoßen werden. Denn wenn dieser keine Anhaltspunkte dazu besitzt, dann wird er sich nicht mit den Möglichkeiten auseinandersetzen können und weiterhin der Auffassung sein, dass es keine Beteiligungen sowie keinerlei Informationsaustausch gibt. Mit verschiedenen Werbemöglichkeiten wird ebenso das Interesse der Berufspendler für die Beteiligungen geweckt. Werden vermehrt Menschen eingebunden, dann bekommen diese mittels Öffentlichkeitsbeteiligungen und gerechter Aufklärungsarbeit ein Gefühl von Sicherheit und Relevanz in der Stadt. Ein sorgfältiger Informationsaustausch sowie der Einbezug in das städtische Geschehen können der psychologischen Hürde des Gewohnheitstiers entgegenwirken. Eine gesteigerte Akzeptanz sowie eine glücklichere respektive tolerantere Bewohnerschaft wäre das Resultat. Zu erwähnen sei zusätzlich, dass durch Werbung nicht jeder Bürger erreicht werden kann. Es muss ebenso von dessen Seite der Wille zur Einbindung vorhanden sein. Die Werbung kann allerdings einen großen Effekt darauf haben, wie viele Menschen in die Beteiligungen eingebunden sind und Personen dazu animieren, sich zu beteiligen.
9. Annährung über Smart City Entwicklungskonzepte
Mit der Online-Plattform „Würzburg mitmachen“ wurde ein Forum integriert, welches die Bürger stärker in das Geschehen einbinden soll. Die Initiative, die Bevölkerung intensiver in die städtische Entwicklung einzuspannen, ist vorhanden. Mit einem stärkeren Fokus darauf, die Plattform und die Öffentlichkeitsbeteiligungen gezielter zu bewerben, kann die soziale Resilienz in der Stadt gefördert werden. Dieses Gemeinwohl wird im Wesentlichen vom Fachabteil Smarte Region Würzburg des Fachbereichs Wirtschaft, Wissenschaft und Standortmarketing aufgegriffen (Stadt Würzburg o. J. A). Ein Bestandteil dessen ist es, sich um die Erweiterung sowie die Verbesserung der Online-Plattform zu kümmern. Der Schwerpunkt des Fachabteils liegt darin, sich den benötigten Entwicklungsprozessen der Stadt objektiv und optimistisch entgegenzustellen und dafür zu sorgen, dass die Stadt ihre Funktionsfähigkeiten beibehalten respektive diese langfristig verbessern kann. Bei den betrachteten Entwicklungsansätzen geht es darum, die Stadt technologischer, ökonomischer, ökologischer und sozialer zu gestalten. Da Veränderungen in einer Stadt wiederkehrende Prozesse sind, wird der Bürger ins Zentrum des Vorgehens gerückt. Der Mensch, dessen Gewohnheiten Veränderungen mit Schließungsreflexen prinzipiell abblocken, soll die Prozesse zukünftig als einen essentiellen Vorgang wahrnehmen können. Die Infrastruktur für die Öffentlichkeitsbeteiligungen soll ausgebaut werden. Sowohl stationär als auch digital. An verschiedenen Standorten, sowohl in der kreisfreien Großstadt sowie im umschließenden Kragenkreis, sollen Workshops und Seminare angeboten werden, bei denen sich unmittelbar mit den Veränderungsprozessen und den möglichen Entwicklungsalternativen auseinandergesetzt werden kann. Auf der Online-Plattform sollen darüber hinaus Foren entstehen, in denen sich zu bestimmten Thematiken respektive Projekten ausgetauscht werden kann. Als Exempel konnte sich die Bevölkerung auf der Plattform beteiligen, nachdem das Planfeststellungsverfahren zur S 6 abgeschlossen war. An die neu gedachte Straßenbahnlinie wird öffentlicher Raum angeschlossen. Dieser soll im Zuge dessen ebenfalls eine angemessene Aufwertung widerfahren. Neben dem Wittelsbacherplatz können dahingehend der Josef-Stangl-Platz sowie der Geschwister-Scholl-Platz evaluiert werden. Die Webseite „Würzburg mitmachen“ bietet nicht nur die Möglichkeit der Abstimmung. Die Bürger können sich obendrein mit Ideen und eigenen Bedürfnissen integrieren, die in sachlichen Diskussionsforen abgehandelt werden. Abschließend werden daraus gewonnene Impulse für die zukünftige Planung aufgegriffen. Es wird sich also nicht nur beteiligt, indem die städtischen Vorschläge angenommen oder abgelehnt werden. Primär wird das Bedürfnis der Bürger stärker gewichtet. Im Kontext der zur anstehenden neuen Straßenbahnlinie angehenden Platzgestaltungen werden übergeordnete Thematiken der Barrierefreiheit, der Aufenthaltsqualität sowie der Wertigkeit von Fahrrad- und Fußgängerwegen aufgegriffen. Allerdings sei hier ebenfalls festzuhalten, dass es von essentieller Bedeutung ist, ausreichend Promotion für die Beteiligungsmöglichkeiten und die Online-Plattform zu machen. Ohne den nötigen Werbeaspekt und die Möglichkeit, darauf aufmerksam zu werden, kann das maximale Potenzial nicht ausgeschöpft werden. Dafür sollten Geldmittel bereitgestellt und generell eine ausreichende Kommunikation zu Akteuren, wie vorzugsweise der WVV, aufgebaut werden, welche die städtischen Intentionen aufgreifen und einspannen können.
Generell werden gegenwärtig vermehrt Smart City Konzepte aufgegriffen und entgegengenommen, um Entwicklungsprozesse nachhaltig lenken zu können (Interview U. Kömpel 10/2023; 2). Das gilt ebenso für Projekte zur Verkehrsinfrastruktur in Würzburg. Beispielsweise wurden Smart City Ideen und Impulse aufgegriffen, um den Verkehr gezielter durch das Straßensystem in Würzburg führen zu können. Es handelt sich um Verkehrs- und Parkleitsysteme. Verkehrsleitsysteme werden bewusst eingebunden, um die Ampelschaltung auf Hauptverkehrsstraßen in Würzburg zu optimieren. So wird der Input genutzt, um das häufige Bremsen und Anfahren an Ampeln zu reduzieren. Unmittelbar aufeinanderfolgende Ampeln werden so geschaltet, dass bei Fahren der erlaubten Geschwindigkeit die Ampeln kontinuierlich in einem Zug überquert werden können (Interview M. Weber 10/2023; 2). Dieser Effekt ist beispielsweise an den dicht aneinandergereihten Ampeln an Röntgen- und Haugerring positiv zu beobachten. Ebenso werden Bewegungssensoren eingebracht, die erkennen sollen, wenn jemand an einer Ampel wartet respektive auf diese zufährt. Dadurch können sich Ampeln selbstständig regulieren und je nach Bedarf die Schaltung durchführen. Des Weiteren könnte eine intelligente Nutzung bei Fußgängerampeln eingebracht werden. Mittels integrierter Kameras, welche die Anzahl an Passanten wahrnehmen können, wären regulierte Grünphasen möglich. Wartet zum Exempel nur eine Person an der Ampel, dann reicht eine kürzere Grünphase aus als bei einer Schulklasse. Bei Parkleitsystemen können Smart City Ideen eingebunden werden, um parkplatzsuchende Pkw-Fahrer gezielt zu freien Parkgaragen zu leiten. Mittels dynamischer Anzeigetafeln, welche die Anzahl freier Parkplätze in Parkgaragen anzeigen, kann der Nutzer des motorisierten Individualverkehrs gezielt darauf zusteuern. Diese werden in Würzburg bereits eingebunden, um die wichtigsten und größten Parkhäuser und -garagen kenntlich zu machen. Im Zuge der möglichen Bewirtschaftung von Talavera und dem Parkplatz am Dallenberg- bad könnten diese mit den dynamischen Hinweistafeln mit den akkuraten Anzahlen an freien Stellplätzen ausgewiesen werden. Die Einbringung technologischer Funktionen ermöglicht darüber hinaus die Nutzung von Parkhäusern, ohne Parktickets ziehen zu müssen. Mithilfe von Kameras, welche die Kennzeichen der Fahrzeuge aufnehmen können, wird das Parken von Parktickets getrennt und auf das Fahrzeug ausgelegt. Vor allem für Pendler, welche Langzeittickets für Parkhäuser erwerben, kann dadurch das Parken einfacher gestaltet werden. Der abgeschlossene Vertrag zur Langzeitnutzung wird mit dem System der jeweiligen Parkgarage verknüpft. Das Kennzeichen wird registriert, wodurch der Nutzer, ohne jeglichen Aufwand, sowohl in das Parkhaus ein- sowie ausfahren kann. Ein weiterer Ansatz geht auf den generellen Ausbau digitaler Möglichkeiten zurück. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden die Menschen dazu gedrängt, von zu Hause zu arbeiten. Dieser Ansatz kann verwendet und aufgearbeitet werden, um daraus einen Nutzen der Nachhaltigkeit zu ziehen. Die Förderung der Telearbeit mit einem festen Arbeitsstandort, im eigenen häuslichen Umfeld, reduziert die Straßenverkehrslast gänzlich, da sich die Individuen den Verkehrsweg vollumfänglich einsparen können. Summa summarum führen Smart City Entwicklungskonzepte technologische, ökonomische, ökologische und soziale Aufwertungsmaßnahmen mit sich. Es werden nicht nur die Maßnahmen per se betrachtet, sondern ebenso die Stadt Würzburg, welche sich intensiver mit dem Überbegriff Smart City auseinandersetzen möchte. Mit dem Fachabteil Smarte Region Würzburg wird versucht, die soziale Resilienz zu steigern. Dabei wird der Fokus auf die Kompetenzen gelegt, den Bürger bestmöglich in die Belange einzubinden. Mittels der dabei entstehenden Impulse und einer adäquaten Promotion für die Beteiligungsmöglichkeiten sowie den etlichen Ansätzen an Smart City Konzepten kann die Entwicklung der Würzburger Verkehrsinfrastruktur positiv gelenkt werden.
10. Fazit
Um in das eigentliche Hauptthema der psychologischen Hürden der Entwicklung der städtischen Verkehrsinfrastruktur in Würzburg einzuleiten, ist eine fachlich-sachliche Beschreibung über themenbezogene Inhalte herangezogen worden: Die Infrastruktur Würzburgs wird durch städtebauliche Maßnahmen verschiedener Epochen geprägt. Es fließen mittelalterliche sowie frühneuzeitliche Komponenten der Renaissance und des Barocks ein. Für die Verkehrsinfrastruktur kann im Wesentlichen die Phase des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg herangezogen werden. Der Fokus auf das Auto sowie die Trennung von Wohn-, Freizeit- und Arbeitsort bilden die Grundlagen für die autogerechte Stadt. In der Gegenwart werden vermehrt die Nachhaltigkeit und der Klimaschutz in den Mittelpunkt gerückt. Ziele für nachhaltige Entwicklung, wie jene der Agenda 2030, sollten berücksichtigt und bestmöglich umgesetzt werden.
Mittlerweile wird versucht, sich diesen Anforderungen in Würzburg anzunehmen. Dafür wurden im Voraus etliche Potenziale aufgenommen und evaluiert. Für die autogerechte Stadt bilden die Ziele der Agenda 2030 einen enormen Druck aus. Mit präterpropter 56.000 täglichen Einpendlern und dem starken Durchgangsverkehr entstehen regelmäßig hohe Auslastungen auf den Einfallsstraßen, der Nordtangente und dem Südring. Für die Innenstadtgestaltung wird der Fokus darauf gelegt, diese so autofrei wie möglich gestalten zu können. Eingegrenzt auf den Bischofshut sollen langfristig alle Oberflächenparkplätze sowie etliche asphaltierte Flächen weichen. Mit regionalen Produkten, vorzugsweise einer Pflasterung aus Muschelkalk sowie Betonsteinen in Kalkoptik und neuer Begrünung, soll die Aufenthaltsqualität aufgewertet werden. Mit den feststehenden Neugestaltungsmaßnahmen der Theaterstraße, der Balthasar-Neumann-Promenade und den bereits begonnenen Umbauten in der Karmelitenstraße werden diesbezüglich die ersten Grundsteine gesetzt. Um den Würzburger Südring zu entlasten, soll eine erweiterte und neue Bundesstraße im westlichen Umland dienen. Mit der B 26n soll das städtische Verkehrsaufkommen vom Durchgangsverkehr zwischen A 3 und A 7 bereinigt werden. Durch einige planerische Auseinandersetzungen in Politik und Gesellschaft konnte dieses Projekt sehr lange nicht realisiert werden. Bezüglich des essentiellen Nutzens kann allerdings davon ausgegangen werden, dass die Bundesstraße langfristig eingebunden wird. Um die Projekte der Stadt zu finanzieren, werden Fördertöpfe mobilisiert. Wichtigster Geldgeber ist dahingehend die Städtebauförderung, welche verschiedene Fördertöpfe zur Verfügung stellt. Eines dieser ist beispielsweise unter der Bezeichnung „Sozialer Zusammenhalt“ bekannt. Bis 2019 war dieses Programm noch unter dem Namen „Stadt und Ortsteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt“ gängig. Würzburg bezog Fördermittel aus diesem Fördertopf beispielsweise für die Aufwertungsmaßnahmen im Stadtbezirk Zellerau. „Wachstum und Erneuerung“ ist das Förderprogramm der Städtebauförderung, welches für die Innenstadtgestaltung primär herangezogen wird. Ein geringer Anteil des Kapitals wird aus Stellplatzablösen bezogen. Allgemein können aus den bereits geplanten Umbaumaßnahmen in Würzburg positive Effekte entnommen werden. Das Stadtklima kann von den Veränderungen profitieren. Eine hellere Oberflächenstruktur und die eingeplante Begrünung bedingen eine fröhlichere Atmosphäre sowie eine aufgebesserte Aufenthaltsqualität. Ebenso fließen eine geminderte Lärmbelästigung sowie schonende Verhältnisse für die mentale Gesundheit mit ein.
Im Zuge von Veränderungsprozessen in Agglomerationsräumen muss der Bürger betrachtet werden. Im Mittelpunkt dessen stehen die menschlichen Angewohnheiten. Der Begriff der Gewohnheiten hat sowohl positive als auch negative Eigenschaften. Bezüglich der Veränderungsprozesse ist der Begriff eher negativ behaftet. Abrupte Veränderungen können enorme Hürden für einzelne Personen darstellen. Diese können im schlimmsten Fall mit schwerwiegenden mentalen Belastungen einhergehen. Dreh- und Angelpunkt der Gewohnheiten ist der Kortex. Auf diesem entstehen Reaktionen aus angeborenen Reizen, welche auf Stimuli von außen treffen. Die angeborenen Reize, wie beispielsweise das Zwinkern oder das Atmen, sind dem Menschen von Natur aus gegeben. Die Stimuli von außen werden mit Lernprozessen assoziiert, also zum Exempel über die jeweiligen Sinnesorgane wahrgenommene Reize. Auf der Hirnrinde treffen die verschiedenen Stimuli aufeinander, wodurch bedingte Reaktionen entstehen. Zum Exempel wird eine bedingte Reaktion zur Fortbewegung gebildet, wenn ein Individuum regelmäßig das Auto benutzt. Es wird zur Gewohnheit. Treffen neue Reize auf die bereits bestehende Reaktion, entsteht ein Schließungsreflex. Das bedeutet, die etablierte Reaktion nimmt dies als Angriff wahr und verschließt sich. Das kann mit den Veränderungsprozessen assoziiert werden. Ein aufgezwungener Umstieg vom motorisierten Individualverkehr auf den ÖPNV, ohne mögliche Eingewöhnungszeit und nötige Überzeugungsarbeit, lässt den Menschen gestresst und angegriffen reagieren. Mit den Veränderungen wird dann eine Einbuße des eigenen Wohlstandes respektive der eigenen Sicherheit aufgefasst und mit Einschränkungen gleichgesetzt. Wird dies nicht unterbunden, dann reagiert der Mensch emotional. Um die ungewollten Emotionen zu überbrücken, kann nicht mehr auf Rationalität zurückgegriffen werden. Indes wird mit Emotionen reagiert, welche je nach Individuum am stärksten vorhanden sind. Es können Aggressionen, Trauer und Depressionen folgen. Generell hat sich die Fortbewegung, abseits des Zufußgehens, bereits in den letzten Tausenden Jahren stetig weiterentwickelt. Das Reiten von Nutztieren, über die Erfindung des Streitwagens bis hin zur Kutsche. Im 19. Jahrhundert, im Zuge etlicher Innovationen während der Industrialisierung, konnte das Automobil entstehen. Bis in die Gegenwart konnte sich das Auto als beliebtestes Fortbewegungsmittel in Deutschland etablieren. Es ist zwar festzuhalten, dass ebenso auf andere Verkehrsmittel wie den ÖPNV oder das Fahrrad zurückgegriffen wird, zum aktuellen Zeitpunkt ist jedoch das eigene Fahrzeug unangefochten an der Spitze. Dabei spielen Faktoren der Bequemlichkeit, der Flexibilität, des zeitlichen Aufwands und Kosten eine wesentliche Rolle. Im Zusammenspiel mit den aufkommenden Problematiken der Gewohnheiten können diese als gegenwärtige Hürden aufgegriffen werden, weswegen eine Vielzahl an Bürgern einen Wechsel auf andere Verkehrsmittel abblockt.
Die Stadt steht vor einigen städtebaulichen Herausforderungen. Im Umgang mit den Neugestaltungsmaßnahmen darf nicht eingleisig vorangeschritten werden. Es müssen etliche Möglichkeiten in Erwägung gezogen werden, um den Bürgern ausreichend Alternativen bieten zu können. Dabei werden neben den Einwohnern der Stadt ebenfalls die Pendler einbezogen, welche die Stadt täglich mit dem eigenen Pkw ansteuern und verlassen. Auf der einen Hand werden Optionen geboten, welche Aufwertungen für den motorisierten Individualverkehr einbringen. Es werden Fahrgemeinschaften und Carsharing betrachtet. Mit Fahrgemeinschaften könnte die Verkehrsauslastung deutlich reduziert werden. Anstattmehrerer einfach besetzter Fahrzeuge wären vermehrt mehrfach besetzte Pkw unterwegs. Einige Bürger machen bereits von der teilindividuellen Variante Gebrauch, weitere würden gerne daran anknüpfen. Durch einige Hürden, wie beispielsweise unterschiedliche Arbeitszeiten oder sonstige Erledigungen vor oder nach der Arbeit, können einige Personen nicht darauf zurückgreifen. Das Carsharing ist ebenfalls eine teilindividuelle Fortbewegungsmöglichkeit. Im privaten Carsharing kann sich mit anderen Personen, vorzugsweise mit Freunden oder dem Nachbarn, ein Auto geteilt werden. Beim öffentlichen Carsharing werden Autos von Unternehmen gestellt, um eine Strecke in einem festgelegten Bereich oder gebunden an einen Start-Stop-Standort zurücklegen zu können. Das Prinzip der High- Occupancy vehicle lane kann die Nutzung des gemeinsamen Fahrens befeuern. Die Fahrgemeinschaftsspuren ermöglichen, dass auf diesen lediglich mehrfach besetzte Fahrzeuge queren dürfen. Diese könnten eine Entlastung des Straßenverkehrs mit sich führen, wenn die Verkehrsteilnehmer aus demselben Grund eine Strecke befahren. Allerdings könnte konträr ein stärkerer Rückstau entstehen, wenn viel Durchgangsverkehr auf einer Straße vorliegt. E-Zonen wären darüber hinaus eine Option, die Nutzung CO2-neutraler Pkw zu fördern. E-Zonen sind in Deutschland gegenwärtig nicht gebräuchlich. Hierzulande wird hauptsächlich auf Umweltzonen zurückgegriffen. Die wohl interessanteste Thematik für den motorisierten Individualverkehr stellen Parkplätze dar. Sollen etliche Oberflächenparkplätze im Bischofshut weichen, so müssen neue Parkflächen außerhalb und am Rand der Innenstadt entstehen. Es werden vermehrt Standorte evaluiert, an denen neue Parkhäuser und -garagen realisiert werden können. Dabei wird nicht nur innerhalb der Gemarkungsgrenzen der kreisfreien Stadt gearbeitet, sondern darüber hinaus der Landkreis Würzburg für mögliche Park & Ride Parkplätze begutachtet. In Würzburg steht der großflächige Parkplatz Talavera im Mittelpunkt. Dieser wird, nach dem missglückten Versuch einer Bewirtschaftung, zukünftig nicht mehr als Stadtentwicklungsfläche betrachtet und bleibt vorerst kostenfrei.
Einige dieser Optionen können nur aufgegriffen und angepasst werden, wenn Alternativen zum Pkw greifbar sind. Allen voran wird der ÖPNV betrachtet. Dieser muss ausreichend ausgebaut sein, um als Alternative in Betracht gezogen werden zu können. Neben den öffentlichen Verkehrsmitteln in der kreisfreien Großstadt werden zudem die Anbindungen ins Umland betrachtet. Diese sind in einigen Belangen ausbaufähig und müssen, im Zuge der Umgestaltungsmaßnahmen, berücksichtigt werden. Zudem können Optionen des nichtmotorisierten Individualverkehrs aufgegriffen werden. Allen voran die Nutzung des Fahrrads, welches in der kürzeren Vergangenheit ein steigendes Interesse von Bürgern der Stadt und der näheren Umgebung widerfahren hat. Diesbezüglich muss für den Fahrradfahrer eine grundlegende Sicherheit im Straßenverkehr geboten werden können. Es können Fahrradstraßen und -wege in Erwägung gezogen werden. Zusätzlich können diese für Elektrofahrräder bereitgestellt werden, was eine schnellere und kräftesparende Option bietet. Generell soll eine intermodale Fortbewegung fokussiert werden. Es handelt sich um die Fortbewegung mit mehreren Verkehrsmitteln auf einer Wegstrecke. Mithilfe von Umsteigeknotenpunkten soll garantiert werden, dass etliche Anbindungen bestehen und sich schnell durch die Stadt fortbewegt werden kann, ohne in dieser das Auto benutzen zu müssen. Zu solchen Knotenpunkten zählen beispielsweise der Hauptbahnhof, der Barbarossa- platz sowie das Hubland. Park & Ride Parkplätze im Umland sowie der Parkplatz am Dal- lenbergbad und die Talavera können für eine kombinierte Nutzung von Pkw mit weiteren Alternativen in Betracht gezogen werden. Als Letztes werden mögliche Reurbanisie- rungsmaßnahmen respektive Nachverdichtungsmöglichkeiten betrachtet. Die Stadtbezirke sollen als beliebte Wohnstandorte vorangehen. Generell wird der Würzburger Wohnungsmarkt durch hohe Mieten gekennzeichnet. Diese Situation muss beruhigt werden, um Würzburg als attraktiven Wohnstandort hervorzuheben.
Prinzipiell können die Alternativen auf drei Oberbegriffe separiert werden, welche in einer Pyramide dargestellt werden können. Diese Hyperonyme lauten vermeiden, verlagern und verbessern. Vermeiden erhält die primäre Position, da auf jegliche Fortbewegungsmittel verzichtet oder eines zusammen genutzt wird. Verlagern steht in der Mitte, da auf andere Verkehrsmittel, wie dem ÖPNV oder das Fahrrad, umgestiegen wird. Verbessern wird am geringsten priorisiert. Hierbei handelt es sich um Optionen, um diejenigen befriedigen zu können, welche unbedingt an ihrem gewohnten Standard festhalten wollen oder aufgrund mangelnder Alternativen dies beibehalten müssen. Hierbei werden überwiegend CO2neutrale Pkw-Alternativen aufgegriffen. Im Allgemeinen spielt die Kommunikation eine essentielle Rolle bezüglich der Neugestaltungsmaßnahmen. Kommunikation ist das wichtigste Bindeglied für gesunde Beziehungen. Sowohl zwischen den beteiligten Akteuren aus Politik, Planung, Wirtschaft und mehr sowie zwischen diesen und den Bürgern, muss ein sachlich-fachlicher Informationsaustausch zustande kommen. Mit der richtigen Kommunikation zwischen den Akteuren kann eine schnelle, gute und plansichere Umgestaltung angegangen werden. Durch einen passenden Informationsaustausch mit dem Bürger kann dieser frühzeitig in die Geschehnisse eingebunden werden und sich diesen annehmen. Dies ist sowohl vor Ort mit direktem Kontakt als auch auf Online-Plattformen möglich. Mithilfe von Smart City Entwicklungskonzepten kann die städtische Infrastruktur respektive die soziale Resilienz zusätzlich gefördert werden. In Würzburg befasst sich das Fachabteil Smarte Region Würzburg des Fachbereichs Wirtschaft, Wissenschaft und Standortmarketing damit. Hier stehen die Öffentlichkeitsarbeit und die Einbindung ökonomischer, ökologischer, sozialer und technologischer Fortschritte im Vordergrund.
Ziel dieser Ausarbeitung war es, die Möglichkeiten in der Entwicklung der städtischen Verkehrsinfrastruktur Würzburgs sowie die Bedeutung und Importanz des Bürgers zu beleuchten. Unter den erläuterten Alternativen sind einige aufzugreifen, welche bei zukünftigen Maßnahmen und Veränderungen berücksichtigt werden können oder sollten. Fahrgemeinschaften und Carsharing sind Optionen, die verstärkt eingebunden werden müssen. Da diese zu einer signifikanten Reduzierung des Straßenverkehrs beitragen können, werden diese im Bereich des Vermeidens in der „Pyramide der nachhaltigen Mobilität“ aufgefasst. Den Fahrgemeinschaften kann ein großes Potenzial zugesprochen werden. Bei den Umfragen kristallisierte sich heraus, dass bereits einige auf die Option zurückgreifen und weitere eine Perspektive für die Zukunft darin sehen. Mittels Mitfahrportalen und Vermittlungen kann das Konzept zukünftig extern gestützt und dafür gesorgt werden, dass einige problematische Aspekte ausgeräumt werden können. Mit dem Mitfahrportal MAX liegt in Würzburg ein sehr interessantes Projekt mit Potenzial vor. Dieses könnte eine essentielle Funktion im künftigen Umgang mit dem motorisierten Individualverkehr einnehmen. Auf diesem Ansatz kann aufgebaut werden. Das Carsharing wird in den letzten Jahren stetig beliebter. Da beim öffentlichen Carsharing Mitgliedschaften abgeschlossen werden müssen, kann dies signifikant ausgewertet werden. In den letzten zehn Jahren konnte sich die Anzahl der Mitglieder auf präterpropter 4,5 Millionen verzehnfachen. Ähnlich wie die Fahrgemeinschaften wird in Würzburg mittlerweile versucht, ebenfalls das Carsharing zu fördern. Im gesamten Gemarkungsbereich der kreisfreien Großstadt bietet das Unternehmen Scouter gegenwärtig 79 Pkw an 43 Standorten, mit Potenzial zur Erweiterung, an. In Kooperation mit der WVV wird versucht, das Carsharing zu fördern und den Bewohnern eine Alternative zu einem eigenen Fahrzeug zu bieten. Dieses Kooperationsverhältnis ermöglicht die Sicht auf eine positive Entwicklung des Alternativansatzes und des ÖPNV. Da sich die WVV mit inhaltsbezogenen Unternehmen und der Stadt Würzburg solidarisiert, kann erwartet werden, dass diese ebenso bei weiteren essenziellen Bezügen eine Beteiligung ermöglichen würden. Ausgeweitet auf den Landkreis Würzburg kooperieren das Kommunalunternehmen APG und das Autohaus Rumpel & Stark aus Unterpleichfeld miteinander. Da hierbei aktuell lediglich drei Fahrzeuge angeboten werden, ist das Projekt definitiv noch ausbaufähig. Das Angebot in Würzburg per se ist ein essentieller Anhaltspunkt für eine nachhaltige Entwicklung und bindet Potenzial ein.
Das herausgearbeitete Konzept der Fahrgemeinschaftsspur ist etwas, was in Würzburg und der näheren Umgebung keinen realisierbaren Anhaltspunkt bindet. High-occupancy vehicle lanes werden überwiegend auf weitläufigen und mehrspurigen Passagen eingebunden. Die Verkehrsinfrastruktur Würzburgs bietet diese Entwicklungsmöglichkeit nicht. Da es dennoch wichtig ist, an dem Potenzial der Fahrgemeinschaften festzuhalten, kann aus der Idee eine weitere Perspektive gezogen werden. Um die Innenstadt respektive den Bischofshut von einer hohen Verkehrslast zu befreien, kann anstelle von Fahrgemeinschaftsspuren eine City-Maut in Betracht gezogen werden. In Anlehnung an Konzepte, wie sie beispielsweise in London oder Paris realisiert wurden, könnte bezweckt werden, dass Pendler autonom den Pkw außerhalb der Stadt parken und die Innenstadt per Fahrgemeinschaft befahren. Dies kann als Resultat hervorgehen, wenn die Gebühren lediglich pro Auto und nicht pro Person oder gar nur für einfach besetzte Fahrzeuge erhoben werden. Insofern dies umgesetzt wird, kann der nachhaltig agierende Straßenverkehrsteilnehmer bevorzugt die Altstadt befahren. Ein wichtiger Tenor läge hierbei darin, den motorisierten Individualverkehr nicht gänzlich aus dem Zentrum verbannen zu müssen. Stattdessen könnte diese exklusiv per Fahrgemeinschaft angesteuert werden. Die Einnahmen, welche mit der City-Maut generiert werden könnten, bekommen einen Nutzen in der Investition für weitere verkehrsinfrastrukturelle Maßnahmen, wie vorzugsweise dem Ausbau des ÖPNV. Ähnlich kann die Thematik der E-Zonen behandelt werden. Zum aktuellen Zeitpunkt, zu welchem sich das Elektromobil noch inmitten der Entwicklung befindet und die Findung weiterer CO2-neutraler Alternativen noch nicht abgeschlossen ist, machen diese gegenwärtig keinen Sinn. E-Zonen könnten, neben der nachhaltigen Komponente, durch die enormen Einschränkungen mentale Hürden bis hin zu Belastungserscheinungen beim Bürger mit sich führen. Aufgrund hoher Kosten und dem Umstand, dass sich die Entwicklung noch im vollen Gange befindet, kann ein unweigerlicher Umstieg auf CO2--neutrale Varianten nicht erwartet werden. Allerdings kann hier ebenfalls das Konzept der City-Maut aufgegriffen werden. Angelehnt an das realisierte Konzept in Palermo, könnte eine Umsetzung erfolgen. In der dortigen ZTL ist festgehalten, dass jegliche Verkehrsteilnehmer für das eingegrenzte Gebiet Gebühren verrichten müssen. Ausgenommen sind neben dem ÖPNV und dem Not dienst Motorräder sowie Elektrofahrzeuge. Geknüpft an das Konzept der City-Maut, bei der der Nutzer der Fahrgemeinschaft bevorzugt wird, könnte ebenso der Verkehrsteilnehmer mit einem CO2-neutralen Fahrzeug bevorteilt werden.
Die Thematik der Parkplatzgestaltung ist für eine autogerechte Stadt wie Würzburg unumgänglich. Die in den Fokus gerückte Talavera wird mittlerweile nicht mehr als Stadtentwicklungsfläche betrachtet. Im Wesentlichen eine Situation, welche die Stadt nicht zufriedenstellen sollte. Nicht nur, dass die Talavera eine große Fläche ist, welche Potenzial für eine nachhaltige Gestaltung bietet, sondern ebenso deren aktueller Status als teils asphaltierter Standort mit Schotterfläche. Es kann grundlegend von einem Kommunikationsproblem gesprochen werden, da im Voraus an den Bürgerentscheid keine vernünftigen Perspektiven geboten wurden. Anhand der Umfrage, bei der genauere Ziele und Perspektiven der Umsetzung erläutert wurden, würde eine Mehrheit der Befragten ein ersichtlich positiveres Ergebnis bei einem weiteren Bürgerentscheid zugunsten einer bewirtschafteten Talavera heranziehen. Anhand der ausgearbeiteten Entwürfe der Studierenden der Geovisualisierung an der THWS lässt sich das Potenzial des Standortes darstellen. Mit Perspektiven zu einer nachhaltigen Oberflächengestaltung, möglichen Wohngebäuden, einem garantierten Standort für das Würzburger Volksfest sowie Parkhäusern oder Tiefgaragen werden einige Impulse ausgesendet. Überdies hätten, mittels eines organisierten Wettbewerbs zwischen etlichen Architekten, weitere Konzeptionen und Ideen gesammelt werden können. Im Zuge der gesammelten und dargebotenen Impulse sowie einem essentiellen Informationsaustausch mit den Bürgern zu den möglichen Umsetzungen und der Sinnhaftigkeit der Bewirtschaftung könnte respektive sollte zukünftig weiterhin an einer Aufwertung der Talavera festgehalten werden. Weitere Optionen für Parkhäuser und -garagen sind in der stark versiegelten kreisfreien Großstadt schwer auszumachen. Einige Vorschläge, wie vorzugsweise Tiefgaragen bei der Tectake Arena, dem Vorplatz der Residenz oder eine Parkplatzgestaltung auf dem Areal des Bahnhofs Zell scheiterten an zu hohen Kosten oder der hohen Bedeutung des Standortes. Mit dem Parkhaus am Bahnhof wird aktuell eine Alternative errichtet, welche mehr Stellplätze garantiert als das Vorgängermodell. Weitere Impulse konnten erneut von den Entwürfen der Studierenden der THWS aufgegriffen werden. Im Raum steht ein Parkdeck auf dem Sanderrasen im Zuge einer Umgestaltung des dortigen Sportplatzes. In einem Bebauungsplan wurde zudem bereits die Umsetzung eines Parkhauses am Greinberg festgehalten. Grundlegend besteht somit das Potenzial, neue Stellplatzanlagen in Würzburg zu integrieren. Da allerdings nicht viele Alternativen aufgeboten werden können ist es umso wichtiger, an den gegebenen Optionen festzuhalten. Daher werden weitere Optionen im Umland evaluiert, um Park & Ride Parkplätze einzubinden. Hierfür ist ein sachlicher Informationsaustausch mit wichtigen Akteuren des Landkreises von enormer Bedeutung. Die umliegenden Kommunen und Vororte können ebenso von Park & Ride Parkplätzen profitieren. Zum Exempel umfasste eine Initiative vom zweiten Bürgermeister Würzburgs, Martin Heilig, die Integration eines Parkplatzes im Gewerbegebiet Höchberg. Ein dortiger Park & Ride Parkplatz könnte bewirken, dass mehr Personen auf den Supermarkt sowie weitere unmittelbar angrenzende Läden zurückgreifen. Generell wird den Perspektiven im westlichen Umland eine hohe Bedeutung zuteil, um dem dort strukturschwachen ÖPNV zu assistieren.
Grundlegend muss festgehalten werden, dass ohne ausreichend Alternativen die Talavera und der Parkplatz am Dallenbergbad nicht bewirtschaftet sowie die Oberflächenparkplätze im Bischofshut nicht gänzlich weichen sollten. Dabei sollte unbedingt der ÖPNV betrachtet werden. Im Fokus stehen sowohl die Erreichbarkeit von Stadtteilen vom Würzburger Hauptbahnhof aus als auch die Anbindungen ins Umland. Mit einer entsprechenden Förderung des ÖPNV und einer Berücksichtigung wesentlicher Arbeitszeiten in bestimmten Stadtbezirken, beispielsweise dem Industriegebiet Lengfeld, könnten sich einige Bürger einen Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel eher vorstellen als zum aktuellen Zeitpunkt. Hierbei ist erneut eine Kommunikationsstruktur aufzufassen. Es sollte ein stärkerer Informationsaustausch zum Bürger entstehen, um die Schwachstellen des ÖPNV filtern zu können. Eine passende Kommunikation zwischen der WVV und der DB könnte zusätzlich Umsteigeproblematiken zwischen Regionalbahn und öffentlichen Verkehrsmitteln der Stadt reduzieren. Im Zuge der Veränderung sollte dem Bürger frühzeitig die Wahl der Alternativen aufgezeigt werden, damit dieser sich mit diesen mit einer Eingewöhnungszeit auseinandersetzen kann. Intensiver würden sich Bürger mit dem ÖPNV auseinandersetzen, würde diesem eine höhere Bedeutung zuteil. Die öffentlichen Verkehrsmittel müssen sich als ein Standardfortbewegungsmittel etablieren. Hierbei kann sich am Verkehrsmuster Dublins orientiert werden, wo der Bus das meistgenutzte Verkehrsmittel ist. Zudem sollte stets die Verkehrsinfrastruktur für Fahrradteilnehmer berücksichtigt werden. Da mehr als 60 % der Befragten in Würzburg mehr, verbesserte und sicherere Fahrradwege und - straßen fordern, sollten diesbezüglich ebenfalls Alternativen evaluiert werden. Generell nimmt die Bedeutung des Fahrrads in den vergangenen Jahren wieder zu. Reichlich Bewohner der Stadt und der angrenzenden Kommunen greifen gerne auf das Fahrrad zurück.
Um das Fahrrad als einen essentiellen Bestandteil der Verkehrsinfrastruktur in Würzburg einbinden zu können, sollte für die Nutzer eine ausreichende Sicherheit garantiert sowie neue Fahrradwege eingebunden werden. Die Qualität der Sicherheit sollte vorzugsweise am Berliner Ring regelmäßig begutachtet und möglicherweise aufgebessert werden. Mit kommenden Maßnahmen an der Veitshöchheimer Straße wird zudem bereits ein neuer Fahrradweg eingeplant.
Ein Schwerpunkt der Verkehrsinfrastruktur sollte auf intermodale Fortbewegungsmöglichkeiten gelegt werden. Die bereits eingebundenen Umsteigeknotenpunkte ermöglichen in der Stadt, darauf zurückzugreifen. Mit der kommenden S 6 wird der schienengebundene ÖPNV weiter ausgebaut und bietet zusätzliche Möglichkeiten, sich mit verschiedenen Verkehrsmitteln fortzubewegen. Dieser Ansatz hat definitiv Potenzial, erweitert zu werden. Dahingehend können die Ideen zu möglichen Park & Ride Parkplätzen im Umland aufgegriffen werden. Dort wäre ein Umstieg vom eigenen Auto auf Fahrgemeinschaften oder öffentliche Verkehrsmittel denkbar. Mit einem ausgebauten Netz des ÖPNV im westlichen Umland und dazugehörigen Schotterflächen könnte ermöglicht werden, dass Pendler aus Kommunen, die nicht unmittelbar an das Busnetz nach Würzburg angebunden sind, nahegelegene Haltestellen ansteuern und umsteigen könnten. Ebenso würden sich das Parkhaus am Greinberg sowie das Parkdeck am Sanderrasen für eine intermodale Fortbewegung eignen. Der Ansatz der Reurbanisierung wird hingegen nicht priorisiert. Grundlegend gehört die Gestaltung von Wohnraum sowie die Entlastung des Wohnungsmarktes in Würzburg berücksichtigt. Allerdings unabhängig von Maßnahmen bezüglich der Verkehrsinfrastruktur. Allgemein kristallisiert sich bei den Bürgern heraus, dass der Wohn- dem Arbeitsort bevorzugt wird. 45 % der Befragten in Würzburg wären gänzlich abgeneigt, für einen kürzeren Arbeitsweg umzuziehen. Daher sollte der Fokus weiterhin überwiegend auf der Gestaltung der Fortbewegungsmöglichkeiten liegen.
Essentiell ist, um die mentalen Hürden der Bewohner zu reduzieren respektive um dahingehend präventiv zu handeln, einen wertvollen Informationsaustausch zu garantieren. Es hat sich herausgestellt, dass etliche Möglichkeiten zur Beteiligung von Bürgern in Würzburg vorhanden sind. Das ist in unterschiedlichsten Varianten möglich. Da 55 % der Befragten in Würzburg allerdings eindeutig kommuniziert haben, dass sie mit dem Informationsaustausch seitens beteiligter Akteure unzufrieden sind, liegt dennoch eine Problematik vor. Lediglich einer der 47 Probanden wusste, dass es eine Online-Plattform gibt, auf der sich mit städtischen Maßnahmen auseinandergesetzt werden kann. Der Bürger muss quasi auf die Optionen zur Beteiligung stärker gestoßen werden. Das bedeutet, dass von der Stadt Werbung für die Beteiligungsmöglichkeiten gemacht werden muss. Dafür kann zum Exempel eine Kooperation mit der WVV von Nutzen sein. Neben den Haltestellen könnte die Aufklärungsarbeit für die Öffentlichkeitsbeteiligung ebenso auf der Applikation der WVV sowie auf den Straßenbahnwagen geschaltet und präsentiert werden. Werden die Bürger vermehrt in das Geschehen mittels etlicher Öffentlichkeitsbeteiligungen eingebunden, dann können diese zu anstehenden Maßnahmen aufgeklärt werden. Es kann das Gefühl von Sicherheit und Wertschätzung entstehen. Dies könnte schlussendlich einen Anhaltspunkt bieten, der Hürde des Gewohnheitstiers entgegenzuwirken. Ist die Bevölkerung grundlegend zufriedener mit der Einbindung, so könnte eine höhere Akzeptanz sowie eine grundlegende Toleranz das Resultat sein. Erläutert werden muss allerdings ebenso, dass dadurch nicht automatisch jeder Bürger eingebunden werden kann. Es muss natürlich ebenso die nötige Initiative von der Bevölkerung bestehen, sich beteiligen zu wollen. Um die Online-Plattform zu verbessern und die soziale Resilienz in Würzburg zu steigern, ist der Fachabteil Smarte Region Würzburg tätig. Dieser versucht sich mittlerweile intensiv daran, Bürger verstärkt einzubinden. Wird dies mit den erwähnten Ansätzen zur Aufklärungsarbeit kombiniert, kann dahingehend ein starkes System in Würzburg aufgebaut werden. Generell sind Smart City Entwicklungskonzepte Ansätze, die technologische, ökonomische, ökologische und soziale Fortschritte mit sich führen sollen. Vorzugsweise wurden in Würzburg bereits Smart City Ansätze bezüglich der Verkehrsinfrastruktur aufgenommen, als Aufwertungsmaßnahmen für Verkehrs- und Parkleitsysteme evaluiert wurden. Mit geregelten Ampelschaltungen kann ein fließender und weniger stockender Verkehr gewährleistet werden. Mit den Parkleitsystemen können die Verkehrsteilnehmer des motorisierten Individualverkehrs gezielt zu Parkgaragen und -häusern mit ausreichend Kapazität gelenkt werden. Mittels entstehender Impulse aus der Bevölkerung durch Öffentlichkeitsbeteiligungen, einer adäquaten Werbekampagne sowie den eingebrachten Smart City Entwürfen, kann die Würzburger Verkehrsinfrastruktur nachhaltig und für den Bürger verständnisvoller gestaltet werden. Summa summarum können die etlichen Ansätze genutzt werden, um verschiedene Alternativen für den Bürger in der Fortbewegung garantieren zu können. Mit Berücksichtigung der Aufklärungsarbeit könnten mentale Hürden überbrückt und eine gesunde Stadtgesellschaft angestrebt werden. Durch die Auseinandersetzung eines gesamten Fachabteils mit der sozialen Resilienz der Stadt wird ein bedeutender Grundstein für einen zukünftig erfolgreichen Werdegang gelegt.
11. Literaturverzeichnis
ADAM, P. (2023): „Mehr Lebensqualität durch grüne Räume in der Stadt“, in: Talavera 2023: Ein Stadtteil entsteht, unter: https://geovisualisierung.com/microsite/talavera2023/(28.11.2023).
AMMON, C. W. (1805): „Vollständiger Unterricht vom Kutschfuhrwesen für Herrschaften und Kutscher“, Nürnberg/Sulzbach.
APG (o. J.): „APG-Carsharing”, unter: https://www.apg-info.de/apg-angebote/apg-carsharing/index.html (22.11.2023).
Appl Scorza, G. (2021): „Klimawandel: verstehen und handeln - Sozialpsychologie und Klimaschutz“, Wien.
BBSR - BUNDESINSTITUT FÜR BAU-, STADT- UND RAUMFORSCHUNG (2012): „Raumabgrenzungen und Raumtypen des BBSR“ (Analysen Bau.Stadt.Raum, Band 6), Bonn.
BCS - BUNDESVERBAND CARSHARING (2023): „Aktuelle Zahlen und Fakten zum CarSharing in Deutschland“, unter: https://carsharing.de/alles-ueber-carsharing/carsharing-zahlen/aktuelle-zahlen-fakten-zum-carsharing-deutschland (22.11.2023).
BEER, B. (2020): „Systematische Beobachtung“, in: Bettina, B. und König, A. (Hrsg.): Methoden ethnologischer Feldforschung in 3. Auflage, Berlin: S. 55-76.
BMDV - BUNDESMINISTERIUM FÜR DIGITALES UND VERKEHR (2023): „Radverkehr“, unter: https://bmdv.bund.de/DE/Themen/Mobilitaet/Fahrradverkehr/fahrradverkehr.html(07.12.2023).
BMJ - BUNDESMINISTERIUM DER JUSTIZ (2022): „Steuerentlastungsgesetz 2022“, in: Bundesgesetzblatt 1 (17), S. 749-751.
BMUV - Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und VERBRAUCHERSCHUTZ (2015): „Übereinkommen von Paris“, Paris.
BMuV - BuNDEsMiNisTERiuM FÜR uMWELT, NATuRscHuTZ, NuKLEARE sicHERHEiT uND VERBRAucHERscHuTZ (o. J.): „umweltplakette/umweltzone“, unter: https://www.bmuv.de/themen/luft/umweltzonen-/-umweltplakette(25.11.2023).
BMVBW - BuNDEsMiNisTERiuM FÜR VERKEHR, BAu- uND WOHNuNGsWEsEN (2000): „Verkehr in Zahlen 2000“, Hamburg.
BMVi - BuNDEsMiNisTERiuM FÜR VERKEHR uND DiGiTALE iNFRAsTRuKTuR (2021): „Verkehr in Zahlen 2020/2021“, Hamburg.
BMWK - BuNDEsMiNisTERiuM FÜR WiRTscHAFT uND KLiMAscHuTZ (o. J.): „Das Erneu- erbare-Energien-Gesetz“, unter: https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Dossier/eeg.html(21.10.2023).
BMWsB - BuNDEsMiNisTERiuM FÜR WOHNEN, sTADTENTWicKLuNG uND BAuWEsEN (o. J. A): „sozialer Zusammenhalt“, unter: https://www.staedtebaufoerderung.info/DE/Programme/SozialerZusammenhalt/sozialerzusammenhaltnode.html(08.11.2023).
BMWSB - BuNDESMiNiSTERiuM FÜR WOHNEN, STADTENTWicKLuNG uND BAuWESEN (o. J. B): „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“, unter: https://www.staedtebaufoerderung.info/DE/Programme/WachstumNachhaltigeErneuerung/wachstumnachhaltigeerneuerung node.html (08.11.2023).
BMZ - BuNDESMiNiSTERiuM FÜR WiRTScHAFTLicHE ZuSAMMENARBEiT uND ENTWicKLuNG (2023): „Agenda 2030 - Die globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung“, unter: https://www.bmz.de/de/agenda-2030(21.10.2023).
BOGENBERGER, K. und ScHÖNHOFER, T. (2022): „A comprehensive Review on Managed Lanes in Europe“, München.
BONN, P. (2022): „Aus für Verbrennungsmotoren in der europäischen Union?“, Linz.
BORTZ, J. und DÖRING, N. (2016): „Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozialund Humanwissenschaften“ in 5. Auflage, Wiesbaden.
BRADE, W. (2023): „Domestikation und Nutzung von Equiden Teil 2: Neuere Erkenntnisse zur Domestikation des Pferdes und aktuelle Nutzung des Pferdebestandes in Deutschland“, in: Berichte über Landwirtschaft - Zeitschrift über Agrarpolitik und Landwirtschaft 101 (2).
BUCHANAN, C. und GUNN, S. (2019): „Traffic in Towns - A study of the Long Term Problems of Traffic in Urban Areas (The Buchanan Report)“, London.
BUCHHOLZ, M. (2021): „Park & Ride Greinberg“, in: Stadt der Zukunft, unter: https://gis.fkv.thws.de/sdz/ (30.11.2023).
BUCHINGER, J. N. (1843): „Julius Echter von Mespelbrunn: Bischof von Würzburg und Herzog von Franken“, Würzburg.
CELINA, K. (2023): „Nein zur B26n! - Warum ich die B26n verhindern will“, unter: https://www.kerstin-celina.de/nein-zur-b26n/(07.11.2023).
Czowalla, L.; Busch, D.; Fromberg, A.; Gwiasda, P.; Wilde, M. und Lanzendorf, M. (2017): „Neuere Entwicklungen zur Integration von Fahrrad und Öffentlichem Verkehr in Deutschland: Überblick zum Stand des Wissens und der Praxis“, Arbeitspapiere zur Mobilitätsforschung 15, Frankfurt a. M.
DER NEUE WIESENTBOTE (2023): „CHW bietet Online-Vortrag über die Würzburger Residenz“, unter; https://www.wiesentbote.de/2023/03/21/chw-bietet-online-vortrag-ueber-die-wuerzburger-residenz/(21.10.2023).
DESTATIS (2023): „Bevölkerung nach Nationalität und Geschlecht 2022“, unter: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/deutsche-nichtdeutsche-bevoelkerung-nach-geschlecht-deutschland.html(15.11.2023).
Deutscher Bundestag (1990): „11. Wahlperiode - Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und FDP“, Bonn.
FREYTAG, G. (1867): „soll und Haben - Roman in sechs Büchern“, Leipzig.
FuNKE, T. (2006): „Entwicklung von Verkehrsmittelwahlmodellen für komplexe Mitfahrverkehre“, Stuttgart.
Gerike, R.; Hössinger, R.; Juschten, M.; Kopp, J.; Manz, W.; Rentschler, C.; Riegler, S.; RÖßGER, L. und Schlag, B. (2016): „Carsharing 2025 - Nische oder Mainstream?“, Dresden/Berlin.
GOLDRATT, E. M. (1990): „What is this thing called THEORY OF CONSTRAINTS and how should it be implemented?”, Croton-on-Hudson.
GPF - GLOBAL POLICY FORUM (2020): „Agenda 2030: Wo steht die Welt?”, Bonn.
STA - SÜDTIROLER TRANSPORTSTRUKTUREN AG (o. J.): „Die Pyramide der nachhaltigen
Mobilität“, unter: https://www.greenmobility.bz.it/projekte/die-pyramide-der-nachhaltigen-mobilitaet/die-pyramide-der-nachhaltigen-mobilitaet/(16.12.2023).
GRÜNE FRAKTION - sTADTRAT WÜRZBuRG (2022): „Besser leben im Bischofshut“, unter: https://gruene-fraktion-wuerzburg.de/besser-leben-im-bischofshut/(06.11.2023).
HAIDACHER, A. (2019): „Wir haben so viel Reichtum, aber leben in Armut - Der Lithiumabbau und die indigene Bevölkerung Boliviens“, Graz.
HAHN, W.; HOPPE, R. und SCHLEICHER, P. (2022): „Kurzstudie über Klimaschutzbeiträge zur Umweltverträglichkeitsprüfung von Bundesfernstraßen im Rahmen der Aufstellung des Bundesverkehrswegeplans 2040, Marburg.
HEINEBERG, H. (2017): „Stadtgeographie“ in 5. Auflage, Paderborn.
HEINITZ, F. (2020): „Potenziale und Hemmnisse für Pkw-Fahrgemeinschaften in Deutschland“, Dessau-Roßlau.
Hecke, A. (2021): „B26n - Aktueller Sachstand. Stadtratssitzung Lohr a. Main am 30. Juni 2021“, unter: https://www.b26neu.de/wp-content/uploads/2021/07/2021-06-30B-26nStadtrat-Lohr-a.Main-am-30.06.2021StBaWue.pdf(07.11.2023).
HESSE, M. (2018): „Suburbanisierung“, in: ARL - Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.): Handwörterbuch der Stadt- und Raumentwicklung, Hannover: S. 2629-2639.
HOLZ-RAU, C. (2018): „motorisierter Individualverkehr“, in: ARL - Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.): Handwörterbuch der Stadt- und Raumentwicklung, Hannover: S. 1577-1584.
INKAR - INDIKATOREN UND KARTEN ZUR RAUM- UND STADTENTWICKLUNG (2023 A): „Bevölkerung gesamt 1995-2019“, in: Absolutzahlen, unter: https://www.inkar.de/(16.10.2023).
INKAR - INDIKATOREN UND KARTEN ZUR RAUM- UND STADTENTWICKLUNG (2023 B): „Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen 2019“, in: Wirtschaft, unter: https://www.inkar.de/(16.10.2023).
INKAR - INDIKATOREN UND KARTEN ZUR RAUM- UND STADTENTWICKLUNG (2023 C): „Einpendler 2019“, in: Verkehr und Erreichbarkeit, unter: https://www.inkar.de/(16.10.2023).
INKAR - Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung (2023 D): „Ländlichkeit 2019“, in: Siedlungsstruktur, unter: https://www.inkar.de/(16.10.2023).
ISING, H. und MASCHKE, C. (2000): „Beeinträchtigung der Gesundheit durch Verkehrslärm“, Berlin.
Jacob, R.; Decieux, J. P. und Heinz, A. (2014): „Umfrage - Einführung in die Methoden der umfrageforschung“ in 3. Auflage, München.
JEANNERET-GRiS, c.-E. (1933): „charta von Athen“, Athen.
KARWATKA, D. (2015): „Nicholas-Joseph cugnot and His Steam carriage”, in: Tech Directions 74 (6), S.10.
KNiES, c. (2015): „Warum kostet die Moz-Sanierung mindestens 27 Mio. €?“, in: inter- viewr.tv, unter: https://interviewr.tv/warum-kostet-die-sanierung-mindestens-27-mio-d83bef36d134(27.10.2023).
KoPP, J. (2015): „GPS-gestützte Evaluation des Mobilitätsverhaltens von free-floating carSharing-Nutzern“, zürich.
KRiSPEL, S.; MAiER, G.; PEYERL, M. und WEiHS, P. (2017): „urban Heat islands - Reduktion von innerstädtischen Wärmeinseln durch Whitetopping“, in: Bauphysik 39 (1), S. 33-40.
LANDKREiS WÜRzBuRG (2022): „Gemeinsam pendeln mit MAX - vier Arbeitgeber aus Würzburg starten mit MAX, dem Mitfahrportal“, unter: https://www.landkreis-wuerzburg.de/Auf-einen-Klick/Startseite/Gemeinsam-pendeln-mit-MAX-Vier-Arbeitgeber-aus-W%C3%BCrzburg-starten-mit-MAX-Das-Mitfahrportal.php?object=tx,2680.5&ModID=7&FID=2680.29827(21.11.2023).
LfStat - Bayerisches Landesamt für Statistik (2023): „Statistik kommunal 2022 - Gemeinde Gerbrunn“, unter: https://www.statistik.bayem.de/mam/produkte/statistikkommunal/2022/09679136.pdf(18.10.2023).
LFsTAT - BAYERisCHEs LANDEsAMT FÜR sTATisTiK (2022): „statistik kommunal 2021 - Markt Höchberg“, unter: https://www.statistik.bayem.de/mam/produkte/statistikkommunal/2021/09679147.pdf(18.10.2023).
MACKiE, P. (2005): „The London congestion charge: A tentative economic appraisal. A comment on the paper by Prud’homme and Bocajero”, in: Transport Policy 12 (3), s. 288-290.
MANFRAHs, F. (2020): „Citymanagement: innenstadt-Belebung mit system - starke Zentren mit Erlebnisqualität gestalten“, Wiesbaden.
MAYER, H. O. (2013): „interview und schriftliche Befragung. Grundlagen und Methoden empirischer sozialforschung“ in 6. Auflage, München.
NiKOLAUs, G. (2021): „Fahrradhighway und Lock&shop“, in: stadt der Zukunft, unter: https://gis.fkv.thws.de/sdz/(08.12.2023).
Outram, A. K.; Bendrey, R.; Evershed, R. P.; Kasparov, A.; Olsen, s.; Stear, N. A.;
THORPE, N. und ZAiBERT, V. (2009): „The earliest horse harnessing and milking”, in: science 323 (5919), s. 1332-1335.
PALERMO MOBiLiTA sOsTENiBiLE (o. J.): „ZTL“, unter: https://ztl.comune.palermo.it/ztl/jsp/home.jsp?modo=info&info=servizi.jsp&ARECOD=10&S=30(25.11.2023).
POPP, H. (2013): „Die Architektur der Barock- und Rokokozeit in Deutschland und der schweiz“, Paderborn.
REICHOW, H. B. (1959): „Die Autogerechte Stadt : ein Weg aus dem Verkehrs-Chaos“, Ravensburg.
REINHARDT, W. (2015): „Geschichte des Öffentlichen Personenverkehrs von den Anfängen bis 2014 - Mobilität in Deutschland mit Eisenbahn, U-Bahn, Straßenbahn und Bus“, Wiesbaden.
REINKOBER, N. (1994): „Fahrgemeinschaften und Mobilitätszentrale - Bestandteile eines zukunftsorientierten öffentlichen Personennahverkehrs“ (Schriftenreihe für Verkehr und Technik, Band 81), Bielefeld.
REYNARD S. H. (2021): „Der neue Sanderrasen“, in: Stadt der Zukunft, unter: https://gis.fkv.thws.de/sdz/(01.12.2023).
SAUER, S. (o. J.): „Geovisualisierung - Ein Blog über: Reale Ideen in Virtuellen Welten“, unter: https://geovisualisierung.com/(31.10.2023).
SCHOCH, R. (1990): „Noch einmal: Salomon Kleiner - Neuerworbene Zeichnungen“, in: MonatsAnzeiger 1990 (108), S. 861-862.
SCHULZ-WIMMER, H. (2010): „Reite das Gewohnheitstier - Routine raffiniert einsetzen“, München.
SOUTHWORTH, F. und WESTBROOK, F. (1986): „High-Occupancy-Vehicle Lanes: Some Evidence on Their Recent Performance”, in: Transportation Research Record 1081 (1), S. 31-39.
SPICHTIG, R. (2008): „Evolution des Bewusstseins - Grundlagenforschung der korrelativen Verhaltens-Psychologie“, Würzburg.
SPÖHRING, W. (2013): „Qualitative Sozialforschung“, Braunschweig.
STAATLICHES BAUAMT WÜRZBURG (o. J.): „Die Historie zur B26neu“, unter: https://www.b26neu.de/historie/ (07.11.2023).
Stadt Würzburg (2019): „Soziale Stadt Zellerau - Dokumentation 2007-19“, Würzburg.
Stadt Würzburg (2020): „Anwohner- und Eigentümerbefragung - Zusammenfassung“, unter: https://www.wuerzburg.de/m568073(28.10.2023).
STADT WüRZBuRG (2022): „Bürgerentscheide Talavera“, unter: https://www.wuerzburg.de/wahlen/Wahl-2022-07- 24/09663000/praesentation/ergebnis.html?wahl id=26&stimmentyp=0&id=eb ene 3 id 1 (27.11.2023).
STADT WüRZBuRG (2023 A): „Organisationsplan des Baureferates (Referat IV) der Stadt Würzburg“, unter: file:///C:/Users/Lukas-PC-2019/Downloads/0rganisationsplan%20des%20Baureferates%20Stand%2019.01.2023.pdf(27.10.2023).
STADT WüRZBuRG (2023 B): „Privat-Pkw je 1.000 Haushalte“, in: Kraftfahrzeuge, unter: https://statistik.wuerzburg.de/ (02.11.2023).
STADT WüRZBuRG (2023 C): „Stadtbodenkonzept - Bischofshut Würzburg“, Würzburg.
STADT WüRZBuRG (2023 D): „Statistische Daten 2022 - Würzburg“, unter: https://www.wuerzburg.de/media/www.wuerzburg.de/org/med5478/58274400wuerzburg2022stadtprofil.pdf(18.10.2023).
STADT WüRZBuRG (o. J. A): „Smart City: Maßnahmen und Projekte“, unter: https://www.wuerzburg.de/unternehmen/smart-city/massnahmen-und-projekte/536708.Massnahmen-und-Projekte.html(15.12.2023).
Stadt Würzburg (o. J. B): „Würzburg Mitmachen“, unter: https://wuerzburg-mitmachen.de/(14.12.2023).
THWS - Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt (o. J.): „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Studienbereich Geo - Stefan Sauer“, unter: https://geo.thws.de/studienbereich/personensuche/mitarbeiterinnen-und-mitarbeiter/person/stefan-sauer/(31.10.2023).
uLLRicH, G. A. (1819): „Die Blokade der Festung Marienberg und des Mainviertels zu Würzburg in den Jahren 1813 und 1814“, Würzburg.
uN - VEREiNTE NATiONEN (1998): „Das Protokoll von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen“, Kyoto.
Van den Berg, L.; Drewett, R.; Klaassen, L. H.; Rossi, A. und Vijverberg, c. H. T. (1982): „A study of growth and decline”, Oxford.
VEJNiK, L. (2016): „Asphalt-inseln. Orte des Mitfahrens“, in: Bogner, S.; Franz, B.; Meier, H.-R. und Steiner, M. (Hrsg.): Denkmal - Erbe - Heritage, Wien/Heidelberg: S. 170-175.
VOLTi, R. (2006): „cars and culture - The Life Story of a Technology”, Baltimore.
WENZEL, W. (2020): „Der sächsische Erzbergbau im Spiegel der Namen“, in: Sächsische Heimatblätter 2020 (2), S. 81-83.
WESTPHAL, c. (1872): „Die Agoraphobie, eine neuropathische Erscheinung“, in: Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten 3 (1), S. 138-161.
WiERLiNG, J. (2023): „Ein neuer Festplatz - Talavera“, in: Talavera 2023: Ein Stadtteil entsteht, unter: https://geovisualisierung.com/microsite/talavera2023/(28.11.2023).
WiESNETH, A. (2013): „Welterbstätten der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen“, in: icOMOS-Hefte des Deutschen Nationalkomitees 57, S. 48-60.
WIETSCHEL, M. (2020): „Ein Update zur Klimabilanz von Elektrofahrzeugen“, Karlsruhe.
Witzke, S. (2015): „Carsharing und die Gesellschaft von Morgen - Ein umweltbewusster Umgang mit Automobilität?“, Ulm.
WVV - WÜRZBURGER VERSORGUNGS- UND VERKEHRS-GMBH (o. J.): „Carsharing - Ihr Plus zu ihrem Abo“, unter: https://www.wvv.de/mobil-b2c/carsharing/(22.11.2023).
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Inhaltsverzeichnisses?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst folgende Hauptpunkte: Einleitung, Ziele in puncto Nachhaltigkeit (mit Unterpunkten zu Städtebaulicher Entwicklung Würzburgs und Einfluss des Faktors Nachhaltigkeit im 21. Jahrhundert), Methodik (mit Unterpunkten zu Leitfadeninterview, Schriftlicher Befragung, Systematischer Beobachtung, und weiteren herangezogenen Daten), Verkehrsplanerische Anpassungen und Maßnahmen in Würzburg, Betrachtung des Umgangs der Bevölkerung mit massiven Veränderungen, Aufgebot an möglichen Alternativen und Perspektiven zur Umsetzung in Würzburg, Modell "Pyramide der nachhaltigen Mobilität", Abwägung von Kommunikationsmöglichkeiten, Annäherung über Smart City Entwicklungskonzepte, Fazit, und Literaturverzeichnis.
Welche Abbildungen werden im Abbildungsverzeichnis aufgeführt?
Das Abbildungsverzeichnis listet verschiedene Darstellungen auf, darunter eine Darstellung zur Ländlichkeit bayerischer Landkreise, die Würzburger Residenz, Organisationspläne des Baureferates, Planungen am Grafeneckart, Alternativstrecken der Bundesstraße 19, Privat-Pkw je Haushalt in Würzburg, Pflastersteinkartierung des Bischofshuts, Stadtbodenkonzepte, Blicke in die Theaterstraße und Karmelitenstraße, Ergebnisse von Online-Umfragen zum Arbeitsweg und belastenden Faktoren, die Bedeutung des Zeitaufwands, Fahrgemeinschaften, Marktentwicklungen des Carsharings, ZTL in Palermo, Abstimmungsergebnisse zu Parkplatzkosten, Lebensqualität durch grüne Räume, neue Festplätze auf der Talavera, Park & Ride Konzepte, den Sanderrasen, Zufriedenheit mit ÖPNV-Angeboten, Alternativwünsche für den ÖPNV, Fahrradhighways, Umsteigeknoten, Pendlerbereitschaft, die Pyramide der nachhaltigen Mobilität und die Zufriedenheit mit der Kommunikation.
Was sind die Hauptpunkte der Einleitung?
Die Einleitung behandelt die Bedeutung von Städten als Zentren menschlichen Handelns, ihre Entwicklung und ihren ökonomischen Einfluss, besonders in ländlich geprägten Räumen wie Würzburg. Sie diskutiert Suburbanisierungstendenzen und die Rolle von Städten als wichtige Standorte für Berufstätigkeiten. Sie geht auch auf das Konzept der "autogerechten Stadt" ein und die Notwendigkeit, diese nachhaltig und lebenswert zu gestalten.
Welche Ziele werden in puncto Nachhaltigkeit verfolgt?
Die Ziele umfassen die städtebauliche Entwicklung Würzburgs unter Berücksichtigung historischer Aspekte und den Einfluss von Nachhaltigkeit im 21. Jahrhundert. Es werden die Charta von Athen, Klimaschutz, Nachhaltigkeitspolitik, das Kyoto-Protokoll, das Übereinkommen von Paris und die Agenda 2030 der Vereinten Nationen (insbesondere SDG 11) thematisiert.
Welche Methodiken werden im Rahmen der Studie angewendet?
Die Studie greift auf empirische Methodiken zurück, darunter Leitfadeninterviews mit Experten der Stadtplanung, schriftliche Befragungen (standardisiert und teilstandardisiert) zu innerstädtischen Verkehrssituationen, eine systematische Beobachtung der Pflasterung im Bischofshut, sowie weitere Daten aus einer Kooperation zwischen der THWS und der Stadt Würzburg.
Welche verkehrsplanerischen Anpassungen und Maßnahmen werden in Würzburg betrachtet?
Es werden verschiedene Aspekte behandelt, wie die Aufnahme von Sachverhalten mit Handlungspotenzial (z. B. Stausituationen auf Ein- und Ausfallstraßen), die nachhaltige Gestaltung der Altstadt (Bischofshut), Entlastungsansätze für den Würzburger Südring (B26n), Investorenfindung, und entstehende Vorteile für die Stadt (z.B. Verbesserung des Stadtklimas).
Wie wird der Umgang der Bevölkerung mit massiven Veränderungen betrachtet?
Die Ausarbeitung geht auf psychologische Aspekte ein, wie die Bedeutung von Gewohnheiten, die Entstehung von Gewohnheiten, mentale Barrieren durch das Gefühl der Einschränkung, sowie die Bedeutung des Autos. Es wird analysiert, wie Menschen auf städtebauliche Veränderungen der Verkehrsinfrastruktur reagieren und welche Rolle die Partizipation der Bürger spielt.
Welche Alternativen und Perspektiven zur Umsetzung werden in Würzburg vorgeschlagen?
Es werden verschiedene Alternativen betrachtet, darunter integrierbare Alternativen für den bestehenden motorisierten Individualverkehr (Promotion für Fahrgemeinschaften, Carsharing, High-occupancy vehicle lane, E-Zonen, intelligente Gestaltung von Parkhäusern), und Alternativen, um dem expandierenden Aufkommen des Pkw entgegenzuwirken (Ausbau des ÖPNV, Aufwertungsmaßnahmen für den nichtmotorisierten Individualverkehr, Attraktivitätssteigerung intermodaler Fortbewegungsmöglichkeiten, Nähe durch Reurbanisierung).
Was beinhaltet das Modell "Pyramide der nachhaltigen Mobilität"?
Das Modell segmentiert die Alternativen auf drei Hyperonyme. Diese lauten: vermeiden, verlagern und verbessern. Vermeiden (Zu Fuß gehen und Verzicht auf Fortbewegungsmethoden), Verlagern (Alternativen zu öffentlichen Verkehrsmitteln) und verbessern (CO2-neutrale PKW-Alternativen).
Welche Kommunikationsmöglichkeiten werden abgewogen?
Es werden verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten zur Einbindung der Bevölkerung betrachtet. So ist ein Raum im Mozart-Gymnasium geplant und die Online-Plattform "Würzburg mitmachen", welche von der Stadt Würzburg gestellt wird, bietet verschiedene Umfragen, Beteiligungsmöglichkeiten und fachliche Informationsbeiträge.
Wie wird sich über Smart City Entwicklungskonzepte angenähert?
Die Stadt Würzburg setzt sich intensiver mit dem Überbegriff Smart City auseinander. Mit dem Fachabteil Smarte Region Würzburg wird versucht, die soziale Resilienz zu steigern. Hier stehen die Öffentlichkeitsarbeit und die Einbindung ökonomischer, ökologischer, sozialer und technologischer Fortschritte im Vordergrund.
- Quote paper
- Lukas Billek (Author), 2024, Entwicklung der städtischen Verkehrsinfrastruktur im 21. Jahrhundert am Beispiel Würzburg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1488363