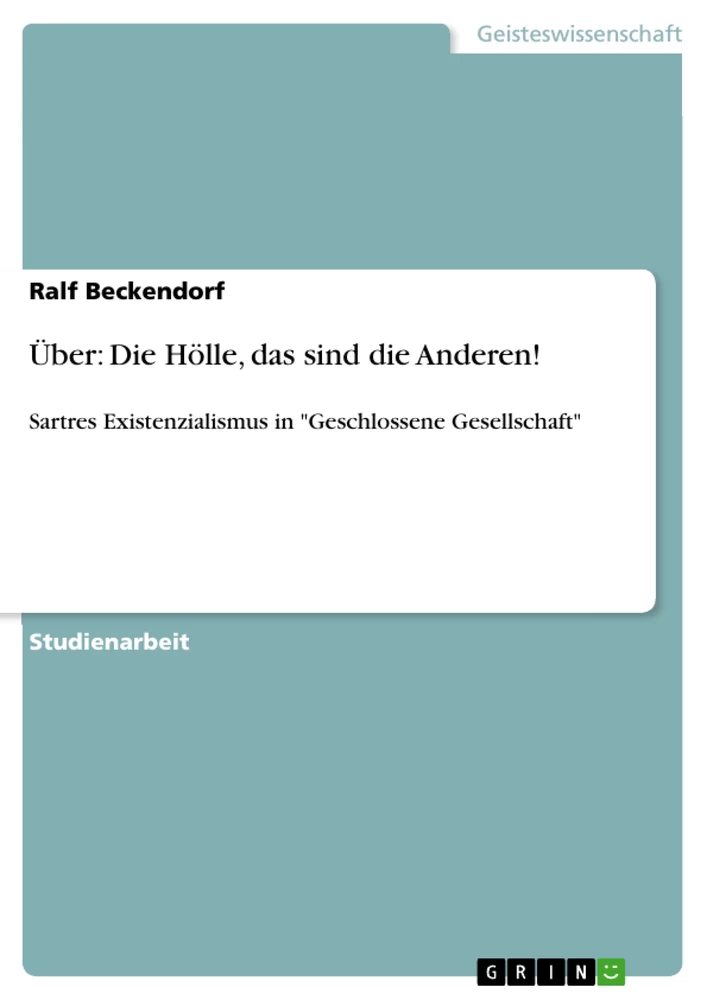Sartres Werk widersetzt sich jedem Versuch einer Einordnung. In kritischer Anlehnung an Hegel, Freud, und Heidegger entwickelte Sartre eine existentialistische Phänomenologie, die ontologisch und anthropologisch ausdifferenziert wurde. In dem Kapitel „Der Blick“ aus Sartres „Das Sein und das Nichts“ gibt er eine mögliche Antwort auf die Frage, weshalb die Anderen für uns zur Hölle werden können: Es sind die Blicke der Anderen, die uns in eine Höllensituation bringen können. Warum? Die Ursache dafür sieht Sartre in mehreren Punkten. An erster Stelle das menschliche Schamgefühl und die scheinbar sinnlose Existenz aller Dinge in der Welt, was Sartre bereits 1935 in seinem Roman „Der Ekel“ geschildert hatte.
Der Blick des Menschen ist eine objektive Sichtweise. Alles was wir in unserer Umwelt wahrnehmen, begreifen wir zunächst als Objekt, so auch die anderen Menschen. Unser Schamgefühl bezeichnet Sartre als das begreifen dessen, das man von Anderen gesehen wird und so zum Objekt des Betrachters gemacht wird. Das Höllische daran ist nun, laut Sartre, dass wir nicht imstande sind den uns Betrachtenden unsere Subjektheit, unser eigenes Wesen zu vermitteln. „Insofern bilden die andren zunächst eine Hölle, weil sie uns dazu verdammen, etwas zu sein, was wir nicht sind, und uns damit unserer Freiheit berauben, uns zu dem zu machen, was wir wirklich sind.“ Das bedeutet, dass der Betrachter nicht in der Lage ist unser inneres Wesen zu erfassen. Der erste Eindruck, bleibt immer ein äußerlicher, den man durch Gestik, Mimik und Aussagen des Gegenübers erfährt. So verhält es sich auch mit den Figuren des Dramas „Geschlossene Gesellschaft“. Drei Charaktere treffen hier aufeinander, von denen je einer den Blicken und Meinungen der zwei Anderen ausgesetzt ist und bleibt. Auch der Zuschauer wird niemals in die Situation gelangen, dass wahre Wesen eines der Charaktere zu erfassen. Es ist und bleibt der Blick, der das Schamgefühl, als ein ich werde gesehen in uns wach ruft und damit den Anderen zum Feind macht, der nicht unser Wesen, sondern unsere Existenz als ein Objekt unter Objekten erfährt. „Der Andere wird zunächst als die Hölle erfahren, als der Feind, der einen durch seinen Blick im weitesten Sinne tötet, weil er festlegt, versteinert, zu einem Objekt, zu einem Ding macht , das ihm passiv ausgesetzt ist.“
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. JEAN-PAUL SARTRE
- 2.1 „GESCHLOSSENE GESELLSCHAFT“, ZUM INHALT DES DRAMAS
- 3 FÜR-ANDERE-SEIN, SARTRES EXISTENZIALISMUS
- 3.1 SARTRES EXISTENZIALISMUS IN „GESCHLOSSENE GESELLSCHAFT“
- 4. „DIE HÖLLE, DAS SIND DIE ANDERN“; FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht Jean-Paul Sartres Existenzialismus und dessen Darstellung in seinem Drama „Geschlossene Gesellschaft“. Ziel ist es, Sartres philosophische Konzepte des „Für-Andere-Seins“ und des „Blicks“ zu erläutern und ihre Umsetzung im Drama zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die Beziehung zwischen Subjekt und Objekt im Kontext des menschlichen Daseins und der daraus resultierenden existentiellen Erfahrungen.
- Sartres Existenzialismus und seine philosophischen Grundlagen
- Das Konzept des „Für-Andere-Seins“ und seine Bedeutung
- Die Rolle des „Blicks“ in der Konstruktion der sozialen Wirklichkeit
- Analyse der Charaktere und ihrer Beziehungen in „Geschlossene Gesellschaft“
- Die Hölle als Metapher für die existenzielle Bedingung des Menschen
Zusammenfassung der Kapitel
1. EINLEITUNG: Die Einleitung stellt die zentrale Frage nach der Entstehung von Hölle durch den Anderen auf und führt in Sartres Existenzialismus und sein Drama „Geschlossene Gesellschaft“ ein. Sie skizziert den Ansatz der Arbeit, Sartres Philosophie anhand seines Lebenslaufs und seines Werks „Das Sein und das Nichts“ zu beleuchten und dessen Umsetzung im Drama zu analysieren. Die begrenzte Betrachtung auf für das Drama relevante Aspekte von Sartres Philosophie wird begründet.
2. JEAN-PAUL SARTRE: Dieses Kapitel präsentiert einen biografischen Abriss von Jean-Paul Sartre, der seinen Einfluss auf seine philosophische Entwicklung hervorhebt. Sartres Kindheit, geprägt vom frühen Verlust des Vaters und dem Aufwachsen bei den Großeltern, wird als formative Erfahrung für seine spätere Existenzialistische Philosophie dargestellt. Seine akademische Laufbahn und seine literarische und politische Tätigkeit werden in ihren Grundzügen skizziert. Die Bedeutung seines Werks „Das Sein und das Nichts“ für das Verständnis seines Dramas wird betont.
2.1 „GESCHLOSSENE GESELLSCHAFT“, ZUM INHALT DES DRAMAS: Dieser Abschnitt gibt eine knappe Inhaltsangabe von Sartres Drama „Geschlossene Gesellschaft“. Die Handlung, in der drei Personen nach ihrem Tod in einem einzigen Raum eingesperrt sind, wird beschrieben. Die Charaktere Garcin, Inés und Estelle werden vorgestellt, und die anfängliche Dynamik ihrer Interaktion wird skizziert. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Hölle als Ort der ewigen Begegnung und der daraus resultierenden Konflikten und Abhängigkeiten der Figuren.
3 FÜR-ANDERE-SEIN, SARTRES EXISTENZIALISMUS: Dieses Kapitel erörtert Sartres Existenzialismus, insbesondere das Konzept des „Für-Andere-Seins“. Ausgehend vom Schamgefühl als zentralem Element werden die Objekt-Subjekt-Beziehungen zwischen Menschen analysiert. Sartres „An-sich-Sein“ und „Für-sich-Sein“ werden definiert und im Kontext des „Blicks“ des Anderen erläutert. Die Bedeutung der Wahrnehmung und der Objektwerdung in den zwischenmenschlichen Beziehungen wird im Detail diskutiert, um das Verständnis für Sartres Theorie zu schaffen.
3.1 SARTRES EXISTENZIALISMUS IN „GESCHLOSSENE GESELLSCHAFT“: Dieser Abschnitt untersucht die Umsetzung von Sartres philosophischen Thesen in seinem Drama. Die Gestaltung des Raumes als Hölle, das Fehlen von Spiegeln und die ununterbrochene Beleuchtung werden als symbolische Elemente interpretiert, die Sartres Konzepte visualisieren. Ausgewählte Szenen aus dem Drama werden analysiert, um die Objektwerdung der Figuren durch die gegenseitigen Blicke und das daraus resultierende Schamgefühl zu verdeutlichen. Die Interaktionen zwischen den Charakteren werden als Veranschaulichung von Sartres Philosophie des „Für-Andere-Seins“ interpretiert.
Schlüsselwörter
Existenzialismus, Jean-Paul Sartre, Geschlossene Gesellschaft, Für-Andere-Sein, Blick, Schamgefühl, Objektwerdung, Freiheit, Hölle, An-sich-Sein, Für-sich-Sein, Subjekt, Objekt, zwischenmenschliche Beziehungen.
Häufig gestellte Fragen zu: Jean-Paul Sartres "Geschlossene Gesellschaft" - Seminararbeit
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert Jean-Paul Sartres Existenzialismus und dessen Darstellung in seinem Drama „Geschlossene Gesellschaft“. Der Fokus liegt auf Sartres Konzepten des „Für-Andere-Seins“ und des „Blicks“ und deren Umsetzung im Drama. Die Arbeit untersucht die Beziehung zwischen Subjekt und Objekt im Kontext des menschlichen Daseins und der daraus resultierenden existentiellen Erfahrungen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Sartres Existenzialismus und seine philosophischen Grundlagen, das Konzept des „Für-Andere-Seins“, die Rolle des „Blicks“ in der Konstruktion sozialer Wirklichkeit, eine Analyse der Charaktere und ihrer Beziehungen in „Geschlossene Gesellschaft“, und die Hölle als Metapher für die existenzielle Bedingung des Menschen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über Jean-Paul Sartre (inklusive eines Unterkapitels zur Inhaltsangabe von "Geschlossene Gesellschaft"), ein Kapitel über Sartres Existenzialismus und das "Für-Andere-Sein" (mit einem Unterkapitel zur Umsetzung im Drama), und ein Fazit. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung stellt die zentrale Frage nach der Entstehung der Hölle durch den Anderen und führt in Sartres Existenzialismus und sein Drama „Geschlossene Gesellschaft“ ein. Sie skizziert den Ansatz der Arbeit und begründet die begrenzte Betrachtung auf für das Drama relevante Aspekte von Sartres Philosophie.
Was beinhaltet das Kapitel über Jean-Paul Sartre?
Dieses Kapitel bietet einen biografischen Abriss Sartres, der seinen Einfluss auf seine philosophische Entwicklung hervorhebt. Es beleuchtet seine Kindheit, akademische Laufbahn, literarische und politische Tätigkeit und betont die Bedeutung seines Werks „Das Sein und das Nichts“ für das Verständnis seines Dramas.
Was ist die Inhaltsangabe von "Geschlossene Gesellschaft"?
Die Inhaltsangabe beschreibt die Handlung, in der drei Personen nach ihrem Tod in einem einzigen Raum eingesperrt sind. Die Charaktere Garcin, Inés und Estelle werden vorgestellt, und die anfängliche Dynamik ihrer Interaktion und die Hölle als Ort der ewigen Begegnung wird skizziert.
Wie wird Sartres Existenzialismus erläutert?
Das Kapitel erörtert Sartres Existenzialismus, insbesondere das Konzept des „Für-Andere-Seins“. Es analysiert Objekt-Subjekt-Beziehungen, definiert Sartres „An-sich-Sein“ und „Für-sich-Sein“ im Kontext des „Blicks“ des Anderen und diskutiert die Bedeutung der Wahrnehmung und Objektwerdung in zwischenmenschlichen Beziehungen.
Wie wird Sartres Philosophie in "Geschlossene Gesellschaft" umgesetzt?
Dieser Abschnitt analysiert die Umsetzung von Sartres philosophischen Thesen im Drama. Der Raum, das Fehlen von Spiegeln und die Beleuchtung werden als symbolische Elemente interpretiert. Ausgewählte Szenen werden analysiert, um die Objektwerdung der Figuren und das Schamgefühl zu verdeutlichen. Die Interaktionen werden als Veranschaulichung von Sartres Philosophie des „Für-Andere-Seins“ interpretiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Existenzialismus, Jean-Paul Sartre, Geschlossene Gesellschaft, Für-Andere-Sein, Blick, Schamgefühl, Objektwerdung, Freiheit, Hölle, An-sich-Sein, Für-sich-Sein, Subjekt, Objekt, zwischenmenschliche Beziehungen.
- Quote paper
- Ralf Beckendorf (Author), 2005, Über: Die Hölle, das sind die Anderen!, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148756