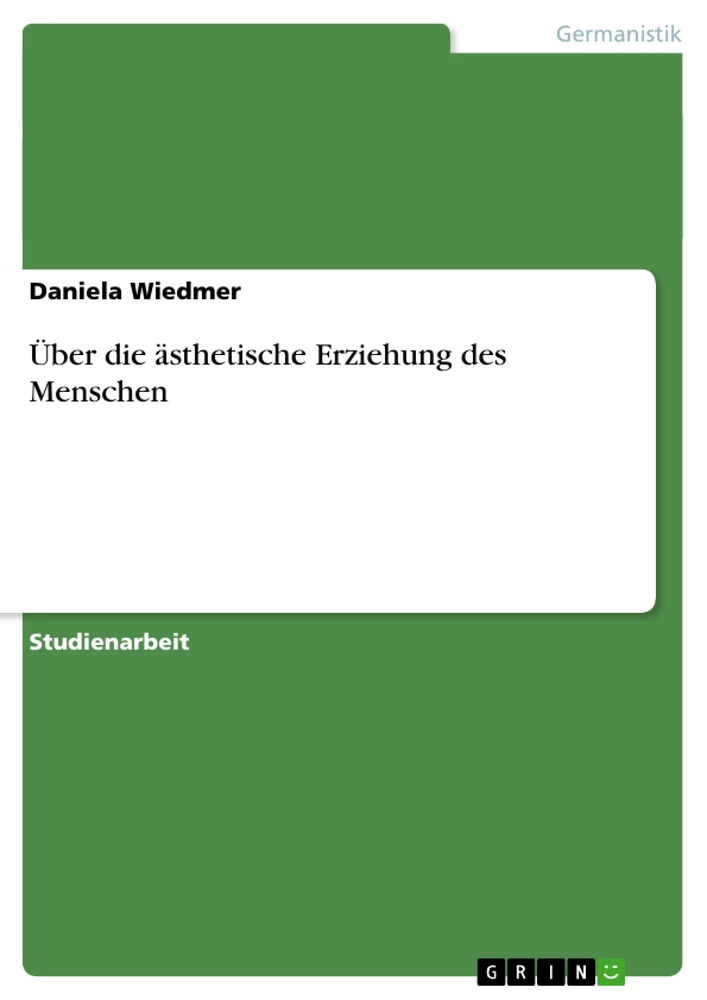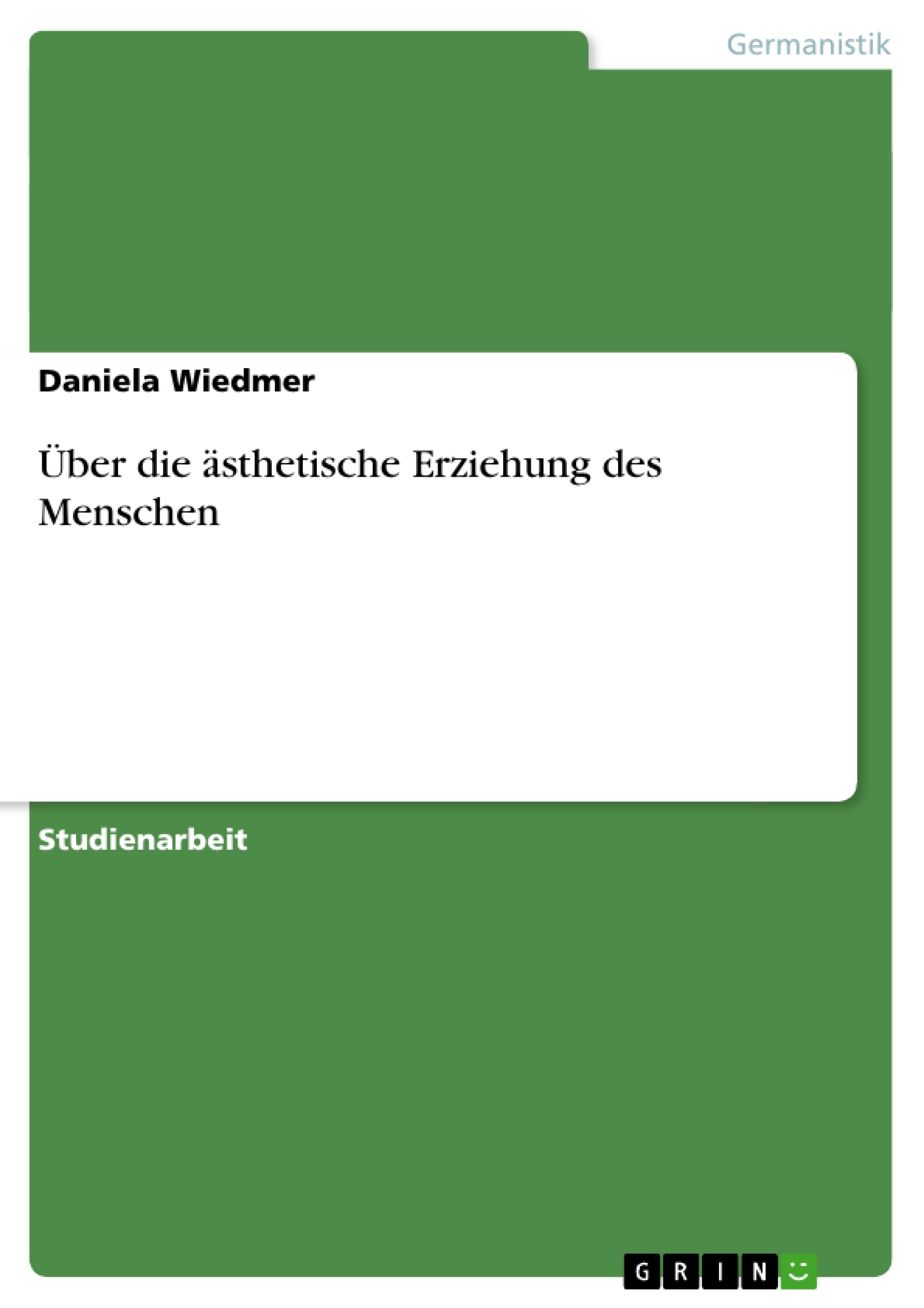Woran liegt es, dass wir noch immer Barbaren sind?
Obwohl wir diese Frage erst im achten Brief von Schillers ästhetischer Erziehung finden, können wir sagen, dass sie doch eine der Leitfragen ist, die beantwortet werden soll und muss. Wie kann es sein, dass wir, obwohl wir in einer aufgeklärten Gesellschaft leben und uns dennoch unserer Natur bewusst sind, noch immer als Barbaren, aber auch als Wilde auftreten? Woran liegt es, dass wir immer dem einen oder anderen Trieb in uns den Vorzug geben, entweder als Vernünftige erscheinen wollen oder uns unsere Rechte wie Tiere erkämpfen möchten? Zwar stellt sich Schiller diese Frage in Bezug auf seine Zeit, die geprägt war durch die Französische Revolution, aber auch durch seine eigenen Erfahrungen als Schriftsteller, dennoch können wir auch in unserer Zeit die Fragestellung als aktuell betrachten, was am Ende dieser Arbeit der Fall sein soll.
Hauptziel dieser Arbeit ist es jedoch den Weg aufzuzeigen, der uns zum ästhetischen Zustand führt, wie ihn Schiller in den Briefen 17 bis 22 darstellt. Zuvor erscheint es aber sinnvoll, eine kurze Zusammenfassung mit wesentlichen Punkten der vorherigen Briefe zu geben. Das ist alleine deshalb schon notwendig, weil die Begriffe, die Schiller in den vorherigen Briefen geprägt hat, unbedingt geklärt werden müssen. Was verstehen wir unter Person und Zustand? Welche Triebe herrschen in uns und wie ist es möglich, sie zu vereinigen, wenn dies überhaupt möglich ist? Welchen Dienst leistet dabei die Kunst, die Kultur? Was ist Schönheit? Welche Aufgabe haben die schmelzenden und energischen Kräfte? Nur durch das Verständnis dieser, man könnte sagen, Grund- begriffe, ist es auch möglich, den Weg zum ästhetischen Zustand nachzuvollziehen.
Dabei soll die Betrachtung sich allein auf Schillers Auffassungen beziehen. Zwar orientierte sich Schiller vornehmlich an Kantischen Grundsätzen, wie er selbst am Anfang schreibt und in der Sekundärliteratur werden viele weitere philosophische Strömungen, insbesondere von Fichte und Hegel, im Zusammenhang zur ästhetischen Erziehung betrachtet, dennoch baut Schillers Abhandlung nicht vollständig auf ihnen auf und muss eigenständig betrachtet werden, zumal er sich in einigen Punkten sehr wohl von Kant unterscheidet.
Der Schluss soll eine Rückführung zum Beginn sein und beweisen, dass Schiller in seiner Abhandlung Weitblick gezeigt hat, als er schrieb: „Die alten Grundsätze werden bleiben, aber sie werden das Kleid des Jahrhunderts tragen[…]“*.
Inhaltsverzeichnis
- „Woran liegt es, dass wir noch immer Barbaren sind?“
- „Ewig nur an ein einzelnes kleines Bruchstück des Ganzen gefesselt, bildet sich der Mensch selbst nur als Bruchstück aus“ - Zusammenfassung der Briefe 1-16
- Der ästhetische Zustand
- „An dem Menschen findet sie einen schon verdorbenen und widerstrebenden Stoff“ - Brief 17
- „Die Schönheit verknüpft die zwey entgegengesetzten Zustände“ Brief 18
- „Der Wille behauptet eine vollkommene Freyheit zwischen beyden“ – Brief 19
- „Die Schalen einer Wage stehen gleich, wenn sie leer sind; sie stehen aber auch gleich, wenn sie gleiche Gewichte enthalten.“ – Brief 20
- „In dem ästhetischen Zustand ist der Mensch also Null“ Brief 21
- „Ein Zustand der höchsten Realität“ – Brief 22
- „Die alten Grundsätze werden bleiben, aber sie werden das Kleid des Jahrhunderts tragen“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit Schillers „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“ und untersucht den Weg zum ästhetischen Zustand, wie er in den Briefen 17 bis 22 dargestellt wird. Sie beleuchtet die zentralen Begriffe und Theorien, die Schiller in den vorherigen Briefen entwickelt hat, um ein tieferes Verständnis des ästhetischen Zustands zu ermöglichen. Die Arbeit fokussiert dabei auf Schillers eigene Auffassungen, wobei sie seine Auseinandersetzung mit Kant und anderen philosophischen Strömungen nur am Rande betrachtet.
- Die Kritik an Kant und die Suche nach einer Verbindung von Vernunft und Gefühl
- Die Entwicklung des Menschen vom Naturzustand zum sittlichen Zustand
- Die Rolle der Kunst und Kultur in der Erziehung des Menschen
- Die Bedeutung des ästhetischen Zustands für die Einheit von Mensch und Staat
- Die Rolle der Freiheit und der Willkür in der menschlichen Existenz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Zusammenfassung der Briefe 1-16 beleuchtet Schillers Kritik an Kant und die Suche nach einer Synthese von Vernunft und Gefühl. Sie zeigt, wie Schiller den Weg des Menschen von der Natur zur Sittlichkeit und schließlich zur Freiheit beschreibt. Die Bedeutung der Kunst und Kultur als Mittel der Erziehung wird hervorgehoben, sowie die Notwendigkeit, die Einigkeit zwischen Mensch und Staat zu erreichen.
Der Abschnitt „Der ästhetische Zustand“ analysiert Schillers Beschreibung des ästhetischen Zustands, der als ein Zustand der Harmonie und Einheit zwischen Vernunft und Gefühl, Natur und Kultur, Mensch und Staat verstanden wird. Die einzelnen Briefe beleuchten dabei verschiedene Aspekte dieses Zustands, wie die Notwendigkeit der „Null“-Erfahrung, die Verbindung von entgegengesetzten Zuständen und die Rolle des Willens.
Schlüsselwörter
Ästhetische Erziehung, ästhetischer Zustand, Vernunft, Gefühl, Natur, Kultur, Freiheit, Willkür, Staat, Mensch, Kunst, Schönheit, Schiller, Kant, Philosophie.
- Quote paper
- Daniela Wiedmer (Author), 2008, Über die ästhetische Erziehung des Menschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148578