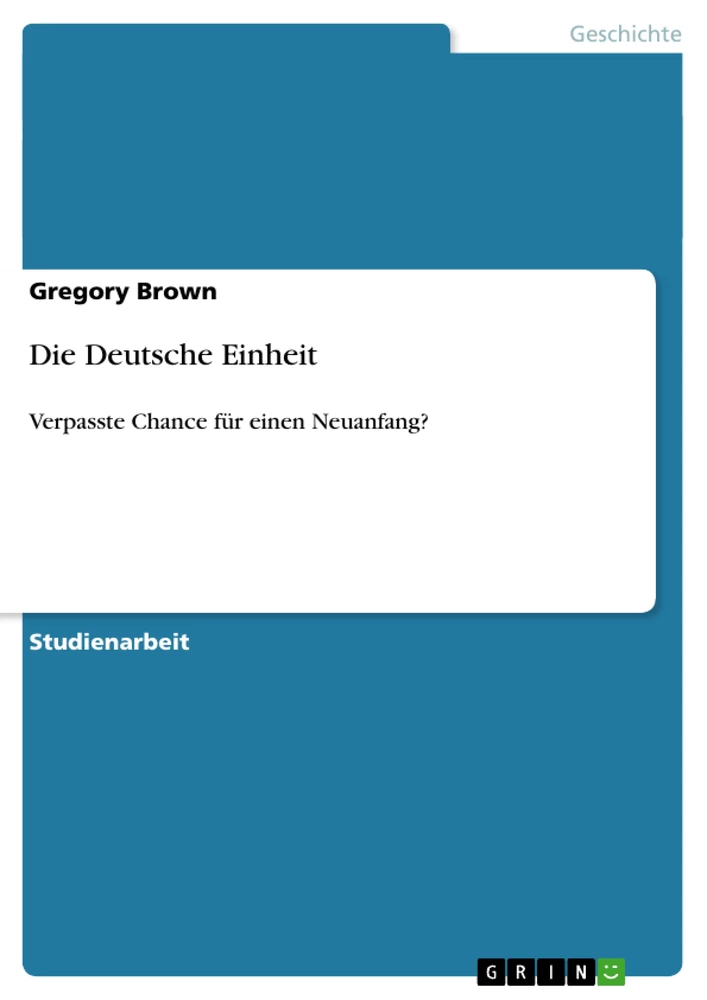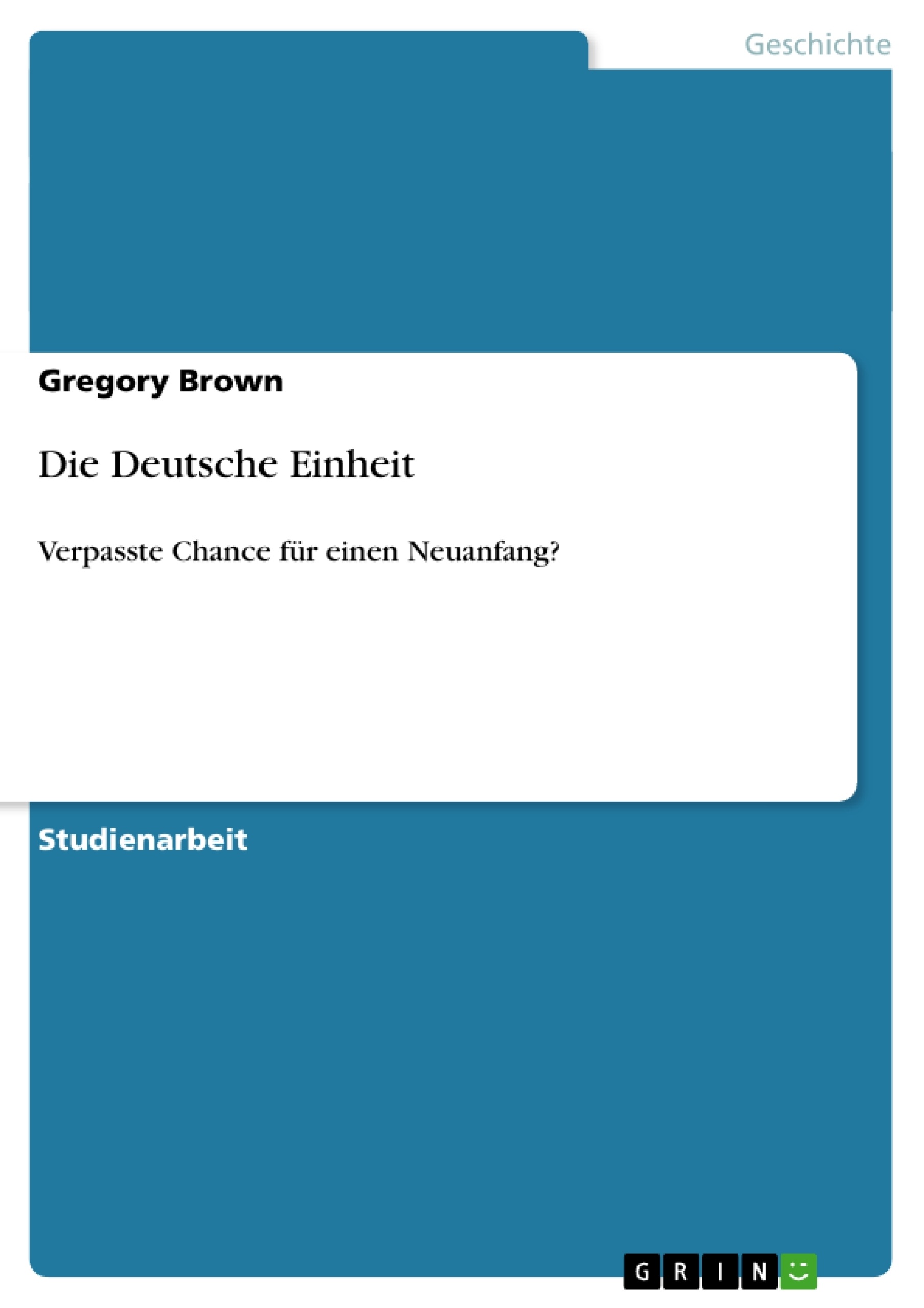Am 3. Oktober 1990 trat die DDR der Bundesrepublik Deutschland bei. Nach über 40-jähriger Teilung war das deutsche Volk wieder in einem Staat vereint. Doch auch fast 20 Jahre nach der Wiedervereinigung lebt die Mauer in den Köpfen weiter. Viele Ostdeutsche fühlen sich immer noch als „Deutsche zweiter Klasse“. Viele Historiker, insbesondere jene mit DDR-Hintergrund, sind der Ansicht, dass die DDR von der BRD gewaltsam und gegen ihren Willen einverleibt wurde. Sie weisen darauf hin, dass die DDR im Jahre 1990 keine Diktatur mehr war, sondern ein freier, demokratischer und völkerrechtlich anerkannter Staat. Die Mehrzahl der Intellektuellen wünschte sich damals einen eigenständigen Staat DDR und die Verwirklichung eines „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“. Als klar wurde, dass sich die Vereinigung nicht länger aufhalten liesse, schwenkten sie um und propagierten einen neuen „humanistischen“ Staat mit einem neuen Grundgesetz, der die Errungenschaften der BRD und der DDR miteinander vereint hätte. Unter anderem hätten plebiszitäre Elemente, der Antifaschismus und das Recht auf Arbeit in der neuen gemeinsamen Verfassung festgeschrieben werden sollen. Stattdessen kam es zu einem einfachen Beitritt der DDR zur BRD nach Artikel 23 des Grundgesetzes. Nach Ansicht der „Ost-Historiker“ wurde die Ordnung der BRD der DDR „übergestülpt“. Bundeskanzler Helmut Kohl bekräftigte mehrmals, dass die BRD der „freiheitlichste und menschlichste Staat in der deutschen Geschichte “ sei. Das Grundgesetz war für ihn unantastbar.
Ziel dieser Seminararbeit ist es, die historische Debatte über die Frage, weshalb sich ein demokratischeres, auf humanistisch-sozialistischen Wurzeln basierendes Deutschland nicht realisieren liess, aufzuzeichnen. Dabei werden drei Forschungsansätze unterschieden. Ich werde mich vor allem auf die beiden letzteren stützen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Kontroverse zur deutschen Einheit.
2.1 Die vorherrschende Strömung der Geschichtswissenschaft
2.2 Die Historiker mit DDR-Hintergrund
2.3 Der Ansatz von Klaus-Peter Dauks
3. Fazit
3.1 Gründe gegen eine eigenständige DDR
3.2 Gründe gegen eine Vereinigung nach Artikel 146
3.3 Forschungsbilanz:
4. Zeittafel
5. Literatur
Anhang
1 .Einleitung
Am 3. Oktober 1990 trat die DDR der Bundesrepublik Deutschland bei. Nach über 40jähriger Teilung war das deutsche Volk wieder in einem Staat vereint. Doch auch fast 20 Jahre nach der Wiedervereinigung lebt die Mauer in den Köpfen weiter. Viele Ostdeutsche fühlen sich immer noch als „Deutsche zweiter Klasse“. Viele Historiker, insbesondere jene mit DDR-Hintergrund, sind der Ansicht, dass die DDR von der BRD gewaltsam und gegen ihren Willen einverleibt wurde. Sie weisen darauf hin, dass die DDR im Jahre 1990 keine Diktatur mehr war, sondern ein freier, demokratischer und völkerrechtlich anerkannter Staat. Die Mehrzahl der Intellektuellen wünschte sich damals einen eigenständigen Staat DDR und die Verwirklichung eines „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“. Als klar wurde, dass sich die Vereinigung nicht länger aufhalten liesse, schwenkten sie um und propagierten einen neuen „humanistischen“ Staat mit einem neuen Grundgesetz, der die Errungenschaften der BRD und der DDR miteinander vereint hätte. Unter anderem hätten plebiszitäre Elemente, der Antifaschismus und das Recht auf Arbeit in der neuen gemeinsamen Verfassung festgeschrieben werden sollen. Stattdessen kam es zu einem einfachen Beitritt der DDR zur BRD nach Artikel 23 des Grundgesetzes.[1] Nach Ansicht der „Ost-Historiker“ wurde die Ordnung der BRD der DDR „übergestülpt“. Bundeskanzler Helmut Kohl bekräftigte mehrmals, dass die BRD der „freiheitlichste und menschlichste Staat in der deutschen Geschichte[2] “ sei. Das Grundgesetz war für ihn unantastbar.
Ziel dieser Seminararbeit ist es, die historische Debatte über die Frage, weshalb sich ein demokratischeres, auf humanistisch-sozialistischen Wurzeln basierendes Deutschland nicht realisieren liess, aufzuzeichnen. Dabei werden drei Forschungsansätze unterschieden. Ich werde mich vor allem auf die beiden letzteren stützen.
1. Die vorherrschende Strömung der deutschen Forschung zur DDR reduziert diesen Staat auf den Aspekt des Unrechtsstaats und der totalitären Diktatur. Der Anschluss der DDR an die BRD wird dabei als selbstverständlich hingenommen und kaum be-leuchtet. Zu diesem Bereich zählen offizielle Publikationen der Bundesregierung wie das Handbuch zur deutschen Einheit, der Beitrag von Beate Ihme-Tuchel[3] in der Reihe „Kontroversen um die Geschichte“ oder das Handbuch „Bilanz und Perspektiven der DDR-F orschung“.
2. Die bereits oben geschilderten Historiker aus der ehemaligen DDR vertreten die Ansicht, dass eine reformierte DDR eine echte Alternative zur Bundesrepublik hätte sein können. Dabei stütze ich mich vor allem auf die Sammelbände „Die kurze Zeit der Utopie“ von Siegfried Prokop[4] und „Das letzte Jahr der DDR‘ von Stefan Bollinger.[5]
3. Marxistisch geprägte westdeutsche Historiker, wie Klaus-Peter Dauks, beschäftigen sich mit den strukturellen Ursachen und Zusammenhängen der Wende. Sie haben durchaus Sympathien für die DDR, gehen aber davon aus, dass die strukturellen Mängel des Staates zu gravierend waren und Reformen nicht durchführbar. Ursprünglich arbeitete auch Hermann Weber, der die Forschung zur DDR während Jahrzehnten massgeblich geprägt hatte, nach diesen Methoden. Jedoch schenkte Weber den EntWicklungen innerhalb der DDR nach dem Mauerfall zu wenig Beachtung.
Thematisch knüpft diese Seminararbeit an eine frühere Proseminararbeit an.[6] Diese handelte von den sogenannten Stalin-Noten des Jahres 1952. Damals schlug Stalin den Westmächten die Schaffung eines vereinten, neutralen, demilitarisierten und demokratischen Deutschland vor. Der Westen befürchtete eine Sowjetisierung ganz Deutschlands und lehnte den Vorschlag ab. Bis heute ist es unter Historikern umstritten, wie ernstgemeint der Vorschlag war. Schwerpunkt meiner Analyse werden die innenpolitischen Entwicklungen der DDR sowie die deutsch-deutschen Beziehungen sein. Aussenpolitische Aspekte werden nur am Rande erwähnt werden, da die USA, nach Ansicht des Amerika-Experten Claus Montag[7], die freie und demokratische Entscheidung der Deutschen akzeptiert hätten, sogar eine Neutralität oder eine Mitgliedschaft im Warschauer Pakt. Dies hinderte sie freilich nicht daran, sich für eine NATO-Mitgliedschaft Deutschlands einzusetzen.
Der zeitliche Schwerpunkt meiner Betrachtung bildet die Zeit von kurz vor dem Mauerfall im November 1989 bis zur deutschen Einheit im Oktober 1990. Den Mauerfall als Eckdatum habe ich gewählt, weil alle Forscher, auch diejenigen mit Ost-Hintergrund, das Ende der SED-Diktatur als positiv erachten. In dieser Arbeit soll es nicht um den Zusammenbruch der DDR gehen, sondern um die Frage, ob nach Ansicht der Forschung eine eigenständige demokratische DDR 1990 oder ein neuer gesamtdeutscher Staat, der die positiven Aspekte beider Teilstaaten übernommen hätte, realisierbar gewesen wäre.
Nach der Erläuterung der drei Forschungsansätze endet die Arbeit mit einem kurzen Fazit der Ergebnisse. Auf eine längere ereignisgeschichtliche Darstellung der Wende wird verzichtet, hingegen gibt eine kurze Zeittafel über die wichtigsten Geschehnisse Auskunft. Im Anhang befindet sich der „Aufruf für unser Land“. Die biographischen Anmerkungen zu den Forschern stammen, sofern sich in ihren Büchern keine Hinweise finden, aus Internetquellen. Zu einigen Personen konnten keine Informationen gefunden werden.
2. Kontroverse zur deutschen Einheit.
Ich werde in den nächsten drei Unterkapiteln die Erklärungsansätze der drei Strömungen zum Scheitern der DDR analysieren und jeweils untersuchen, warum sich, aus Ansicht der Forschung, der Anschluss an die BRD durchsetzte. Da die vorherrschende Tendenz der Geschichtsschreibung in meiner Typologie gerade dadurch charakterisiert wird, dass sie sich nur sehr oberflächlich mit den Umständen der Wiedervereinigung befasst hat, wird das Unterkapitel zu dieser Strömung kürzer ausfallen. Bei den anderen Strömungen werde ich detaillierter vorgehen, und insbesondere bei Dauks beleuchten, warum seiner Ansicht nach eine alternative Entwicklung sowohl im politischen, im sozialen als auch im wirtschaftlichen Bereich scheiterte.
2.1 Die vorherrschende Strömung der Geschichtswissenschaft
Die vorherrschende Forschungsrichtung zur DDR betrachtet vor allem die Aspekte der totalitären Diktatur und des Unrechtsstaates. Die Ereignisse nach dem Mauerfall werden in Überblickwerken zur Geschichte der DDR oder offiziellen Publikationen der Bundesregierung, wie beispielsweise dem Handbuch zur deutschen Einheit, fast völlig ausgeblendet. In Werken wie dem Band zur DDR in der Reihe „Kontroversen der Geschichte“ von Beate Ihme-Tuchel, dem Band ,„Bilanz und Perspektiven der DDR-Forschung“, der u.a. von Rainer Eppelmann[8] herausgegeben wurde, und auch in zahlreichen weiteren Büchern, die einen Überblick über den Forschungstand und die offenen Forschungsfragen geben sollten, werden viele Ereignisse aus der Spätphase der DDR kaum erwähnt. Die Mehrzahl der Autoren stammt aus dem Westen, einige wie beispielsweise Eppelmann oder auch Richard Schröder[9] kommen hingegen aus dem kirchlichen Umfeld der DDR.
Ihme-Tuchel erwähnt beispielsweise die reformsozialistischen Absichten der Bürgerbewegung 1989, geht aber auf die Umstände der Wiedervereinigung nicht ein, obwohl diese in der Politik und Öffentlichkeit beider Landesteile lange umstritten waren.[10] Die Argumente von Historikern mit DDR-Hintergrund werden kaum erwähnt mit der Begründung, dass diese durch ihre Betonung der „guten Absichten“ des Sozialismus nur ihre Vergangenheit beschönigen und ihren Einsatz für eine totalitäre Diktatur legitimieren wollen. Die Sichtweise, dass die DDR ein „fehlgeschlagenes Experiment, deren ursprünglich hehre Intentionen sich zu irgendeinem, meist nicht näher definierten, Zeitpunkt der Entwicklung unglücklich in ihr Gegenteil verkehrt hätten“[11] sei schlicht naiv und einer kritischen Auseinandersetzung nicht würdig.
Ein weiterer bedeutender Forscher zur DDR ist der Politikwissenschaftler Eckhard Jesse[12], einer der bedeutendsten zeitgenössischen Totalitarismusforscher. Jesse teilt Helmut Kohls Ansicht, dass die Bundesrepublik Deutschland die freieste Gesellschaft in der deutschen Geschichte sei. Er glaubt nicht, dass irgendwelche „Errungenschaften“ der DDR erhaltenswert gewesen wären und betont die Notwendigkeit der Verankerung Deutschlands in der „westlichen Wertegemeinschaft“ womit er die Militärallianz NATO zu meinen scheint.[13] Nur so könne die Bundesrepublik zukünftigen Herausforderungen gewachsen sein. Einem neutralen pazifistischen Deutschland erteilt er eine Abfuhr. Jesse veröffentlichte u.a. einen Band mit Aufsätzen von pro-westlichen DDR-Bürgerrechtlern. Darin erklärte beispielsweise der Dresdner Herbert Wagner:
„Nachdem ich im Herbst 1989 gar das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland erstmals lesen konnte - und ich las es in einem durch wie einen spannenden Kriminalroman -, war mir klar, dass wir den gerade laufenden Versuch, eine neue DDR-Verfassung zu schreiben, bleiben lassen und das Grundgesetz nahezu eins zu eins übernehmen sollten“.[14]
Ich werde am Beispiel des Artikels von Hartmunt Zimmermann[15] im Handbuch zur deutschen Einheit kurz darlegen, wie die vorherrschende Tendenz der Forschung die Entwicklungen, die zum Ende der DDR führten, darstellt. Zimmermann schildert, wie die Bevölkerung der DDR immer unzufriedener mit ihrer Führung wurde, die sich weigerte, die Reformprozesse in den Nachbarstaaten nachzuziehen. Die nachgewiesene Fälschung der Kommunalwahlen 1989 und die Rechtfertigung der DDR-Führung der Niederschlagung der chinesischen Demokratiebewegung brachten das Fass zum Überlaufen. Da sich die DDR auf Grund der in diesem Jahr stattfindenden Feiern zum 40. Jahrestag keine negativen Schlagzeilen leisten wollte, erlaubte sie den tausenden Menschen, die in den bundesdeutschen Botschaften der Nachbarstaaten Zuflucht gesucht hatten, die Ausreise. Daraufhin begannen die Menschen, die weiterhin in der DDR „eingesperrt“ waren, mit den Montagsdemonstrationen. Honeckers Nachfolger Egon Krenz machte nur wenige Zugeständnisse und versuchte die Führungsrolle der SED zu wahren. Die Empörung über den ans Tageslicht tretenden Machtmissbrauch der SED, die Grenzöffnung und der Mauerfall machten den Reformprozess unumkehrbar. Nach der Grenzöffnung wurde das Gefälle des Lebensstandards mit der BRD sichtbar. Runde Tische entstanden, weil es der Volkskammer an Legitimation fehlte. Der SED liefen die Mitglieder in Massen davon. Die Bevölkerung skandierte „wir sind ein Volk“. Sie wollte die sofortige Vereinigung beider Staaten. Im Februar erhielt Helmut Kohl von Moskau die Zustimmung zur Wiedervereinigung. Damit verlor die DDR die Möglichkeit zur eigenständigen Entwicklung. In der DDR ging die CDU nach ihrem Wahlsieg eine Koalition mit der SPD ein. Obwohl die Regierung bereits Ende Juli zerbrach bestand ein breiter Konsens zur Einheitsfrage. Im Oktober wurde schließlich der Beitritt nach Artikel 23 vollzogen.
Für Zimmermann scheint klar, dass das Volk einen bedingungslosen Beitritt wollte und das Modrows Regierung nicht legitim und daher irrelevant war. Er vermittelt das Bild eines Volksaufstandes gegen die SED und erwähnt weder, dass die Opposition pro-sozialistisch war, noch den Umstand, dass laut Umfragen weder de Maiziere noch das Volk einen bedingungslosen Anschluss wollten. Auch die Bestrebungen der DDR-Intellektuellen, eine gemeinsame neue Verfassung zu schaffen, sind kein Thema.
Es versteht sich von selbst, dass diese Ereignisse in den verschiedenen Werken unterschiedlich dargestellt werden. Auch die Vorkommnisse und Unterlassungen sind unterschiedlich. Besonders überraschend ist jedoch, dass der Aufruf „für unser Land“,[16] der in den Werken von Bollinger und Prokop eine zentrale Rolle spielt, in keinem dieser sogenannten Überblickswerke erwähnt wird. Ebenso wenig wird darauf eingegangen, dass damals auch im Westen viele Intellektuelle, wie z. B. Günther Grass, der Wiedervereinigung skeptisch gege- nüberstanden.[17] Sie fürchteten das Wiederaufkommen eines großdeutschen Nationalismus.
[...]
[1] Der Artikel 23 zählte die Länder der Bundesrepublik auf und erwähnte, dass andere Teile Deutschlands jederzeit der Bundesrepublik hätten beitreten können, worauf dort das Grundgesetz in Kraft getreten wäre. Bereits das Saarland war auf diese Weise der Bundesrepublik beigetreten. Im Falle der DDR bedeutete dieser Artikel, dass die Volkskammer der DDR jederzeit einen Beitritt zur BRD hätte beschließen können, wenn sie das Grundgesetz zu übernehmen bereit gewesen wäre. Ein Einverständnis der BRD wäre nicht nötig gewesen. Bei der Wiedervereinigung 1990 wurde das Grundgesetz der BRD zwar in einigen Punkten angepasst um den Beitritt der DDR juristisch zu ermöglichen, so wurden z.B. bestehende Verträge, Schulden, öffentliche Finanzen und Arbeitsverhältnisse geregelt. Dies war jedoch nicht mit der Ausarbeitung einer neuen Verfassung zu vergleichen.
[2] Kohl, Helmut, in: Diekmann, Kai/Reuth, Ralf Georg, Helmut Kohl. Ich wollte Deutschlands Einheit, Berlin 19992, S. 262.
[3] Jg. 1959, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften der Freien Universität Berlin.
[4] Jg. 1940, 1983-1996 Professor für Zeitgeschichte an der Humboldt Universität Berlin.
[5] Jg. 1954, studierte Philosophie, Politikwissenschaft und Geschichte an der Humboldt Universität, Habilitation 1986. 1990 aus der Lehre ausgeschieden.
[6] Die Deutschlandpolitik Stalins 1945-1953, Proseminararbeit in Neuester Geschichte Universität Bern, Eingereicht bei lic. Phil. Anton-Andreas Speck, September 2007.
[7] Jg. 1933, bis 1990 Professor für Außenpolitik der USA am Institut für Internationale Beziehungen Potsdam. Seit 1993 Redaktor der Zeitschrift Welttrends.
[8] Jg. 1943, Pfarrer, 1990-2005 Bundestagsabgeordneter für die CDU, seit 1998 Vorsitzender der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.
[9] Jg. 1943, evangelischer Theologe aus Sachsen, seit 2001 im nationalen Ethikrat.
[10] Der SPD-Vorsitzende Oskar Lafontaine wollte, dass die Bevölkerung der DDR ihren Staat zuerst politisch und wirtschaftlich reformieren sollte. Viele ostdeutsche Bürgerrechtler teilten diese Meinung. Lafontaine hielt die Idee des Nationalstaates für nicht mehr zeitgemäß. Eine Einigung sollte im Rahmen der gesamteuropäischen Integration stattfinden.
[11] Ihme-Tuchel, Beate, Kontroversen um die Geschichte. Die DDR, Darmstadt 2002, S. 7.
[12] Jg. 1948, 1978-1993 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Trier. Habilitation 1989. Seit 1993 Professor für Politikwissenschaft an der Universität Chemnitz
[13] Jesse, Eckhard, Bundesrepublik Deutschland: Geschichte, in: Korte, Karl-Rudolf/Weidenfeld, Werner (Hg.), Handbuch zur deutschen Einheit, Frankfurt 1993, S. 70.
[14] Wagner, Herbert, „Am 19. Dezember ist es endlich soweit“ in: Jesse, Eckhard, Friedliche Revolution und deutsche Einheit. Sächsische Bürgerrechtler ziehen Bilanz, Berlin 2006, S. 111.
[15] Bis 1992 Leiter des Arbeitsbereichs DDR-Forschung an der Freien Universität Berlin. Mittlerweile verstorben.
[16] Dabei handelte es sich um eine Ende November veröffentlichte Erklärung prominenter Bürger der DDR wie z.B. Christa Wolf. Der Aufruf, der von 200‘000 Menschen unterzeichnet wurde, propagierte eine eigenständige demokratische DDR.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text?
Dieser Text ist eine Seminararbeit, die sich mit der Kontroverse um die deutsche Einheit beschäftigt. Er untersucht die historische Debatte darüber, warum sich ein demokratischeres, auf humanistisch-sozialistischen Wurzeln basierendes Deutschland nicht realisieren ließ. Dabei werden drei Forschungsansätze unterschieden.
Welche Forschungsansätze werden in der Arbeit unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet drei Forschungsansätze:
- Die vorherrschende Strömung der deutschen Forschung, die die DDR auf den Aspekt des Unrechtsstaats und der totalitären Diktatur reduziert.
- Historiker aus der ehemaligen DDR, die die Ansicht vertreten, dass eine reformierte DDR eine echte Alternative zur Bundesrepublik hätte sein können.
- Marxistisch geprägte westdeutsche Historiker, die sich mit den strukturellen Ursachen und Zusammenhängen der Wende beschäftigen und die davon ausgehen, dass die strukturellen Mängel der DDR zu gravierend waren.
Welchen Zeitraum betrachtet die Arbeit?
Der zeitliche Schwerpunkt der Betrachtung liegt auf der Zeit von kurz vor dem Mauerfall im November 1989 bis zur deutschen Einheit im Oktober 1990.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die historische Debatte über die Frage aufzuzeichnen, weshalb sich ein demokratischeres, auf humanistisch-sozialistischen Wurzeln basierendes Deutschland nicht realisieren liess.
Was ist der „Aufruf für unser Land“ und warum ist er wichtig?
Der „Aufruf für unser Land“ war eine Ende November veröffentlichte Erklärung prominenter Bürger der DDR, die eine eigenständige demokratische DDR propagierte. Er wurde von 200‘000 Menschen unterzeichnet. Er wird in einigen Forschungsansätzen (Bollinger und Prokop) als zentral betrachtet, in anderen (vorherrschende Forschungsrichtung) jedoch nicht erwähnt.
Welche Rolle spielten die Stalin-Noten von 1952?
Die Seminararbeit knüpft an eine frühere Arbeit über die Stalin-Noten von 1952 an, in denen Stalin den Westmächten die Schaffung eines vereinten, neutralen, demilitarisierten und demokratischen Deutschland vorschlug.
Wer sind einige der erwähnten Forscher?
Einige der erwähnten Forscher sind Beate Ihme-Tuchel, Siegfried Prokop, Stefan Bollinger, Klaus-Peter Dauks, Hermann Weber, Claus Montag, Rainer Eppelmann, Richard Schröder, Eckhard Jesse und Hartmunt Zimmermann.
Welche Kritik wird an der vorherrschenden Strömung der Geschichtswissenschaft geübt?
Es wird kritisiert, dass die vorherrschende Strömung die Ereignisse nach dem Mauerfall fast völlig ausblendet, die Argumente von Historikern mit DDR-Hintergrund kaum erwähnt und die Umstände der Wiedervereinigung nur sehr oberflächlich betrachtet.
Warum wird Artikel 23 des Grundgesetzes erwähnt?
Artikel 23 des Grundgesetzes ermöglichte den Beitritt der DDR zur BRD. Er zählte die Länder der Bundesrepublik auf und erwähnte, dass andere Teile Deutschlands jederzeit der Bundesrepublik hätten beitreten können.
- Quote paper
- Gregory Brown (Author), 2008, Die Deutsche Einheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148504