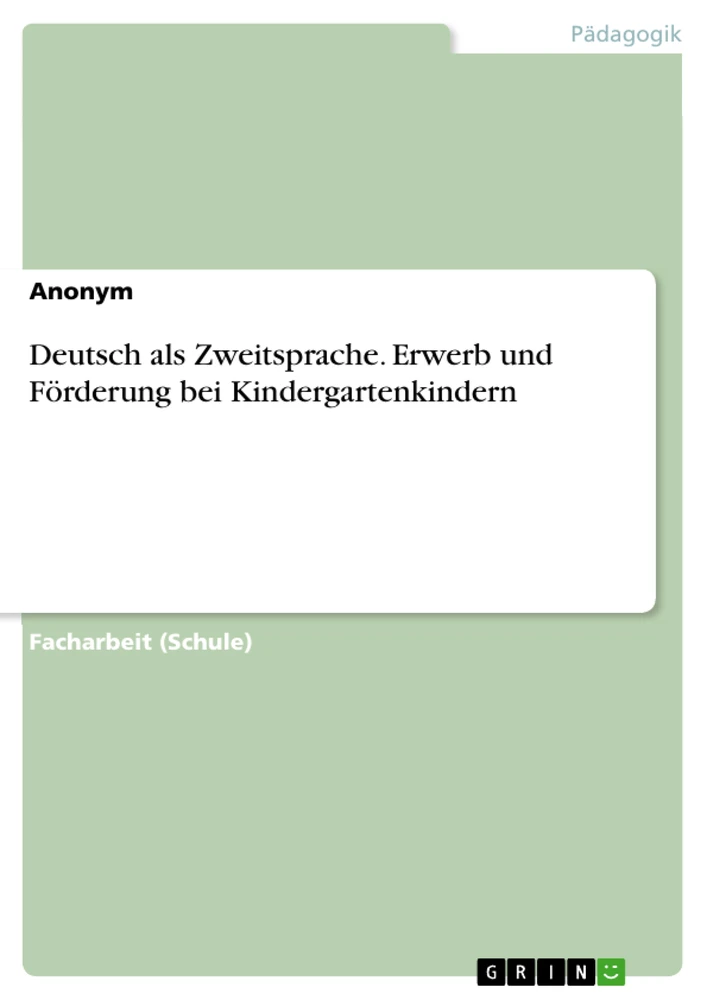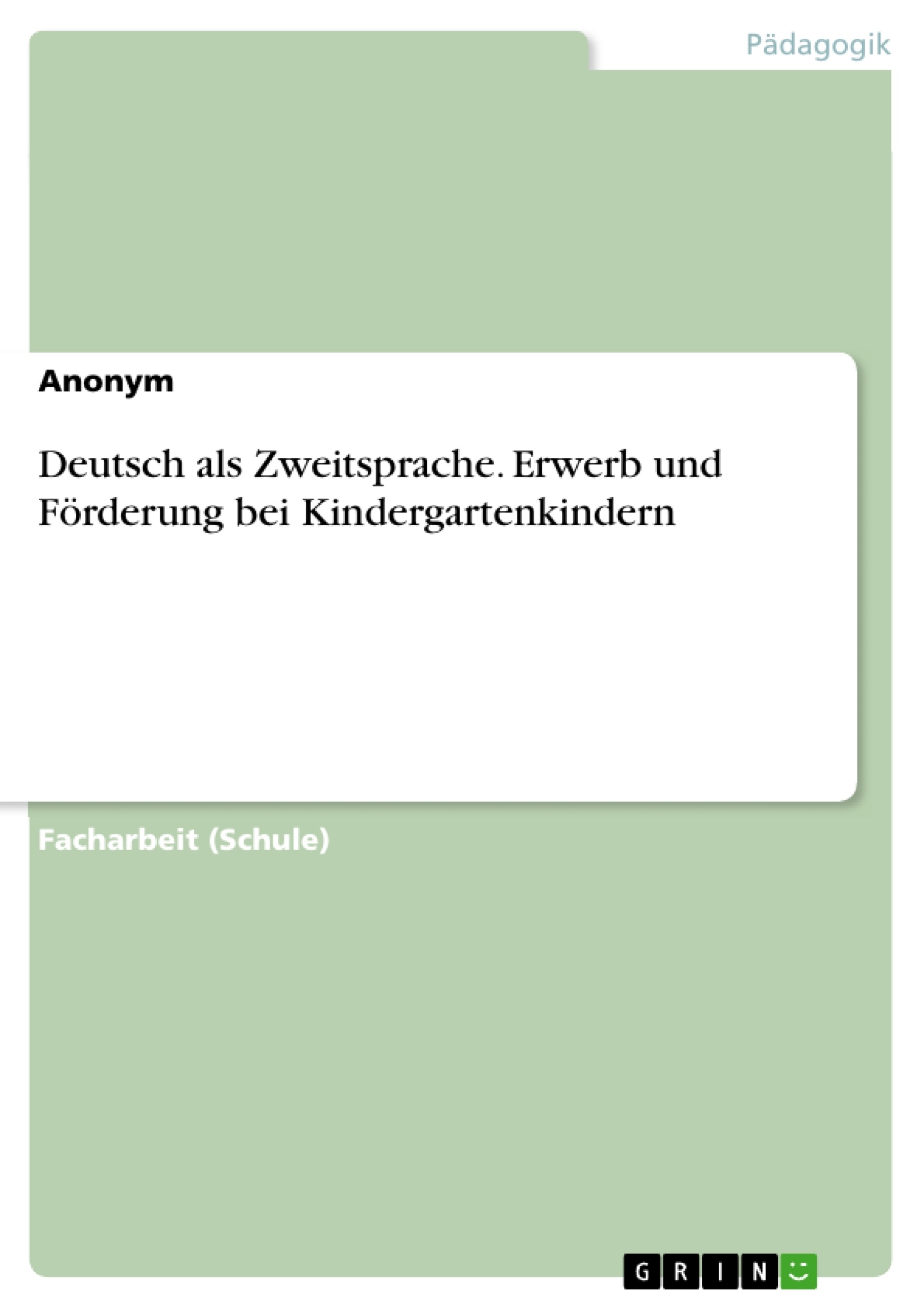Die Arbeit erklärt zunächst die Begriffe „Erstsprache" und „Zweitsprache". Daraufhin soll unterschieden werden, welche Formen des Zweitspracherwerbs es gibt und welches davon der Ausgangspunkt der Arbeit ist. Anschließend soll klargestellt werden, was
die Erstsprache für den Erwerb einer Zweitsprache bedeutet und welchen Vorteil es mit sich bringt. Danach werde ich der Frage nachgehen, mit welchen Herausforderungen die Kinder mit nicht deutscher Erstsprache konfrontiert sind und wie sich der Spracherwerb dieser Kinder im Kindergarten gestaltet, aber auch die Spracherwerbssituation in Zusammenarbeit mit den Eltern. Daraufhin werde ich einen Beobachtungsbogen vorstellen, der dabei hilft, die sprachlichen Fähigkeiten und die Motivation beim Erlernen der deutschen Sprache zu beobachten. Zum Schluss zeige ich, welche zwei Optionen es für Sprachfördermaßnahmen gibt. Passend dazu stelle ich ein Konzept zur ganzheitlichen Sprachförderung vor.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aufbau der Facharbeit
- Begrifflichkeiten
- Erstsprache
- Zweitsprache
- Zweitspracherwerb
- ungesteuerter / natürlicher Zweitspracherwerb
- Sukzessiver Zweitspracherwerb
- Die Bedeutung der Erstsprache für den Erwerb einer Zweitsprache
- Die Spracherwerbssituation
- Die Spracherwerbssituation im Kindergarten
- Die Spracherwerbssituation in Zusammenarbeit mit den Eltern
- Sprachstandserhebung von Kindern mit Zweitsprache Deutsch
- Spracherhebungsverfahren
- SISMIK-Verfahren
- Sprachfördermaßnahmen
- Sprachstrukturelle Förderprogramme
- Ganzheitliche Sprachförderung
- Meine, deine, unsere Sprache
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Facharbeit befasst sich mit dem Erwerb und der Förderung der deutschen Sprache bei Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren, die Deutsch als Zweitsprache lernen. Sie untersucht die verschiedenen Formen des Zweitspracherwerbs, insbesondere den sukzessiven Erwerb, und analysiert die Bedeutung der Erstsprache für den Prozess des Zweitspracherwerbs. Darüber hinaus betrachtet die Arbeit die Herausforderungen und Möglichkeiten des Spracherwerbs im Kindergarten und in Zusammenarbeit mit den Eltern.
- Die verschiedenen Formen des Zweitspracherwerbs (ungesteuerter, sukzessiver)
- Die Bedeutung der Erstsprache für den Zweitspracherwerb
- Die Spracherwerbssituation im Kindergarten
- Die Zusammenarbeit mit den Eltern bei der Sprachförderung
- Sprachstandserhebungsverfahren und Sprachfördermaßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert den Aufbau der Facharbeit und führt die zentralen Themen ein. Kapitel 2 beleuchtet die Begriffe „Erstsprache“ und „Zweitsprache“ und legt die Grundlage für die weitere Analyse des Zweitspracherwerbs. Kapitel 3 beschreibt die verschiedenen Formen des Zweitspracherwerbs, einschließlich des sukzessiven Erwerbs, der im Mittelpunkt dieser Arbeit steht. Kapitel 4 untersucht die Spracherwerbssituation im Kindergarten und die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit den Eltern. Kapitel 5 stellt Sprachstandserhebungsverfahren wie SISMIK vor, und Kapitel 6 beschreibt verschiedene Sprachfördermaßnahmen.
Schlüsselwörter
Zweitspracherwerb, Deutsch als Zweitsprache, Erstsprache, Kindergarten, Sprachförderung, sukzessiver Zweitspracherwerb, Sprachstandserhebung, SISMIK, ganzheitliche Sprachförderung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2024, Deutsch als Zweitsprache. Erwerb und Förderung bei Kindergartenkindern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1484971