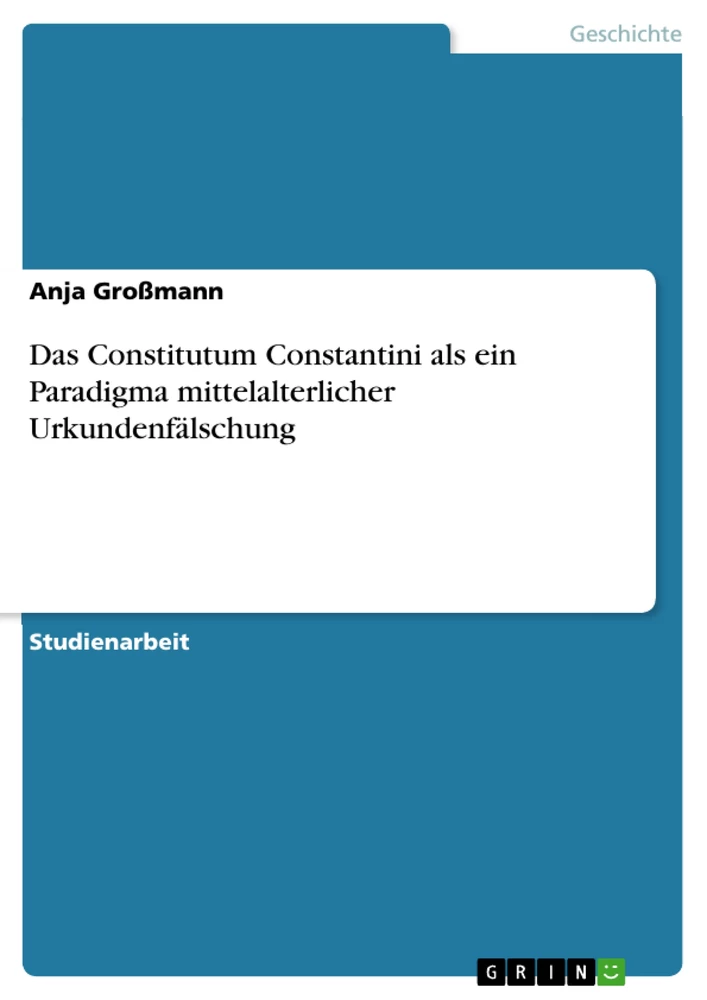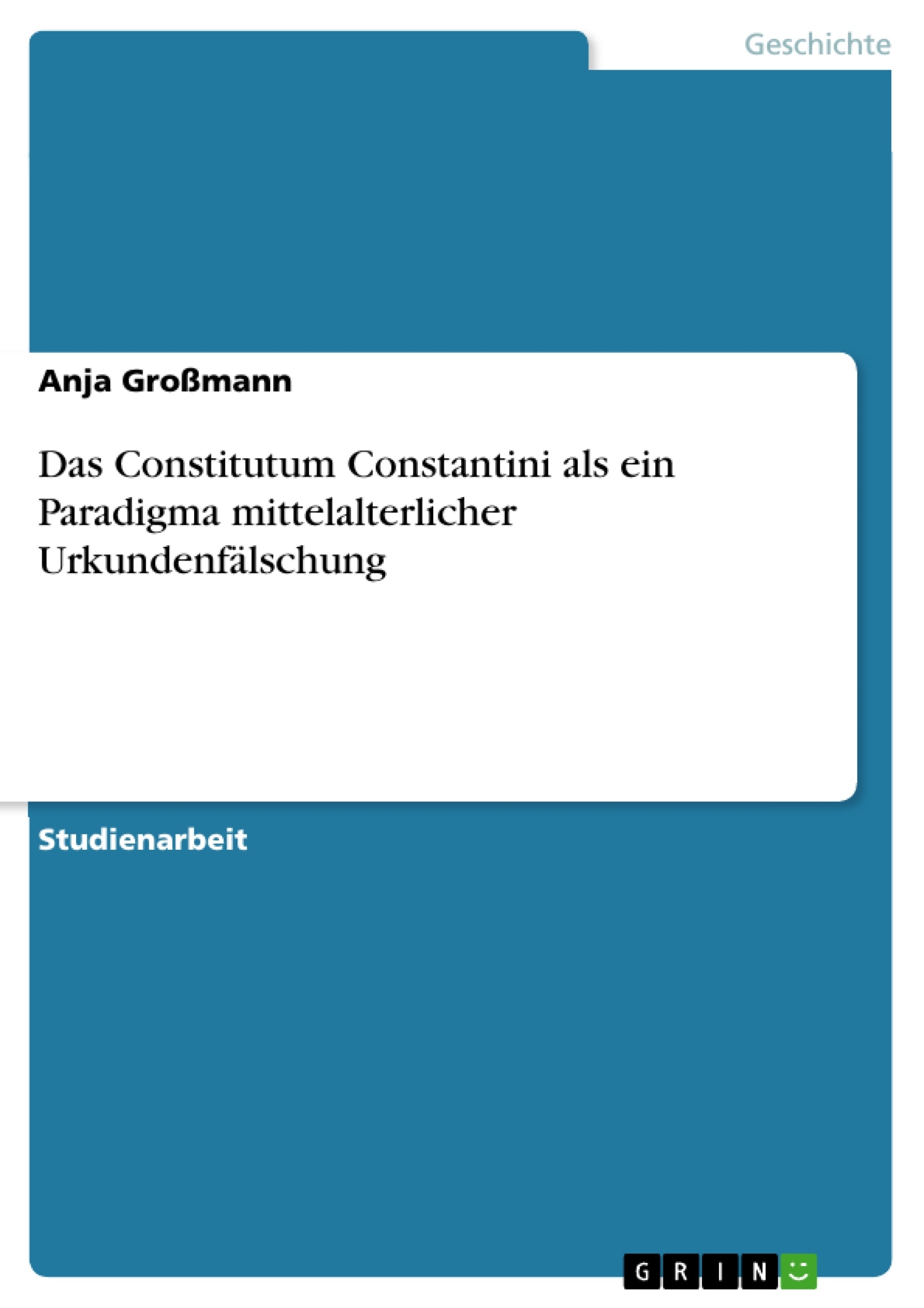Das auf den 30. März 317 aus Rom datierte Constitutum Constantini ist ein Paradigma der mittelalterlichen Urkundenfälschung aus dem Grunde, da es demonstriert, um ein wie vieles größer der historische Einfluss eines Falsifikates gegenüber einem echten Diplom sein kann. Diese Schenkung Kaiser Konstantins, der dem Christentum zu Akzeptanz und Etablierung im Römischen Reich verholfen hatte, übertrug dem Papsttum den Primat über alle Kirchen, imperialen Rechte und Besitztitel sowie die Territorialdonation, die den Kirchenstaat begründete. Aufgrund dieser weitreichenden Privilegierung wurde das Constitutum Constantini „‚Bestandteil des mittelalterlichen Weltbildes‘“.
In der vorliegenden Arbeit soll nun dieses Zeugnis der Falsifikationen des Mittelalters in Bezug auf seine Entstehung, seine inhaltliche Konzeption, die Wirkungsgeschichte und die humanistische Echtheitskritik analysiert werden.
Zunächst wird in einem propädeutischen Teil die Thematik der Urkundenfälschung aufgezeigt, wobei anfangs der Terminus an sich definiert werden soll, um danach eine knappe Typologie gefälschter Diplome zu geben. Anschließend sollen einige Motive der Falsifikatoren zur Herstellung der unechten Rechtsdokumente inklusive einer Reflexion über den Wahrheitsbegriff im Mittelalter vorgestellt werden. Den letzten Part der Propädeutik bildet ein Überblick über die moderne Methodik der Urkundenkritik.
Nachdem summarisch die Überlieferungstypen des Constitutum Constantini dargestellt wurden, wird den Forschungskontroversen vor allem um die Entstehungszeit breiter Raum gewidmet werden, wobei zum einen ein allgemeines Resümee über die diversen Hypothesen gegeben werden soll – mit der temporalen und kontextuellen Genese haben sich zuletzt unter anderem Fuhrmann, Gericke, Hehl, Ohnsorge beschäftigt –, und zum anderen wird die Schichtentheorie Gerickes und die anschließende Diskussion zwischen ihm und Fuhrmann aufgezeigt werden. Im Punkt fünf soll der Inhalt der Schenkungsurkunde, der sich in die Confessio und in die Donatio gliedert, thematisiert werden, um nachfolgend die Wirkungsgeschichte, die erst explizit in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts einsetzte, analysieren zu können. Die Echtheitskritik am Constitutum Constantini wird im siebten Abschnitt Gegenstand der Untersuchung bezüglich der Ungläubigkeit an der Authentizität im Mittelalter und des formalen Nachweises der Falschheit der Urkunde durch Nikolaus von Kues und Lorenzo Valla sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Propädeutischer Teil zur Urkundenfälschung im Mittelalter
- Begriffsdefinition
- Typologie gefälschter Diplome
- Motive zur Herstellung von Falsifikaten
- Urkundenkritik
- Zur Überlieferungsbasis des Constitutum Constantini
- Entstehungsort und -zeit der Fälschung
- Überblick der Forschungsthesen
- Das Etappen-Genese-Modell
- WOLFGANG GERICKES Vier-Stufen-These
- Widerspruch Horst FUHRMANNS und die weitere Diskussion
- Inhalt der Urkunde
- Confessio
- Donatio – die Rechtsbestimmungen des Constitutum Constantini
- Wirkungsgeschichte und Interpretation des Falsifikates
- Echtheitskritik
- Zweifel an der Authentizität im Mittelalter
- Der formale Fälschungsnachweis durch die Humanisten Nikolaus von Kues und Lorenzo Valla
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Analyse des Constitutum Constantini, einer Fälschung aus dem Mittelalter. Ziel ist es, die Entstehung, inhaltliche Konzeption, Wirkungsgeschichte und die humanistische Echtheitskritik dieser Urkunde zu beleuchten.
- Die Urkundenfälschung im Mittelalter: Definition des Begriffs, Typologie der Fälschungen, Motive und Methoden
- Die Überlieferungsbasis des Constitutum Constantini
- Die Entstehung des Constitutum Constantini: Forschungsthesen und das Etappen-Genese-Modell
- Der Inhalt des Constitutum Constantini: Confessio und Donatio
- Die Wirkungsgeschichte und Interpretation des Falsifikates
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Constitutum Constantini als ein Paradebeispiel für die mittelalterliche Urkundenfälschung vor und skizziert die Ziele der vorliegenden Arbeit. Der propädeutische Teil beleuchtet den Begriff der Urkundenfälschung im Mittelalter, einschließlich der Typologie gefälschter Diplome, Motive zur Herstellung von Falsifikaten und die Methoden der Urkundenkritik. Das dritte Kapitel behandelt die Überlieferungsbasis des Constitutum Constantini. Im vierten Kapitel werden die Forschungskontroversen um den Entstehungsort und die -zeit der Fälschung beleuchtet, wobei insbesondere das Etappen-Genese-Modell und die Diskussion zwischen Wolfgang Gericke und Horst Fuhrmann im Vordergrund stehen. Kapitel fünf analysiert den Inhalt des Constitutum Constantini, der sich in die Confessio und die Donatio gliedert. Die Wirkungsgeschichte des Falsifikates wird im sechsten Kapitel untersucht, während das siebte Kapitel die Echtheitskritik im Mittelalter und die formale Fälschungsanalyse durch Nikolaus von Kues und Lorenzo Valla beleuchtet. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Mittelalterliche Urkundenfälschung, Constitutum Constantini, Konstantinische Schenkung, Donatio Constantini, Echtheitskritik, Humanismus, Nikolaus von Kues, Lorenzo Valla, Historische Hilfswissenschaften, Diplomatik, Quellenkritik, Mittelalterliche Geschichte.
- Quote paper
- Anja Großmann (Author), 2007, Das Constitutum Constantini als ein Paradigma mittelalterlicher Urkundenfälschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148458