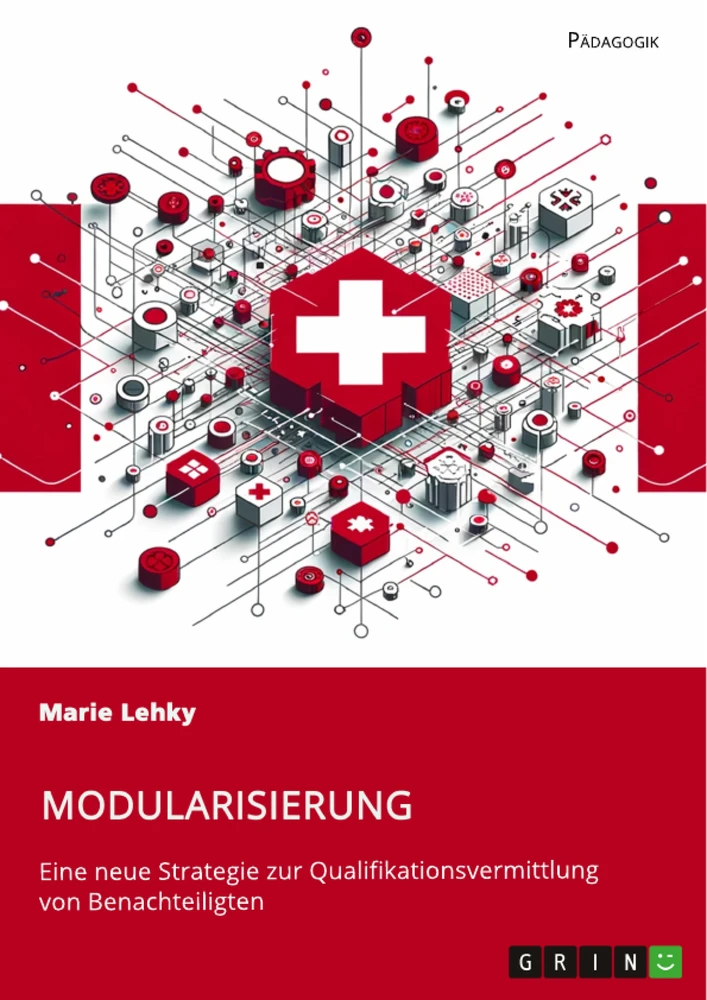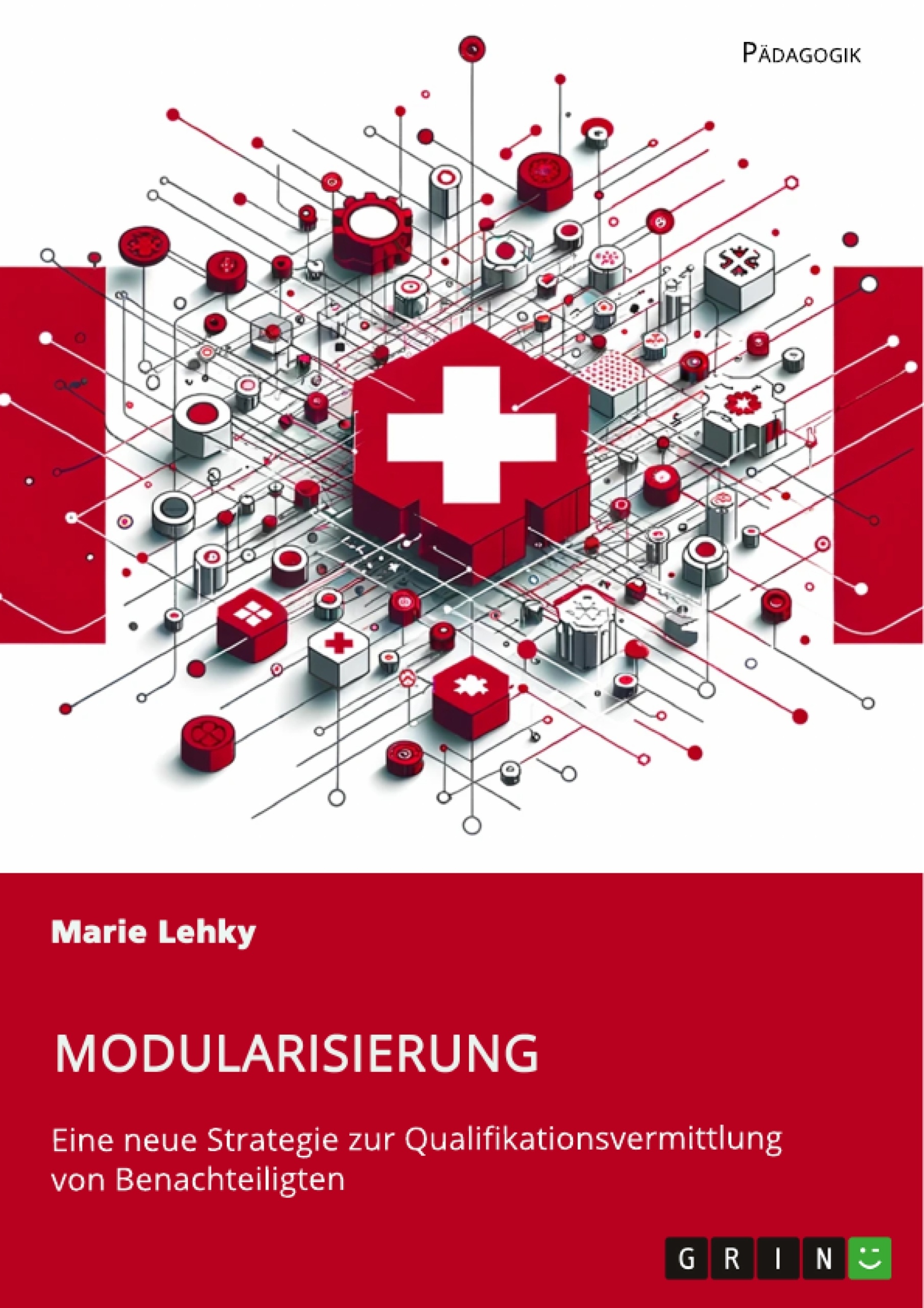In ihrem Essay "Modularisierung", verfasst an der Universität Zürich, beschreibt Marie Lehky detailliert das Prinzip und die strategische Bedeutung der Modularisierung in der beruflichen Bildung. Modularisierung bezeichnet die Gliederung von Lehrplänen in eigenständige Module, die einzelne, zertifizierbare Qualifikationen darstellen.
Lehky diskutiert die Vorteile dieses Systems, insbesondere für benachteiligte Gruppen, die durch flexible Bildungsstrukturen Unterstützung in ihrer beruflichen Laufbahn finden können. Der Essay erörtert weiterhin die gesellschaftliche und bildungspolitische Notwendigkeit der Modularisierung und deren Einfluss auf die Gestaltung moderner Bildungssysteme, insbesondere im Kontext der schweizerischen Berufsbildung.
Essay zum Begriff „Modularisierung“
These: Eine neue Strategie zur Qualifikationsvermittlung von Benachteiligten
Unter dem Begriff „Modul“ versteht man „eine sich aus mehreren Elementen zusammensetzende Einheit innerhalb eines Gesamtsystems, die jederzeit ausgetauscht werden kann“ [1] (Informatik). Im gleichen Duden wird der Begriff „Modularisierung“ folgendermassen definiert: „die Gliederung (eines Programms) in einzelne Module“ [2] (EDV). Nach dem Duden „Deutsches Universalwörterbuch“ kann das Modul auch eine „Lehreinheit bei bestimmten Hochschulstudiengängen“ [3] darstellen. An der Universität Zürich beispielsweise können Studierende mit Hilfe des Vorlesungsverzeichnisses Module bzw. Veranstaltungen der Theologischen Fakultät, der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, der Philosophischen Fakultät und der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät buchen. Die Studiengänge sind in Form von Modulen aufgebaut. In der Sprach- und Literaturwissenschaft können Studierende aus dem Katalog der Vorlesungen, Proseminaren, Seminaren, Übungen und Sprachkursen Basismodule der Sprachwissenschaft bzw. Literaturwissenschaft auswählen und später Aufbaumodule, Ergänzungsmodule, Vertiefungsmodule und Spezialisierungsmodule besuchen, welche auf den Basismodulen aufbauen. Ein Modul ist also wie ein Bauelement beschaffen. Hierzu ein kleines Beispiel aus der Übersicht der Module im Kleinen Nebenfach des Bachelor-Studiums im Fach „Slavische Literaturwissenschaft“ mit 30 Kreditpunkten.
Diese Abbildung ist nicht in der Leseprobe enthalten.
Abb. 1 Übersicht über die Module „Slavische Literaturwissenschaft“
Das Prinzip der Modularisierung funktioniert wie folgt: Die Lerneinheit wird zerlegt, somit erhält man zertifizierbare Teilqualifikationen. Anstelle eines Lizentiats-Studienabschlusses (lic. phil.), welcher in der Regel ca. vier oder mehr Jahre geht, wird der Lernstoff neu auf zwei Stufen „Bachelor“ und „Master“ aufgeteilt, sodass man auch eine zertifizierte Teilqualifikation „Bachelor“ für die Lerneinheit der Lizentiatsstufe erhält.
Aber nach Dieter Münk existiert in der Berufspädagogik für den Begriff der „Modularisierung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung“ bislang keine übereinstimmende Definition. [4] Das Wort Modul taucht weder im Berufsbildungsgesetz (BBG), welches seit 2004 in Kraft getreten ist, noch in der Verordnung zur Berufsbildung auf. [5]
Die Berufsausbildung erhält eine Teilqualifikation, welche sich berufsbildungspolitisch gegen die Beruflichkeit von Ausbildung, Beruf und Arbeit richtet, weil sie den Kern des dualen Systems – den Beruf in seiner Ganzheit – untergräbt, eine Teilzertifizierung anstrebt und nach einem Baukastenprinzip, Module oder Teilkonzepte, welche beliebig kombiniert werden können, aufbaut. Dieses Phänomen kann man auch im Essay „Modularisierung versus Beruflichkeit?“ [6] von Prof. Dr. Philipp Gonon feststellen.
Auf internationaler Ebene werden bereits Modularisierungsbestrebungen im Zusammenhang mit internationaler Anerkennung in Berufsbildung umgesetzt, insbesondere für Zielgruppen wie Benachteiligte, vor allem aber im Bereich der Zusatzqualifikationen (NCVQ-Verfahren, GNVQ-Verfahren). [7]
Für benachteiligte Gruppen, wie beispielsweise schulmüde und fremdsprachige Jugendliche, Behinderte, Lernende mit Lernschwächen, Arbeitslose, Frauen usw. werden gebrochene Karrieren als gewichtige Gründe für eine Modularisierung mit Zukunft hervorgehoben.
Zum Beispiel bei Frauen, welche durch das Kinderkriegen und durch die Kindererziehung zeitweise aus dem Erwerbsleben ausgestiegen sind, werden Lebensläufe mit Einträgen wie „Hausfrau und Mutter“ oder „Betreuung der 3 Kinder gewährleistet“ ausgebessert oder zusammengebastelt, um eventuelle Lücken im CV zu beseitigen um damit einen Wiedereinstieg in die Lohnarbeit zu ermöglichen. Eine neue berufliche Neuorientierung z.B. durch Kurswesen oder berufliche Weiterbildung im Baukastensystem soll auch für Personen, welche einen Karriereknick durchlaufen haben, welche Arbeitslose genannt werden, geschafft werden, weil kompakte Bildungsstrukturen entstandardisiert und Lebensformen enttraditioniert werden und die „normale“ Biographie aufgelöst haben. Dies erfordert eine neue Modularisierungsform im gesamten Bildungswesen.
Da Modularisierungskonzepte, welche auch eine flexiblere Gestaltung der Grundbildung anstreben, auch Teilabschlüsse (EBA, IT-Branche: Grund- und Aufbaustufen) ermöglichen und eine Qualifizierung und Zertifizierung (z.B. bei Abbrechen der Ausbildung durch einen Qualifizierungspass) für bereits erfolgreich abgeschlossene Module bieten. Des Weiteren könnten anerkannte Ausbildungs-abschlüsse wie bisher (z.B. Infopraktiker ➝ Informatiker EFZ) angestrebt werden.
Die vierjährige berufliche Ausbildung zum Informatiker bzw. zur Informatikerin in der Schweiz ist in Teilsegmenten modularisiert und beruht auf einem Modulbaukastensystem, wo Teilqualifikationen (gegenseitige Anerkennung der Module und Lehrabschlussprüfungen der Ausbildungsverbände) anerkannt werden. Es kann eine generalistische Ausbildung oder eine Ausbildung mit Schwerpunkten zum Beispiel im Support oder Systemtechnik ausgewählt werden.
„In der beruflichen Grundbildung sollte zunächst eine auf Ganzheitlichkeit beruhende Basis gelegt werden, ehe dann im Sinne einer Differenzierung und Erweiterung Module in das Berufskonzept eingebaut werden könnten (Dubs 2003, S.7).“ [8]
Rolf Dubs, mein ehemaliger Professor, betont, dass die Vorteile einer Modularisierung in der Weiterbildung lägen, weil sie bei breiter Anerkennung „viele Effizienzprobleme“ löse und eine grössere Durchlässigkeit im Bildungssystem gewährleisten würde. [9] Ausserdem werden in der Weiterbildung eine Differenzierung des Bildungsangebotes und eine Pluralisierung von Anbietern beobachtet. Universitäten in Modularisierungskonzepte einzubeziehen, ein „unified system“ (Bologna: einen einheitlichen Europäischen Hochschulraum) zu entwickeln, um Transparenz zu erhöhen und Vergleichbarkeit von erbrachten Leistungen (für andere Betriebe, für andere Universitäten, Bologna) zu ermöglichen. Ausbildungsinhalte, die als Modul gefasst sind, werden durch Testergebnisse in einem Qualifizierungspass oder in einem Leistungsausweis dokumentiert (Qualifikationsbuch für das kaufm. Berufsfeld).
Module werden durch Teilprüfungen abgeschlossen, insbesondere in der IT-Branche, normalerweise schliessen die meisten beruflichen Grundausbildungen jedoch mit einer Gesamtprüfung am Ende der Ausbildung ab. Da das Berufsbildungsgesetz (BBG Art. 33): „Die beruflichen Qualifikationen werden nachgewiesen durch eine Gesamtprüfung, eine Verbindung von Teilprüfungen oder durch andere vom Bundesamt anerkannte Qualifikationsverfahren.“ breit interpretierbar ist, sind verschiedene Formen von Qualifikationsnachweisen zulässig, diejenige einer Gesamtprüfung oder Teilprüfungen, um den Anforderungen der Wirtschaft sinnvoll beizutragen.
Die Modularisierungsdebatte der Berufsbildung basiert bereits auf getätigten Teilreformen im Bildungswesen, welche aufgrund von gesellschaftlichen Entwicklungen (durch reflexive Modernisierung, durch Individualisierung, durch Globalisierung) eine flexiblere Bildungsstruktur erwartet. Also mehr Mobilität bzw. Flexibilität durch Modularisierung.
Module, welche X-Lektionen umfassen, beruhen auf Kompetenzen, die wiederum „aus mehreren Fähigkeiten, fachlicher, methodischer und sozialer Art“ [10] bestünden.
Infolge der Modernisierungsdynamik können Eidgenössische Berufsatteste (EBA) in den folgenden Berufssparten: Verkauf, Gastronomie, Metallbau, Informatik usw. durch verkürzte Ausbildungen z.B. Reifenpraktiker/in, Infopraktiker/in für Jugendliche mit schulisch reduzierter Leistungsfähigkeit absolviert werden. Der Schwerpunkt der Ausbildung für Lernende mit Lernschwächen sollte deshalb auf die methodischen und sozialen Ressourcen gelegt werden. Diese Berufsatteste (4 Tage im Ausbildungs-betrieb, 1 Tag im Berufsfachschulunterricht) als Teilqualifikation (units) mit Möglichkeit in den Beruf des Automonteurs (siehe Reifenpraktiker/in) zu wechseln, um die Lehre anschliessend mit dem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) abzuschliessen. Das gleiche gilt für die Attestausbildung des Infopraktikers, der nach dem ersten Lehrjahr in die reguläre Grundbildung Informatiker (EFZ) mit Schwerpunkt Support wechseln kann. Ebenso kann der Mechapraktiker seine zertifizierbare Teillehre nach dem Absolvieren von Prüfungen in Berufskunde und Allgemeinbildung zu einem anerkannten eidgenössischen Fähigkeitsausweis ausweiten.
Modularisierung soll auf veränderte Anforderungen der Moderne und der Wirtschaft (Nachfrage-Angebot) reagieren können, die Effizienz steigern und den Bedürfnissen und Umständen der Individuen gerecht werden, indem auch neuartige Lernkombinationen ermöglicht werden. [11]
Literatur
Wermke, Matthias/Kunkel-Razum, Kathrin/Scholze-Stubenrecht, Werner (2010) (Hrsg.): Duden. Das Fremdwörterbuch. (10., akt. Aufl.) Bd.5, Mannheim/Zürich, S.681.
Dudenredaktion (2011) (Hrsg.): Duden. Deutsches Universalwörterbuch. (7., überarb. und erw. Aufl.) Mannheim/Zürich, S. 1205.
Dubs, Rolf (2003): Modularisierung als Lehrplanprinzip. In: Berufsbildung Schweiz, 2, 2003, S. 5-7.
Gonon, Philipp (2002): Modularisierung als reflexive Modernisierung. In: Gonon, Philipp (Hrsg.): Arbeit, Beruf und Bildung. Bern, S. 375-386.
Gonon, Philipp (2012): Stand der Modularisierung der Berufsbildung in der Schweiz. In: Berufsbildung. Zeitschrift für Praxis und Theorie in Betrieb und Schule, 133, 2012, S. 45-47.
Münk, Dieter (2006): Module in der Berufsausbildung. In: Kaiser, Franz-Josef/Pätzold, Günter (Hrsg.): Wörterbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik. (2., überarb. und erw. Aufl.) Bad Heilbrunn, S.373-375.
[1] Duden (2010), Bd. 5, S. 681.
[2] Ebd.
[3] Duden (2011), S. 1205.
[4] Vgl. Münk, S. 373.
[5] Vgl. Gonon (2012), S. 45.
[6] Gonon (2002), S. 375f.
[7] Vgl. Gonon (2002), S. 379f.
[8] Gonon (2012), S. 46.
[9] Ebd.
[10] Ebd.
[11] Vgl. Gonon (2002), S. 380f.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus des Essays "Essay zum Begriff „Modularisierung“"?
Der Essay beschäftigt sich mit dem Begriff der Modularisierung, insbesondere im Kontext der Qualifikationsvermittlung für Benachteiligte. Er untersucht, wie Modularisierung in verschiedenen Bildungsbereichen eingesetzt wird, von Universitätsstudiengängen bis zur beruflichen Aus- und Weiterbildung. Der Essay beleuchtet auch die Vor- und Nachteile der Modularisierung, einschließlich ihrer potenziellen Auswirkungen auf die Beruflichkeit und die Anerkennung von Qualifikationen.
Wie wird der Begriff "Modul" im Essay definiert?
Ein Modul wird als eine Einheit innerhalb eines Gesamtsystems definiert, die sich aus mehreren Elementen zusammensetzt und jederzeit ausgetauscht werden kann. Im Hochschulkontext kann ein Modul eine Lehreinheit darstellen. Modularisierung wird als die Gliederung eines Programms oder einer Lerneinheit in einzelne Module verstanden.
Welche Kritik an der Modularisierung wird im Essay geäußert?
Kritiker sehen in der Modularisierung in der Berufsausbildung eine Teilqualifikation, die sich gegen die Beruflichkeit von Ausbildung, Beruf und Arbeit richtet. Sie argumentieren, dass die Modularisierung den Kern des dualen Systems untergräbt, indem sie Teilzertifizierungen anstrebt und nach einem Baukastenprinzip vorgeht, bei dem Module beliebig kombiniert werden können.
Für welche Zielgruppen wird die Modularisierung als vorteilhaft angesehen?
Modularisierung wird als vorteilhaft für benachteiligte Gruppen angesehen, wie z.B. schulmüde und fremdsprachige Jugendliche, Menschen mit Behinderungen, Lernende mit Lernschwächen, Arbeitslose und Frauen. Gebrochene Karrieren werden als gewichtige Gründe für eine Modularisierung hervorgehoben, da sie eine flexiblere Gestaltung der Bildungswege ermöglicht und Teilabschlüsse sowie die Zertifizierung bereits abgeschlossener Module ermöglicht.
Welche Rolle spielt die Modularisierung in der beruflichen Grundbildung?
In der beruflichen Grundbildung wird Modularisierung eingesetzt, um Teilqualifikationen anzuerkennen und eine flexiblere Gestaltung der Ausbildung zu ermöglichen. Dies kann dazu beitragen, dass Lernende mit Lernschwierigkeiten leichter einen Berufsabschluss erlangen. Es wird betont, dass zunächst eine auf Ganzheitlichkeit beruhende Basis gelegt werden sollte, ehe dann im Sinne einer Differenzierung und Erweiterung Module in das Berufskonzept eingebaut werden.
Welche Vorteile bietet die Modularisierung in der Weiterbildung?
Die Modularisierung in der Weiterbildung bietet Vorteile wie die Lösung von Effizienzproblemen, die Gewährleistung einer größeren Durchlässigkeit im Bildungssystem, die Differenzierung des Bildungsangebotes und die Pluralisierung von Anbietern. Sie ermöglicht die Entwicklung eines einheitlichen Europäischen Hochschulraums (Bologna) und erhöht die Transparenz und Vergleichbarkeit von Leistungen.
Wie wird die Modularisierung durch das Berufsbildungsgesetz (BBG) geregelt?
Das Berufsbildungsgesetz (BBG) lässt verschiedene Formen von Qualifikationsnachweisen zu, einschließlich Gesamtprüfungen und Teilprüfungen. Dies ermöglicht es, den Anforderungen der Wirtschaft sinnvoll beizutragen und die Modularisierung in der Berufsbildung zu fördern.
In welchen Berufsfeldern werden Eidgenössische Berufsatteste (EBA) angeboten?
Eidgenössische Berufsatteste (EBA) werden in verschiedenen Berufssparten angeboten, wie z.B. Verkauf, Gastronomie, Metallbau und Informatik. Diese verkürzten Ausbildungen sind für Jugendliche mit schulisch reduzierter Leistungsfähigkeit konzipiert und bieten eine Teilqualifikation mit der Möglichkeit, später in eine reguläre Grundbildung zu wechseln.
Warum wird Modularisierung als Reaktion auf moderne Anforderungen gesehen?
Modularisierung wird als Reaktion auf veränderte Anforderungen der Moderne und der Wirtschaft gesehen, da sie die Effizienz steigern und den Bedürfnissen und Umständen der Individuen gerecht werden soll. Sie ermöglicht neuartige Lernkombinationen und eine flexiblere Anpassung an die sich wandelnden Arbeitsmarktanforderungen.
- Quote paper
- Marie Lehky (Author), 2012, Modularisierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1484362