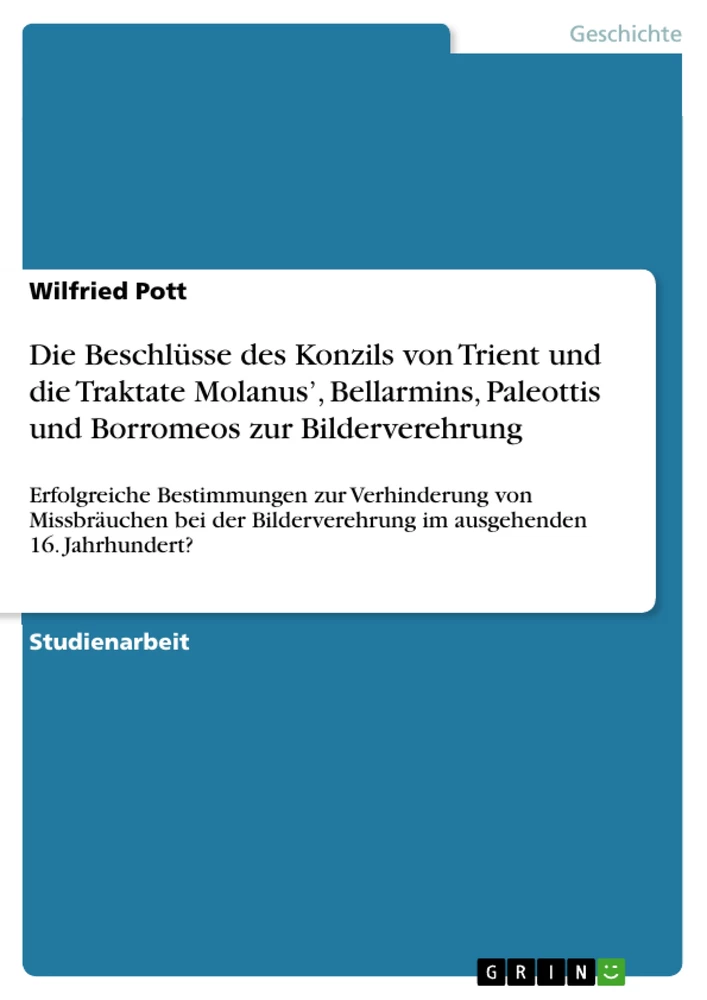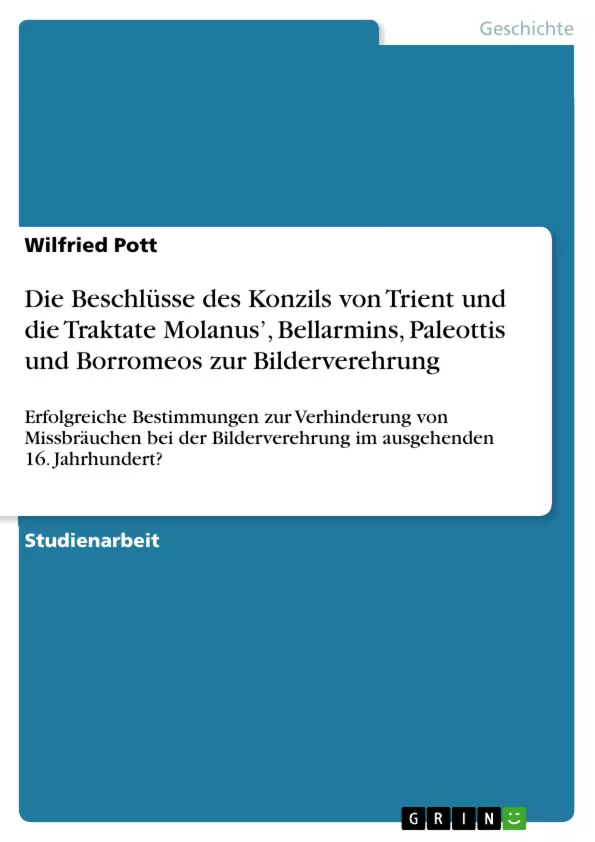Meine Hausarbeit widmet sich thematisch den Missbräuchen bei der Bilderherstellung und Bilderverehrung, sowie den Maßnahmen, die zur Verhinderung derartiger Missbräuche ergriffen wurden. Was galt aber im ausgehenden 16. Jahrhundert als Missbrauch? Handelte es sich dabei nur um vereinzelte Missstände oder ein Problem, das die gesamte katholische Kirche betraf? Die Reformatoren sahen es wohl so. Aber dies soll nicht Thema dieser Hausarbeit sein. Vielmehr befasst sie sich, nach einer kurzen zeitlichen und thematischen Einordnung, auf der Grundlage der Beschlüsse des Trienter Konzils zur Bilderverehrung, mit den Traktaten Molanus’, Bellarmins, Paleottis und Borromeos. Diese vier Verfasser definierten die Funktion eines Bildes, die Aufgaben des Malers und bildeten somit mit ihren Werken die theoretische Grundlage, um Missbräuche bei der Herstellung und Verehrung von Bildern im ausgehenden 16. Jahrhundert zu unterbinden. Die Hausarbeit unterscheidet dabei zwei Bereiche, einerseits die Missbräuche der Maler und andererseits die (abergläubischen) Missbräuche der Gläubigen. Dem Klerus kam bei der Missbrauchsbekämpfung eine gewichtige Aufgabe zu. So hatte das Konzil von Trient den Bischöfen auferlegt, in ihren Diözesen für eine korrekte Verwendung der Bilder zu sorgen. Konkrete Maßnahmen gegen fehlgeleitete Maler, Gläubige und Maßnahmen allgemeiner Art sollen des Weiteren unter diesem Punkt thematisiert werden. Die Reformatoren haben ihrerseits die Finger in die offene Wunde der katholischen Kirche gelegt. Wenn nun die katholische Kirche von selbst eine aus ihrer Sicht missbräuchliche Praxis aufgreift und mit höchster Lehrautorität zu beheben sucht, ist dies bemerkenswert, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Bilderverehrung an sich nie in Frage gestellt wurde. Es ist deshalb zweifelsfrei so, dass es sich bei der Missbrauchsbekämpfung um eine Detailfrage handelte, da das Hauptinteresse der Bildertheologen dem Nachweis galt, dass die Bilderverehrung kein abusus war.
Nachdem die theoretischen Bestimmungen, die die Missbräuche definierten, und die Missbräuche und die Verantwortlichen dargestellt, sowie die Maßnahmen zur Behebung derselben geschildert wurden, lässt sich der Erfolg bewerten. Denn nur wenn es gelang, die Missbräuche zu bekämpfen, waren die Bestimmungen des Konzils von Trient und deren Ausführungen in den Traktaten erfolgreich und dem Ziel dienlich, die Bilderverehrung zu fördern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zeitliche und thematische Einordnung
- 3. Die Beschlüsse des Konzils von Trient zur Bilderverehrung
- 4. Die Verhinderung von Missbräuchen bei der Bilderherstellung und -verehrung
- 4.1 Theoretische Bestimmungen
- a) Grundsätzliches
- b) Theoretische Ansätze bei Johannes Molanus, Robert Bellarmin, Gabriele Paleotti und Karl Borromeo
- c) Unterschiede der Ansätze und Zielsetzungen
- 4.2 Missbräuche
- a) Grundsätzliches
- b) Missbräuche durch Maler
- c) Missbräuche durch Gläubige und allgemeiner Art
- 4.3 Missbrauchsbekämpfung
- a) Die Stellung und die Aufgaben des Klerus bei der Missbrauchsbekämpfung
- b) Maßnahmen gegen Maler / Anforderungen an die Maler
- c) Maßnahmen gegen Gläubige und allgemeiner Art
- 4.4 Erfolg der Maßnahmen
- 4.1 Theoretische Bestimmungen
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Missbräuche bei der Herstellung und Verehrung von Bildern im ausgehenden 16. Jahrhundert und die Maßnahmen zu deren Verhinderung. Sie analysiert die Beschlüsse des Konzils von Trient und die dazugehörigen Traktate von Molanus, Bellarmin, Paleotti und Borromeo, um die theoretischen Grundlagen und praktischen Maßnahmen der Missbrauchsbekämpfung zu beleuchten.
- Definition von Missbrauch in der Bilderverehrung im 16. Jahrhundert
- Analyse der theoretischen Ansätze zur Bilderverehrung bei führenden Theologen
- Unterscheidung verschiedener Missbrauchstypen (durch Maler und Gläubige)
- Rolle des Klerus bei der Missbrauchsbekämpfung
- Bewertung des Erfolgs der Maßnahmen zur Missbrauchsbekämpfung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Fokus der Arbeit auf Missbräuche bei der Bilderherstellung und -verehrung im ausgehenden 16. Jahrhundert und die Maßnahmen zu deren Verhinderung. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die zentralen Autoren, deren Traktate untersucht werden. Die Einleitung hebt hervor, dass die Bilderverehrung an sich nicht in Frage gestellt wurde, sondern lediglich deren Missbrauch bekämpft werden sollte. Der begrenzte Umfang der Arbeit führt zur Ausklammerung der reformatorischen Positionen.
2. Zeitliche und thematische Einordnung: Dieses Kapitel bietet einen historischen Kontext, beginnend mit dem Jahr 1520 und dem Durchbruch der Reformation. Es beschreibt die instabile politische Lage im Heiligen Römischen Reich und den Verlauf der religiösen Konflikte, bis hin zum Konzil von Trient. Die unterschiedlichen Positionen von Luther und anderen Reformatoren zur Bilderverehrung werden kurz angerissen, wobei der Schwerpunkt auf dem Kontext des Konzils und der Notwendigkeit der Intervention der katholischen Kirche liegt.
3. Die Beschlüsse des Konzils von Trient zur Bilderverehrung: Dieses Kapitel befasst sich detailliert mit den konkreten Beschlüssen des Konzils von Trient zur Bilderverehrung. Es analysiert die Entscheidungen des Konzils in Bezug auf die Zulässigkeit von Bildern, die korrekte Darstellung heiliger Personen und die Vermeidung von Missverständnissen und Missbräuchen im religiösen Kontext. Die Bedeutung dieser Beschlüsse für die spätere Entwicklung der katholischen Bildertheologie wird herausgestellt.
4. Die Verhinderung von Missbräuchen bei der Bilderherstellung und -verehrung: Dieser umfangreiche Abschnitt analysiert die theoretischen und praktischen Ansätze zur Missbrauchsbekämpfung. Er untersucht die Traktate von Molanus, Bellarmin, Paleotti und Borromeo, um deren Verständnis von der Funktion des Bildes, den Aufgaben des Malers und die Definition von Missbräuchen zu erörtern. Die verschiedenen Ansätze und Zielsetzungen der Autoren werden verglichen und die unterschiedlichen Arten von Missbräuchen (durch Maler und Gläubige) werden detailliert beschrieben. Schließlich werden die konkreten Maßnahmen der Kirche gegen diese Missbräuche und die Rolle des Klerus bei deren Umsetzung dargestellt.
Schlüsselwörter
Konzil von Trient, Bilderverehrung, Missbrauch, Johannes Molanus, Robert Bellarmin, Gabriele Paleotti, Karl Borromeo, Gegenreformation, katholische Theologie, Bildertheologie, Missbrauchsbekämpfung, Klerus, Reformatoren.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Missbräuche bei der Bilderherstellung und -verehrung im ausgehenden 16. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Missbräuche bei der Herstellung und Verehrung von Bildern im ausgehenden 16. Jahrhundert und die Maßnahmen zu deren Verhinderung. Der Fokus liegt auf der Analyse der Beschlüsse des Konzils von Trient und der dazugehörigen Traktate von Molanus, Bellarmin, Paleotti und Borromeo, um die theoretischen Grundlagen und praktischen Maßnahmen der Missbrauchsbekämpfung zu beleuchten. Die Bilderverehrung an sich wird nicht in Frage gestellt, sondern lediglich deren Missbrauch.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition von Missbrauch in der Bilderverehrung im 16. Jahrhundert; Analyse der theoretischen Ansätze zur Bilderverehrung bei führenden Theologen; Unterscheidung verschiedener Missbrauchstypen (durch Maler und Gläubige); Rolle des Klerus bei der Missbrauchsbekämpfung; Bewertung des Erfolgs der Maßnahmen zur Missbrauchsbekämpfung; die Beschlüsse des Konzils von Trient zur Bilderverehrung; der historische Kontext des ausgehenden 16. Jahrhunderts (Reformation, Gegenreformation, politisches Umfeld).
Welche Autoren werden in der Hausarbeit analysiert?
Die Hausarbeit analysiert die Traktate von Johannes Molanus, Robert Bellarmin, Gabriele Paleotti und Karl Borromeo, um deren Verständnis von der Funktion des Bildes, den Aufgaben des Malers und die Definition von Missbräuchen zu erörtern und deren unterschiedliche Ansätze und Zielsetzungen zu vergleichen.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Zeitliche und thematische Einordnung, Die Beschlüsse des Konzils von Trient zur Bilderverehrung, Die Verhinderung von Missbräuchen bei der Bilderherstellung und -verehrung (unterteilt in Theoretische Bestimmungen, Missbräuche, Missbrauchsbekämpfung und Erfolg der Maßnahmen), und Fazit. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Zusammenfassung.
Welche Arten von Missbräuchen werden untersucht?
Die Arbeit unterscheidet verschiedene Arten von Missbräuchen, sowohl solche, die von Malern begangen wurden (z.B. ungenügende künstlerische Ausführung, unzulässige Darstellungen), als auch solche, die von Gläubigen ausgingen (z.B. falsche Verehrung, Aberglaube im Zusammenhang mit Bildern).
Welche Rolle spielte der Klerus bei der Missbrauchsbekämpfung?
Die Hausarbeit beleuchtet die Stellung und die Aufgaben des Klerus bei der Missbrauchsbekämpfung, seine Maßnahmen gegen Maler und Gläubige und die Umsetzung der Maßnahmen zur Verhinderung von Missbrauch.
Wie wird der Erfolg der Maßnahmen zur Missbrauchsbekämpfung bewertet?
Die Hausarbeit bewertet den Erfolg der Maßnahmen zur Missbrauchsbekämpfung, wobei der Umfang der Arbeit eine umfassende Beurteilung begrenzt.
Welchen historischen Kontext bietet die Arbeit?
Die Arbeit bietet einen historischen Kontext, der den Durchbruch der Reformation (ab 1520), die instabile politische Lage im Heiligen Römischen Reich und den Verlauf der religiösen Konflikte bis hin zum Konzil von Trient umfasst. Die unterschiedlichen Positionen von Luther und anderen Reformatoren zur Bilderverehrung werden kurz angerissen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Konzil von Trient, Bilderverehrung, Missbrauch, Johannes Molanus, Robert Bellarmin, Gabriele Paleotti, Karl Borromeo, Gegenreformation, katholische Theologie, Bildertheologie, Missbrauchsbekämpfung, Klerus, Reformatoren.
- Citation du texte
- Wilfried Pott (Auteur), 2010, Die Beschlüsse des Konzils von Trient und die Traktate Molanus’, Bellarmins, Paleottis und Borromeos zur Bilderverehrung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148304