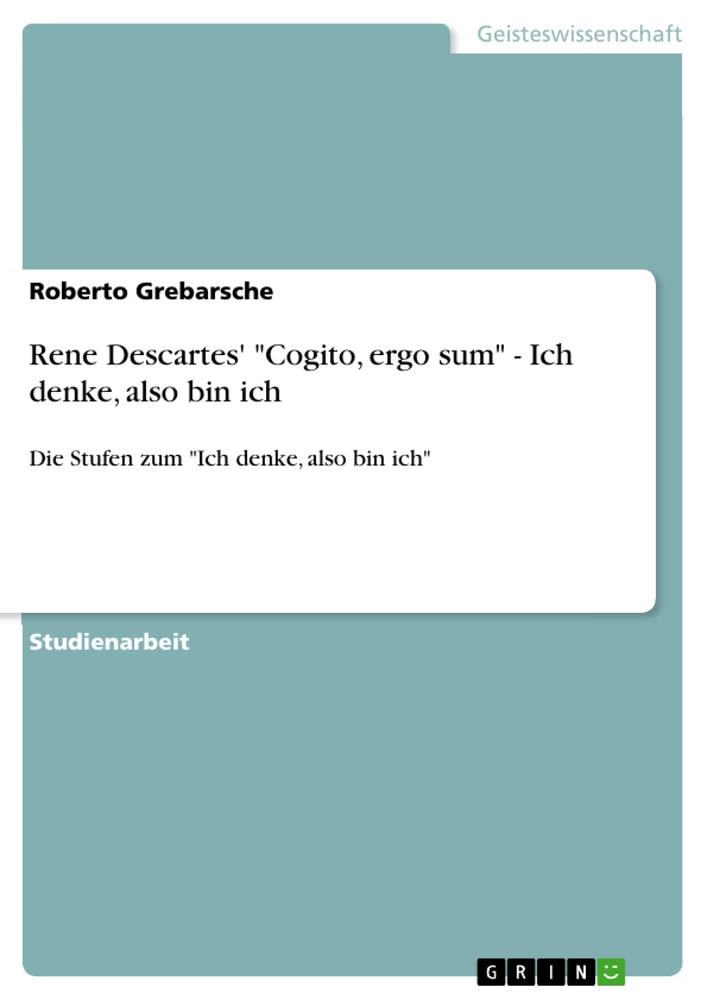Kaum ein anderer Satz hat die Philosophie so nachhaltig geprägt wie Descartes
„ Ich denke, also bin ich“.
Kaum ein anderer Satz der Philosophie ist gleichsam auch in der Umgangssprache so bekannt wie dieser.
Was jedoch steckt hinter diesem Axiom und noch interessanter ist die Frage, was Descartes dazu bewegt hat, eine so kurze Antwort zu finden auf seine Fragen, die ihn so lange in den Meditationen beschäftigt hat.
Mit den zwei eher kurzen Schriften „Kleine Abhandlung über die Methode des richtigen Vernunftsgebrauchs“ und „6 Meditationen über die erste Philosophie“ wurde er bekannt und berühmt. Die „erste Philosophie“ benutzte Descartes dabei als anderen Begriff für die Metaphysik, also die Grundlagen der Erkenntnis.
In seiner ersten Meditation zweifelte Descartes alles an.
Ihn verfolgte ständig der Gedanke, was er schon alles in seinem Leben aufgenommen hat, was sich später als falsch herausstellte, obwohl er zum Zeitpunkt, da er dachte, es sei wohl war, davon absolut überzeugt gewesen ist.
Aus diesem Grund stellte er sich die Frage, ob man überhaupt etwas wirklich ohne auch nur den geringsten Zweifel wissen kann.
Gibt es ein absolutes sicheres Wissen für den Menschen?
Um das herauszufinden wendete er das methodische Zweifeln an, denn er wollte endlich unumwerfliche Antworten finden an dem keine Zweifel mehr bestehen.
Dies wird deutlich als er sagte:
„ … ich war der Meinung, ich müsse einmal im Leben alles von Grund auf umstürzen und von den ersten Grundlagen an ganz neu anfangen, wenn ich endlich einmal etwas Festes und Bleibendes in den Wissenschaften errichten wollte.“
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2.1 Skepsis an der Erkenntnis der Sinne
- 2.2 Skepsis an der Realität
- 2.3 Die Frage der Täuschung
- 2.4 Die Erkenntnis - „Ich denke, also bin ich“
- 2.5 Die 4 Grundregeln Descartes
- 2.6 Résumé
- 3. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Descartes' Skeptizismus und seine Überwindung durch das Cogito-Argument. Die Arbeit analysiert Descartes' methodischen Zweifel und seine Suche nach unbezweifelbarer Erkenntnis. Sie beleuchtet seine Argumentationslinie und die Bedeutung des Cogito für die Philosophie.
- Descartes' methodischer Zweifel
- Skepsis gegenüber den Sinnen
- Das Traumargument
- Das Cogito-Argument ("Ich denke, also bin ich")
- Die Bedeutung des Cogito für die Erkenntnistheorie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt Descartes' berühmten Satz "Ich denke, also bin ich" in den Kontext seiner philosophischen Arbeiten, insbesondere der "Meditationen über die erste Philosophie" und der "Kleinen Abhandlung über die Methode des richtigen Vernunftsgebrauchs". Sie skizziert Descartes' Motivation, durch methodischen Zweifel zu unbezweifelbarer Erkenntnis zu gelangen und die Frage nach der Möglichkeit absoluten Wissens zu thematisieren. Die Einleitung legt den Grundstein für die folgende detaillierte Analyse von Descartes' skeptischen Argumenten und seiner Lösung des Problems.
2.1 Skepsis an der Erkenntnis der Sinne: Dieses Kapitel untersucht Descartes' Zweifel an der Zuverlässigkeit der Sinneswahrnehmung. Es werden Beispiele für Sinnestauschungen angeführt, wie optische Täuschungen, um zu verdeutlichen, wie unsere Sinne uns täuschen können. Descartes argumentiert, dass die Sinne nicht als zuverlässige Grundlage für Wissen dienen können, da sie uns irreführen können. Er betont die Grenzen unserer Sinneswahrnehmung und die Möglichkeit der Täuschung selbst im Alltag. Die Beschränkungen unserer Sinnesorgane werden als Ausgangspunkt für die Notwendigkeit eines tiefergehenden Zweifels etabliert.
2.2 Skepsis an der Realität: Dieses Kapitel befasst sich mit Descartes' Traumargument. Er argumentiert, dass wir nicht mit Sicherheit wissen können, ob wir wach oder träumen. Die lebhaften und intensiven Erfahrungen im Traum werfen Zweifel an der Realität unserer Wahrnehmung auf. Die Ähnlichkeit von Traum und Wachzustand wird betont, um die Unmöglichkeit einer eindeutigen Unterscheidung allein durch Sinneserfahrung zu illustrieren. Das Kapitel legt den Grundstein für die Notwendigkeit einer weitergehenden, nicht-sinnlichen Erkenntnisquelle.
2.3 Die Frage der Täuschung: Dieses Kapitel vertieft die Thematik der Täuschung und erweitert die Zweifel über die Sinneswahrnehmung und das Traumargument auf die Möglichkeit einer umfassenden Täuschung durch einen allmächtigen Dämon. Die Möglichkeit einer systematischen Täuschung wird diskutiert, welche alle unsere Überzeugungen in Frage stellt. Dieser umfassende Zweifel bildet den Höhepunkt der skeptischen Phase in Descartes' Argumentation und führt zur Notwendigkeit eines sicheren Fundaments für Erkenntnis.
2.4 Die Erkenntnis - „Ich denke, also bin ich“: Dieses Kapitel präsentiert Descartes' berühmtes Cogito-Argument ("Ich denke, also bin ich") als Lösung des Problems des radikalen Skeptizismus. Durch die Unmöglichkeit, am eigenen Denkakt selbst zu zweifeln, findet Descartes einen unbezweifelbaren Ausgangspunkt für Wissen. Das "Ich" als denkende Substanz wird als sicheres Fundament für weitere Erkenntnis postuliert. Die Bedeutung des Cogito als Ausgangspunkt für Metaphysik und Erkenntnistheorie wird hervorgehoben.
2.5 Die 4 Grundregeln Descartes: Dieses Kapitel beschreibt Descartes' vier Regeln zur richtigen Anwendung der Vernunft. Die Regeln dienen dazu, systematisch und methodisch nach Wahrheit zu suchen und Irrtümer zu vermeiden. Sie bilden eine methodische Grundlage für das weitere Erkenntnisgewinnungsprozess, basierend auf der Sicherheit des Cogito. Die Regeln geben einen Einblick in Descartes' philosophische Methode und betonen die Bedeutung von Klarheit und Ordnung im Erkenntnisprozess.
2.6 Résumé: Das Résumé fasst die Ergebnisse der vorherigen Kapitel zusammen und unterstreicht die Bedeutung von Descartes' skeptischer Methode und seiner Lösung des Skeptizismus durch das Cogito-Argument. Es zeigt den Weg von radikalem Zweifel hin zu einem sicheren Fundament für Wissen und bietet einen Ausblick auf weitere philosophische Fragestellungen, die sich aus Descartes' Erkenntnissen ergeben.
Schlüsselwörter
Descartes, Skeptizismus, Cogito, methodischer Zweifel, Sinneswahrnehmung, Traumargument, Erkenntnistheorie, Metaphysik, unbezweifelbare Erkenntnis, Vernunft.
Häufig gestellte Fragen zu: Descartes' Skeptizismus und das Cogito-Argument
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit analysiert René Descartes' methodischen Zweifel und seine Überwindung des Skeptizismus durch das berühmte Cogito-Argument ("Ich denke, also bin ich"). Sie untersucht Descartes' Zweifel an der Sinneswahrnehmung, das Traumargument und die Möglichkeit einer umfassenden Täuschung. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung des Cogito als unbezweifelbarer Ausgangspunkt für Erkenntnis und beschreibt Descartes' vier Regeln zur richtigen Anwendung der Vernunft.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Hausarbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Descartes' methodischer Zweifel, Skepsis gegenüber den Sinnen, das Traumargument, das Cogito-Argument, die Bedeutung des Cogito für die Erkenntnistheorie, Descartes' vier Regeln der Vernunft und eine Zusammenfassung der Argumentationslinie.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, mehrere Kapitel, die Descartes' skeptische Argumente und die Lösung durch das Cogito-Argument detailliert untersuchen, sowie ein Literaturverzeichnis und ein Kapitel mit Schlüsselbegriffen. Die Kapitel befassen sich nacheinander mit der Skepsis an der Sinneserkenntnis, der Skepsis an der Realität (Traumargumet), der Frage der umfassenden Täuschung, dem Cogito-Argument, Descartes' vier Regeln der Methode und einem zusammenfassenden Résumé.
Was ist das Cogito-Argument und seine Bedeutung?
Das Cogito-Argument ("Ich denke, also bin ich") ist Descartes' Antwort auf seinen radikalen Skeptizismus. Durch die Einsicht, dass der Akt des Zweifelns selbst beweist, dass etwas denkt (nämlich er selbst), findet er einen unbezweifelbaren Ausgangspunkt für Wissen. Das "Ich" als denkende Substanz wird als sicheres Fundament für weitere Erkenntnis postuliert. Das Cogito ist von fundamentaler Bedeutung für die Erkenntnistheorie und die Metaphysik.
Welche Rolle spielt der methodische Zweifel in Descartes' Philosophie?
Der methodische Zweifel ist die Grundlage von Descartes' philosophischer Methode. Er besteht darin, systematisch und gründlich an allen Überzeugungen zu zweifeln, um ein sicheres Fundament für Wissen zu finden. Durch die Überwindung dieses Zweifels gelangt Descartes zum Cogito-Argument und damit zu einem unbezweifelbaren Ausgangspunkt für die Erkenntnis.
Was sind Descartes' vier Regeln der Vernunft?
Descartes formuliert vier Regeln zur richtigen Anwendung der Vernunft, um systematisch und methodisch nach Wahrheit zu suchen und Irrtümer zu vermeiden. Diese Regeln bilden die methodische Grundlage für den Erkenntnisgewinnungsprozess nach der Etablierung des Cogito. Sie betonen die Bedeutung von Klarheit und Ordnung im Erkenntnisprozess.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Hausarbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Descartes, Skeptizismus, Cogito, methodischer Zweifel, Sinneswahrnehmung, Traumargument, Erkenntnistheorie, Metaphysik, unbezweifelbare Erkenntnis, Vernunft.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke gedacht, insbesondere für Studierende der Philosophie, die sich mit Descartes' Erkenntnistheorie und seinem Skeptizismus auseinandersetzen möchten.
- Quote paper
- Roberto Grebarsche (Author), 2009, Rene Descartes' "Cogito, ergo sum" - Ich denke, also bin ich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148240