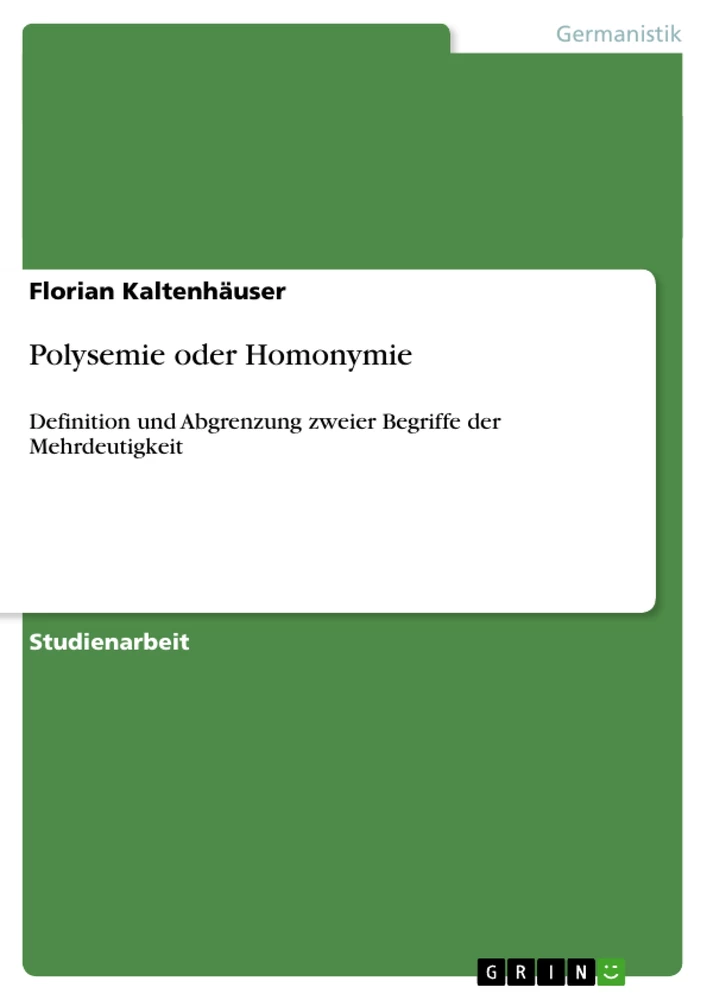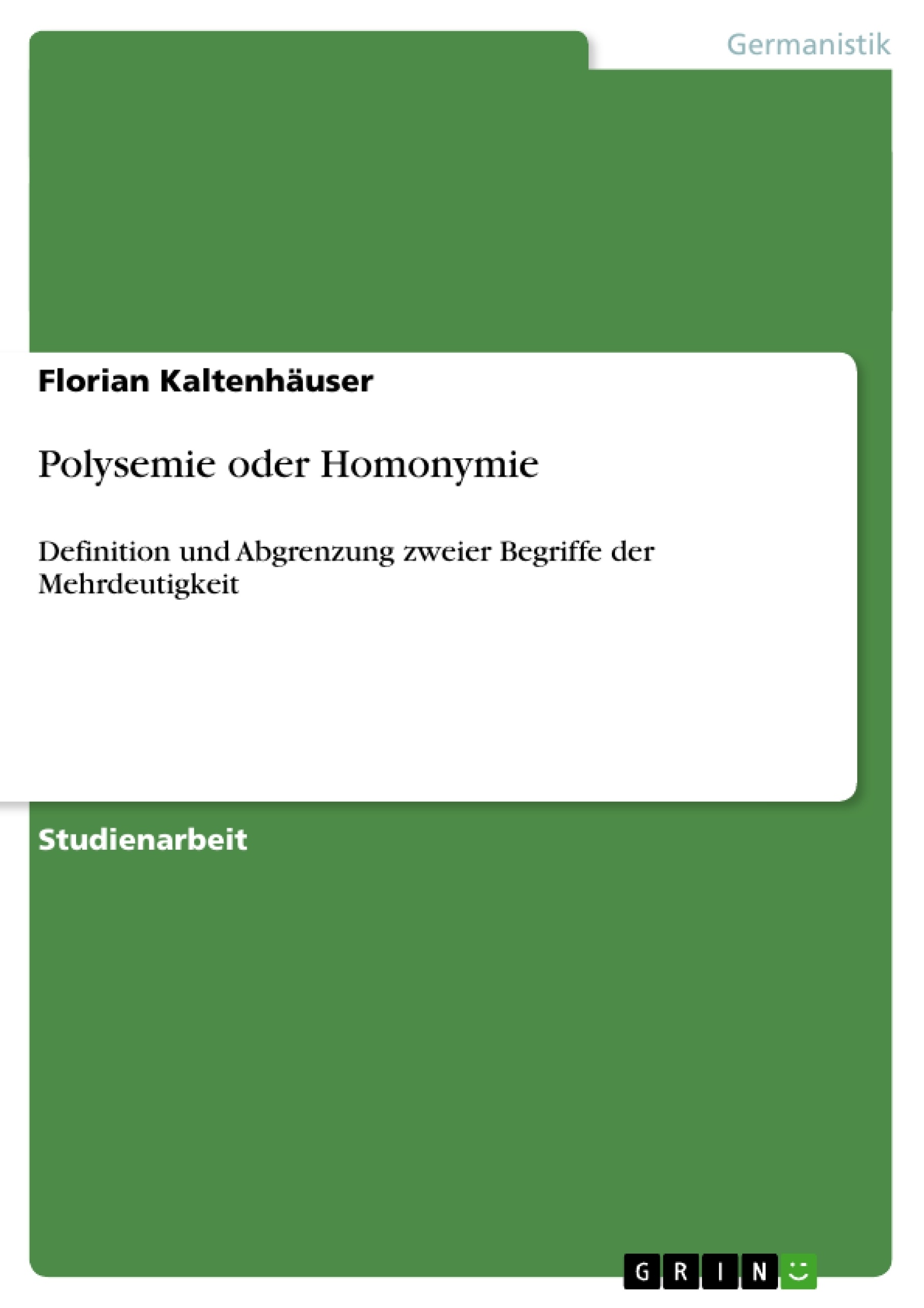Das Wort Polysemie ist gebildet aus dem griechischen Wort poly für viel und sema für Zeichen. Der Gegenbegriff ist die Monosemie. Da Polysemie im Allgemeinen Mehrdeutigkeit eines sprachlichen Zeichens bedeuten kann, ist oft auch von Ambiguität die Rede.
Das Problem, mit dem sich diese Arbeit beschäftigt, ist, dass auch Homonymie Mehrdeutigkeit bezeichnet und die Begriffe nicht immer eindeutig auseinander zuhalten sind. Darum müssen Charakteristika gefunden werden, die eine Unterscheidung zur Polysemie zulassen. Da diese Frage viele Linguisten beschäftigte, wird auch ein Blick auf die historische Entwicklung der Beg-riffe im Rahmen der Linguistik geworfen. Außerdem werden auch die jeweils gegenteiligen Phänomene Monosemierung bzw. Disambiguierung und Synonymie untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Polysemie
- 2.1. Kontextabhängigkeit
- 2.2. Monosemierung
- 2.3. Historischer Exkurs
- 3. Synonymie
- 3.1. Formen der Synonymie
- 3.2. Nichtsynonymien
- 4. Homonymie
- 4.1. Homophonie und Homographie auf Wortformebene
- 4.2. Voraussetzungen für partielle Homonymie
- 5. Polysemie oder Homonymie?
- 5.1. Mögliche Unterscheidungen
- 5.2. Subkategorisierung zur besseren Abgrenzung
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Abgrenzung der Begriffe Polysemie und Homonymie, beide kennzeichnen Mehrdeutigkeit sprachlicher Zeichen. Die Zielsetzung ist die Identifizierung von Charakteristika, die eine eindeutige Unterscheidung ermöglichen. Die historische Entwicklung der Begriffe in der Linguistik wird ebenfalls betrachtet, ebenso wie die Gegenphänomene Monosemierung und Synonymie.
- Definition und Abgrenzung von Polysemie und Homonymie
- Analyse der Kontextabhängigkeit polysemer Wörter
- Untersuchung des Phänomens der Monosemierung
- Einordnung der Synonymie im Kontext der Mehrdeutigkeit
- Historische Entwicklung der linguistischen Betrachtung von Polysemie und Homonymie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Polysemie und Homonymie ein, wobei die Schwierigkeiten bei der Unterscheidung beider Begriffe hervorgehoben werden. Das Problem der Mehrdeutigkeit sprachlicher Zeichen wird als Ausgangspunkt der Arbeit definiert und die Notwendigkeit einer klaren Abgrenzung der beiden Begriffe begründet. Die methodische Vorgehensweise, die eine Analyse der Charakteristika beider Phänomene sowie einen historischen Rückblick umfasst, wird skizziert. Die Untersuchung der Gegenphänomene Monosemierung und Synonymie wird als ergänzender Ansatz angekündigt.
2. Polysemie: Dieses Kapitel definiert Polysemie als Mehrdeutigkeit von Wörtern und Sätzen, wobei die verschiedenen Bedeutungen eines Ausdrucks in einem inhaltlichen Zusammenhang stehen und sich oft von einer Grundbedeutung ableiten. Es wird betont, dass polyseme Lexeme verschiedene Inhalte unter einer identischen Form zusammenfassen. Am Beispiel des Adjektivs "alt" und der unterschiedlichen Bedeutungen (gegenteil von neu, gegenteil von jung, zeitlich zurückliegend) wird die Vielschichtigkeit des Phänomens veranschaulicht. Zusätzliche Beispiele mit dem Wort "rock" und "chicken" verdeutlichen die Problematik der Bedeutungszuweisung, selbst in einem Kontext. Es wird herausgestellt, dass Polysemie im Sprachwandel als neuer Zeichenausdruck zu verstehen ist und die Übertragung der üblichen Bedeutung auf neue Referenzbereiche beschreibt. Das Prinzip der Polysemie wird nicht nur auf einzelne Lexeme, sondern auch auf komplexe Ausdrücke und Wortketten ausgedehnt.
2.1. Kontextabhängigkeit: Dieser Abschnitt behandelt die Rolle des Kontextes bei der Auflösung von Mehrdeutigkeit. Es wird argumentiert, dass der Kontext meist eine eindeutige Bedeutungszuweisung ermöglicht. Der Sprecher beabsichtigt in der Regel nur eine bestimmte Bedeutung eines polysemen Wortes, und der Hörer kann diese meist aufgrund des Kontextes erkennen. Die Arbeit beleuchtet jedoch auch Fälle, in denen trotz Kontext Ambiguität besteht, sei es durch absichtliche Mehrdeutigkeit des Sprechers oder Missverständnis des Hörers. Beispiele werden genannt, um die komplexen Zusammenhänge zwischen Kontext, Sprecherintention und Hörerverständnis zu verdeutlichen. Auch die Problematik vager Begriffe wird angesprochen, die selbst im Kontext nicht immer eindeutig zu interpretieren sind.
2.2. Monosemierung: Dieser Abschnitt definiert Monosemierung (Disambiguierung) als den Prozess der Zuordnung eines Ausdrucks zu einem polysemen Lexem durch den Kontext. Es wird erklärt, dass eine erfolgreiche Monosemierung zu eindeutigen Lexemen führt. Der Abschnitt behandelt Fälle, in denen die Disambiguierung fehlschlägt, entweder aufgrund ungenauer Formulierung oder absichtlicher Mehrdeutigkeit (Wortspiel). Die eigentliche Monosemierung wird als eindeutige Auswahl aus mehreren Bedeutungsalternativen beschrieben.
Schlüsselwörter
Polysemie, Homonymie, Mehrdeutigkeit, Kontextabhängigkeit, Monosemierung, Disambiguierung, Synonymie, Linguistik, Sprachwandel, Lexem, Semem.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Polysemie und Homonymie
Was ist der Hauptgegenstand dieses Textes?
Der Text befasst sich mit der Abgrenzung der Begriffe Polysemie und Homonymie, beide kennzeichnen Mehrdeutigkeit sprachlicher Zeichen. Ziel ist die Identifizierung von Merkmalen zur eindeutigen Unterscheidung beider Phänomene. Die historische Entwicklung der Begriffe in der Linguistik, sowie die Gegenphänomene Monosemierung und Synonymie werden ebenfalls betrachtet.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die Definition und Abgrenzung von Polysemie und Homonymie, analysiert die Kontextabhängigkeit polysemer Wörter, untersucht das Phänomen der Monosemierung, ordnet die Synonymie im Kontext der Mehrdeutigkeit ein und beleuchtet die historische Entwicklung der linguistischen Betrachtung von Polysemie und Homonymie.
Was ist Polysemie?
Polysemie wird als Mehrdeutigkeit von Wörtern und Sätzen definiert, wobei die verschiedenen Bedeutungen eines Ausdrucks in einem inhaltlichen Zusammenhang stehen und sich oft von einer Grundbedeutung ableiten. Polyseme Lexeme fassen verschiedene Inhalte unter einer identischen Form zusammen. Der Text illustriert dies anhand von Beispielen wie "alt" oder "rock".
Welche Rolle spielt der Kontext bei der Polysemie?
Der Kontext spielt eine entscheidende Rolle bei der Auflösung von Mehrdeutigkeit polysemer Wörter. Meist ermöglicht der Kontext eine eindeutige Bedeutungszuweisung. Der Text beleuchtet aber auch Fälle von Ambiguität, die trotz Kontext bestehen bleiben, sei es durch absichtliche Mehrdeutigkeit oder Missverständnis.
Was bedeutet Monosemierung?
Monosemierung (oder Disambiguierung) ist der Prozess der Zuordnung eines Ausdrucks zu einem polysemen Lexem durch den Kontext. Eine erfolgreiche Monosemierung führt zu eindeutigen Lexemen. Der Text behandelt auch Fälle, in denen die Disambiguierung fehlschlägt.
Was ist Homonymie?
Der Text erwähnt Homonymie als ein weiteres Phänomen der Mehrdeutigkeit, unterscheidet es aber detailliert von Polysemie. Die genaue Definition und Abgrenzung zur Polysemie wird im Text behandelt (Kapitel 4 und 5).
Wie wird Synonymie im Text eingeordnet?
Synonymie wird als Gegenphänomen zur Mehrdeutigkeit betrachtet und im Kontext der Abgrenzung von Polysemie und Homonymie eingeordnet. Der Text untersucht die verschiedenen Formen der Synonymie und Nichtsynonymien (Kapitel 3).
Welche methodische Vorgehensweise wird im Text verwendet?
Der Text verwendet eine analytische Vorgehensweise, die die Charakteristika von Polysemie und Homonymie untersucht und einen historischen Rückblick umfasst. Die Untersuchung der Gegenphänomene Monosemierung und Synonymie dient als ergänzender Ansatz.
Welche Schlüsselwörter sind für den Text relevant?
Die Schlüsselwörter sind: Polysemie, Homonymie, Mehrdeutigkeit, Kontextabhängigkeit, Monosemierung, Disambiguierung, Synonymie, Linguistik, Sprachwandel, Lexem, Semem.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, der Text enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel (Einleitung, Polysemie, Kontextabhängigkeit, Monosemierung, Synonymie, Homonymie, Polysemie oder Homonymie?, Fazit), die die wichtigsten Punkte jedes Kapitels hervorhebt.
- Quote paper
- M.A. Florian Kaltenhäuser (Author), 2008, Polysemie oder Homonymie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148205