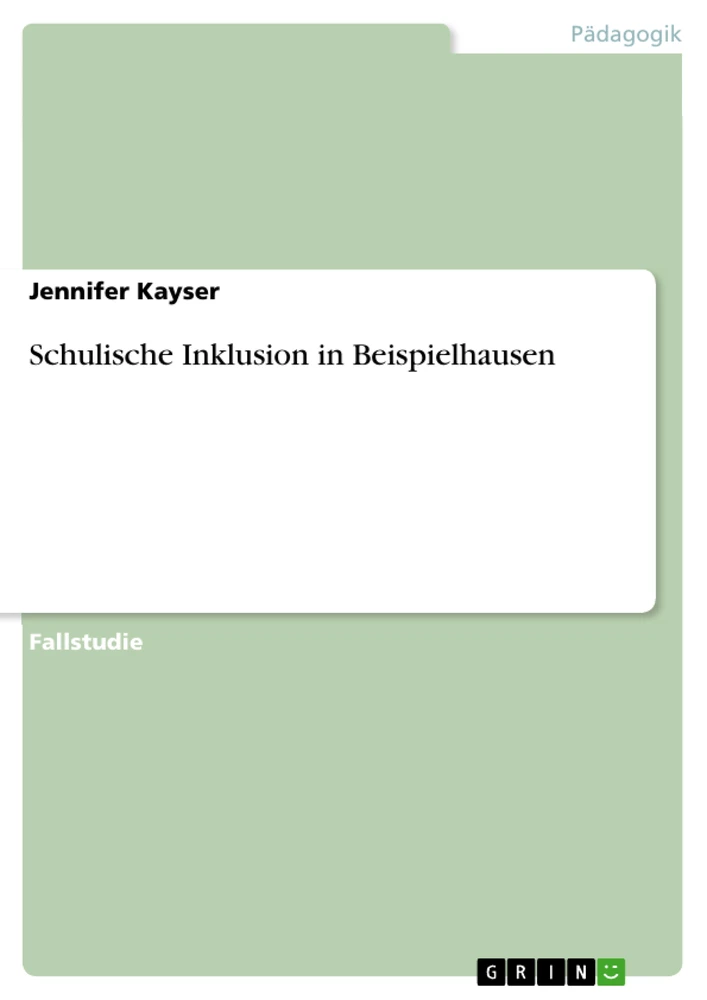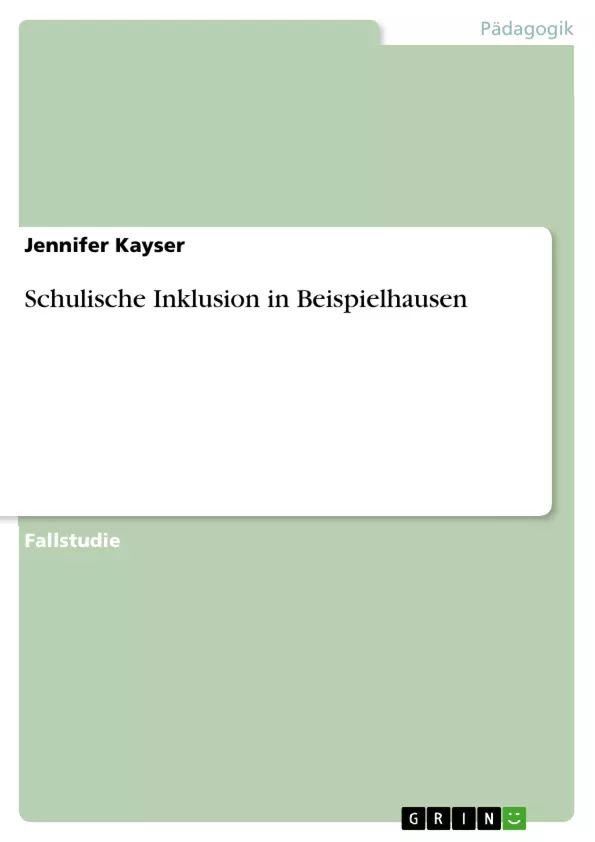In der heutigen Gesellschaft ist die schulische Inklusion ein unverzichtbares Thema. Die UN-Behindertenrechtskonvention, die 2009 in Kraft trat, hat klar festgelegt, dass Inklusion nicht nur eine Idee, sondern ein Recht für alle Menschen ist. Besonders in der Schulbildung kann Inklusion einen großen Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe leisten.
Kinder sollten möglichst früh gemeinsam und voneinander lernen, um Vorurteile und Berührungsängste zu vermeiden. Allerdings fehlt es oft an grundlegenden Konzepten sowie an gut geschultem Personal, um eine effektive Inklusion umzusetzen. Trotz der scheinbaren Starrheit des deutschen Bildungssystems sollte dies keine Hürde für die gemeinsame Beschulung darstellen.
Die Forschung zum Thema „Schulische Inklusion in Beispielhausen“ hat gezeigt, dass die Umsetzung von Inklusion eine sorgfältige Planung und flexible Anpassung erfordert. Die qualitative Forschung in diesem Bereich betont die Bedeutung individueller Erfahrungen und Bewertungen der Betroffenen. Es wird klar, dass die Schule durch gezielte Maßnahmen einen erheblichen Beitrag zur Inklusion leisten kann und muss
Inhaltsverzeichnis
- I. Inhaltsverzeichnis
- II. Abkürzungsverzeichnis.
- 1. Einleitung
- 1.1 Ausgangssituation
- 1.2 Forschungsfrage
- 2. Methodologische Positionierung
- 2.1. Aktueller Forschungsstand und grundlagentheoretische Einbettung der Forschung
- 3. Bestimmung der Forschungsfeldes
- 4. Sampling.
- 5. Datenerhebungsverfahren
- 5.1. Narratives Interview
- 6. Datenaufbereitung – Transkription
- 7. Datenauswertungsverfahren
- 7.1. Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring
- 8. Erstellung eines Erhebungsinstruments
- 9. Kritische Betrachtung und Fazit
- III. Literaturverzeichnis
- IV. Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Fallstudie „Schulische Inklusion in Beispielhausen“ untersucht die Auswirkungen der UN-Behindertenrechtskonvention auf die inklusive Beschulung in einer konkreten Schule. Die Studie zielt darauf ab, die Herausforderungen und Chancen der Inklusion aus der Perspektive der Lehrkräfte zu beleuchten.
- Herausforderungen der Inklusion aus Sicht der Lehrkräfte
- Die Benotung von Kindern mit Behinderung im Vergleich zu Kindern ohne Behinderung
- Die subjektiven Erfahrungen von Lehrkräften im inklusiven Schulalltag
- Die Auswirkungen der UN-Behindertenrechtskonvention auf die Schulpraxis
- Die Bedeutung des Lehrer*innen-Wissensstandes im Bereich der inklusiven Pädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Ausgangssituation in der Stadt Beispielhausen vor, in der die Anzahl von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Regelschulen gestiegen ist. Es wird deutlich, dass diese Entwicklung sowohl Chancen als auch Herausforderungen für die Schule mit sich bringt.
Die Forschungsfrage, die in dieser Arbeit behandelt wird, lautet: „Welche Schwierigkeiten sehen Lehrkräfte in der Benotung von Kindern mit Behinderung im Vergleich zu der Benotung von Kindern ohne Behinderung innerhalb einer Klassengemeinschaft in einer Regelschule in Beispielhausen?“.
Das Kapitel „Methodologische Positionierung“ erläutert den qualitativen Ansatz der Forschung und die Wahl der geeigneten Forschungsmethoden, um die Forschungsfrage zu beantworten.
Schlüsselwörter
Inklusive Bildung, Schulische Inklusion, UN-Behindertenrechtskonvention, Qualitative Forschungsmethoden, Narratives Interview, Qualitative Inhaltsanalyse, Lehrkräfte, Benotung, Herausforderungen der Inklusion, Subjektive Erfahrungen, Fallstudie.
- Quote paper
- Jennifer Kayser (Author), 2023, Schulische Inklusion in Beispielhausen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1482035