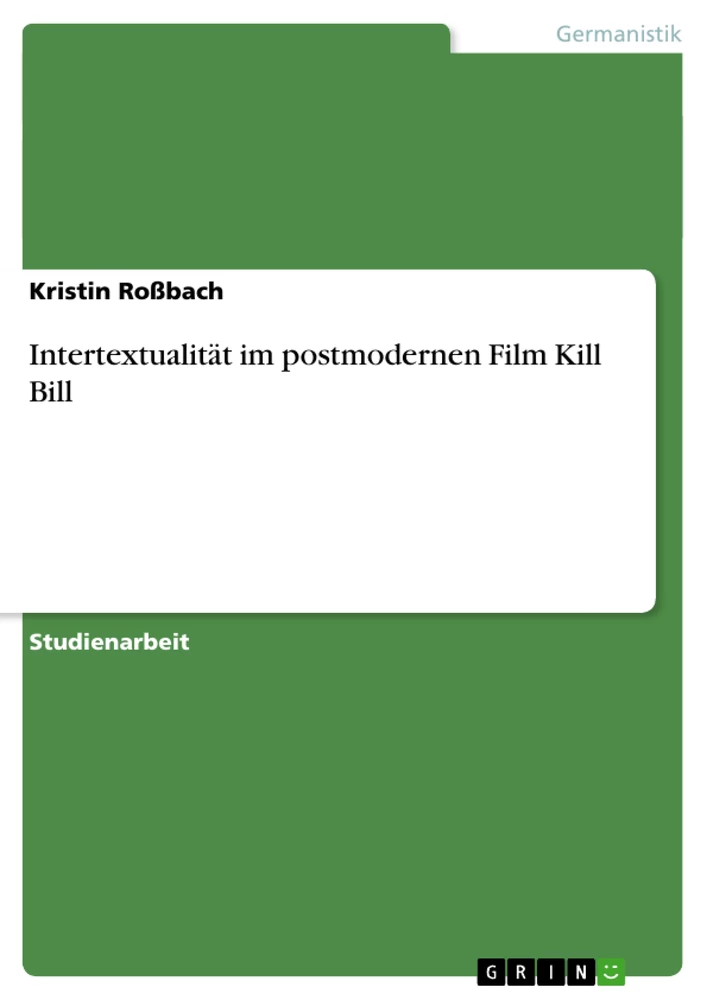In der Proseminararbeit „Intertextualität in Tarantinos postmodernen Film Kill Bill“, stehen vor allem die intertextuellen Bezüge im Vordergrund.
Zuerst folgt eine theoretische Skizzierung des Begriffs der Intertextualität.
Im ersten Kapitel dieser Arbeit werden deshalb die Ansätze nach Kristeva, Genette und Barthes vorgestellt, des Weiteren folgen intertextuelle Phänomene und ihre Funktionen. Im zweiten Kapitel dieser Arbeit soll geklärt werden, was ein postmoderner Film ist und was diesen ausmacht.
Hier werden vor allem die Merkmale eines postmodernen Films genauer
betrachtet. Außerdem soll der Frage nachgegangen werden, warum Kill Bill ein postmoderner Film ist.
Im zweiten Teil der Arbeit, wurden Thesen aufgestellt, die dann mit Hilfe der Filme und ausgewählter Literatur, versucht wurden zu klären.
Der rote Faden aus Blut, der sich durch den Gesamtfilm zieht, kennzeichnet viele intertextuelle Bezüge, die nicht alle in dieser Arbeit geklärt werden sollen und können, sondern nur einige wenige, werden bewusst herausgesucht und näher betrachtet.
Weitere Fragen, die in der Arbeit geklärt werden sollen, sind:
· Müssen alle intertextuellen Bezüge erkannt werden, um die
Handlung zu verstehen?
· Welche Wirkung soll beim Leser/Zuschauer erzeugt werden?
· Welche Funktionen nehmen die intertextuellen Bezüge ein?
Zunächst muss der Versuch unternommen werden, den Begriff
„Intertextualität“ genug wissenschaftlich und umfassend zu klären, um
später näher auf die eben dargestellten Fragen eingehen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Intertextualität
- Ansätze nach Julia Kristeva, Gérard Genette und Roland Barthes.
- Intertextuelle Phänomene und ihre Funktionen
- Der postmoderne Film
- Merkmale des postmodernen Films
- Kill Bill ist ein postmoderner Film …....
- Intertextuelle Bezüge in Kill Bill
- Chronologische Strukturen....
- Ästhetisierung von Gewalt ..
- Genreplay und Genderplay.
- Musik als Storyvorgabe.....
- Der intertextuelle Höhepunkt in der Szene „Von Angesicht zu Angesicht“.
- Fazit
- Literatur und Quellenverzeichnis.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit „Intertextualität in Tarantinos postmodernen Film Kill Bill“ analysiert die intertextuellen Bezüge in Quentin Tarantinos Film Kill Bill. Die Arbeit zielt darauf ab, die verschiedenen Ansätze zur Intertextualität zu erläutern und deren Anwendung in Kill Bill zu untersuchen. Darüber hinaus wird die Frage geklärt, inwiefern Kill Bill als postmoderner Film zu verstehen ist.
- Die verschiedenen Ansätze zur Intertextualität nach Kristeva, Genette und Barthes
- Die Funktionen und Auswirkungen von Intertextualität in Filmen
- Die Merkmale des postmodernen Films und die Einordnung von Kill Bill in diesen Kontext
- Die Analyse der intertextuellen Bezüge in Kill Bill, insbesondere in Bezug auf Gewalt, Genre und Gender
- Die Rolle der Musik als Storyvorgabe in Kill Bill
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Zielsetzung der Arbeit vor. Sie führt in die Thematik der Intertextualität und des postmodernen Films ein und skizziert die Struktur der Arbeit.
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit dem Begriff der Intertextualität. Es werden die Ansätze von Julia Kristeva, Gérard Genette und Roland Barthes vorgestellt und die verschiedenen Phänomene und Funktionen der Intertextualität erläutert.
Das zweite Kapitel definiert den postmodernen Film und seine Merkmale. Es wird untersucht, inwiefern Kill Bill als postmoderner Film zu verstehen ist.
Das dritte Kapitel analysiert die intertextuellen Bezüge in Kill Bill. Es werden verschiedene Aspekte wie die chronologische Struktur, die Ästhetisierung von Gewalt, Genreplay und Genderplay sowie die Rolle der Musik untersucht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Intertextualität, Postmoderne, Quentin Tarantino, Kill Bill, Film, Gewalt, Genre, Gender, Musik, Chronologie, Ästhetik, Anspielungen, Zitate, Prätexte, Dialogizität, Transformation, Interpretation.
- Quote paper
- Kristin Roßbach (Author), 2009, Intertextualität im postmodernen Film Kill Bill, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148111