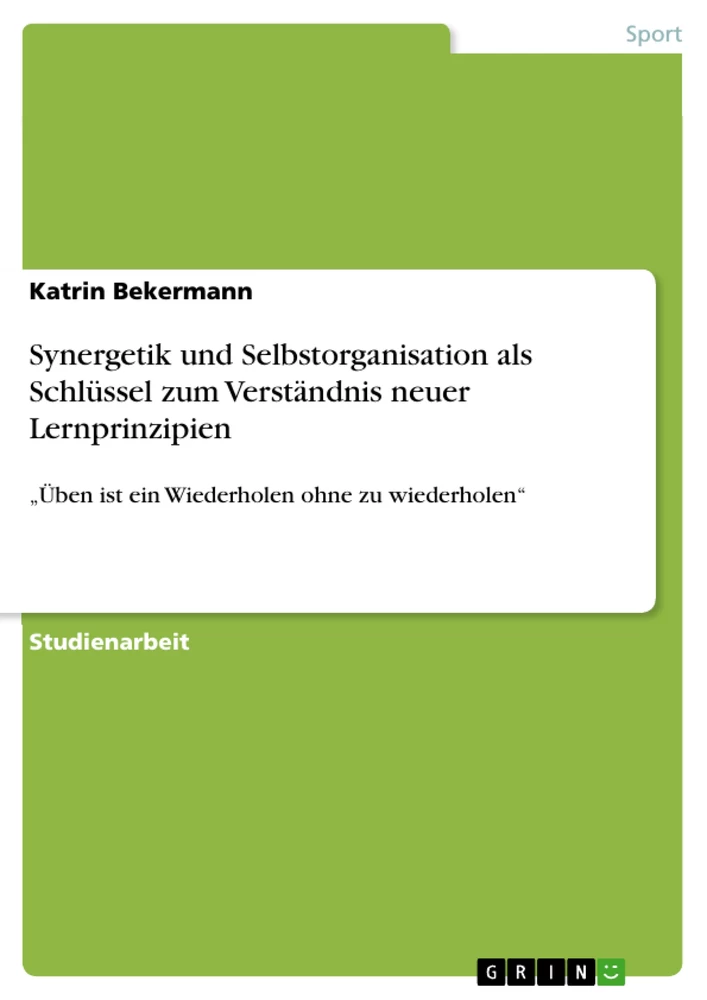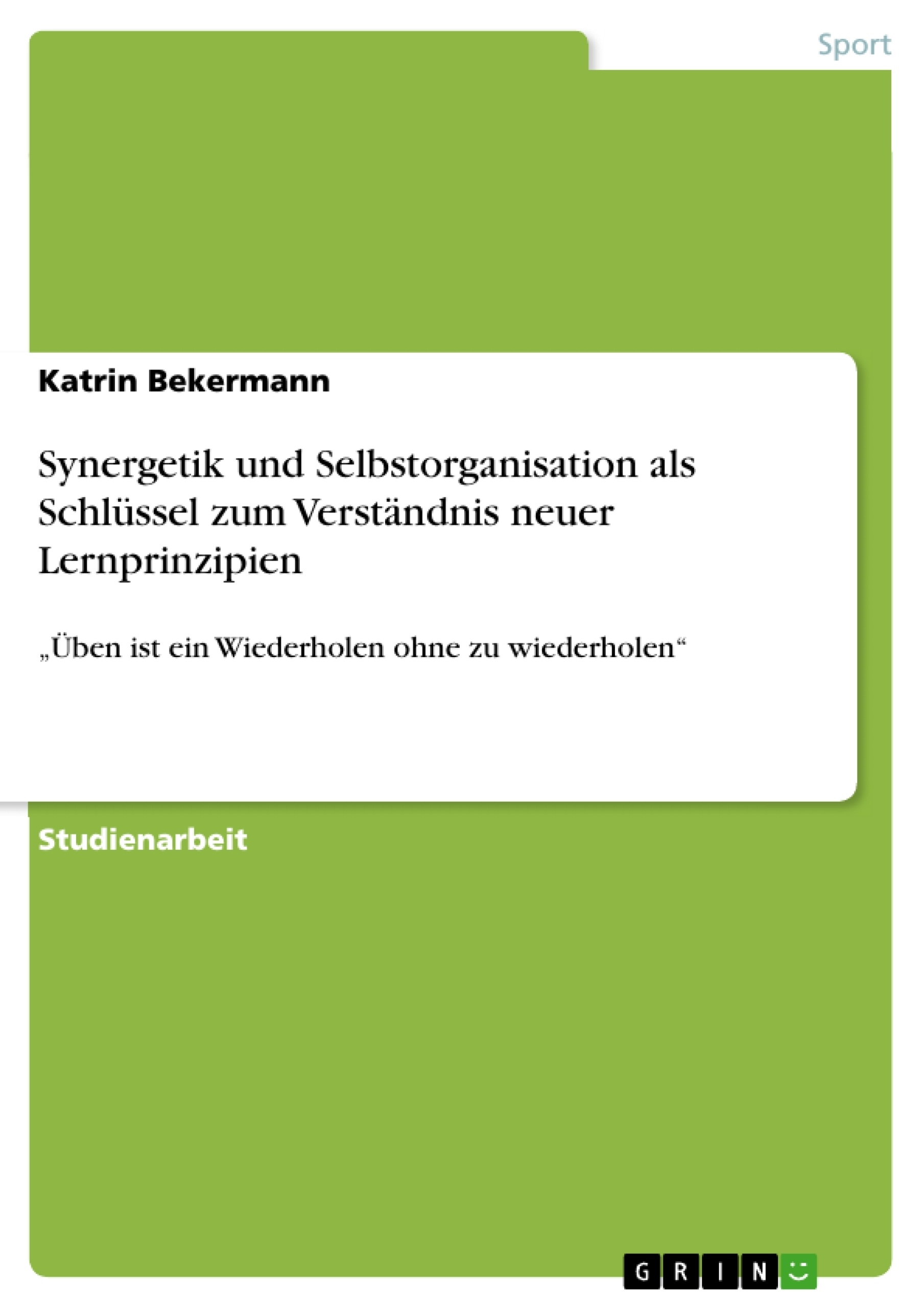Aus heutiger Sicht der Bewegungswissenschaft erscheinen Theorien, die unter den so genannten Motor Approach fallen, wie z.B. der Informationsverarbeitungs- oder kognitive Ansatz, in vielen Aspekten überholt und veraltet. So stoßen diese an ihre Grenzen, wenn es darum geht, Phänomene wie Flexibilität, d.h. die schnelle und adäquate Anpassung der Bewegung an sich verändernde Situationen, oder Variabilität zu erklären. Wie kommt es auch nach zahlreichen Wiederholungen zu Variabilität und Schwankungen in der Bewegungsausführung? Variabilität ist dabei ein unvermeidbares und notwendiges Phänomen, das sich selbst bei vielfach geübten Bewegungsabläufen beobachten lässt.
Entgegen der Computeranalogie soll der Mensch als komplexes, offenes biophysikalisches System betrachtet werden, das sich im Austausch mit der Umwelt befindet. Menschliches Verhalten und Handeln basieren auf der vielseitigen Interaktion zahlreicher Systemkomponenten. Stadler et al. sehen folgende zu klärende Problematik: „Die Komplexität biologischer Bewegungsabläufe steht in deutlichem Kontrast zu der erlebnismäßigen Leichtigkeit der Bewegungsausführung.“ Wie kann es gelingen, trotz dieser Komplexität Bewegungen zu koordinieren? Welche Konsequenzen für das Lehren und Lernen von Bewegungen ergeben sich?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Inhaltsüberblick
- Der Action Approach
- Bernstein als Wegbereiter
- Das Problem der Freiheitsgrade
- Die Nichteindeutigkeit zwischen motorischem Zentrum und Peripherie
- Die Bernsteinsche Koordinationshypothese: From freezing to freeing
- Der systemdynamische Ansatz
- Der ökologische Ansatz
- Bewegungskoordination
- Interpolation und Extrapolation
- Selbstorganisation
- Koordinative Strukturen
- Affordanzen
- Variationsmöglichkeiten
- Neue Bewegungsformen und Spitzenleistungen
- Methodisch-didaktische Konsequenzen für das motorische Lernen
- Das differenzielle Lernen und Lehren nach Schöllhorn
- Kritik an den klassischen Lerntheorien und -strategien
- Alternative und klassische Konzepte variablen Übens
- Das heuristische Lernen nach Pesce
- Ergänzende Überlegungen
- Variables Üben aus ökologischer Sichtweise
- Variabilität und Stabilität
- Abschließende Überlegungen
- Kritikpunkte und Problembereiche des systemdynamischen Ansatzes
- Ergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht alternative Ansätze zur Bewegungskoordination, die den klassischen "Motor Approach" übersteigen. Sie beleuchtet die Problematik der Bewegungsflexibilität und -variabilität und deren Implikationen für das motorische Lernen und Lehren. Der Fokus liegt auf der Anwendung systemdynamischer Prinzipien und der Bedeutung von variablem Üben.
- Das Problem der Freiheitsgrade im menschlichen Bewegungssystem
- Der systemdynamische Ansatz zur Bewegungskoordination und seine Anwendung auf das motorische Lernen
- Konzepte des variablen Übens: differenzielles Lernen und heuristisches Lernen
- Bernsteins Koordinationshypothese ("Freezing to Freeing")
- Die Rolle von Variabilität und Fehlern im motorischen Lernprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und benennt die Limitationen des traditionellen "Motor Approach" hinsichtlich der Erklärung von Flexibilität und Variabilität in Bewegungen. Sie stellt die zentralen Forschungsfragen nach der Koordination komplexer Bewegungen und den daraus resultierenden Konsequenzen für das motorische Lernen und Lehren.
Problemstellung: Dieses Kapitel beleuchtet die Diskrepanz zwischen der Komplexität biologischer Bewegungsabläufe und der scheinbaren Leichtigkeit ihrer Ausführung. Es unterstreicht die Notwendigkeit, über die Grenzen des "Motor Approach" hinauszugehen und alternative Erklärungsmodelle zu finden, um das Phänomen der Variabilität in der Bewegungsausführung zu verstehen.
Der Action Approach: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über verschiedene Ansätze des "Action Approach", der sich von traditionellen, informationsverarbeitungsorientierten Modellen abgrenzt. Es betont den Einfluss der Gestaltpsychologie, der ökologischen Wahrnehmungspsychologie und naturwissenschaftlicher Disziplinen wie der Chaostheorie und Synergetik auf das Verständnis von Bewegung.
Bernstein als Wegbereiter: Dieses Kapitel präsentiert Bernstein's Beiträge zur Bewegungsforschung, insbesondere sein Konzept der "Freiheitsgrade" und die damit verbundene Problematik der Bewegungskoordination. Es beschreibt Bernsteins dreistufiges Modell des motorischen Lernens ("Freezing to Freeing"), das die progressive Beherrschung der Freiheitsgrade im Lernprozess betont.
Der systemdynamische Ansatz: Dieses Kapitel erläutert den systemdynamischen Ansatz, der Bewegungen als emergente Prozesse aus der Interaktion zahlreicher Systemkomponenten versteht. Es bezieht die Synergetik als relevante Grundlage ein und beschreibt die Selbstorganisation als zentralen Aspekt der Bewegungskoordination und des Lernprozesses.
Bewegungskoordination: Dieses Kapitel fokussiert sich auf die Konzepte der Interpolation und Extrapolation, Selbstorganisation, koordinative Strukturen und Affordanzen im Kontext der Bewegungskoordination. Es vertieft den systemdynamischen Ansatz weiter.
Variationsmöglichkeiten: Dieses Kapitel behandelt die methodisch-didaktischen Konsequenzen für das motorische Lernen, insbesondere im Hinblick auf variables Üben. Es stellt das differenzielle Lernen und Lehren nach Schöllhorn und das heuristische Lernen nach Pesce vor und diskutiert die Bedeutung von Variabilität und Fehlern im Lernprozess.
Schlüsselwörter
Bewegungskoordination, Action Approach, Systemdynamik, Synergetik, Bernstein, Freiheitsgrade, variables Üben, differenzielles Lernen, heuristisches Lernen, Selbstorganisation, Variabilität, motorisches Lernen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Alternative Ansätze zur Bewegungskoordination
Was ist das zentrale Thema des Dokuments?
Das Dokument untersucht alternative Ansätze zur Bewegungskoordination, die über den klassischen "Motor Approach" hinausgehen. Es beleuchtet die Problematik der Bewegungsflexibilität und -variabilität und deren Implikationen für motorisches Lernen und Lehren, mit Fokus auf systemdynamische Prinzipien und variablem Üben.
Welche Ansätze zur Bewegungskoordination werden behandelt?
Das Dokument behandelt den Action Approach, den systemdynamischen Ansatz, den ökologischen Ansatz und Bernsteins Koordinationshypothese ("Freezing to Freeing"). Es werden Konzepte wie Interpolation/Extrapolation, Selbstorganisation, koordinative Strukturen und Affordanzen diskutiert.
Welche Rolle spielt Bernstein in diesem Kontext?
Bernstein wird als Wegbereiter für alternative Ansätze präsentiert. Sein Konzept der "Freiheitsgrade" und sein dreistufiges Modell des motorischen Lernens ("Freezing to Freeing") werden ausführlich erläutert. Es wird die Problematik der Bewegungskoordination im Hinblick auf die Vielzahl von Freiheitsgraden im menschlichen Bewegungssystem beleuchtet.
Was ist der systemdynamische Ansatz und seine Bedeutung?
Der systemdynamische Ansatz versteht Bewegungen als emergente Prozesse aus der Interaktion zahlreicher Systemkomponenten. Er bezieht die Synergetik ein und betont die Selbstorganisation als zentralen Aspekt der Bewegungskoordination und des Lernprozesses. Seine Anwendung auf motorisches Lernen wird detailliert beschrieben.
Welche Bedeutung hat variables Üben?
Variables Üben wird als methodisch-didaktische Konsequenz der erläuterten Ansätze dargestellt. Das Dokument stellt das differenzielle Lernen nach Schöllhorn und das heuristische Lernen nach Pesce vor und diskutiert die Bedeutung von Variabilität und Fehlern im Lernprozess aus ökologischer Perspektive.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument beinhaltet eine Einleitung, Problemstellung, einen Überblick über den Action Approach (inkl. Bernsteins Beitrag), Kapitel zu Bewegungskoordination, Variationsmöglichkeiten (mit Fokus auf variablem Üben und den Lerntheorien von Schöllhorn und Pesce), abschließende Überlegungen, Kritikpunkte zum systemdynamischen Ansatz und ein Ergebniskapitel.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Bewegungskoordination, Action Approach, Systemdynamik, Synergetik, Bernstein, Freiheitsgrade, variables Üben, differenzielles Lernen, heuristisches Lernen, Selbstorganisation, Variabilität, motorisches Lernen.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Die Zielsetzung ist die Untersuchung alternativer Ansätze zur Bewegungskoordination, die über den traditionellen "Motor Approach" hinausgehen, und die Analyse der Problematik von Bewegungsflexibilität und -variabilität sowie deren Implikationen für motorisches Lernen und Lehren.
Welche Limitationen des traditionellen "Motor Approach" werden angesprochen?
Das Dokument kritisiert den traditionellen "Motor Approach" für seine unzureichende Erklärung von Flexibilität und Variabilität in Bewegungen. Es unterstreicht die Notwendigkeit, alternative Erklärungsmodelle zu finden, um die Komplexität biologischer Bewegungsabläufe besser zu verstehen.
- Quote paper
- Katrin Bekermann (Author), 2006, Synergetik und Selbstorganisation als Schlüssel zum Verständnis neuer Lernprinzipien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147970