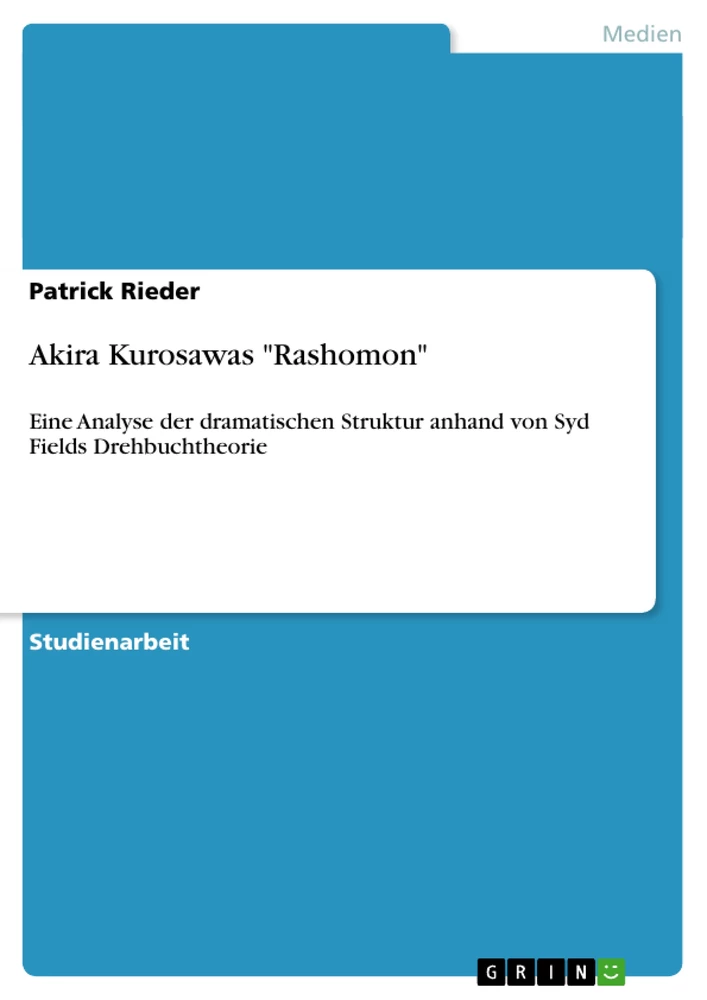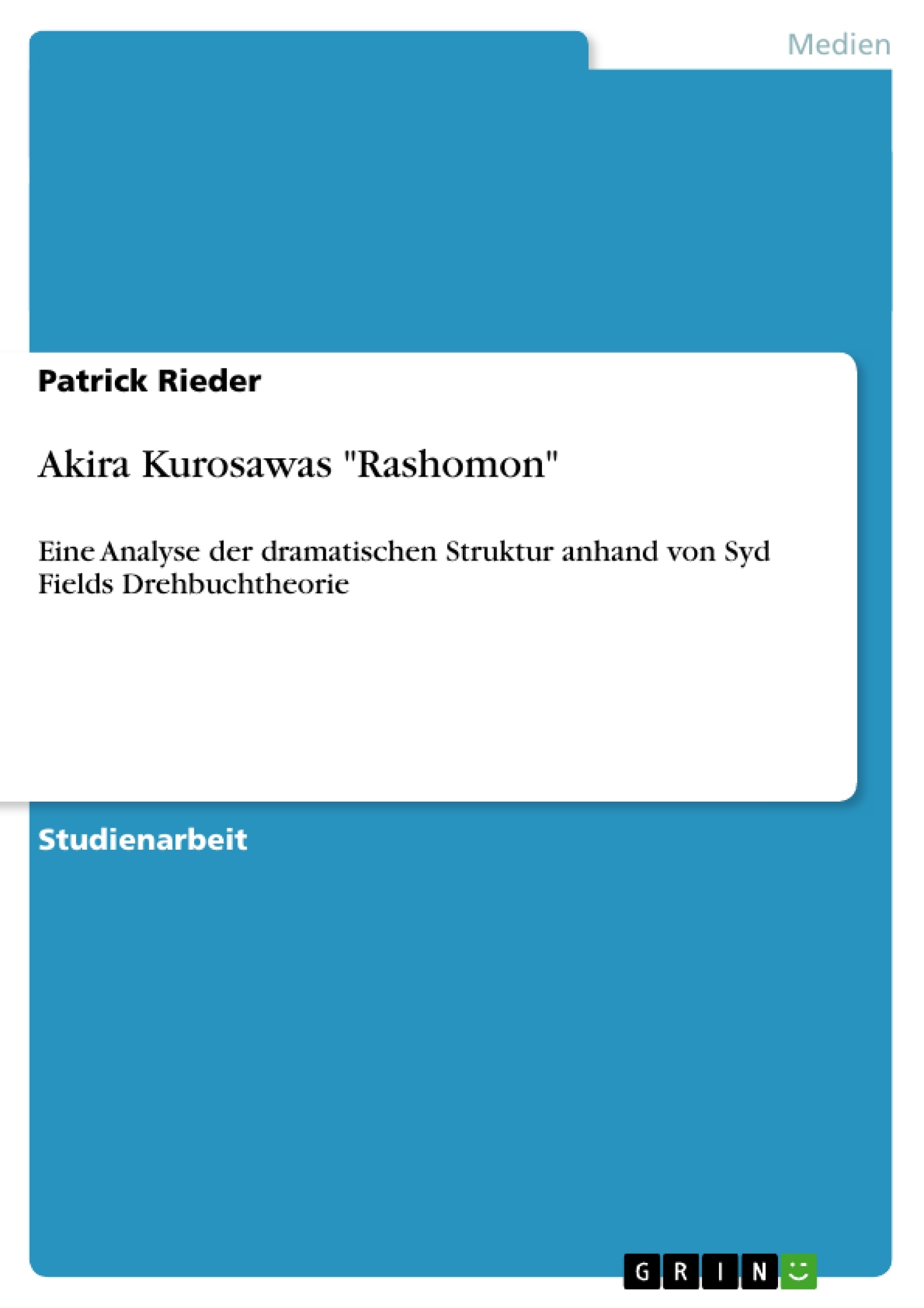Drehbuchliteratur gibt es mittlerweilen wie Sand am Meer. In einem Vergleich von vieren dieser Handbücher kam Ellermann zu dem Schluss, dass sie sich an „der ‚klassischen Erzählweise‘ des Hollywood-Kinos“ orientieren. Er kritisiert den dramaturgischen Aufbau in diesen Werken damit, dass sie sich alle an der geschlossenen Form des Dramas orientieren und somit die Möglichkeit einer offenen Form ausschließen.
Howard und Mabley gehen in ihrer Analyse des Films Rashomon davon aus, dass Rashomon wegen seines Verzichtes auf einen Protagonisten ohne die Kategorien Spannungsbogen, Höhepunkt und Auflösung auskommen muss.
Insofern bietet es sich gerade bei einem Film wie Rashomon, der seine Geschichte, oder Geschichten, mit wechselnden Protagonisten, auf mehreren Ebenen erzählt, zu untersuchen, ob er nicht doch eine 3-Akt-Struktur, wie Syd Field sie vorschlägt, aufweist.
In dieser Arbeit soll somit untersucht werden, ob und wie sich Rashomon in eine 3-Akt-Struktur einteilen lässt.
Dazu sollen zunächst die verschiedenen Plots des Filmes untersucht, in Sub- und Hauptplots unterteilt werden und deren Protagonisten, Ziele und Antagonisten identifiziert werden.
Anschließend soll anhand einer Methode Robert McKees untersucht werden, ob und wie stark Rashomon in das „Genre“ des Kunstfilms eingeordnet werden kann und welche Elemente der klassischen Struktur in ihm zu finden sind.
Bis schließlich die Erzählstruktur des Filmes Rashomon anhand von Syd Fields Terminologie untersucht werden wird und die Ergebnisse bewertet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Narrationsanalyse
- Erzählebenen und -perspektiven
- Verzerrung
- Hauptplot und Subplots
- Protagonisten, Ziele und Antagonisten
- McKees Story-Dreieck
- offenes vs. geschlossenes Ende
- äußerer vs. innerer Konflikt
- einzelner vs. mehrere Protagonisten
- aktiver vs. passiver Protagonist
- lineare vs. nichtlineare Zeit
- Kausalität vs. Koinzidenz
- konsistente vs. inkonsistente Realität
- Veränderung vs. Stillstand
- Archeplot - Miniplot - Antiplot
- Strukturanalyse nach Syd Fields Paradigma
- 1. Akt
- 2. Akt
- 3. Akt
- Schlusswort
- Anhang
- Sequenzprotokoll
- Syd Fields Paradigm Worksheets für die Plots in Rashomon
- Literaturverzeichnis
- Filmausgabe
- Sekundärliteratur
- Internetquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, zu untersuchen, ob und wie sich Akira Kurosawas Film „Rashomon“ in eine 3-Akt-Struktur einteilen lässt, die von Syd Field vorgeschlagen wurde. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Plots des Films, identifiziert die Protagonisten, Ziele und Antagonisten und untersucht, ob und wie stark der Film in das „Genre“ des Kunstfilms eingeordnet werden kann.
- Die verschiedenen Erzählebenen und -perspektiven im Film
- Die Verzerrung der Geschichte durch die unterschiedlichen Erzählstimmen
- Die Einteilung des Films in Hauptplot und Subplots
- Die Analyse der Filmstruktur nach Syd Fields Paradigma
- Die Einordnung des Films in das „Genre“ des Kunstfilms
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Films „Rashomon“ ein und stellt die Forschungsfrage nach der 3-Akt-Struktur des Films. Kapitel 2 widmet sich der Narrationsanalyse und untersucht die verschiedenen Erzählebenen, -perspektiven und Verzerrungen. Kapitel 3 analysiert die Filmstruktur anhand von Syd Fields Paradigma und untersucht die Einordnung des Films in das „Genre“ des Kunstfilms. Das Schlusswort fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Rashomon, Akira Kurosawa, 3-Akt-Struktur, Syd Field, Erzählstruktur, Kunstfilm, Verzerrung, Perspektiven, Protagonisten, Antagonisten, Subplots, Hauptplot
- Citar trabajo
- Patrick Rieder (Autor), 2009, Akira Kurosawas "Rashomon", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147961