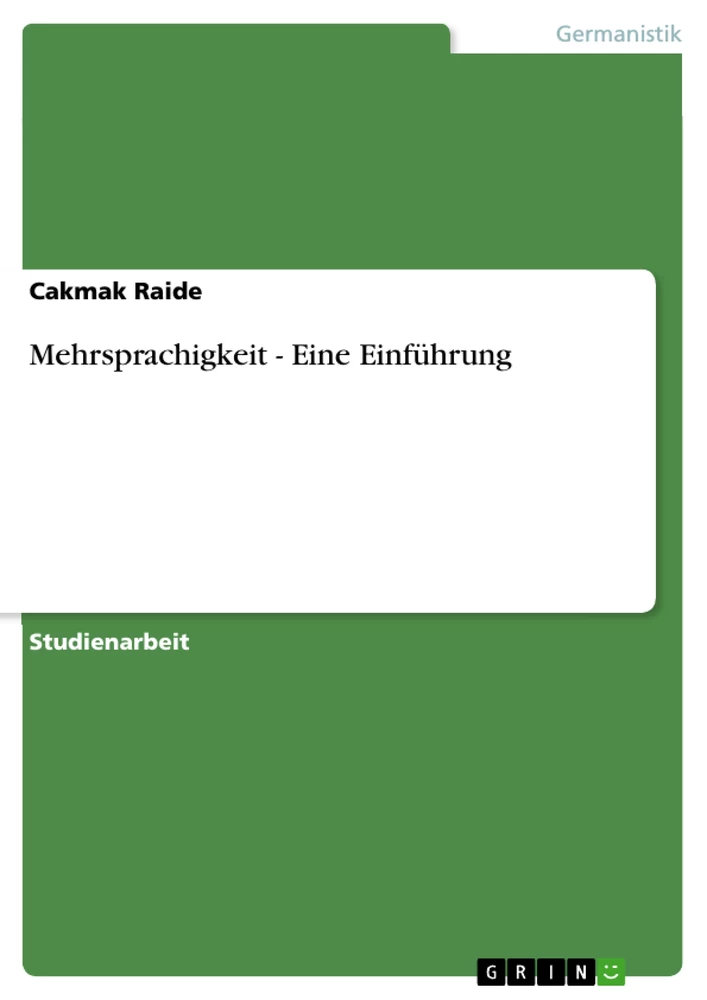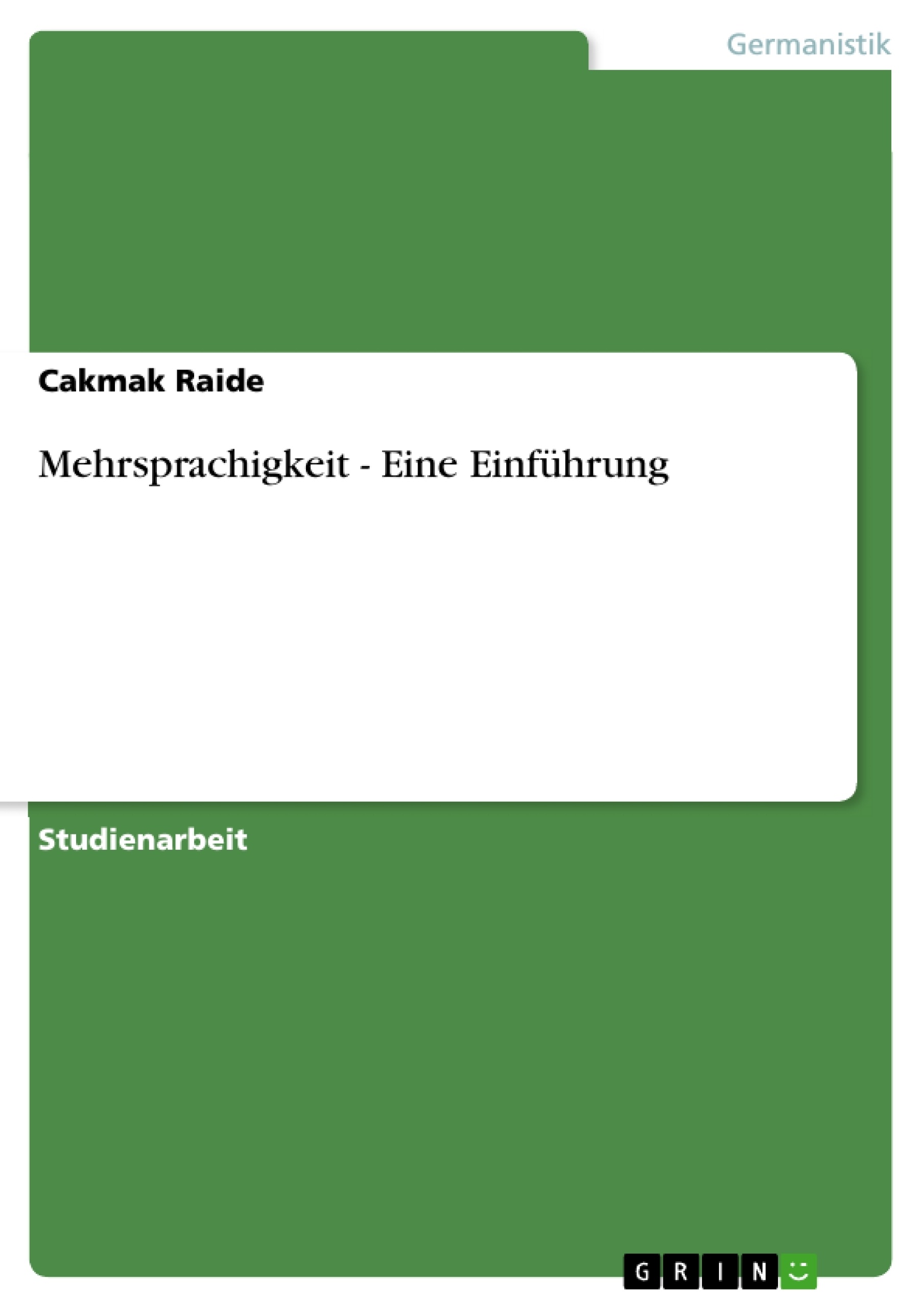Im Zuge der Globalisierung wird die Mehrsprachigkeit im Unterricht immer wichtiger. Gerade in Deutschland, einem Land mit hoher Einwandererzahl, wird der Bedarf an neuen Konzepten immer dringender. Zur Zeit sind etwa 10% der Bürger Deutschlands nicht deutscher Herkunft, diese Zahl liegt angesichts der Einbürgerungen um weites höher. Rund ein Fünftel der deutschen Bevölkerung weist einen sogenannten Migrationshintergrund auf. Als Menschen mit Migrationshintergrund werden vom Statistischen Bundesamt all jene, in Deutschland lebenden Personen gezählt, die seit der Gründung der Bundesrepublik im Jahr 1949 eingewandert sind, sowie deren Nachkommen. Die Mehrheit dieser rund 15 Millionen sprechen aber neben der deutschen oft auch noch eine andere (Mutter-)Sprache. Etwa 10 % aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland sprechen darüber hinaus eine andere Sprache als Deutsch als ihre Erstsprache.
Durch die heterogene Zusammensetzung in Schulen bzw. Schulklassen wachsen auch die Ansprüche an die Bildung. Ein zentrales Element der sich durch die Globalisierung verändernden Bildung in Deutschland ist die Sprachenvielfalt die sich in Schulen ergibt.
In meiner Hausarbeit werde ich auf diese Mehrsprachigkeit im Unterricht eingehen. Vor allem werde ich die Methoden und Konzepte aber auch die Unterrichtsdidaktik von Mehrsprachigkeit betrachten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition von Mehrsprachigkeit
- Allgemeine Erkenntnisse im Bezug auf die Mehrsprachigkeit
- Ansätze von Mehrsprachigkeitsprojekten
- Folgerungen für die Unterrichtpraxis
- Didaktik zwei- bzw. mehrsprachiger Bildung
- Modelle mehrsprachiger Erziehung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Bedeutung von Mehrsprachigkeit im deutschen Schulsystem im Kontext der Globalisierung und steigenden Einwanderung. Sie analysiert verschiedene Konzepte und Methoden des mehrsprachigen Unterrichts, beleuchtet die didaktischen Herausforderungen und präsentiert verschiedene Ansätze von Mehrsprachigkeitsprojekten.
- Definition und Verständnis von Mehrsprachigkeit
- Erkenntnisse zu den Auswirkungen von Mehrsprachigkeit auf die kognitive und sprachliche Entwicklung
- Analyse verschiedener Ansätze von Mehrsprachigkeitsprojekten (z.B. Immersion, Submersion)
- Didaktische Implikationen für den mehrsprachigen Unterricht
- Modelle und Konzepte mehrsprachiger Erziehung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung betont die wachsende Bedeutung von Mehrsprachigkeit im deutschen Bildungssystem aufgrund der Globalisierung und der hohen Einwanderungsrate. Sie führt in die Thematik ein und skizziert den Fokus der Arbeit auf Methoden, Konzepte und die Didaktik mehrsprachiger Bildung.
Definition von Mehrsprachigkeit: Dieses Kapitel hinterfragt die gängige Vorstellung von Mehrsprachigkeit als perfekte Beherrschung mehrerer Sprachen. Es präsentiert eine umfassendere Definition, die verschiedene Kompetenzstufen und Kontexte einbezieht, von muttersprachlicher Kompetenz bis hin zu fachsprachlichem Verständnis. Es thematisiert die Realität der Mehrsprachigkeit in Deutschland, auch in vermeintlich einsprachigen Regionen, und die gesellschaftlichen Konsequenzen dieser Sprachvielfalt.
Allgemeine Erkenntnisse im Bezug auf die Mehrsprachigkeit: Dieses Kapitel beleuchtet die positive Wirkung von Mehrsprachigkeit auf die kognitive Entwicklung und den Spracherwerb. Es bezieht sich auf wissenschaftliche Studien, die den Nutzen früher Mehrsprachigkeit hervorheben, wie beispielsweise die DESI-Studie. Es widerlegt weitverbreitete Mythen über negative Auswirkungen und betont die Bedeutung der sozialen Umgebung und der Sprachförderung für den Schulerfolg mehrsprachiger Schüler.
Ansätze von Mehrsprachigkeitsprojekten: Dieses Kapitel beschreibt unterschiedliche Ansätze im Umgang mit Mehrsprachigkeit im Unterricht, insbesondere Submersion und Immersion. Es diskutiert die methodischen Unterschiede zwischen erwerbsorientierten und begegnungsorientierten Ansätzen im Fremdsprachenunterricht und beleuchtet das Konzept der Immersion als umfassendes "Sprachbad" im Unterricht. Es hebt die Notwendigkeit hervor, von der Bewertung von Sprachen als "mehr- oder minderwertig" abzugehen und die "Migrantensprachen" als Ressource zu betrachten.
Schlüsselwörter
Mehrsprachigkeit, Bilingualismus, Spracherwerb, Sprachförderung, Immersion, Submersion, Didaktik, mehrsprachiger Unterricht, Migrationshintergrund, interkulturelle Bildung, Sprachkompetenz.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Mehrsprachigkeit im deutschen Schulsystem
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit befasst sich umfassend mit dem Thema Mehrsprachigkeit im deutschen Schulsystem. Sie beinhaltet eine Einleitung, eine Definition von Mehrsprachigkeit, allgemeine Erkenntnisse zu deren Auswirkungen, verschiedene Ansätze von Mehrsprachigkeitsprojekten, didaktische Implikationen für den Unterricht und Modelle mehrsprachiger Erziehung. Die Arbeit analysiert Konzepte und Methoden des mehrsprachigen Unterrichts und beleuchtet die damit verbundenen didaktischen Herausforderungen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Definition und das Verständnis von Mehrsprachigkeit, die Auswirkungen auf kognitive und sprachliche Entwicklung, die Analyse verschiedener Ansätze von Mehrsprachigkeitsprojekten (z.B. Immersion, Submersion), didaktische Implikationen für den mehrsprachigen Unterricht und Modelle und Konzepte mehrsprachiger Erziehung. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von Mehrsprachigkeit im Kontext der Globalisierung und steigender Einwanderung.
Wie wird Mehrsprachigkeit in der Arbeit definiert?
Die Arbeit geht über die gängige Vorstellung von Mehrsprachigkeit als perfekte Beherrschung mehrerer Sprachen hinaus. Sie präsentiert eine umfassendere Definition, die verschiedene Kompetenzstufen und Kontexte, von muttersprachlicher Kompetenz bis hin zu fachsprachlichem Verständnis, einbezieht. Die Realität der Mehrsprachigkeit in Deutschland, auch in vermeintlich einsprachigen Regionen, und deren gesellschaftliche Konsequenzen werden thematisiert.
Welche Erkenntnisse zu den Auswirkungen von Mehrsprachigkeit werden präsentiert?
Die Arbeit beleuchtet die positive Wirkung von Mehrsprachigkeit auf die kognitive Entwicklung und den Spracherwerb. Sie bezieht sich auf wissenschaftliche Studien, die den Nutzen früher Mehrsprachigkeit hervorheben (z.B. DESI-Studie). Sie widerlegt weitverbreitete Mythen über negative Auswirkungen und betont die Bedeutung der sozialen Umgebung und der Sprachförderung für den Schulerfolg mehrsprachiger Schüler.
Welche Ansätze von Mehrsprachigkeitsprojekten werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt unterschiedliche Ansätze im Umgang mit Mehrsprachigkeit im Unterricht, insbesondere Submersion und Immersion. Sie diskutiert die methodischen Unterschiede zwischen erwerbsorientierten und begegnungsorientierten Ansätzen im Fremdsprachenunterricht und beleuchtet das Konzept der Immersion als umfassendes "Sprachbad". Die Notwendigkeit, von der Bewertung von Sprachen als "mehr- oder minderwertig" abzugehen und "Migrantensprachen" als Ressource zu betrachten, wird hervorgehoben.
Welche didaktischen Implikationen werden für den mehrsprachigen Unterricht gezogen?
Die Arbeit leitet didaktische Implikationen für den mehrsprachigen Unterricht ab, basierend auf den vorgestellten Erkenntnissen und den analysierten Ansätzen von Mehrsprachigkeitsprojekten. Sie beleuchtet die Herausforderungen und Chancen des mehrsprachigen Unterrichts und schlägt möglicherweise didaktische Modelle vor (genaue Details sind aus dem gegebenen Text nicht ersichtlich).
Welche Modelle mehrsprachiger Erziehung werden vorgestellt?
Die Hausarbeit präsentiert verschiedene Modelle mehrsprachiger Erziehung, die sich aus den Analysen der verschiedenen Ansätze und didaktischen Implikationen ergeben. Die spezifischen Modelle sind im gegebenen Textfragment nicht detailliert beschrieben, werden aber im Gesamtkontext der Arbeit behandelt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter der Arbeit sind: Mehrsprachigkeit, Bilingualismus, Spracherwerb, Sprachförderung, Immersion, Submersion, Didaktik, mehrsprachiger Unterricht, Migrationshintergrund, interkulturelle Bildung, Sprachkompetenz.
- Quote paper
- Cakmak Raide (Author), 2010, Mehrsprachigkeit - Eine Einführung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147956