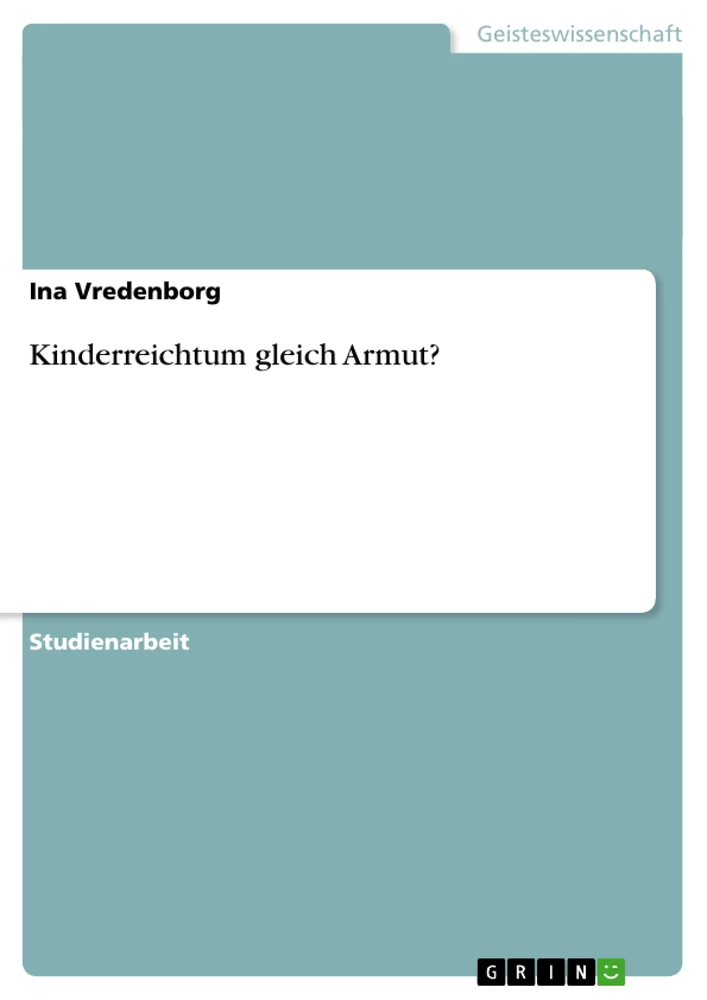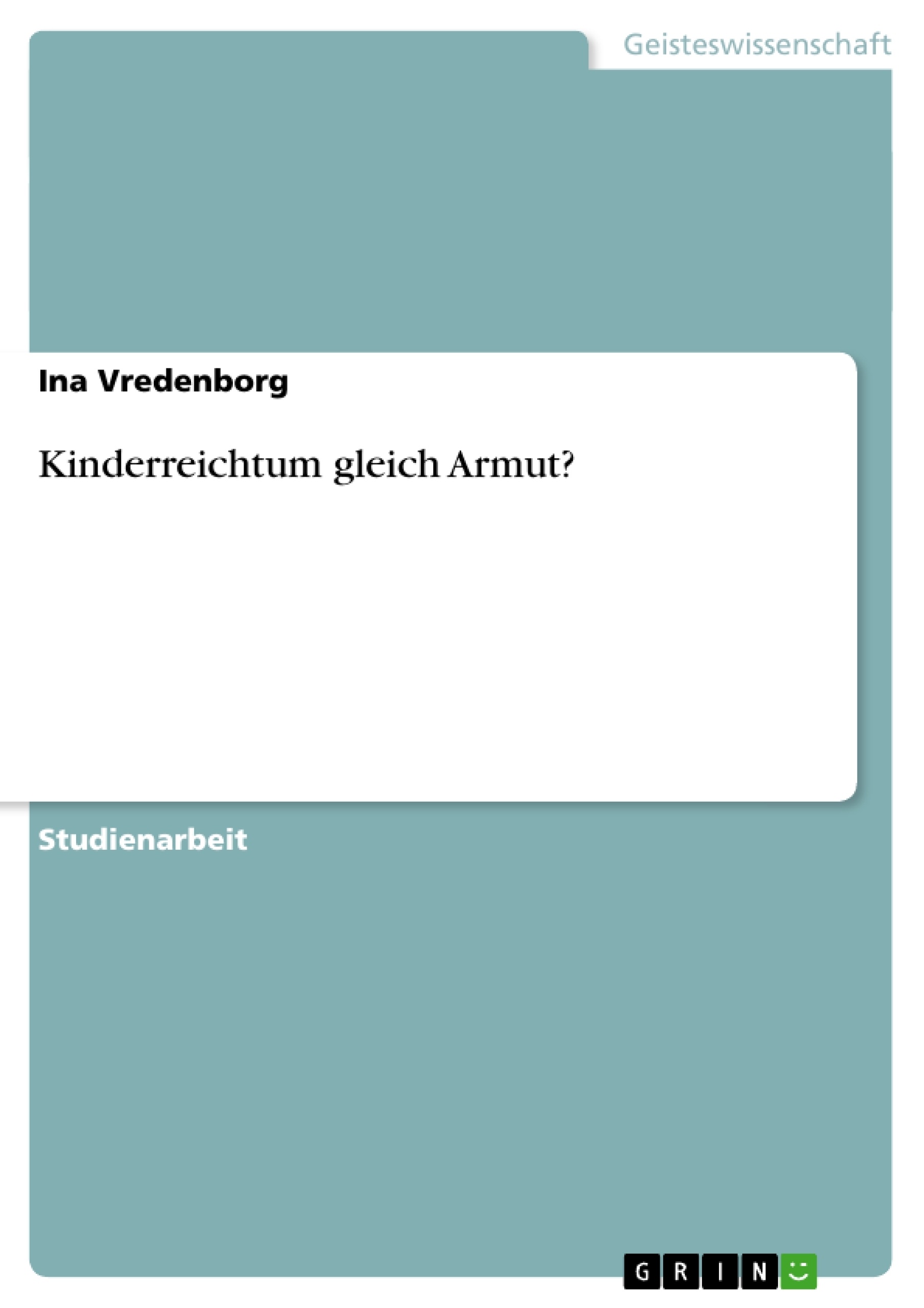Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich hauptsächlich mit der Frage, ob Kinder-reichtum in der Bundesrepublik Deutschland zur Verarmung führt und welchen Ein-fluss die Zahl von Kindern auf die Lebenslage ihrer Familie hat.
Im Rahmen dieser Fragestellung soll folgende Hypothese überprüft werden:
"Je kinderreicher eine Familie ist, desto höher ist ihr Armutsrisiko bzw. je weniger Kinder eine Familie hat, desto niedriger ist ihre Gefahr in eine prekäre Lebenslage zu geraten."
Um einen Einstieg in das Thema zu erleichtern beginnt die Arbeit mit einer Definiti-on ihrer Hauptbegriffe „Armut“ und „Kinderreichtum“. Es folgt ein Vergleich der aktuellen Lebensverhältnisse, in denen dargestellt wird, ob und vor allem wie kin-derreiche Familien in Deutschland benachteiligt sind. Dafür werden insbesondere statistische Erhebungen heran gezogen, um einen Überblick zu geben. In dem darauf folgenden Abschnitt wird eine kurze Zusammenfassung gegeben, um dann auf die in der Einleitung aufgestellte Hypothese näher einzugehen. Dieser Teil der Hausarbeit stellt einen wesentlichen Bestandteil der Arbeit dar, weil es hier zu einer „Teil- Widerlegung“ der gestellten Hypothese kommt.
Unter der verwendeten Literatur stechen vor allem drei Werke hervor. Der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, der mit Hilfe von aktuellem statisti-schem Material einen Überblick über die Thematik gibt und aus dem in anderer Lite-ratur oft zitiert und verwiesen wird. Außerdem Franz- Xaver Kaufmanns Buch über die Zukunft der Familie im vereinten Deutschland, dass präzise und detailgenau die Abhängigkeit der Familien in Bezug auf wirtschaftliche Vorgaben aufzeigt. Und das Werk von Bernd Eggen und Marina Rupp „Kinderreiche Familien“, dass eine aus-führliche und vielfältige Bestandsaufnahme über das Leben kinderreicher Familien liefert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was bedeutet Armut?
- Wann gilt heute eine Familie als kinderreich?
- Lebensbereiche von kinderreichen und kinderarmen/losen Familien
- Bildung und Erwerbstätigkeit
- Einkommensverhältnisse
- Wohnverhältnisse
- Resümee
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Frage, ob Kinderreichtum in Deutschland zur Verarmung führt und welchen Einfluss die Anzahl von Kindern auf die Lebenslage ihrer Familie hat. Die Hypothese lautet: Je kinderreicher eine Familie ist, desto höher ist ihr Armutsrisiko. Die Arbeit analysiert die Definitionen von "Armut" und "Kinderreichtum", vergleicht die Lebensverhältnisse von kinderreichen und kinderarmen Familien und untersucht statistische Erhebungen, um die Hypothese zu überprüfen.
- Definition von Armut und Kinderreichtum
- Lebensverhältnisse von kinderreichen Familien
- Statistische Erhebungen und Analyse der Hypothese
- Zusammenhang zwischen Kinderzahl und Armutsrisiko
- Sozioökonomische Faktoren, die die Lebenslage von Familien beeinflussen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Hypothese der Arbeit vor. Sie erläutert den Aufbau der Arbeit und die verwendeten Quellen. Das zweite Kapitel definiert den Begriff "Armut" und diskutiert verschiedene Messmethoden. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Definition von "Kinderreichtum" und beleuchtet die aktuellen Geburtenraten in Deutschland. Das vierte Kapitel analysiert die Lebensbereiche von kinderreichen und kinderarmen Familien, insbesondere in Bezug auf Bildung, Erwerbstätigkeit, Einkommen und Wohnverhältnisse. Die Arbeit stützt sich dabei auf statistische Erhebungen und empirische Daten.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Kinderreichtum, Armut, Familienarmut, Lebensverhältnisse, Bildung, Erwerbstätigkeit, Einkommen, Wohnverhältnisse, statistische Erhebungen, Deutschland.
- Quote paper
- Ina Vredenborg (Author), 2008, Kinderreichtum gleich Armut?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147875