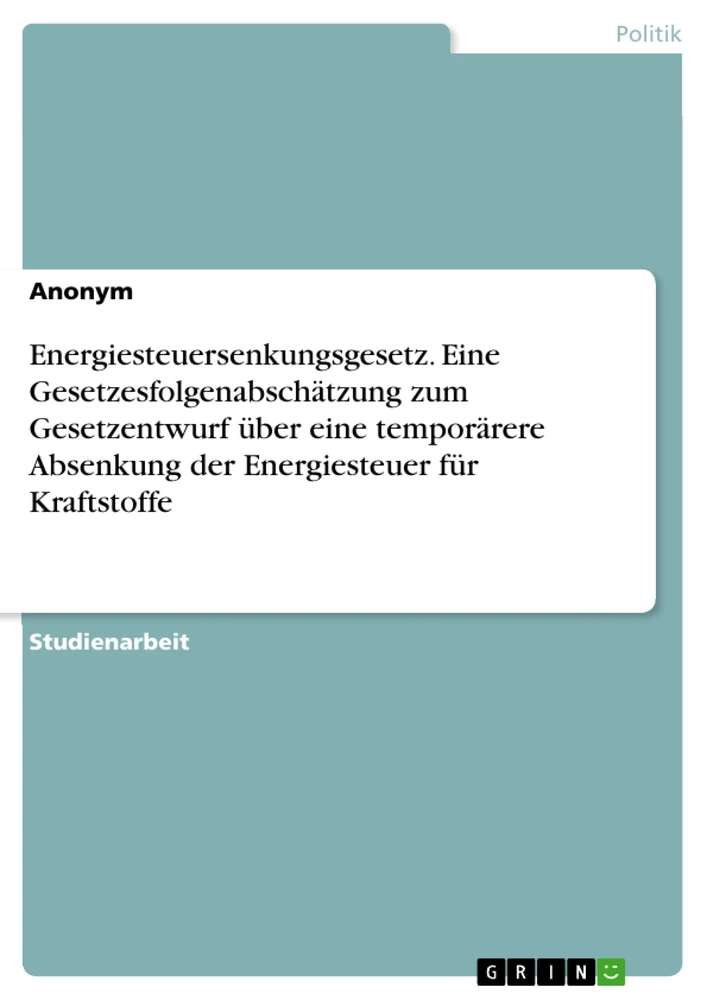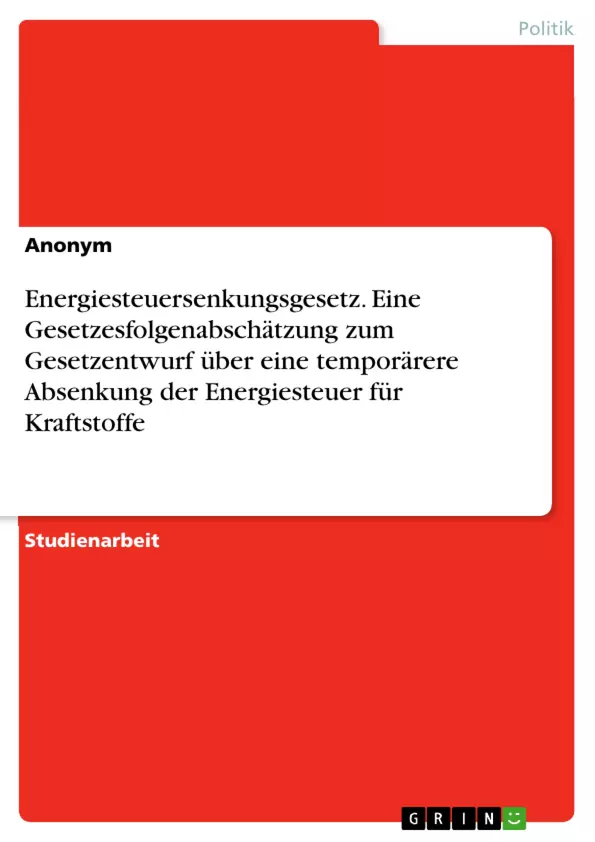Im Folgenden soll, anhand eines steuerungstheoretischen Modells der Gesetzesfolgenabschätzung, beurteilt werden, ob die beabsichtigten Programme der Bundesregierung das zugrundeliegende Problem der stetig steigenden Energiepreise ursachenadäquat bekämpfen oder nicht. Ferner soll das Analyseraster hauptsächlich auf das Energiesteuersenkungsgesetz bezogen werden, wobei der neue Entwurf des Regionalisierungsgesetzes peripher berücksichtigt werden soll.
Diese Untersuchung basiert auf einem differenzierten steuerungstheoretischen Modell, welches sich aus einer Dreiklang-Konzeption zusammensetzt: der Interventionshypothese, der Kausalhypothese und der Aktionshypothese. Jede dieser Hypothesen bietet eine spezifische Perspektive auf die Steuerungsmechanismen und deren potenzielle Wirksamkeit. Durch die detaillierte Analyse dieser Hypothesen wird es möglich, fundierte Aussagen über die Effektivität und Zielgenauigkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen zu treffen.
„Die Verbraucherpreise steigen immer schneller“ – so lautet die Einleitung eines Tagesschau-Artikels, welcher am 30.05.2022 publiziert worden ist (Tagesschau 2022). Demnach stieg die Inflation im Mai in Deutschland auf etwa 7.9 Prozent an, bei einem gleichzeitigen Anstieg der Lebensmittelpreise um 11.1 Prozent und der Energiepreise um 38.3 Prozent. Sowohl die Inflation als auch die Teuerung der Lebenshaltungskosten haben zur Folge, dass den Bürger*innen erhebliche Mehrkosten und Belastungen auferlegt werden, die insbesondere durch die Corona-Pandemie und den völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine resultieren. Indes hat der russische Angriff dafür gesorgt, dass der bereits angespannte Energiemarkt noch vulnerabler wurde.
Als Reaktion auf diese Entwicklungen hat die Bundesregierung einige temporäre Entlastungspakete für Bürger*innen und die Wirtschaft vorgesehen. Dazu gehören die zeitlich begrenzte Senkung der Energiesteuer und die Einführung des sogenannten „9-Euro-Tickets“. Diese Entlastungspakete wurden als Gesetzesentwürfe am 10.05.2022 vorgestellt. Der Entwurf zum Energiesteuersenkungsgesetz sieht eine dreimonatige Reduzierung der Energiesteuer auf ein europäisches Mindestmaß vor, und der Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes die Einführung eines ÖPNV-Tickets, welches teilweise aus den Regionalisierungsmitteln finanziert werden soll (EnergieStSenkG 2022, Art. 1, RegG 7).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Ziele und Maßnahmen des Gesetzentwurfs
- 2.1 Ziele des Gesetzentwurfs
- 2.2 Intendierte Maßnahmen zur Realisierung des Ziels
- 3. Analyse der Steuerungskonzeption
- 4. Analyse des gesellschaftlichen Problems
- 5. Prüfung der Hypothesen
- 5.1 Prüfung der Interventionshypothese
- 5.2 Prüfung der Kausalhypothese
- 6. Analyse der Bewertungskriterien
- 7. Analyse der Einigungskosten
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert das Energiesteuersenkungsgesetz (EnergieStSenkG) und dessen beabsichtigte Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft und Bevölkerung im Kontext steigender Energiepreise. Die Analyse bewertet die Effektivität der geplanten Maßnahmen zur Entlastung der Bürger*innen und untersucht die zugrundeliegende Steuerungskonzeption.
- Bewertung der Effektivität des EnergieStSenkG
- Analyse der Steuerungskonzeption des Gesetzes
- Untersuchung des gesellschaftlichen Problems steigender Energiepreise
- Prüfung der Interventions- und Kausalhypothesen
- Bewertung der Einigungskosten des Gesetzes
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext des Energiesteuersenkungsgesetzes vor dem Hintergrund stark steigender Energie- und Lebensmittelpreise in Deutschland im Mai 2022. Der russische Angriff auf die Ukraine wird als verschärfender Faktor für die bereits angespannte Energiemarktlage identifiziert. Die Bundesregierung reagiert mit Entlastungspaketen, darunter die temporäre Senkung der Energiesteuer und die Einführung des 9-Euro-Tickets. Die Arbeit kündigt eine steuerungstheoretische Folgenabschätzung des Energiesteuersenkungsgesetzes an.
2. Ziele und Maßnahmen des Gesetzentwurfs: Dieses Kapitel beschreibt das primäre Ziel des EnergieStSenkG: die Entlastung von Bürger*innen und Wirtschaft durch fallende Kraftstoffpreise und alternative Mobilitätsmöglichkeiten. Die angestrebte Erhöhung der Kaufkraft und der damit verbundene Ausgleich der Haushaltsausgaben werden ebenfalls thematisiert. Das angepasste Regionalisierungsgesetz (RegG) wird als ergänzende Maßnahme zur Verstärkung der Entlastungswirkung vorgestellt. Das Kapitel beschreibt detailliert die geplanten Maßnahmen zur Senkung der Energiesteuer für verschiedene Kraftstoffe und die Einführung des 9-Euro-Tickets.
3. Analyse der Steuerungskonzeption: Dieses Kapitel analysiert die Wirkungszusammenhänge des Gesetzentwurfs anhand eines Modells, das aus Interventions-, Kausal- und Aktionshypothese besteht. Die Interventionshypothese postuliert, dass die Energiesteuersenkung zu niedrigeren Kraftstoffpreisen führt. Die Kausalhypothesen beschreiben die erwarteten Folgen: Entlastung der Bürger*innen und Wirtschaft, erhöhte Kaufkraft und daraus resultierende Umsatzsteuermehreinnahmen. Die Aktionshypothese fasst zusammen, dass die Energiesteuersenkung zu einer Entlastung führt. Das Kapitel stellt die Zusammenhänge in einer Grafik dar.
4. Analyse des gesellschaftlichen Problems: Dieses Kapitel analysiert das gesellschaftliche Problem steigender Energiepreise auf Basis des wohlfahrtsökonomischen Modells zum Marktversagen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Annahme unendlich schneller Anpassungsgeschwindigkeiten von Märkten oft nicht erfüllt ist. Am Beispiel der Kraftstoffpreise wird gezeigt, wie die Kombination aus steigender Nachfrage nach der Corona-Pandemie und dem russischen Angriff auf die Ukraine zu Preisanstiegen führt und die Marktflexibilität beeinträchtigt.
Schlüsselwörter
Energiesteuersenkungsgesetz, Energiepreise, Inflation, Kaufkraft, Steuerungskonzeption, Marktversagen, Entlastung, ÖPNV, 9-Euro-Ticket, Russland-Ukraine-Krieg, Gesetzesfolgenabschätzung.
Häufig gestellte Fragen zum Energiesteuersenkungsgesetz (EnergieStSenkG)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Energiesteuersenkungsgesetz (EnergieStSenkG) und dessen beabsichtigte Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft und Bevölkerung im Kontext steigender Energiepreise. Die Analyse bewertet die Effektivität der geplanten Maßnahmen zur Entlastung der Bürger*innen und untersucht die zugrundeliegende Steuerungskonzeption.
Welche Ziele verfolgt das EnergieStSenkG?
Das primäre Ziel des EnergieStSenkG ist die Entlastung von Bürger*innen und Wirtschaft durch fallende Kraftstoffpreise und alternative Mobilitätsmöglichkeiten. Es zielt auf eine Erhöhung der Kaufkraft und den damit verbundenen Ausgleich der Haushaltsausgaben ab.
Welche Maßnahmen sieht das EnergieStSenkG vor?
Das Gesetz sieht detaillierte Maßnahmen zur Senkung der Energiesteuer für verschiedene Kraftstoffe und die Einführung des 9-Euro-Tickets vor. Das angepasste Regionalisierungsgesetz (RegG) wird als ergänzende Maßnahme zur Verstärkung der Entlastungswirkung genannt.
Wie wird die Steuerungskonzeption des Gesetzes analysiert?
Die Analyse der Steuerungskonzeption erfolgt anhand eines Modells mit Interventions-, Kausal- und Aktionshypothese. Die Interventionshypothese postuliert niedrigere Kraftstoffpreise durch die Energiesteuersenkung. Die Kausalhypothesen beschreiben erwartete Folgen wie Entlastung, erhöhte Kaufkraft und Umsatzsteuermehreinnahmen. Die Aktionshypothese fasst die Entlastungswirkung zusammen. Die Zusammenhänge werden grafisch dargestellt.
Welches gesellschaftliche Problem wird betrachtet?
Die Arbeit analysiert das gesellschaftliche Problem steigender Energiepreise auf Basis des wohlfahrtsökonomischen Modells zum Marktversagen. Sie betont die oft unrealistische Annahme unendlich schneller Anpassungsgeschwindigkeiten von Märkten und zeigt am Beispiel der Kraftstoffpreise, wie steigende Nachfrage und der Ukraine-Krieg zu Preisanstiegen und eingeschränkter Marktflexibilität führen.
Welche Hypothesen werden geprüft?
Die Arbeit prüft eine Interventionshypothese (Energiesteuersenkung führt zu niedrigeren Kraftstoffpreisen) und Kausalhypothesen (erwartete Folgen der Energiesteuersenkung wie Entlastung, erhöhte Kaufkraft und Mehreinnahmen).
Wie wird die Effektivität des Gesetzes bewertet?
Die Arbeit bewertet die Effektivität des EnergieStSenkG durch die Analyse der beschriebenen Maßnahmen, der Steuerungskonzeption und der Prüfung der Hypothesen. Die Einigungskosten des Gesetzes werden ebenfalls analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Energiesteuersenkungsgesetz, Energiepreise, Inflation, Kaufkraft, Steuerungskonzeption, Marktversagen, Entlastung, ÖPNV, 9-Euro-Ticket, Russland-Ukraine-Krieg, Gesetzesfolgenabschätzung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zu den Zielen und Maßnahmen des Gesetzes, zur Analyse der Steuerungskonzeption, zum gesellschaftlichen Problem steigender Energiepreise, zur Prüfung der Hypothesen, zur Analyse der Bewertungskriterien und der Einigungskosten sowie ein Fazit. Kapitelzusammenfassungen sind ebenfalls enthalten.
Welchen Kontext beschreibt die Einleitung?
Die Einleitung beschreibt den Kontext des Energiesteuersenkungsgesetzes vor dem Hintergrund stark steigender Energie- und Lebensmittelpreise in Deutschland im Mai 2022. Der russische Angriff auf die Ukraine wird als verschärfender Faktor identifiziert. Die Bundesregierung reagiert mit Entlastungspaketen, darunter die temporäre Senkung der Energiesteuer und das 9-Euro-Ticket. Die Arbeit kündigt eine steuerungstheoretische Folgenabschätzung an.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2022, Energiesteuersenkungsgesetz. Eine Gesetzesfolgenabschätzung zum Gesetzentwurf über eine temporärere Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1478391