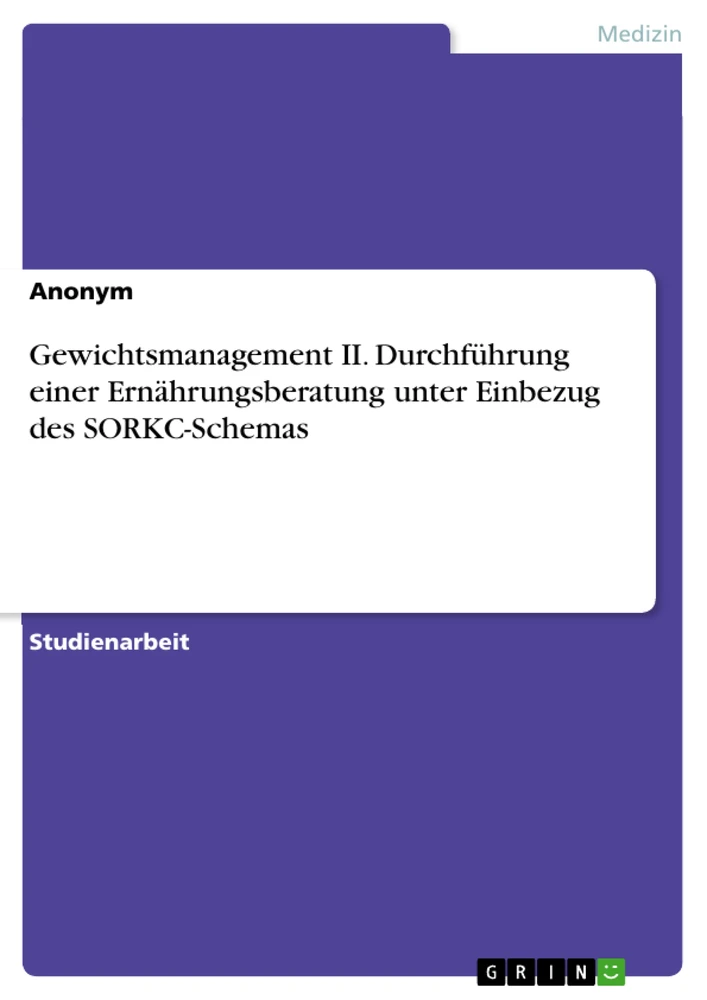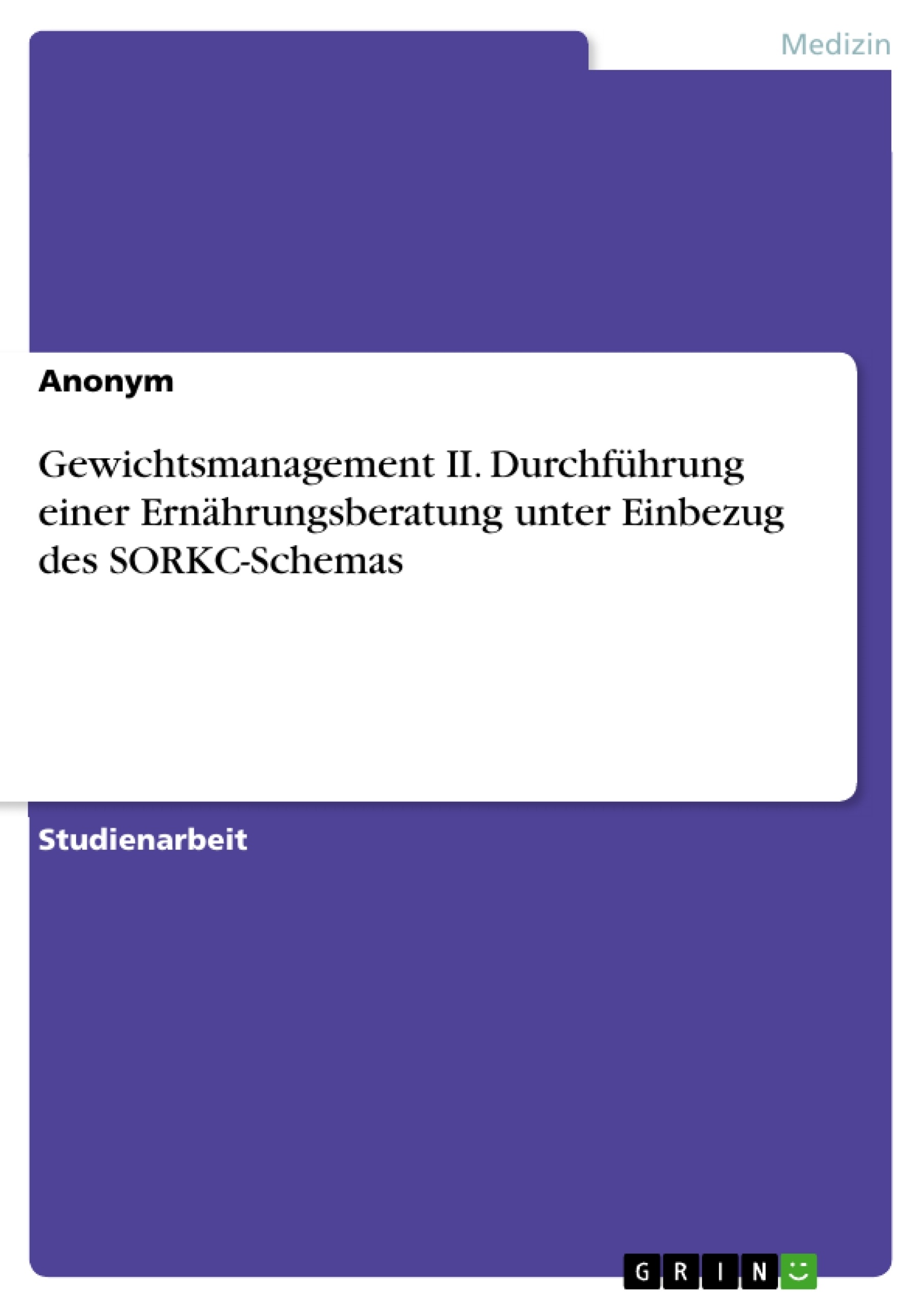Diese Arbeit stellt eine Durchführung einer Ernährungsberatung unter Einbezug des SORKC-Schemas mit einem fiktiven Patienten dar. Diese Person wird zunächst beschrieben, bevor eine Verhaltensanalyse durchgeführt wird. Anschließend erfolgt das Verhaltenstraining. Zum Schluss wird eine Literaturrecherche durchgeführt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Personenbeschreibung
- 1.2 Ausgangssituation
- 2 Verhaltensanalyse
- 2.1 SORKC-Schema
- 2.2 Positive Verhaltensänderung
- 2.3 Konsequenz
- 3 Verhaltenstraining
- 3.1 Kognitive Umstrukturierung
- 3.2 Verstärkung des neuen Verhaltens
- 3.3 Rückfallprophylaxe
- 4 Literaturrecherche
- 4.1 Studie 1
- 4.2 Studie 2
- 4.3 Studie 3
- 5 Literaturverzeichnis
- 6 Tabellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Anwendung des SORKC-Schemas zur Ernährungsberatung bei einem fiktiven Patienten, Herrn Müller, der an Adipositas Grad II und Diabetes Mellitus Typ 2 leidet. Ziel ist es, die Verhaltensanalyse mithilfe des SORKC-Schemas darzustellen und daraus ein individuelles Verhaltenstraining abzuleiten, welches Herrn Müller bei seiner Gewichtsreduktion unterstützt.
- Anwendung des SORKC-Schemas zur Verhaltensanalyse
- Identifikation von problematischem Essverhalten und Bewegungsmangel
- Entwicklung eines individuellen Verhaltenstrainings zur Gewichtsreduktion
- Strategien zur kognitiven Umstrukturierung und Rückfallprophylaxe
- Integration von Literaturrecherche zu relevanten Studien
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt Herrn Müller, einen 54-jährigen Mann mit Adipositas Grad II und Diabetes Mellitus Typ 2, vor. Seine Lebensumstände, medizinische Vorgeschichte (inklusive eines kürzlich erlittenen Schlaganfalls), und seine Motivation zur Gewichtsreduktion werden detailliert beschrieben. Seine Arbeitsbelastung, sein Mangel an Bewegung und ungesunde Essgewohnheiten (häufiges „Snacken“ und Konsum von Softdrinks) werden als zentrale Herausforderungen identifiziert. Sein Wunsch nach einer Lifestyle-Modifikation nach einem Schlaganfall bildet die Grundlage für die Ernährungsberatung. Die Ausgangssituation betont seine Schwierigkeiten mit der Selbstmotivation und die Herausforderungen in Bezug auf seine Ernährung aufgrund seines Arbeitsalltags.
2 Verhaltensanalyse: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Anwendung des SORKC-Schemas (Situation-Organismus-Reaktion-Konsequenz-Kontingenz) auf Herrn Müllers Verhalten. Es erklärt das Schema detailliert und analysiert, wie die einzelnen Komponenten (Situation, Organismus, Reaktion, Konsequenz, Kontingenz) auf Herrn Müllers Essverhalten und Bewegungsmangel wirken. Es werden verschiedene Reize, interne Faktoren (Organismusvariablen) und die daraus resultierenden Konsequenzen (positive und negative Verstärkung) untersucht, um die Zusammenhänge zwischen seinem Verhalten und den beeinflussenden Faktoren zu verstehen. Das Kapitel dient als Grundlage für die Entwicklung eines individuellen Verhaltenstrainings.
Schlüsselwörter
SORKC-Schema, Verhaltensanalyse, Ernährungsberatung, Gewichtsmanagement, Adipositas, Diabetes Mellitus Typ 2, Verhaltenstraining, Kognitive Umstrukturierung, Rückfallprophylaxe, Lifestyle-Modifikation, Sekundärprophylaxe.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Hausarbeit: Verhaltensanalyse und -training bei Adipositas und Diabetes Mellitus Typ 2
Was ist das Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit analysiert die Anwendung des SORKC-Schemas zur Ernährungsberatung eines fiktiven Patienten (Herr Müller) mit Adipositas Grad II und Diabetes Mellitus Typ 2. Ziel ist die Darstellung der Verhaltensanalyse mittels SORKC und die Ableitung eines individuellen Verhaltenstrainings zur Gewichtsreduktion.
Welche Methoden werden in der Hausarbeit verwendet?
Die zentrale Methode ist die Verhaltensanalyse mithilfe des SORKC-Schemas (Situation-Organismus-Reaktion-Konsequenz-Kontingenz). Zusätzlich werden Strategien der kognitiven Umstrukturierung und Rückfallprophylaxe im Verhaltenstraining angewendet. Die Arbeit stützt sich auch auf relevante Literaturrecherche.
Wer ist der fiktive Patient in der Hausarbeit?
Der fiktive Patient ist Herr Müller, ein 54-jähriger Mann mit Adipositas Grad II und Diabetes Mellitus Typ 2. Er hat kürzlich einen Schlaganfall erlitten und möchte seine Lebensweise ändern, um seine Gesundheit zu verbessern.
Welche Aspekte von Herrn Müllers Leben werden betrachtet?
Die Hausarbeit untersucht Herrn Müllers Arbeitsbelastung, Bewegungsmangel, ungesunde Essgewohnheiten (häufiges Snacken, Konsum von Softdrinks) und seine Schwierigkeiten mit der Selbstmotivation. Seine medizinische Vorgeschichte, insbesondere der Schlaganfall, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
Wie wird das SORKC-Schema angewendet?
Das SORKC-Schema wird verwendet, um Herrn Müllers Essverhalten und Bewegungsmangel zu analysieren. Es werden die Situation, der Organismus (interne Faktoren), die Reaktion (Verhalten), die Konsequenzen (positive und negative Verstärkung) und die Kontingenz (Zusammenhang zwischen Verhalten und Konsequenz) untersucht, um die Ursachen seines Verhaltens zu verstehen.
Was ist das Ziel des Verhaltenstrainings?
Das Ziel des Verhaltenstrainings ist es, Herrn Müller bei seiner Gewichtsreduktion zu unterstützen. Es beinhaltet Strategien zur kognitiven Umstrukturierung, um ungünstige Denkweisen zu verändern, und zur Rückfallprophylaxe, um langfristigen Erfolg zu sichern.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zur Verhaltensanalyse mit dem SORKC-Schema, ein Kapitel zum Verhaltenstraining (inklusive kognitiver Umstrukturierung und Rückfallprophylaxe), ein Kapitel zur Literaturrecherche, ein Literaturverzeichnis und ein Tabellenverzeichnis.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: SORKC-Schema, Verhaltensanalyse, Ernährungsberatung, Gewichtsmanagement, Adipositas, Diabetes Mellitus Typ 2, Verhaltenstraining, Kognitive Umstrukturierung, Rückfallprophylaxe, Lifestyle-Modifikation, Sekundärprophylaxe.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2023, Gewichtsmanagement II. Durchführung einer Ernährungsberatung unter Einbezug des SORKC-Schemas, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1477817