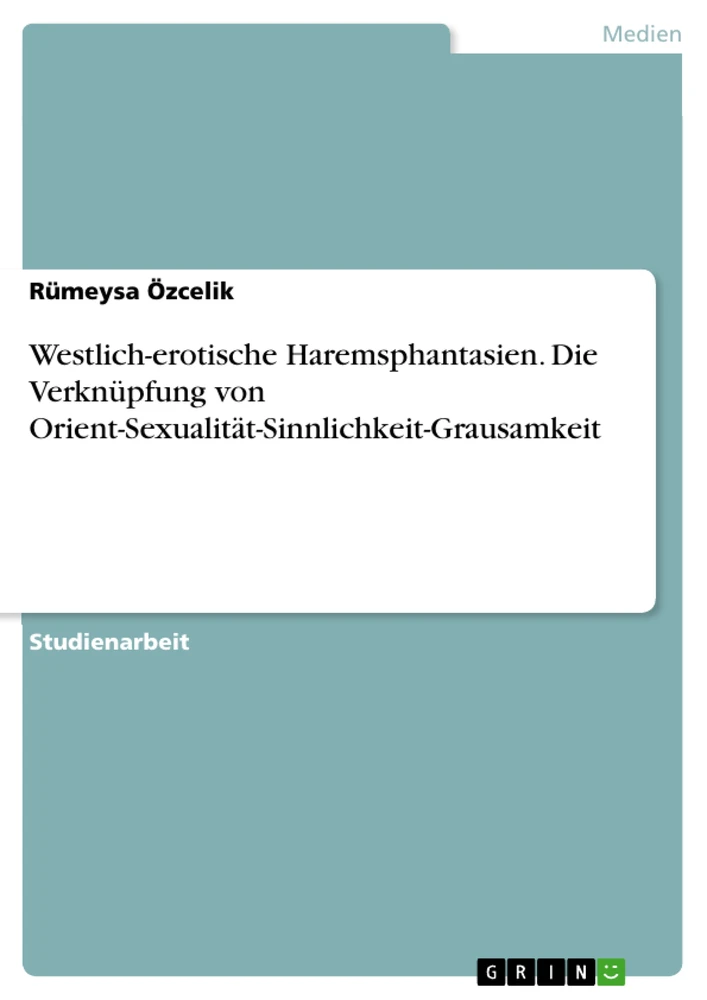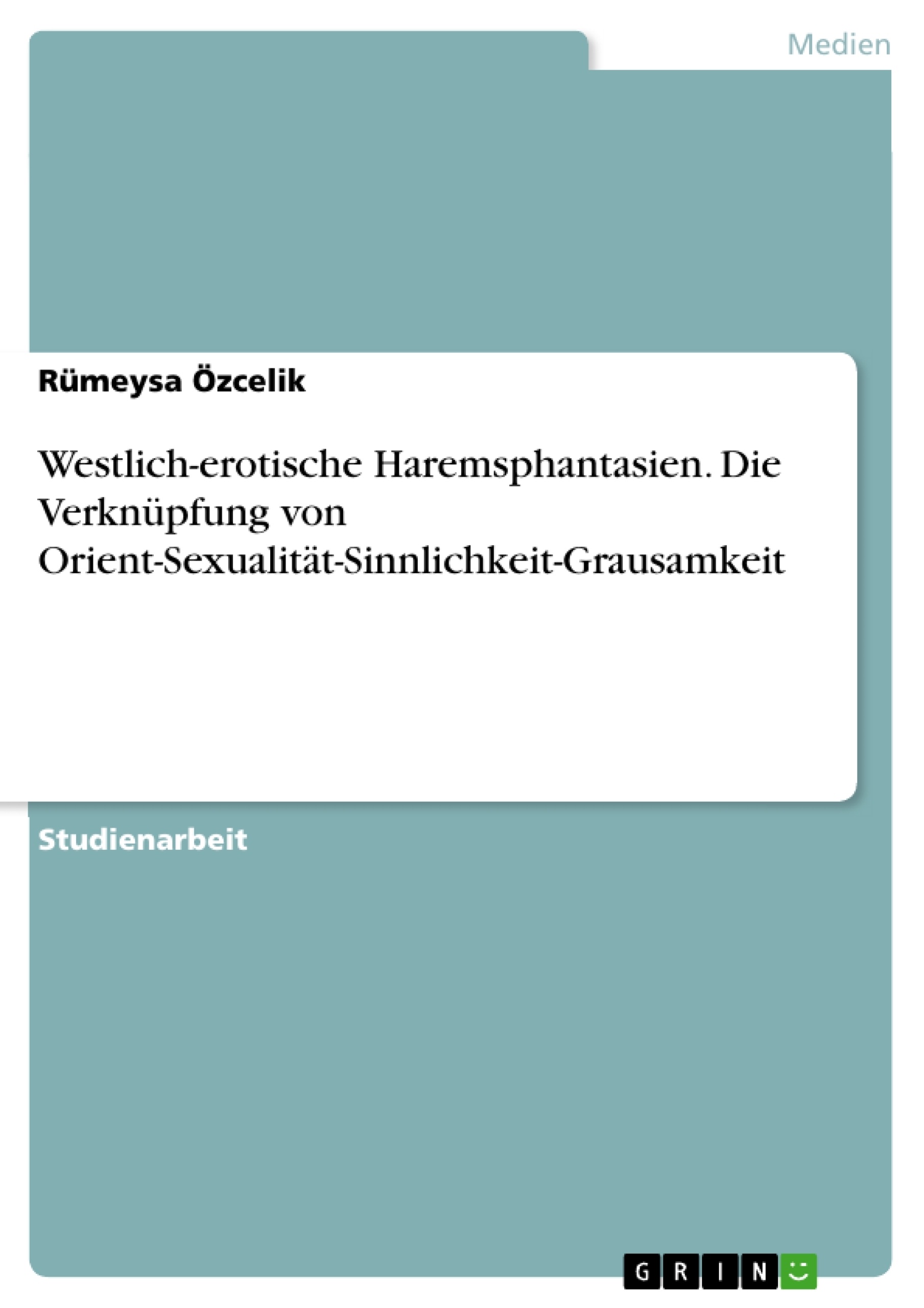Der Harem, ein Ort, der für einige Männer Wunder wahr werden lässt: sexuelle Wunscherfüllung, ohne Widerstand der Frauen, die zu Sklavinnen gemacht der Literatur, als auch in der Kunst wiederfinden. Die Arbeit beschäftigt sich mit westlich-erotisierten Haremsphantasien und deren Ursprung. Zu Beginn wird eine Malerei des 19.Jahrhunderts vorgestellt, um im weiteren Verlauf der Ausarbeitung die Phantasien und ihren Ursprung herauszuarbeiten. Es soll ein Bild darüber geschaffen werden, wie Kultur, Religion, Mentalität, Welt- und Selbstbildnis aufeinander Bezug nehmen, so Voreingenommenheit konstruieren können und durch Fremdtypisierung "das Andere" hervorbringt. Um ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie "das Andere" definiert werden kann, werden die religiösen Differenzen zwischen dem Christentum und dem Islam gegenübergestellt und unter anderem mit Koranversen belegt. Dabei wird auf die Mehrehe des Sultans und auf die Vorstellung des Harems als ein "Lustgemach" eingegangen. Zusätzlich werden die innere Motivation bzw. Bedürfnis des christlichen Westens und des islamischen Osten angerissen. Angemerkt sei, dass sich die ausgewählten Literaturen grundsätzlich auf das Osmanische Reich beschränken. Damit der Thematik neben den Fachliteraturen eine andere Art des Einblicks gewährt werden kann, kommt eine Autobiografie zum Einsatz. Dabei handelt es sich um das Buch: Harem - westliche Phantasien, östliche Wirklichkeit von Fatima Mernissi. Im Anschluss der Arbeit werden einzelne Bildelemente des Werkes "Die Haremsdienerin" von Trouillebert aufgegriffen und interpretiert, um die christlichen Phantasien zusammenzufassen und ein Resümee zu ziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- „Die Haremsdienerin“ 1874 von Paul-Désiré Trouillebert
- Das Leben einer Haremssklavin
- Der Weg in den Harem
- Die Ausbildung zur Haremssklavin
- Ihre Stellung in der Haremshierarchie
- Die „Vielweiberei“ des Sultans
- Die Schaffung eines christlichen Gegenbildes: Der Islam
- Der Harem: „ein reines Lustgemache des osmanischen Sultans“
- Der westlich-christliche und der östlich-islamische Harem
- Eine islamische Legitimation?
- Auswertung und Interpretation: „Die Haremsdienerin“ 1874 von Paul-Désiré Trouillebert
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert westlich-erotisierte Haremsphantasien und ihre Entstehungsgeschichte. Sie zeigt, wie Kultur, Religion, Mentalität und Selbstbildnis zur Konstruktion von Vorurteilen beitragen können und durch Fremdtypisierung „Das Andere“ hervorbringen.
- Die Darstellung von Haremsdamen in Kunst und Literatur
- Die Konstruktion von „Das Andere“ durch Fremdtypisierung
- Religiöse Differenzen zwischen Christentum und Islam
- Die Mehrehe des Sultans und der Harem als „Lustgemach“
- Die innere Motivation des christlichen Westens und des islamischen Ostens
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit beleuchtet westliche Haremsphantasien und deren Ursprung, indem sie eine Malerei des 19. Jahrhunderts als Ausgangspunkt nimmt.
- „Die Haremsdienerin“ 1874 von Paul-Désiré Trouillebert: Die Arbeit analysiert die Porträtmalerei „Die Haremsdienerin“ und beschreibt detailliert die Darstellung der weiblichen Figur, ihrer Kleidung und des Settings.
- Das Leben einer Haremssklavin: Dieser Abschnitt untersucht die Reise einer Haremssklavin, ihre Ausbildung und ihre Position innerhalb der Haremshierarchie.
- Die „Vielweiberei“ des Sultans: Dieser Teil der Arbeit beleuchtet die Vorstellung von der Mehrehe des Sultans und thematisiert die Konstruktion des Islams als christliches Gegenbild.
- Der westlich-christliche und der östlich-islamische Harem: Hier wird der Unterschied zwischen der christlichen und islamischen Sichtweise des Harems beleuchtet.
Schlüsselwörter
Haremsphantasien, Fremdtypisierung, Orientalismus, Kultur, Religion, Christentum, Islam, Mehrehe, Sultan, „Das Andere“, Selbstbildnis, Kunst, Literatur, Trouillebert, „Die Haremsdienerin“
- Citation du texte
- Rümeysa Özcelik (Auteur), 2020, Westlich-erotische Haremsphantasien. Die Verknüpfung von Orient-Sexualität-Sinnlichkeit-Grausamkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1477010