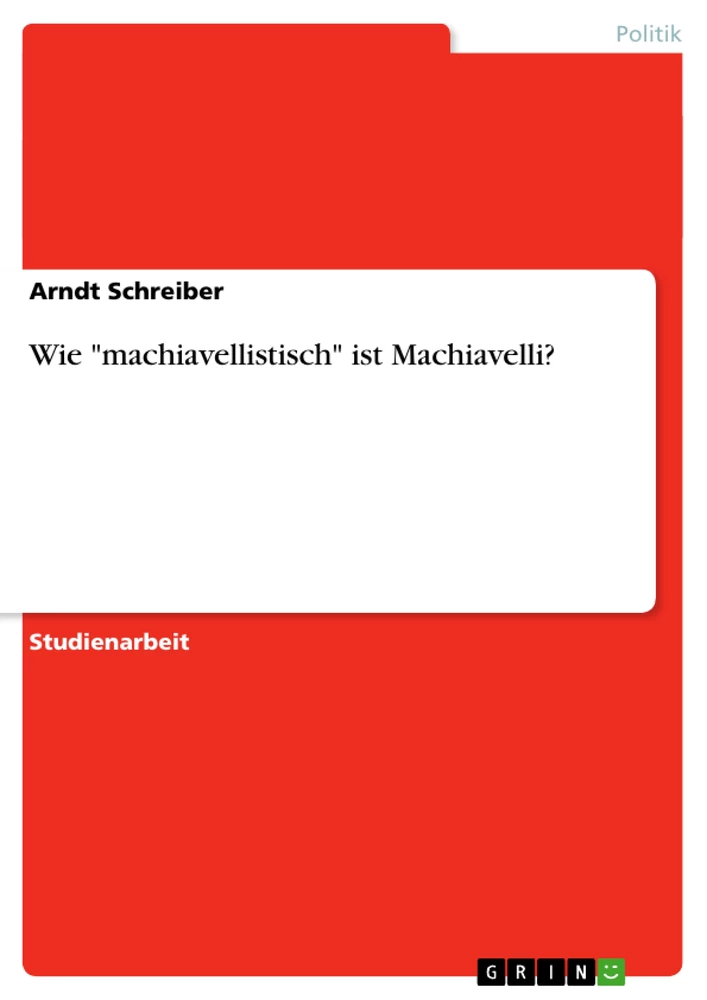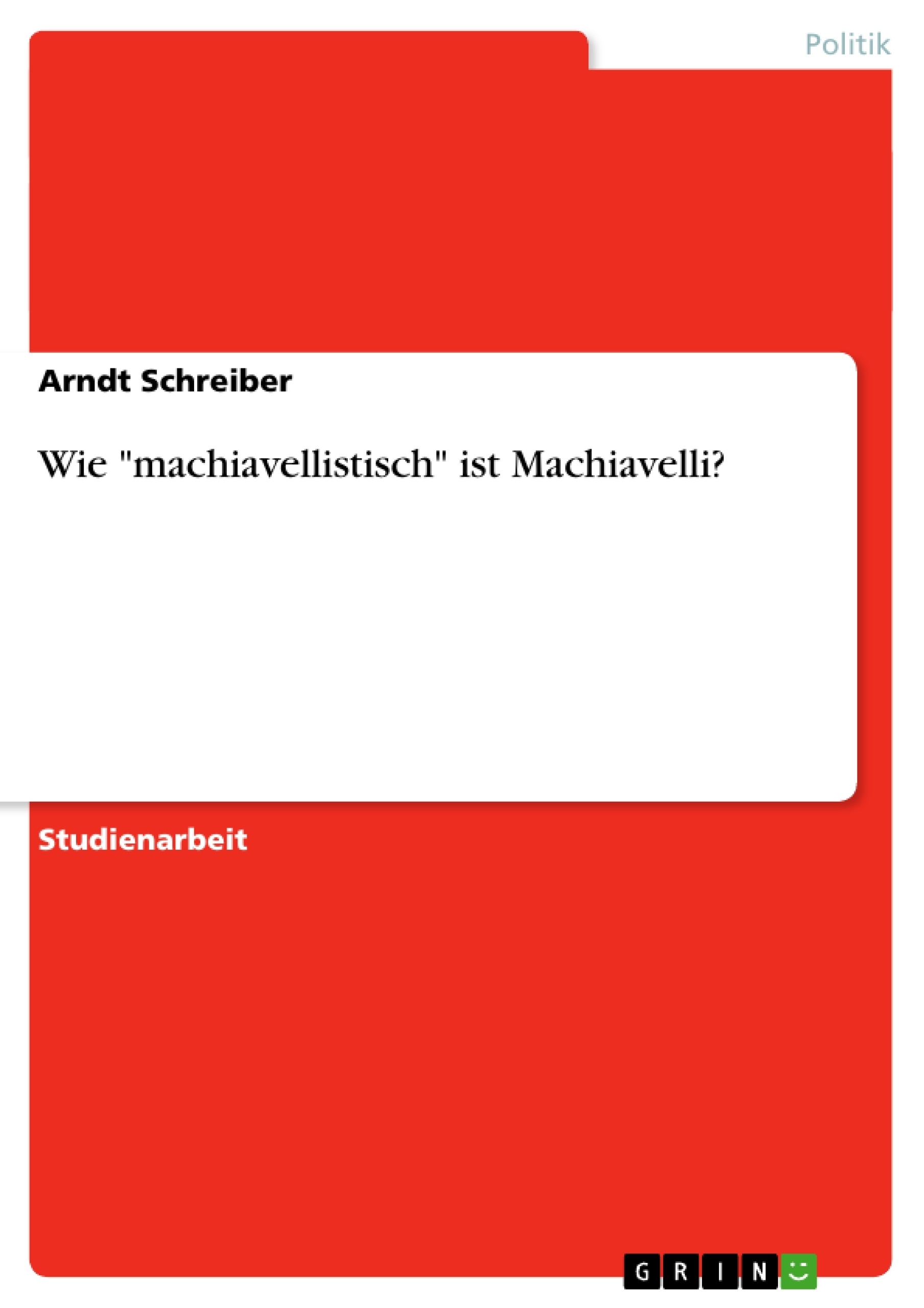[...] In nahezu allen europäischen Sprachen ist der Familienname
Niccolò Machiavellis zum „Epitheton für einen Schurken“1 geworden, und auch
seinem Vornamen erging es nicht besser: „Old Nick“ nennen die Engländer bis heute
scherzhaft-umgangssprachlich den Leibhaftigen selbst. Doch trifft solch zweifelhafter
Ruhm den Florentiner Staatsmann und Autor der berüchtigten Ratschläge an den „neuen
Fürsten“ zu Recht? Konnte sich tatsächlich erst durch seine politische Theorie das Verbrechen
der Politik bemächtigten? Oder etwas pointierter gefragt: Wie „machiavellistisch“
ist das Werk Machiavellis wirklich?
Zur Beantwortung dieser Frage sollen im dritten Kapitel dieser Arbeit die zwei vielleicht
am häufigsten wiederholten Thesen der Machiavelli-Kritik diskutiert werden. Das betrifft
zum einen den hier von René König erhobenen Vorwurf, Machiavellis Werk stehe für eine
„Umwertung der Werte“ und zum anderen die zuletzt von Leo Strauss vertretene Ansicht,
der Florentiner habe als „Lehrer des Bösen“ die Politik in Theorie und Praxis bis heute
korrumpiert und trage daher letztlich auch die Verantwortung für die Gewaltherrschaften
des 20. Jahrhunderts. Darüber hinaus gilt es das von Strauss als problematisch bewertete
Verhältnis Niccolò Machiavellis zur Religion im allgemeinen und zum Christentum im
besonderen etwas genauer zu untersuchen. Eine solche Erörterung setzt freilich die zuverlässige
Kenntnis der anthropologischen und geschichtstheoretischen Grundannahmen
dieses ersten Staatsphilosophen der Neuzeit voraus, deren knapper Skizzierung sich daher
das vorangehende zweite Kapitel widmen wird. Die beiden politisch-philosophischen
Hauptwerke Machiavellis, also der „Principe“ (1513) und die „Discorsi“ (1522) bildeten
bei der Fertigstellung dieser Arbeit die primäre Textgrundlage. Da die lange Zeit heftig
umstrittene Politikberatung des Florentiners wie kaum bei einem anderen Denker jener
Zeit jedoch nur vor dem Hintergrund seiner ganz unmittelbaren Krisenerfahrung zu
verstehen ist, wird sich das folgende erste Kapitel zunächst einmal deren skizzenhaften
Nachzeichnung zuwenden.
1 Macaulay, Thomas: Machiavelli, Heidelberg 1994, S. 4.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Die politische Krise Italiens als Ausgangspunkt
- 2. Machiavellis Weg zu einem neuen Verhältnis von Moral und Politik
- 2.1. Politik im Wirkungsdreieck von necessità, fortuna und virtù
- 2.2. Der principe nuovo als Retter des politischen Gemeinwesens
- 3. Die Selbsterhaltung des Staates als absolute politische Moral
- 3.1. Machiavellis Umwertung der Werte
- 3.2. Niccolò Machiavelli – Der Lehrer des Bösen?
- 3.3. „Ich liebe mein Vaterland mehr als meine Seele.“
- 4. Schlussbetrachtungen
- 5. Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Frage, inwiefern Niccolò Machiavellis Werk als „machiavellistisch“ bezeichnet werden kann, indem sie seine politischen Theorien im Kontext der italienischen Renaissance und der Krisen der Zeit beleuchtet. Die Analyse fokussiert auf die Kritik an Machiavellis vermeintlicher „Umwertung der Werte“ und seiner Rolle als „Lehrer des Bösen“. Zudem wird das Verhältnis Machiavellis zur Religion, insbesondere zum Christentum, näher beleuchtet.
- Die politische Krise Italiens im späten 15. Jahrhundert als Ausgangspunkt für Machiavellis politisches Denken
- Machiavellis Theorie von virtù, fortuna und necessità und ihre Bedeutung für das politische Handeln
- Die Rolle des „principe nuovo“ als Retter des Staates in Krisenzeiten
- Die Selbsterhaltung des Staates als absolute politische Moral und ihre Auswirkungen auf traditionelle Werte
- Die Kritik an Machiavellis angeblicher „Umwertung der Werte“ und seiner Rolle als „Lehrer des Bösen“
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die politische Krise Italiens im späten 15. Jahrhundert und die gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen, die Niccolò Machiavelli als Hintergrund seiner politischen Überlegungen erlebte. Es zeigt auf, wie die Wirtschaftskrise und die Machtkämpfe der italienischen Stadtstaaten die Republik Florenz in eine tiefe politische Krise stürzten und die traditionelle Ethik in Frage stellten.
Das zweite Kapitel beschreibt Machiavellis Theorie von virtù, fortuna und necessità und ihre Bedeutung für das politische Handeln. Es erläutert, wie Machiavelli den „principe nuovo“ als Retter des Staates in Krisenzeiten sah und welche Rolle die Selbsterhaltung des Staates in seinen politischen Überlegungen spielte.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Kritik an Machiavellis vermeintlicher „Umwertung der Werte“ und seiner Rolle als „Lehrer des Bösen“. Es untersucht, inwiefern Machiavellis Theorien tatsächlich eine Umdeutung von Moral und Politik darstellen und welche Verantwortung ihm für die Gewaltherrschaften des 20. Jahrhunderts zugeschrieben wird. Zudem wird das Verhältnis Machiavellis zur Religion, insbesondere zum Christentum, genauer betrachtet.
Schlüsselwörter
Machiavelli, Politik, Moral, virtù, fortuna, necessità, principe nuovo, Staat, Selbsterhaltung, Renaissance, Italien, Krise, „Umwertung der Werte“, „Lehrer des Bösen“, Religion, Christentum
- Quote paper
- Arndt Schreiber (Author), 2003, Wie "machiavellistisch" ist Machiavelli?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14757