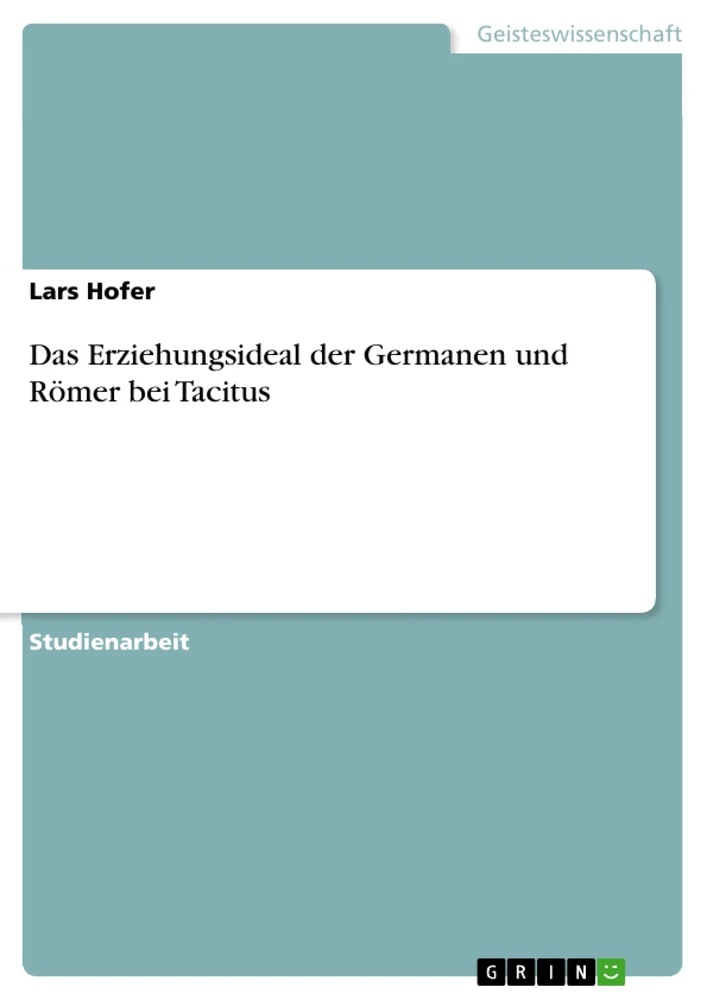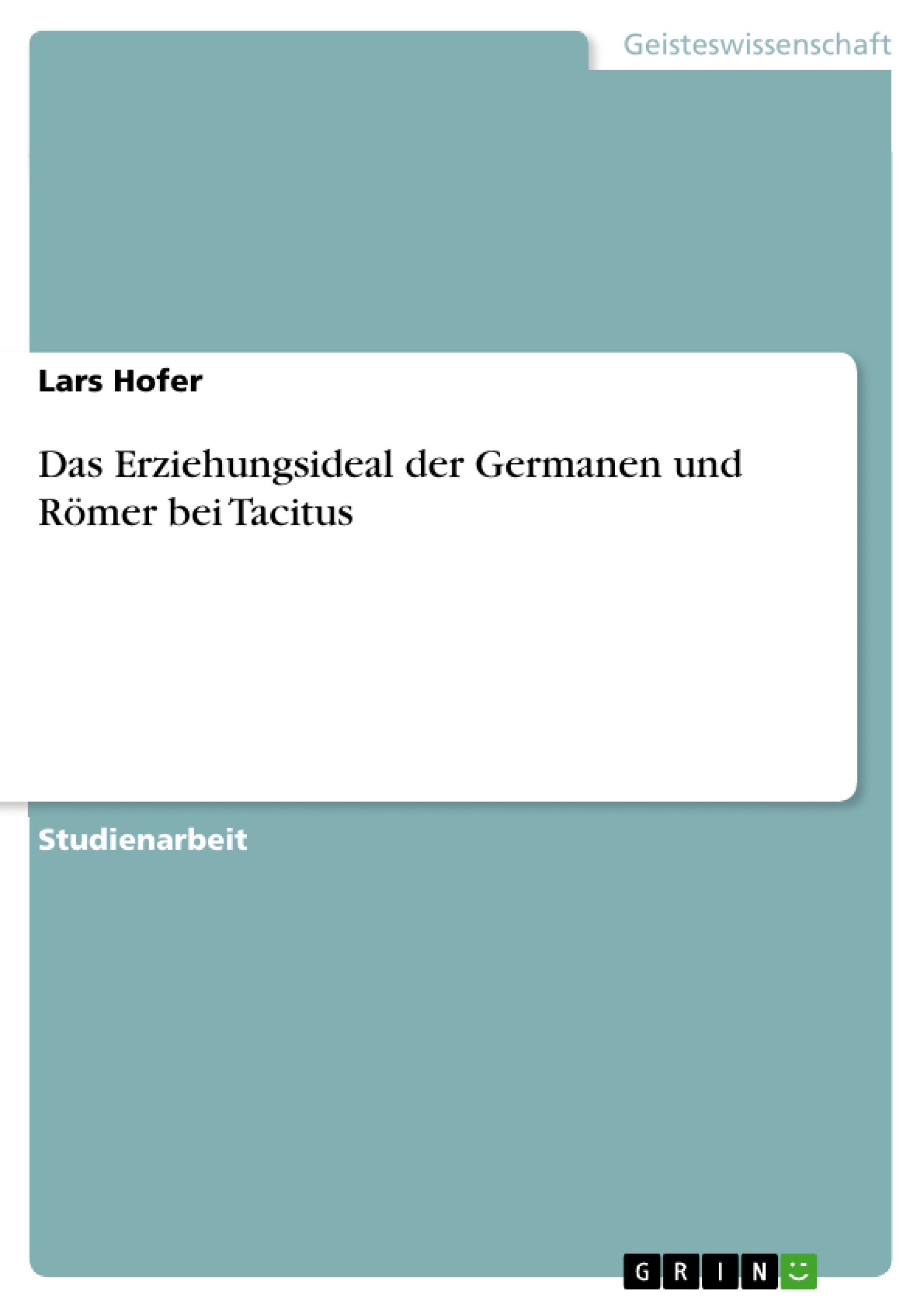Die verschiedenen Bilder von Erziehung, die Tacitus zum einen von den Germanen und zum anderen von den Römern skizziert, sollen in dieser Arbeit anhand Tac. Germ. 20,1.1 und Tac. Dial. 29,1.1 verglichen werden. Dabei werden zunächst die verschiedenen Erziehungsmethoden erörtert und mit Hilfe der Textkritik auf sprachlicher und stilistischer Basis kontrastiert. Hierzu werden die Motive Tacitus‘ im Hinblick auf seinen persönlichen Hintergrund erarbeitet und in Relation zum historischen Kontext gesetzt. Der wissenschaftliche Kern, des von Tacitus selbst möglicherweise subjektiv gezeichneten Bildes, soll so zu einem objektiven herausgearbeitet werden. Dabei soll als Arbeitshypothese gelten, dass es sich bei dem Dialogus de oratoribus um eine taceteische Schrift handelt, dessen Annahme sich bewährt hat, obwohl die Verfasserfrage bis heute nicht strikt bewiesen ist. Die folgende Analyse befasst sich mit Tac. Germ. 20.1.1, durch dessen Interpretation im Vergleich mit Tac. Dial. 29,1.1 Gemeinsamkeiten und jeweilige Unterschiede aufgezeigt, speziell aber die verschiedenen eigentümlichen Charakteristika untersucht werden sollen.
Sowohl in seiner ethnographischen Schrift „De ritu, situ, moribus et condicione Germaniae descriptio“ (Germania) als auch in seinem „Dialogus de oratoribus“ befasst sich Publius Cornelius Tacitus in kurzen Episoden mit dem Thema Erziehung, woran der sittliche, geistige und politische Verfall der Republik erklärt werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Vergleich von Tac. Germ. 20,1.1 und Tac. Dial. 29,1.1
- 1. Übersetzung von Tac. Germ. 20,1.1
- 2. Interpretation
- III. Schluss
- IV. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, die unterschiedlichen Erziehungsideale bei den Germanen und Römern, wie sie Tacitus in seinen Werken "Germania" und "Dialogus de oratoribus" darstellt, zu vergleichen und zu analysieren. Im Zentrum steht dabei die Gegenüberstellung von Tac. Germ. 20,1.1 und Tac. Dial. 29,1.1.
- Vergleich der Erziehungsmethoden bei den Germanen und Römern
- Analyse der Motive und des historischen Kontextes von Tacitus' Darstellung
- Kontrast der sprachlichen und stilistischen Besonderheiten der beiden Texte
- Untersuchung der unterschiedlichen Charakteristika der germanischen und römischen Erziehung
- Herausarbeitung des wissenschaftlichen Kerns von Tacitus' subjektivem Bild der Erziehung
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Diese Einleitung stellt das Thema der Arbeit - die Analyse von Tac. Germ. 20,1.1 und Tac. Dial. 29,1.1 im Kontext des Erziehungsideals der Germanen und Römer - vor. Zudem werden die Ziele und die Methode der Arbeit erläutert, die auf einen Vergleich der beiden Textstellen abzielt.
II. Vergleich von Tac. Germ. 20,1.1 und Tac. Dial. 29,1.1
1. Übersetzung von Tac. Germ. 20,1.1
Die Übersetzung von Tac. Germ. 20,1.1 liefert den Textgrundlage für den Vergleich und die Interpretation.
2. Interpretation
a. Germania
Dieser Abschnitt analysiert die Darstellung der Erziehung bei den Germanen in Tac. Germ. 20,1.1. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der Lebensumstände der Kinder und deren Verhältnis zu den Erwachsenen.
b. Dialogus
Dieser Abschnitt befasst sich mit der Gegenüberstellung der Darstellung der römischen Erziehung in Tac. Dial. 29,1.1 zu den germanischen Gepflogenheiten. Hier werden die Unterschiede in den jeweiligen Erziehungsmethoden beleuchtet.
c. Motive der Germania und des Dialogus
In diesem Abschnitt werden die Motive von Tacitus in beiden Werken, insbesondere im Hinblick auf die unterschiedlichen Erziehungspraktiken, analysiert. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Rolle der Mutter, der Sklaven und der gesellschaftlichen Hierarchien in beiden Texten.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Tacitus, Erziehungsideal, Germanen, Römer, Germania, Dialogus de oratoribus, Textkritik, sprachliche und stilistische Analyse, Motive, Historischer Kontext, Vergleich, Gemeinsamkeiten, Unterschiede.
- Quote paper
- Lars Hofer (Author), 2014, Das Erziehungsideal der Germanen und Römer bei Tacitus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1474512