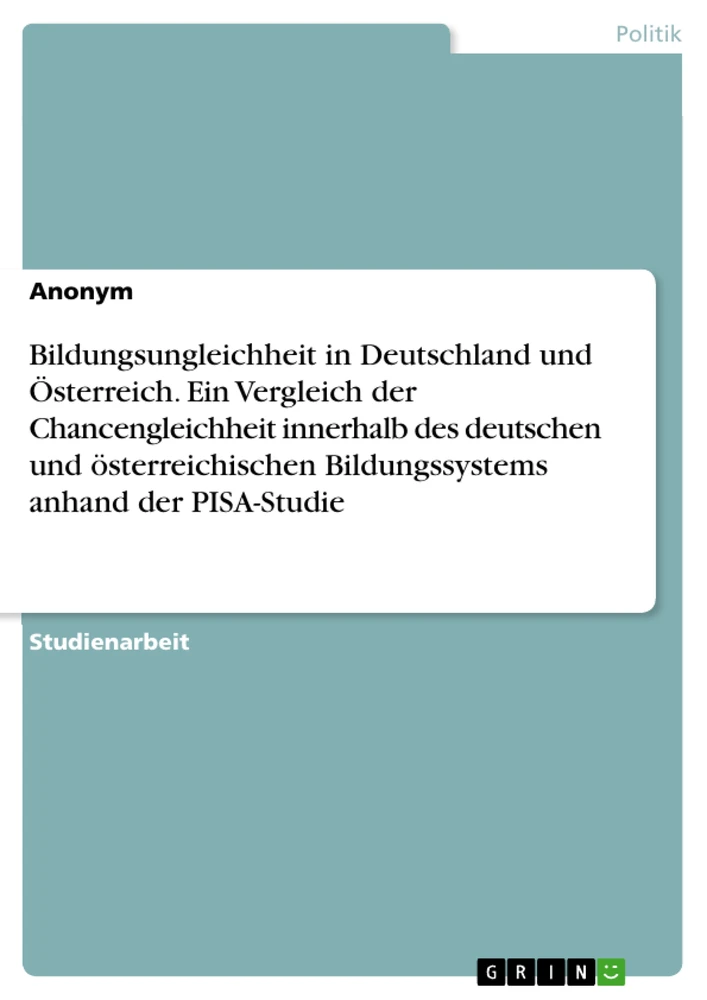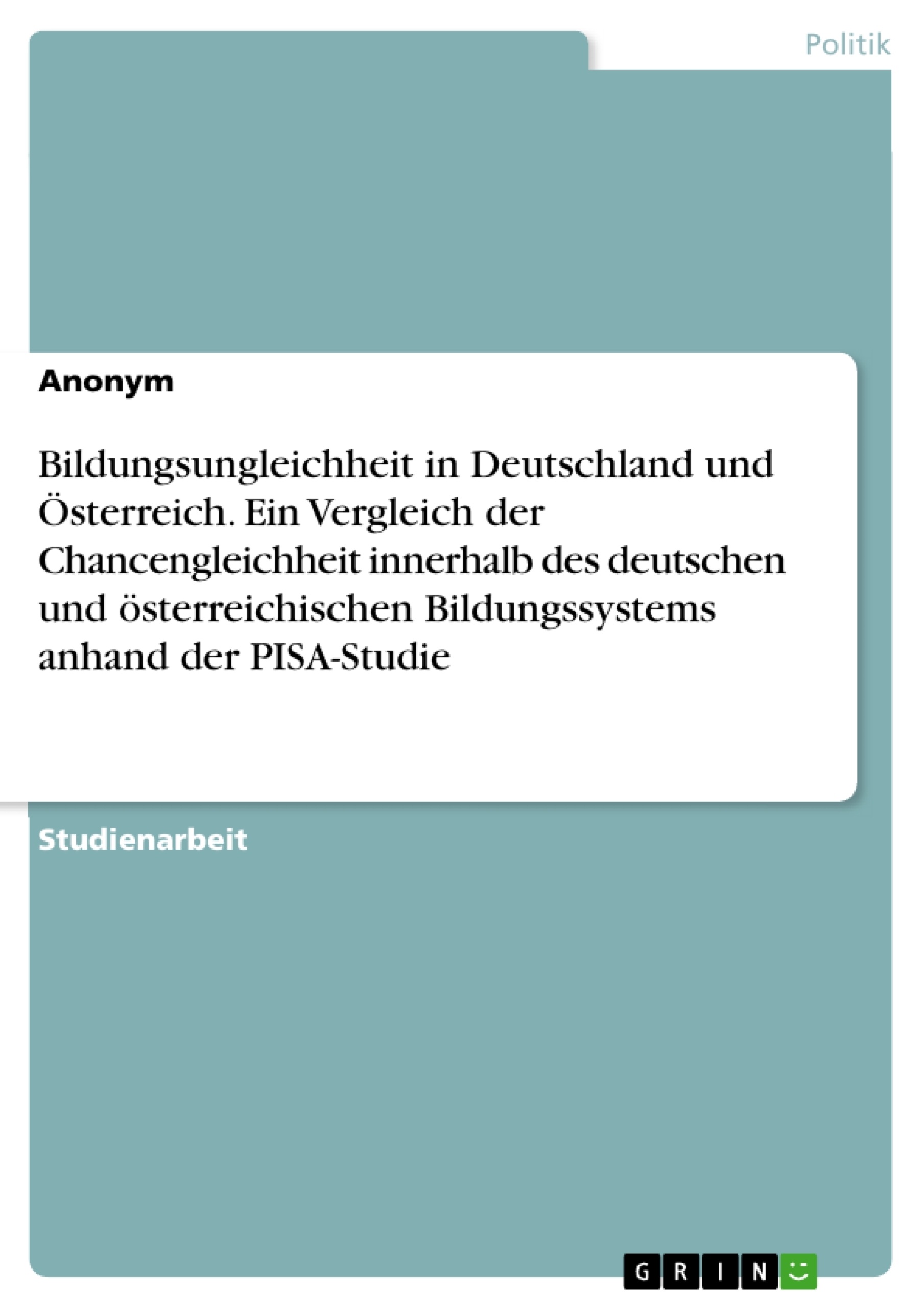Die vorliegende Arbeit untersucht die Bildungssysteme Deutschlands und Österreichs im Kontext der Ergebnisse der PISA-Studie. PISA, das Programm zur internationalen Schülerbewertung, wurde seit 2000 in mehr als 70 Ländern durchgeführt und zielt darauf ab, die Kompetenzen von fünfzehnjährigen Schülern in verschiedenen Bereichen zu messen.
Die Ergebnisse der PISA-Studie dienen als Grundlage für die Analyse der Bildungschancen und -ungleichheiten in beiden Ländern. Es wird ein Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Hintergrund der Schüler und ihren Leistungen in naturwissenschaftlichen Kompetenzen aufgezeigt. Dabei zeigt sich, dass trotz formaler Bemühungen um Chancengleichheit die sozialen und ökonomischen Unterschiede zwischen den Schülern weiterhin eine Rolle spielen.
Im deutschen Schulsystem werden strukturelle Herausforderungen wie die Vielfalt der Schulformen und die föderale Struktur beleuchtet. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Auswahlverfahren nach der Grundschule und den finanziellen Ungleichheiten zwischen den Bundesländern.
Das österreichische Schulsystem, obwohl ähnlich dem deutschen, weist seine eigenen Besonderheiten auf, darunter die zentralisierte Bildungspolitik und die Einführung der Neuen Mittelschulen als Versuch, die Chancengerechtigkeit zu erhöhen.
Insgesamt verdeutlicht die Arbeit, dass trotz der Bemühungen um Verbesserung der Bildungschancen in beiden Ländern weiterhin Herausforderungen bestehen, die eine umfassende Reform des Schulsystems erfordern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theorie
- 2.1 Definition der Chancengleichheit
- 2.2 „Die Illusion der Chancengleichheit“ nach Bourdieu und Passeron
- 2.3 Hypothese
- 3. Das Forschungsdesign der PISA-Studie
- 4. Die Schulsysteme im Vergleich
- 4.1 Das deutsche Schulsystem
- 4.1.1 Kritik am deutschen Schulsystem
- 4.2 Das österreichische Schulsystem
- 4.2.1 Kritik am österreichischen Schulsystem
- 4.1 Das deutsche Schulsystem
- 5. Die Ergebnisse der PISA-Studie
- 5.1 Deutschland
- 5.2 Österreich
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Chancengleichheit im deutschen und österreichischen Bildungssystem anhand der PISA-Studie. Ziel ist es, die Gründe für die festgestellten Chancengleichheitsdefizite zu analysieren und mögliche Ursachen im Aufbau der jeweiligen Schulsysteme zu identifizieren. Der Vergleich beider Systeme ermöglicht die Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden hinsichtlich der sozialen Disparitäten im Bildungserfolg.
- Chancengleichheit im Bildungssystem
- Vergleich des deutschen und österreichischen Schulsystems
- Analyse der PISA-Studie Ergebnisse
- Soziale Disparitäten im Bildungserfolg
- Einflussfaktoren auf die Chancengleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Chancengleichheit im deutschen und österreichischen Bildungssystem ein, ausgehend von den Ergebnissen der PISA-Studie 2016. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Ursachen der festgestellten Defizite und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit: theoretische Fundierung, Systemvergleich und empirische Analyse der PISA-Daten. Die Wahl von Deutschland und Österreich als Fallbeispiele wird mit der sprachlichen und kulturellen Nähe begründet. Der Fokus liegt auf der Identifizierung von Faktoren, die zu Chancenungleichheit im Bildungssystem beitragen.
2. Theorie: Dieses Kapitel legt den theoretischen Rahmen der Arbeit fest. Es beginnt mit einer Definition von Chancengleichheit, die zwischen formalen und substanziellen Aspekten unterscheidet. Anschließend wird Bourdieus Konzept der „Illusion der Chancengleichheit“ eingeführt, um die komplexen sozialen Mechanismen hinter Bildungsungleichheit zu beleuchten. Die Kapitel etabliert ein theoretisches Verständnis von Chancengleichheit, welches für die spätere Analyse der empirischen Daten essenziell ist, indem es die soziale Ungleichheit in Bildungsstrukturen in den Mittelpunkt stellt.
3. Das Forschungsdesign der PISA-Studie: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik und das Design der PISA-Studie, die als empirische Grundlage der Arbeit dient. Es beleuchtet die Erhebungsmethoden und die Art und Weise der Datengewinnung und -analyse, um die Aussagekraft und die Grenzen der Studie zu evaluieren. Das Verständnis des Forschungsdesigns ist wichtig, um die Ergebnisse und Schlussfolgerungen der PISA-Studie kritisch zu bewerten und im Kontext der Arbeit einzuordnen.
4. Die Schulsysteme im Vergleich: Dieses Kapitel vergleicht das deutsche und österreichische Schulsystem. Es beschreibt die jeweiligen Strukturen, Organisation und curricularen Inhalte und analysiert kritische Punkte beider Systeme, die möglicherweise zu Chancengleichheitsdefiziten beitragen könnten. Die Kapitel identifiziert Unterschiede in der Struktur und Organisation der beiden Schulsysteme, die zu einer unterschiedlichen Verteilung von Bildungschancen führen können.
5. Die Ergebnisse der PISA-Studie: Dieses Kapitel präsentiert und interpretiert die relevanten Ergebnisse der PISA-Studie für Deutschland und Österreich. Es fokussiert auf die Daten, die die Chancengleichheit betreffen, und analysiert diese im Lichte der vorherigen theoretischen und systematischen Analysen. Der Vergleich der nationalen Ergebnisse ermöglicht es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den jeweiligen Chancengleichheitsdefiziten zu identifizieren.
Schlüsselwörter
Chancengleichheit, Bildungsungleichheit, PISA-Studie, Deutschland, Österreich, Schulsystem, sozialer Hintergrund, Bourdieu, soziale Disparitäten, Bildungserfolg.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Chancengleichheit im deutschen und österreichischen Bildungssystem
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Chancengleichheit im deutschen und österreichischen Bildungssystem anhand der Ergebnisse der PISA-Studie. Der Fokus liegt auf der Identifizierung von Ursachen für festgestellte Chancengleichheitsdefizite und dem Vergleich der beiden Schulsysteme hinsichtlich sozialer Disparitäten im Bildungserfolg.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Chancengleichheit im Bildungssystem, Vergleich des deutschen und österreichischen Schulsystems, Analyse der PISA-Studie Ergebnisse, soziale Disparitäten im Bildungserfolg und Einflussfaktoren auf die Chancengleichheit. Es wird eine theoretische Fundierung mit Bourdieus Konzept der „Illusion der Chancengleichheit“ vorgenommen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Theorie (inkl. Definition von Chancengleichheit und Bourdieus Konzept), Forschungsdesign der PISA-Studie, Vergleich der deutschen und österreichischen Schulsysteme (inkl. Kritik an beiden Systemen), Ergebnisse der PISA-Studie für Deutschland und Österreich und ein Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet einen quantitativ-vergleichenden Ansatz. Die empirische Grundlage bildet die PISA-Studie. Das Forschungsdesign der PISA-Studie wird detailliert beschrieben, um die Aussagekraft und Grenzen der Studie zu evaluieren. Die Ergebnisse werden im Lichte der theoretischen Fundierung und des Systemvergleichs interpretiert.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert und interpretiert relevante Ergebnisse der PISA-Studie für Deutschland und Österreich bezüglich Chancengleichheit. Der Fokus liegt auf Daten, die soziale Disparitäten im Bildungserfolg aufzeigen. Ein Vergleich der nationalen Ergebnisse ermöglicht die Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in den Chancengleichheitsdefiziten.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und zieht Schlussfolgerungen hinsichtlich der Ursachen von Chancengleichheitsdefiziten in den beiden Bildungssystemen. Es werden mögliche Erklärungen für die festgestellten Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Bildungserfolg unter Berücksichtigung der jeweiligen Schulsystemstrukturen geliefert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Chancengleichheit, Bildungsungleichheit, PISA-Studie, Deutschland, Österreich, Schulsystem, sozialer Hintergrund, Bourdieu, soziale Disparitäten, Bildungserfolg.
Welche theoretische Grundlage wird verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Theorie der Chancengleichheit und das Konzept der „Illusion der Chancengleichheit“ nach Bourdieu und Passeron. Dieses Konzept wird verwendet, um die komplexen sozialen Mechanismen hinter Bildungsungleichheit zu beleuchten und die empirischen Ergebnisse zu interpretieren.
Warum werden Deutschland und Österreich verglichen?
Die Wahl von Deutschland und Österreich als Fallbeispiele wird mit der sprachlichen und kulturellen Nähe begründet, um einen vergleichenden Einblick in ähnliche, aber dennoch unterschiedlich strukturierte Bildungssysteme zu ermöglichen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Bildungsungleichheit in Deutschland und Österreich. Ein Vergleich der Chancengleichheit innerhalb des deutschen und österreichischen Bildungssystems anhand der PISA-Studie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1474258