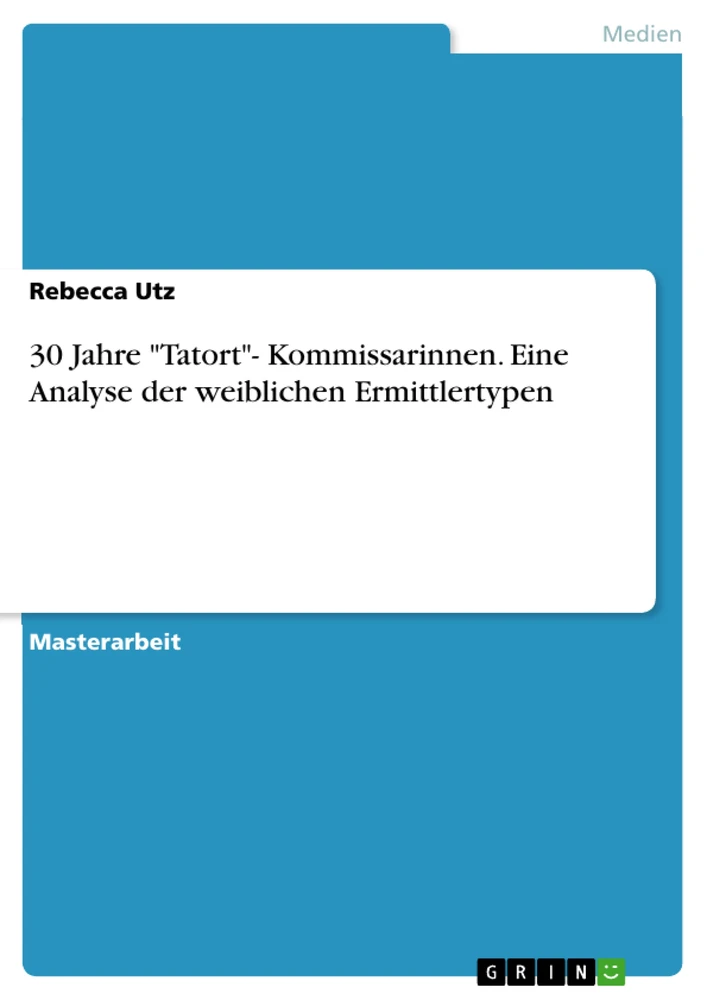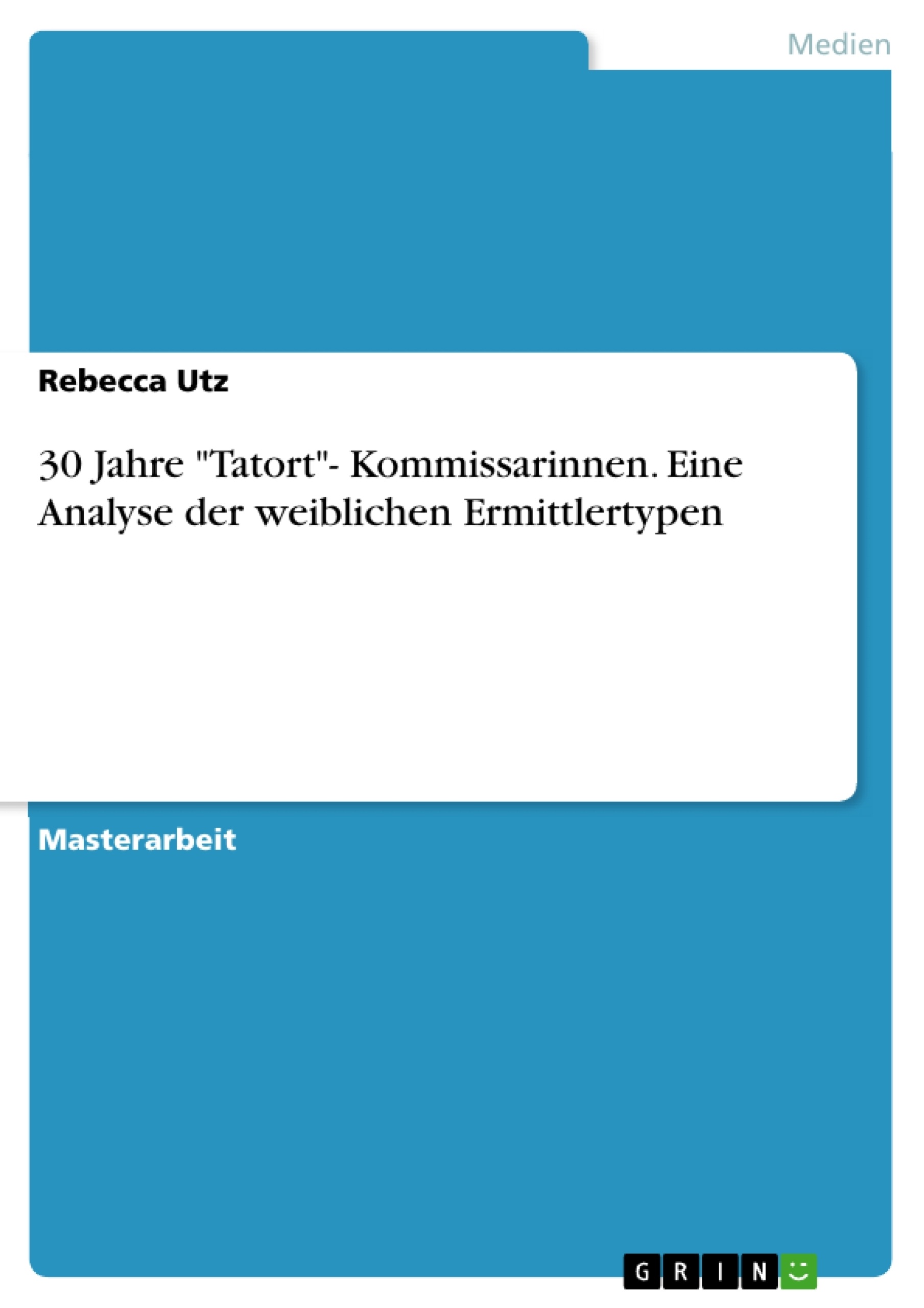Mit seiner ersten Folge Taxi nach Leipzig markierte der Tatort am 29. November 1970 den Startpunkt, von dem aus er im Verlauf von mehr als drei Jahrzehnten und mehr als 600 Folgen bis heute immer noch Fernseh- und Krimigeschichte schreibt. Ziel dieser Untersuchung ist es, diesen Fragen nachzugehen und am Beispiel der Tatort- Kommissarinnen herauszuarbeiten, welche Veränderungen, Entwicklungen und Neuerungen die weiblichen Ermittlertypen von 1978 bis heute durchlaufen haben. Hierbei wird zu ergründen sein, welche Rahmenbedingungen für die jeweiligen Figurenprofile prägend waren beziehungsweise sind. Unerlässlich ist dabei, den jeweiligen zeitgenössischen Kontext im Blick zu behalten, da der Tatort mehr ist als nur ein „Hort deutscher Fernsehkultur“. Wenzel geht sogar so weit zu sagen, dass es wahrscheinlich kein zuverlässigeres Archiv gibt, das die Gegenwartsgeschichte der Bundesrepublik begleitet hat, als die populäre Krimireihe Tatort. In seiner Funktion als unbewusster Geschichtsschreiber ist er für Wenzel außerdem eine Art „populäres Gedächtnis unserer Gegenwartskultur“. So wie der Tatort in diesem Sinne durch seinen Bezug auf die gesellschaftliche Wirklichkeit als Spiegel der Gesellschaft aufgefasst werden kann, so können auch die Tatort-Kommissarinnen stellvertretend als Spiegel der Frauen ihrer Zeit verstanden werden.
Die Untersuchung wird diesbezüglich aufzeigen, dass die Konzeption der weiblichen Ermittlertypen von 1978 bis in die 90er Jahre maßgeblich geprägt war vom Geschlechterdiskurs der Emanzipationsbewegung und deren Errungenschaften für die Frauen, insbesondere im Bereich der Polizei. Des Weiteren wird die Untersuchung die Situation der weiblichen Ermittlertypen seit den 90er Jahren beleuchten und ergründen, inwiefern hier vor allem die Umwälzungen im Medienbereich mit den sich wandelnden Produktions- und Rezeptionsbedingungen (ausgelöst durch die Dualisierung des Rundfunksystems in den 80er Jahren) zu entscheidenden Neuerungen bei den Figurenkonzepten der Kommissarinnen führten.
Die Analyse der weiblichen Ermittlertypen versteht sich in erster Linie als Beschäftigung mit den sich wandelnden Weiblichkeitsdarstellungen. Sie bewegt sich damit im Spannungsverhältnis zwischen Fernseh- und Außenrealität, denn als fiktive Figuren sind die Kommissarinnen keine Eins-zu-eins-Nachbildungen der Realität, sondern vielmehr mediale Zerrbilder beziehungsweise Idealbilder der Frauen ihres jeweiligen zeitlichen Kontextes.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thema und Fragestellung
- Forschungsstand
- Auswahl und Analyse der Folgen
- Aufbau der Untersuchung
- Korrelationen zwischen Fernseh- und Außenrealität
- Das Massenmedium Fernsehen: ein Agent der Geschlechtsrollenstereotypisierung
- Der Fernsehkrimi: ein leicht adaptierbares, standardisiertes Erfolgsgenre
- Der „Tatort“: eine Krimireihe mit programmatischen Leitlinien
- Die Kommissarinnen im „Tatort“ und ihr Bruch mit tradierten Rollenmustern
- Das Bild der Fernsehfrau in den 70er Jahren
- Das Bild der Ermittlerinnen in den frühen Fernsehkrimis
- Überblick zu den Fernsehkrimiserien der 60er und 70er Jahre
- Zusammenfassung zu den Rollenmodellen der Serienheldinnen
- Warum gelingt gerade den Kommissarinnen der Bruch?
- Prinzipielle Eigenschaften einer Kommissarinnen-Figur
- Orientierung an der Außenrealität aufgrund des Realitätsprinzips
- Mehr Gleichberechtigung: Frauen bekommen Zugang zur Schutzpolizei
- Formale Gleichberechtigung vs. „Token-Dynamik“
- Erste Station: Pionierinnen Buchmüller und Wiegand
- Figurengestaltung der Marianne Buchmüller
- Figurengestaltung der Hanne Wiegand
- Thematisierung des Geschlechterdiskurses
- Beispiele bei Buchmüller
- Beispiele bei Wiegand
- Buchmüller und Wiegand: vorfeministische Ermittlertypen
- Zweite Station: Der Durchbruch mit Odenthal
- Figurengestaltung der Lena Odenthal
- Neuerungen im Ermittlertyp: von der Krimi-Mutti zur „POLICE-Woman“
- Lena Odenthal: der feministische Ermittlertyp
- Dritte Station: Kommissarinnen-Boom der 90er Jahre
- Lena Odenthal bekommt Verstärkung
- Wie lässt sich der Kommissarinnen-Boom erklären?
- Auswirkungen des dualen Rundfunksystems
- Figurenbeispiele anderer TV-Ermittlerinnen
- Die Kommissarin
- Rosa Roth
- Bella Block
- Doppelter Einsatz
- Figurengestaltung der Inga Lürsen
- Inga Lürsen: Entwurf eines differenzierten Frauenbildes
- Lürsen & Co: Modelle verschiedener Lebensstilkonzepte
- Typenviefalt und „Ermittlergeschichten“
- Typen-Vielfalt gleich Frauen-Vielfalt?
- Vierte Station: Das neue Jahrtausend und die „Turbo-Power-Frau“
- Die „zweite Welle“ der „Tatort“-Kommissarinnen: Blum, Sänger und Lindholm
- Figurengestaltungen der „zweiten Welle“
- Klara Blum
- Charlotte Sänger
- Charlotte Lindholm
- Der „weibliche Columbo“ des NDR
- Der NDR-„Landhauskrimi“
- Charlotte Lindholm: erotische Einzelkämpferin und Mutter
- Die Lindholm-Faszination
- Typen- und Frauenvielfalt heute: starke Frauen, schwache Männer?
- Gemeinsamkeiten der „Tatort“-Kommissarinnen
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Entwicklung der weiblichen Ermittlertypen im „Tatort“. Sie analysiert die Darstellung von Kommissarinnen im Laufe der letzten 30 Jahre und untersucht die Veränderungen im Frauenbild, die sich in dieser Entwicklung widerspiegeln.
- Entwicklung des Frauenbildes im „Tatort“
- Vergleich zwischen Fernseh- und Außenrealität
- Analyse der Kommissarinnen-Figuren
- Einfluss von gesellschaftlichen Entwicklungen auf die Figuren
- Geschlechterdiskussion in der Krimi-Serie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema und die Fragestellung der Arbeit vor, erläutert den Forschungsstand und die Auswahl der analysierten Folgen, sowie den Aufbau der Untersuchung.
Das zweite Kapitel betrachtet die Korrelation zwischen Fernseh- und Außenrealität und beleuchtet die Rolle des Fernsehens als Agent der Geschlechtsrollenstereotypisierung. Außerdem wird die Rolle des Fernsehkrimis als leicht adaptierbares Genre und die Programmatischen Leitlinien des „Tatorts“ näher untersucht.
Kapitel 3 analysiert das Bild der Kommissarinnen im „Tatort“ und ihren Bruch mit tradierten Rollenmustern. Es betrachtet das Bild der Fernsehfrau in den 70er Jahren und die Rolle der Ermittlerinnen in den frühen Fernsehkrimis. Abschließend wird untersucht, warum gerade den Kommissarinnen der Bruch mit traditionellen Rollenmodellen gelingt.
Kapitel 4 befasst sich mit den ersten beiden „Tatort“-Kommissarinnen, Marianne Buchmüller und Hanne Wiegand. Es analysiert ihre Figurengestaltungen und die Thematisierung des Geschlechterdiskurses in den jeweiligen Folgen.
Im fünften Kapitel steht die Kommissarin Lena Odenthal im Fokus. Es wird ihre Figurengestaltung, die Neuerungen im Ermittlertyp und ihr feministisches Profil untersucht.
Kapitel 6 widmet sich dem Kommissarinnen-Boom der 90er Jahre. Es betrachtet Lena Odenthals Verstärkung durch weitere Kommissarinnen und erklärt den Boom anhand des dualen Rundfunksystems. Des Weiteren werden Figurenbeispiele anderer TV-Ermittlerinnen vorgestellt und die Figurengestaltung der Inga Lürsen analysiert.
Das siebte Kapitel beschäftigt sich mit den „Tatort“-Kommissarinnen des neuen Jahrtausends: Klara Blum, Charlotte Sänger und Charlotte Lindholm. Es analysiert ihre Figurengestaltungen und untersucht die Lindholm-Faszination.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Masterarbeit sind: „Tatort“, Kommissarinnen, Frauenbild, Geschlechterrollenstereotypisierung, Fernsehkrimi, Feminismus, Ermittlertypen, Realitätsprinzip, Medienanalyse, Kulturgeschichte.
- Quote paper
- Master Rebecca Utz (Author), 2008, 30 Jahre "Tatort"- Kommissarinnen. Eine Analyse der weiblichen Ermittlertypen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1474060