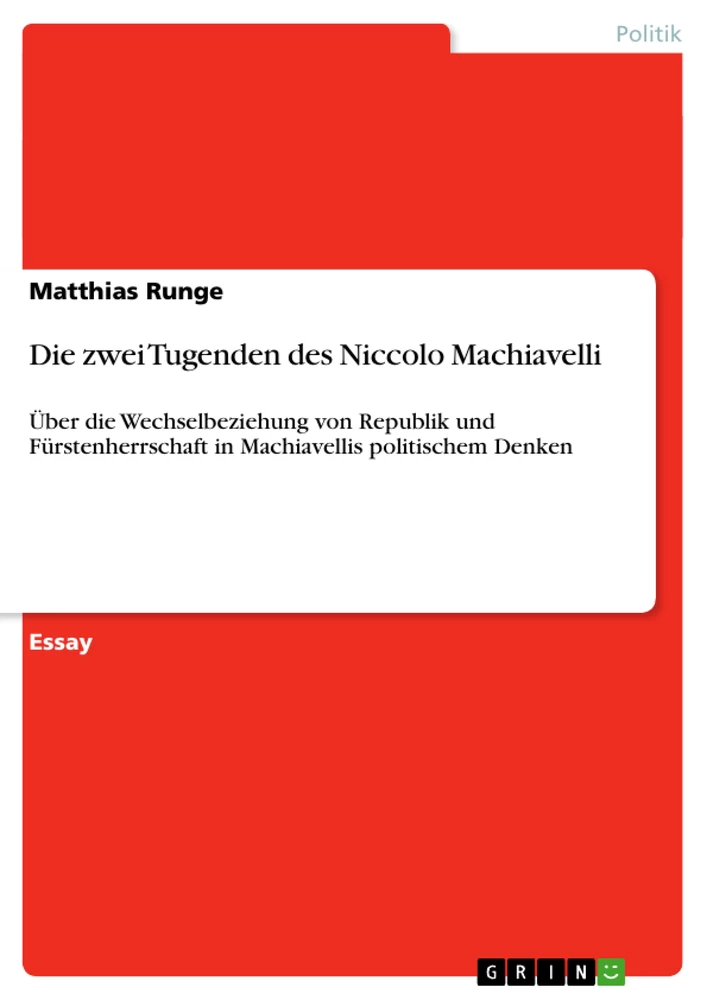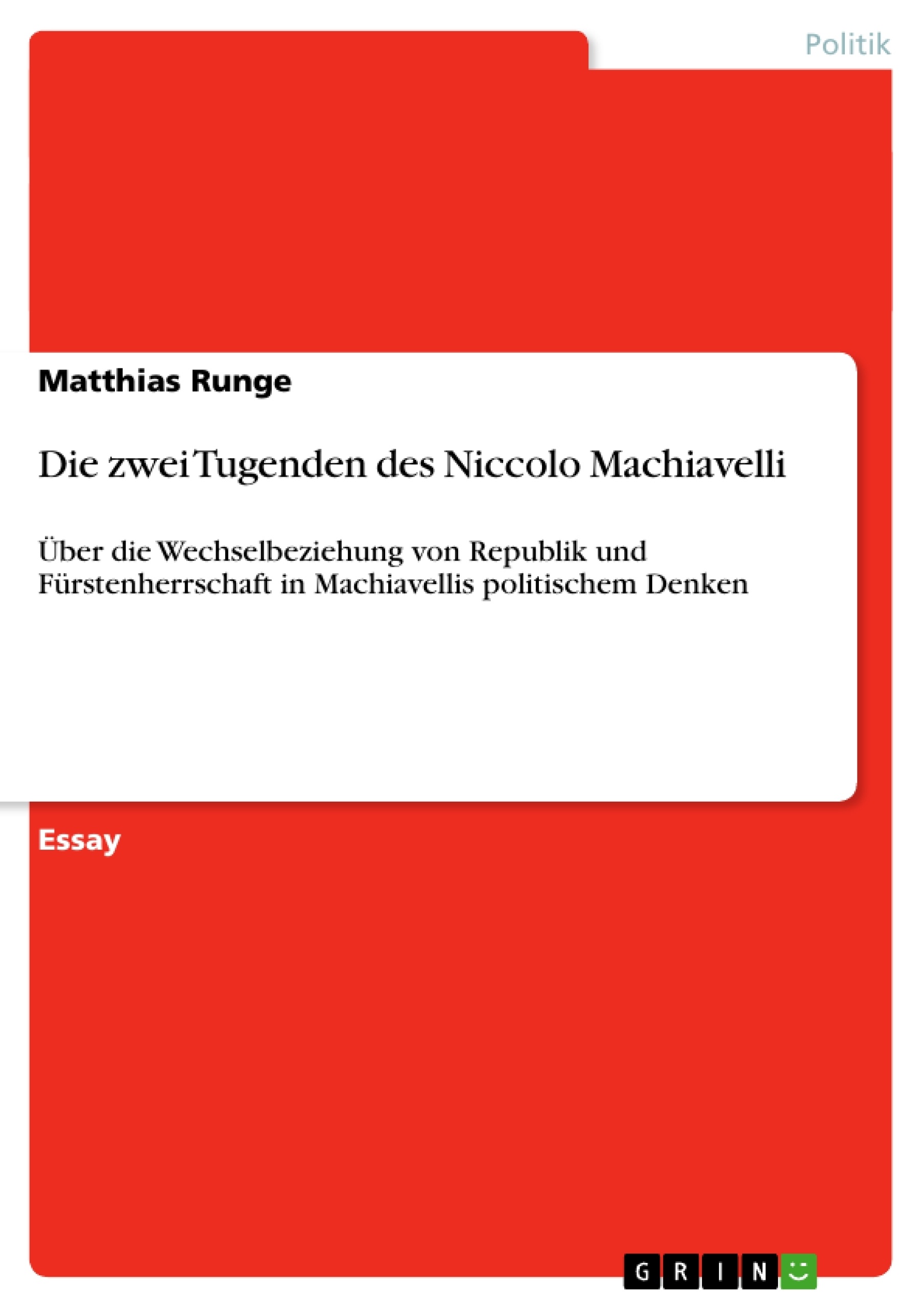In den 90-iger Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde in der Politik und in den Medien vielfach und immer wieder gerne von den Tugenden der Bürger gesprochen. Dabei wurde die Diskussion durch zwei Sichtweisen bestimmt. Konservative Politiker betonten mit Vorliebe das Element der Opferbereitschaft der Bürger für den Staat. Im Gegensatz dazu wiesen Politikwissenschaftler, wie Herfried Münkler , auf das besondere Freiheitsverständnis der politischen Tugend in der Theoriegeschichte hin, nämlich Freiheit als gleichbedeutend mit dem Recht, ja beinah der Pflicht zur politischen Partizipation und öffentlichen Diskussion. Die Ausübung der Partizipationsrechte scheint dabei an keinen oder einen nur rudimentär vorhandenen institutionellen Rahmen gebunden zu sein .
Das beide Vorstellungen der gleichen Wurzel entspringen wird deutlich, wenn man die Elemente zusammenfaßt, die den Diskurs über die politische Tugend von der Antike bis zur Frühen Neuzeit bestimmt haben: Der Staat besteht aus der Gemeinschaft der Bürger. Diese Bürger setzen sich für ihren Staat ein. Sie opfern ihr Leben bei seiner Verteidigung und sie sind politisch aktiv. Sie überwinden ihre vitalen Interessen und Egoismen zu Gunsten des Gemeinwesens. Im Gegensatz zum Kontraktualismus, wo die Menschen durch Zwangsmittel dazu bewegt werden, ihre Egoismen zu begrenzen, handeln sie im Tugenddiskurs aus der Einsicht heraus, dass sie dem Gemeinwesen ihr Leben und ihr Hab und Gut verdanken . Durch diese Einsicht wird das Gemeinwesen stabilisiert. Gefährdet wird diese Stabilität durch die Dekadenz. Sie erwächst zwangsläufig aus der Ruhe eines nach innen und außen stabilen und sicheren Gemeinwesen. Diese Ruhe fördert Müßiggang, Luxus und Egoismus. Das Anwachsen dieser Kräfte, läßt die Opferbereitschaft der Bürger sinken. Damit der Verfall der Sitten nicht zur völligen Zerstörung des Staates führt, muß dem Treiben der Bürger mit staatlichem Zwang begegnet werden . Diese Kehrseite des Tugenddiskurses wird jedoch meistens von den Apologeten der politischen Tugend übersehen . Im Folgenden wird am Beispiel der Schriften von Niccolo Machiavelli das Verhältnis von politischer Tugend der Bürger und der Herrschaft des Fürsten betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Politische Tugend, Dekadenz und Herrschertugend
- III. Republik und Fürstentum im zyklischen Geschichtsbild
- IV. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das politische Denken Niccolo Machiavellis, insbesondere die Wechselbeziehung von Republik und Fürstenherrschaft. Sie untersucht, wie Machiavelli die Begriffe der politischen Tugend, der Dekadenz und der Herrschertugend in seinen Schriften einsetzt, um die Stabilität und den Verfall von Staaten zu erklären.
- Die Rolle der politischen Tugend in der Republik und die Gefahr der Dekadenz
- Der Zusammenhang zwischen Herrschertugend und dem Erhalt der Macht
- Das zyklische Geschichtsbild Machiavellis und die Wechselbeziehung von Republik und Fürstenherrschaft
- Die Bedeutung des Militärs und der Bürgerwehr für die Stabilität eines Staates
- Die Spannung zwischen individuellen Interessen und dem Gemeinwohl
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die Debatte um das Konzept der politischen Tugend in der Politik und den Medien des späten 20. Jahrhunderts. Sie zeigt, wie verschiedene Perspektiven auf die politische Tugend, von Opferbereitschaft bis hin zur politischen Partizipation, in der Theoriegeschichte diskutiert wurden.
II. Politische Tugend, Dekadenz und Herrschertugend
Dieses Kapitel analysiert Machiavellis Schriften im Kontext der politischen Tugend und der Herrschertugend. Es untersucht, wie Machiavelli die Republik als eine Form des Staates beschreibt, die auf einem tugendhaften Volk basiert, das sich durch Wehrhaftigkeit und politische Partizipation auszeichnet. Der Abschnitt beleuchtet auch die Gefahren der Dekadenz, die durch Wohlstand und Müßiggang entstehen können und die Stabilität einer Republik untergraben.
III. Republik und Fürstentum im zyklischen Geschichtsbild
Dieses Kapitel befasst sich mit Machiavellis zyklischem Geschichtsbild und der Wechselbeziehung von Republik und Fürstenherrschaft. Es untersucht, wie Machiavelli die Republik als eine idealtypische Form des Staates betrachtet, die jedoch durch Dekadenz in eine Fürstenherrschaft übergehen kann.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die politischen Schriften Niccolo Machiavellis und beleuchtet zentrale Begriffe wie Republik, Fürstenherrschaft, politische Tugend, Dekadenz, Herrschertugend, Bürgerwehr, Gemeinwohl und zyklisches Geschichtsbild.
- Citar trabajo
- Dr. Phil Matthias Runge (Autor), 1997, Die zwei Tugenden des Niccolo Machiavelli, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147358