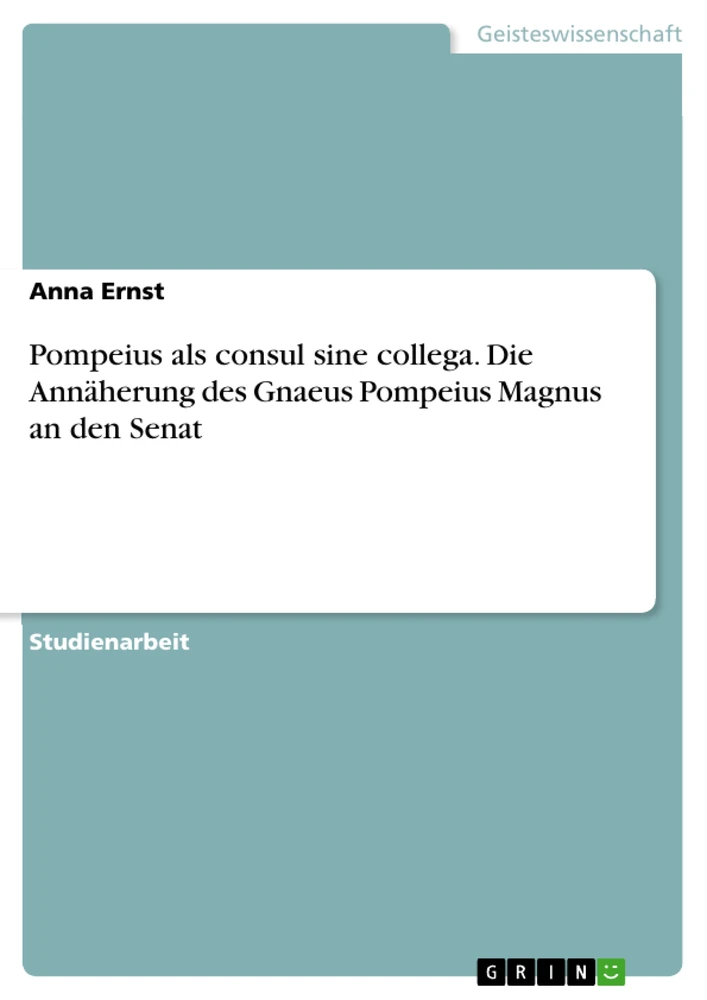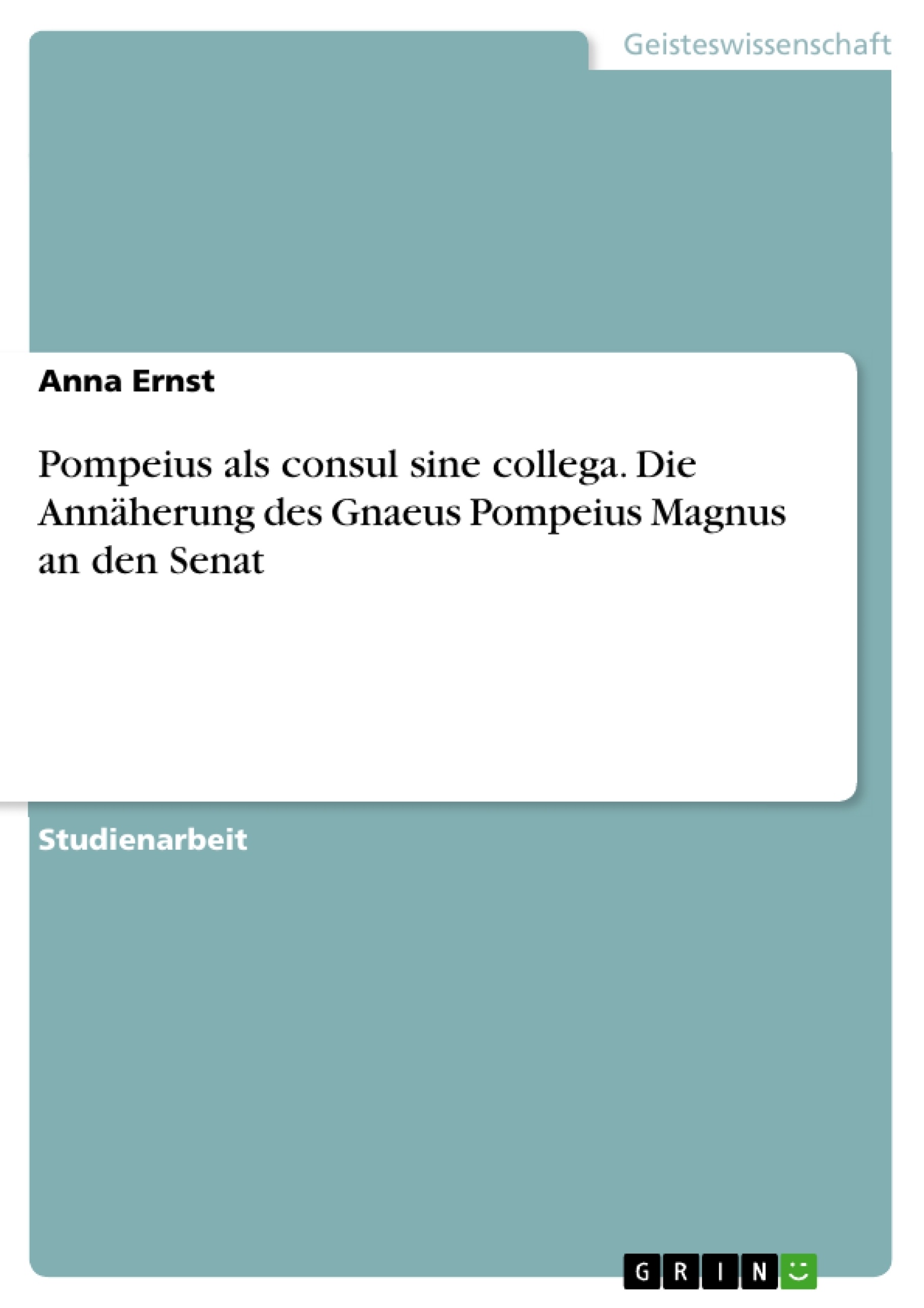Das kollegiale Konsulat galt als das höchste politische und militärische Amt der Magistratur der Verfassung der Römischen Republik. Gnaeus Pompeius Magnus ernannte man im Jahre 52 v. Chr. zum consul sine collega. Ihm wurden somit diktatorische Vollmachten anvertraut.
Pompeius galt als einer der herausragendsten militärischen Feldherren seiner Zeit. Über seine Tätigkeiten als Politiker gibt es allerdings gespaltene Meinungen. Die folgende Arbeit beleuchtet die politischen Tätigkeiten des Pompeius und die damit verbundene Annäherung an den Senat und ermittelt die Gründe für die Ernennung des Pompeius zum alleinigen Konsul durch den Senat.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die res publica zur Zeit des Pompeius
- 3. Pompeius in den Jahren 54 bis 52 v. Chr.
- 3.1 Die Annäherung des Pompeius an den Senat
- 3.2 consul sine collega
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die politischen Aktivitäten von Gnaeus Pompeius Magnus in den Jahren 54 bis 52 v. Chr. und seine Annäherung an den Senat, die letztendlich zu seiner Ernennung zum consul sine collega führte. Die Analyse beleuchtet die Gründe für diese Ernennung im Kontext der römischen Republik und der Beziehungen Pompeius' zu Caesar.
- Die politische Struktur der römischen Republik zur Zeit des Pompeius
- Die Rolle des Senats und die Machtkämpfe innerhalb der Nobilität
- Pompeius' politische Strategien und sein Verhältnis zum Senat
- Die Bedeutung des Konsulats und die außergewöhnliche Situation des consul sine collega
- Die Beziehungen zwischen Pompeius und Caesar
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt das Thema der Arbeit: die Ernennung des Pompeius zum consul sine collega im Jahre 52 v. Chr. und die damit verbundene Annäherung an den Senat. Sie skizziert den Untersuchungszeitraum (54-52 v. Chr.) und die wichtigsten Quellen, darunter Plutarchs Biographie des Pompeius und Ciceros Reden, sowie die Werke Caesars. Die Einleitung legt die Fragestellung und den methodischen Ansatz der Arbeit dar und betont die Relevanz der Beziehung zwischen Pompeius und Caesar für das Verständnis der Ereignisse.
2. Die res publica zur Zeit des Pompeius: Dieses Kapitel beschreibt die politische Struktur der römischen Republik, die verschiedene Elemente – aristokratische, demokratische und monarchische – vereinte. Es werden der Senat, die Volksversammlungen und die Magistratur mit ihren Funktionen und wechselseitigen Beziehungen beleuchtet. Besonders hervorgehoben werden die gegensätzlichen Gruppierungen innerhalb des Senats (populares und optimates) und die zunehmende Bedeutung des Volkes in der Politik. Das Kapitel erklärt die Funktionsweise des Konsulats, seine Rolle als höchstes Amt und die Möglichkeiten der gegenseitigen Kontrolle der Konsuln durch das Kollegialitätsprinzip. Abschließend wird das Ausnahmeamt des Diktators im Kontext des senatus consultum ultimum behandelt, um den Kontext der Ernennung eines consul sine collega zu verdeutlichen.
3. Pompeius in den Jahren 54 bis 52 v. Chr.: Dieses Kapitel fokussiert auf Pompeius' politische Aktivitäten in den Jahren 54-52 v. Chr., beginnend mit seiner Position nach dem zweiten Konsulat. Es analysiert seine Nähe zum politischen Zentrum Roms im Gegensatz zu Caesars Tätigkeit in Gallien. Der Tod der Tochter Caesars und Ehefrau Pompeius' im Jahr 54 v. Chr. wird als ein Schlüsselereignis betrachtet, welches die Beziehungen zwischen Pompeius und Caesar deutlich belastete. Das Kapitel beleuchtet Pompeius' bewusste Annäherung an den Senat, unterstreicht seine politischen Strategien und die zunehmend spannungsgeladene Situation mit Caesar, die im Kontext des Aufstiegs Pompeius' zum consul sine collega gesehen werden muss.
Schlüsselwörter
Gnaeus Pompeius Magnus, consul sine collega, Römische Republik, Senat, populares, optimates, Gaius Julius Caesar, Triumvirat, politische Macht, Konsulat, senatus consultum ultimum, Diktatur.
Häufig gestellte Fragen zu: Pompeius' Weg zum consul sine collega (54-52 v. Chr.)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die politischen Aktivitäten von Gnaeus Pompeius Magnus in den Jahren 54 bis 52 v. Chr. Der Schwerpunkt liegt auf seiner Annäherung an den Senat und der damit verbundenen Ernennung zum consul sine collega. Die Analyse beleuchtet die Hintergründe dieser Ernennung im Kontext der römischen Republik und der Beziehungen Pompeius' zu Caesar.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die politische Struktur der römischen Republik zur Zeit Pompeius', die Rolle des Senats und die Machtkämpfe innerhalb der Nobilität. Sie analysiert Pompeius' politische Strategien und sein Verhältnis zum Senat, die Bedeutung des Konsulats und die außergewöhnliche Situation des consul sine collega, sowie die Beziehungen zwischen Pompeius und Caesar.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel über die res publica zur Zeit Pompeius', ein Kapitel über Pompeius' Aktivitäten in den Jahren 54-52 v. Chr. und ein Fazit. Kapitel 3 unterteilt sich in die Unterkapitel „Die Annäherung des Pompeius an den Senat“ und „consul sine collega“.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung beschreibt das Thema der Arbeit – die Ernennung Pompeius' zum consul sine collega und seine Annäherung an den Senat – und skizziert den Untersuchungszeitraum (54-52 v. Chr.). Sie nennt die wichtigsten Quellen (Plutarch, Cicero, Caesar) und legt die Fragestellung und den methodischen Ansatz dar. Die Relevanz der Beziehung Pompeius-Caesar wird hervorgehoben.
Worum geht es im Kapitel über die res publica?
Dieses Kapitel beschreibt die politische Struktur der römischen Republik mit ihren aristokratischen, demokratischen und monarchischen Elementen. Es beleuchtet den Senat, die Volksversammlungen und die Magistratur, die gegensätzlichen Gruppierungen innerhalb des Senats (populares und optimates) und die Rolle des Volkes. Es erklärt das Konsulat, seine Funktion und das Kollegialitätsprinzip, sowie das Ausnahmeamt des Diktators im Kontext des senatus consultum ultimum.
Was ist der Inhalt des Kapitels über Pompeius' Aktivitäten (54-52 v. Chr.)?
Dieses Kapitel analysiert Pompeius' politische Aktivitäten nach seinem zweiten Konsulat, seine Annäherung an den Senat im Gegensatz zu Caesars Tätigkeit in Gallien. Der Tod der Tochter Caesars und Ehefrau Pompeius' wird als Schlüsselereignis betrachtet. Es beleuchtet Pompeius' Strategien und die zunehmende Spannung mit Caesar im Kontext seines Aufstiegs zum consul sine collega.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Gnaeus Pompeius Magnus, consul sine collega, Römische Republik, Senat, populares, optimates, Gaius Julius Caesar, Triumvirat, politische Macht, Konsulat, senatus consultum ultimum, Diktatur.
- Arbeit zitieren
- Anna Ernst (Autor:in), 2024, Pompeius als consul sine collega. Die Annäherung des Gnaeus Pompeius Magnus an den Senat, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1472948