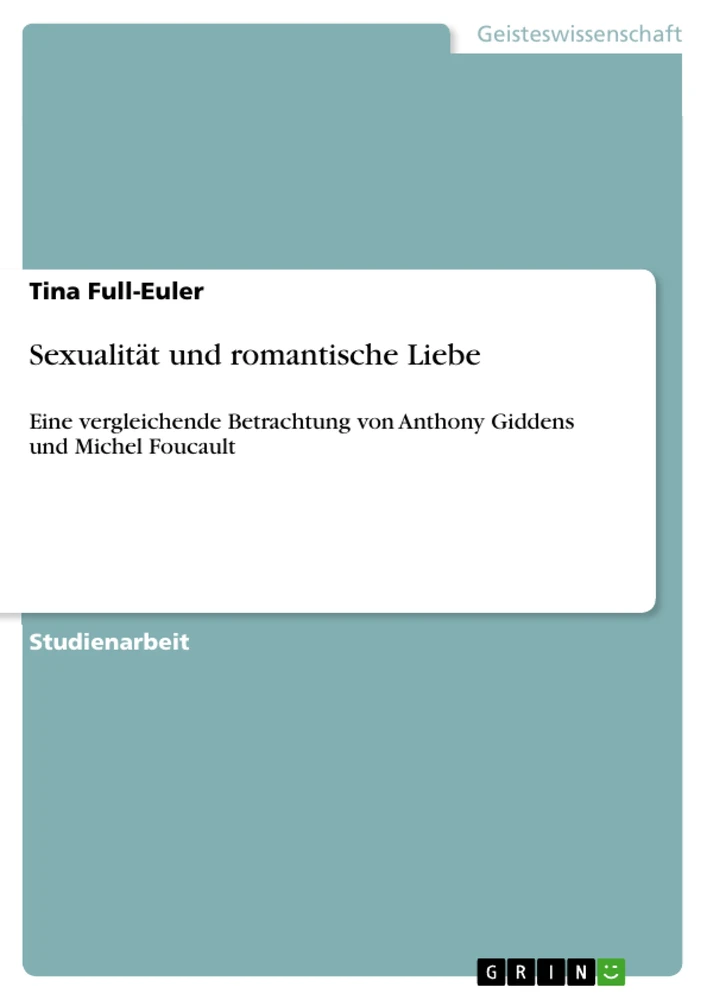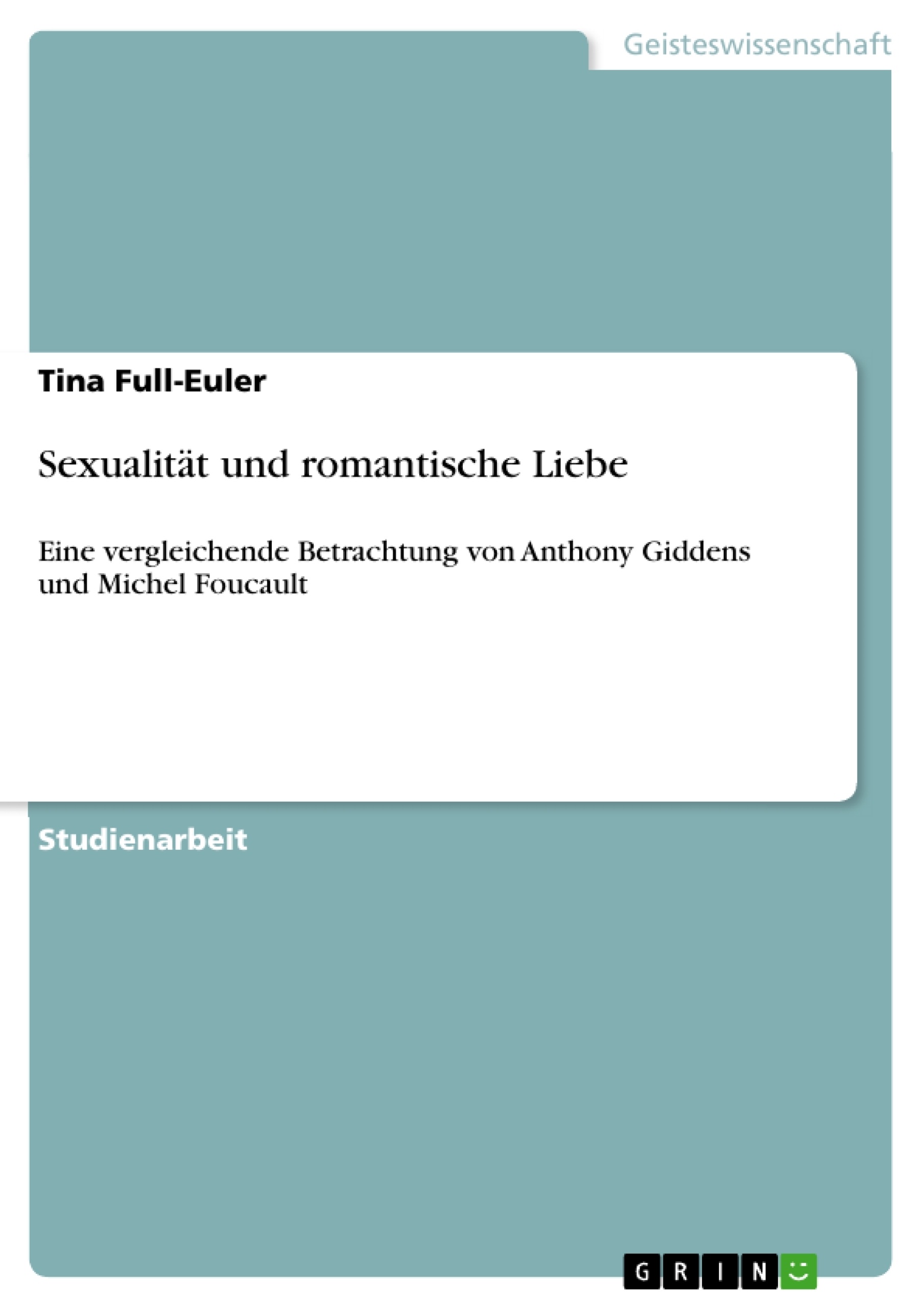Sexualität als wissenschaftlicher Begriff musste durch den gesellschaftlichen Diskurs erst erfunden werden, und der Grund dafür liegt wahrlich in Sphären der Macht. Mit ihrer Erwähnung wurde die Sexualität der Frauen gleichzeitig negiert, und zwar aus Machtinteresse der Männer, die diesen Diskurs führten.
Auch Anthony Giddens und Michel Foucault stehen im Diskurs über Sexualität: Foucault fordert zur Kritik auf, und Giddens reagiert. Giddens meint, die Entwicklung der Sexualität von der viktorianischen Zeit bis heute verlaufe nach Foucault „gradlinig“ und deren Erklärung sei „recht einfach“. Giddens kommentiert: „Dennoch liegen die Dinge nicht ganz so einfach“, wie sie eben Foucault beschreibt. Da möchte man den Satz umdrehen und sagen: Ganz so einfach kann es Foucault wirklich nicht gemeint haben. Dazu ist es nötig, auf einige grundlegende Gedanken Foucaults einzugehen, die den ersten Band „Der Wille zum Wissen“ seines dreibändigen Werkes „Sexualität und Wahrheit“ (französisch „Histoire de la sexualité“, 1976) bestimmen.
Der zweite Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit dem Komplex der romantischen Liebe nach Giddens. Dabei muss die in dieser Idee angelegte Ambivalenz im Auge behalten werden: Einerseits diente die Erfindung der romantischen Liebe zur Unterdrückung der Frau, andererseits bedeutete sie einen ersten Schritt in Richtung sexuelle Revolution.
Inhalt
1. Einleitung
2. Der Begriff der Sexualität bei Anthony Giddens und Michel Foucault
2.1 Aus „Der Wille zum Wissen“
2.2 Zur Kritik Giddens’ an Foucault
3. Die Idee der romantischen Liebe
3.1 Der Begriff der romantischen Liebe bei Anthony Giddens
3.2 Kritische Betrachtung
4. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
„Sexualität ist ein soziales Konstrukt, das sich in den Sphären der Macht bewegt, nicht bloß eine biologische Antriebskraft, die entweder befriedigt wird oder auch nicht“ (Giddens 1993, S. 33). Soweit sind Michel Foucault und Anthony Giddens sich einig. Sexualität als wissenschaftlicher Begriff mußte durch den gesellschaftlichen Diskurs erst erfunden werden, und der Grund dafür liegt wahrlich in den „Sphären der Macht“. So erwähnt Giddens, daß „Sexualität“ im heute gebrauchten Sinne zum ersten Mal 1889 in einem Buch zu lesen war, das sich die Frage stellte, „warum Frauen für die verschiedensten Krankheiten anfällig sind, die Männer nicht bekommen - ein Phänomen, für das die weibliche ‘Sexualität’ verantwortlich gemacht wurde“ (ebd.). Mit ihrer Erwähnung wurde die Sexualität der Frauen gleichzeitig negiert, und zwar aus Machtinteresse der Männer, die diesen Diskurs führten.
Auch Giddens und Foucault stehen im Diskurs über Sexualität: Foucault fordert zur Kritik auf, und Giddens reagiert. Giddens meint, die Entwicklung der Sexualität von der viktorianischen Zeit bis heute verlaufe nach Foucault „gradlinig“ (ebd., S. 34) und deren Erklärung sei „recht einfach“ (ebd., S. 35). Giddens kommentiert: „Dennoch liegen die Dinge nicht ganz so einfach“ (ebd., S. 36) - wie sie eben Foucault beschreibt. Da möchte man den Satz umdrehen und sagen: Ganz so einfach kann es Foucault wirklich nicht gemeint haben. Doch dazu ist es nötig, auf einige grundlegende Gedanken Foucaults einzugehen, die den ersten Band „Der Wille zum Wissen“ seines dreibändigen Werkes „Sexualität und Wahrheit“ (französisch „Histoire de la sexualité“, 1976) bestimmen.
Der zweite Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit dem Komplex der romantischen Liebe wie Giddens ihn vorstellt (vgl. ebd., S. 48 ff.). Dabei muß die in dieser Idee angelegte Ambivalenz im Auge behalten werden: Einerseits diente die Erfindung der romantischen Liebe zur Unterdrückung der Frau, andererseits bedeutete sie einen ersten Schritt in Richtung sexuelle Revolution.
2. Der Begriff der Sexualität bei Anthony Giddens und Michel Foucault
Foucault nimmt seinen Kritikern schon in seinem Vorwort zur deutschen Ausgabe den Wind aus den Segeln: Er betont den unvollständigen Charakter seiner Abhandlung, um in den folgenden Bänden flexibel und offen auf Kritik eingehen zu können. Er möchte keine „Geschichte der sexuellen Verhaltensweisen in den abendländischen Gesellschaften schreiben“ (Foucault 1998, S. 7), sondern betrachtet das „Werden eines Wissens“ (ebd.), das Werden der Wissenschaft von der Sexualität. Dabei behauptet er nicht, es hätte keine Unterdrückung von Sexualität gegeben, doch Repression sei nicht das Hauptziel der Verbindung Macht-Wissen-Lust. Es ist Foucault bewußt, daß er durch die Wahl seines Themas „Sexualität“ andere der Sexualität „benachbarte Begriffe“ (ebd., S. 8) ausblendet - so auch die Liebe, die Giddens so vermißt. Doch mit anderen Begriffen ließe sich das, was er zeigen möchte wohl auch demonstrieren. Sexualität ist also nur ein Beispiel für die Darstellung folgenden Problems:
[W]ie ist in den abendländischen Gesellschaften die Produktion von Diskursen, die (zumindest für eine bestimmte Zeit) mit einem Wahrheitsgehalt geladen sind, an die unterschiedlichen Machtmechanismen und -institutionen gebunden? (ebd.).
Auf diese Weise wird ein Teil der Kritik Giddens’ schon entschärft, bevor die eigentliche Abhandlung überhaupt beginnt: Giddens kritisiert den „theoretischen Rahmen“ (Giddens 1993, S. 34), den Foucault seinem Diskurs gibt, und daß er ihn nicht mit der romantischen Liebe ausfüllt, obwohl Foucault ausdrücklich betont, er schreibe keine geschichtliche Abhandlung. Der Diskurs und die Macht bekämen ein zu großes Gewicht, obwohl die Darstellung dieses Zusammenhangs doch Foucaults Hauptanliegen ist. Es werde „zuviel Nachdruck auf die Sexualität“ (ebd.) gelegt, obwohl Foucault den Beispielcharakter der Sexualität betont. Auch die Repression - so Giddens - sei doch nur allzu manifest gewesen im viktorianischen Zeitalter, doch das bestreitet Foucault ja auch nicht.
So oder so ähnlich hätte sich Foucault wahrscheinlich verteidigt. Um auf die anderen Kritikpunkte, die Giddens noch aufführt, einzugehen, ist es wohl sinnvoll, einigen Zusammenhänge aus „Der Wille zum Wissen“ darzustellen, die in der Diskussion im Text Giddens’ relevant sind.
2.1 Aus „Der Wille zum Wissen“
Wie ist das also mit Diskurs, Macht, Lust und der Sexualität bei Foucault?
Der Beginn der Sexualität geht einher mit ihrer Diskursivierung, ihrer Verwissenschaftlichung, d. h. „der Vermehrung der Diskurse über den Sex, die im Wirkungsbereich der Macht selbst stattfindet: institutioneller Anreiz über den Sex zu sprechen, und zwar immer mehr darüber zu sprechen“ (Foucault 1998, S. 28). Diese Diskursivierung hat ihren Ursprung in den Beichtspiegeln des Mittelalters bis ins 17. Jahrhundert: Hier wurde noch freimütig gefragt und geantwortet. Ab dem 17. Jahrhundert fing man dann an, aus der Sexualität ein Geheimnis zu machen. Bei der Beichte fragt man nicht mehr direkt nach dem Sexualleben, sondern fordert vorsichtig die Selbstprüfung von Körper und Seele, meint aber die Sexualität.
Unter dem Deckmantel einer gründlich gesäuberten Sprache, die sich hütet, ihn beim Namen zu nennen, wird der Sex von einem Diskurs in Beschlag genommen, der ihm keinen Augenblick Ruhe oder Verborgenheit gönnt (ebd., S. 31).
Wichtig ist noch, daß eben seit jener Zeit das Beichtgeständnis regelmäßig eingefordert wurde. Natürlich gingen seither nicht alle regelmäßig zur Beichte, aber die Aufforderung steht als „Imperativ“ (ebd.) da.
Das Merkwürdige an der ganzen Sache ist nun, daß Sexualität etwas Geheimes wird, über das man nicht spricht und trotzdem fordert man dieses Sprechen ein.
Für Foucault spricht auch das Schweigen über Sexualität. Wenn z. B. in den Bildungsanstalten des 18. Jahrhunderts Sexualität ein Tabuthema ist, so spricht doch die Architektur solcher Einrichtungen für sich: Die Betten sind mit Trennwänden oder Vorhängen versehen, Regeln überwachen das Zubettgehen usw. In den Familien werden Kinder- und Elternschlafzimmer getrennt. Dieses Phänomen bezeichnet Foucault als den „internen Diskurs der Institution“ (ebd., S. 41). Nach Foucault sind auch die verschiedenen Arten zu schweigen „(...) integrierender Bestandteil der Strategien, welche die Diskurse tragen und durchkreuzen“ (ebd., S. 40).
Der Titel der Liebes- und Sexualgeschichte eines anonymen Autors des 19. Jahrhunderts spricht für sich: „My secret Life“ (ebd., S. 32) und dann wird darin alles detailgetreu berichtet. Doch für Foucault scheint das kein Widerspruch zu sein: Gerade wenn man aus der Sexualität ein Geheimnis macht, spornt doch das zum Reden an, fördert das die Diskursivierung. Man möchte doch immer mehr wissen über das Verbotene, und darüber sprechen heißt schon Grenzen überschreiten und Lustgewinn. Bis heute ist das wohl so. „Wir glauben, daß uns das Wesentliche dauernd entgeht und wir darum stets aufs Neue seine Spur aufnehmen müssen“ (ebd., S. 47). Wir glauben heute ständig, uns sexuell befreien zu müssen von irgendwelchen Zwängen, jedoch wirkt dieser Befreiungswille sehr zwanghaft.
Die modernen Gesellschaften zeichnen sich nicht dadurch aus, daß sie den Sex ins Dunkel verbannen, sondern daß sie unablässig von ihm sprechen und ihn als das Geheimnis geltend machen (ebd., S. 49).
Foucault fragt sich, woher es kommt, daß alle von Unterdrückung der Sexualität sprechen, wo doch das Sprechen über Sexualität eine „Form der Predigt“ (ebd., S. 17) angenommen hat. Die Menschen sprechen „(...) redselig von ihrem eigenen Schweigen (...)“ (ebd., S. 18). Foucaults Frage lautet nicht: Gab es Unterdrückung? - und diese Frage beantworten die Anhänger der Repressionshypothese mit „ja“. Ihrer Meinung nach wird deswegen so viel darüber gesprochen, weil man sich nur langsam und nur durch Sprechen von dieser lang anhaltenden Repression erholen kann. Foucaults Frage lautet: Wie kommt es zu der Diskursivierung der Repression? Seine Antwort heißt sinngemäß (vgl. ebd., S. 16): Spricht man von Repression, hat man allein schon durch das Sprechen über etwas zu Unterdrückendes den Eindruck, etwas Verbotenes zu tun, eine kleine Revolution zu wagen. Dies ist natürlich mit einem Lustgewinn verbunden. Man spricht also von Repression und regt genau dadurch den Austausch über Sexualität an. Oder mit den Worten Foucaults: „Die Aussage von der Unterdrückung und die Form der Predigt verweisen aufeinander und verstärken sich gegenseitig“ (ebd., S. 17) und:
Alles in allem geht es darum, den Fall einer Gesellschaft zu prüfen, die seit mehr als einem Jahrhundert lautstark ihre Heuchelei geißelt, redselig von ihrem eigenen Schweigen spricht und leidenschaftlich und detailliert beschreibt, was sie nicht sagt, die genau die Mächte denunziert, die sie ausübt, und sich von den Gesetzen zu befreien verspricht, denen sie ihr Funktionieren verdankt (ebd., S. 18).
Der Diskurs über die Repression vertieft also zwangsweise das Wissen über Sexualität und untersteht dem „Regime von Macht-Wissen-Lust“ (ebd., S. 21). Er ist damit „(...) in einer allgemeinen Ökonomie der Diskurse über den Sex anzusiedeln, wie sie seit dem 17. Jahrhundert im Innern der modernen Gesellschaften herrscht“ (ebd.). Die Repressionshypothese gehört zu einer „Diskursstrategie“ (ebd., S. 22): einer Strategie, die durch „Machttechnik“ und „Wille zum Wissen“ eine „Wissenschaft von der Sexualität“ gestalten möchte, um nach dem „Prinzip der Ausstreuung und der Einpflanzung polymorpher Sexualitäten“ (ebd.) Sexualität immer feiner zu organisieren und besser zu kontrollieren.
Geheimnis, Repression und Schweigen sind also nach Foucault Teil der Strategie einer „Vermehrung der Diskurse“ (ebd., S. 43) verbunden mit einer „Intensivierung der Mächte“ und damit zu einer Vervielfältigung der Sexualität. Es entsteht ein Verbindungsnetz von Macht und Diskurs.
Warum wurde diese Strategie so sehr gefördert, fragt sich Foucault. Es liegt wohl daran, daß staatliche Institutionen ein Interesse an der Entwicklung eines „komplexen und vielfältig wirkenden Dispositivs“ (ebd., S. 35) haben (d.h.: „Vorkehrungen, die eine strategische Operation durchzuführen erlauben“ (ebd.)), um eine „verordnete Steigerung der kollektiven und individuellen Kräfte“ (ebd., S. 37) zu erreichen. Der Staat erkennt die Wichtigkeit der Regelung des Sexuallebens der Bevölkerung als zukünftiges Ziel und nutzt sie für seine Zwecke. „Der Sex ist zum Einsatz, zum öffentlichen Einsatz zwischen Staat und Individuum geworden“ (ebd., S. 39). Allerdings ist sich Foucault unsicher, ob der Diskurs seit über 300 Jahren wirklich darauf abzielt, eine „ökonomisch nützliche und politisch konservative Sexualität“ (ebd., S. 51) zu bilden, wenn aber doch, dann nicht durch Unterdrückung.
Die Entfaltung der Macht vollzieht sich nach Foucault in vier Operationen (vgl. ebd., S. 56 ff.):
1. Die Organisation des Diskurses schafft „ Durchdringungslinien “ (ebd., S. 57).
2. Dies führt zu einer „ Einkörperung der Perversionen und einer neuen Spezifizierung der Individuen “ (ebd., S. 58), d. h., durch die Erforschung von peripheren Sexualitäten und deren Aufzählung im 19. Jahrhundert werden sie Wirklichkeit: sie werden benannt und damit erst konstruiert. Nach einem besonderen Interesse an der heterosexuellen Beziehung ist nun „der Homosexuelle des 19. Jahrhunderts [ist] zu einer Persönlichkeit geworden, (...)“ (ebd.). Beachtete man die peripheren Sexualitäten vor ihrer Benennung im Strafkodex weniger bis gar nicht - ein Ehebruch wurde weitaus härter bestraft als z. B. Sodomie - tat man es danach umso mehr. Ein grausames Beispiel ist die massenhafte Hinrichtung von Homosexuellen im Dritten Reich. Die Sexualität macht den homosexuellen Menschen in seinem Verhalten und in seiner Persönlichkeitsstruktur zu einer „Sondernatur“ (ebd.). „All diese ehedem kaum wahrgenommenen Gestalten müssen nun vortreten, um das Wort zu ergreifen und zu gestehen, wer sie sind“ (ebd., S. 53). Der Diskurs stellt sie vor die Identitätsfrage: Sexualität ist gleich Identität und eine Eigenschaft des Individuums.
3. Es kommt zu „ unaufhörlichen Spiralen der Macht und der Lust“ (ebd., S. 61): Man hat Lust, sich an der Macht des Diskurses zu beteiligen, selbst zu beobachten und Neues zu entdecken; dem gegenüber steht die Lust, diese Macht zu umgehen und auszuhöhlen.
4. Daraus entwickeln sich „ Dispositive sexueller Sättigung “ (ebd.): Unterschiedliche Sexualitäten wurden „sorgfältig angelegt und zum Wachsen gebracht“ (ebd.), und zwar „gleichzeitig begehrte und verfolgte Lüste“ (ebd.). Daher kommt es zu einer sexuellen Sättigung in Räumen, die alles bieten: von der Kanalisierung der Sexualität in der Ehe bis zum gesellschaftlich tolerierten Freudenhaus.
Um Foucault noch einmal kurz und knapp zusammenzufassen: Alle möglichen Formen der Sexualität existierten und existieren schon bevor sie durch die Diskursivierung von Sexualität benannt wurden bzw. werden. Durch diese Benennung machte man die Sexualität zu einer Eigenschaft des Menschen und stellte ihn damit vor eine Identitätsfrage.
2.2 Zur Kritik Giddens’ an Foucault
Einige der wichtigsten Kritikpunkte, die Giddens anmerkt, wurden schon anfangs entschärft. Auch die folgenden, die Giddens aneinanderreiht, lassen sich relativieren.
Giddens kritisiert den Begriff „offenes Geheimnis“ (Giddens 1993, S. 34). Der medizinische Diskurs sei schließlich an der breiten Masse vorbeigegangen. Aber bei Foucault ist auch dieses Nicht-Wissen, das Schweigen eine Art von Diskursivierung, eine Art Machtausübung. Auch Nicht-Wissen organisiert Sexualität.
Die Wichtigkeit, die Foucault dem Geständnis bei der Erschaffung eines Dispositivs einräumt, sei falsch. Giddens übersieht, daß Foucault den Begriff des Geständnisses in erster Linie in Bezug auf die Beichte verwendet. Und er versäumt es, dem Begriff „Geständnis“ eine eigene, bessere Formulierung entgegenzusetzen.
Giddens spricht von einer „modellierbaren Sexualität“ (ebd., S. 38), d. h. von der Sexualität als eine Eigenschaft des Menschen, die die Voraussetzung der sexuellen Revolution gewesen sei (genauer: Kap. 2). Der Begriff der „modellierbaren Sexualität“ widerspricht Foucault allerdings nicht: Bei Foucault befreit sich Sexualität ebenfalls von Fortpflanzung und wird durch ihre Vervielfältigung zur Eigenschaft von Individuen. Die Revolution begreift Foucault nicht einseitig als Befreiung. Es ist auch der Zwang, immer wieder hinter das angebliche Geheimnis der Sexualität kommen zu müssen. Diese Ambivalenz wird im Folgenden immer wieder auftauchen.
Giddens möchte Foucaults „Interpretation der Entwicklung des Selbst“ (ebd., S. 41) als „Konstrukt einer bestimmten ‘Technologie’“ (ebd.) widersprechen. Man befände sich eher im Bereich einer „’Offenheit’ der Identität“ (ebd.). Foucaults Endaussage ist jedoch nahezu die gleiche; er beschreibt nur eben auch den Entwicklungsgang. Erst als die Sexualität durch ihre Diskursivierung zur Eigenschaft der Menschen wurde, mußten sich jene in dieses Raster einordnen und sich fragen: „Wer bin ich“? Die zunehmende Verwissenschaftlichung, die „reflexive Einverleibung von Wissen“ (ebd., S. 41) erschwere die Identitätsfindung, meint auch Giddens und trifft sich hier mit Foucault:
Das Selbst stellt heutzutage für jeden und für jede ein reflexives Projekt dar - eine mehr oder weniger kontinuierliche Befragung der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es ist ein Projekt, das seinen Weg mitten in einem Haufen anderer reflexiver Quellen finden muß: Therapien und Selbsthilfe-Handbücher, Fernsehsendungen und Zeitschriftenartikel (ebd.).
Giddens geht hier noch einen Schritt weiter: Die Reflexion hat neben dem Geist auch den Körper eingeholt. Sie findet über Geist und Körper statt. Der Körper wurde Ausdruck eines Lebensstils (vgl. ebd., S. 42). Für eine neuerliche Steigerung dieses Körperkults macht Giddens die „Einführung einer ‘Wissenschaft’ der Ernährung“ (ebd., S. 43) verantwortlich, die zu einer Frage des Lebensstils stilisiert, was man ißt und warum. Dabei verweist er auf die Eßstörungen gerade bei jungen Frauen. Diese neue ‘Zivilisationskrankheit’ habe die Hysterie abgelöst:
Denn es ist ja gerade die Diät, die eine Verbindung zwischen physischer Erscheinung, Identität des Selbst und Sexualität im Kontext sozialen Wandels herstellt, mit der die Individuen zu Rande kommen müssen. Abgemagerte Körper legen heute nicht mehr länger Zeugnis von ekstatischer Frömmigkeit ab, sondern von der Härte dieses säkularen Kampfes (ebd.).
Beide ‘Krankheiten’ wurden und werden Frauen zugeschrieben, also der Hälfte der Bevölkerung, der Sexualität vor noch nicht allzu langer Zeit abgesprochen wurde; beide Krankheiten stehen in engem Zusammenhang mit der Sexualität und sie entstanden beide aus der Verwissenschaftlichung erst der Sexualität, dann des Körpers. Die Schwierigkeiten der Frauen liegen wohl in diesen Extremen: Erst werden sie von der Männerwelt für hysterisch erklärt, wenn sie ihre Sexualität ausleben, dann wird die Lust quasi über strenge Schönheitsideale eingefordert.
Im Abschnitt über das Ende der Perversionen (vgl. ebd., S. 43 ff.) geht Giddens letztendlich doch konform mit Foucault, auch wenn er dem „Kampf um die öffentlichen Toleranz“ (ebd., S. 44) in dieser Entwicklung einen hohen Stellenwert einräumt.
So gesehen können wir den Verfall des Begriffs der Perversion als teilweise erfolgreichen Kampf für die Rechte auf Selbstverwirklichung interpretieren, der sich innerhalb eines liberalen demokratischen Staates abspielt (ebd., S. 45).
Aber diese Demokratie hat zwei Seiten: Einerseits bietet sie die Möglichkeit der Diskussion um Toleranz, andererseits entsteht dieser Diskussionsbedarf erst mit der „Vergesellschaftung der natürlichen Welt“ (ebd.) als Charakteristikum der Moderne durch Organisation menschlichen Handelns. Die Demokratie läßt Freiraum zur Diskussion, aber der wissenschaftliche Diskurs ist vorgegeben und machtbestimmt. Wenn man mit Giddens weiterdenkt, liegt hierin die Ambivalenz der Demokratie. Also ist das Ende der Perversionen neben der Verschiebung von Toleranzschwellen auch bedingt durch den „Prozeß der Ablösung der Perversion durch den Pluralismus im Rahmen eines weitgespannten Sets von Veränderungen (...) im Rahmen der fortschreitenden Ausdehnung der Moderne“ (ebd.). Gewagt ist es natürlich, bei einer solchen Sichtweise vom „Niedergang ‘der Perversion’“ (ebd., S. 43) zu sprechen, da der Prozeß der Pluralisierung diesen nicht selbstverständlich beinhaltet; vielmehr bedeutet hier Pluralisierung eine Verschiebung der Grenzen zur Perversion.
Foucault richtet sein Hauptaugenmerk auf das Hervortreten der peripheren Sexualitäten bzw. der Perversionen. Aus seiner Sicht wird durch die Diskursivierung menschliches Handeln organisiert. Giddens und Foucault liegen so weit nicht voneinander entfernt. Ihr Ergebnis bleibt das gleiche: Neue Formen der Sexualität entstehen erst durch ihre Organisation. Perversionen müssen als solche benannt werden. Giddens sieht dies allerdings auch als Anfang vom Ende der Perversionen, aber: erst der Anfang macht ein Ende möglich.
Giddens Begriff der „institutionellen Reflexivität“ wirkt eher als Zusammenfassung der Gedanken Foucaults denn als Gegenbegriff. Der Prozeß der „Neuordnung der Dinge“ (ebd., S. 39) ist bei Foucault keineswegs „festgelegt“ oder verläuft „einseitig“, sondern er ist das Ergebnis einer gegenseitigen Beeinflussung von Diskurs und sozialem Handeln. Man denke hier an die „Spiralen von Macht und Lust“. Die Definition von Macht, die Foucault kurz nach dem Erscheinen von „Der Wille zum Wissen“ in „Ein Spiel um die Psychoanalyse“ gibt, erscheint alles andere als statisch:
Bei der Macht handelt es sich in Wirklichkeit um Beziehungen, um ein mehr oder weniger organisiertes, mehr oder weniger pyramidalisiertes, mehr oder weniger koordiniertes Bündel von Beziehungen (Foucault 1978, S. 126).
Auch nach Foucault werden die „gewöhnlichen, alltäglichen sexuellen Praktiken einer kontinuierlichen Reflexion unterzogen (...)“ (Giddens 1993, S. 40), nämlich dem Diskurs. Giddens sagt selbst: „Die Erfindung der Sexualität war Foucault zufolge Teil eines bestimmten differenzierten Prozesses der Bildung und Festigung moderner gesellschaftlicher Institutionen“ (ebd., S. 32). Diese Diskursivierung ist also sowohl institutionell als auch reflexiv und das mit der gleichen Ambivalenz wie Giddens’ Demokratiebegriff. Giddens’ Kritik greift nicht und dort, wo er neue Begrifflichkeiten vorschlägt, liegt er gar nicht so weit von Foucault entfernt.
Nun noch zu einem letzten Kritikpunkt: Foucault habe die romantische Liebe nicht berücksichtigt. Dieser Punkt ist jedoch zu vernachlässigen: Foucault hätte die romantische Liebe oder deren Sexualität durchaus als Beispiel verwenden können, schließlich geht sie durch den romantischen Roman mit einer massenhaften Diskursivierung einher; Foucault verwendet aber andere Beispiele. Allerdings soll Foucaults Desinteresse an dieser Stelle nicht davon abhalten, diesen durchaus spannenden und aufschlußreichen Komplex der romantischen Liebe mit Giddens näher zu betrachten.
3. Die Idee der romantischen Liebe
Im 19. Jahrhundert führte nach Giddens der Diskurs über Sexualität zur Entstehung verschiedener „Bereiche des Macht-Wissens“ (Giddens 1993, S. 31): Die weibliche Sexualität und die der Kinder mußten ‘entdeckt’ werden, nur um sie sofort wieder zu unterdrücken, Sexualität wurde nur Ehepartnern zugestanden und nicht-heterosexuelle Formen der Sexualität machte man zu Perversionen, von denen Betroffene geheilt werden mußten. Während des 19. Jahrhunderts kam es mit der Idee der romantischen Liebe zu einem „historischen Einschnitt in der Sexualität (ebd., S. 37). Sie machte die Beziehung unter Ehepartnern zu einer besonderen und das ‘Heim’ zu einem Ort „emotionaler Absicherung“ (ebd.). „Die Verkleinerung der Familie war historisch sowohl Bedingung als auch Konsequenz der Einführung moderner Verhütungsmethoden“ (ebd.). Dies bedeutete eine Befreiung der Sexualität, die sie zur individuellen Eigenschaft werden ließ. Mit der „modellierbaren Sexualität“ (ebd., S. 38) schuf man die Voraussetzung zur sexuellen Revolution in den 60er Jahren, deren Errungenschaften Giddens in der sexuellen Befreiung der Frauen und der gesellschaftlichen Anerkennung von Homosexualität sieht. Von einer Befreiung der kindlichen Sexualität spricht Giddens jedoch noch nicht.
Im Kontext der sexuellen Revolution also erscheint die romantische Liebe als deren Wegbereiter. Doch genau wie die sexuelle Revolution aus Foucaults Sicht weist auch der Komplex der romantischen Liebe ambivalente Züge auf: Man erfand ihn aus dem Diskurs über die Sexualität heraus, um weibliche Sexualität zu kanalisieren, und um Frauen in einer eng zugeschnittenen Rollenzuschreibung zu unterdrücken; damit wurde die sexuelle Befreiung der Frauen erst konditioniert; die Männer haben diese unfreiwillig miterfunden.
3.1 Der Begriff der romantischen Liebe bei Anthony Giddens
Die romantische Liebe unterscheidet sich von der „leidenschaftlichen Liebe, amour passion “ (Giddens 1993, S. 48), obwohl beide Phänomene auch einige Elemente verbinden. Amour passion ist ein „universelles Phänomen“ (ebd., S. 49) und „dem Charisma ähnlich“ (ebd.). Man wird von einer bestimmten Person quasi verzaubert, so daß man alles für diese tun würde und seine Umwelt dabei vergißt. Die amour passion kann die soziale Ordnung aus dem Gleichgewicht bringen:
Das Kennzeichen leidenschaftlicher Liebe ist die Dringlichkeit, die sie von den Routinen des alltäglichen Lebens unterscheidet und mit denen sie konsequenterweise tendenziell in Konflikt gerät (ebd., S. 48).
Giddens betont, die amour passion sei aus diesen Gründen nie als ein Grundstock für eine langjährige Ehe angesehen worden (vgl. ebd., S. 49). Adolph Freiherr von Knigge beschreibt in seinem ‘Benimmbuch’ „Über den Umgang mit Menschen“ die bitteren Folgen einer unüberlegten Romanze in jungen Jahren:
Er [der junge Mann] verbindet sich auf ewig mit einem Geschöpfe, das sich seinen von Leidenschaft geblendeten Augen ganz anders darstellt, als es ihn nachher die nüchterne Vernunft kennen lehrt, und dann hat er sich eine Hölle auf Erden bereitet (Knigge 1977, S. 187).
Die romantische Liebe ist ein kulturelles Phänomen im Europa des späten 18. Jahrhunderts als „Ausdruck und Teil eines säkularen Wandels“ (Giddens 1993, S. 51) mit breiter sozialer Wirkung. Sie wurde eine Art Lebensideal: Christliche Werte, die Idee der Ergänzung von Mann und Frau in der Ehe auf Lebenszeit verbunden mit einer doch schon „offenen Zukunft“ (ebd., S. 52) der Lebensgeschichte durch die nötige Selbstreflexion machten ihr Wesen aus. Man unterstand jedoch natürlich immer noch dem „kosmischen Schicksal“ (ebd.). Diese Idealisierung des anderen und das Entwerfen einer gemeinsamen Zukunft bestimmen für Giddens als „subversives Moment“ (ebd., S. 58) die Idee der romantische Liebe.
Das Verhältnis der Ehepartner zueinander wurde unter den familialen Verbindungen ein besonderes: „Das erste und natürlichste Band unter den Menschen, nächst der Vereinigung zwischen Mann und Weib, ist von jeher das Band unter Eltern und Kindern gewesen“ (Knigge 1977, S. 145). Die Leidenschaft der amour passion lenkte man in geordnete Bahnen: „Die Liebe bricht mit der Sexualität, indem sie sich die Sexualität einverleibt“ (Giddens 1993, S. 51). Romantische Liebe und Sexualität sind entkoppelt. Man mußte durch „intuitives Erfassen der Eigenschaften des anderen“ (ebd.) Zuneigung zum Charakter eines Individuums fassen und unterdrückte sexuelles Verlangen. Die Tugendhaftigkeit des Charakters zählte von nun an auf dem Heiratsmarkt, nicht mehr nur die ökonomische Situation des Partners.
Die Idee der romantischen Liebe ging einher mit einer emotionaleren „Beziehung zwischen Eltern und Kindern“, der „Erfindung der Mutterschaft“ und der „Erfindung des ‘Heims’“ (ebd., S. 53) und schaffte damit der Frau einen „neuen Status“ (ebd.).
Neu war jetzt die Koppelung von Mutterschaft und Weiblichkeit, die als Eigenschaften der Persönlichkeit interpretiert wurden - Eigenschaften, die langgehegte Vorstellungen über weibliche Sexualität beeinflußten (ebd., S. 54).
Damit verbunden ist ein „zweigeschlechtliches Modell der Handlungen und Gefühle“ (ebd.): Die Frauen blieben zu Hause in ihrer Rolle als Frau und Mutter, traten mit der Außenwelt kaum in Kontakt und waren für die Liebespflege und den Haushalt zuständig: „Romantische Liebe war im wesentlichen feminisierte Liebe“ (ebd.). Giddens betont aber, daß dies in all ihren Einschränkungen den Frauen „neue Bereiche der Intimität“ (ebd., S. 55) öffnete. Es bedeutete auch eine neue Macht der Frauen innerhalb ihres klar abgesteckten Bereiches. Die Männer arbeiteten außerhalb dieses Heims; ihr Einfluß im häuslichen Bereich sank im 19. Jahrhundert. Männer konnten ihre in der Ehe nicht gelebte amour passion z. B. mit einer Prostituierten ausleben, Frauen konsumierten Liebesromane als Zeichen ihrer eigenen Passivität (vgl. ebd.), um die „Spannung zwischen romantischer Liebe und amour passion “ (ebd., S. 54) zu überbrücken. Und das war wohl der Hauptgrund, daß der romantische Roman zum Massenprodukt wurde: Eine kleine Abwechslung für die, „(...) deren Leben eingeschränkt und arm ist (...)“ (ebd., S. 57).
Die Frauen konnten der triumphalen Idee der einzigen großen Liebe nachhängen, auch wenn jene in das geordnete Eheleben integriert war; die Männer lebten ihre Leidenschaft außerhalb ihrer vier Wände aus und hielten auf diese Art „Distanz zu einer neu aufkommenden Sphäre der Intimität“ (ebd., S. 58). Es gab also die amour passion noch, wenn auch bei den Frauen nur in der Phantasie oder eben in kanalisierter Form. Der amour passion machte man insofern Zugeständnisse, als sie die romantische Liebe aufrechterhielt: Man gestand den Frauen so viel Leidenschaft zu, daß sie gerade noch zufrieden waren und an den bestehenden Verhältnissen nicht rüttelten.
3.2 Kritische Betrachtung
Übrigens bleibt es doch immer gewaltig hart, daß wir Männer uns so leicht alle Arten von Ausschweifungen erlauben, den Weibern aber, die von Jugend auf durch uns zur Sünde gereizt werden, keinen Fehltritt verzeihn wollen, obgleich freilich für die bürgerliche Verfassung diese größre Strenge gegen das schwächere Geschlecht sehr heilsam ist (Knigge 1977, S. 200 f.), stellt Adolph Freiherr von Knigge über den Umgang mit Frauenzimmern fest, die in diesem Buch eher als Sondergruppe der Spezies Mensch, denn als Mensch behandelt werden.
Mit dieser Aussage gibt Knigge schon zu erkennen, wozu die Unterdrückung der Frauen gut sei: für die „bürgerliche Verfassung“, d. h. für das Patriarchat bzw. die unantastbare Alleinherrschaft der Männer. Vor diesem Hintergrund lohnt es sich, einige Aussagen Knigges mit Blick auf die romantische Liebe genauer unter die Lupe zu nehmen.
Die Tätigkeitsfelder von Ehefrau und Ehemann sind genau abgesteckt in komplementärer Rollenverteilung: Knigge rät, „(...) daß jeder seinen angewiesenen Wirkungskreis habe“ (ebd., S. 167). Andernfalls käme es zu „Verwirrung“ bzw. alles andere „taugt nichts“ (ebd.).
[I]hre Existenz [die der Frau] schränkt sich ein auf den häuslichen Zirkel, dahingegen des Mannes Lage ihn eigentlich fester an den Staat, an die große bürgerliche Gesellschaft knüpft; deswegen gibt es Tugenden und Laster, Handlungen und Unterlassungen, die bei einem Geschlechte von ganz andern Folgen sind als bei dem anderen (ebd., S. 81). Der Mann muß Herr sein in seinem Hause; so wollen es Natur und Vernunft (ebd., S. 177).
Die Begründung dieser Rollenaufteilung beruft sich auf „Natur und Vernunft“ bzw. bürgerliches Gesetz und bleibt damit pseudokausal. Knigge schreibt über die Frage, ob es auch unter Eheleuten Geheimnisse geben solle:
Freilich, da der Mann von der Natur bestimmt ist, der Ratgeber seines Weibes, das Haupt der Familie zu sein; da die Folgen jedes übereilten Schrittes der Gattin auf ihn fallen; da der Staat nur an ihn hält; da die Frau eigentlich gar keine Person in der bürgerlichen Gesellschaft ausmacht; da die Verletzung der Pflichten von ihrer Seite schwer auf ihm liegt und diese Verletzung die Familie weit unmittelbarer beschimpft und derselben Schande und Nachteil bringt als die Ausschweifungen des Mannes dies tun; da sie viel mehr von dem äußern Rufe abhängt als er; endlich da Verschwiegenheit mehr eine männliche als weibliche Tugend ist, so kann es wohl seltner gut sein, wenn die Frau ohne ihres Mannes Wissen Schritte unternimmt und dieselben vor ihm verheimlicht. Er hingegen, der an den Staat geknüpft ist, (...) kann unmöglich immer so alles erzählen und mitteilen (ebd., S. 165 f.).
Es ist der Mann, der die Familie mit der Außenwelt verbindet und der mit seinen Pflichten in die bürgerliche Gesellschaft integriert bleibt. Jeder Fehler von seiten der Frau kann dabei dem Mann als öffentliche Person schaden; und die Zahl der möglichen Fehltritte ist groß:
Zum Beispiel wenn die Frau mit ihren „stumpfen Organen“ (ebd., S. 163) kein Ohr mehr für die Sorgen ihres Mannes hat, „(...) wenn die Gattin so an gar nichts von allem warmen Anteil nimmt, was dem Gatten wichtig und interessant scheint“ (ebd., S. 173); wenn sie ihm Zärtlichkeiten verwehrt, so daß er gezwungen wird, diese sich anderswo zu holen: „Ein Kuß ist ein Kuß, und es wird wahrlich fast immer des Weibes Schuld sein, wenn ein sonst nicht schlechter Mann diesen Kuß, den er von treuen, reinen und warmen Lippen ehrenvoll und bequem zu Hause erlangen könnte, mit Hintansetzung von Pflicht und Anstand, bei Fremden holt“ (ebd., S. 165); „(...) wenn schlechte Haushaltung den Ehemann und Vater in Armut gestürzt hat, und er nun den Blick umherwirft auf die Personen seiner Familie, die von ihm Unterhalt, Nahrung, Wartung, Erziehung, Vergnügen fordern“ (ebd., S. 168); „wenn unsre Gattin uns durch ein mürrisches, feindseliges Temperament, durch Neid, Geiz oder unvernünftige Eifersucht das Leben verbittert, oder wenn sie sich durch ein falsches, tückisches Herz verächtlich macht, oder wenn sie in Unzucht oder Völlerei lebt“ (ebd., S. 174), denn „in Rücksicht auf die Folgen hingegen ist freilich die Unkeuschheit einer Frau weit strafbarer als die eines Mannes“ (ebd., S. 178).
Die strikte Rollenzuweisung und das dadurch hohe Fehlerpotential sind bei der Frau natürlich bedingt. „Jedes Geschlecht, jeder Stand, jedes Alter, jeder einzelne Charakter hat dergleichen Schwächen“ (ebd., S. 188), aber die Frau hat im Gegensatz zum Mann eben besonders viele, auch wenn diese in den Mantel der weiblichen Eigenschaften gehüllt sind: „Frauenzimmer“ besitzen „(...) einen esprit de détail, eine Feinheit, unschuldige Verschlagenheit, Behutsamkeit, einen Witz, ein Dulden, eine Nachgiebigkeit und Geduld (...)“ (ebd., S. 170). Ein Mann dagegen ist „(...) zuvorschauender, gefaßter bei allen Vorfällen, fester, unerschütterlicher, weniger den Vorurteilen unterworfen, ausdauernder und gebildeter [sei] als das Weib“ (ebd.). Frauen trachten in ihrer Eitelkeit nach Lob (vgl. ebd., S. 193) und nach dem „Triumph des Augenblicks“ (ebd., S. 196), können ihre Neugier kaum zügeln (vgl. ebd., S. 193), haben „reizbarere Nerven“ (ebd., S. 194) und sind deswegen äußerst launisch.
Schwächrer Körperbau; eingepflanzte Neigung zu weniger dauerhaften Freuden; Launen aller Art, die den Verstand oft in den entscheidensten Augenblicken fesseln; Erziehung und endlich bürgerliche Verfassung, welche die Verantwortung des Hausregiments allein auf den Mann wälzt; das alles bestimmt laut die Gattin, Schutz zu suchen, und legt dem Gatten die Pflicht auf zu schützen (ebd., S. 171).
Daraus schließt Knigge: „Nun ist aber doch nichts lächerlicher, als wenn der Weisere und Stärkere Schutz suchen soll bei dem Toren und Schwachen“ (ebd.). Deswegen darf eine Frau nicht klüger sein als ihr Mann, falls im Haushalt kein Chaos ausbrechen soll. Knigge geht sogar soweit, daß er Männern, die nicht gerade die intelligentesten sind, davon abrät, zu heiraten; lieber sollten diese Männer also unverheiratet bleiben, als daß eine Frau sie bevormundete, denn „[E]s geht in einem Hause, wo ein Mann von mittelmäßigen Fähigkeiten das Regiment führt, größtenteils immer noch besser her als in einem, wo eine kluge Frau ausschließlich Herr ist“ (ebd.). Damit die Frauen nicht klüger werden, bleiben ihnen auch die Bildung und das Ausleben der eigenen Kreativität untersagt:
Es erregt wahrlich, wo nicht Ekel, doch Mitleiden, wenn man hört, wie solche armen Geschöpfe [die Frauen] sich erkühnen, über die wichtigsten Gegenstände, die Jahrhunderte hindurch der Vorwurf der mühsamsten Nachforschungen großer Männer gewesen sind, und von denen diese dennoch mit Bescheidenheit behauptet haben, sie sähen nicht ganz klar darin (ebd., S. 202).
Kein Wunder also, wenn die Frauen massenhaft Liebesromane konsumierten, blieb ihnen doch erstens die Lektüre betreffend keine große Auswahl, zweitens konnten sie so bewußt dumm gehalten werden. Frauen sollten sich doch „(...) an die Bestimmung der Natur halten (...)“ (ebd., S. 201), sonst „(...) geht alles verkehrt im Hause“ (ebd., S. 202), und nach folgenden weiblichen Tugenden streben: „Keuschheit und Sittsamkeit“ (ebd., S. 200).
Weigert sich die Gattin, ihre Rolle, die ihr die Natur vorschreibt, zu spielen, bleibt dem Mann nur das Erdulden dieser für ihn schrecklichen Situation „(...) ohne Hoffnung einer andern Erlösung, als wenn der dürre Knochenmann mit seiner Sense dem Unwesen ein Ende macht“ (ebd., S. 153). Dabei gilt für den Ehemann folgendes: „Erfülle endlich um so treuer Deine Pflichten, je öfter Dein Weib dieselben übertritt“ (ebd., S. 176) und „(...) vermeide alles Aufsehen“ (ebd.). Erst wenn die ‘Schande’ durch das Weib vor der Öffentlichkeit nicht mehr zu verbergen ist, wird eine Trennung möglich (vgl. ebd., S. 178). Aber: „Wahre Liebe kann auch ein verirrtes Herz zur Tugend zurückführen“ (ebd., S. 200). Damit setzt Knigge die Liebe gleich mit der eben genannten Pflichterfüllung.
Nach diesem Exkurs ins 18. Jahrhundert noch einmal zurück zu Anthony Giddens. Giddens erkennt also subversive Züge in der Idee der romantischen Liebe: in der Idealisierung des anderen und damit einer Individualisierung und im Erschaffen einer gemeinsamen Zukunft. Dabei habe die Partnersuche durchaus etwas Aktives, die romantische Liebe „etwas Triumphales“ (Giddens 1993, S. 56). Giddens’ Interpretation scheint nach der genauen Betrachtung des „Knigge“, des Regelwerks für das aufstrebende Bürgertum, schwer verständlich. Idealisiert wird in dieser Zeit die perfekte Erfüllung einer Rolle. Je besser man eine solche spielt, desto größere Chancen hat man auf dem Heiratsmarkt. Der individuelle Charakter des einzelnen erstickt in Verhaltensvorschriften. Nicht um Individualisierung, um Entpersonalisierung der Welt geht es hier. Auch wenn Giddens von der gottgewollten Ergänzung von Mann und Frau spricht: Ist das nicht eine männliche Erfindung, um die Frau ins Haus zu verdrängen, denn schließlich müssen die Rollen komplementär verteilt sein, und um der Frau die gegensätzlichen Eigenschaften des Mannes zuzusprechen? Und das können natürlich nur schlechtere sein, die guten schreibt der Mann sich ja schon selbst zu.
Überhaupt wirkt die Idee der romantischen Liebe als ein Instrument zur Unterdrückung der Frau, und dabei haben die Männer besonderes Geschick bewiesen: Sie haben es den Frauen zum Ideal gemacht, sich selbst zu unterdrücken. Man heiratete eben nur diejenigen, die sich anpaßten. Dieses Unterdrückungssystem funktionierte bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein. Noch in den 50er Jahren - gerade nach einer Zeit, in der die Frauen ein neues Selbstbewußtsein erlangt hatten - berief man sich wieder auf den „Knigge“, schrieb „Benimmbücher“, und - was überraschend und logisch zugleich erscheint - es schrieben nun Frauen für Frauen. Die Strategie der Männer ging auf.
Zwei Beispiele sind das „Einmaleins des guten Tons“ von Gertrud Oheim und „Der neuzeitliche Haushalt“ von Erna Horn.
Die Frau ist von je die berufene Hüterin der guten Sitten. Wenn auch der Krieg und die Nachkriegszeit dazu angetan schienen, alle ehemaligen Gesetze umzuwerfen, so ist man heute doch schon wieder dahin gelangt, einzusehen, daß es ohne diese nicht geht (Horn 1952, S. 479).
Diese Bücher aus den 1950er Jahren sind in ihren Aussagen noch direkter und radikaler als ein Freiherr von Knigge: „Jeder Mensch besitzt einen gewissen Geltungsdrang, der beim Mann in beruflichen Ehrgeiz gipfelt, bei der Frau jedoch darin, schön zu sein!“ (ebd., S. 503). Die Passivität der Frau kann kaum noch gesteigert werden. Im Abschnitt über die „Beziehungen zwischen Mann und Frau“ im „Einmaleins des guten Tons“ wird Knigge gleich drei Mal erwähnt, um ihn dann an peniblen Verhaltensvorschriften noch zu übertreffen: So habe Knigge gemeint, vernünftige Regeln für Verliebte seien überflüssig, da sie in einem solch emotionalen Zustand nicht beachtet würden. Frau Oheim stellt sie mit größerer Pedanterie als Knigge dennoch auf. Z. B. beim Thema „Bekanntschaften machen“ erklärt sie:
Ein Herr z. B. bittet diesen Partner, ihn der Dame vorzustellen, für die er sich interessiert, die Dame äußert ihm ihren Wunsch, diesen oder jenen Herrn kennenzulernen, worauf dann das Bekannt-Machen nach den auf Seite 56 ff genau geschilderten Regeln vor sich geht (Oheim 1958, S. 120).
Sonst gilt für die Frau, „(...) daß es der schönste frauliche Sieg ist, eigene Wünsche zart und diplomatisch in die männliche Initiative einzubauen!“ (ebd., S. 122). Sein Wunsch ist der ihre.
Hatte man nach diesem Krieg keine neuen Wertvorstellungen, daß man sich an über 150jährigen festhalten mußte? Oder war es ein letztes konservatives Aufbäumen vor der Revolution? Das zu untersuchen wäre ein neues Kapitel. Fest steht aber, daß Giddens’ Aussage, die romantische Liebe sei ein erster Schritt hin zur sexuellen Revolution, als historisch schief zu bewerten ist. Vielmehr macht die Unterdrückung der Frau ihre Emanzipation erst nötig. Oder - um näher an Foucault zu rücken: Erst die Diskursivierung und Institutionalisierung durch die machtbestimmten Männer benennen die Idee der romantischen Liebe, machen sie zu einer zu erstrebenden Eigenschaft der Menschen bzw. der Frauen, von der sie sich - einmal internalisiert - nur schwer wieder lösen können, muß doch die Unterdrückung erst einmal als solche erkannt werden.
4. Literaturverzeichnis
Foucault, Michel, 1978: Ein Spiel um die Psychoanalyse. Gespräch mit Angehörigen des Departement de Psychoanalyse der Universität Paris/Vincennes. In: ebd. (Hrsg.): Dispositive der Macht. Über Sexualität, Wissen und Wahrheit. Berlin, S. 118-175.
Foucault, Michel, 1998: Sexualität und Wahrheit. Bd. 1: Der Wille zum Wissen. 10. Aufl., Frankfurt a.M.
Giddens, Anthony, 1993: Wandel der Intimität. Sexualität, Liebe und Erotik in modernen Gesellschaften. Frankfurt a.M., S. 28-59.
Horn, Erna, 1952: Der neuzeitliche Haushalt. Ein Führer durch die gesamte Küche und Hauswirtschaft aus der Versuchsküche Buchenau. München-Solln.
Knigge, Adolph Freiherr von, 1977 [1788]: Über den Umgang mit Menschen. Frankfurt a.M.
Oheim, Gertrud, 1958: Einmaleins des guten Tons. 21. Aufl., Gütersloh.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text?
Dieser Text ist eine umfassende Auseinandersetzung mit dem Begriff der Sexualität, insbesondere im Kontext der Theorien von Anthony Giddens und Michel Foucault, sowie der Idee der romantischen Liebe.
Was sind die Hauptthemen des Textes?
Die Hauptthemen sind die Konstruktion von Sexualität im gesellschaftlichen Diskurs, die Kritik Giddens’ an Foucaults Thesen, die Idee der romantischen Liebe und ihre Ambivalenz, sowie die Rolle der Macht in der Gestaltung von Sexualität und Geschlechterrollen.
Wie definieren Giddens und Foucault Sexualität?
Sowohl Giddens als auch Foucault sehen Sexualität als ein soziales Konstrukt, das von Machtstrukturen geprägt ist und nicht bloß eine biologische Triebkraft darstellt. Foucault betont die Diskursivierung der Sexualität und die Rolle von Macht, Wissen und Lust. Giddens kritisiert Foucault dafür, die romantische Liebe in seinen Analysen zu vernachlässigen.
Was ist die "amour passion" und wie unterscheidet sie sich von der romantischen Liebe?
Die "amour passion" ist ein universelles Phänomen leidenschaftlicher Liebe, das die soziale Ordnung aus dem Gleichgewicht bringen kann. Im Gegensatz dazu ist die romantische Liebe ein kulturelles Phänomen des späten 18. Jahrhunderts, das auf christlichen Werten, Ergänzung von Mann und Frau und einer gemeinsamen Zukunft basiert.
Welche Kritik übt Giddens an Foucaults Konzept der Sexualität?
Giddens kritisiert Foucault für seinen "theoretischen Rahmen", der seiner Meinung nach die romantische Liebe und die Rolle der Repression im viktorianischen Zeitalter vernachlässigt. Er argumentiert, dass Foucault zu viel Gewicht auf Diskurs und Macht lege und die Dinge nicht so einfach seien, wie Foucault sie darstellt.
Was ist die Bedeutung des "Geständnisses" im Kontext von Foucaults Theorie?
Foucault sieht das Geständnis, insbesondere im Bezug auf die Beichte, als ein wichtiges Instrument zur Diskursivierung der Sexualität. Durch das Einfordern von Geständnissen wird ein Sprechen über Sexualität erzwungen, selbst wenn diese als geheim gilt.
Wie betrachtet Foucault die Repressionshypothese?
Foucault stellt die Repressionshypothese in Frage und argumentiert, dass das Sprechen über Repression selbst eine Form der Machtausübung und ein Lustgewinn sein kann. Er behauptet, dass die modernen Gesellschaften nicht den Sex ins Dunkel verbannen, sondern unablässig von ihm sprechen und ihn als *das* Geheimnis geltend machen.
Welche Rolle spielt die Diskursivierung der Sexualität nach Foucault?
Nach Foucault führt die Diskursivierung dazu, dass Sexualität zu einer Eigenschaft des Menschen wird und Individuen vor eine Identitätsfrage stellt. Dies geschieht durch die Benennung und Kategorisierung verschiedener Formen der Sexualität, wodurch diese erst "wirklich" werden.
Welche Ambivalenz ist in der Idee der romantischen Liebe angelegt?
Die romantische Liebe diente einerseits zur Unterdrückung der Frau, indem sie in eine eng zugeschnittene Rollenzuschreibung gezwungen wurde. Andererseits bedeutete sie einen ersten Schritt in Richtung sexuelle Revolution, indem sie eine individuelle Eigenschaft der Sexualität ermöglichte.
Wie werden Frauen in Knigges "Über den Umgang mit Menschen" dargestellt?
Frauen werden in Knigges Werk als weniger rational und stärker von Emotionen und Launen geleitet dargestellt. Ihnen wird eine geringere Rolle in der Gesellschaft zugeschrieben, und ihre Hauptaufgabe wird im häuslichen Bereich und der Pflichterfüllung als Ehefrau und Mutter gesehen.Knigge rechtfertigt die Unterdrückung der Frau durch die angebliche Notwendigkeit für die "bürgerliche Verfassung", d.h. das Patriarchat, um eine unantastbare Alleinherrschaft der Männer zu gewährleisten.
Was kritisiert der Text an Giddens' Interpretation der romantischen Liebe?
Der Text kritisiert Giddens' optimistische Sicht auf die romantische Liebe als einen ersten Schritt zur sexuellen Revolution. Stattdessen wird argumentiert, dass die Idee der romantischen Liebe eher als ein Instrument zur Unterdrückung der Frau diente, indem sie sie in spezifische Rollen zwang und ihre Emanzipation erst notwendig machte.
- Quote paper
- Tina Full-Euler (Author), 1999, Sexualität und romantische Liebe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1472828