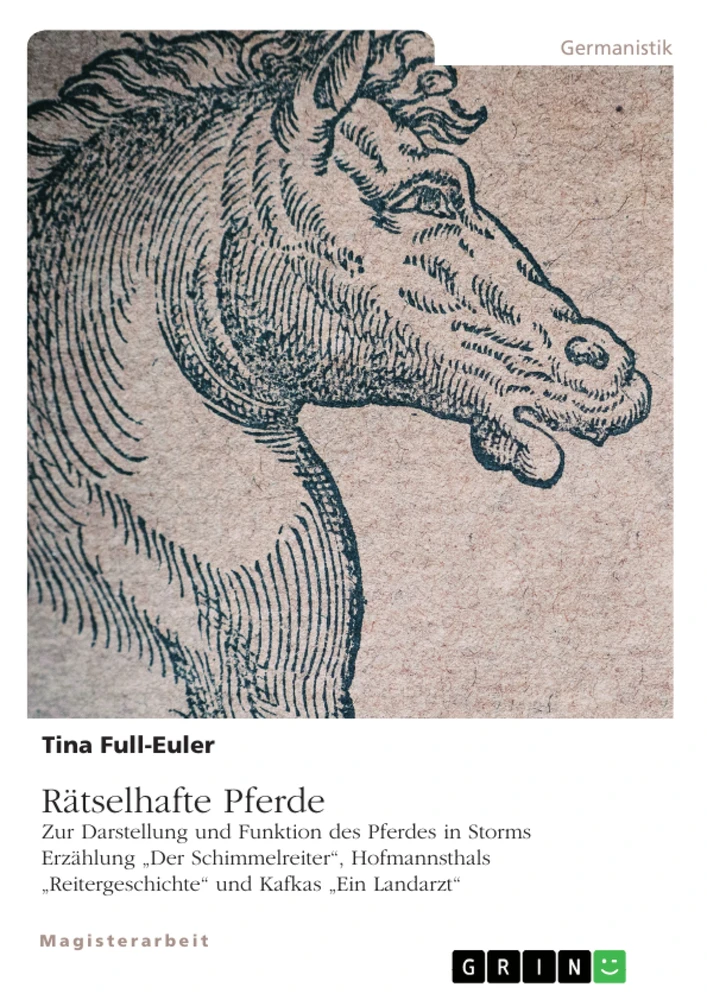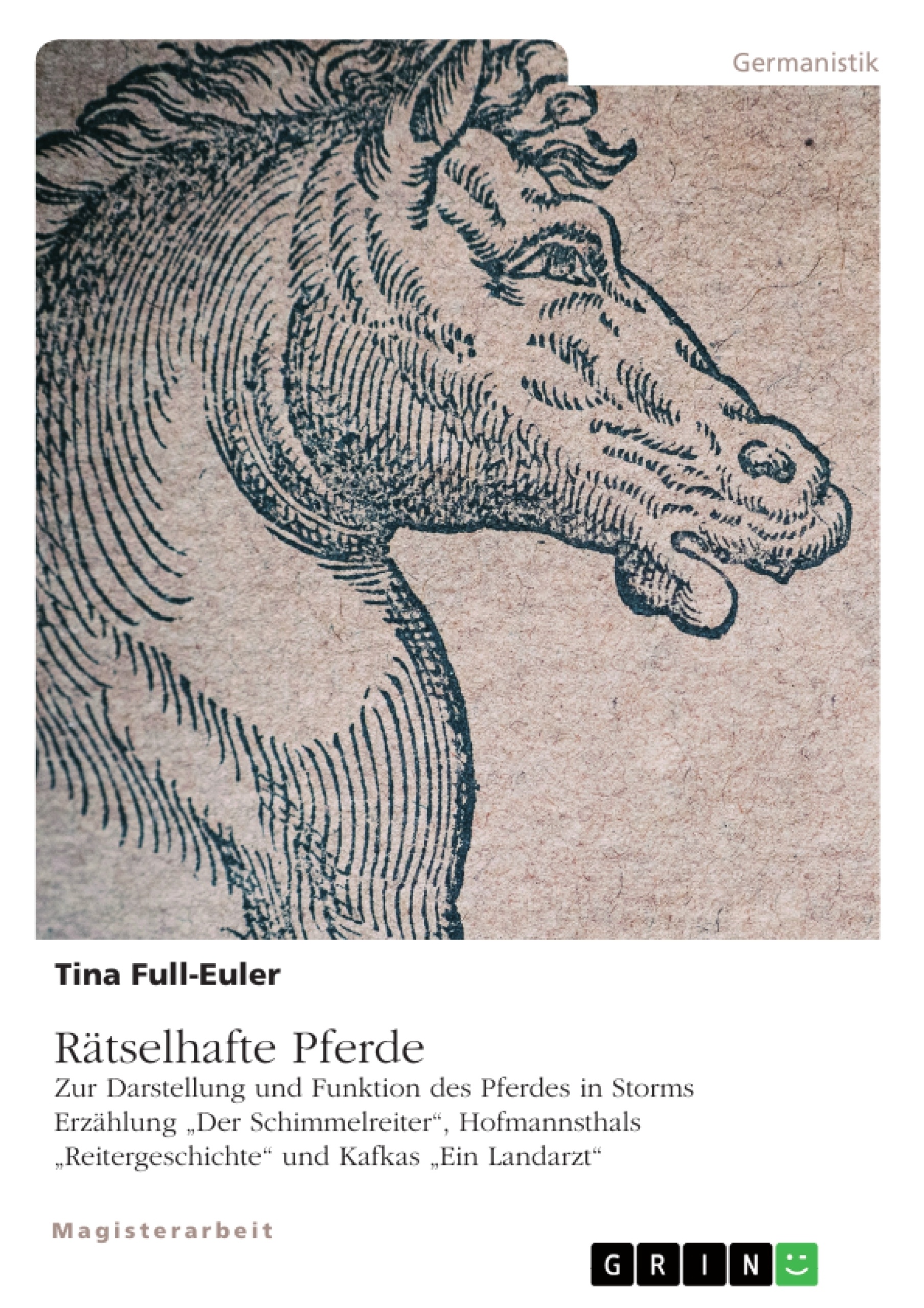Die rätselhaften Pferde der für diese Arbeit ausgewählten Erzählungen stehen im Mittelpunkt. Betrachtet werden: "Der Schimmelreiter" von Theodor Storm, "Reitergeschichte" von Hugo von Hofmannsthal und "Ein Landarzt" von Franz Kafka. Einerseits ist davon auszugehen, dass die Autoren sich mit Pferden gut auskannten, da dieses Tier damals zum Alltag gehörte. Andererseits erscheint die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert als Zeit des sich ankündigenden Umbruchs der Ross-Reiter-Beziehung besonders interessant.
In dieser Arbeit geht es um die Darstellung der Pferde – mit all ihren Anspielungen auf Mythologie und traditionelle Symbolik – und die Funktion, die diese Tiere innerhalb des Textes einnehmen. Dabei tritt die polyvalente Symbolik und antithetische Struktur der einzelnen Pferde schillernd zum Vorschein: Wie ein Chamäleon die Farbe, wechseln sie ihre Deutungsmöglichkeiten. Die einzelnen Kapitel verfolgen die Pferde durch den jeweiligen Prosatext und ergänzen sich zu einer Interpretation auf dem Rücken des Pferdes.
Es zeigt sich, dass die ausgewählten Pferde-Geschichten auf zwei mythische Erklärungsmuster zurückzuführen sind, dass sie in ihrer chronologischen Folge den Ablösungsprozess von Mensch und Pferd in seiner Problematik widerspiegeln und verarbeiten, und damit das Pferd als Symbol für kulturellen Wandel gelten kann. Das Pferd wird von Erzählung zu Erzählung immer mehr zum Symbol der inneren Befindlichkeit des Menschen, indem es die Eigenschaften des Menschen spiegelt, steigert oder kontrastiert.
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
II. Theodor Storm: Der Schimmelreiter - eine Novelle auf vier Beinen
II.1 Der zeitgenössische Erwartungshorizont
II.2 Der magisch-mythische Schimmel
II.2.1 Die Anspielung auf die Wotan-Mythe
II.2.2 Das Pferdegerippe auf Jevershallig
II.2.3 Der Schimmel als Muttersymbol
II.2.4 Das Pferdegerippe und der Schimmel Haukes
II.3 Der Schimmel des aufstrebenden Bewusstseins
II.3.1 Hauke Haien: der Vernunftmensch
II.3.2 Hauke, Elke und der Schimmel - oder von der Einschränkung des Weiblichen
II.4 Der Schimmel als Libidosymbol
II.5 Die Ross-Reiter-Beziehung zwischen Schimmel und Hauke
II.5.1 Das Pferd-Reiter-Verhältnis als Bild der Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur
II.5.2 Der Schimmel als Heldenross
II.5.3 Der Schimmel als Spiegel des Menschen Hauke Haien
II.5.4 Der Schimmel als Symbol des Leidens
II.5.5 Das Einbrechen des Weiblich-Unbewussten
II.6 Die große Sintflut
II.7 Die Labilität des Ross-Reiter-Verhältnisses: der Schimmel als Pegasos
II.8 „Der Schimmelreiter”: eine Novelle auf dem Rücken des Pferdes
III. Hugo von Hofmannsthal: Reitergeschichte - der Mensch fällt vom Pferd
III.1 „Reitergeschichte”: die Geschichte eines Reiters
III.2 Eine Erzählung zwischen Leben und Tod
III.3 Das Pferd als Kampfmaschine: Reiten zwischen Disziplin und eingefordertem Triebverhalten
III.4 Der Reiter Anton Lerch
III.4.1 Der Ritt durch Mailand
III.4.2 Wachtmeister Lerch: zwischen Himmel und Erde
III.4.3 Das Lahmen des „Braun”
III.4.4 Das kurzzeitige Verlassen des Pferderückens und seine Folgen
III.4.5 „Seitwärts der Rottenkolonne”
III.5 Vom Verlust der reiterlichen Dominanz: der Ritt durchs Dorf
III.5.1 Vom Galopp zum Schritt
III.5.2 Tierische Hindernisse
III.5.2.1 Die Ratten
III.5.2.2 Die Hunde
III.5.2.3 Die Kuh
III.5.3 Der Doppelgänger
III.6 Der Tod des Reiters
III.6.1 Ruf zur Attacke
III.6.2 Die Eroberung des „Prämiums”
III.6.3 Der Eisenschimmel
III.6.4 Lerch fällt vom Pferd
III.6.5 Die Aufkündigung der Ross-Reiter-Verbindung: Wachtmeister Lerch als Bellerophon
III.7 Das Pferd: Symbol des Unaussprechlichen
IV. Franz Kafka: Ein Landarzt - das Pferd ist tot, es lebe das Pferd
IV.1 Vom Umbruch der Ross-Reiter-Beziehung
IV.1.1 „Aber das Pferd fehlte, das Pferd”
IV.1.2 „Ein Landarzt” als Übergangsstadium
IV.1.3 Das Pferd als Symbol des Leidens
IV.2 Von der Sehnsucht nach dem Pferd
IV.2.1 Die Wiedergeburt des Pferdes
IV.2.2 Von der Anziehungskraft des Pferdes
IV.3 „Unbeherrschbare Pferde”
IV.3.1 Irdisch und unirdisch zugleich: die Landarzt-Pferde
IV.3.2 Das Pferd als Libidosymbol
IV.3.3 Die Reise ins Innere
IV.3.4 Im Krankenzimmer: zwischen Leben und Tod
IV.3.5 Die Pferde im Fenster
IV.3.6 Ein Wagenrennen ohne Ziel
IV.4 Der Reiter wird grotesk
IV.5 Die Landarzt-Pferde als Nachfolger des Trojanischen Pferdes
IV.6 Geschichten wie Pferde
V. Resümee
VI. Literaturverzeichnis
I. Einleitung
Lange bevor das Pferd vor den Wagen gespannt oder geritten wurde, muss es auf den Menschen eine große Faszination ausgeübt haben: Die ersten Götter, die sich der Mensch ersann, besaßen Pferdegestalt.
Mit dem Einsatz des Pferdes als Nutz- und Reittier begann eine jahrtausendlange enge Beziehung. Vor allem aufgrund seiner Schnelligkeit machte es den Fortschritt im wahrsten Sinne des Wortes möglich: Es trug den Menschen durch Zeit und Raum; große Strecken konnten schneller überwunden werden. Indem der Mensch das Pferd bestieg, erhob er sich über den Boden und erlangte neues Selbstbewusstsein.
So ist es zu verstehen, dass das Verhältnis zwischen Mensch und Pferd in Mythen und Literatur immer wieder verarbeitet wurde und wird.
In der Zeit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert beginnt sich der Mensch vom Pferd als Nutztier zu lösen; Maschinen, die er sich selbst ausgedacht hat, werden die Kreatur nach und nach ersetzen. Aber ist es nicht so, dass sich der Mensch auch heute noch der Symbolkraft des Pferdes kaum entziehen kann?
Die Jahrhundertwende bildet die grobe zeitliche Klammer für die im Rahmen dieser Arbeit ausgewählten Erzählungen. Sie erschien als Zeit des sich ankündigenden Umbruchs der Ross-Reiter-Beziehung besonders interessant. Zugleich ist davon auszugehen, dass ihre Autoren sich mit Pferden gut auskannten, da dieses Tier damals zum Alltag gehörte.
Nach deutschsprachiger Erzählliteratur namhafter Autoren der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, in der das Pferd eine große Rolle spielt, braucht man nicht lange zu suchen. Es boten sich an: „Der Schimmelreiter” von Theodor Storm (1817-1888), „Reitergeschichte” von Hugo von Hofmannsthal (1874-1929) und „Ein Landarzt” von Franz Kafka (1883-1924). Wichtig bei der Auswahl der Prosastücke war es, dass deren Entstehungs- bzw. Erscheinungsdaten nicht zu dicht beieinander lagen, um auch innerhalb des Zeitrahmens Entwicklungslinien aufzeigen zu können, wie sich die Darstellung des Pferdes gewandelt hat.
Bereits Anfang 1885 äußerte Theodor Storm die Idee, einen „Deichsagenstoff” in eine Novelle umzuformen, doch deren Umsetzung verzögerte sich: Storm begann mit der Arbeit am „Schimmelreiter” erst im Juli 1886.1 Immer wieder durch andere Projekte und durch Krankheit des Autors unterbrochen, wurde die Novelle, die letzte seines Lebens, am 9. Februar 1888 schließlich fertig. Im April und Mai 1888 erschien „Der Schimmelreiter” in Paetels „Deutscher Rundschau” und noch im gleichen Jahr ebenfalls bei Paetel in Buchform.
Das Jahr 1898 gilt als Entstehungsjahr der „Reitergeschichte” von Hugo von Hofmannsthal.2 Wann er diese Erzählung fertigstellte, lässt sich nicht mehr eindeutig rekonstruieren. Sie wurde in der Ausgabe vom 24. Dezember 1899 der „Neuen Freien Presse” veröffentlicht, im Buchdruck erstmals im Jahre 1905 unter dem Titel „Das Märchen der 672. Nacht und andere Erzählungen” im Wiener Verlag.
Franz Kafkas „Ein Landarzt” entstand wahrscheinlich im Januar und Februar 1917.3 Der Text erschien noch im selben Jahr in „Die neue Dichtung. Ein Almanach” bei Kurt Wolff, obwohl das Titelblatt des Almanachs die Jahreszahl 1918 aufweist. 1919 wird sie in Kafkas Sammlung „Ein Landarzt. Kleine Erzählungen” - als Buchdruck bei Kurt Wolff verlegt - zur Titelerzählung.
Die Verknüpfung dieser drei Erzählungen rechtfertigt sich auch mit Blick auf die Forschung zur „Reitergeschichte”: Immer wieder verweisen Literaturwissenschaftler einerseits auf den „Schimmelreiter”4, betonen andererseits jedoch die Nähe dieser Erzählung zum Werk Franz Kafkas5. Die „Reitergeschichte” bildet somit die Mitte dieser Arbeit und verbindet „Schimmelreiter” und „Ein Landarzt”.
In vorliegender Arbeit stehen die Pferde der erwähnten Erzählungen im Zentrum. Es geht um deren Darstellung - mit all ihren Anspielungen auf Mythologie und traditionelle Symbolik - und die Funktion, die die Pferde innerhalb des Textes einnehmen. Dabei trat die polyvalente Symbolik und antithetische Struktur der einzelnen Pferde schillernd zum Vorschein: Wie ein Chamäleon die Farbe wechseln sie ihre Deutungsmöglichkeiten und passen sich in ihrer Symbolik der Erzählsituation an.
Die einzelnen Kapitel verfolgen die Pferde durch die Geschichten, um sich vielleicht sogar auf diese Art und Weise zu einer Interpretation des Textes auf dem Rücken des Pferdes zu entwickeln. Dabei steht die jeweilige Erzählung nahezu ausschließlich im Mittelpunkt der Betrachtungen. Wenn es allerdings die Materiallage ergab, wurde beispielsweise auf Tagebucheinträge oder Briefe, die sich dem Pferd widmen, verwiesen.
Für die Einordnung und Interpretation der literarischen Pferde erwies sich die Untersuchung „Das Pferd als Symbol. Zur kulturellen Bedeutung einer Symbiose”6 von Marlene Baum als hilfreich, auch wenn sie sich auf die bildende Kunst bezieht. Auf ihre allgemeine Abhandlung über das Symbol „Pferd” wird verwiesen, wenn sich Verbindungen zu den einzelnen Pferden der untersuchten Erzählungen ergeben. Baums Thesen, die sie für die bildende Kunst als bestätigt sieht, sollen im Verlauf der Betrachtungen aufgegriffen, auf die Prosastücke transferiert und überprüft werden, soweit es der Rahmen dieser Arbeit zulässt:
- Fast alle Mensch-Pferd-Darstellungen lassen sich lesen als Nachfolger von den Kentauren, dem Pegasos und seinem Reiter Bellerophon oder vom Trojanischen Pferd.
- In fast allen Mensch-Pferd-Darstellungen steigert, spiegelt oder kontrastiert das Pferd den Menschen und wird damit zum wesentlichen Ausdrucksträger.
- Aus der sich verändernden Darstellungsweise des Pferdes lässt sich häufig kultureller Wandel ablesen.7
Nach Baum zeigten die Mythen von den Kentauren, von Pegasos und vom Trojanischen Pferd die „Urformen der Mensch-Pferd-Beziehung”8, gleichzeitig lieferten sie die „Urmuster für künstlerische Darstellungsformen von Mensch und Pferd”9:
Kentauren sind sehr alte mythische Vorstellungen, in denen sich die archaische seelisch-körperliche Einheit von Mensch und Tier manifestiert hat.10
Der Mythos von Pegasos und Bellerophon symbolisiert das psychische Beziehungsgeflecht zwischen Mensch und Pferd in anderer Weise als der Kentaur. Die Roß-Reiter-Symbiose des Helden und seines geflügelten Rosses beinhaltet sowohl deren harmonisches Gelingen als auch ihr Scheitern. So sehr der Mensch kraft seines Verstandes das Tier zu nutzen vermag, so deutlich zeigt sich auch die Problematik jeglicher symbiotisch-symbolischer Beziehungsformen, sobald diese der Reflexion des erwachten Bewusstseins unterzogen wird.11
Das Trojanische Pferd versinnbildlicht als kultisch-kriegerisches Objekt, das es einst war, die Fähigkeiten des Menschen, die Natur in seine Dienste zu stellen. Es zeugt damit von der vollzogenen Bewußtwerdung. Zugleich vermag es die Psyche seiner Erfinder und Nutznießer zu entlarven. Fast alle von Künstlern geschaffenen Pferde können als Nachfolger des Trojanischen Pferdes gesehen werden, da sie, ebenso wie dieses, Träger symbolischer Botschaften sind.12
Ein solches mythologisches Raster führt zwar zu Vereinfachungen und Reduzierungen, bietet aber auch Möglichkeiten, die Pferdedarstellungen zu strukturieren, um Entwicklungslinien erkennbar zu machen.
Im Folgenden soll nun unter anderem gezeigt werden, dass die ausgewählten Pferde-Geschichten auf zwei mythische Erklärungsmuster zurückzuführen sind, dass sie in ihrer chronologischen Folge den Ablösungsprozess von Mensch und Pferd in seiner Problematik widerspiegeln und verarbeiten und damit das Pferd als Symbol für kulturellen Wandel gelten kann und dass das Pferd von Erzählung zu Erzählung immer mehr zum Symbol der inneren Befindlichkeit des Menschen wird, indem es die Eigenschaften des Menschen spiegelt, steigert oder kontrastiert.
II. Theodor Storm: Der Schimmelreiter - eine Novelle auf vier Beinen
Mit der Niederschrift der Novelle „Der Schimmelreiter” hatte Theodor Storm große Schwierigkeiten. Am 29. August 1886 schrieb er an Paul Heyse über das Fortschreiten der Arbeit an diesem Text:
In Arbeit ferner: „Der Schimmelreiter”, eine Deichgeschichte; ein böser Block, da es gilt eine Deichgespenstersage auf die vier Beine einer Novelle zu stellen, ohne den Charakter des Unheimlichen zu verwischen.13
Man braucht nicht lange nach diesen vier Beinen in der Novelle zu suchen: Sie gehören dem Pferd, in dem sich nicht nur der unheimliche Charakter, sondern auch die gesamte Symbolkraft des Textes verdichtet. Storm setzt dieses archetypische Symbol14 schillernd und facettenreich ein. Mit der Einbettung des Pferdes in Aberglauben und Mythologie gelangt die Erzählung selbst in den Bereich des Mythischen, der den Leser in seinen Bann zieht.15
Auch der Erzähler, der die Geschichte des Schimmelreiters als Kind liest, konnte sie seitdem nicht mehr aus seinem Gedächtnis bannen, als habe sie in ihm etwas Ursprüngliches, zutiefst Menschliches bewegt: Dies ist der Erzähler des ersten Rahmens des „Schimmelreiters”. Genauso erging es wohl seinem Vorgänger, dem Erzähler des zweiten Rahmens, der dem gespenstischen Reiter glaubt begegnet zu sein und der die Geschichte Hauke Haiens - die Binnenerzählung - vom alten Schulmeister erfährt. So lebt der „Schimmelreiter” seit Mitte des 18. Jahrhunderts bis zu seiner Niederschrift Ende des 19. Jahrhunderts fort und schlägt durch sein mythologisches Fundament seine Brücken weiter in die Vergangenheit und als beliebte Schullektüre bis in die unmittelbare Gegenwart hinein. Dabei kann doch die Überlieferungssituation als sehr unsicher gelten, denn weder der Erzähler der letzten Verschriftlichung noch der alte Schulmeister, ein Aufklärer, verbürgen sich für die Wahrheit des Inhalts.16 Diese Erzählhaltung wurde als Moment einer ambivalenten Grundtendenz der Novelle schon vielfach erwähnt und interpretiert.17
Fakten und Historizität allein können also die Anziehungskraft des „Schimmelreiters” nicht ausmachen; gerade wegen seiner Einbettung in die Mythologie muss sie auf einer höheren, symbolischen Ebene liegen18, die, wie noch zu zeigen ist, maßgeblich mit der zentralen Rolle des Pferdes zusammenhängt. Der Schimmel ist mit der Handlung und den Figuren auf solch enge Weise verbunden, dass die „Deichgeschichte”19 ohne ihn nicht zu denken ist. Das Pferd trägt im wahrsten Sinne des Wortes die Erzählung auf seinem Rücken, steht, wie Storm es ausdrückte, auf vier Beinen im Text: Bereits im Titel begegnet dem Leser das Pferd, insgesamt findet dieses Tier im „Schimmelreiter” über 135 Erwähnungen.20 Überhaupt spielen Tiere und insbesondere Pferde in Storms Werk eine große Rolle.21 Nach diesen Überlegungen erscheint es durchaus gerechtfertigt, den Versuch zu wagen, die Novelle vom Pferd her zu interpretieren.22
II.1 Der zeitgenössische Erwartungshorizont
Schon im Titel23 wird das Mensch-Pferd-Verhältnis eindeutig definiert: „Der Schimmelreiter”. Bereits der Begriff „Reiter” entbehrt nicht einer gewissen Spannung, denn einen Reiter kann es ohne Pferd nicht geben, das Pferd muss immer mitgedacht werden. Die Identität wird unsicher. Die Beziehung zwischen Mensch und Tier schwingt mit, und weil der Mensch hier über das Tier definiert wird, auch eine Art von Abhängigkeit. Der Reiter kann ohne Pferd nicht sein, und umgekehrt wurde zu Storms Zeit das Pferd wohl ausschließlich als Arbeits- und Reittier und damit als dem Menschen untergeordnet gesehen. Da das Wort „Reiter” das Pferd beinhaltet und der Reiter realiter das Pferd von oben dominiert, zeigt sich die Überlegenheit des Menschen dem Tier gegenüber. Aber in diesem Falle scheint es fast, als sei das Ungleichgewicht aufgehoben, indem Storm das Pferd explizit nennt und - was die Farbe angeht - noch konkretisiert; und dennoch verschiebt sich durch das zweifache Auftreten des Pferdes im Titel das Gewicht unmerklich auf das Pferd, auf die animalische Seite.
Storm wird sogar noch konkreter: Es geht um den Schimmelreiter mit direktem Artikel, nicht um irgendeinen beliebigen. Das Leserpublikum des 19. Jahrhunderts wird dabei an den personifizierten Tod gedacht haben, der im Volksaberglauben auf einem mageren Schimmel reitet.24 Diese Vorstellung hat ihren Ursprung in alten mythologischen Grundlagen. So besaßen zum Beispiel die ursprünglichen Gottheiten in altgermanischer Zeit Pferdegestalt; hierin zeigt sich die „tierdämonologische Funktion des Pferdes mit chthonischer Bedeutung”25. Aus dem Tierdämon wird der Totengott Wotan und sein Pferd - der achtbeinige Schimmel Sleipnir - göttliches Attribut. Unter dem negierenden Einfluss des Christentums auf altgermanische Sagen wird die Wotansmythe zur Teufelsmythe des gespenstischen Schimmelreiters degradiert, der Tod und Unheil bringt und auch als Seelenführer agiert.26 In einigen Varianten nimmt er sogar seine Geliebte mit ins Grab, was mit Blick auf das Ende des „Schimmelreiters” besonders interessant erscheint. Ohne die Erzählung zu kennen, wird der Titel beim Leser Todesassoziationen wecken. Der gespenstische Schimmelreiter gilt als spukhafter Sturmdämon27, lässt also auch an unheimliche Erscheinungen bei Unwetter denken.
Doch das weiße Pferd ist nicht nur mit den chthonischen Gottheiten und damit mit Tod und Schrecken verbunden, sondern nimmt seinen „mythologischen Aufstieg”28 als Pferd des Sonnengottes und Symbol des aufstrebenden Geistes. Aus diesem Grund wird es später zum bevorzugten Pferd der siegreichen Helden: „Aus dem lunar-chthonischen Tier wurde das strahlende Roß der solaren Helden!”29 Der mythologische Aufstieg des Pferdes ist Symbol für die Bewusstwerdung des Menschen und den kulturellen Wandel.
Während die Bedeutung des Pferdes als Seelensymbol, als Symbol für Hexen und Teufel und als Wassersymbol primär chthonische Aspekte beinhaltet, zeugt das Pferd als Sonnensymbol von der beginnenden oder vollzogenen Bewußtseinserhellung des Menschen [...].30
Mit dieser ambivalenten Hell-Dunkel-Symbolik des Pferdes richtet sich der Erwartungshorizont des Lesers auf eine Geschichte zwischen Leben und Tod, eine Geschichte, die auf Polaritäten gründet. Dass Storm der Schimmel mit all seinen Konnotationen wichtig gewesen sein muss, lässt sich auch daran erkennen, dass er den ursprünglichen Titel seiner Quelle „Der gespenstige Reiter” aus dem „Danziger Dampfboot” vom 14. April 1883 nicht beibehält.
II.2 Der magisch-mythische Schimmel
II.2.1 Die Anspielung auf die Wotan-Mythe
Der Erzähler des zweiten Rahmens reitet seine Stute auf dem Deich und wird vom Wind fast ins Wasser hinabgedrückt; man kann diesen Deich also auch durchaus als Grenzregion zwischen Leben und Tod sehen.31 Der Erzähler begegnet während dieses Sturmes bei Mondschein auf dem Deich der gespenstischen Erscheinung des Schimmelreiters:
Jetzt aber kam auf dem Deiche etwas gegen mich heran; ich hörte nichts; aber immer deutlicher, wenn der halbe Mond ein karges Licht herabließ, glaubte ich eine dunkle Gestalt zu erkennen, und bald, da sie näher kam, sah ich es, sie saß auf einem Pferde, einem hochbeinigen hageren Schimmel; ein dunkler Mantel flatterte um ihre Schultern, und im Vorbeifliegen sahen mich zwei brennende Augen aus einem bleichen Antlitz an. (S. 697 f.)
Diese Gestalt erinnert an den unheimlichen Reiter, der im Volksaberglauben den Tod repräsentiert. Noch deutlicher wird die Ähnlichkeit mit dem zum Teufel degradierten Wotan, wie ihn Marlene Baum nach Max Jähns zitiert:
Als der „Wilde Jäger” taucht er „selbst auf luftigem, grauweißem Rosse, dem das Feuer aus den Nüstern sprüht, auf. Das Haupt des Reiters bedeckt ein großer, breitkrempriger Hut; ein mächtiger, schwarzer Mantel wallt um seine Schultern.”32
Die Unsicherheit über die Identität des Schimmelreiters ist insofern erhalten, als der Reisende nur glaubt, sie zu sehen, was wiederum den Charakter des Unheimlichen verstärkt und die Erscheinung in den Bereich des Aberglaubens rückt. Diese „visuelle und akustische Indirektheit”33 findet sich immer, wenn der gespenstische Reiter in der zweiten Rahmenerzählung erscheint: „[M]ir war, als streifte mich der fliegende Mantel, und die Erscheinung war [...] lautlos an mir vorübergestoben” (S. 698) oder: „[D]ann war’s, als säh ich plötzlich ihren Schatten [...]” (ebd.).
Im Wirtshaus erfährt der Reisende dann, dass die Gestalt auf dem Deich durchaus kein Unbekannter ist; dies sei der Schimmelreiter. Vom alten Schulmeister, der - noch bevor er zu erzählen beginnt - einwendet, es sei viel Aberglaube dazwischen (vgl. S. 700), wird der Reisende die Geschichte des Schimmelreiters erfahren. Die chthonische Bedeutung des Pferdes ist - wie oben schon angedeutet - in den Aberglauben verlagert und zeugt noch von Überresten eines magisch-mythischen Weltbilds. Storm distanziert sich von diesem, indem er es in einem ‘Als-ob-Stil’ schildert oder dem einfachen Volk in den Mund legt.34
II.2.2 Das Pferdegerippe auf Jevershallig
Dies wird besonders deutlich in der Geschichte vom Pferdegerippe auf Jevershallig bzw. Jeverssand. Der Schulmeister unterbricht zuvor seine Erzählung, um das bisher Berichtete als „Überlieferungen verständiger Leute” (S. 753) von dem nun folgenden „Geschwätz des ganzen Marschdorfes, sobald nur um Allerheiligen die Spinnräder an zu schnurren fangen” (ebd.) abzugrenzen. Niemand kann sich erklären, wie das Pferd dort auf die Hallig gelangt war.
Ein paar weißgebleichte Knochengerüste ertrunkener Schafe und das Gerippe eines Pferdes, von dem freilich niemand begriff, wie es dort hingekommen sei, wollte man, wenn der Mond von Osten auf die Hallig schien, dort auch erkennen können. (S. 753 f.)
Doch an manchen Abenden „sollen die Knochen sich erheben und tun als ob sie lebig wären” (S. 755). Als der Dienstjunge Carsten und der Knecht Iven Johns zum ersten Mal meinen, dort ein Pferd zu erkennen, kann man die Hallig selbst im „trüben Mondduft” (S. 754) kaum ausmachen. Die Flut steigt, und nur das Meer ist zu hören. Auch beim zweiten Mal heißt es, die Hallig stehe wie ein Nebelfleck im Wasser; der Mond scheint wieder von Osten. Wird das Pferd in den Augen des Betrachters lebendig, so sind die Knochen nicht mehr zu sehen.
Der Dienstjunge weiß dieses Pferd sofort einzuordnen: „Da geht ein Pferd - ein Schimmel -, das muss der Teufel reiten - wie kommt ein Pferd auf Jevershallig?” (ebd.) Doch als er selbst zur Hallig fährt, liegt dort nur das Gerippe. So bleibt die Wahrheit über diese Erscheinung merkwürdig in der Schwebe; nur in der Distanz des Beobachters scheint sie zu existieren, und auch hier handelt es sich wieder um ein Dasein zwischen Leben und Tod. Dass auf der Hallig ein Pferd läuft, ist nur in die Personenrede gestellt, der Erzähler aber bleibt wie so oft, was dieses Phänomen betrifft, indirekt: „[N]ur was sie für ein Pferd, einen Schimmel hielten, schien dort auf Jevershallig noch beweglich” (S. 755) oder: „Drüben aber war es, als hebe, was dorten ging, den Hals [...].” (S. 756)
Bei Tag sucht Carsten das Pferd vergebens; es gehört der Nacht, wenn der Mond von Osten scheint. Die Nebelschwaden tun ihr übriges. Die Naturphänomene ergänzen sich in solchen Nächten anscheinend so gut, dass sie das seltsame Schauspiel begünstigen und die Einbildungskraft derart anregen, dass ein im Aberglauben als spuk- und gespensterhaft geltender Schimmel entsteht.35
II.2.3 Der Schimmel als Muttersymbol
Die Verbindung von Nacht, Mond und Wasser ordnet diesen Schimmel in den magisch-lunaren Bereich:
Wenn das Pferd nicht zu Fuß auf Jevershallig gelangt sein kann, liegt der Gedanke nahe, es werde in Mondnächten aus dem Meer geboren36, um daraufhin wieder in Knochen zu zerfallen, als zeige es den Kreislauf von Werden und Vergehen. Tatsächlich gibt es bei Griechen und auch Arabern Mythen, die eine Entstehung des Pferdes aus dem Wasser kennen. So habe Poseidon, der ursprünglich selbst als Rossgestalt gedacht wurde, dem Menschen das Pferd geschenkt.37 Interessant erscheint besonders die Geburt des arabischen Pferdes aus dem Wasser38, da es über Haukes gekauften Schimmel heißt, er „[...] hatte, was die Araber verlangen, ein fleischlos Angesicht” (S. 761).
Das Wasser, das alles gebärende und verschlingende Prinzip, gilt als Symbol des Archetypus’ Mutter.39 Auch das Pferd wird als das den Menschen tragende Tier der Muttersymbolik zugeordnet. Wasser und Pferd bedeuten Bewegung und Transportmittel. Beide Symbole sind polar besetzt, drücken Gefahr und Sicherheit, Tod und Leben aus. Wegen dieser umfassenden Symbolik gilt das Pferd auch als kosmisches Symbol, als Symbol für die Welt.40
Der Mond, das „milde Gestirn” (S. 806), steht ebenfalls für das mütterliche Prinzip und ist aufgrund der Gezeiten eng mit dem Meer verbunden. Diese Nähe von Wasser, Pferd und Mond zum Weiblichen41 und damit zum ewigen Kreislauf von Werden und Vergehen verweist auf ein archaisch-mütterliches, ein matriarchalisches Weltbild.
Dabei hat der Schimmel durch seine analoge Farbgebung nochmals eine besondere Beziehung zum Mond und auch zum Wasser, denn im Mittelalter galt der Schimmel im Zuge der Temperamentenlehre als „das weiche Element des Wassers und das Phlegma”42. Wie der Schnee würden diese Tiere ihre Konsistenz wechseln, was natürlich den Zyklus von Werden und Vergehen noch unterstreicht.
All diese Elemente spielen in der Geschichte vom Gerippe auf Jeverssand eine Rolle, sind miteinander verwoben und verstärken den chthonischen Charakter des Schimmels auf der Hallig. Allerdings ist dieser in den Aberglauben verlagert und wird vom Dienstjungen sofort mit dem Teufel in Verbindung gebracht.
Damit ergeben sich Analogien zum Schimmel aus der zweiten Rahmenerzählung, den der Reisende auch nachts bei Mondschein sieht bzw. ja auch hier ihn nur glaubt zu sehen und von dem es in der dritten Unterbrechung der Binnenerzählung heißt, er habe sich unter seinem Reiter in den Bruch gestürzt (vgl. S. 737). Dies verweist bereits auf das tragische Ende der Binnenerzählung.
II.2.4 Das Pferdegerippe und der Schimmel Haukes
Der Schimmel Haukes wird mit dem Pferdegerippe auf Jevershallig in Verbindung gebracht: Hauke kauft seinen Schimmel genau zu dem Zeitpunkt, als „[...] der Mond zurückgegangen, und die Nächte dunkler geworden waren [...]” (S. 758), als also die äußeren Umstände das Erkennen des Geisterpferdes nicht mehr zuließen. Gleichzeitig kann der Dienstjunge selbst die Knochen „weder Tages noch bei Mondschein” (S. 762) entdecken. Nach Haukes Sturz ins Meer ist das Gerippe im Mondlicht wieder da: „[D]as ganze Dorf will es gesehen haben.” (S. 808) Das frisch gekaufte Pferd ist so „[...] mager, dass man jede Rippe zählen konnte [...].” (S. 758) Dies und sein schon erwähnter „fleischloser” Araberkopf evozieren die Vorstellung, es sei das belebte Gerippe aus dem Meer und werde von diesem wieder verschlungen, als habe das Tier Hauke als Psychopompos bzw. Seelenführer abgeholt.43 Es bleiben allerdings Vermutungen, weil Storm diese Verbindungen mit oben aufgezeigten Mitteln in der Schwebe hält, wie überhaupt die gesamte Novelle an der Grenze von Leben und Tod spielt.44
Der Dienstjunge sagt von dem geheimnisvollen Pferd auf der Hallig, es ginge „wie lebig”, und kurze Zeit später meint der Knecht zu Carsten über Haukes Schimmel: „Wenn je ein Pferd ein lebigs war, so ist es der!” (S. 763) Elke berichtet Hauke von dem Brauch, „was Lebigs” in den Damm zu werfen, damit der Deich halte. Hier findet sich ebenfalls eine Verbindung von dem Gerippe aus dem Meer und dem Schimmel und gleichzeitig wieder eine Allusion auf das Ende Haukes, gewissermaßen als Deichopfer. Dies wird noch verstärkt, berücksichtigt man, dass der Schimmelhengst wegen seiner besonderen Bindung zu Gottheiten bei fast allen indogermanischen Völkern zu den beliebtesten Opfertieren zählte.45 Die Griechen opferten ihren chthonischen Göttern Schimmel auch durch Ertränken; so stieß Mithridates vor Beginn des Krieges gegen die Römer ein Gespann weißer Rosse ins Meer.
Ebenfalls auf Haukes Ende verweist die Sage vom nordischen Wassergott Nikur in apfelgrauer Rossgestalt. Wer ihn besteigt, mit dem stürzt er sich in die Fluten. Bezeichnenderweise ist auch Haukes Schimmel nicht völlig weiß; er besitzt ein „blaugeapfeltes Fell” (S. 761).46
Wegen dieser Anspielungen wird es dem Leser schwer fallen, Haukes Schimmel nicht diesem magisch-mythischen Bereich zuzuordnen, gerade auch weil er von der Dorfgemeinschaft immer wieder als „Teufelspferd” bezeichnet wird und Hauke als „Schimmelreiter”.47 Fest steht, dass sein Pferd vom Dorfvolk durch den Aberglauben mit dem Teuflischen identifiziert wird. Bleibt also zu fragen, inwieweit es, was ja mit der chthonischen Auslegung verbunden ist, mit der Symbolik des Mütterlichen, der Polarität von Leben und Tod und dem Unbewussten korrespondiert.
II.3 Der Schimmel des aufstrebenden Bewusstseins
II.3.1 Hauke Haien: der Vernunftmensch
Der Vernunftmensch Hauke Haien, „die lange Friesengestalt mit den klugen grauen Augen neben der hageren Nase und den zwei Schädelwölbungen darüber” (S. 743 f.), versteht es schon als Kind, gut zu rechnen.48 Er wächst ohne Mutter auf; zumindest wird sie nie erwähnt.49 Gerade in Situationen, in denen das Meer eindeutig negativ besetzt ist, nämlich bei stürmischem Wetter, zieht es ihn unweigerlich hinaus ans Wasser auf den Deich, um sich bessere Deichprofile auszudenken:
Stand eine Springflut bevor, so konnte man sicher sein, er lag trotz Sturm und Wetter weit draußen am Deiche mutterseelenallein. (S. 704)
Anscheinend fühlt sich der junge Hauke von diesem mütterlichen Element angezogen, jedoch nur, wenn es seine vernichtende Seite zeigt, und diese möchte er weiter eindämmen. Dafür begibt er sich in Grenzsituationen am Abgrund des Todes, für die der Deich steht, und ist sich dessen wohl bewusst. Sein Vater ermahnt ihn:
„Hörst du mich nicht? Ich sag, du hättst versaufen können.”
„Ja”, sagte Hauke; „ich bin doch nicht versoffen”!
„Nein”, erwiderte nach einer Weile der Alte [...],- „diesmal noch nicht.” (S. 703)
Die Todessymbolik des Meeres50 wird immer wieder hervorgehoben: Es ist die „wilde Wasserwüste” (ebd.), wirft Wasserleichen aus. Als Hauke im Winter auf dem Deich steht, ist ihm, „[...] als liege die ganze Welt in weißem Tod” (S. 705), ein Hinweis auf seinen Tod als Schimmelreiter, wenn der Schimmel auch nie im Text als weißes Pferd bezeichnet wird.
Einsam, „nur mit Wind und Wasser” (S. 707), wächst Hauke zu einem „langen, hageren Burschen” (ebd.) heran. Nun steht auch der Wind als etwas Bewegtes mit dem Pferd aufgrund dessen Schnelligkeit in engem Zusammenhang; viele Mythen schildern seine Schöpfung aus dem Wind. Als Geschöpf des Windes wird es zum Symbol für Bewusstseinserweiterung und Expansionsdrang des Menschen.
Diesen Drang verspürt auch der Rechner Hauke Haien. Nachdem er den Kater der alten Trin’ Jans umgebracht hat, die in einer Kate auf dem Außendeich ihr Dasein fristet, erklärt er sich seinem Vater:
„Ja, man wird grimmig in sich, wenn man’s nicht an einem ordentlichen Stück Arbeit auslassen kann.” (S. 712)
Haukes Streben gilt es allerdings, das für ihn bedrohliche, mütterliche Prinzip einzudämmen; das zeigt sich äußerlich in seinen Deichbauvorstellungen, innerlich im Wunsch nach Beherrschung seiner Triebe, seines Unbewussten.51 Während er den weißen Angorakater der Trin’ Jans tötet, der doch nur seinen Instinkten gefolgt war, kann er seine Triebe nicht im Zaum halten. Bezeichnenderweise geschieht dies dann, als Hauke seine Beute nicht mehr einvernehmlich mit dem Tier zu teilen bereit ist, sondern ihm seinen Willen aufzwingen will. Die Kreatur versteht nicht, der Gegensatz zwischen Tier und Mensch bricht auf, bis Hauke ebenfalls instinktiv und unvernünftig reagiert: Nach dem Gesetz der Natur gewinnt der Stärkere. Mit dem Kater tilgt Hauke auch die letzte Erinnerung der Trin’ Jans an ihren ertrunkenen Sohn52: „Kein Kind, kein Lebigs mehr!” (S. 710) beweint Trin’ Jans den Verlust ihres Vierbeiners. Wieder verletzt Hauke das ursprünglich Mütterliche, von dem er sich lösen möchte.
Hauke Haien tötet den weißen Kater, das weiße Pferd aber wird er zu reiten und zu zügeln wissen; als Schimmelreiter wird er auch „Symbol der Beherrschung wilder Kraft”53.
II.3.2 Hauke, Elke und der Schimmel - oder von der Einschränkung des Weiblichen
Zwischen der Deichgrafentochter Elke Volkerts und Hauke Haien gibt es einige Parallelen: Bei Elkes erster Beschreibung im Text heißt es, sie habe einen hageren Arm; auch ihr Blick liegt auf dem Meer, allerdings scheint das große Wasser für sie positiver besetzt zu sein als für Hauke:
Die Dirne schien von dort ihre Augen über den Deich hinaus nach dem Meer zu haben, wo an dem stillen Abend die Sonne eben in das Wasser hinabsank und zugleich das bräunliche Mädchen mit ihrem letzten Schein vergoldete. (S. 714)
„[S]ie waren beide geborene Rechner [...]” (S. 717), doch Elke schaut als Frau „über den Deich hinaus” zum Meer, während der Mann Hauke sich am Deich festrechnet. Schon früh bekommt Hauke von seinem Vater als quasi männliches Prinzip auf den Weg, er könne es ja vielleicht zum Deichgrafen bringen und verfolgt daraufhin diesen Gedanken bis zum Ziel: „’Ja, Vater!’ erwiderte der Junge.” (S. 704) Doch sein Verstand allein reicht dazu nicht, er muss die Frau Elke zur Unterordnung zwingen, und Elke, die in patriarchalen Strukturen aufwuchs, lässt dies bereitwillig geschehen.
Nachdem Hauke seinen Dienst als Kleinknecht unter dem Deichgrafen angetreten hatte und mitrechnen durfte, lobt der Oberdeichgraf die Arbeit seines Wirts. Dieses Rechnen aber richtet sich zunächst gegen die alte Trin’ Jans und die dicke Vollina, die auf einer alten Stute zu reiten pflegt. Hauke weist beide Frauen in ihre Schranken; mit Erfolg, wie Elkes Worte beweisen:
„Nein, Hauke; als ich allein der Helfer war, da wurden wir nicht gelobt. Ich kann ja auch nur rechnen; du aber siehst draußen alles, was der Deichgraf doch wohl selber sehen sollte; du hast mich ausgestochen!” (S. 722)
„Denk nur nicht, dass mir’s leid tut, Hauke”, sagte nach kurzem Sinnen das Mädchen; „das ist ja Mannessache!” (S. 723)
Was hier Mannessache ist, scheint eindeutig: Es ist die Einschränkung des Weiblichen, was das Patriarchat gleichzeitig aber auch auf lange Sicht bedroht. Die Einseitigkeit des patriarchalen Prinzips schwächt es mit der Zeit von innen heraus; spätestens in der dritten Generation, wie Tede Haien betont (vgl. S. 716). Aus diesem Grund wird Hauke mit den Worten Ole Peters’ Deichgraf „von seines Weibes wegen” (S. 747) und deswegen von den Dorfbewohnern verspottet. Zwischen den beiden zukünftigen Eheleuten ist die Heirat nach dem Tod des alten Deichgrafen abgemachte Sache. Mit Hilfe des Eisboselspiels hat Hauke Elke gewonnen. So weit haben die Frauen das patriarchale System internalisiert, dass sie dessen Schwachstellen kitten und an ihrer eigenen Unterdrückung unbewusst mitarbeiten.
Mit ihrer Heirat gerät die junge Frau in den Grenzbereich von Leben und Tod, den Hauke umgibt. Dies wird schon deutlich am Tag, als ihr Vater stirbt und damit dem Aufstieg Haukes nichts mehr im Wege steht: Sie wird vom Erzähler mit ähnlichen Worten beschrieben wie die zwei Rappen, die den Sarg ihres Vaters ziehen: „Schweife und Mähnen der Pferde wehten in dem scharfen Frühjahrswind.” (S. 741) Von Elke heißt es:
Hier blieb sie stehen und sah, während ihre Trauerkleider im Frühlingswinde flatterten, wie drüben an dem Dorfe jetzt die letzten Wagen zur Kirche hinauffuhren. (ebd.)
Elke wird durch die schwarzen Pferden - die Seelenbegleiter im scharfen Wind - mit dem Tod in Verbindung gebracht. „Sie richtete sich auf, blickte noch einmal scharf hinaus [...].” (S. 742) Dabei herrscht „Totenstille” (S. 741) und „Gedanken des Todes und des Lebens begannen sich in ihr zu streiten” (S. 742). Von Haukes Arbeitsweise heißt es wenig später, er fege mit einem scharfen Besen (vgl. S. 746). So stehen also Pferd, Tod, Elke und das Werk Haukes in engem Zusammenhang. Elke sagt selbst über Haukes Deichbauvorhaben: „[D]as ist ein Werk auf Tod und Leben.” (S. 750)
Als Hauke das böse Wort über ihn, er sei nur Deichgraf seines Weibes wegen zu Ohren bekommt, ist er außer sich. Wieder einmal bricht der instinktive Hass gegen seine Umwelt hervor: „’Hunde!’ schrie er, und seine Augen sahen grimmig zur Seite, als wolle er sie peitschen lassen.” (S. 747) Elke beruhigt ihn: „[N]ur wer ein Amt regieren kann, der hat es!” (S. 748) Sie selbst weist ihm den Weg, auf welche Weise er diesen Makel kompensieren kann, denn mit dem Deichbau hat er die Möglichkeit, das Weibliche auf einer höheren Ebene einzuschränken.54 Endlich bekommt der Deichgraf durch seine Frau den äußeren Anstoß, das, was „[...] bis jetzt nur noch in seinem Kopf vorhanden war” (S. 749), mit dem er jahrelang schwanger gegangen war, in die Tat umzusetzen. Seine Ehe blieb bis zu diesem Zeitpunkt bezeichnenderweise unfruchtbar.
Für sein Vorhaben muss sich Hauke mehrere Male in die Stadt zum Oberdeichgrafen begeben. Dabei wird zum ersten Mal erwähnt, dass Hauke reitet. Doch zu diesem Zeitpunkt reitet er noch seinen braunen Wallach, ein kastriertes männliches Pferd. Solange der Deichbau eine Kopfgeburt bleibt, wird Hauke den Braunen noch reiten; den Schimmel besteigt er mit den ersten Arbeiten am Deich: „Das verschnittene Pferd gibt vor, mehr zu scheinen, als es ist [...].”55 Es ist Zeichen dafür, dass Hauke sich den Titel „Deichgraf” noch verdienen muss, gleichzeitig aber auch dafür, dass er seine Triebnatur noch nicht vollständig unter Kontrolle hat, seine Gedanken und seine Ehe unfruchtbar sind. Doch die Idee, das große Element des Mütterlichen zu dämmen, erfordert einen klaren Verstand, den sich Hauke zunächst in seinem Innern erkämpfen muss:
Wie ein Rausch stieg es ihm ins Gehirn; aber er preßte die Nägel in seine Handflächen und zwang seine Augen, klar und nüchtern zu sehen, was dort vor ihm lag. (ebd.)
Gleichzeitig grenzt er seine Frau mehr und mehr aus seinem Vorhaben und Leben aus:
Sein Verkehr mit anderen Menschen außer in Arbeit und Geschäft verschwand fast ganz; selbst der mit seinem Weibe wurde immer weniger. (S. 752)
Nachdem das neue Deichprojekt angenommen ist, wartet Elke nicht mehr sehnsuchtsvoll abends im Bett auf ihren Mann, sondern schläft bereits. Sie ist „ausgestochen” (S. 722).
II.4 Der Schimmel als Libidosymbol
Es scheint, Elkes Platz sei von jemand anders eingenommen: Mit der Akzeptanz des Deichbaus kommt der Schimmel. Als Hauke ihn nach dem Kauf vorführt, wird auch sein brauner Wallach zum ersten Mal genannt - wahrscheinlich um den Kontrast zwischen beiden Tieren und den Entwicklungsstufen Haukes deutlich zu machen. Interessant ist nun, wie Hauke seiner Frau erläutert, wie es zu dem Pferdehandel gekommen sei: Sein Profil sei vom Oberdeichgrafen akzeptiert und für folgende arbeitsreiche Zeit habe der Herrgott sie zusammengebracht. Auf den ersten Blick scheint das mit dem Pferdekauf nichts zu tun zu haben und doch sind es die ersten Gedanken, die Hauke zu diesem Thema einfallen. Darauf antwortet Elke: „[I]ch bring dir keine Kinder.” (S. 759) So stehen also Deichbau, Schimmel und die unfruchtbare Ehe in engem Zusammenhang. Wenn Hauke mit dem Deich das weibliche Prinzip bekämpfen will, das Pferd als Muttersymbol unter sich zwingt56 und die Ehe letztlich nur dazu dient, diesen Kampf auszutragen, erkennt Elke unbewusst die Folgen des Kampfes auf privater Ebene: Die Ehe bleibt unfruchtbar.
Es lohnt sich, den Jungfernritt des Deichgrafen auf seinem Schimmel näher zu betrachten:
Dann führte er es aus dem Stall und legte ihm einen leichten Sattel auf; aber kaum saß er droben, so fuhr dem Tier ein Wiehern wie ein Lustschrei aus der Kehle; es flog mit ihm davon, die Werfte hinab auf den Weg und dann dem Deiche zu; doch der Reiter saß fest, und als sie oben waren, ging es ruhiger, leicht, wie tanzend, und warf den Kopf dem Meere zu. Er klopfte und streichelte ihm den blanken Hals, aber es bedurfte dieser Liebkosung schon nicht mehr; das Pferd schien völlig eins mit seinem Reiter [...]. (S. 761)
Von Anfang an lässt sich der Schimmel nur von Hauke besteigen, auch wenn er seinem Knecht versichert: „[E]s trägt dich wie in einer Wiege!” (ebd.) Spätestens mit diesem Ausruf ist die Deutung des Pferdes als Muttersymbol im Text nicht mehr zu bestreiten. Die Tragfunktion dieses Tieres wird in direkten Bezug zur Wiege gesetzt. Anscheinend ohne Zutun des Reiters führt der Weg des Pferdes sofort auf den Deich - das das Wasser eindämmende Prinzip -, um dann seinen Blick in freier Sicht aufs Meer richten zu können.
Sobald Hauke den Schimmel bestiegen hat, folgen Beschreibungen, die an eine sexuelle Beziehung zwischen Reiter und Pferd denken lassen57: Lustschreie, die tanzende Bewegung, Liebkosungen und die fast völlige Vereinigung. Der Schimmel wird zum Libidosymbol; im Bild des Reitens vereinigen sich Mutter- und Libidosymbolik:
Indem der Mann zum Reiter wird, zwingt er symbolisch die Libido unter sich. Er erhebt sich im wahrsten Sinne des Wortes über die mütterliche Erde und löst sich damit von der Übermacht des Unbewußten.58
II.5 Die Ross-Reiter-Beziehung zwischen Schimmel und Hauke
II.5.1 Das Pferd-Reiter-Verhältnis als Bild der Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur
Das Pferd vereinigt als Muttersymbol die Polarität von Leben und Tod. Durch diese in ihm angelegte Polarität kann es sowohl den chthonischen als auch - im Zuge der Bewusstwerdung des Menschen - den solaren Bereich repräsentieren.
Es [das Pferd] vereinigt die Libidosymbolik der Mutter, also die unbewußte Triebsphäre, mit der männlichen Libidosymbolik des unaufhaltsam vorwärtsstrebenden Bewußtseins. So vermag das Pferd in idealer Weise den Expansionsdrang des Mannes zu befriedigen.59
Daher zeigt sich das Aufstreben des menschlichen Geistes ebenfalls in der Entwicklung von ursprünglichen Gottheiten in Rossgestalt über das Pferd als Attribut der Götter bis zum Pferd des solaren Helden. Wenn der Held aufs Pferd steigt, um seinem Expansionsdrang zu folgen, wird diese Polarität auf Ross und Reiter übertragen: Aufgrund der Unmöglichkeit des dauerhaften harmonischen Einsseins von Natur und Mensch muss sich der Mensch als vernünftiges Wesen von der Natur, dem Unbewussten lösen.60 Während dieses schmerzlichen Lösungsprozesses wird der Abstand zwischen Natur und Mensch immer größer; das Ross-Reiter-Verhältnis spiegelt diesen Konflikt. Die kentaurische Einheit beider Wesen aus einem magisch-mythischen Zeitalter ist aufgehoben bzw. drückt nur noch den utopischen Wunsch des Menschen nach Einheit mit der Natur aus. Pferd und Reiter aber sind zwei Wesen; auch von Hauke und seinem Schimmel heißt es ja: „[...] das Pferd schien völlig eins mit seinem Reiter [...]”61 (ebd.), wobei der Reiter das Pferd und damit die Natur62 aus einer höheren Position mit seinem Verstand gewaltsam zu beherrschen sucht.
Dieser Kampf findet auf zwei Ebenen statt; er richtet sich sowohl nach außen als auch nach innen. Äußerlich zeigt er sich im Konflikt des Menschen gegen Naturgewalten, innerlich in der Auseinandersetzung mit den eigenen vitalen Instinkten, mit dem eigenen Unbewussten: dem Es. Die Begriffe „Ich” und „Es” werden in dieser Arbeit in folgendem Sinne gebraucht: „Ich” steht für Verstand und aufstrebendes Selbstbewusstsein des Menschen, „Es” für seine vitalen Instinkte.
In der Roß-Reiter-Symbiose verkörpert das Pferd das Es und der Reiter das Ich, das als geistiges Prinzip die männlich-beherrschende Rolle übernimmt [...].63
Dabei kann sich das menschliche Ich erst dann entwickeln, wenn die kentaurische Einheit verloren ist und der Mensch sich bewusst seinem Es gegenüber abzugrenzen versucht.
Haukes Schimmel verkörpert ebenfalls beide Kampfesebenen: Er zeigt einerseits in Verbindung mit dem Deichbau den Kampf gegen das weibliche Prinzip als Inbesitznahme der Welt, andererseits den Kampf im Zügeln der eigenen Triebe, des Unbewussten. Das Stadium der mangelnden Selbstkontrolle des jungen Hauke, das noch beim Töten des Katers vorherrscht, scheint überwunden, und doch wird das Unbewusste immer wieder hervorbrechen, muss es immer wieder an die Kandare genommen werden. Davon zeugt unter anderem die ständige Anwesenheit des Schimmels während der Deichbauarbeiten.
II.5.2 Der Schimmel als Heldenross
Der Schimmel zeigt viele Eigenschaften eines Heldenrosses.64 So bildet er mit seinem Reiter, dem Vernunftmenschen Hauke Haien, eine fast vollkommene Einheit; er lässt sich nur von Hauke reiten, und beide gehen gemeinsam in den Tod. Im Streben nach dem vollkommenen Sieg des Bewusstseins dient das ehemals numinose Tier dem Helden als Ausdruck seiner Macht zur Selbsterhöhung. Damit gelangt er in die Nähe des Göttlichen und somit in die Gefahr der menschlichen Hybris, der auch Hauke verfällt65: Als Elke im Kindbettfieber liegt, heißt es von ihm, er habe sich sein eigen Christentum zurechtgerechnet.66 Hauke bezweifelt die Allmacht Gottes. Für seine Tochter ist er anscheinend eine Art Vater-Gott: „Vater kann alles - alles!” (S. 787), und Hauke selbst sieht seinen neu errichteten Deich fast als achtes Weltwunder. Der Oberdeichgraf bemerkt zur Verlobung von Elke mit Hauke: „[D]aß ein Deichgraf von solch junger Jungfer gemacht wurde, das ist das Wunderbare an der Sache!” (S. 746) Auch der alte Schulmeister schlägt die Brücke von Hauke zu Christus67:
„[D]em Sokrates gaben sie ein Gift zu trinken, und unsern Herrn Christus schlugen sie an das Kreuz! Das geht in den letzten Zeiten nicht mehr so leicht; aber - [...] einen tüchtigen Kerl, nur weil er uns um Kopfeslänge überwachsen war, zum Spuk- und Nachtgespenst zu machen - das geht noch alle Tage.” (S. 808)
II.5.3 Der Schimmel als Spiegel des Menschen Hauke Haien
Der Schimmel ist Ausdrucksmittel der Selbstdarstellung Haukes. Er erhöht seinen Reiter, indem er ihm in gewisser Hinsicht als Spiegel dient. Das dunkle Pferdeauge spiegelt bekanntermaßen seinen Betrachter; es gilt als Spiegel der Seele: Immer wieder hat der Schimmel „die schönen Augen auf seinen Herrn gerichtet” (S. 762, vgl. auch S. 770).
Zwischen Reiter und Pferd finden sich das Physische betreffend Gemeinsamkeiten68: Anfangs ist der Schimmel noch mager, dann schreitet er „schlank auf seinen festen Beinen” (S. 761). Dies muss die hagere Gestalt Haukes noch unterstreichen. Das Pferd besitzt „feurige braune Augen” (ebd.), hat einen „feurigen Kopf” (S. 763). Als die Deicharbeiter den kleinen Hund den Damm hinabwerfen, heißt es: „[...] aus dem hageren Gesicht des Deichgrafen sprühte der Zorn, und sie hatten abergläubische Furcht vor ihm.” (S. 778)
Im Pferd-Reiter-Bild potenziert das Tier die Physis Haukes, so dass ein unheimliches Bild entsteht, das bei den Deicharbeitern jene abergläubische Furcht hervorruft: „[...] wie aus seinem hageren Gesicht die Augen starrten, wie sein Mantel flog und wie der Schimmel sprühte!” (S. 771) Es ist das Bild des Schimmelreiters, wie es sich im Aberglauben erhalten hat. Hauke gibt seine Befehle beim Deichbau grundsätzlich hoch zu Ross, das heißt von oben herab:
[D]azwischen ritt der Deichgraf auf seinem Schimmel, den er jetzt ausschließlich in Gebrauch hatte, und das Tier flog mit dem Reiter hin und wider, wenn er rasch und trocken seine Anordnungen machte [...]. (S. 769)
Indem Hauke als Schimmelreiter den Aberglauben der Leute bedient, erzeugt er bei ihnen Angst und erlangt dadurch Macht und Gehorsam:
Schon von weitem [...] hörten sie das Schnauben seines Rosses, und alle Hände faßten fester in die Arbeit: „Frisch zu! Der Schimmelreiter kommt!” (ebd.)
Ihre Angst wird mit der Vokabel beschrieben, die man üblicherweise dem Fluchttier Pferd zuschreibt: Sie sind „scheu” (S. 770). Damit ist die Angst auf das Pferd bezogen und erscheint gleichzeitig als eine ursprüngliche.
Diese Ausführungen zeigen also wieder den in den Aberglauben der Dorfleute verlagerten magischen Charakter des Pferdes, denn ein solcher passt natürlich nicht zu einem solaren Helden. Insofern spiegeln Pferd und Reiter den Konflikt zwischen dem Volk und seinem Deichgrafen. Hauke, der Vernunftmensch, bekämpft den Aberglauben als Rudiment eines magisch-mythischen Weltbilds.69 So verpönt er die zu jener Zeit angesagten außerkirchlichen religiösen Versammlungen - sogenannte Konventikel - und verhindert, den kleinen gelben Hund als Deichopfer einzusetzen.
Wenn der Schimmel die Eigenschaften des Deichgrafen steigert, ist die Angst der Arbeiter durchaus realistisch. Als sie beim großen Sturm den Hauke-Haien-Koog durchbrechen wollen, versucht einer von ihnen, den Schimmel anzugreifen:
„Herr, hütet Euch!” rief einer aus dem Haufen und stieß mit seinem Spaten gegen das wie rasend sich gebärdende Tier; aber ein Hufschlag schleuderte ihm den Spaten aus der Hand, ein anderer stürzte zu Boden. (S. 804)
Der Schimmel verdeutlicht dem Leser die Gefühle Haukes, indem er sie bildlich einfängt, sichtbar macht und auf diese Weise verstärkt. Hauke hört, wie zwei Arbeiter dem neuen Koog den Namen seines Schöpfers geben. Hauke fühlt sich noch größer: „[E]r hob sich im Sattel, gab seinem Schimmel die Sporen [...].” (S. 781) Sein Stolz wird auf den Schimmel projiziert, denn dies ist schließlich ein Gefühl, was das Tier nicht kennen kann: „Der Schimmel ging in stolzem Galopp; vor seinen Ohren aber summte es: ‘Hauke-Haien-Koog! Hauke-Haien-Koog!’” (ebd.) Des Deichgrafen Hybris wird deutlich.70
II.5.4 Der Schimmel als Symbol des Leidens
Anfangs stößt das Tier unter Hauke noch Lustschreie aus; doch dieser harmonische Eindruck zwischen Reiter und Pferd wird bald gestört. Bereits kurz nach Beginn der Deichbauarbeiten gebraucht Hauke zum ersten Mal die Sporen: „Er gab seinem Pferde die Sporen, dass es wie toll in den Koog hinabflog.” (S. 770 f.) Die Schreie des Schimmels sind Ausdruck seines Schmerzes unter der Gewalteinwirkung des Reiters:
Da gab er seinem Schimmel die Sporen, dass das Tier einen Schrei ausstieß, und stürmte den Deich hinab, und alles wich vor ihm zurück. (S. 777 f.)
So wird der Schimmel zu dem Zeitpunkt, als Hauke mit der Eindämmung des Weiblichen beginnt, zum Bild dessen schmerzlicher Unterdrückung, zum Symbol des Leidens. Gleichzeitig zeugt er davon, dass diese Unterdrückung nur gewaltsam geschehen kann und einen ständig erneut aufzunehmenden Kampf darstellt. Das Pferd muss immer wieder gezügelt werden; dabei werden die Auseinandersetzungen immer heftiger: Bei ihrem letzten Ritt heißt es: „Da klang es wie ein Todesschrei unter den Hufen seines Rosses.” (S. 801) Und kurz bevor beide ins Meer stürzen:
Er richtete sich hoch auf und stieß dem Schimmel die Sporen in die Weichen; das Tier bäumte sich, es hätte sich fast überschlagen; aber die Kraft des Mannes drückte es herunter. (S. 807)
Von diesem Leiden an der Unterdrückung zeugt eindringlich Trin’ Jans mit der Geschichte vom Wasserweib, die sie der kleinen Tochter Haukes erzählt.71 Elke hatte die alte Frau als „verlebte Dienstmagd ihres Großvaters” (S. 782) auf den Deichgrafenhof geholt, damit sie dort ihren Lebensabend verbringe. Die Hafschleusen aus Trin’ Jans’ Geschichte - von Männern erdacht und erbaut - sind als das Eindämmende mit Haukes Deich gleichzusetzen. In ihnen ist das Wasserweib gefangen und kann nicht wieder ins Meer zurück. Der Verlust ihrer Freiheit ist schmerzhaft: „O, wie sie schrie und mit ihren Fischhänden sich in ihre harten struppigen Haare griff!” (S. 788) Sie schreit ebenso wie der Schimmel, und als Symbol des Weiblichen wird sie wie der Schimmel auf Jevershallig in Verbindung mit Wasser und Mond gebracht.
II.5.5 Das Einbrechen des Weiblich-Unbewussten
Je weiter die Deichbauarbeiten fortschreiten, je gewaltsamer Hauke reitet, desto stärker bricht das Weiblich-Unbewusste in sein Leben ein und zeigt seine zerstörerische Kraft: Elkes und Haukes Kind, das Kind eines Verstandesmenschen und einer Frau, die schläft, ist, wie Elke selbst sagt, „schwachsinnig”. Dem Mädchen fehlt der Verstand, es fühlt sich zur alten Trin’ Jans und zu den Tieren72, dem kleinen gelben Hund Perle und der Möwe Claus, hingezogen. Zusammen ergeben sie das „wunderliche Vierblatt, das nur durch einen gleichen Mangel am selben Stengel festgehalten wurde” (S. 784). Im Kindbettfieber ohne Bewusstsein, warnt Elke ihren Mann vor dem Wasser, das ihn zu vernichten droht. Auch seine Tochter Wienke hat vor dem Meer eine fast kreatürliche Angst. Als sie mit ihrem Vater auf den Deich reitet, fragt sie diesen: „’Hat es [das Wasser] Beine?’ frug es wieder; ‘kann es über den Deich kommen?’” (S. 786)
Der neue Deich steht schon einige Jahre, als der Deichgraf schwer an Marschfieber erkrankt. Man erinnere sich an Haukes Aussage: „Ja, man wird grimmig in sich, wenn man’s nicht an einem ordentlichen Stück Arbeit auslassen kann.” (S. 712) Es scheint, dass der äußerliche Kampf des Menschen gegen die Natur nun nach innen gerichtet ist73, ein Kampf ‘in sich’, zwischen Ich und Es. Haukes Schwäche verweist auf die Schwächen des Deichs, des einseitig Männlichen. Sein vorzeitiges Triumphgefühl macht ihn „allzeit leicht zufrieden” (S. 790). In diesem Zustand muss er erkennen, dass das Wasser unbezwingbar ist und sich zwischen altem und neuem Deich unaufhaltsam seinen Weg gesucht hat.74 Der Schimmel als das Unbewusste kontrastiert an dieser Stelle zum ersten Mal Haukes Willen75:
Der Schimmel drängte vorwärts und schnob und schlug mit den Vorderhufen; aber der Reiter drückte ihn zurück, er wollte langsam reiten, er wollte auch die innere Unruhe bändigen, die immer wieder in ihm aufgor. (S. 792)
Immer wieder aufs Neue muss Hauke das Muttersymbol an die Kandare nehmen, und das ist natürlich bei seiner momentanen geistigen und körperlichen Schwäche umso schwieriger. Er verdrängt seine im Innern liegende Unruhe. Es ist, wie Storm selbst am 7. April 1888 an Ferdinand Tönnies schreibt, „die Scheu, nach endlich vollendetem Werk den Kampf aufs neue zu beginnen”76.
Bei seiner zweiten Besichtigung der Unglücksstelle geht Hauke zu Fuß, obwohl Ole Peters ihm ausdrücklich geraten hatte, seinen Schimmel mitzunehmen; zumindest wird der Schimmel mit keinem Wort erwähnt: „Hauke, der nicht wusste, wie uns die Natur mit ihrem Reiz betrügen kann, stand auf der Nordwestecke des Deiches [...].”77 (S. 794) Der Schaden erscheint ihm so weniger schlimm. Nach geringfügigen Ausbesserungen des Deiches geht die Verdrängung weiter: „Der Deichgraf meinte eine stärkende Ruhe in seinem noch geschwächten Körper sich verbreiten zu fühlen [...].” (S. 794 f.)
Weil ihm das Pferd seine eigene Schwäche vorführen würde - Pferde gelten ja als unfähig, sich zu verstellen -, lässt er es wieder absatteln, wenn er an besagter Stelle hätte vorbeireiten müssen; und als er dann tatsächlich wieder einmal auf dem Schimmel an ihr vorbeireitet, sieht er „das gespenstische neue Bett des Prieles; so sehr er seine Augen anstrengte, es wollte nicht mehr weichen” (S. 795). Hauke kann nicht mehr verdrängen, die Eindämmung hat versagt; das muss dem Deichgrafen nun bewusst werden.
Dies zeigt sich auch, wenn Hauke die Warnung der sterbenden Trin’ Jans wiederholt:
„Gott gnad de annern!” sprach es leise in ihm. „Was wollte die alte Hexe? Sind denn die Sterbenden Propheten --?” (S. 797)
Als Trin’ Jans ihre Warnung ausspricht, liegt sie mit einem „hippokratischen Gesicht” (S. 796) auf dem Totenbett, wie man den Gesichtsausdruck eines Sterbenden nach dem griechischen Arzt Hippokrates nennt. In dieser Bezeichnung schwingt eine weitere Anspielung auf das Pferd in seiner Eigenschaft als Seelenführer mit.
II.6 Die große Sintflut
Dann kommt der große Sturm, in dem das Meer als ‘materia prima’ seine Rechte einfordert; auch der Mond steht am Himmel und wird in diesem Abschnitt mehrfach genannt. „Draußen wieherte der Schimmel, dass es wie Trompetenschall in das Heulen des Sturmes hineinklang.” (S. 800) Damit erscheint er als Seelenführer Haukes über das Meer ins Totenreich, denn der chthonische Bereich ist ja bereits mit Wasser und Mond angesprochen. Der Knecht warnt Hauke, der Schimmel sei wie toll, der Zügel könne reißen. Dies ist Zeichen für den umfassenden Kontrollverlust des Mannes.
Begriffe aus dem Militär wie Streithengst, Schlacht und Kampf unterstreichen die kriegerische Auseinandersetzung zwischen Mensch und Natur. Wie sie ausgeht, wird deutlich an der häufigen Verwendung von Wörtern, die den Tod konnotieren, wie zum Beispiel Todesschrei, Totenstille, Todesangst, totenbleich usw. „[D]en Reiter aber wollte es überfallen, als sei hier alle Menschenmacht zu Ende; als müsse jetzt die Nacht, der Tod, das Nichts hereinbrechen.” (S. 802)
Die Katastrophe kommt wirklich einer Sintflut gleich78, als Hauke in einem letzten Anflug von Hybris den Leuten verbietet, seinen Deich, sein Lebenswerk zu durchstoßen. Folglich wird das Wasser das gesamte Dorf, alles, was „lebig” ist, überfluten. Zweimal noch ruft Hauke sein „Vorwärts”, bis es heißt: „[D]er Schimmel wollte nicht mehr vorwärts.” (S. 806) Die Expansion des Mannes ist zu Ende.79 Die Urmutter holt sich alle diejenigen, die Hauke zuvor unterdrückt hatte: seine gesamte Familie mit sämtlichen Tieren.
An dieser Stelle sei an das Pferd als Symbol für die Welt erinnert, die in Gestalt dieses Tieres geopfert wird, um wieder neu zu entstehen. In diesem Zusammenhang ist interessant, dass die skaldische Bezeichnung ‘Askr Yggdrasil’ für Weltbaum ‘Esche des Rosses Odins’ bedeutet.80 Wenn Hauke seiner Frau den Schimmel zum ersten Mal zeigt, geschieht dies unter der Esche, dem immergrünen Baum und Symbol kraftvoller Festigkeit.81 Überhaupt spielt die Esche als Familiensymbol in dieser Novelle eine nicht unbedeutende Rolle.82 Die Verknüpfung zwischen dem Pferd als kosmisches Symbol und Opfertier, dem Totengott Odin (Wotan) und der Esche als Weltbaum im „Schimmelreiter” verweist bereits auf eine Sphäre des Untergangs.
Am Ende verkörpert der Schimmel Haukes eigene vitale Instinkte, denn ein Pferd würde sich nie unter seinem Reiter auf Leben und Tod ins Wasser drängen lassen und wenn, würde es instinktiv schwimmen und sich vom Reiter lösen. Der Kampf zwischen Ich und Es einerseits und zwischen Mensch und Natur andererseits ist getrennt dargestellt. Hauke muss seinen Überlebenstrieb, den Schimmel, bekämpfen, um sich auf einer höheren Ebene mit dem Spruch der alten Trin’ Jans auf den Lippen83 dem anderen Muttersymbol, dem Wasser, zu opfern84:
„Herr Gott, nimm mich; verschon die andern!”
Noch ein Sporenstich; ein Schrei des Schimmels, der Sturm und Wellenbrausen überschrie; dann unten aus dem hinabstürzenden Strom ein dumpfer Schall, ein kurzer Kampf.
Der Mond sah leuchtend aus der Höhe; aber unten auf dem Deiche war kein Leben mehr als nur die wilden Wasser [...]. (S. 807)
Später wird sich der Schimmelreiter immer dann, wenn die Naturgewalten ihre Rechte einfordern, ins Meer stürzen, um an deren Macht zu erinnern. Er ist in den ewigen Prozess von Werden und Vergehen integriert.
II.7 Die Labilität des Ross-Reiter-Verhältnisses: der Schimmel als Pegasos
Noch ein letztes Mal soll die Mythologie des Pferdes bemüht werden. Als in Hauke der Gedanke heranreift, die Natur noch effektiver einzudämmen, wird dies folgendermaßen beschrieben:
Ein anderer Gedanke [...] bemächtigte sich seiner jetzt aufs neue und mächtiger als je zuvor, als seien plötzlich Flügel ihm gewachsen. (S. 748)
Schon beim ersten Ritt Haukes auf seinem Schimmel heißt es: „[E]s flog mit ihm davon [...].” (S. 761) Doch nicht nur an dieser Stelle fliegt der Schimmel; das Verb „fliegen” ist nahezu bei jedem Ritt dabei: „Ein Sporenstich fuhr in die Weichen des Schimmels, und einen Schrei ausstoßend, flog er auf dem Deich entlang [...].” (S. 792) Traditionsgemäß wird der Grau- oder Blauschimmel mit dem Element der Luft in Beziehung gesetzt.85
Mit dem Schimmel als weißes, fliegendes Pferd entsteht eine Verbindung zu einem bekannten Artgenossen der griechischen Mythologie: zu Pegasos.86
Poseidon gilt als der Vater von Pegasos, gleichzeitig ist Pegasos als weißes geflügeltes Zeusross mit dem Himmlischen verbunden. „So vereinigt Pegasos in seiner Doppelnatur das chthonische Erbe mit den ‘männlichen’ Kräften des Lichtes”87 und steht damit für die Auseinandersetzung zwischen Mutterrecht und Patriarchat. Diese Polarität lässt sich - wie gezeigt - auch für Haukes Schimmel nachweisen.
Der Reiter des Pegasos’ heißt in der griechischen Mythologie Bellerophon. Als der Held sich auf seinem Pferd zum Olymp aufschwingen möchte, weiß Zeus dies zu verhindern: Pegasos wirft seinen Reiter ab, so dass er auf die Erde zurückfällt. Hier zeigt sich das Reiten als Befreiung des menschlichen Geistes und gleichzeitig die Hybris des Menschen, den Göttern ähnlich zu sein. Doch der Aufstieg ist nur Trug: Der Mensch fällt auf die Erde zurück. Die archaische Einheit von Mensch und Natur, gespiegelt in der Gestalt des Kentauren, ist aufgehoben.
Der Pegasos-Mythos kündet damit von der Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur und deren Problematik: Sofern die Harmonie zwischen Ich und Es gewahrt ist, bilden beide eine Einheit von unschlagbarer Kraft, lässt sich der Pegasos willig leiten. Ist das Gleichgewicht gestört, zerbricht die Einheit, und aus dem Höhenflug erfolgt der Absturz.88
Nach Baum ist dieses Gleichgewicht ab dem Zeitpunkt gestört, „wo das Pferd den Reiter in seinen Eigenschaften steigern oder kontrastieren soll”89. Beides war bei Haukes Schimmel der Fall. Die Labilität des Ross-Reiter-Verhältnisses ist sichtbar.
II.8 „Der Schimmelreiter”: eine Novelle auf dem Rücken des Pferdes
In Hauke Haiens Geschichte spiegelt sich der Pegasos-Mythos, das ergibt sich aus vorheriger Analyse und Interpretation. Die Brücke zwischen Mythos und „Schimmelreiter” bildet der Schimmel. Überhaupt scheint es, als verdichte sich in diesem Tier und in der Ross-Reiter-Darstellung aufgrund deren Symbolik und Mythologie die gesamte Erzählung: Da ist zunächst die Polarität von Werden und Vergehen, die die gesamte Novelle durchzieht; die Bewusstwerdung des Menschen und damit einhergehend seine gewaltsame Auseinandersetzung äußerlich mit der Natur, im Innern mit seinen eigenen vitalen Instinkten; damit eng verbunden in einer Zeit, in der die industrielle Revolution einsetzt, der Konflikt zwischen magisch-mythischem Weltbild und aufklärerischem Denken90, der sich durch die ambivalente Erzählhaltung zwischen Wahrheitsanspruch und Aberglauben in der gesamten Deichgeschichte spiegelt; und nicht zuletzt der Konflikt zwischen Matriarchat und Patriarchat, der Unterdrückung des Weiblichen, die wegen ihrer Einseitigkeit stetig erneuert werden muss, um am Ende doch ihre Wirkung zu verfehlen. Auch wegen der ambivalenten Symbolik des Schimmels bleibt es so schwierig, das Ende Haukes bzw. der Novelle eindeutig zu interpretieren, ist es letztlich nicht eindeutig zu klären, ob der magisch-mythische Schimmel oder der des aufstrebenden Bewusstseins in der Sintflut untergeht.91
So bestätigt sich die anfängliche Aussage, das Pferd trage die gesamte Symbolkraft des Textes auf seinem Rücken. Durch seine schillernde Symbolik bekommt die Novelle Bodenhaftung, ohne ihren unheimlichen Charakter zu verlieren.
III. Hugo von Hofmannsthal: Reitergeschichte - der Mensch fällt vom Pferd
Gesehen mit diesen Augen sind die Tiere die eigentlichen Hieroglyphen, sind sie lebendige geheimnisvolle Chiffern, mit denen Gott unaussprechliche Dinge in die Welt geschrieben hat. Glücklich der Dichter, dass er auch diese göttlichen Chiffern in seine Schrift verweben darf -92
Hugo von Hofmannsthal hat die Tiere in seine Schriften eingewebt, sie durchziehen sein gesamtes Werk.93 Das Pferdemotiv spielt darin eine besonders wichtige Rolle.94 Davon zeugt neben vielen anderen Dichtungen die „Reitergeschichte”.95
Man darf mit obigem Zitat davon ausgehen, dass das Pferd den geheimnisvollen und rätselhaften, ja nahezu hermetischen Charakter dieser Erzählung, der von vielen Interpreten hervorgehoben wird96, unterstreicht und in vielerlei Hinsicht das Unaussprechliche anzeigt. In einem Brief vom 18. Juni 1895 an Edgar Karl von Bebenburg betont Hofmannsthal, alles im Leben sei voll Bedeutung:
Das Hochsein der Berge, das Großsein des Meeres das Dunkelsein der Nacht, die Art wie Pferde dreinschauen, wie unsere Hände gebaut sind, wie Nelken riechen, wie der Boden in Wellen und Mulden verläuft oder in Dünen [...].97
Der „Art wie Pferde dreinschauen” gilt auch das Augenmerk folgender Betrachtungen zur „Reitergeschichte”.98
III.1 „Reitergeschichte”: die Geschichte eines Reiters
Die „Reitergeschichte” ist eine Erzählung, in der sich Reales und Irreales durchdringen99 ; doch im Unterschied zum „Schimmelreiter” distanziert sich der Erzähler nicht mehr von anscheinend Irrealem, vielmehr vermischen sich objektive und subjektive Betrachtungsweise.100 So kann die rätselhafte Sphäre, die das Pferd - und nicht nur dieses - in der „Reitergeschichte” umgibt, nicht mehr der Aussage dritter Personen oder dem Volksaberglauben zugeschrieben werden. Im Vergleich mit dem „Schimmelreiter” erweist sich die Einbettung dieser Erzählung in die Pferdemythologie als viel geringer, und doch spürt der Leser wieder diese große Kraft, die vom archetypischen Symbol „Pferd” ausgeht: Das Pferd trägt den Wachtmeister Anton Lerch in seinen Tod.
Storm konnte mit der Wahl des Titels „Der Schimmelreiter” davon ausgehen, dass ein Großteil seiner Leserschaft den gespenstischen Schimmelreiter mit dem Tod assoziierte und die diversen Anspielungen auf abergläubische Überlieferungen und Mythologie wahrnahm. Wenn nun bei Hofmannsthal diese Anspielungen weniger deutlich ausfallen, so hängt dies wohl mit der fortschreitenden Bewusstseinserweiterung des Menschen zusammen: „Mythen sind Symbole für die Bewusstwerdung des Menschen.”101 Sobald sich der Mensch ungeklärte Zusammenhänge erschlossen hat, werden magisch-mythische Erklärungsversuche überflüssig, was jedoch deren unbewusstes Fortwirken und die Entstehung neuer mythologischer Bilder nicht ausschließt.102
Die „Reitergeschichte” ist ebenfalls wie „Der Schimmelreiter” eine Geschichte an der Schwelle von Leben und Tod: Sie spielt mitten im Krieg. Das Pferd trägt die Männer durch diesen hindurch und unterstreicht mit seiner ambivalenten Symbolik zwischen Werden und Vergehen deren Ritt hart an der Grenze des Lebens. Beide Erzählungen enden mit dem Tod des Helden, doch bei Hofmannsthal überlebt das Pferd.
Der Titel ist im Gegensatz zu „Der Schimmelreiter” merkwürdig allgemein gehalten: „Reitergeschichte”. Jede konkretisierende Einschränkung durch einen Artikel fehlt, man erhält den Eindruck, es handle sich um den Reiter im Allgemeinen, um eine Geschichte, die jedem Reiter passieren könne. Das Pferd ist wiederum in den Titel integriert und damit aus der Geschichte als Komplementär nicht wegzudenken, bleibt allerdings genauso unbestimmt wie sein Reiter. Es wird nicht explizit genannt, sondern der Begriff „Reiter” impliziert das Tier; es ist dem Reiter untergeordnet. Der Titel suggeriert also eine Geschichte der Ross-Reiter-Beziehung selbst mit all ihren Konflikten.
Es folgt, wenn man denn auf das Wesentliche reduzieren möchte, die Geschichte eines Reiters, der tot vom Pferd fällt: Nach Trennung dieses tragfähigen Verhältnisses muss jede Reitergeschichte natürlicherweise enden.
III.2 Eine Erzählung zwischen Leben und Tod
Die Erzählung beginnt mit genauen Orts- und Zeitangaben:
Den 22. Juli 1848, vor 6 Uhr morgens, verließ ein Streifkommando, die zweite Eskadron von Wallmodenkürassieren, Rittmeister Baron Rofrano mit 107 Reitern, das Kasino San Alessandro und ritt gegen Mailand.103
Der 22. Juli gilt als Gedächtnistag Maria Magdalenas und damit als Glücks- und Unglückstag zugleich.104 Dem Aberglauben nach soll man an diesem Tag nichts Wichtiges tun, „denn, 9 hängen, 9 erfallen, 9 tränken sich”105. Die „Reitergeschichte” beschreibt einen 22. Juli der „bestandenen Gefechte und anderer Glücksfälle” (S. 40) und einen Tag, an dem neun Beutepferde gewonnen werden, die neun Tote bedeuten.
Damit wird vom ersten Satz an die ambivalente Textstruktur zwischen Glück und Unglück, zwischen Sieg und Niederlage, Leben und Tod vorgegeben.106 Dazu passt auch die Kriegssituation, die einen Kampf um diese Pole verspricht. Die polare Struktur wird sich durch den gesamten Text ziehen, immer wieder durch Kämpfe verdeutlicht und sich, wie zu zeigen ist, im Pferd-Reiter-Bild verdichten.
Krieg und Frieden liegen nah beieinander:
[D]er Mais stand regungslos, und zwischen Baumgruppen, die aussahen, wie gewaschen, glänzten Landhäuser und Kirchen her. Kaum hatte das Streifkommando die äußerste Vorpostenlinie [...] hinter sich gelassen, als zwischen den Maisfeldern Waffen aufblitzten und die Avantgarde feindliche Fußtruppen meldete. (S. 39)
Der Unterschied zwischen diesen beiden Sätzen scheint gar nicht sehr groß: Der Mais steht hoch, man assoziiert die Farbe Gelb und sieht mit dem inneren Auge die glänzende Landschaft. Doch der erste Satz bedeutet Frieden, der zweite Krieg, obwohl diese Verschiebung kaum merklich vonstattengeht.
Auffällig ist auch der Kontrast von Reiterschwadron und ihren ersten Gegnern an diesem Tag. Die Reiter kämpfen gegen Fußtruppen oder - genauer gesagt - Personen, die ihnen allein schon ihrer nicht erhöhten Position wegen unterlegen sein müssen. Die Unterlegenheit des Gegners verdeutlichen die Tiervergleiche: Ihre Kugeln klingen miauend, wie die Wachteln werden sie von den Reitern getrieben (Vgl. ebd.). „Gegen 10 Uhr vormittags fiel dem Streifkommando eine Herde Vieh in die Hände” (S. 39 f.): Ein solcher Satz fällt in seiner ganzen Merkwürdigkeit kaum mehr auf; fast gleichgültig wird es dem Leser, ob es sich an dieser Stelle nun tatsächlich um Vieh oder um Fußtruppen oder um „hübsche junge Leute mit weißen Händen und halblangem Haar” (S. 39) handelt. Wichtig erscheint nurmehr der stilisierte Kontrast zwischen selbstbeherrschten Reitern und Kreatur. Die kriegerischen Auseinandersetzungen wirken wie ein unwirkliches Spiel, in dem einem „die ganz verwirrten Feindlichen” (S. 40) als zufällige Eroberung in die Hände fallen. Diese Stilisierung ist ein augenfälliges Merkmal der „Reitergeschichte”.
III.3 Das Pferd als Kampfmaschine: Reiten zwischen Disziplin und eingefordertem Triebverhalten
Der Reiter zwingt das Pferd unter sich, und so wird dieses Tier zum Mittler zwischen Ich und Es.107 Erscheint die Reitweise harmonisch, wird sie zum Bild eines Menschen, der seine vitale Triebkraft zügeln kann, zum Bild seiner Selbstbeherrschung. Doch diese Selbstbeherrschung bleibt labil, die Instinkte müssen immer wieder bezwungen werden, das Pferd kann jederzeit durchgehen.
Hofmannsthal erfuhr das instabile Verhältnis zwischen Reiter und Pferd am eigenen Leibe während seiner Militärzeit. 1894/95 leistete er sein Freiwilligenjahr in Göding, ging im Mai 1896 für Waffenübungen nach Tlumacz und im Juli 1898 nach Czortkow.108 Hofmannsthal wusste von der Reitkunst als äußeres Zeichen zivilisierten Bürgertums und als Grundlage für einen gesellschaftlichen Aufstieg und einer neuen Identität: „Ich möchte sehr berühmt werden; ich möchte gut reiten können; gut italienisch, ordentlich gehen und reden und ein wirklicher gentleman sein […]”109, schreibt er im Dezember 1892 an Edgar Karl von Bebenburg und am 19. Februar 1894 an Richard Dehmel: „Ich arbeite mäßig, schlafe viel, reite und fechte täglich […].”110
In seiner Militärzeit reitet er ein „wildes unheimliches Pferd”111, das sich immer wieder gegen seinen Willen durchsetzt. Davon zeugt ein Brief an seinen Vater vom 2. August 1895:
In schlechten Stunden überkommt mich eine kleinliche und nutzlose Ungeduld und Angst, jedes zerrissene Kleidungsstück ängstigt mich, und ich verliere vollständig den Kopf. So ähnlich ist es mit dem Pferd. Dieser leichte Stütz ist nicht der Rede wert, wird bei Veränderung des Stalles und ruhiger, rationeller Behandlung höchstwahrscheinlich baldigst verschwinden und brauchte gar nicht erwähnt zu werden. Auch ich selber würde das Pferd herrichten können, wenn mich nicht manchmal eine so merkwürdige Ratlosigkeit erfassen würde, genau wie bei den mathematischen Kompositionen im Gymnasium.112
Das Pferd macht dem jungen Hofmannsthal auf diese Weise die eigenen Defizite schmerzlich bewusst. Seine Angst vor dem Reiten kommt in den Briefen deutlich zum Ausdruck.113 Das Pferd als Muttersymbol ist „das tragende Tier, aber auch das hinwegtragende”114. Somit reichen die Empfindungen beim Reiten vom Wohlbefinden bis zum angstvollen Ausgeliefertsein an diesen großen, starken Vierbeiner. Daher kann das Pferd nur dann gezügelt werden, solange der Wille des Reiters das Tier beherrscht, denn bei einem rein körperlichen Machtkampf trägt es immer den Sieg davon.
Hofmannsthal betont selbst, „[…] dass nur der lebt, der den Tod in sich aufgenommen hat”115. Für diese Integration steht symbolisch das Pferd.116 In einer Kriegssituation wie in der „Reitergeschichte” wird diese Bedeutung des Pferdes noch verstärkt, bedeutet doch jedes Gefecht auch ein Kampf ums Überleben.
Der Kampf zwischen Ich und Es wird ebenfalls verschärft: Ein Tag wie der 22. Juli erfordert von den Reitern einen ständigen Wechsel zwischen Disziplin und eingefordertem Triebverhalten, zwischen selbstbeherrschtem Reiten und zügelloser Leidenschaft auf Kommando. Dieser Konflikt wird durch das Reiten gespiegelt, das Pferd zum Konfliktträger.
Weil das Pferd als Mutter- und Libidosymbol die Triebsphäre des Menschen, aber als Symbol des aufstrebenden Bewusstseins auch den männlichen Expansionsdrang verkörpert, zeigte sich im „Schimmelreiter” der Konflikt auf zwei Ebenen: nach innen und nach außen gerichtet. Zumindest der Konflikt nach außen scheint in der „Reitergeschichte” ein anderer zu sein: Die Bezwingung der Naturgewalt durch den Menschen steht hier anscheinend nicht mehr im Vordergrund, sein Kampf richtet sich nunmehr gegen die eigene Spezies, gegen das Expansionsstreben des Gegners. Man versucht als äußeres Zeichen dafür sein Gegenüber von der Kampfmaschine „Pferd” zu stürzen. Damit ist das Bild des aufstrebenden, solaren Helden anachronistisch geworden.
III.4 Der Reiter Anton Lerch
III.4.1 Der Ritt durch Mailand
Schon im ersten Satz der Erzählung wird der Gegensatz zwischen Rittmeister Baron Rofrano und den 107 Reitern aufgemacht. Rofrano wird als erster namentlich aus der Anonymität der Eskadron herausgestellt. Auch seine Reitkünste weisen ihm eine besondere Stellung zu: Er ist ein Meister des Reitens.117 Daraufhin erscheint die Schwadron als Kollektiv, aus dem im weiteren Verlauf des ersten Absatzes einzelne Namen hervorgehoben werden. So auch derjenige des Wachtmeisters Anton Lerch, der eine Villa umstellen lässt und vom Pferd absitzt, um „hübsche junge Leute mit weißen Händen und halblangem Haar” (S. 39) gefangen zu nehmen. Das Absitzen, Fenster, Haare und die Farbe „weiß” werden bei seinem weiteren Ritt noch eine Rolle spielen.
Der zweite Absatz beginnt wieder mit bekanntem Gegensatzpaar von Rittmeister und Schwadron:
Nachdem laut übereinstimmender Aussagen der verschiedenen Gefangenen die Stadt Mailand von den feindlichen sowohl regulären als irregulären Truppen vollständig verlassen, auch von allem Geschütz und Kriegsvorrat entblößt war, konnte der Rittmeister sich selbst und der Schwadron nicht versagen, in diese große und schöne, wehrlos daliegende Stadt einzureiten. (S. 40)
Dieses Einreiten118 klingt fast wie ein organisiertes Belohnen durch den Rittmeister für die bestandenen Gefechte seiner Schwadron und gehört mit zu diesem Krieg. Es ist das Vergehen am Wehrlosen, das in dieser Stadt in ihrer mütterlich-beschützenden Funktion Zuflucht gefunden hatte.119 Das Bild einer Massenvergewaltigung der entblößt daliegenden Stadt durch die berittenen Männer wird noch deutlicher mit der Synekdoche „achtundsiebzig aufgestemmte nackte Klingen” (ebd.), der besonderen Erwähnung von Haustoren, sich öffnenden „verschlafenen Fenstern” (ebd.) und Erztoren, von Dachkammern, dunklen Torbogen und „entblößten Armen” (ebd.).
[...] vom trabenden Pferde herab funkelnden Auges auf alles dies hervorblickend aus einer Larve von blutbesprengtem Staub; zur Porta Venezia hinein, zur Porta Ticinese wieder hinaus: so ritt die schöne Schwadron durch Mailand. (S. 40 f.)
Das trabende Pferd verdeutlicht gegen Ende dieses langen Satzes nochmals in seiner Bewegung den Expansionsdrang des Mannes, befriedigt in der Unterdrückung des Weiblichen.120 Das Herabschauen vom Pferd zeigt die überhöhte Machtposition dieser Reiter, indem sie das Pferd als Libidosymbol durch Willenskraft zwischen ihre Beine gezwungen haben. Die Trennung der einzelnen Satzteile durch Semikola und die häufige Verwendung des Partizip Präsens verstärken den Eindruck eines quälend langen Augenblicks, einer ausweglosen Situation und der Passivität der Stadt.121
In dieser triebhaft aufgeladenen Stimmung und noch bevor die Schwadron die Stadt verlassen hat, richtet sich nun die Aufmerksamkeit des Erzählers auf Wachtmeister Anton Lerch. Durch das deduktive Vorgehen des Erzählers hat diese Fokussierung auf einen Reiter etwas Beispielhaftes: Lerch steht für einen Reiter unter vielen.122 Der Gegensatz Rittmeister/Schwadron ist denn auch am Ende der „Reitergeschichte” auf die Konfrontation Rofrano/Lerch verkürzt. Indem der Reiter Lerch wie durch ein Vergrößerungsglas gesehen wird, bekommt der Leser Einblicke in dessen inneren Konflikt zwischen Ich und Es. Das Pferd wandelt sich „vom Symbol für die Bewusstwerdung der Seele zum Symbol für psychische Befindlichkeiten”123.
III.4.2 Wachtmeister Lerch: zwischen Himmel und Erde
Des Wachtmeisters Name hat Symbolcharakter124: Die Lerche ist ein Vogel, der zum Flug fast senkrecht in den Himmel aufsteigt und sein Nest auf dem Boden baut. Damit wird sie Symbol für die Verbindung von Himmel und Erde125 und erinnert an die bereits beschriebene Doppelnatur des Pegasos’ von chthonischem Erbe und aufstrebendem Geist. Dass Hofmannsthal die spezifische Symbolik der Lerche bekannt gewesen sein musste, zeigt ein Zitat aus „Der Abenteurer und die Sängerin oder Die Geschenke des Lebens” (1898):
[...], hier saß einst Musik,
so süß, wie in der Brust von jungen Lerchen,
die überladen mit Triumph aufsteigen
und manchmal tot vor Lust zur Erde fallen.126
Die Verbindung von Lerche und Musik offenbart eine weitere zu Pegasos als Musenross, das den „phantastischen Flug der schweifenden Gedanken, die jeden irdischen Bezug vergessen lassen”127 verkörpert. Der Name Lerch stellt somit seinen Träger in ein Konfliktfeld zwischen „Dienen und Freiheit, Aufstieg und Fall, Sieg und Angst, Gehorsam und Stolz, was nichts anderes bedeutet als die Auseinandersetzung des Bewusstseins mit den vitalen Instinkten”128.
III.4.3 Das Lahmen des „Braun”
Anton Lerch reitet ein braunes Pferd mit weiß gestiefelten Vorderbeinen. Braun ist die Farbe der Erde und hat seit dem späten Mittelalter auch erotische Bedeutung.129 Die weißen Stiefel erinnern an die Beine einer Frau, schließlich sind Pferde Zehenspitzengänger, haben schlanke Fesseln und entsprechen damit weiblichen Schönheitsidealen. So verstärken die markant gefärbten Vorderbeine des Braunen seine Libidosymbolik.130
Bis zum besagten Ritt durch Mailand wurde weder über Anton Lerch noch über seinen „Braun” etwas Auffälliges berichtet: Der Wachtmeister hatte anscheinend bis zu dieser Stelle sein Tier im Griff.131 In dieser erotisch gefärbten Stimmung jedoch dreht sich Lerch im Sattel zurück, weil er glaubt, in einem Fenster „ein ihm bekanntes weibliches Gesicht zu sehen” (S. 41). Im Moment des Umdrehens, also als er für kurze Zeit den männlichen Gedanken des Vorwärtsstrebens vernachlässigt, fällt sein Pferd bezeichnenderweise mit „einigen steifen Tritten” (ebd.) aus dem allgemeinen Marschrhythmus. Nochmals sei daran erinnert, dass das Pferd unter einem Reiter dessen vitale Instinkte symbolisieren kann. Dieses Eindrucks kann man sich an dieser Stelle nur schwer erwehren, zu gewollt wirken die sexuellen Konnotationen, wenn das Pferd steife Tritte tut, Lerch „ohne Störung aus dem Gliede” (ebd.) kann und daraufhin „das Vorderteil seines Pferdes in den Flur des betreffenden Hauses” (ebd.) lenkt.
Das Pferd spiegelt das Unbewusste seines Reiters und übernimmt so dem Leser gegenüber eine Mittlerrolle der optischen Veranschaulichung.132 Dafür spricht auch, dass es für die kurzzeitige Lahmheit des Pferdes keinen wirklichen Grund gibt, wird sie doch, nachdem Lerch die Vorderhufe kontrolliert hat, nicht mehr erwähnt; im Gegenteil: Am Ende der Vuic-Episode heißt es, das Pferd trabe der Schwadron nach. Lerch möchte absitzen und sucht und findet unbewusst einen Grund hierzu im Verhalten seines Pferdes.
III.4.4 Das kurzzeitige Verlassen des Pferderückens und seine Folgen
Das Absteigen vom Pferderücken verdeutlicht, dass Lerch seine Leidenschaft nicht mehr zu zügeln gewillt ist und aus dieser Art organisierter Vergewaltigung der Schwadron auszubrechen anstrebt. Er verlässt die höhere Sphäre des Bewusstseins und steht wie sein Reittier auf dem Boden: Die Harmonie zwischen Ich und Es ist gestört. Der Sphärenwechsel wird ebenfalls angedeutet, indem Lerch das Pferd halb in den Hausflur eindringen lässt. Kaum ist dies geschehen, öffnet sich auch schon die Tür zum Zimmer der Vuic und gibt Lerch voyeuristisch den Blick frei auf ein behagliches Leben. Er sieht ein großes weißes Bett und im Spiegel erscheint ein „vollständig rasierter älterer Mann”133 (ebd.), mit dem die Frau wahrscheinlich kurz zuvor geschlafen hat. Lerch dagegen hatte es früher noch nicht einmal geschafft, mit Vuic allein zu sein; immer war ihr damaliger Geliebter mit anwesend. Lerchs Erregung ist nicht zu überlesen: Der Anblick der Frau treibt ihm „das Blut in den starken Hals und unter die Augen” (ebd.) und er spricht seine einzige direkte Rede in der „Reitergeschichte”: „’Vuic’,- [...] ‘in acht Tagen rücken wir ein, und dann wird das da mein Quartier’, [...].” (S. 42)
Irgendetwas muss Lerch gehindert haben, die Frau auf der Stelle zu erobern: Es war sein Pferd durch „stummes Zerren am Zaum, dann, indem es laut den anderen nachwieherte” (ebd.). Lerch muss also die Zügel noch in der Hand halten, er hat die Verbindung zu seinem Pferd und damit zur Schwadron nicht völlig aufgegeben. Der Braun kontrastiert hier in seinem Herdentrieb den Willen oder - besser gesagt - den Nicht-Willen seines Reiters. Fast scheint es, als sei in dieser Kontrastierung die Verteilung der Rollen von Trieb und Bewusstsein vertauscht: Lerch verkörpert in dieser Situation sein Es, während das Tier ihn durch den Zaum an das notwendige Zügeln der Leidenschaft erinnert.
Dafür spricht auch, dass das Pferd erst am Ende dieser Episode wieder erwähnt wird, dazwischen setzt Lerchs Bewusstsein aus. Dieses Nicht-Erwähnen erscheint umso bemerkenswerter, bedenkt man die ungewöhnliche Position des Pferdes in der Türschwelle, gegen die sich gerade dieses sehr scheue und ängstliche Tier bestimmt schon gewehrt hätte. Erst gegen Ende der Episode ist der Wachtmeister der Sprache mächtig, wenn auch nicht zur Tat fähig. Mit der Erwähnung des ungehorsamen Pferdes schlagen im Haus die Türen zu, die Triebwelt verschließt sich und Lerch sitzt auf.
III.4.5 „Seitwärts der Rottenkolonne”
Die Rückkehr auf den Pferderücken scheint jedoch nur äußerer Natur: „Das ausgesprochene Wort aber machte seine Gewalt geltend” (ebd.), vor allem über Lerch.134 Er reitet „seitwärts der Rottenkolonne, einen nicht mehr frischen Schritt” (ebd.). Sein Bewusstsein ist getrübt, sein „Blick in der mitwandernden Staubwolke verfangen” (ebd.). Lerchs Gedanken um den rasierten Mann, der zu einer „schwammigen Riesengestalt” (ebd.) heranwächst, veranschaulichen das immer stärkere Hineinleben in eine Triebwelt. Der „Splitter im Fleisch, um den herum alles von Wünschen und Begierden schwärte” (S. 43), lässt ihn nicht mehr los.135 Gerade auf einem Pferd sitzend wird eine solche Realitätsflucht gefährlich, denn das sichere Lenken dieses Tieres erfordert in jeder Hinsicht einen absoluten Überblick der Situation und vorausschauendes Denken.
Im Leben gefangen sein.
Die Elemente. Der beschwerliche Staub, die mühseligen Steine, die traurigen Straßen, die harten Dämme, die Tücke der Pferde und des eigenen Körpers.
Leben und sich ausleben nur im Kampf mit den widerstrebenden Mächten. So lehrt mich mein Pferd den Wert des Vermögens, der Unabhängigkeit.136
So lautet eine Aufzeichnung Hofmannsthals vom 1. August 1895 aus der Gödinger Zeit. Sie beschreibt ein Reitgefühl zwischen Gefangensein und Unabhängigkeit. Die „Tücke” des Pferdes macht dem Menschen seine eigene Ohnmacht dem Leben gegenüber bewusst. Beherrscht er das Tier, trägt es zum Streben nach Unabhängigkeit und zum Selbstbewusstsein bei. Das Reiten konfrontiert den Menschen mit seinem Urkonflikt als Natur- und Kulturwesen: Er ist hin- und hergerissen „im Kampf mit den widerstrebenden Mächten”, zwischen „angeborenem Freiheitsdrang und zivilisatorischen Ansprüchen”137.
Wachtmeister Lerchs Weg führt ins Gefangensein; er entflieht dem Konflikt in sein tiefstes Inneres und wird damit einer der passiven, willenlosen, realitätsflüchtenden Helden der Dekadenz138:
Dem Streifkommando begegnete in den Nachmittagsstunden nichts Neues und die Träumereien des Wachtmeisters erfuhren keine Hemmungen. (S. 42)
III.5 Vom Verlust der reiterlichen Dominanz: der Ritt durchs Dorf
III.5.1 Vom Galopp zum Schritt
In dieser Stimmung zieht es Lerch fast magisch seitlich des Weges in ein verödetes Dorf, mit „halbverfallenem Glockenturm in einer dunkelnden Mulde gelagert” (S. 43). Diese Beschreibung verdeutlicht sein triebgesteuertes Interesse an diesem Dorf. Er möchte es im Galopp nehmen in seiner „Einbildung”, „einen feindlichen General mit geringer Bedeckung zu überraschen und anzugreifen oder anderswie ein ganz außerordentliches Prämium zu verdienen” (ebd.).
Die folgende Dorfepisode wurde vielfach als Umkehrparallele zum Ritt durch Mailand gelesen139, jedoch bedeutet sie vielmehr eine Steigerung dessen, indem sie die konsequente Degradierung Lerchs Bewusstsein zum Ausdruck bringt. Sicheres Zeichen für die Schwäche seiner Willenskraft ist, dass er sein Pferd nicht mehr beherrscht; das Pferd als sein Unbewusstes verselbständigt sich mehr und mehr.
Doch zunächst wird die vorwärtsstrebende Bewegung von Ross und Reiter als Zeichen aufstrebenden Denkens immer wieder durch äußere Einflüsse eingeschränkt. Lerch muss das Tier vom Galopp in den Schritt parieren, weil sich „glitschiges Fett” (ebd.) auf dem Boden befindet: Sein Unbewusstes findet keinen Halt mehr, der Bodenkontakt wird unsicher, und die Labilität des Ross-Reiter-Verhältnisses tritt zum Vorschein. Diese Szene stammt aus dem Erfahrungsbereich des jungen Hofmannsthal, der in einem Brief vom 25. Mai 1896 aus Tlumacz seinen Eltern Folgendes berichtet:
Das Terrain ist schauerlich, aber eben darum recht lustig. Steile Abhänge, gleich daneben versumpfte Wiesen, tiefe Einschnitte mit lehmigen rutschigen Rändern, hohe Zäune, und aus jeder elenden Lehmhütte fahren die elenden verwilderten Bauernköter zwischen die Pferde. Ich bin einmal vom Pferd gerutscht, aber absichtlich, weil es auf beiden Vorderfüßen gelegen ist und auf dem glitschigen Boden nicht hätte mit dem Reiter aufstehen können, bin auch gleich wieder weiter galoppiert, nur etwas schmutzig.140
Wieder sucht Lerch die Ursache für sein Nichtvorwärtskommen im Unterbau seines Pferdes, wieder wendet er sich um, aber diesmal schaut er nach dem „rückwärtigen Eisen” (ebd.). Seine Aufmerksamkeit ist also auf den hinteren Teil des Tieres gerichtet und damit Ausdruck seines triebhaften Interesses. Nachdem Lerch den Blick auf die Hufe seines Braunen gesenkt hatte, erkennt er eine mit dem Pferd als Libidosymbol eng verbundene Frauengestalt als eigentliche Ursache der Lahmheit.141 Fast scheint es, als sei sie Teil des Pferdes, als hauchte es ihr Leben ein142:
[S]ie ging so dicht vor dem Pferde, dass der Hauch aus den Nüstern den fettig glänzenden Lockenbund bewegte, der ihr unter einem alten Strohhute in den entblößten Nacken hing, und doch ging sie nicht schneller und wich dem Reiter nicht aus. (ebd.)
Auch das Erscheinen der Vuic in Mailand hing mit der Lahmheit des Braunen zusammen, auch ihr Nacken wurde ausdrücklich erwähnt. Somit erinnert diese „Frauenperson” (ebd.) an Vuic, doch rücken ihr schlampiges Auftreten, das Fehlen von Schönheitsbekundungen wie die „feine weiße Haut der Vuic” (S. 42) und ihre so unwirkliche körperliche Nähe zum Pferd sie noch stärker in den Bereich einer von Trieben regierten Unterwelt. Davon zeugt auch ihre Anonymität - für Lerch ist sie in erster Linie Frau - und dass Lerch ihr Gesicht als Sitz der Ratio nicht sehen kann.
III.5.2 Tierische Hindernisse
III.5.2.1 Die Ratten
Den nun folgenden lebenden Hindernissen für Pferd und Reiter, den Ratten und Hunden, lässt sich ein erdnaher Charakter nicht absprechen. Überhaupt macht das Dorf mit seinen Verfallserscheinungen einen morbiden Eindruck, der Tod scheint allgegenwärtig143: „Das Dorf blieb totenstill; kein Kind, kein Vogel144, kein Lufthauch.” (S. 43) Denn mit dem mangelnden Einfluss Lerchs auf sein Pferd, mit der zunehmenden Trennung von Ich und Es - ein Teil allein wäre ja nicht überlebensfähig - und der größer werdenden Distanz zum Leben zeigt sich die Nähe des Todes. Insofern wird der Braun, wie zu Anfang schon angedeutet, auch zum Seelenführer Anton Lerchs.
Die Ratten sind das erste lebende Hindernis, das Pferd und Reiter in ihrem Weiterkommen hindert: Das Pferd scheut. Ratten verkörpern als niedere, unsaubere Kreaturen Krankheiten, und es gilt als Unglück, wenn sie das Haus verlassen, spricht dies doch dafür, dass die Vorräte dort zur Neige gehen.145 Der Braune kontrastiert an dieser Stelle den Reiter, dieser muss zum ersten Mal Gewalt anwenden146: „Ein Schenkeldruck brachte es wieder vorwärts […].” (S. 44) Die gestörte Harmonie zwischen Ich und Es wird sichtbar und wandelt sich zum Kampf des einen gegen das andere. Außerdem lenkt der Reiter das Pferd nicht mehr durch seinen Willen, sondern durch gewaltsames Eingreifen: Das Unbewusste Lerchs beginnt, ein Eigenleben zu führen.
III.5.2.2 Die Hunde
Dann kommen die Hunde, sechs an der Zahl. Sie tragen allesamt Anzeichen der Verwahrlosung. Die „weiße unreine Hündin mit hängenden Zitzen” (ebd.) läuft herrenlos aus einem Haus. Durch ihre negative Erscheinung verkehrt sie die positive Konnotation der Farbe „weiß”, die im allgemeinen für Reinheit und Unschuld steht, in ihr Gegenteil.147 Die äußeren Geschlechtsmerkmale und damit das Weibliche erscheinen nicht mehr anziehend - wie noch zuvor in der Vuic-Episode -, sondern abstoßend hässlich.
Das Windspiel mit „aufgeschwollenem Leib” (ebd.) erinnert an den in Lerchs Gedankenwelt zur „schwammigen Riesengestalt” (S. 42) gewachsenen rasierten Mann. Diese Rasse gilt als Symbol der Wahrnehmung, denn besonders der Windhund kennt seinen Herrn.148 Doch in den Augen dieses Windspiels liegt ein „entsetzlicher Ausdruck von Schmerz und Beklemmung” (S. 44). Dem anderen weißen Hund laufen fast wie Tränen „schwarze Rinnen aus den entzündeten Augen” (ebd.), und der Dachshund sucht mit „unendlich müde[n] und traurig[en]” (ebd.) Augen den Blick des Wachtmeisters. Das Motiv der treuen Hundeaugen wird hier umgedeutet: Der beste Freund des Menschen ist herrenlos, kann den treuen Blick nicht mehr auf seinen Herrn richten. Das Sinnesorgan wird Ausdruck des Schmerzes, die Wahrnehmung ist getrübt.
Die Hunde zeigen dem Wachtmeister den schmerzlichen Verlust eines Bezugspunktes und das Leiden am herrenlosen Bewusstsein. Sie spiegeln so seine eigene Situation, was durch die symbolische Nähe des Hundes zum Tod als Wächter des Totenreiches, durch die starke Sexualkraft dieses Tieres und den Hund als Sinnbild der Unreinheit und Niedrigkeit149 noch unterstrichen wird; oder mit den Worten Hofmannsthals, die er am 7. August 1895 Leopold von Andrian sendet:
Und auf dem Rasen sind […] 15 Hunde, alle häßlich, Mischungen von Terriers und Bauernkötern, übermäßig dicke Hunde, läufige Hündinnen, ganz junge schon groß mit weichen ungeschickten Gliedern, falsche Hunde, verprügelte und demoralisierte, auch stumpfsinnige, alle schmutzig, mit häßlichen Augen, und wundervollen weißen Zähnen. Darin lagen alle Mächte des Lebens und seine ganze erstickende Beschränktheit, dass es von sich selbst hypnotisiert ist.150
Die Hunde der „Reitergeschichte” versuchen in ihrer „erstickenden Beschränktheit” das Vorwärtskommen des Braunen mit seinem Reiter einzuschränken; sie sind dem Bereich des Pferdes zugeordnet, Lerchs Triebwelt: „Der Braun konnte keinen Schritt mehr tun.” (ebd.) Dies ist die Stagnation des Bewusstseins.
Lerch möchte sich von den leidenden Kreaturen befreien, doch überrascht es wenig, dass sich ihm die Pistole als Phallussymbol angesichts seiner geschwächten Willenskraft versagt. Also muss er wieder Gewalt auf sein Pferd ausüben, diesmal in gesteigerter Form, ein Schenkeldruck reicht nicht mehr aus: Er gab „dem Pferde beide Sporen und dröhnte über das Steinpflaster hin” (ebd.).
III.5.2.3 Die Kuh
Ein letztes Tier stellt sich in den Weg, um ihm sein beschränktes Leben vorzuführen: Eine Kuh auf dem Weg „zur Schlachtbank” (ebd.). Auch sie sucht mit „kläglichen Augen” (ebd.) die Nähe des Pferdes. Beide Tiere - Pferd und Kuh151 - sind Muttersymbole, aber sie verkörpern unterschiedliche Stadien dieses Symbols152: Während die Kuh für das magisch-mythische Zeitalter des Schlafens steht - völlig unreflektiert holt sie sich in ihrem Lebensinstinkt hier kurz vor dem Tod noch eine Maulvoll Heu -, steht das berittene Pferd für die Unterdrückung des Weiblichen, des Unbewussten durch den Reiter. Die Zeit der unreflektiert kentaurischen Einheit153 ist vorüber, die Kuh wird zum Schlachten geführt. Sie erinnert Lerch an seine unweigerliche Pflicht, das Pferd zu lenken und eine Balance zwischen Ich und Es herzustellen. Sobald sich der Mensch nämlich der Labilität dieser Balance bewusst wird, gibt es kein Zurück mehr, ist die Einheit überwunden und jede einseitige Flucht ins Unbewusste, aber auch ins rein Geistige schmerzhaft.
III.5.3 Der Doppelgänger
In gesteigerter Form erinnert Lerch auch die Erscheinung des Doppelgängers154 an seine Reiterpflichten. Gleichzeitig zeigt diese jedoch die weitere Verselbständigung seines Unbewussten, bleibt sie doch selbst unwirklich. Der Wachtmeister fühlt „in der Gangart seines Pferdes eine so unbeschreibliche Schwere, ein solches Nichtvorwärtskommen” (S. 45), als hätte er „eine unmeßbare Zeit mit dem Durchreiten des widerwärtigen Dorfes verbracht” ebd.). Im Unbewussten ist die Zeit aufgehoben155: Das Pferd kann sich kaum noch vorwärts bewegen.
Hofmannsthal ist der Ansicht, Tiere „[…] wittern das, was über menschliches Begreifen hinausgeht”156. Konsequenterweise ist es der Braun, der den Doppelgänger zuerst wahrnimmt157 ; Zeichen dafür ist sein „schwerer röhrender Atem” (ebd.). Obwohl Lerch als erfahrener Reiter dieses Geräusch kennen müsste, kann er es zunächst nicht orten, genauso wenig wie dessen Ursache. So weit hat also das Pferd als sein Es sich schon verselbständigt. Bezeichnenderweise erkennt Lerch zuerst das Pferd des Doppelgängers mit dem seinen identisch. Er definiert sich also über seinen Unterbau und muss seinem Pferd abermals die Sporen geben, um sich selbst in der anderen Gestalt zu sehen. Anscheinend braucht es für die Selbsterkennung diese gewaltsame Vorwärtsbewegung, denn um seiner selbst bewusst zu werden, braucht es das wache Bewusstsein.
Der Doppelgänger sitzt wie Lerch auf dem Pferd und zeigt ihm damit die Spaltung seiner Persönlichkeit, aber eben auch die Möglichkeit, dieses Defizit durch Zügeln des Tieres, des Kreatürlichen auszugleichen. Doch Lerch ist quasi doppelt gespalten: mehr oder weniger in sich selbst und von seinem Reiterideal.
Die Brücke verstärkt dieses Bild nochmals; dabei scheint sie wirklich nur dieser stilisierten Darstellung zu dienen, denn der Graben, den sie überbrückt, ist trocken und wohl auch nicht allzu tief, wenn „die Gemeinen Holl und Scarmolin mit unbefangenen Gesichtern von rechts und links” (ebd.) aus ihm auftauchen können. Die Brücke steht einerseits für die Spaltung, aber auch für die Verbindung von Ich und Es158, und bietet Lerch andererseits die Option, sich in ihrer Mitte mit dem Doppelgänger zu vereinen und seine Identität wiederzufinden.
Im Allgemeinen gilt das Motiv des Doppelgängers als Ausdruck der (hier: doppelten) Spaltung der Persönlichkeit und des Identitätsverlustes sowie als Vorzeichen des Todes.159 Für beides steht es in der „Reitergeschichte”: Indem Lerch sein Pferd zurückreißt und den Doppelgänger abweist, dass dieser verschwindet, bringt er sich um die lebenswichtige Integration von Ich und Es.160 Auch die Brücke ist verschwunden; jedenfalls wird sie nicht mehr erwähnt.161 Am Ende der Dorfepisode, die letztlich nur dazu dient, dieses zu verdeutlichen, trägt das Pferd unter Lerch den Sieg davon. Die zwei Gemeinen, die das Dorf umritten, haben ja „unbefangene Gesichter”, haben von den Geschehnissen im Dorf nichts mitbekommen; diese waren nur dem Reiter Lerch vorbehalten.162
III.6 Der Tod des Reiters
III.6.1 Ruf zur Attacke
Als der Ruf zur folgenden Attacke ertönt, sieht der Wachtmeister zunächst passiv zu: Lerch
[…] sah, indem, er die vier losen Zügel in der Linken versammelnd, den Handriemen um die Rechte schlang, den vierten Zug sich von der Schwadron ablösen und langsamer werden […]. (S. 45 f.)
Vier Zügel hat er also, um sein Pferd an die Kandare zu nehmen, und am Ende der Dorfepisode sind sie alle „lose” als Zeichen Lerchs Zügellosigkeit.
Die Zügel bleiben ohne wirksame Verbindung zum Pferdemaul, auch wenn der Wachtmeister sie in der linken Hand versammelt, denn schließlich verkürzt er sie nicht. In diesem Zustand reitet er triebgesteuert in die Schlacht, in diesen langen Satz hinein, der erst mit dem Wort „Eisenschimmel” endet. Der Satz erinnert in seiner Struktur an den, der den Ritt durch Mailand beschreibt. In seiner Häufung von Zeitadverbien und Kommata und der Verwendung des epischen Präteritums zeigt er Lerch als unreflektierten Mitläufer des Kampfes163, in dem es darum geht, sich gegenseitig vom Pferd zu stoßen bzw. „die Finger der Zügelhand ab- und tief in den Hals des Pferdes hinein[zu]hauen” (S. 46).
In diesem Gefecht erscheint auch der Rittmeister „mit weit aufgerissenen Augen und grimmig entblößten Zähnen” (ebd.) wie ein aufgeregtes Pferd.164 Als Meister des Reitens ist er fähig, auf Kommando seine vitalen Instinkte nach außen zu kehren. Anders der Wachtmeister: Er befand sich schon zuvor in diesem erregten Zustand.
III.6.2 Die Eroberung des „Prämiums”
Lerch „[…] fühlte die Mêlée sich lockern und war auf einmal allein, am Rand eines kleinen Baches, hinter einem feindlichen Offizier auf einem Eisenschimmel” (ebd.). Es klingt, als sei der Eisenschimmel Lerchs eigentliches Kampfziel. Das Satzende zeigt ein weiteres Mal jene merkwürdige Stilisierung, denn dass sich der Wachtmeister ohne Vorankündigung im Augenblick des Gefechts allein direkt hinter einer solchen Beute befindet, wie er sie sich vor dem Einreiten in das Dorf ersehnt hatte165, klingt mehr als unwahrscheinlich. Vielmehr erscheint die nun folgende Szene am idyllischen „Rand eines kleinen Baches” (ebd.) als konsequente Weiterentwicklung der Ereignisse der Dorfepisode. Das Einleben in sein Unbewusstes hat er erfolgreich abgeschlossen und trifft nun auf sein in der Tiefe seines Innern schwelendes Begehren.
Für Lerchs mangelnde Integrationsfähigkeit spricht an dieser Stelle seine Isolation: „und war auf einmal allein”. Zu dieser Isolation trägt auch seine Sprachlosigkeit bei166, wenn man berücksichtigt, dass sich für Hofmannsthal der Mensch in erster Linie durch Wort und Tat vom Tier abhebt: „Tiere haben mit dem Menschen das Werk gemeinsam, aber die Rede und die Tat, diese beiden Magieen sind dem Menschen vorbehalten”167, lautet eine Aufzeichnung Hofmannsthals vom Oktober 1921. Die einzigen Worte, die Lerch zu Vuic spricht, wird er nicht in die Tat umsetzen können; auch deswegen ist er dem Kreatürlichen zuzuordnen.
Ebenso wie Lerch hat der feindliche Offizier seine Triebnatur nicht unter Kontrolle: „Der Offizier wollte über den Bach; der Eisenschimmel versagte.” (ebd.) Des Offiziers Wille kämpft mit dem Tier auf dem er sitzt, die Pistole kann er nicht abdrücken. So mit sich selbst beschäftigt und in seiner Willenskraft geschwächt wird er zur leichten Beute.
Der Offizier riß ihn [den Eisenschimmel] herum, wendete dem Wachtmeister ein junges, sehr bleiches Gesicht und die Mündung einer Pistole zu, als ihm ein Säbel in den Mund fuhr, in dessen kleiner Spitze die Wucht eines galoppierenden Pferdes zusammengedrängt war. (ebd.)
Mit dem Herumreißen des Pferdes und den Abwehrreaktionen des Offiziers erinnert die Szene an diejenige der Begegnung mit dem Doppelgänger.168 Lerch vertreibt den Offizier jedoch nicht mehr nur mit der Hand, sondern tötet ihn. Genaugenommen ist es die „Wucht” des Pferdes, die tötet169, als eindeutiges Zeichen der Gewichtsverlagerung im Innern Lerchs. Mit Pistole, Säbel und Mundöffnung bleibt die phallisch-sexuelle Färbung dieses gewaltsamen Vorgehens unübersehbar. Der Mund gilt als Organ des Wortes, als Symbol für die Macht des Geistes und der Schöpferkraft.170 So dient also auch dieses einprägsame Bild der Gewalt dazu, die schmerzliche Unterdrückung und den Verlust des Geistes, der Vernunft darzustellen.
Der Wachtmeister riß den Säbel zurück und erhaschte an der gleichen Stelle, wo die Finger des Herunterstürzenden ihn losgelassen hatten, den Stangenzügel des Eisenschimmels, der leicht und zierlich wie ein Reh die Füße über seinen sterbenden Herrn hinweghob. (ebd.)
Wieder erscheint dieser Vorgang sehr unwirklich, denn der Galopp des Braunen wird urplötzlich in den zierlichen Bewegungen des Eisenschimmels aufgefangen, der weniger wie ein Pferd, sondern wie ein Reh sich bewegt.
Wenn der Offizier vom Pferd fällt, ist dies ein Hinweis auf mangelnde Integration von Instinkt- und Triebsphäre. Der Eisenschimmel bleibt allein zurück und verkörpert ohne Reiter die „totale Einseitigkeit einer Ebene”171, sei es diejenige der Triebwelt oder des Bewusstseins. Seine Freiheit erlangt der Schimmel allerdings nicht wieder: Lerch fasst die Zügel genau an der Stelle, an der der „Herunterstürzende” (ebd.) ihn losließ. Er besteigt ihn aber nicht.
III.6.3 Der Eisenschimmel
Den Eisenschimmel kennzeichnet mit seiner Färbung die Ambivalenz des archteypischen Symbols „Pferd”: Nach dem Deutschen Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm heißt ein Pferd zur damaligen Zeit dann Eisenschimmel, wenn es mehr schwarz als weiß ist.172 Weiß gilt als Gegensatz von schwarz, der Eisenschimmel integriert beides und kann damit sowohl Leben als auch Tod, aufstrebendes Bewusstsein und vitale Instinktwelt repräsentieren.173 Im Wort „Eisenschimmel” schwingt auch ein gewisses Gewaltpotential mit und doch ist er ein „schönes Beutepferd” (ebd.), kann damit also männlich und weiblich174 wirken. Der Schimmel ist das „Reittier der Fürsten und Sieger”175 ; mit dem Eisenschimmel wird der Siegertypus anachronistisch: Sein Reiter fällt tot vom Pferd.176
Durch seinen ambivalenten Charakter ist der Eisenschimmel schwer einzuordnen; dies ist nur in Zusammenhang mit dem Wachtmeister und seinem Braun möglich. Mit seiner gewaltsamen Festnahme als Beutepferd und in Anbetracht der bisherigen Analyse und Interpretation erscheint er eher im negativen Licht als Lerchs Todesvorbote und Seelenführer.177
Andererseits heißt es über ihn:
Er [Lerch] ritt zum Rittmeister und meldete, immer den Eisenschimmel neben sich, der mit gehobenem Kopf tänzelte und Luft einzog, wie ein junges178, schönes und eitles Pferd, das es war. (ebd.)
Im Kontrast179 zu Lerchs schwerem Braun wirkt der Eisenschimmel leicht, in seiner Zierlichkeit kaum wie ein Pferd180, und ist weniger dem Element Erde als dem der Luft verbunden. Diese Auffälligkeit und seine oben herausgearbeiteten ambivalenten Eigenschaften rücken ihn in die Nähe des Pegasos’, der als aufstrebendes Bewusstsein gen Himmel fliegt. Wenn Lerch nun dieses Beutepferd neben sich führt, muss es fast zwangsläufig als seine von ihm nahezu gelöste Denkfähigkeit scheinen. Der Braun und der Eisenschimmel veranschaulichen die Trennung von Ich und Es, Lerch ist auf dem Braunen sitzend einseitig dem Unbewussten zugetan. Er ist der Realität entrückt, geistig kaum anwesend, und insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass der Rittmeister seiner Meldung keine Beachtung schenkt: „Der Rittmeister hörte die Meldung nur zerstreut an.” (ebd.)
III.6.4 Lerch fällt vom Pferd
Insgesamt sind es neun Handpferde, die Unruhe in die Schwadron bringen:
Auch standen die Pferde nicht ruhig, besonders diejenigen, zwischen denen fremde erbeutete Pferde eingeschoben waren. Nach solchen Glücksfällen schien allen der Aufstellungsraum zu enge, und solche Reiter und Sieger verlangten sich innerlich, nun im offenen Schwarm auf einen neuen Gegner loszulegen, einzuhauen und neue Beutepferde zu packen. (S. 47)
Die Pferde ohne Reiter verstärken die triebhaft aufgeladene Situation, die sich chaotisch zu entladen droht. Sie stören das eingeforderte Gleichgewicht zwischen Ich und Es: Die Pferde sind in der Überzahl.
Der Rittmeister befiehlt:
„Handpferde auslassen!” Die Schwadron stand totenstill.181 Nur der Eisenschimmel neben dem Wachtmeister streckte den Hals und berührte mit seinen Nüstern fast die Stirne des Pferdes, auf welchem der Rittmeister saß. (ebd.)
Es ist eine Grenzsituation zwischen Leben und Tod: Für den Wachtmeister nämlich bedeutete das Loslassen des Eisenschimmels, der sich hier als Zeichen der Verselbständigung Lerchs gelöster Vernunft als einziger zu rühren wagt182, der vollkommene Verlust seines Bewusstseins und damit sein Ende. Durch die Bewegung des Handpferdes richtet sich das Augenmerk des Rittmeisters, während er bis drei zählt und seine Pistole einsatzbereit macht, auf Lerch.
Lerchs „Bewusstsein” war
von der ungeheuren Gespanntheit dieses Augenblicks fast gar nicht erfüllt, sondern von vielfältigen Bildern einer fremdartigen Behaglichkeit ganz überschwemmt, und aus einer ihm selbst völlig unbekannten Tiefe seines Innern stieg ein bestialischer Zorn gegen den Menschen da vor ihm auf, der ihm das Pferd wegnehmen wollte […]. (S. 47 f.)
Lerch möchte sein erträumtes „Prämium”, an dem seine Existenz hängt, nicht loslassen.183 Sein Bewusstsein ist kaum noch vorhanden, ist in der kreatürlichen „Tiefe seines Innern” verschwunden.184 Seine Realitätsflucht scheint geglückt, doch führt diese die folgende Handlung ab absurdum.185 Der tödliche Schuss aus der Pistole des Rittmeisters, eines Menschen, bei dem Wort und Tat zusammenfallen186, ist die letzte, logische Konsequenz der traurigen Geschichte des Anton Lerch.187
[U]nd der Wachtmeister taumelte, in die Stirn getroffen, mit dem Oberleib auf den Hals seines Pferdes, dann zwischen dem Braun und dem Eisenschimmel zu Boden. (S. 48)
Bezeichnenderweise in den Sitz des Verstandes getroffen, fällt der Reiter Lerch zwischen die durch die beiden Pferde repräsentierten unabhängigen Hälften seines Ich, zwischen die in seinem Namen bereits angelegten Pole.
Die Ross-Reiter-Einheit zeigt sich damit in ihrer ganzen Labilität und Fragwürdigkeit, die der glänzenden Einheit des stolzen Rosses samt seinem stolzen Reiter polar gegenübersteht. Symbolisch trennen sich Ich und Es, und es offenbart sich deutlich, wie schwach das eine ohne das andere ist.188
Die Spaltung des Menschen in Natur- und Kulturwesen ist Lerch zum Verhängnis geworden.
III.6.5 Die Aufkündigung der Ross-Reiter-Verbindung: Wachtmeister Lerch als Bellerophon
Wie im „Schimmelreiter” gibt es auch in der „Reitergeschichte” keine Darstellung einer kentaurischen Einheit von Reiter und Pferd, denn wie gezeigt, spiegelt, steigert oder kontrastiert das Pferd den Reiter in seinen Eigenschaften und dient auf diese Weise, spätestens aber, wenn der Reiter dominant wird, als Mittler optischer Veranschaulichung.189 Damit erscheint die Ross-Reiter-Beziehung reflektiert, das Stadium der magisch-mythischen Einheit ist überwunden. Doch die „Reitergeschichte” geht, was den Pegasos-Mythos angeht, über den „Schimmelreiter” hinaus: Wie einst Bellerophon fällt der Mensch vom Pferd auf die Erde zurück; er stürzt vom Pferd, von seinem Statussymbol. Es ist der Tod des Reiters und der Zusammenbruch der Ross-Reiter-Verbindung.
Das Verlassen des Pferderückens als einer Bühne jedoch bezeugt andererseits einen Bewußtseinswandel: Der Verlust der einstigen archaisch-kentaurischen Einheit ist als unabänderlich anerkannt.190
Zu Anfang wurde auf die allgemeine Ebene des Textes hingewiesen, die diese Erzählung bereits durch den Titel anvisiert. Lerch steht als leidender Held stellvertretend für die Menschheit. Indem er vom Pferd fällt, wird das Pferd als Symbol umgedeutet von dem des Sieges zu dem der Niederlage; es wird zum „Symbol der verlorenen Einheit und des Leidens”191. Dafür stehen auch die anderen „mit einem Zügelriß oder Fußtritt” (ebd.) freigelassenen Beutepferde. Doch als domestiziertes Tier in einer zivilisierten Welt kann es seine ursprüngliche Freiheit nicht wiedererlangen; es ist nicht frei, sondern reiterlos: Der Verlust des Reiters muss mitgedacht werden. Das Pferd ohne Reiter steht einseitig entweder für die Krise des Bewusstseins oder die verfehlte Integration der Instinktwelt.
III.7 Das Pferd: Symbol des Unaussprechlichen
Diese Ausdeutung der „Reitergeschichte” bestätigt sich in einem kurzen Blick auf „Ein Brief” (1901/02), in dem Hofmannsthal alias Lord Chandos das Verhältnis von geistiger und körperlicher Welt über drei Entwicklungsstufen eindrucksvoll schildert192:
Mir erschien damals in einer Art von andauernder Trunkenheit das ganze Dasein als eine große Einheit: geistige und körperliche Welt schien mir keinen Gegensatz zu bilden, […] in allem fühlte ich Natur, […] und in aller Natur fühlte ich mich selber […].193
Dieser „mythische Einheitszustand der Präexistenz”194 erwies sich als Illusion:
Mein Fall ist, in Kürze, dieser: Es ist mir völlig die Fähigkeit abhanden gekommen, über irgend etwas zusammenhängend zu denken oder zu sprechen.195
Es zerfiel mir alles in Teile, die Teile wieder in Teile und nichts mehr ließ sich mit einem Griff umspannen.196
Diese Konfliktstruktur bleibt in der „Reitergeschichte” unausgesprochen und schwingt dennoch in der Ross-Reiter-Darstellung mit; insofern bestätigt sich die anfängliche Vermutung, in dieser Erzählung verdichte sich im Pferd als Symbol das Unaussprechliche.
It is very striking that the horse-and-rider image is found in its positive variant in early and late works alike, while in its negative variant it is restricted to a certain period, that is to say the years between 1895 and 1912 at the latest, allowing for the uncertainty of dating Andreas.197
Die Ross-Reiter-Darstellungen im Werk Hofmannsthals spiegeln also die Bewusstseinszustände Lord Chandos’; die „Reitergeschichte” gehört mit ihrer verfehlten Integration von Pferd und Reiter zur zweiten negativen Phase.
Im später entstandenen Lord Chandos-Brief ist jedoch im Gegensatz zur „Reitergeschichte” das Dasein „nicht ganz ohne freudige und belebende Augenblicke”198 ; es sind dies die Augenblicke, in denen man durch unmittelbare Teilnahme am Leben für eine kurze Zeit in eine andere Materie hinüberfließt, für eine kurze Zeit Teil der Synthese wird.199 Gerade beim Reiten sind solche Glücksmomente immer wieder zu spüren, wenn der Eindruck entsteht, Pferd und Reiter bewegten sich völlig harmonisch.200 Hofmannsthal selbst berichtet Helene von Nostitz in einem Gespräch im Jahr 1906 von einem solchen Moment aus dem Jahr 1895, der zwar eigentlich gefährlich scheint, aber dennoch unmittelbar erlebt wird:
Eines Tages ging es [das Pferd] durch, wir flogen durch die Wälder. Es war schön, denn die Sonnenstrahlen schossen durch die Baumstämme und flimmerten um uns. Ich wußte, dass wir dem sicheren Tode entgegenritten, denn vor uns lag ein Walddickicht mit harten aneinandergepreßten Stämmen. Da, plötzlich besann sich das Pferd und trabte, langsamer werdend, in eine andere Richtung. Wir kamen in ein freundliches Dorf. Ein schönes böhmisches Mädchen trat mir entgegen, den Körper nur mit einem losen Hemde bekleidet. Zum ersten Male nach langen Wochen fühlte ich Hunger; ich bat sie um ein Glas Milch und trank es aus. Dann saß ich noch eine Weile. Der Mond ging auf, und in seinem Schein ritt ich nach Hause. Ich habe ein solches Glücksgefühl wie in diesen Stunden niemals empfunden.201
IV. Franz Kafka: Ein Landarzt - das Pferd ist tot, es lebe das Pferd
Ich war in großer Verlegenheit: eine dringende Reise stand mir bevor; ein Schwerkranker wartete auf mich in einem zehn Meilen entfernten Dorfe; starkes Schneegestöber füllte den weiten Raum zwischen mir und ihm; einen Wagen hatte ich, leicht, großräderig, ganz wie er für unsere Landstraßen taugt; in den Pelz gepackt, die Instrumententasche in der Hand, stand ich reisefertig schon auf dem Hofe; aber das Pferd fehlte, das Pferd.202
Mit diesem langen Satz, an dessen Ende das Pferd steht bzw. fehlt, eröffnet Franz Kafka seine Erzählung „Ein Landarzt”. Alles steht für die Reise bereit, aber dies alles wird nichtig, weil das Pferd nicht vorhanden ist. Das Fehlen des Pferdes wird zum Ausgangspunkt des Schreibens203 und ist daher für die Erzählung von existentieller Bedeutung.204 Die große Verlegenheit wird erst mit der Konjunktion „aber” verständlich, die den Gegensatz von Vorhandenem und Fehlendem verdeutlicht, die Größe des Verlustes durch die zweifache Erwähnung des Pferdes.205 Als könne dieser Verlust über den Text kompensiert werden, ist das Wort „Pferd” unter all den anderen signifikanten Zeichen des Textes (wie Wunde, Pelz, Knecht usw.) das am meisten genannte206, was wiederum dessen Wichtigkeit für die Erzählung unterstreicht.
Aufgrund vorheriger Überlegungen mag es kaum verwundern, dass „Ein Landarzt” als die dunkelste und rätselhafteste Erzählung Kafkas gilt207, wenn das Pferd darin eine solch tragende Rolle spielt. Auf die ambivalente Symbolik dieses Tieres scheint Verlass, wird doch in der Forschung immer wieder auf das ambivalente Strukturprinzip von „Ein Landarzt” hingewiesen.208 Die Erzählung nimmt damit im Werk des Autors eine ähnliche Stellung ein wie schon zuvor „Der Schimmelreiter” bei Theodor Storm und „Reitergeschichte” bei Hugo von Hofmannsthal. Während Hofmannsthal sich später von seiner „Reitergeschichte” distanzierte, war „Ein Landarzt” eine der wenigen Erzählungen Kafkas, die seinen strengen Bewertungskriterien einigermaßen standhielt und noch zu Lebzeiten veröffentlicht wurde:
Zeitweilige Befriedigung kann ich von Arbeiten wie „Landarzt” noch haben, vorausgesetzt, dass mir etwas Derartiges noch gelingt (sehr unwahrscheinlich). Glück aber nur, falls ich die Welt ins Reine, Wahre, Unveränderliche heben kann.209
„Ein Landarzt” gibt einer Sammlung von 14 Erzählungen den Namen und erlangt schon allein deswegen unter diesen eine Sonderstellung. In den meisten dieser Geschichten kommen Pferde vor210 ; es scheint fast, als würden sie durch die Kraft des Pferdesymbols zusammengehalten. Überhaupt stößt man bei Kafka immer wieder auf die merkwürdigsten Pferdedarstellungen, sogar in den Tagebüchern: Das Pferdemotiv ist in seinem Werk von großer Bedeutung.211 Viele Fragmente variieren das Thema des Aufbruchs eines Reiters, so dass das Pferd im Werk Kafkas als Aufbruchssymbol gelten kann.212
IV.1 Vom Umbruch der Ross-Reiter-Beziehung
IV.1.1 „Aber das Pferd fehlte, das Pferd”
Wie schon die beiden zuvor betrachteten Erzählungen bewegt sich auch „Ein Landarzt” in der Sphäre zwischen Leben und Tod: Ein Arzt wird zu einem Schwerkranken gerufen, den er ohne sein Fortbewegungsmittel - diesmal wird das Pferd nicht geritten, sondern dient als Zugtier - nicht erreichen kann; und doch hebt sich „Ein Landarzt” bereits in seinem Anfangsbild von den zwei anderen Erzählungen ab: Alle Zeichen stehen auf Aufbruch, doch diese Aufbruchsstimmung muss zunächst im Bild erstarren, weil das Pferd fehlt. Das Pferd wird hier gerade deshalb so wichtig, weil es nicht da ist, oder anders formuliert: Erst wenn das Pferd fehlt, wird dem Menschen dessen tragende Funktion bewusst. Die menschlichen Defizite, die das Pferd so selbstverständlich auszugleichen bereit war, treten augenscheinlich ins Bewusstsein und machen sich schmerzlich bemerkbar.
Im „Schimmelreiter” kündigte sich die Labilität der Ross-Reiter-Beziehung bereits an213, die „Reitergeschichte” endet mit der Aufkündigung dieses fruchtbaren Verhältnisses214, im „Landarzt” leitet dessen Zusammenbruch die Erzählung ein und begründet das Dilemma des Arztes.
Jahrtausendlang trug das Pferd den Menschen und wurde, indem es ihn vom irdischen Boden erhob, zum Symbol des aufstrebenden Bewusstseins. Gleichzeitig wurde es zum Sinnbild der Natur, von der sich der Mensch, sei es nun seine eigene Triebwelt oder äußere Naturgewalt, als Reiter abhängig zeigte.215 Zwangsläufig musste es dem Menschen, wollte er die Verselbständigung des Geistes und die Unabhängigkeit von der Natur weiter verfolgen, zum Ziel werden, sich von der uralten Gemeinschaft mit dem Pferd zu befreien.
„[…] aber das Pferd fehlte, das Pferd. Mein eigenes Pferd war in der letzten Nacht, infolge der Überanstrengung in diesem eisigen Winter, verendet;” (S. 252 f.) Es scheint hier wirklich das Pferd im Allgemeinen gemeint zu sein, denn der nächste Satz klingt durch die Betonung „mein eigenes Pferd” eher als Herausstellen des Landarztpferdes aus der Menge aller Pferde. Wenn mit „das Pferd” nur das Pferd des Arztes gemeint wäre, hätte der nachfolgende Satz mit einem einfachen „Es” anschließen können. Im gesamten Dorf ist kein Pferd aufzutreiben: „[…] es war aussichtslos, ich wußte es […].” (S. 253) Der Arzt wusste schon im ersten Satz, dass ihm kein Pferd zur Verfügung stehen würde.
An dieser Stelle fällt ein weiterer Unterschied zu den beiden anderen behandelten Erzählungen auf: Das Pferd fehlt auch im Titel, ist im wahrsten Sinne des Wortes abwesend. Natürlich kann man nicht unterstellen, dass Kafka das Tier bewusst aus dem Titel herausgehalten hätte, doch sollte es zumindest erwähnt werden, gerade wenn man bedenkt, welch essentielle Bedeutung es für die Erzählung hat und dass das Pferd als Fortbewegungsmittel für einen Arzt auf dem Lande zu dieser Zeit von allergrößter Wichtigkeit war. Ohne das Pferd ist sein Beruf kaum auszuüben, ist er zur Untätigkeit verdammt216: „[I]mmer unbeweglicher werdend, stand ich zwecklos da.” (ebd.) Sein gesamtes Dasein scheint ohne Pferd sinnlos geworden: „Was tue ich hier in diesem endlosen Winter! Mein Pferd ist verendet, und da ist niemand im Dorf, der mir seines leiht.” (S. 257) Auf die Abwesenheit des Pferdes im Titel sollte auch deswegen hingewiesen werden, weil Kafka für die Geschichte „Das nächste Dorf” - ebenfalls aus der Landarzt-Sammlung - ursprünglich den Titel „Ein Reiter” vorgesehen hatte, diesen aber änderte.217
IV.1.2 „Ein Landarzt” als Übergangsstadium
„Ein Landarzt” entsteht zu einer Zeit, in der das Pferd als Nutztier beginnt auszusterben. Die zunehmende Motorisierung des Menschen macht es als privates Fortbewegungsmittel überflüssig. Das Auto als direkter Nachfahre des Pferdes manifestiert sich noch heute in Ausdrücken wie „Pferdestärke” und „ins Auto steigen”, gleichzeitig klingt hier leise die Schwierigkeit mit, sich vollständig von diesem Tier zu lösen. Mit der Erfindung des Autos hat die Verselbständigung des Geistes Gestalt angenommen, was zugleich neue Gefahr in sich birgt, da der Mensch nun seinen eigenen Produktionen ausgeliefert ist, die als Maschinen Macht auf ihn ausüben und eine Eigendynamik entwickeln können. Diese Produktionen bleiben letztendlich wie auch das Zäumen und Satteln des Pferdes Mittel, menschliche Defizite auszugleichen und die Natur zu überlisten, und damit mit einem Restrisiko verbunden. Der Konflikt zwischen Mensch und Natur ist damit bis heute ungelöst.218
Das Pferd befindet sich außerhalb des Machtbereichs des Arztes und somit wird das, wofür das Pferd steht, ebenfalls unbeherrschbar: Dem Landarzt fehlt das Pferd zunächst als Nutztier und er empfindet diesen Mangel als Verlust219, weil ihm ein Ersatzmittel noch nicht zur Verfügung steht. Als äußeres Zeichen seiner Unbeweglichkeit wird er „immer mehr vom Schnee überhäuft” (S. 253). Aber auch als Symbolträger für menschliche Eigenschaften ist das Pferd für den Landarzt nicht mehr vorhanden. Jegliches geistige Vorwärtsstreben ist unterbunden, weil sich das Symbol des aufstrebenden Bewusstseins dem menschlichen Einfluss entzogen hat. Die Verselbständigung des Geistes kündigt sich an. Damit eng verbunden ist das Pferd als Symbol der poetischen Inspiration in Gestalt des Pegasos’, der unter anderem den phantastischen Gedankenfluss ohne irdischen Bezug verkörpert.
Das gezügelte Pferd steht für die Beherrschung der Triebe, des menschlichen Unbewussten, und führt, wenn die Verbindung zwischen Ross und Reiter denn harmoniert, zur Selbstbeherrschung des Menschen und zu einer neuen Identität.220 Kann er dies alles nicht mehr auf das Tier projizieren, bricht die Triebwelt ungezügelt hervor und entwickelt eine Art Eigendynamik, werden Identitäten unsicher. All dies trifft für die „Landarzt”-Erzählung zu.
„Ein Landarzt” zeichnet eine Art Übergangsstadium: Einerseits ist das Ross-Reiter-Verhältnis unabänderlich zerbrochen, andererseits gibt es für das Pferd noch keinen adäquaten Ersatz, und so zeigt sich das Ausgleichen der Defizite durch das Pferd als Selbstbetrug. Einerseits muss sich der Mensch vom Pferd lösen221, andererseits scheint es als archetypisches Symbol für den Menschen von solcher Anziehungskraft zu sein, „dass er sich das Fortbestehen der Symbiose über alle Vernunft hinaus und mit allen Mitteln zu sichern sucht”222. Auch der Landarzt wird ja eine Lösung finden, wie er zu dem Kranken gelangen kann.
IV.1.3 Das Pferd als Symbol des Leidens
Der Text gibt mit dem Tod des Landarzt-Pferdes einen konkreten Hinweis, warum das Pferd als solches verschwunden ist: Es verendete „infolge der Überanstrengung in diesem eisigen Winter” (S. 252 f.). Nun würde sich ein Pferd allerdings instinktiv nicht überanstrengen, sondern sich einfach ausruhen, wenn es müde ist. Der Mensch selbst muss es gezwungen haben, sich zu überanstrengen, und hat dabei wohl seine Dominanz mit allen erdachten gewaltsamen Mitteln ausgespielt und am Ende zu weit getrieben: „Überanstrengung” ist eine euphemistische Benennung der Todesursache aus menschlicher Sicht. Im wahrsten Sinne des Wortes machte sich der Landarzt sein Pferd gewaltsam untertan, leidet aber schließlich an diesem Verlust und damit indirekt auch unter der Gewalt, die er selbst ausübte. Von diesem Leiden an der gewaltsamen Einwirkung spricht auch ein Tagebucheintrag Kafkas im Juli 1913; das Pferd zeigt sich hier als Symbol des Leidens223:
Ich elender Mensch!
Nur das Pferd ordentlich peitschen! Ihm die Sporen langsam einbohren, dann mit einem Ruck sie herausziehn, jetzt aber mit aller Kraft sie ins Fleisch hineinfahren lassen.
Was für Not!224
Die immer größer werdende Dominanz des Reiters verdeutlichte sich auch im Verlauf der beiden anderen in dieser Arbeit besprochenen Erzählungen. Sie zeigte sich vor allem, wenn das Pferd die Eigenschaften seines Reiters kontrastierte und somit den Reiter zwang, seinen Willen mit Schenkeldruck oder Sporen durchzusetzen. Die Labilität des Verhältnisses wird nach außen hin sichtbar. „Ein Landarzt” hat diesen Kampf schon hinter sich: Der Mensch bleibt einsamer, zweifelhafter Sieger; das Pferd ist tot.
IV.2 Von der Sehnsucht nach dem Pferd
IV.2.1 Die Wiedergeburt des Pferdes
Der Landarzt greift in seiner Not zu einer List: Er macht sich seine Pferde selbst, lässt sie aus der Tiefe seines Innern entstehen225, und dies ist ihm ein leichtes, schließlich ist sein Unbewusstes ungezügelt; es kann in Gestalt der Pferde ungehindert ausbrechen, noch dazu ist es mitten in der Nacht. Außerhalb seines Ich, im Dorf, war es „aussichtslos”, an ein Pferd zu kommen. In seiner Isolation226 bleibt der Arzt auf sich selbst angewiesen und geschickt weiß er den Pferdemangel, für den er ja selbst verantwortlich ist, zu kompensieren. Somit entstehen die Pferde zwar aus einem unbewussten Zustand heraus, sind aber gleichzeitig auch kalkulierte Produktion des menschlichen Geistes: Die Ambivalenz des Pferdesymbols bleibt lebendig.227 Das Pferd bildet die „Brücke zwischen bewussten und unbewussten Teilen der Psyche”228.
Zum Zeichen der Aussichtslosigkeit ein Pferd zu finden, schwenkt das Dienstmädchen die Laterne. Dieses Zeichen nimmt der Arzt zum Anlass, sich nochmals umzusehen:
Ich durchmaß noch einmal den Hof; ich fand keine Möglichkeit; zerstreut, gequält stieß ich mit dem Fuß an die brüchige Tür des schon seit Jahren unbenützten Schweinestalles. Sie öffnete sich und klappte in den Angeln auf und zu. Wärme und Geruch wie von Pferden kam hervor. Eine trübe Stalllaterne schwankte drin an einem Seil. (S. 253)
In einem Zustand der Zerstreuung, des mangelnden Bewusstseins, aber auch der Qual sucht der Arzt nach einer Möglichkeit und findet zunächst keine. Erst als er mit dem Fuß, der vom Kopf am weitesten entfernten Extremität, an die Tür seines Schweinestalls stößt, ergibt sich eine solche. Die Tür gilt als Sinnbild des Übergangs von einem Bereich in den anderen229, an dieser Stelle von außen nach innen. Dieser Gegensatz wird verstärkt durch die Opposition von der Kälte draußen und der Wärme, die die Pferde im Innern des Schweinestalls verströmen. Diese Wärme ist das erste, was den Arzt an Pferde denken lässt, doch entstehen diese in seiner Imagination, indem er die Wärme zunächst nur mit diesem Tier vergleicht: „Wärme und Geruch wie von Pferden”230.
Die Laterne, die zuvor für das Fehlen des Pferdes stand, wirft im Stall trübes Licht und schwankt von selbst, gerade wie wenn sich hier das getrübte Bewusstsein des Arztes regte. Der Schweinestall scheint für die surreale Geburt der Pferde aus der Tiefe des Innern des Arztes der ideale Ort, gilt doch das Schwein einerseits als Symbol der Fruchtbarkeit, andererseits für die niederen Sphären des Daseins.231 Nachdem der Knecht, der erst zum Knecht wird, als der Arzt ihn als solchen bezeichnet, aus dem Stall hervorgekrochen ist232, beugt sich der Landarzt noch tiefer und das Dienstmädchen kommentiert: „Man weiß nicht, was für Dinge man im eigenen Hause vorrätig hat.” (ebd.) Das Haus steht als Symbol traditionell für den menschlichen Körper, in dem die Seele wohnt.233 An späterer Stelle sagt der Arzt: „Aus dem Schweinestall muss ich mein Gespann ziehen;” (S. 257) und gegen Ende der Erzählung: „[L]angsam wie alte Männer zogen wir [Pferde und Arzt] durch die Schneewüste”234 (S. 261). Kein anderer als er selbst hat dieses Gespann ins Leben gerufen, es sind Imaginationen und Teil seines Ich.
Keine Stelle des Textes spricht allerdings explizit aus, was dem Leser unablässig suggeriert wird: dass die Pferde aus dem Innern des Arztes selbst geboren werden. Doch Kafka setzt die Zeichen so geschickt und dicht, dass sie nicht nur das Unbewusste des Arztes zu spiegeln scheinen, sondern zugleich das Unbewusste des Lesers direkt ansprechen. Durch die Verwendung einer traditionell ambivalenten Symbolik, die letztlich niemals eindeutig aufzulösen ist, kann sich der Leser der unbewussten Beeinflussung durch den Text ebenso wenig entziehen wie sich der Landarzt den Pferden.235
IV.2.2 Von der Anziehungskraft des Pferdes
Kaum ein Interpret des „Landarztes” versäumt es, das Traumartige bis Traumatische der Erzählung hervorzuheben.236 Dazu gehören unter anderem die Auflösung des Ich-Komplexes und die Projektion seiner Komponenten auf verschiedene Traumbilder237, die konkrete vorrationale Gestaltung unter Aufhebung der Kategorien von Raum und Zeit und damit Synchronizität238 statt Kausalität.239 Der Tod des Pferdes ist, wie bereits gezeigt, der Anlass für die Reise ins Innere des Arzt-Ich240, für den Verlust von Identität, für die Verselbständigung deren Komponenten. Die Entwicklung der „Bedeutung des Pferdes vom Seelensymbol oder vom Symbol für die Bewusstwerdung der Seele zum Symbol für psychische Befindlichkeiten”241 des Menschen scheint abgeschlossen.
Im „Schimmelreiter” zeigte sich der Kampf mit der Natur sowohl nach innen als auch nach außen gerichtet, in der „Reitergeschichte” im Kampf des Menschen, sich gegenseitig in der Vorwärtsbewegung zu hindern und zu einem Großteil im Innern des Protagonisten, im „Landarzt” ist der Konflikt nahezu vollständig ins Innere des Arztes verlegt. Doch im Innern des Menschen scheint all das gespeichert, was mit dem Pferd als archetypischem Symbol zusammenhängt und von dem sich der Mensch nicht zu lösen vermag.
Kafka verknüpft seine Pferdegestalten mit einem solch dichten Netz von Anspielungen auf die uralte Geschichte der Mensch-Pferd-Beziehung und deren mythologische Umsetzung in Bilder, dass sich die traumhafte Atmosphäre im Kopf des Lesers fast von selbst zu entwickeln beginnt. Denn es ist ja Eigenschaft des Traums, „dass Vorstellungstendenzen archetypischer Natur, wie sie auch in Mythen, Märchen und Sagen Gestalt annehmen, im Traume wirksam sind und zu Schöpfungen führen, die dem wachen Denken eher fremd geworden sind”242. Indem Kafka mit solchen Andeutungen spielt, sie in einen neuen Kontext oder in Opposition zueinander setzt, ins Leere laufen lässt oder humoristisch unterläuft, sie aber gleichzeitig den Leser direkt ansprechen, zeigt sich das Nicht-Loslassen-Können vom archteypischen Symbol Pferd.243 Nach wie vor hat es eine große Anziehungskraft, obwohl oder gerade weil es sich dem Landarzt entzogen hatte.
Das erste, was der Arzt mit seinen Ersatz-Pferden in Verbindung bringt, ist die Wärme.244 Natürlich steht diese in Opposition zur Kälte des Winters und damit für den Kontrast innen/außen, aber zunächst einmal zeigt die Wärme die positive Besetzung dieses Tieres in der Vorstellung des Arztes, vertraut er doch auf sein helfendes Eingreifen. Die Wärme, die von dem Tier ausgeht bzw. die der Arzt gedanklich mit ihm verbindet und die ihm verloren gegangen war, bedeutet auch eine archaische Sehnsucht des Menschen nach der Nähe zum Pferd, die erst aufkommt, nachdem das Pferd als selbstverständlicher Begleiter des Menschen fehlt.
IV.3 „Unbeherrschbare Pferde”
IV.3.1 Irdisch und unirdisch zugleich: die Landarzt-Pferde
„Hollah, Bruder, hollah, Schwester!” rief der Pferdeknecht, und zwei Pferde, mächtige flankenstarke Tiere schoben sich hintereinander, die Beine eng am Leib, die wohlgeformten Köpfe wie Kamele245 senkend, nur durch die Kraft der Wendungen ihres Rumpfes aus dem Türloch, das sie restlos ausfüllten. Aber gleich standen sie aufrecht, hochbeinig, mit dicht ausdampfendem Körper. (S. 253 f.)
Als Bruder und Schwester ruft der Knecht die Pferde aus dem Stall hervor, gleichzeitig kann es sich aber auch auf den Arzt und sein Dienstmädchen beziehen.246 Dies zeigt abermals die enge Verbindung der Figuren untereinander, denn das Dienstmädchen wird ja ebenfalls Teil der imaginären Ereignisse. Mit der Bezeichnung der Pferde als Bruder und Schwester wird von Anfang an die Ambivalenz ihrer Symbolik unterstrichen, wobei nicht auszumachen ist, welches Pferd den männlichen, welches den weiblichen Part übernimmt. Das eine ist jeweils das, was das andere nicht ist, da im Pferd mit seinem polaren Charakter - wie schon erwähnt - beides angelegt ist. Dies gilt auch für das Pferd als Symbol des aufstrebenden Bewusstseins wie der Triebwelt des Menschen. Zur Erinnerung:
Es [das Pferd] vereinigt die Libidosymbolik der Mutter, also die unbewußte Triebsphäre, mit der männlichen Libidosymbolik des unaufhaltsam vorwärtsstrebenden Bewußtseins.247
Die Ambivalenz des Pferde-Symbols manifestiert sich im Bild der beiden Pferde.
Als wolle er seinen Verlust doppelt kompensieren, lässt der Landarzt gleich zwei Pferde aus dem Türloch kommen.248 Sie sind „flankenstark” und „hochbeinig”, ausgestattet mit tierischer Vitalität249, und versprechen vor Kraft strotzend allein durch ihr Exterieur seine Hoffnungen zu befriedigen.250 Sie erscheinen ihm jedoch auch „mächtig”, üben also von Anfang an eine gewisse Macht auf ihn aus.251
Das Hervorkriechen der Pferde aus dem Türloch wird geschildert wie eine Geburt aus der Erde, aus den unbewussten Tiefen des Schweinestalls. Die langen Beine der Tiere unterstützen diese Assoziation: Fohlen haben verhältnismäßig lange Beine, was sich, sind sie ausgewachsen, verliert. Die geburtsähnliche Entstehung der Pferde spielt auf den chthonischen Charakter dieses Muttersymbols an, der im „Schimmelreiter” so oft zitiert wurde. Die Geburt aus dem Loch zeigt das Pferd von Anfang an auch als Libidosymbol.252 Mit der Muttersymbolik eng in Zusammenhang steht das Pferd als Sinnbild des Kreislaufs von Werden und Vergehen, Leben und Tod: Das Pferd war verstorben, daraufhin kommt es zur Geburt aus dem Schweinestall.
Die „ausdampfenden Körper” der Pferde machen die Wärme in kalter Umgebung sichtbar. Auf diese Weise setzen sich die Tiere von der kalten Umgebung eindrucksvoll ab und verdeutlichen dadurch abermals die Polarität zwischen Leben und Tod.253 Dass diese Pferde dampfen, lässt sich als Folge der Geburt erklären, indem sie die Mutterwärme nach außen tragen, oder einfach, weil sie durch die Anstrengung schwitzen.254
Die Pferde kommen aus dem unterirdischen Bereich des Schweinestalls, sind aber gleichzeitig die Kopfgeburt des Arztes und damit Symbol des aufstrebenden Geistes, der sich vom Pferd zu lösen sucht. Sie sind irdisch und zugleich „unirdisch”, wie sie der Arzt gegen Ende der Erzählung bezeichnet (vgl. S. 261).
IV.3.2 Das Pferd als Libidosymbol
Um sich von seiner zügellosen Triebnatur zu lösen, greift der Arzt zu einer weiteren List: Er projiziert sein sexuelles Verlangen auf seine Untergebenen, die - zumindest durch ihre Berufsbezeichnung - in Abhängigkeit zu ihm stehen wie ehemals das Pferd: auf den Knecht und das Dienstmädchen. Als der Knecht dem „willigen Mädchen” in die Wange beißt und so seine Absichten verdeutlicht, wandelt sie sich vom Neutrum zur Frau255, die Erzählzeit wechselt vom Präteritum ins Präsens256, was die verschwindende Distanz zum Geschehen ausdrückt:
„Hilf ihm”, sagte ich, und das willige Mädchen eilte, dem Knecht das Geschirr des Wagens zu reichen. Doch kaum war es bei ihm, umfaßt es der Knecht und schlägt sein Gesicht an ihres. […] „Du Vieh”, schreie ich wütend, „willst du die Peitsche?” (S. 254)
Der Ausruf des Arztes mit Vieh und Peitsche rückt den Knecht, der die Pferde als seine Geschwister sieht und „immer mit den Pferden beschäftigt” (ebd.) ist, abermals in die Nähe des Pferdes, in die Nähe des Tieres, dessen Verlust er kompensieren muss. Im Hause dann wird sich der Trieb des Arztes in Person des Knechtes verselbständigen, indem dieser dort das Mädchen vergewaltigt, dem er den Namen „Rosa” gibt. Rosa wird sein „Opfer” (S. 261), wie am Tag zuvor das Pferd dem Landarzt zum Opfer gefallen war. Damit entwickeln die Ereignisse im Haus des Arztes eine Art Eigendynamik, die ihn jedoch bis zum Ende der Erzählung immer wieder einholen und somit Macht auf ihn ausüben: Er hat seine Triebnatur ausgegliedert, trotzdem befindet sie sich unter seinem Dach. Immer wieder wird er sich während der Krankenszene nicht zuletzt durch die rosa Wunde an Rosa erinnern, und jedes Mal wenn er sich erinnert, steht bezeichnenderweise ein Pferd in unmittelbarer textueller Nachbarschaft. Die Verbindung von Rosa, rosa Wunde und Pferd ergibt sich auch durch die Möglichkeit der etymologischen Ableitung von „Rosa” aus ‘hross’ (Ross, Pferd).257
Nicht nur dadurch ist die Verselbständigung des Triebes mit den Pferden eng verbunden, schließlich dringt der Knecht in dem Augenblick ins Haus ein, in dem die Pferde vor dem Wagen des Arztes unbeherrschbar werden.258 Zumindest in einem der beiden Pferde, dies ergibt sich aus der Ambivalenz dessen Symbolkraft, drückt sich die Verselbständigung der Triebnatur, ihre Unbeherrschbarkeit und Macht und gleichzeitig das Nicht-Lösen-Können von ihr aus. Somit bleibt das Pferd als Libidosymbol die gesamte Erzählung hindurch lebendig.
IV.3.3 Die Reise ins Innere
„Munter!” sagt er; klatscht in die Hände; der Wagen wird fortgerissen, wie Holz in der Strömung; noch höre ich, wie die Tür meines Hauses unter dem Ansturm des Knechtes birst und splittert, dann sind mir Augen und Ohren von einem zu allen Sinnen gleichmäßig dringenden Sausen erfüllt. Aber auch das nur einen Augenblick, denn, als öffne sich unmittelbar vor meinem Hoftor der Hof meines Kranken, bin ich schon dort […]. (S. 254 f.)
Die schnellen Pferde beschleunigen die Reise259 des Arztes in sein eigenes Inneres, bringen ihn in nur einem „Augenblick” aus dem Schneesturm vor das Krankenzimmer. Diese Reise wird zu einer Art Lebensreise in die eigene Ohnmacht, der Weg des Lebens zu einer Reise in den Tod.260 Dementsprechend brechen in dieser Szene, als müsse die gesamte Geschichte des Menschen mit dem Pferd verarbeitet werden, archaische Bilder der Mensch-Pferd-Beziehung hervor, gespeichert im tiefsten Innern des Arztes. Besonders stark vertreten sind die Eigenschaften des Pferdes als Seelenführer.
Allein das Bild des Gespanns mit Wagen und Lenker erweckt unweigerlich eine Vielzahl unterschiedlicher mythologischer Vorstellungen, die das Pferd mit seinem polaren Charakter verbindet: Sei es das Gespann des Hades, das Gespann des Sonnengottes, das Gespann, wie es Platon im Phaidros beschreibt261, als Repräsentant der Komponenten menschlicher Persönlichkeit, die die Vernunft zügeln muss, um Unsterblichkeit zu erlangen, oder - damit einhergehend - die korrekte Wagenlenkung als Gleichnis für die Lebensführung:
Wer allein seinem Wagen und Rossegespann vertrauend,
Planlos immer ins Weite bald hier-, bald dorthin sich wendet,
Diesem irrt sein Gespann durch die Bahn; er zügelt es nimmer.
Wer aber klug seinen Vorteil wahrt auch mit minderen Rossen,
Schaut beständig aufs Ziel und wendet nach und beachtet
Wohl, wohin er zuerst sie gelenkt mit den rindernen Zügeln.262
Der Arzt wird sein Gespann ebenfalls nie zügeln können.
Die Pferde überwinden in einem Augenblick Zeit und Raum: Sie wirken wie mit magisch-mantischen Gaben ausgestattete Fabelrosse aus Heldensagen263, können durch die Lüfte reiten wie im Märchen, was bei Betrachtung des Endes der Erzählung umso absurder wirkt.264 Es ist ebenfalls eine Anspielung auf das Pferd als kosmisches Symbol:
Das Pferd als Zeitsymbol ist in engstem Zusammenhang mit seiner Funktion als Seelensymbol zu sehen, da der Kreislauf von Werden und Vergehen auch den zeitlichen Ablauf des Lebens bestimmt. So wird das Pferd, indem es Raum und Zeit zu überschreiten vermag, kosmisches Symbol und Lebenssymbol.265
Im „Landarzt” erscheint die Bewegung, der Lauf des Lebens wie ein einziger Augenblick. Das Pferdegespann als Seelenführer bringt den Arzt in die Nähe des Todes. Dieses Bild wird verstärkt durch die Kontrastierung von Bewegung und Ruhe in einem Satz; eben noch das „Sausen” von einem Ort zum anderen in einem Augenblick, dann heißt es: „[…] ruhig stehen die Pferde; der Schneefall hat aufgehört; Mondlicht ringsum […].” (S. 255) Die Pferde sind am Ziel ihrer Reise, ein neuer äußerer Rahmen tut sich auf, der Bilder eines magisch-mythischen Denkens evoziert, das unbewusst im Innern des Arztes liegt und sich eigentlich im Zuge der Bewusstseinserweiterung des Menschen verloren hatte.
Ganz charakteristisch hierfür ist die Verbindung von Pferd, Mond und Wasser266 - wird doch der Wagen „fortgerissen, wie Holz in der Strömung” (ebd.). Die Vorstellung vom Pferd als Attribut der Götter stammt ebenfalls aus einer Zeit, in der das menschliche Selbstbewusstsein sich langsam zu entwickeln begann:
„Ja”, denke ich lästernd, „in solchen Fällen helfen die Götter, schicken das fehlende Pferd, fügen der Eile wegen noch ein zweites hinzu, spenden zum Übermaß noch den Pferdeknecht -” (S. 255 f.)
Im folgenden Satz wird der Arzt die Pferde als „unbeherrschbar” anerkennen (vgl. S. 256), obwohl er doch eigentlich weiß, dass nur er selbst sie ins Leben gerufen hat. Es ist die Flucht des Urhebers, sein Selbstbetrug, indem er sich auf überholte Bilder aus vergangenen Zeiten stützt. Wenn der Arzt das Wiehern der Pferde als „Lärm” „höhern Orts angeordnet” (S. 258) einordnet, geht dies in eine ähnliche Richtung.
IV.3.4 Im Krankenzimmer: zwischen Leben und Tod
Die Familie des Kranken begleitet die Untersuchung des Arztes mit vorrationalen Handlungsriten267, die der Arzt nicht versteht: „[D]en verwirrten Reden entnehme ich nichts;” (S. 255) und an anderer Stelle: „Rezepte schreiben ist leicht, aber im Übrigen sich mit den Leuten verständigen, ist schwer.” (S. 257) Nur mit dem kranken Jungen kann er sprechen, was die Familie wiederum nicht hört. Dieser Gegensatz von Reden und Schweigen, Verstehen und Nicht-Verstehen268 verdeutlicht ein weiteres Mal die Isolation des Landarztes, aber auch die Nähe zum Kranken als Teil seines Unbewussten.
Doch die pantomimisch-magischen Rituale der Familie ziehen den Arzt genau wie die Pferde in ihren Bann. Von Anfang an wirkt er der Familie gegenüber ohnmächtig und passiv: „[M]an hebt mich fast aus dem Wagen” (S. 255). Diese Passivität zeigt sich auch in der Satzstruktur. Das Ich ist in den langen, durch Semikola unterteilten Sätzen gefangen.269 Die Wehrlosigkeit des Arztes gipfelt darin, dass die Familie ihn auszieht; völlig nackt ist er ihr ausgeliefert.270
„[I]m Krankenzimmer ist die Luft kaum atembar” (ebd.): Der Mangel an Lebensluft kennzeichnet das Zimmer als abgegrenzten Raum des Todes271, denn die Fenster sind noch geschlossen und es ist der erste Gedanke des Arztes, diese zu öffnen. Die Anwesenheit des Todes, aber auch die Einheit der Figuren Landarzt und Knabe, wird nochmals verdeutlicht in der Verbindung vom Jungen „ohne Hemd” (ebd.) und dem bärtigen Arzt, der sich, bevor er entkleidet und zum Kranken ins Bett gelegt wird, „alter Landarzt” (S. 259) nennt, und den die Pferde wie im Fluge trugen: In der griechischen Kunst wurde der Tod sowohl als schöner, nackter Jüngling als auch als alter bärtiger Mann mit Flügeln dargestellt.272
Allerdings entzieht sich die Situation dann wieder jeder eindeutigen Auslegung, gilt doch das Bett als Symbol der Geburt und des Todes273 und gibt erotischen Assoziationen274 Raum. Eindeutig scheint nur, dass sie sich in ihrer gesamten Widersprüchlichkeit im Pferd als Lebens- und Todessymbol verdichtet.
IV.3.5 Die Pferde im Fenster
Diese Pferde, die jetzt die Riemen irgendwie gelockert haben; die Fenster, ich weiß nicht wie, von außen aufstoßen; jedes durch ein Fenster den Kopf stecken und, unbeirrt durch den Aufschrei der Familie, den Kranken betrachten. (S. 256)
Es scheint, als spiegelten die Pferde an dieser Stelle den Willen des Arztes: Sie öffnen seinem Wunsch entsprechend die Fenster und sorgen auf diese Weise für Lebensluft. Sie durchbrechen als Lebenssymbol die Abgeschlossenheit dieses Todesraums und bieten die Möglichkeit einer Flucht vom dunklen Innenraum nach draußen ins helle Mondlicht, vom Tod ins Leben.275 Konsequenterweise kommt dem Arzt diese Option sogleich in den Sinn276: „Ich fahre gleich wieder zurück”, denke ich, als forderten mich die Pferde zur Reise auf […].” (ebd.) Die Hoffnung auf Rettung evoziert weiterhin das Bild der beiden Tiere, die den gebetteten Knaben beschützend betrachten, was unweigerlich Erinnerungen an die Weihnachtsgeschichte wachruft.277 Eine den Arzt erlösende Wendung innerhalb der Geschichte, die ihn von den Pferden befreit, wird man jedoch vergeblich suchen.278
Auf den ersten Blick mag der Wechsel von geschlossenem zu offenem Fenster als positiv gelten. Doch die eindeutige Zuordnung von positivem Äußeren und negativem Innern wird im Laufe der Krankenszene umgedeutet: „Wolken treten vor den Mond; warm liegt das Bettzeug um mich; schattenhaft schwanken die Pferdeköpfe in den Fensterlöchern.” (S. 259) Hier strahlt der Innenraum angenehme Wärme aus, die Fenster dagegen werden als Zugang nach draußen zu dunklen Löchern. Das Schwanken der Köpfe erinnert an das Schwanken der Laterne im Schweinestall und die Fensterlöcher an das Türloch, aus dem die Pferde emporkrochen. Der äußere Bereich scheint dadurch als ein unterirdischer.
Das Bild der durch die Pferde sich öffnenden Fenster bleibt ebenso ambivalent wie sein Agens. In ihm steckt, wirft man einen Blick auf die Pferdemythologie, nicht nur das Pferd als Lebensretter, sondern auch als Todesbote:
In Griechenland stammt die Vorstellung vom Roß als Psychopompos noch aus vorhomerischen Zeiten, als das Pferd der Mondgöttin geweiht war und vorwiegend chthonischen Charakter hatte. Auf vielen griechischen Totenmahlreliefs schaut, wie durch ein geöffnetes Fenster, ins Zimmer ein Pferdekopf.279
In biblischen Darstellungen von Sterbe- und Begräbnisszenen wird der Pferdekopf anstelle des Pferdes zum Führer des Toten; der Kopf vertritt als Sitz der Sinne das ganze Pferd.280 Diese Vorstellungen wirken weiter fort im Aberglauben, wenn es heißt, ein Pferd, das sich abends vor dem Fenster eines Schwerkranken sehen lässt, bringe den sicheren Tod.281
Ebenso in den Bereich des Aberglaubens gehört die Verknüpfung von Pferdewiehern mit dem nahen Tod eines Menschen.282 Im „Landarzt” wird diese Vorstellung zunächst umgedeutet. Als ein Pferd „zur Zimmerdecke wiehert” (S. 256), befindet der Arzt: „der Junge ist gesund” (ebd.), obwohl jener gefordert hatte: „Doktor, laß mich sterben.” (S. 255) Als dann beide Pferde wiehern, befindet der Arzt: „[J]a, der Junge ist krank” (S. 258), und sogleich fordert der Knabe seine Rettung. Das Wiehern beider Pferde, in denen sich ja die Ambivalenz von Leben und Tod bildlich manifestiert, erlaubt die Umkehrung der ersten Szene und ist zugleich deren konsequente Fortsetzung, da das Pferd als Symbol keine einseitige Darstellung zulässt.
Erst nach dem Wiehern beider Pferde, findet der Arzt die Wunde283 des Jungen, als ob sich ihm in ihr die Symbolkraft dieses Tieres „aufgetan” (ebd.) habe: Die Wunde zeigt sich als Symbol des Todes und des Lebens284, des männlichen und weiblichen Geschlechts, als Libidosymbol und als Symbol des Leidens. Sie steht, wenn man so weit gehen will, für den schmerzlichen Verlust des Pferdes, damit auch als Kastrationswunde für die endgültige Trennung von der Triebnatur, für das Aufbrechen menschlicher Defizite und für das Nicht-Lösen-Können des Menschen von der Symbolik dieses Tieres.285
IV.3.6 Ein Wagenrennen ohne Ziel
Die Pferde öffnen zwar die Fenster, haben sich aber zuvor von ihren Riemen befreit. Aus diesem Grunde nennt der Arzt sie „unbeherrschbare Pferde” (S. 256). Somit wird wieder fraglich, ob ihr Verhalten tatsächlich mit dem Willen des Arztes konform geht. Kurz bevor er gegen Ende der Erzählung zur Flucht aufbricht286, lässt sich ein ähnliches Phänomen erkennen. Der Landarzt bezeichnet die Pferde als treu und gehorsam: „Noch standen treu die Pferde an ihren Plätzen. […] Gehorsam zog sich ein Pferd vom Fenster zurück […].” (S. 260) Er versucht sich hier mit alten, überholten Vorstellungen zu beruhigen und gar zu täuschen, die natürlich nicht mehr greifen, denn das Pferd ist tot. Treue und Gehorsam, dem Pferd seit Jahrtausenden zugeschriebene Eigenschaften, werden als Projektionen menschlicher Wunschvorstellungen auf dieses Tier entlarvt, gerade auch in Anbetracht des völligen Ausgeliefertseins des Arztes gegenüber seinen Pferden. Das Prinzip des Selbstbetrugs, mit Hilfe dieser Projektionen menschliche Defizite auszugleichen, wird nicht mehr greifen.
Dies wird dem Arzt jedoch erst dann völlig bewusst, und er vermag es sich erst dann einzugestehen, als er selbst auf die Eigenschaft dieses Tieres keinen Einfluss mehr besitzt, die es für den Menschen überhaupt so attraktiv werden ließ: seine Schnelligkeit. Dementsprechend erkennt er: „Betrogen! Betrogen! Einmal dem Fehlläuten der Nachtglocke gefolgt - es ist niemals gutzumachen.” (S. 261) Die Pferde kontrastieren den Fluchtwillen des Arztes, und dies wirkt umso eindringlicher, als sie ja schon gezeigt haben, wie schnell sie Raum und Zeit überwinden können. Das Bild der absoluten Geschwindigkeit auf ein Ziel hin gerichtet wird umgedeutet in eine unendlich langsame Kreisbewegung, in ein Wagenrennen ohne Ziel. Der Arzt muss sich dem Tempo der Pferde anpassen. Es wird ihm bewusst, dass sich die Produktionen seines Geistes verselbständigt haben.
IV.4 Der Reiter wird grotesk
In der Beschreibung der Flucht entsteht ein groteskes Bild eines Reiters:
Ich schwang mich aufs Pferd. Die Riemen lose schleifend, ein Pferd kaum mit dem andern verbunden, der Wagen irrend hinterher, der Pelz287 als letzter im Schnee. „Munter!” sagte ich, aber munter ging’s nicht; langsam wie alte Männer zogen wir durch die Schneewüste; (S. 260 f.)
Die einzige aktive Tätigkeit des Reiters ist der Sprung auf den Pferderücken, doch es ist ein Sprung in die absolute Abhängigkeit. Nicht der Reiter reitet das Pferd, sondern das Pferd den Reiter. Das Ross-Reiter-Verhältnis wird umgekehrt. Der Arzt ist seinen eigenen imaginierten Pferden, die sich von den Riemen lösten und sich verselbständigten, hilflos ausgeliefert. Gleichzeitig zeigt das Bild die Abhängigkeit von der Symbolkraft dieses Tieres, mit dessen Ambivalenz Kafka geschickt spielt. Auch die Schlussszene drückt diese aus: Von den zwei Pferden wird eines geritten, das andere nicht; die Pferde sind kaum noch miteinander verbunden, was sowohl die Eigendynamik des Triebes als auch des Geistes auszudrücken vermag und deren Auseinanderentwicklung. Der Mensch wird zum Opfer der ambivalenten Symbolik, die er selbst dem Pferd zugeschrieben hatte. Die Auseinanderentwicklung verdeutlicht sich ebenfalls in der asyndetischen Satzstruktur des zweiten Satzes obigen Zitats und das Fehlen eines Verbes, das den Satz zusammenhält: „Die Riemen lose schleifend, ein Pferd kaum mit dem andern verbunden, der Wagen irrend hinterher, der Pelz als letzter im Schnee.” (S. 261)
Nackt, dem Froste dieses unglückseligsten Zeitalters288 ausgesetzt, mit irdischem Wagen, unirdischen Pferden, treibe ich mich alter Mann umher. (ebd.)
Der nackte Mensch auf dem Pferd, was eigentlich für eine ursprüngliche, kentaurische Einheit mit ausgewogenem Kräfteverhältnis stehen könnte, wirkt nahezu lächerlich. Denn die Einheit wird nicht zerstört aufgrund der Dominanz des Reiters, sondern der des Pferdes.289 Ebenso grotesk wirkt es, wenn der Mensch eine Art Unsterblichkeit erlangt, aber eben nicht als vernünftiger Wagenlenker im Sinne Platons, sondern weil er auf ewig zwischen den Polen seines Daseins, zwischen Irdischem und Unirdischem, Leben und Tod, Triebwelt und aufstrebendem Bewusstsein gefangen ist.290 Der menschliche Grundkonflikt ist in der Schlussszene als symbolisches Zustandsbild eingefroren.291
IV.5 Die Landarzt-Pferde als Nachfolger des Trojanischen Pferdes
Die Landarzt-Pferde stehen in der Tradition des Trojanischen Pferdes:
Die Abhängigkeit des Menschen von der Natur musste zugunsten des geistigen Prinzips überwunden werden, er ist gezwungen, die Natur zu überlisten. Dafür steht symbolisch das Trojanische Pferd:
Das Trojanische Pferd ist reines Medium, das, auf göttlichen Rat hin vom Menschen als künstliches Objekt geschaffen, benutzt wird, ein Vorhaben durchzusetzen.292
Der Mensch ist in seinem Bauch eingeschlossen und dem Geschehen ausgeliefert. Im Innern des Pferdes liegen alle Möglichkeiten verborgen; das Trojanische Pferd wird zum „Symbolpferd schlechthin”:
Als das Symbolpferd schlechthin erscheint das Trojanische Pferd anstelle des Menschen. Es symbolisiert als künstlich-kunstvolles Objekt die Verselbständigung des Geistes: Einmal gefunden, kann es sich dem menschlichen Zugriff zuweilen entziehen und entwickelt dann ein unberechenbares Eigenleben.293
Darüber hinaus symbolisiert das Trojanische Pferd auch das Wesen des Pferdes selbst, das zugleich männliche und weibliche Züge in sich trägt. Auch vereinigt es die Polarität von Geburt und Tod (Verderben). Als Kultpferd, chthonisches Angstpferd und als Kriegsroß birgt es zudem einen großen Teil der mythischen Pferdesymbolik.294
Indem der Mensch mit Hilfe des künstlichen Pferdes versucht, sich von der Natur zu lösen, kann es sowohl zum Sinnbild der sich verselbständigten Triebwelt als auch des Geistes werden; es steht somit für die Einseitigkeit einer Ebene und wird deswegen ebenfalls zum Symbol des Leidens an der verlorenen Einheit.
All diese Eigenschaften, dies zeigten obige Betrachtungen zu „Ein Landarzt”, vereinigen die Landarzt-Pferde.
IV.6 Geschichten wie Pferde
Im Innern des Landarztes entstehen nicht nur die Pferde, sondern mit ihnen auch „Ein Landarzt”. Ohne die konstruierten Pferde gäbe es die Geschichte nicht, bliebe sie ebenso unbeweglich wie der Landarzt selbst ohne Pferd bzw. würde sie zu einem der zahlreichen Fragmente Kafkas, die einen Aufbruch mit Pferden skizzieren.295 Es scheint, als habe sich Kafka durch das Entstehenlassen dieser Pferde selbst überlistet, um weiter schreiben zu können:
[D]as muß der trostloseste Mensch zugeben, es kann erfahrungsgemäß aus Nichts etwas kommen, aus dem verfallenen Schweinestall der Kutscher mit den Pferden kriechen.296
Je mehr Pferde du anspannst, desto rascher gehts- nämlich nicht das Ausreißen des Blocks aus dem Fundament, was unmöglich ist, aber das Zerreißen der Riemen und damit die leere fröhliche Fahrt.297
Damit erscheinen die Pferde als Symbol der dichterischen Inspiration298, quasi als verdoppelt verstärkter Pegasos, in dessen Abhängigkeit und Machtkreis sich der Dichter begibt, sich von ihm umhertreiben lässt wie der Landarzt. Dieses Musenross mit polarem Charakter verkörpert die Gedanken, die aus der Tiefe des Innern emporsteigen und im phantastischen Flug jeden irdischen Bezug verlieren, genau wie die Landarzt-Pferde, die aus dem Schweinestall kommen und am Ende „unirdisch” heißen. In einem Tagebucheintrag vom 27. Mai 1914 setzt Kafka diesen Vorgang ein weiteres Mal eindrucksvoll ins Bild:
Gestern erschien mir das weiße Pferd zum erstenmal vor dem Einschlafen, ich habe den Eindruck, als wäre es zuerst aus meinem der Wand zugedrehten Kopf getreten, wäre über mich hinweg und vom Bett hinuntergesprungen und hätte sich dann verloren.299
Mit dem Gedankenflug in engem Zusammenhang steht die Triebsublimierung, die ja im „Landarzt” eine wichtige Rolle spielte, als Voraussetzung der poetischen Produktivität. Gleichzeitig bleibt jedoch das Pferd als Libidosymbol die gesamte Erzählung hindurch lebendig und unterstreicht einen gewissen auto-erotischen Aspekt des Schreibens.300 Diese Verbindung zeigt sich besonders deutlich in Kafkas Fragment vom Pferd Eleonor301, in dem der Ich-Erzähler mit diesem ein Jahr lang „wie etwa ein Mensch mit einem Mädchen, das er verehrt, von dem er aber abgewiesen wird”302, zusammen in einem Stall lebt.
Das Pferd als ambivalentes Symbol verdeutlicht noch einen weiteren produktionsästhetischen Konflikt: den Konflikt zwischen gesellschaftlichem Druck nach Anpassung und angeborenem Freiheitsdrang. Gerade Kafka litt ja bekanntermaßen unter dem Spannungsverhältnis von beruflichen und privaten Pflichten versus künstlerischer Existenz303: Um sein Pferd Eleonor zu unterhalten, muss der Erzähler jeden Tag fünf bis sechs Stunden arbeiten. Diesen „Zeitausfall”304 macht er schließlich für das Scheitern der Bemühungen um dieses Pferd verantwortlich. Dass dieser Aspekt ebenfalls in „Ein Landarzt” eine Rolle spielt, ergibt sich aus der Berufsbezeichnung, die der Geschichte den Titel gibt, und durch das Schlussbild des Arztes in der „Schneewüste”, bei Kafka ein Symbol für die Isolation reinen Dichtertums.305 Er zeigt sich auch, wenn man beachtet, dass der Arzt eigentlich nur Wagen und Geschirr für ein Pferd haben dürfte, dass also von den zwei Pferden notwendigerweise eines angeschirrt, das andere aber frei an dessen Seite laufen müsste.
Indem die Landarzt-Pferde das Innere des Menschen spiegeln, werden sie zur Geschichte. Kafka selbst vergleicht in einem Tagebucheintrag vom 15. Januar 1915 seine erdachten Geschichten mit Pferden:
Nun stehen vor mir vier oder fünf Geschichten aufgerichtet, wie die Pferde vor dem Zirkusdirektor Schumann bei Beginn der Produktion.306
Am Ende der „Landarzt”-Erzählung ist das Ich in der Kreisbewegung307 seiner erschaffenen Pferde gefangen; die Erzählung „Ein Landarzt” schreibt sich dadurch ewig weiter, als erhebe sie selbst den Anspruch auf Unsterblichkeit.308 Die Welt scheint wirklich, wie Kafka es wollte, ins „Unveränderliche” gehoben. Wie dem Landarzt ergeht es dem Leser, der sich aus der ambivalenten Erzählstruktur nicht zu befreien vermag. Man könnte fast meinen, er säße neben dem Landarzt auf dem zweiten Pferd. Die Macht der Erzählung ist die Macht seines tragenden Symbols, der Symbolkraft des Pferdes.
V. Resümee
Im Folgenden werden noch einmal die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit zur Funktion und Darstellung des Pferdes in „Der Schimmelreiter”, „Reitergeschichte” und „Ein Landarzt” zusammengefasst. Soweit nicht schon in den einzelnen Kapiteln geschehen, bietet sich an dieser Stelle auch Raum für einige vergleichende Bemerkungen.
Eines haben alle drei Erzählungen - vom Pferd abgesehen - gemeinsam: Jede von ihnen gilt im Werk ihres Autors als die rätselhafteste, dunkelste und undurchdringlichste. Eine Wirkung, die maßgeblich vom Pferd ausgeht, das durch die Texte galoppiert und den Leser mitreißt. Die Geschichten sind ebenso ambivalent wie das sie tragende Symbol.
Dabei werden die Pferde mit Einschränkungen durchaus realistisch geschildert und binden dadurch in gewisser Weise die Erzählungen an die Realität. Storm, Hofmannsthal und Kafka erweisen sich als ausgezeichnete Pferdekenner. Dies muss nicht überraschen, begegnete man diesem Tier zu Lebzeiten der Autoren doch auf Schritt und Tritt. Das Pferd bewegt sich als Helfer des Menschen in einem für die Zeit, in der die jeweilige Erzählung spielt, üblichen Arbeitsumfeld: Es unterstreicht als Reittier den besonderen Rang eines Deichgrafen, trägt Männer in den Krieg und dient vor dem Wagen eines Landarztes. Das spezielle Wissen der Autoren zeigt sich in der exakten Benennung von Gangarten, Bewegungsabläufen und Verhaltensweisen des Pferdes sowie in der Beschreibung von Fellfärbungen, Zäumung und Reittechniken.
Auf der anderen Seite entstanden die Erzählungen um die Jahrhundertwende, also in einer Zeit, in der das Pferd seine Sonderrolle als Nutztier an Maschinen abzugeben beginnt. Dabei verliert es allerdings nichts von seiner ursprünglichen Symbolkraft, im Gegenteil: Das Pferd wird in jedem der drei Texte zu einem der wichtigsten, wenn nicht zum wichtigsten Symbolträger. Als könne man sich nicht von diesem archaischen Symbol lösen, funktionieren und wirken alte Bilder wie zum Beispiel das Pferd als Mutter- und Libidosymbol, kosmisches Symbol, Opfertier, Heldenross, chthonisches Angstpferd, Musenross oder als Vermittler zwischen Bewusstem und Unbewusstem, unterstützt durch zahlreiche Anspielungen auf die Pferdemythologie.
Einen besonderen Stellenwert erlangt das Pferd in seiner Eigenschaft als Seelenführer, mit seiner ambivalenten Symbolik zwischen Werden und Vergehen: Alle Erzählungen spielen an der Grenze zwischen Leben und Tod, was ihren unheimlichen Charakter nur unterstreicht. Im „Schimmelreiter” sterben Pferd und Reiter, in der „Reitergeschichte” fällt Lerch tot vom Pferd, im „Landarzt” war das Pferd verendet, die Pferde bringen den Arzt in eine ausweglose Situation.
Mit der Allgegenwärtigkeit des Todes wird nicht nur eine uralte Bedeutungszuschreibung aufgegriffen, sondern es ist, als spiegelten die unterschiedlichen Mensch-Pferd-Darstellungen vom „Schimmelreiter” über die „Reitergeschichte” bis zu „Ein Landarzt” chronologisch die Entwicklung eines schmerzlichen Ablösungsprozesses, der mit der zunehmenden Industrialisierung einhergeht. Im „Schimmelreiter” stürzen sich Mensch und Pferd noch gemeinsam ins Meer, wenn auch unter der Dominanz des Reiters, in der „Reitergeschichte” bricht die Ross-Reiter-Verbindung auseinander, „Ein Landarzt” beginnt bereits mit deren Zusammenbruch. Insofern trifft für diese Arbeit die anfängliche Behauptung zu, dass die drei Erzählungen schrittweise die Auseinanderentwicklung von Mensch und Pferd verarbeiten und das Pferd als Symbol für kulturellen Wandel gelten kann.
Durch die fortschreitende Auseinanderentwicklung wird das Pferd immer mehr zum Symbol der inneren Befindlichkeit des Menschen: Die Pferde des Landarztes sind reine Produkte seines Innern, die Gestalt des Eisenschimmels stand bereits an der Grenze zur Imagination. Auch die Handlung selbst ist von Erzählung zu Erzählung stärker auf das Innenleben der Personen konzentriert.
Das Pferd wirkt vor allem dort als Symbol der inneren Befindlichkeit des Menschen, wo es dessen Eigenschaften spiegelt, steigert oder kontrastiert. Dies zeigte sich in jedem der drei untersuchten Texte, wobei sowohl im jeweiligen Verlauf der Geschehnisse als auch in der chronologischen Reihung der Geschichten die Kontrastierung stetig zunahm. Auf diese Weise manifestiert sich der Verlust der einstmals unreflektiert kentaurischen Einheit von Pferd und Reiter, die erst dann in vollem Umfang bewusst werden kann, wenn sie als unwiederbringlich verloren gilt; die Labilität des Ross-Reiter-Verhältnisses wird durch die gewaltsame Einwirkung des Reiters nach außen hin sichtbar. Der Versuch, menschliche Defizite durch das Pferd ausgleichen zu wollen, erweist sich damit als Selbstbetrug. Mit der sich verstärkenden Kontrastierung geht eine wachsende Verselbständigung des Pferdes einher. Es entwickelt eine gewisse Macht über den Menschen: ein Zeichen für die notwendige Ablösung bei gleichzeitigem Nicht-Lösen-Können.
Der Reiter, der sein Pferd beherrscht, erlangt neues Selbstbewusstsein und eine neue Identität. Ist das Gleichgewicht zwischen Ross und Reiter gestört, wird diese Entwicklung unterbunden; mit zunehmender Kontrastierung werden Identitäten unsicher. Dies kündigt sich im „Schimmelreiter” mit der gespenstisch-unrealistischen Erscheinung des Deichgrafen auf seinem Schimmel während des Unwetters bereits an. Die „Reitergeschichte” macht den Identitätsverlust durch das Auftreten des Doppelgängers zum Thema; Wachmeister Lerch, der junge Offizier und Rittmeister Rofrano haben verwandte Züge. In der Forschung zu „Ein Landarzt” gilt die Identität der Figuren untereinander als unbestritten.
Die These, dass das Pferd in allen drei Texten Eigenschaften des Menschen steigert, spiegelt oder kontrastiert, es dabei zum wesentlichen Ausdrucksträger und von Erzählung zu Erzählung immer mehr zum Symbol der inneren Befindlichkeit des Menschen wird, hat sich somit bestätigt.
Tendenziell konnte jede der drei diskutierten Erzählungen in das von Baum entworfene pferdemythologische System integriert werden, wobei sich die Ebenen von Einheit, Trennung und Abspaltung von Mensch und Pferd immer wieder durchdringen.
„Der Schimmelreiter” liest sich als Folie des Pegasos-Mythos’. Der magisch-mythische Charakter des Schimmels bleibt im abergläubischen Denken lebendig. Mit Hauke im Sattel wird dieses Tier zum Symbol des aufstrebenden Bewusstseins. Damit verbindet der Schimmel - wie Pegasos in seiner Doppelnatur und Hell-Dunkel-Symbolik - Bewusstes und Unbewusstes, Himmel und Erde, Aufstieg und Fall.
Der Schimmel verdeutlicht als Muttersymbol unter Hauke den Kampf des männlichen Expansionsstrebens gegen Mutter Natur, verkörpert jedoch gleichzeitig Haukes eigene Triebwelt, die er immer wieder zügeln muss. Somit spiegeln Ross und Reiter einen bis heute ungelösten menschlichen Grundkonflikt: die Suche nach Harmonie zwischen Mensch und Natur, sei damit nun Umwelt oder menschliche Triebnatur gemeint.
In der „Reitergeschichte” stürzt Anton Lerch vom Pferd wie einst Bellerophon von Pegasos; er fällt auf die Erde zurück. Die Trennung von Pferd und Reiter steht für die Auseinanderentwicklung von Geist und Triebwelt; das Pferd ohne Reiter verdeutlicht die absolute Einseitigkeit jeweils einer der beiden Ebenen, die sich ungezügelt verselbständigen können. Noch ist der Mensch ohne das Pferd nicht überlebensfähig: Lerch fällt tot von seinem Reittier. Der Ablösungsprozess von der Natur ist nicht abgeschlossen, wenn in der „Reitergeschichte” der äußere Kampf auch überwunden scheint. Das Pferd allein bleibt als Symbol des Leidens am schmerzlichen Verlust der Einheit zurück.
In „Ein Landarzt” lassen sich die Pferde, die aus den inneren Tiefen des Arztes entstehen, als trojanische interpretieren. Als Produkte des menschlichen Geistes erlangen sie eine Eigendynamik, die zugleich Gefahren in sich birgt. Einerseits zeigt sich in diesem Bild, was der menschliche Verstand zu entwickeln vermag, andererseits wird weiterhin die Abhängigkeit des Menschen vom archetypischen Symbol „Pferd” deutlich, der sich auch der Leser nicht zu entziehen vermag.
Die These, dass sich die Mensch-Pferd-Darstellungen innerhalb der Erzählungen auf zwei mythische Erklärungsmuster zurückführen lassen, hat sich ebenfalls bestätigt.
Mit der Gestalt des Pegasos‘ ergibt sich in seiner Eigenschaft als Musenross eine weitere Deutungsebene für die Texte: Als Symbol der dichterischen Inspiration, der sich verselbständigten Gedanken, scheint es in den Erzählungen lebendig geworden, als trage es die Gedanken des Autors satzweise voran, einmal langsam schreitend, dann wieder flott trabend. Wenn man so will, wird auf diese Weise der Schaffensprozess sichtbar. Die Geschichten werden als Konstruktionen des menschlichen Geistes entlarvt, die ebenso wie die Landarzt-Pferde eine Eigendynamik entwickeln und auf Figuren und Leser Macht ausüben, sie gefangen nehmen.
Diese Sogwirkung wird umso stärker, je mehr die Geschehnisse ins Innere der Figuren verlegt, je mehr die Pferde Teil des Inneren werden. Wie im Flug des Pegasos’ verdeutlicht, verlieren die Erzählungen in ihrer chronologischen Folge immer mehr an Bodenkontakt, verselbständigen sich und entziehen sich - ähnlich dem Trojanischen Pferd - dem Einfluss des Lesers; die Interpretation wird schwieriger. Vergleicht man unter diesem Blickpunkt „Der Schimmelreiter” mit „Ein Landarzt”, wird diese Entwicklung besonders augenfällig.
Die Deutungsschwierigkeiten des Pferdes in jeder der drei Erzählungen lassen sich unter einem Stichwort zusammenfassen: Ambivalenz. Das Pferd als archaisches und damit ambivalent besetztes Symbol entzieht sich jeder eindeutigen Auslegung. Die Autoren setzten die vielschichtige Symbolik dieses Tieres geschickt ein, ja spielten mit ihr. So fanden sich Deutungsmöglichkeiten zwischen chthonischem Angstpferd und solarem Heldenross, Mutter- bzw. Libidosymbol und Symbol des männlichen Expansionsstrebens, Symbol von mutterrechtlichen Strömungen und Patriarchat, Sieg und Niederlage, Leben und Tod, Freiheit und Anpassung, Triebnatur und Vernunft. Zwischen diesen Polen übernimmt das Pferd eine vermittelnde, neutrale Rolle309 ; bezeichnenderweise wird in keiner der Erzählungen sein Geschlecht genannt.
In jeder Erzählung manifestiert sich die Ambivalenz ihres tragenden Symbols in eindrucksvollen Bildern: Im „Schimmelreiter” erscheint bei Unwetter das chthonische Angstpferd, um an die große Urkraft der Natur zu mahnen, gleichzeitig war es das Reittier des Aufklärers Hauke Haien; im Kopf des Lesers verschmelzen beide, das jeweils andere trabt stetig mit. In der „Reitergeschichte” prägen die zwei Pferde, zwischen die Wachtmeister Anton Lerch fällt, das Schlussbild: Brauner und Eisenschimmel, sich komplementär ergänzend. In „Ein Landarzt” sind es ebenfalls zwei Pferde, die die polare Struktur auf ewig einfrieren.
Noch etwas anderes, grundsätzliches erschwert die reflexive Auseinandersetzung mit dem Pferd: Es handelt sich um nichts Geringeres als die Faszination selbst, die dieses Tier noch heute auf den Menschen ausübt. Wenn der Mensch immer noch seine Nähe sucht, obwohl das Pferd als Nutztier nahezu ausgestorben und als Haustier zu groß ist, dann muss von diesem archetypischen Symbol nach wie vor eine große Kraft ausgehen. Es scheint, als wolle der Mensch krampfhaft an dieser uralten Bindung festhalten, indem er das Pferd hinter Gitter sperrt.
Solange der Mensch noch in irgendeiner Weise vom Pferd abhängig ist, lässt sich die schillernde Symbolik dieses Tieres niemals gänzlich aufdecken. Der mythische Charakter des Pferdes lässt sich erst dann vollständig benennen, wenn er sich im Zuge der Bewusstwerdung verloren hat; ansonsten bleibt man selbst in ihm gefangen. Auch die Verfasserin dieser Arbeit musste wahrnehmen, dass sich vor der Interpretation des Symbols „Pferd” immer wieder neue Hindernisse aufbauen, weil es zugleich auf realer Ebene interessiert und fasziniert.
VI. Literaturverzeichnis
Quellen:
Hofmannsthal, Hugo von: Sämtliche Werke. Kritische Ausgabe. Bd. XXVIII. Erzählungen 1. Hg. v. Ellen Ritter. Frankfurt am Main: Fischer 1975 [„Reitergeschichte”, S. 37-48].
Kafka, Franz: Schriften, Tagebücher, Briefe. Kritische Ausgabe. Hg. v. Jürgen Born, Gerhard Neumann, Malcom Pasley u. Jost Schillemeit. Bd. X. Drucke zu Lebzeiten. Hg. v. Wolf Kittler, Hans-Gerd Koch u. Gerhard Neumann. Frankfurt am Main: Fischer 1994 [„Ein Landarzt”, S. 252-261].
Storm, Theodor: Sämtliche Werke in zwei Bänden. Mit einem Nachwort von Johannes Klein. Bd. II. München: Winkler 1967 [„Der Schimmelreiter”, S. 696-809].
Literatur:
Alewyn, Richard: Über Hugo von Hofmannsthal. 4. abermals vermehrte Aufl. Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht 1967.
Arens, Detlev: Franz Kafka. München: dtv 2001 (= dtv portrait 31047).
Artiss, David: Theodor Storms symbolische Tierwelt - dargestellt an seinen Vorstellungen von Wolf, Hund und Pferd. In: Schriften der Theodor-Storm-Gesellschaft 45 (1996). S. 7-22.
Baum, Marlene: Das Pferd als Symbol. Zur kulturellen Bedeutung einer Symbiose. Frankfurt am Main: Fischer 1991.
Baumer, Franz: Franz Kafka. Sieben Prosastücke. Ausgewählt und interpretiert von Franz Baumer. München: Kösel 1965 (= Dichtung im Unterricht Bd. 9).
Becker, Udo: Lexikon der Symbole. Freiburg im Breisgau: Herder 1992.
Blumenstock, Konrad: Pferde bei Kafka. Erläuterungsversuche. In: Duitse Kroniek 16 (1964). S. 82-92.
Böschenstein, Renate: Tiere in Hofmannsthals Zeichensprache. In: Hofmannsthal-Jahrbuch. Zur europäischen Moderne 1 (1993). S. 137-164.
Bossard, Robert: Die Tiersymbolik im Traum. Schlaf und Traum als Bindeglied zwischen Mensch und Tier. In: Tiersymbolik. Hg. v. Paul Michel. Bern: Lang 1991 (= Schriften zur Symbolforschung Bd. 7). S. 13-35.
Coupe, W. A.: Der Doppelsinn des Lebens: Die Doppeldeutigkeit in der Novellistik Theodor Storms. In: Schriften der Theodor-Storm-Gesellschaft 26 (1977). S. 9-21.
Daemmrich, Horst S. und Ingrid Daemmrich: Themen und Motive in der Literatur. Ein Handbuch. Tübingen: Francke 1987 (= UTB für Wissenschaft: Grosse Reihe).
Deutsches Wörterbuch v. Jacob u. Wilhelm Grimm. Fotomechanischer Nachdruck der Erstausgabe 1862-1984. München: dtv 1984.
Emrich, Wilhelm: Franz Kafka. Das Baugesetz seiner Dichtung. Der mündige Mensch jenseits von Nihilismus und Tradition. 6. Aufl. Frankfurt am Main: Athenäum 1970.
Exner, Richard: Ordnung und Chaos in Hugo von Hofmannsthals Reitergeschichte. Strukturelle und semiotische Möglichkeiten der Interpretation. In: Im Dialog mit der Moderne. Zur deutschsprachigen Literatur von der Gründerzeit bis zur Gegenwart. Festschrift für Jacob Steiner. Hg. v. Roland Jost u. Hansgeorg Schmidt-Bergmann. Frankfurt am Main: Athenäum 1986. S. 46-59.
Fasold, Regina: Theodor Storm. Stuttgart: Metzler 1997 (= Sammlung Metzler Bd. 304).
Fingerhut, Karl-Heinz: Die Funktion der Tierfiguren im Werke Franz Kafkas. Offene Erzählgerüste und Figurenspiele. Bonn: Bouvier u. Co. 1969 (= Abhandlungen zur Kunst-, Musik- und Literaturwissenschaft Bd. 89).
Freund, Winfried: Theodor Storm. Stuttgart: Kohlhammer 1987 (= Sprache und Literatur; 126).
Frink, Helen: Animal symbolism in Hofmannsthal’s works. New York: Lang 1987 (= American university studies; series I, germanic languages and literatures; vol. 56).
Frühwald, Wolfgang: Hauke Haien, der Rechner. Mythos und Technikglaube in Theodor Storms Novelle „Der Schimmelreiter”. In: Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. Festschrift für Richard Brinkmann. Tübingen: Niemeyer 1981. S. 438-457.
Gilbert, Mary E.: The image of the horse in Hofmannsthal’s poetic works. In: Modern Austrian Literature vol. 7, no. 3/4 (1974). S. 58-76.
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Hg. v. Hanns Bächthold-Stäubli u. E. Hoffmann-Krayer. Berlin: de Gruyter & Co. 1939.
Hiebel, Hans H.: Franz Kafka: „Ein Landarzt”. München: Frink 1984 (= UTB 1289).
Hiebel, Hans H.: Franz Kafka: Form und Bedeutung. Formanalysen und Interpretationen von Vor dem Gesetz, Das Urteil, Bericht für eine Akademie, Ein Landarzt, Der Bau, Der Steuermann, Prometheus, Der Verschollene, Der Proceß und ausgewählten Aphorismen. Würzburg: Königshausen u. Neumann 1999.
Hoffmann, Volker: Theodor Storm: Der Schimmelreiter. In: Erzählungen und Novellen des 19. Jahrhunderts. Bd. 2. Erw. Ausgabe. Stuttgart: Reclam 1997 (= Universal-Bibliothek Nr. 8414). S. 333-370.
Hofmannsthal, Hugo von: Briefe 1890-1901. Berlin: Fischer 1935.
Hofmannsthal, Hugo von: Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Hg. v. Herbert Steiner. Frankfurt: Fischer 1945 ff.: Aufzeichnungen (1959); Dramen Bd. 1 (1953); Dramen Bd. 3 (1957); Prosa Bd. 1 (1956); Prosa Bd. 2 (1959).
Hoppe, Otfried: Reitergeschichte. In: Deutsche Novellen von Goethe bis Walser. Bd. 2. Hg. v. Jakob Lehmann. Königstein im Taunus: Scriptor 1980. S. 49-76.
Hugo von Hofmannsthal - Leopold von Andrian. Briefwechsel. Hg. v. Walter H. Perl. Frankfurt am Main: Fischer 1968.
Hugo von Hofmannsthal - Edgar Karl von Bebenburg. Briefwechsel. Hg. v. Mary E. Gilbert. Frankfurt am Main: Fischer 1966.
Hugo von Hofmannsthal - Richard Dehmel. Briefwechsel 1893-1919. Mit einem Nachwort hg. v. Martin Stern. In: Hofmannsthal-Blätter 21/22 (1979). S. 1-130.
Hugo von Hofmannsthal - Helene von Nostitz. Briefwechsel. Hg. v. Oswalt von Nostitz. Frankfurt am Main: Fischer 1965.
Jäger-Trees, Corinna: Aspekte der Dekadenz in Hofmannsthals Dramen und Erzählungen des Frühwerkes. Bern: Haupt 1988 (= Sprache und Dichtung; Neue Folge Bd. 38).
Kafka, Franz: Gesammelte Werke. 8 Bde. Hg. v. Max Brod. Frankfurt am Main: Fischer. Lizenzausgabe von Schocken Books, New York: Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande und andere Prosa aus dem Nachlaß (1966); Tagebücher. 1910-1923 (1954).
Kleinschmidt, Gert: „Ein Landarzt”. In: Weber, Albrecht; Carsten Schlingmann u. Gert Kleinschmidt: Interpretationen zu Franz Kafka. Das Urteil, Die Verwandlung, Ein Landarzt, Kleine Prosastücke. München: Oldenbourg 1968 (= Interpretationen zum Deutschunterricht). S. 106-121.
Kremer, Detlef: Ein Landarzt. In: Franz Kafka. Romane und Erzählungen. Hg. v. Michael Müller. Stuttgart: Reclam 1994 (= Universal-Bibliothek Nr. 8811). S. 197-214.
Kuchenbuch, Thomas: Perspektive und Symbol im Erzählwerk Theodor Storms. Zur Problematik und Technik der dichterischen Wirklichkeitsspiegelung im Poetischen Realismus. Dissertation. Marburg an der Lahn: Mauersberger 1969.
Kunz, Josef: Die deutsche Novelle im 19. Jahrhundert. 2. überarb. Aufl. Berlin: Schmidt 1978 (= Grundlagen der Germanistik; 10).
Kurz, Gerhard: Traum-Schrecken. Kafkas literarische Existenzanalyse. Stuttgart: Metzler 1980.
Laage, Karl Ernst: Der ursprüngliche Schluß der „Schimmelreiter”-Novelle. In: ders.: Theodor Storm. Studien zu seinem Leben und Werk mit einem Handschriftenkatalog. Berlin: Schmidt 1985. S. 29-36.
Lakin, Michael: Hofmannsthals Reitergeschichte and Kafkas Ein Landarzt. In: Modern Austrian Literature 3 (1970). S. 39-50.
Le Rider, Jacques: Hugo von Hofmannsthal. Historismus und Moderne in der Literatur der Jahrhundertwende. Wien: Böhlau 1997 (= Nachbarschaften, Humanwissenschaftliche Studien; 6).
Mauser, Wolfram: Hugo von Hofmannsthal. Konfliktbewältigung und Werkstruktur. Eine psycho-soziologische Interpretation. München: Frink 1977.
Mayer, Mathias: Hugo von Hofmannsthal: Reitergeschichte. In: Erzählungen des 20. Jahrhunderts. Bd. 1. Stuttgart: Reclam 1996 (= Universal-Bibliothek Nr. 9462). S. 7-20.
Meyer, Heinrich: Theodor Storm und Ferdinand Tönnies. In: Monatshefte für deutschen Unterricht 32 (1940). S. 355-380.
Möbus, Frank: Sünden-Fälle. Die Geschlechtlichkeit in Erzählungen Franz Kafkas. Göttingen: Wallstein 1994.
Peischl, Margaret T.: Das Dämonische im Werk Theodor Storms. Frankfurt am Main: Lang 1983 (= Europ. Hochschulschriften; Reihe 1, Deutsche Sprache u. Literatur Bd. 505).
Rajec, Elisabeth: Namen und ihre Bedeutungen im Werke Franz Kafkas. Ein interpretatorischer Versuch. Bern: Lang 1977 (= Europ. Hochschulschriften; Reihe 1, Deutsche Literatur u. Germanistik Bd. 186).
Ries, Wiebrecht: Kafka zur Einführung. Hamburg: Junius 1993 (= Zur Einführung; 86).
Rohwer, Jutta C.: Das Tier als Leitmotiv in den späten Novellen Storms. In: Acta Germanica 10 (1977). S. 245-263.
Rösch, Ewald: Getrübte Erkenntnis. Bemerkungen zu Franz Kafkas Ein Landarzt. In: Dialog. Literatur und Literaturwissenschaft im Zeichen deutsch-französischer Begegnung. Festgabe für Josef Kunz. Hg. v. Rainer Schönhaar. Berlin: Erich Schmidt 1973. S. 205-243.
Schärf, Christian: Franz Kafka. Poetischer Text und heilige Schrift. Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht 2000.
Schiele, Erika: Araber in Europa. Geschichte und Zucht des edlen arabischen Pferdes. München: Bayerischer Landwirtschaftsverlag 1967.
Schmidt, Hugo: Zum Symbolgehalt der Reitergeschichte Hofmannsthals. In: Views and Reviews of Modern German Literature. Festschrift for Adolf D. Klarmann. Ed. by Karl S. Weimar. München: Delp 1974. S. 70-83.
Sokel, Walter H.: Franz Kafka. Tragik und Ironie. Zur Struktur seiner Kunst. München: Langen, Müller 1964.
Steinlein, Rüdiger: Hugo von Hofmannsthals Reitergeschichte. Versuch einer struktural-psychoanalytischen Lektüre. In: Zeitschrift für deutsche Philologie 110 (1991). S. 208-230.
Stern, Martin: Die verschwiegene Hälfte von Hofmannsthals „Reitergeschichte”. In: Pestalozzi, Karl und Martin Stern: Basler Hofmannsthal Beiträge. Würzburg: Königshausen u. Neumann 1991. S. 109-112.
Tarot, Rolf: Hugo von Hofmannsthal. Daseinsformen und dichterische Struktur. Tübingen: Niemeyer 1970.
Theodor Storm - Paul Heyse. Briefwechsel. Kritische Ausgabe. Bd. 3: 1882-1888. In Verbindung mit der Theodor-Storm-Gesellschaft hg. v. Clifford Albrecht Bernd. Berlin: Schmidt 1974.
Träbing, Gerhard: Hugo von Hofmannstals „Reitergeschichte”. Beitrag zu einer Phänomenologie der deutschen Augenblicksgeschichte. In: Deutsche Vierteljahresschrift. Für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 43 (1969). S. 707-725.
Wagener, Hans: Theodor Storm. Der Schimmelreiter. Durchgesehene und bibliogr. ergänzte Ausgabe. Stuttgart: Reclam 1993 (= Universal-Bibliothek Nr. 8133).
Werner, Hans-Georg: Probleme der semantischen Analyse von Theodor Storms „Schimmelreiter”. In: ders.: Text und Dichtung - Analyse und Interpretation. Zur Methodologie literaturwissenschaftlicher Untersuchungen. Berlin: Aufbau 1984. S. 293-320.
Wiese, Benno von: Hugo von Hofmannsthal. Reitergeschichte. In: ders.: Die deutsche Novelle. Von Goethe bis Kafka. Interpretationen I. Düsseldorf: Bagel 1967. S. 284-303.
Wunberg, Gotthart: Der frühe Hofmannsthal. Schizophrenie als dichterische Struktur. Stuttgart: Kohlhammer 1965 (= Sprache und Literatur; 25).
Zimmermann, Werner: Hugo von Hofmannsthal. Reitergeschichte (1898). In: ders.: Deutsche Prosadichtungen unseres Jahrhunderts. Interpretationen für Lehrende und Lernende. Bd. 1. 7. verbesserte Aufl. Düsseldorf: Schwann 1985. S. 86-99.
[...]
1 Vgl. zu diesem Absatz Wagener (1993), S. 37 ff.
2 Vgl. zu diesem Absatz Hugo von Hofmannsthal: Sämtliche Werke Bd. XXVIII, S. 217 f.
3 Vgl. zu diesem Absatz Hiebel (1984), S. 149 f.
4 Vgl. Frink (1987), S. 84; Le Rider (1997), S. 82.
5 Vgl. Tarot (1970), S. 343, S. 353; Träbing (1969), S. 724. Der Aufsatz von Lakin (1970) hat den Vergleich von „Reitergeschichte” und „Ein Landarzt” zum erklärten Ziel.
6 Von der Bezeichnung der Mensch-Pferd-Beziehung als Symbiose durch Marlene Baum grenzt sich die Verfasserin dieser Arbeit ab, da der Begriff „Symbiose” als Zusammenleben verschiedener Lebewesen zu gegenseitigem Nutzen definiert ist. Das Pferd nützt zwar dem Menschen, ob allerdings das Pferd aus dieser Beziehung irgendeinen Nutzen davonträgt, bleibt höchst fraglich.
7 Baum (1991), S. 127.
8 Ebd., S. 128.
9 Ebd., S. 69.
10 Ebd., S. 23.
11 Ebd., S. 85.
12 Ebd., S. 126.
13 Theodor Storm - Paul Heyse. Briefwechsel. Bd. 3, S. 140.
14 Vgl. Baum (1991), S. 14 ff.; Bossard (1991), S. 14; Kuchenbuch (1969), S. 213. Das archetypische Symbol ist besonders gekennzeichnet durch eine polyvalente Symbolik und ambivalente Struktur (vgl. Baum (1991), S. 16; Bossard (1991), S. 31 f.).
15 Vgl. Artiss (1996), S. 18; Peischl (1983), S. 35, S. 143 f.
16 Vgl. Theodor Storm: Sämtliche Werke Bd. II, S. 696, S. 700; im folgenden Seitenzahlen von Storms „Schimmelreiter” in diesem Kapitel in Text und Fußnoten ohne weitere Angaben.
17 Vgl. zur Ambivalenz: Coupe (1977); Hoffmann (1997), S. 338 ff.; Kuchenbuch (1969); Werner (1984).
18 Vgl. Fasold (1997), S. 153; Kuchenbuch (1969), S. 197; Peischl (1983), S. 35; Werner (1984), S. 314.
19 Storm selbst zog diese Bezeichnung dem Begriff „Novelle” vor (vgl. Meyer (1940), S. 377).
20 Vgl. Artiss (1996), S. 18.
21 Vgl. Artiss (1996), S. 7, S. 14; Schumann (1962), S. 36.
22 Der Schimmel wird zwar im Großteil der Literatur angesprochen, fand jedoch noch keine eigene umfassende Deutung. Der Aufsatz von Artiss (1996) hat zwar das erklärte Ziel, neben Wolf und Hund auch Storms Pferdesymbolik herauszuarbeiten, jedoch reduzieren sich seine Betrachtungen auf wenige Auffälligkeiten in der Darstellung dieses Tieres; Rohwer (1977), die das Tier als Leitmotiv in Storms späten Novellen untersucht, geht nicht auf das Pferd ein; in Schumanns (1962) Betrachtungen über die Umwelt in Storms Charakterisierungskunst finden sich über das Pferd und insbesondere den Schimmel nur wenige Sätze. In einer der jüngeren Arbeiten über den „Schimmelreiter” fordert Fasold (1997) eine Untersuchung des intertextuellen Bezugs zu christlichen und germanisch-heidnischen Mythologemen, um neue Erkenntnisse über die Vita des Helden zu erlangen (vgl. S. 158). Dies wird in diesem Kapitel mit Hilfe der Mythologie des Pferdes versucht.
23 Werner (1984) verweist auf die „semantische Ambiguität” (S. 295) des Titels, der dadurch Beurteilungsunsicherheit, Spannung und gespenstische Vorstellungen hervorrufe (vgl. S. 295 f.).
24 Vgl. Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens (1939) Bd. VI (im Folgenden zitiert als „Aberglaube”), „Pferd” Sp. 1617; ebd. Bd. IX, „Schimmel” Sp. 168. Ebenfalls beliebt ist das Motiv des Umgehens der Toten als weiße Pferde; diese Verstorbenen waren meist Menschen, die gesündigt hatten (vgl. ebd. Bd. VI, „Pferd” Sp. 1615).
25 Ebd. Bd. VI, „Pferdeopfer” Sp. 1674.
26 Vgl. zur Wotanmythe: Aberglaube Bd. VI, „Pferd” Sp. 1609 ff.; ebd. Bd. IX, „Schimmel” Sp. 167 f.; Baum (1991), S. 63 f.
27 Vgl. Aberglaube Bd. IX, „Schimmel” Sp. 168.
28 Bossard (1991), S. 32.
29 Baum (1991), S. 66.
30 Ebd., S. 46.
31 Vgl. Fasold (1997), S. 153; Hoffmann (1997), S. 337.
32 Max Jähns: Ross und Reiter in Leben und Sprache, Glauben und Geschichte der Deutschen. 2 Bde. Leipzig 1872, Bd. I, S. 325; zit. n.: Baum (1991), S. 64.
33 Coupe (1977), S. 14.
34 „Das reichlich verbalisierte Unheimliche, Spukhafte und Übersinnliche findet sich ausschließlich in figurensprachlichen Äußerungen, wobei die Figuren entweder auf Grund ihres sozialen Habitus, ihrer Bildung, ihrer ideologischen Einstellung, ihres Verhältnisses zu Hauke Haien als nicht oder nur beschränkt glaubwürdig gekennzeichnet sind [...] oder wegen ihres momentanen bzw. dauernden geistigen Zustandes als nicht voll zurechnungsfähig angesehen werden müssen [...].” (Werner (1984), S. 306 f.)
35 Vgl. Aberglaube Bd. IX, „Schimmel” Sp. 168.
36 Vgl. hierzu auch Artiss (1996), S. 19.
37 Vgl. Aberglaube Bd. VI, „Pferd” Sp. 1634.
38 Vgl. Schiele (1967), S. 11.
39 Vgl. im folgenden Baum (1991), S. 19 f., S. 38 ff., S. 66.
40 Vgl. ebd., S. 48.
41 In Poitou z.B. wird das Meer auch „la grande jument blanche” genannt (vgl. Aberglaube Bd. VI, „Meer” Sp. 66).
42 Ebd. Bd. VI, „Pferd” Sp. 1602.
43 Der Weg ins Totenreich führte in vielen Sagen übers Meer (vgl. ebd., „Meer” Sp. 69).
44 Peischl (1983) erwähnt, dass Storm, als er diese Novelle schrieb, selbst todkrank war (vgl. S. 144).
45 Vgl. im folgenden Aberglaube Bd. VI, „Pferdeopfer” Sp. 1671 ff.; ebd. Bd. IX, „Schimmel” Sp. 169 f.; Baum (1991), S. 54 ff.
46 Diese Fellfärbung bestätigt die Aussage Haukes, es handele sich bei dem Schimmel um ein junges Pferd. Schimmel (außer Albinos) kommen gewöhnlich mit dunkler Farbe auf die Welt und werden mit der Zeit immer heller. Ein Apfelschimmel befindet sich in diesem Übergangsstadium; das weiße Fell schimmert schon durch, hat aber noch dunkle Stellen, die im Licht bläulich schimmern können.
47 Vgl. dazu auch die Aussagen von Kuchenbuch ((1969), S. 209) und Werner ((1984), S. 308), die sich allerdings nicht speziell auf den Schimmel, sondern den gesamten Text beziehen.
48 Hoffmann (1997) betont die „Konzentrierung auf den oberen Kopfbereich” (S. 356) in den Beschreibungen Haukes.
49 Vgl. Freund (1987), S. 146.
50 Fasold (vgl. (1997), S. 155) und Kunz (vgl. (1978), S. 143) sehen im „Schimmelreiter” das Meer ausschließlich als Element des Todes.
51 Hauke verkörpere die Zivilisationsproblematik des Menschen, Natur- und Kulturwesen zu sein. Seine Willenskraft trage kompensatorischen Charakter, er müsse seinen Aggressionstrieb in der Kulturleistung sublimieren, folgert Fasold (1997) (vgl. S. 154 ff.).
52 Vgl. Freund (1987), S. 147.
53 Becker ((1992), S. 242) zum Symbol „Reiter”.
54 Vgl. zum zentralen Konflikt in der Symbolik von Meer und Deich: Freund (1987), S. 159 ff.
55 Aberglaube Bd. IX, „Wallach” Sp. 67.
56 Artiss (1996) urteilt also vorschnell, wenn er meint, das Pferd ermögliche eine Flucht vor den Frauen (vgl. S. 13, S. 19).
57 Auch Peischl (1983) betont dieses intime Verhältnis (vgl. S. 91); der Schimmel verkörpere die instinktive, weibliche Seite Haukes Wesen, um als seelisch integrierter Mensch sein Lebenswerk zu vollenden (vgl. S. 143); doch um Integration geht es hier ja gerade nicht.
58 Baum (1991), S. 68.
59 Ebd., S. 65.
60 Vgl. Bossard (1991), S. 33.
61 Hervorhebung der Verfasserin.
62 Der Schimmel als Natursymbol findet sich auch bei Artiss (vgl. (1996), S. 19), Frühwald (vgl. (1981), S. 452) und Peischl (vgl. (1983), S. 143).
63 Baum (1991), S. 121.
64 Vgl. allgemein zum Heldenross ebd., S. 57 ff.
65 Hoffmann (1997) erwähnt, dass zu Storms Lebzeiten durchaus noch die Vorstellung galt, einen vorzeitigen Aufstieg ins übermenschliche Geisterreich mit dem Absturz ins Elementare bezahlen zu müssen (vgl. S. 356). Er sieht in Haukes Wesen ebenfalls eine „gefährliche Nähe zu Gott” (S. 363), wenn er sie auch auf eine andere Weise herleitet.
66 Auch hier wieder die Betonung des Verstandes.
67 Diese christologischen Anspielungen in Bezug auf Hauke lassen auch an die vier apokalyptischen Reiter denken: Der Reiter auf dem weißen Pferd soll Christus als Sieger symbolisieren.
68 Vgl., wenn dort auch nicht besonders ausführlich dargestellt, Artiss (1996), S. 18 f.
69 Dieser Konflikt wird in einem Großteil der Literatur als grundlegend für diese Novelle dargestellt. Vgl. insbesondere: Fasold (1997), S. 153 f.; Frühwald (1981), S. 447, S. 452; Kunz (1978), S. 137; Laage (1985), S. 33.
70 Coupe (1977) zeigt Hauke im Spannungsfeld zwischen Hybris und dem Zwang zur „Erfüllung der großen historischen Aufgabe seines Stammes, [...] die Natur mit Deichen zu bekämpfen und besiegen" (S. 19); ähnlich steht das Pferd als Nutztier im Konflikt zwischen Freiheitsdrang und Zwang zum Gehorsam (vgl. Baum (1991), S. 100).
71 Vgl. hierzu auch Freund (1987), S. 145; zur Figur der Trin’ Jans: ebd., S. 155 ff.
72 Diese beiden Tiere verweisen auf das tragische Ende der kleinen Wienke: Der Hund war zum Deichopfer bestimmt und sehr wahrscheinlich ist es die Möwe Claus, die in jener unheilvollen Sturmnacht vom Schimmel zertreten wird.
73 Vgl. Peischl (1983), S. 93.
74 Freund (1987) sieht darin ein Bild für den Bruch zwischen Vergangenheit und Gegenwart (vgl. S. 151); vgl. auch Coupe (1977), S. 10.
75 Der Schimmel kontrastiert den Willen, spiegelt aber das Unbewusste Haukes: Wenn es schwierig wird, spiegelnde, steigernde oder kontrastierende Wirkung des Pferdes zu unterscheiden, erhöhe sich die Symbolkraft der Darstellung, betont Baum (vgl. (1991), S. 103).
76 Meyer (1940), S. 48.
77 Hervorhebung der Verfasserin.
78 Vgl. Fasold (1997), S. 153.
79 Gleichzeitig scheint es, als verweise der Untergang von Deichgraf und Schimmel auf die bekannte These Max Webers um die Jahrhundertwende, der preußische Adel, der das Pferd als Statussymbol so sehr schätzte und für den symbolisch der preußische Rittmeister stand, sei eine ökonomisch im Untergehen begriffene Klasse.
80 Vgl. Aberglaube Bd. VI, „Pferd” Sp. 1630; Baum (1991), S. 54.
81 Vgl. Becker (1992), S. 74.
82 Vgl. Werner (1984), S. 314 f.
83 Vgl. Freund (1987), S. 158.
84 Im Gegensatz zu dieser Deutung sehen Frühwald (vgl. (1981), S. 455), Peischl (vgl. (1983), S. 143) und Schumann (vgl. (1962), S. 28) Hauke als Sieger. Doch die einfache Aufteilung in Sieger und Besiegte scheint dem symbolischen Gehalt der Novelle nicht angemessen. Frühwald begründet seinen Standpunkt damit, dass Hauke zeige, dass der Mensch fähig sei, das „Tier des Todes” (ebd.) zu reiten. Nach obigen Ausführungen erscheint diese Auslegung des Pferdes als zu einseitig.
85 Vgl. Aberglaube Bd. VI, „Pferd” Sp. 1602; für den Schimmel auf Jevershallig bleibt jedoch, wie erwähnt, der Bezug zum Element „Wasser” erhalten, da dieser farblich nicht näher beschrieben wird.
86 Artiss (1996) findet: „Der Schimmel hat etwas von Pegasus an sich [...]” (S. 18), allerdings ohne jede Erläuterung und weiterführende Analyse.
87 Baum (1991), S. 74.
88 Ebd., S. 128.
89 Ebd.
90 Dieser Konflikt wird auch aufgenommen im Bild des Bruchs zwischen „unvernünftigem” (S. 764) alten Deich und neuem Deich mit besserem Profil.
91 In der Forschungsliteratur finden sich beide Interpretationsansätze.
92 Hugo von Hofmannsthal: Gesammelte Werke (GW) Prosa Bd. 2, S. 87 [„Das Gespräch über Gedichte” (1903)].
93 Vgl. Böschenstein (1993), S. 137; Frink (1987), S. 16.
94 Vgl. Böschenstein (1993), S. 143. „Rider and horse, i.e., human and animal, mind and body - the integration of these two is one of the main themes of Hofmannsthal’s poetry.” (Gilbert (1974), S. 71; vgl. auch ebd., S. 58).
95 Das Pferd spiele hier eine einzigartige Rolle, sei der Katalysator der Erzählung, so Lakin (vgl. (1970), S. 40 f).
96 Vgl. u.a. Mayer (1996), S. 7, S. 16; Zimmermann (1985), S. 97. Stern (1991) betont in seinem kurzen Aufsatz, die Rätselhaftigkeit sei wegen der einseitigen Perspektive nicht aufzulösen (vgl. S. 110).
97 Hugo von Hofmannsthal - Edgar Karl von Bebenburg. Briefwechsel, S. 81.
98 Das Pferd wird im Großteil der Literatur zur „Reitergeschichte” zwar angesprochen, erfährt jedoch keine eigene umfassende Deutung. Näher mit diesem Tier beschäftigen sich die Arbeiten von Böschenstein (1993), Frink (1987) und Gilbert (1974). Der Aufsatz Böschensteins über „Tiere als Elemente Hofmannsthals Zeichensprache” hat eher allgemein-philosophischen Charakter; die „Reitergeschichte” wird nicht erwähnt. Frink untersucht die Tiersymbolik bei Hofmannsthal u.a. mit einem eigenen Kapitel über die „Reitergeschichte”. Darin finden sich einige interessante Hinweise zum Thema „Pferd”, gerade was Hofmannsthals eigene Erfahrungen mit diesem Tier betrifft, jedoch wirken sie weniger als eigenständige Interpretation des Pferdes, denn als Aufzählungen von Eigenschaften und Verhaltensweisen innerhalb der Erzählung. Gilbert untersucht in ihrem Aufsatz „The image of the horse in Hofmannsthal’s poetic works” die unterschiedlichen Darstellungen von Pferd und Reiter und erkennt dabei drei Phasen.
99 Vgl. Lakin (1970), S. 44; Wiese (1967), S. 288; Zimmermann (1985), S. 94.
100 Der Erzähler sei zugleich Interpret, betonen Mauser (vgl. (1977), S. 110) und Träbing (vgl. (1969), S. 709).
101 Baum (1991), S. 15.
102 Tarot (1970) ordnet bezeichnenderweise seine Interpretation der „Reitergeschichte” dem Kapitel „Die Krise des mythischen Bewusstseins und die erzählende Dichtung” (S. 174 ff.) zu.
103 Hugo von Hofmannsthal: Sämtliche Werke (SW) Bd. XXVIII, S. 39; im folgenden Seitenzahlen von Hofmannsthals „Reitergeschichte” in diesem Kapitel in Text und Fußnoten ohne weitere Angaben.
104 Vgl. Mayer (1996), S. 10 f.
105 Aberglaube Bd. V, „Maria Magdalena” Sp. 1686.
106 Exner (1986) betont die Konfliktstruktur der „Reitergeschichte” im Gegensatzpaar Ordnung, Leben, Über-Ich, äußere Handlung versus Chaos, Tod, Es, innere Ereignisse (vgl. S. 48). Das Pferd ordnet er allerdings einseitig als „Symbol der Männlichkeit” erstgenanntem Teil zu, erkennt also nicht dessen ambivalente Symbolik und dass der Konflikt in ihm konzentriert dargestellt ist. Le Rider (1997) spricht von einem Dualismus der Erzählstruktur (vgl. S. 71).
107 Vgl. Kap. II.5.1 dieser Arbeit.
108 Vgl. SW Bd. XXVIII, S. 218.
109 Hugo von Hofmannsthal - Edgar Karl von Bebenburg. Briefwechsel, S. 22.
110 Hugo von Hofmannsthal - Richard Dehmel. Briefwechsel, S. 15.
111 Hugo von Hofmannsthal - Helene von Nostitz. Briefwechsel, S. 162.
112 Hugo von Hofmannsthal. Briefe 1890-1901, S. 160.
113 „He counters his experience of physical inferiority and of the inability to master his horse by increased poetic creativity.” (Frink (1987), S. 22; vgl. auch ebd., S. 71).
114 Baum (1991), S. 118.
115 GW Dramen Bd. 3, S. 454 [Notiz zu „Semiramis”].
116 Vgl. Kap. II.2.3 dieser Arbeit.
117 Vgl. Frink (1987), S. 32.
118 Steinlein (1991) sieht das Eindringenwollen bzw. Eindringen als die Grundfigur der Erzählung (vgl. S. 215).
119 Vgl. ebd., S. 212.
120 „Das Pferd […] ist dabei Zeichen sowohl militärischer wie sexueller und - als Beutepferd - ökonomischer Eroberung und Gewaltsamkeit.” (Mayer (1996), S. 12)
121 Vgl. Lakin (1970), S. 45.
122 Vgl. Frink (1987), S. 67.
123 Baum (1991), S. 81.
124 Vgl. hierzu auch Frink (1987), S. 67.
125 Vgl. Becker (1992), S. 170.
126 GW Dramen Bd. 1, S. 240.
127 Baum (1991), S. 77.
128 Ebd., S. 82; mit diesen Worten beschreibt sie die ambivalente Symbolik des Pegasos’.
129 Vgl. Becker (1992), S. 48.
130 Viel mehr lässt sich zu den weißen Stiefeln nicht sagen, da Abzeichen bei Pferden durch Zeit und Raum mit den unterschiedlichsten Vorstellungen verknüpft waren (vgl. Aberglaube Bd. VI, „Pferd” Sp. 1603 f.).
131 Dies berechtigt jedoch nicht, mit einigen Interpreten (vgl. u.a. Exner (1986), S. 50; Frink (1987), S. 68; Le Rider (1997), S. 82) von einer Einheit von Pferd und Reiter zu sprechen.
132 Vgl. Exner (1986), S. 47, der allerdings die Rolle des Pferdes nicht ausführlich verfolgt; Frink (1987), S. 74. Den Braun als ein Teil Lerchs, als sein Unterbewusstes sehen auch: Alewyn (vgl. (1967), S. 83 f.); Träbing (vgl. (1969), S. 715).
133 Die Verbindung von Mann und Spiegel deutet bereits auf die Begegnung mit dem Doppelgänger hin.
134 Vgl. Le Rider (1997), S. 73 f.
135 Die Überwältigung Lerchs durch seine Triebe betonen u.a. Mauser (vgl. (1977), S. 105); Träbing (vgl. (1969), S. 712).
136 GW Aufzeichnungen, S. 126 f.
137 Baum (1991), S. 109.
138 Vgl. Jäger-Trees (1988), S. 56 f., 86 f.
139 Vgl. u.a. Alewyn (1967), S. 82; Mayer (1996), S. 14; Schmidt (1974), S. 79.
140 Hugo von Hofmannsthal. Briefe 1890-1901, S. 202 f.
141 Vgl. Frink (1987), S. 71 f.
142 Dieser Eindruck verstärkt sich noch in der so unterschiedlichen Reaktion des Pferdes auf die Frauenperson und auf die Begegnung mit den Ratten (s.u.).
143 Wiese (1967) nennt es „Totendorf” (S. 298), Träbing (1969) „Todeslandschaft” (S. 716).
144 Auffällig ist, dass gerade der Vogel als Tier, das sich vom Boden erheben kann, fehlt.
145 Vgl. Becker (1992), S. 237.
146 Vgl. Frink (1987), S. 74; sie sieht den Braun allerdings als Lerchs „military ego” (ebd.), von dem er sich entferne.
147 Gerade die Farbe „weiß” deckt ja bekanntermaßen ein breites Spektrum von positiven bis negativen Konnotationen ab, welches Hofmannsthal geschickt einsetzt. Diese Umdeutungen, genauso wie die zahlreichen Oxymora (z.B. wenn Lerch das Dorf „auf verlockende Weise verdächtig” (S. 43) scheint) sind Teil der ambivalenten Textstruktur; vgl. Wunberg (1965), S. 60; Zimmermann (1985), S. 89.
148 Vgl. Becker (1992), S. 333.
149 Vgl. ebd., S. 134.
150 Hugo von Hofmannsthal - Leopold von Andrian. Briefwechsel, S. 54.
151 Vgl. Becker (1992), S. 159.
152 Vgl. Baum (1991), S. 250 f.
153 Vgl. zum Kentaur bei Hofmannsthal Jäger-Trees (1988), S. 121 ff., S. 163 ff.: Die Frau in der kurzen halbdramatischen Dichtung „Idylle” möchte auf einem Kentauren in eine Traumwelt entfliehen und wird mit seinem eigenen Speer getötet. Die idyllische Einheit ist nicht mehr möglich.
154 Dass es sich tatsächlich um einen Doppelgänger und nicht um ein Spiegelbild Lerchs handeln muss, zeigen Tarot (vgl. (1970), S. 347 f.); Wunberg (vgl. (1965), S. 62 f.).
155 Vgl. Jäger-Trees (1988), S. 87; Schmidt (1974), S. 80.
156 GW Prosa Bd. 1, S. 353 [Studie über die Entwicklung des Dichters Victor Hugo (1901)].
157 Im Aberglauben gelten Pferde als geister- und spuksichtig; wenn sie scheuen, bemerken sie einen Spuk (vgl. Aberglaube Bd. VI, „Pferd” Sp. 1619 f.).
158 Wunberg (1965) sieht sie als Symbol „für die unvereinbar-vereinten Gegensätze” (S. 63).
159 Vgl. Aberglaube Bd. II, „Doppelgänger” Sp. 346 ff; Daemmrich (1987), S. 97 ff.
160 Identitätskonflikt, Selbstentfremdung usw. werden in einem Großteil der Literatur als das Grundthema dieser Erzählung angesehen, wenn auch in unterschiedlichen Kontexten und ohne das Pferd miteinzubeziehen (vgl. u.a. Le Rider (1997), S. 78 f., S. 81; Mayer (1996), S. 14), und manchmal erweitert zum Konflikt Mensch/Umwelt (vgl. u.a. Träbing (1969), S. 724), Fantasie/Realität (vgl. u.a. Frink (1987), S. 89).
161 Allein deswegen kann die Behauptung Tarots (1970) nicht stimmen, dass Lerch über die Brücke in einen Zustand „mythischen Bewusstseins” (S. 348) gelange; im Gegenteil: Er wird sich von diesem Zustand immer weiter entfernen.
162 Vgl. Hoppe (1980), S. 54. So sehen denn auch einige Interpreten den Ritt durchs Dorf als Lerchs Ritt durch sein Inneres (vgl. u.a. Mayer (1996), S. 14; Wunberg (1965), S. 67). Lakin (1970) betont, die gesamte Erzählung sei nur dazu da, Lerchs Innenleben zu erhellen (vgl. S. 46).
163 Vgl. Schmidt (1974), S. 80.
164 Vgl. Exner (1986), S. 53; Le Rider (1997), S. 87.
165 Der Wunsch, „in dem Dorfe geradezu einen feindlichen General mit geringer Bedeckung zu überraschen und anzugreifen oder anderswie ein ganz außerordentliches Prämium zu verdienen” (S. 43).
166 Vgl. Frink (1987), S. 69; Jäger-Trees (1988), S. 56, S. 111; Lakin (1970), S. 46.
167 GW Aufzeichnungen, S. 195.
168 Vgl. Le Rider (1997), S. 83. Mauser (1977) sieht alle Figuren, denen Lerch begegnet, als eine Art Spiegelung seiner selbst (vgl. S. 104).
169 Vgl. Frink (1987), S. 84; sie wertet dies aber als Zeichen einer wiedergefundenen Einheit von Pferd und Reiter, da die Bewegungen des Pferdes der Intention des Reiters folgten.
170 Vgl. Becker (1992), S. 199.
171 Baum (1991), S. 181.
172 Vgl. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm Bd. 3, Sp. 373.
173 Die Ambivalenz, die vor allem Pegasos zum Ausdruck bringt.
174 Lakin (1970) hebt einseitig die Beschreibung des Eisenschimmels als Frau hervor (vgl. S. 42).
175 Aberglaube Bd. IX, „Schimmel” Sp. 172.
176 Anachronistisch wird damit auch das Pferd als Statussymbol des Adels, was sich im „Schimmelreiter” schon ankündigte (vgl. Kap. II.6 dieser Arbeit).
177 Diese Eigenschaft erinnern Frink (vgl. (1987), S. 84) und Le Rider (vgl. (1997), S. 82) an den „Schimmelreiter”; vgl. zu Le Riders (ebd.) Deutung des Eisenschimmels S. 80 ff.
178 Dass es noch ein junger Schimmel sein muss, lässt sich ebenfalls an seiner noch dunklen Fellfärbung erkennen.
179 Frink (1987) deutet diesen an (vgl. S. 84). Der Kontrast zwischen beiden Tieren könnte auch die unterschiedliche Klassenzugehörigkeit ihrer Reiter unterstreichen.
180 Schließlich muss der Erzähler nochmals betonen, dass der Schimmel wirklich ein Pferd ist.
181 Dieses Bild wirkt besonders stark im Vergleich mit der vorher realistisch geschilderten Unruhe unter den Pferden.
182 Einige Interpreten sehen in dieser Bewegung des Eisenschimmels dessen innere Nähe zum Rittmeister, die diesen in seiner Position bedrohe; dem Wachtmeister stehe ein solch adliges Pferd nicht zu (vgl. u.a. Exner (1986), S. 53; Frink (1987), S. 85; Wiese (1967), S. 300).
183 Einige Philologen sehen im Eisenschimmel die Verkörperung all dessen, was Lerch nicht ist, die Verkörperung all seiner Wünsche (vgl. Mauser (1977), S. 106; Lakin (1970), S. 48; Frink (1987), S. 84).
184 Vgl. u.a. Alewyn (1967), S. 87; Steinlein (1991), S. 224; Träbing (1969), S. 719.
185 Hoppe (1980) sieht die Struktur der „Reitergeschichte” als „Stilisierung des Subjektivismus” (S. 73), die hier allerdings mit dem Tod scheitert (vgl. auch S. 58). Das „brutale Durchschneiden des Lebensfadens ohne irgendeine kompensierende Perspektive” (S. 164) sieht Jäger-Trees (1988) als implizite Dekadenzkritik Hofmannsthals (vgl. ausführlicher: S. 153 ff.).
186 Vgl. Frink (1987), S. 87 f.; vgl. auch Jäger-Trees’ (1988) Kapitel V.2: „Antagonisten als Gegenentwürfe zu dekadenten Charakteren” (S. 179 ff.).
187 „Warum muss der Wachtmeister Anton Lerch sterben? Warum muss er so sterben?” (S. 79): Diesen Fragen, mit denen Alewyn (1967) seine Interpretation einleitet und die sich nach ihm so viele Interpreten stellten, würde somit der Boden entzogen.
188 Baum (1991), S. 170.
189 Vgl. Kap. II.7 dieser Arbeit.
190 Baum (1991), S. 207. Aus diesem Grund sind Darstellungen des Pferdes im 20. Jahrhundert fast immer reiterlos (vgl. ebd., S. 214 f.): „In der Kunst der Gegenwart gibt es kein Sturzmotiv mehr, weil es auch keine Reiter mehr gibt. Das Pferd allein tritt an deren Stelle.” (ebd., S. 180)
191 Ebd., S. 209.
192 Vgl. Jäger-Trees (1988), S. 187 ff.
193 GW Prosa Bd. 2, S. 10.
194 Jäger-Trees (1988), S. 156.
195 GW Prosa Bd. 2, S. 11.
196 Ebd., S. 13.
197 Gilbert (1974), S. 70.
198 GW Prosa Bd. 2, S. 14. Vielleicht deswegen in einem Brief von 1919 an Anton Kippenberg die Abgrenzung Hofmannsthals von der „Reitergeschichte”, die er als „Schreibübung” abwertet (vgl. SW Bd. XXVIII, S. 218).
199 Bei der Schilderung dieses Gefühls wird in „Ein Brief” auch das Pferd genannt: einmal, als sich Lord Chandos seiner Tochter gegenüber nicht ausdrücken kann und sich nach einem guten Galopp wieder zu beruhigen fähig ist, ein weiteres Mal, als er gegen Abend ausreitet und seine Gedanken in den Keller mit den Ratten schweifen lässt (vgl. GW Prosa Bd. 2, S. 12, S. 14 f.).
200 Es kann sich jedoch nur um ein Einheits gefühl handeln.
201 Hugo von Hofmannsthal - Helene von Nostitz. Briefwechsel, S. 162.
202 Franz Kafka: Schriften, Tagebücher, Briefe. Kritische Ausg. (Krit. A.) Bd. X, S. 252; im folgenden Seitenzahlen von Kafkas „Ein Landarzt” in diesem Kapitel in Text und Fußnoten ohne weitere Angaben.
203 Vgl. zu dieser Aussage Kap. IV.6 dieser Arbeit.
204 Kaum ein Interpret von „Ein Landarzt” kommt an einer Deutung der Pferde vorbei, wenn auch bisher kein Philologe die Verwendung des Pferdesymbols die gesamte Erzählung hindurch konsequent verfolgt hat. Ausführlichere Informationen über die Bedeutung dieses Tieres in Kafkas Werk auch mit Ausführungen zu „Ein Landarzt” finden sich bei Fingerhut (1969): „Die Funktion der Tierfiguren im Werke Franz Kafkas. Offene Erzählgerüste und Figurenspiele”. Der Aufsatz von Blumenstock (1964): „Pferde bei Kafka. Erläuterungsversuche” erweist sich als wenig ergiebig, da er die Pferde einseitig in eine marxistische Interpretation Kafkas integriert. Auf „Ein Landarzt” geht er nicht ein. Da in dieser Arbeit das Hauptaugenmerk auf die Landarzt-Pferde gerichtet ist, die Erzählung aber eine Fülle von Interpretationsansätzen und Deutungen zulässt, sei an dieser Stelle auf die rezeptionsgeschichtlichen Hinweise von Hiebel (vgl. (1984), S. 22, S. 137 ff.) und Möbus (vgl. (1994), S. 115 ff.) verwiesen. Dies gilt auch für eine Reihe von Arbeiten, die eine psychoanalytische Deutung in den Vordergrund stellen, und die wegen ihrer allzu einseitigen Betrachtungsweise in diesem Kapitel weniger berücksichtigt werden.
205 Vgl. zum ersten Satz auch Kleinschmidt (1968), S. 111 f.
206 Vgl. Möbus (1994), S. 133 f.
207 Vgl. Arens (2001), S. 108; Schärf (2000), S. 153.
208 Vgl. u.a. Kleinschmidt (1968), S. 117; Kremer (1994), S. 208; Kurz (1980), S. 125; Sokel (1964), S. 251 ff.
209 Franz Kafka: Gesammelte Werke (GW) Tagebücher. 1910-1923, S. 534 [September 1917].
210 Vgl. Kremer (1994), S. 199 f.
211 Vgl. Baumer (1965), S. 113; Kremer (1994), S. 199; Rajec (1977), S. 80.
212 Vgl. Fingerhut (1969), S. 76, S. 260; Kurz (1980), S. 131.
213 Vgl. Kap. II.7 dieser Arbeit.
214 Vgl. Kap. III.6.5 dieser Arbeit.
215 Vgl. Kap. II.5.1 dieser Arbeit.
216 Mit dem Pferd sterbe auch das bisherige Leben des Arztes, es käme zu einer Lebenskrise, so Rösch (vgl. (1973), S. 219).
217 Vgl. Kremer (1994), S. 200.
218 Vgl. Baum (1991), S. 84.
219 Den Zustand des Mangels oder inneren Verlustes betonen u.a. auch Hiebel (vgl. (1984), S. 38); Ries (vgl. (1993), S. 81); Rösch (vgl. (1973), S. 219).
220 Vgl. auch Kap. III.3 dieser Arbeit.
221 Dieses Spannungsverhältnis zeigt sich auch in dem kurzen Prosastück Kafkas „Wunsch, Indianer zu werden” (vgl. Franz Kafka: Krit. A. Bd. X, S. 32 f.): Einerseits liegt darin eine Art positive Befreiung vom Pferd in einer absoluten Vorwärtsbewegung, die aber wieder zu einem kentaurischen Bild von Ross und Reiter ohne Zügel und Sporen, wie die Indianer eben ritten, und mit menschlichem Körper anstelle von Pferdehals und -kopf zurückführt. Doch diese Rückkehr zur Einheit muss „Wunsch”, muss Utopie bleiben (vgl. hierzu auch die Deutungsmöglichkeit von Fingerhut (1969), S. 70).
222 Baum (1991), S. 14.
223 Vgl. zu diesem Eintrag auch Fingerhut (1969), S. 55.
224 Franz Kafka: GW Tagebücher. 1910-1923, S. 312 f.
225 Vgl. zu den Pferden als das Innere des Arztes u.a.: Emrich (1970), S. 133, S. 137; Sokel (1964), S. 257. Fingerhut (1969) sieht die Pferde als Konkretisation einer innerpsychischen Situation (vgl. S. 122).
226 Vgl. Lakin (1970), S. 46; Sokel (1964), S. 254, S. 277.
227 Die Ambivalenz der Landarzt-Pferde wird in der Forschung weitgehend nicht beachtet, jedoch kehrt sie in der heterogenen Deutung der Tiere (vgl. Fingerhut (1969), S. 29; Möbus (1994), S. 129) wieder zum Vorschein: Ein Großteil der Interpreten sieht sie als Symbol des Triebes, des Unbewussten (vgl. z.B. Hiebel (1984), S. 43; Möbus (1994), S. 129 f.; Ries (1993), S. 83), was unweigerlich zu Hiebels (1984) Feststellung führen muss: „Ungeklärt bleibt, weshalb ausgerechnet die Kräfte der Sinnlichkeit den Arzt an den Ort des Geistes und der Wahrheit führen […].” (S. 142) Ein anderer Teil der Interpreten sieht die Pferde als „unirdisch” an, als Symbol des Geistes, des Asketischen, indem sie sie in Kontrast zum viehischen Knecht setzen (vgl. z.B. Emrich (1970), S. 135; Fingerhut (1969), S. 247; Sokel (1964), S. 257). Kleinschmidt (1968) nennt sie undeutbar (vgl. S. 117). Die willkürliche Deutungsmöglichkeit der Tiere entspreche der Offenheit der Erzählung, so Fingerhut (vgl. (1969), S. 123; vgl. auch Hiebel (1999), S. 179 f.; Kremer (1994), S. 206). Somit entzieht sie sich einer eindeutigen Interpretation (vgl. Hiebel (1999), S. 177; Kleinschmidt (1968), S. 118; Schärf (2000), S. 164 f.).
228 Baum (1991), S. 19.
229 Vgl. Becker (1992), S. 314.
230 Hervorhebung der Verfasserin.
231 Vgl. Becker (1992), S. 266.
232 Im Aberglauben gibt es die Vorstellung, dass unter dem Stall Zwerge als gute oder böse Pferdepfleger wohnen (vgl. Aberglaube Bd. VI, „Pferdestall” Sp. 1680).
233 Vgl. Becker (1992), S. 123.
234 Hervorhebung der Verfasserin.
235 Kafka habe die Symbolik des Unbewussten intentional thematisiert in der Bauform eines Traums; „Ein Landarzt” sei mit mathematischer Präzision durchkomponiert und nehme anhand formaler Mittel Einfluss auf die Leserpsychologie, so Möbus (vgl. (1994), S. 117 f., S. 124, S. 136). Schärf (2000) betont ebenfalls, wenn auch in anderem Kontext, die bewusste Gestaltung von „Ein Landarzt” und damit zusammenhängend die suggestive Beeinflussung des Lesers (vgl. S. 156, S. 160). Beide erkennen in der Traumstruktur eine deutliche Sexualsymbolik (vgl. Möbus (1994), S. 138; Schärf (2000), S. 154 f.).
236 Die Forschung sei sich einig, dass die Erzählung in ihrer narrativen Struktur die spezifische Bauform eines Traums nachbilde, so Möbus (vgl. (1994), S. 118). Er gibt eine Zusammenfassung der wichtigsten Argumente zu dieser Aussage (vgl. ebd., S. 118 f.).
237 Die Ich-Spaltung und die Identität der Figuren in „Ein Landarzt” wird in nahezu jeder Interpretation hergeleitet. Die Identität aller Figuren sei in der Forschung bestätigt worden, folgert Möbus (vgl. (1994), S. 124 ff.). Hiebel (1999) sieht das „epische Ich” dadurch aufgelöst (vgl. S. 167).
238 Vgl. Hiebel (1999): In „Ein Landarzt” als modernem Text trete das Diachrone hinter das Synchrone zurück als eine Art „zersplitterte Verdichtung” (S. 170); dies führe zur Auflösung des Konzepts der Repräsentation (vgl. S. 164 f.).
239 Vgl. Bossard (1991), S. 27 ff.
240 Vgl. u.a. Fingerhut (1969), S. 123; Kremer (1994), S. 204; Lakin (1970), S. 40 f.
241 Baum (1991), S. 81.
242 Bossard (1991), S. 14.
243 Schärfs (2000) These, Kafka transformiere das Unbewusste in eine mythische Sphäre, und es kehre damit als neuer Mythos zur archaischen Dimension der alten Mythen zurück, schwingt an dieser Stelle mit (vgl. S. 160, S. 164). Vgl. auch Hiebel (1984), S. 70, S. 102 ff.; ebd. (1999), S. 172, S. 247 ff.
244 Vgl. zur Verbindung von Wärme und Pferd auch Baumer (1965), S. 113; Kleinschmidt (1968), S. 119.
245 Dieser Vergleich verweist schon auf das Ende der Erzählung: auf die „Schneewüste” (vgl. Kurz (1980), S. 121).
246 Die meisten Interpreten beziehen die Verwandtschaft auf Pferde und Knecht, Kremer (1994) auf Arzt und Dienstmädchen (vgl. S. 205), Hiebel (1984) neben den genannten Möglichkeiten auch auf Pferde und Domestiken-Paar (vgl. 45 f.).
247 Baum (1991), S. 65.
248 Lakin (1970) sieht Kafkas Landarzt-Pferde als „perhaps his most extraordinary creatures” (S. 40).
249 Vgl. Fingerhut (1969), S. 244; Hiebel (1984), S. 76.
250 Fingerhut (1969) meint, die realen Pferde des Bauern Lüftner hätten Kafka bei der Beschreibung der Landarzt-Pferde beeinflusst (vgl. S. 227 f.) und stützt sich dabei auf einen Tagebucheintrag vom 9. Oktober 1917: „Beim Bauer Lüftner. […] Riesige zwei Pferde im Stall, homerische Gestalten, in einem flüchtigen Sonnenschein, der durch das Stallfenster kam.” (Franz Kafka: GW Tagebücher. 1910-1923, S. 536) Die Landarzt-Pferde spiegelten, da Gefährten im Alltag und unirdische Wesen zugleich, den Schwebezustand von Realität und Irrealität (vgl. Fingerhut (1969), S. 65).
251 Vgl. zu den Landarzt-Pferden zwischen befreiender und vernichtender Macht: Baumer (1965), S. 114; Emrich (1970), S. 136 f.; Fingerhut (1969), S. 167, S. 261; Kleinschmidt (1968), S. 119.
252 Vgl. Kremer (1994), S. 204; Kurz (1980), S. 121.
253 Vgl. Hiebel (1984), S. 43 f.; Kurz (1980), S. 129.
254 Neben dem Menschen ist das Pferd das einzige Lebewesen, das über die gesamte Hautoberfläche schwitzt.
255 Vgl. Kremer (1994), S. 206; Möbus (1994), S. 131. „Die Erzählung ‘Ein Landarzt’ inszeniert einen Umschlag, den vom Neutrum ins Femininum, vom Unbeteiligtsein ins Begehren. Aus dem Herren über die Angst der anderen wird am Schluss ein Geängstigter, aus dem Herren über den Tod ein vom Tod Gezeichneter, aus dem Bekleideten ein Nackter.” (Hiebel (1999), S. 166 f.; vgl. auch ebd. (1984), S. 34 f.)
256 Wieder ein Zeichen für die ambivalente Erzählstruktur; vgl. Kleinschmidt (1968), S. 112; Kurz (1980), S. 124 f.
257 Vgl. Rajec (1977), S. 80.
258 Vgl. zu dieser Gleichzeitigkeit, meistens einseitig als Abspaltung des Triebes gesehen: Hiebel (1984), S. 55; Kremer (1994), S. 205; Kurz (1980), S. 123; Sokel (1964), S. 257.
259 Von Anfang an spricht der Arzt ja von einer „Reise”, was in Zusammenhang mit einem Krankenbesuch doch eher ungewöhnlich erscheint, als wisse er um die kommenden Ereignisse.
260 Im Sinne von „Reise” als „Symbol des Lebensweges” (Becker (1992), S. 241). Die Erzählung als Reise in die totale Machtlosigkeit bzw. in den Tod sehen: Kurz (vgl. (1980), S. 124); Rösch (vgl. (1973), S. 221); Sokel (vgl. (1964), S. 260).
261 Vgl. Hiebel (1984), S. 46; Kurz (1980), S. 120; Sokel (1964), S. 260.
262 Homer: Ilias. Übertragen von Hans Rupé. 2. Aufl. München 1970. XXIII, 318-324; zit. n. Baum (1991), S. 50.
263 Vgl. zu den Eigenschaften von Fabelrossen Aberglaube Bd. VI, „Pferd” Sp. 1627 f.; Baum (1991), S. 60 f.
264 Vgl. zur Unterminierung der Textsorten wie z.B. Märchen, Sage, Legende in „Ein Landarzt”: Schärf (2000), S. 158 ff.; vgl. zum Umschlag von Märchenmotiven ins Groteske u.a. Fingerhut (1969), S. 167.
265 Baum (1991), S. 50.
266 Diese Verbindung spielte vor allem im „Schimmelreiter” eine große Rolle; allerdings waren die chthonischen Eigenschaften des Pferdes hauptsächlich in den Aberglauben verlegt.
267 Vgl. u.a. Kremer (1994), S. 208; Möbus (1994), S. 142; Rösch (1973), S. 223 ff.
268 Vgl. hierzu Kurz (1980), S. 122; Lakin (1970), S. 45 f.; Rösch (1973), S. 224.
269 Vgl. Lakin (1970), S. 45; dieses die Satzstruktur betreffende Phänomen zeigte sich in allen drei in dieser Arbeit untersuchten Erzählungen.
270 Die Nacktheit gilt u.a. als Symbol der bedingungslosen Unterwerfung (vgl. Becker (1992), S. 202 f.). Vgl. zum Motiv des Öffnens und Entkleidens in „Ein Landarzt”: Hiebel (1999), S. 170; Kurz (1980), S. 123; Rösch (1973), S. 222, S. 235.
271 Vgl. Rösch (1973), S. 225 f. Das Verhalten der Familie kann somit auch als Sterberitual gedeutet werden.
272 Vgl. Becker (1992), S. 308. In der Darstellung des Arztes als ‚puer, virilis, senex‘ sieht Möbus (1994) die narrative Umsetzung der traumtheoretischen Subjektstufen-Theorie (vgl. S. 140).
273 Vgl. Becker (1992), S. 39.
274 Vgl. Kremer (1994), S. 209.
275 Damit sind sie während der Krankenszene alles andere als nur „gestisch-gespenstischer Hintergrund” (ebd.).
276 Rösch (1973) sieht in diesen Rettungsgedanken die Verdrängung der tödlichen, der getrübten Erkenntnis des Arztes (vgl. S. 230, S. 237 f.).
277 Vgl. Möbus (1994), S. 141; Sokel (1964), S. 269. Auch die Wunde lässt sich in heilsgeschichtlichem Kontext deuten (vgl. hierzu Hiebel (1984), S. 84; Kurz (1980), S. 127; Möbus (1994), S. 141). Die christologischen Anspielungen bilden nach Möbus (ebd.) eine „zweite Verweisungsebene” des Textes (vgl. ebd., S. 141).
278 Vgl. Hiebel (1999), S. 172; Möbus (1994), S. 150.
279 Baum (1991), S. 32; vgl. auch Fingerhut (1969), S. 167.
280 Vgl. Aberglaube VI, „Pferdekopf” Sp. 1664.
281 Vgl. ebd., „Pferd” Sp. 1620. Die Anspielungen auf den Aberglauben in Verbindung mit dem Pferd sind fast ebenso zahlreich wie im „Schimmelreiter”, jedoch waren diese im „Schimmelreiter” sehr viel klarer als solche abgegrenzt.
282 Vgl. ebd. Sp. 1620. Noch eine weitere Verbindung eines Aspektes dieser Erzählung mit dem Aberglauben sei zumindest erwähnt: Schon Plinius riet zur Vernichtung von Raupen bzw. Würmern, einen Stutenkopf auf eine Gartenstange zu stecken (vgl. ebd., „Pferdekopf” Sp. 1665).
283 Vgl. u.a. zur Deutung der Wunde: Hiebel (1984), S. 83 ff.; ebd. (1999), S. 169 ff.; Kremer (1994), S. 207 ff.; Kurz (1980), S. 126 f.; Möbus (1994), S. 131 ff.; zur biographischen Deutung der Wunde als Anzeichen der im August 1917 ausbrechenden Tuberkulose Kafkas vgl. u.a. Hiebel (1984), S. 13 ff.; Möbus (1994), S. 114 f.
284 Auch die Blume, die Rose und der Wurm stehen für die Symbolik von Leben und Tod (vgl. Becker (1992), S. 45 f., S. 243 f., S. 335).
285 Eine solche Aufzählung von Bedeutungen ist natürlich nie erschöpfend.
286 Die Flucht wird im Präteritum geschildert. Der Tempuswechsel setzt ein, als der Junge still wird und dann Rettungsgedanken folgen. Diese Gedanken scheinen somit nur mit der Distanzierung vom Geschehen möglich. Das ewig bestehende Schlussbild steht dagegen wieder im Präsens.
287 Vgl. zum Pelzsymbol u.a. Kurz (1980), S. 128; Möbus (1994), S. 135 f.
288 Hier schwingt die antike Vorstellung von vier bis fünf Zeitaltern menschlicher Geschichte mit, die als symbolische Zustandsbilder gedacht waren und an deren Ende der völlige Niedergang der Menschheit stehen sollte (vgl. Becker (1992), S. 343).
289 Fingerhut (1969) betont, es gebe keinen Weg zurück zum Tier (vgl. S. 263).
290 Dieser Polarität entspricht ebenfalls die Symbolik der „Wüste” zwischen Gottesnähe und -ferne und die der „Glocke” als Verbindung zwischen Himmel und Erde; die Vorstellung, dass die Glocke als Symbol göttlicher Allmacht die Seele über die Grenzen des Irdischen hinausführt, klingt ironisch an (vgl. Becker (1992), S. 104, S. 335).
291 Vgl. u.a. Rösch (1973), S. 239 ff.; Hiebel (1984), S. 80; Sokel (1964) S. 277.
292 Baum (1991), S. 82.
293 Ebd., S. 180.
294 Ebd., S. 79.
295 „Er [Kafka] handhabt Reiten und Schreiben als Prozesse, die sich gegenseitig zitieren.” (Kremer (1994), S. 198); den Schneeraum sieht Kremer als weißes Papier, das es zu beschriften gilt (vgl. ebd., S. 199). „Es ist, als würde der Dichter noch im Erzählen von eben den Geisterpferden vorwärts gejagt, von denen er berichtet.” (Baumer (1965), S. 109) Vgl. auch Fingerhut (1969), S. 128.
296 Franz Kafka: GW Tagebücher. 1910-1923, S. 563 [27. Januar 1922].
297 Franz Kafka: GW Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande und andere Prosa aus dem Nachlaß, S. 43 f. [45. Aphorismus].
298 Vgl. Hiebel (1984), S. 55; Kremer (1994), S. 199; Sokel (1964), S. 261. Fingerhut (1969) betont, das Pferd sei eine typische Chiffre Kafkas für die Inspiration (vgl. S. 131), „Ein Landarzt” die poetische Umsetzung seines Verhältnisses zur dichterischen Inspiration (vgl. S. 134 ff.).
299 Franz Kafka: GW Tagebücher. 1910-1923, S. 377. Vgl. hierzu auch Fingerhut (1969), S. 131 f.
300 Vgl. zu diesem Aspekt ausführlich: Fingerhut (1969), S. 130 f., S. 140 ff.; Kremer (1994).
301 Vgl. Franz Kafka: GW Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande [...], S. 293 f.
302 Ebd., S. 294.
303 Vgl. Fingerhut (1969), S. 131; Rösch (1973), S. 241; Sokel (1964), S. 280.
304 Franz Kafka: GW Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande [...], S. 294.
305 Vgl. Fingerhut (1969), S. 130; Kremer (1994), S. 211.
306 Franz Kafka: GW Tagebücher. 1910-1923, S. 456. Vgl. auch das Fragment (vgl. ebd.: GW Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande [...], S. 412-415), in dem ein Student nachts sein Pferd dressieren möchte - wie Kafka nachts seine Geschichten bzw. Muse - und sich dafür tagsüber gezwungen sieht zu arbeiten.
307 Vgl. Hiebel (1999), S. 172; Kleinschmidt (1968), S. 113, S. 115.
308 Vgl. zu diesem Aspekt insbes. Schärf (2000), S. 160 ff.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der thematische Schwerpunkt der Analyse der Kurzgeschichten?
Die Analyse konzentriert sich auf die Darstellung des Pferdes in den Erzählungen "Der Schimmelreiter" von Theodor Storm, "Reitergeschichte" von Hugo von Hofmannsthal und "Ein Landarzt" von Franz Kafka, wobei die symbolische Bedeutung, die Funktion innerhalb der Texte und die Anspielungen auf Mythologie und Tradition untersucht werden.
Welche Erzählungen werden in der Analyse berücksichtigt?
Die Analyse umfasst "Der Schimmelreiter" von Theodor Storm, "Reitergeschichte" von Hugo von Hofmannsthal und "Ein Landarzt" von Franz Kafka.
Welche Themen werden in Bezug auf das Pferd untersucht?
Die Analyse untersucht Themen wie die Rolle des Pferdes als Muttersymbol, Libidosymbol, Symbol des aufstrebenden Bewusstseins, Spiegel des Menschen, Seelenführer und Ausdruck von kulturellem Wandel. Auch die Beziehung zwischen Mensch und Pferd (Ross-Reiter-Beziehung) wird detailliert betrachtet.
Welche mythologischen Bezüge werden in Verbindung mit dem Pferd hergestellt?
Es werden Bezüge zu mythologischen Figuren und Konzepten wie Wotan, Pegasos, Kentauren und dem Trojanischen Pferd hergestellt, um die vielfältigen symbolischen Dimensionen des Pferdes zu beleuchten.
Wie wird die Rolle des Pferdes im "Schimmelreiter" interpretiert?
Im "Schimmelreiter" wird das Pferd als vielschichtiges Symbol dargestellt, das sowohl mit Aberglauben und Mythologie verbunden ist als auch für den Kampf zwischen Mensch und Natur, Vernunft und Aberglauben sowie Matriarchat und Patriarchat steht. Der Schimmel Haukes verkörpert auch dessen innere Konflikte und sein Streben nach Kontrolle.
Wie wird das Pferd in der "Reitergeschichte" dargestellt?
In der "Reitergeschichte" wird das Pferd als Spiegel der inneren Konflikte des Reiters Anton Lerch dargestellt. Der Verlust der reiterlichen Dominanz und die Entfremdung von der Natur führen zum Tod des Reiters. Das Pferd wird zum Symbol des Unaussprechlichen und des Leidens am Verlust der einstigen Einheit von Mensch und Tier.
Welche Bedeutung hat das Pferd in "Ein Landarzt"?
In "Ein Landarzt" wird das Fehlen des Pferdes zunächst als Verlust und Ausgangspunkt für eine Reise ins Innere des Arztes dargestellt. Die wiedergeborenen Pferde werden zum Symbol der dichterischen Inspiration, der sich verselbstständigenden Triebwelt und des Verlusts der Kontrolle. Die Pferde als Nachfolger des Trojanischen Pferdes tragen zur grotesken Darstellung des Reiters bei.
Wie wird die Entwicklung der Ross-Reiter-Beziehung über die drei Werke hinweg interpretiert?
Die Entwicklung der Ross-Reiter-Beziehung spiegelt einen fortschreitenden Ablösungsprozess wider. Im "Schimmelreiter" besteht noch eine gewisse Einheit, die jedoch durch Konflikte geprägt ist. In der "Reitergeschichte" kommt es zur Trennung von Ross und Reiter, während "Ein Landarzt" bereits mit dem Zusammenbruch dieser Beziehung beginnt.
Welche Rolle spielt der Aberglaube in den Erzählungen im Bezug auf das Pferd?
Der Aberglaube beeinflusst die Wahrnehmung des Pferdes, besonders im "Schimmelreiter", wo das Pferd oft mit dem Teufel oder dem Tod in Verbindung gebracht wird. In den anderen Erzählungen tritt der Aberglaube in den Hintergrund, aber die mythischen und symbolischen Aspekte des Pferdes bleiben relevant.
Was sind die Hauptthesen, die in der Analyse aufgestellt werden?
Die Hauptthesen umfassen die Darstellung des Pferdes als Spiegel der inneren Befindlichkeit des Menschen, als Symbol für kulturellen Wandel, und die Verknüpfung der Mensch-Pferd-Darstellungen mit mythischen Erklärungsmustern. Das Pferd ist ein vielschichtiges Symbol, dass in den einzelnen Erzählungen andere Schwerpunkte hat.
- Quote paper
- Tina Full-Euler (Author), 2002, Rätselhafte Pferde, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1472796