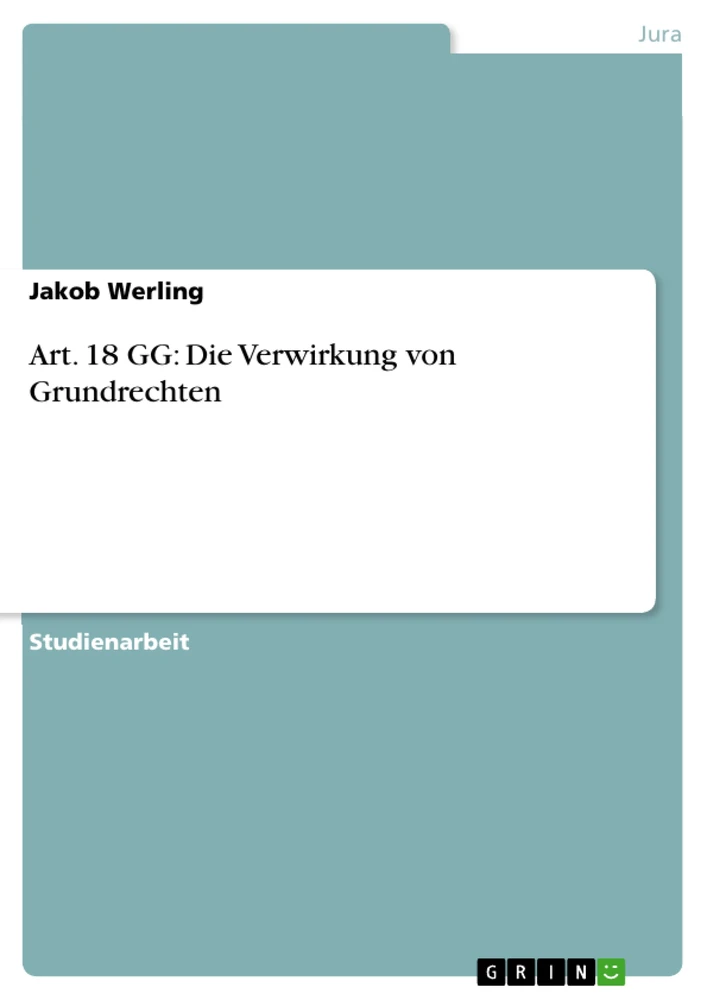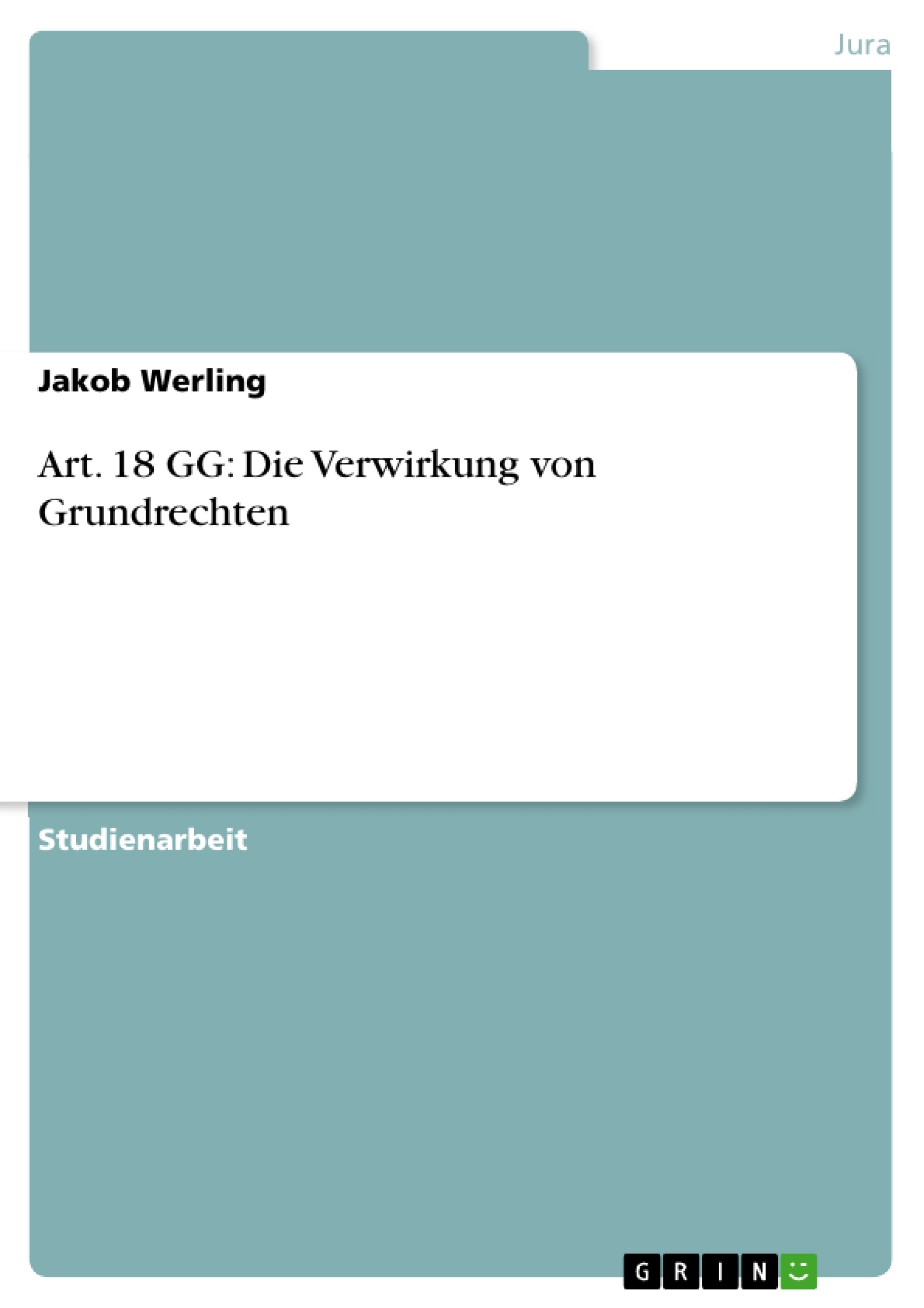Diese Proseminararbeit im Seminar "Rechtskritik" untersucht die historische Entwicklung des Art. 18 Grundgesetz.
Analysiert wird dabei die Auslegung des Begriffs der Grundrechtsverwirkung und es wird auf die rechtlichen Feinheiten eingegangen, die diesen Artikel prägen. Die Arbeit bietet eine gründliche Betrachtung und kritische Analyse dieses zentralen Instruments unserer wehrhaften Demokratie.
Im Anschluss beschäftigt sich der Autor zunächst mit den Grundrechten an sich, gefolgt von einer genaueren Betrachtung von Art. 18. Dabei wird die systematische Stellung, der historische Kontext sowie die Wirkung und Bedeutung der Grundrechtsverwirkung für unsere Demokratie näher analysiert. Das Ziel der Arbeit ist dabei eine kritische Auseinandersetzung mit Art. 18 und seiner Auslegung.
Inhaltsverzeichnis
- I. Problemaufriss
- II. Verwirkung von Grundrechten
- 1. Die Idee der wehrhaften Demokratie
- 2. Historie des Art. 18 GG
- 3. Systematische Stellung des Art. 18 GG
- 4. Tatbestand des Art. 18 GG
- a. Normenadressat
- b. Schutzgut: freiheitlich demokratische Grundordnung (fdGO)
- c. Missbrauchsbegriff
- d. Rechtsfolge des Art. 18 GG
- i. Verwirkung der Schutzdimension eines Grundrechts
- ii. Verwirkung der politischen Dimension
- iii. Verwirkung des speziellen Grundrechts in Bezug auf die missbräuchliche Handlung (Identitätslehre)
- iv. Verhältnismäßigkeit der Entscheidung
- e. Verhältnis zu Art. 2 I GG
- III. Gefahrenbegriff
- 1. Problem der fehlenden Wirksamkeit der Verwirkung
- 2. BVerfG als das ausführende Gericht
- 3. Art. 18 GG im Vergleich zu anderen Normen
- IV. Kritik an Art. 18 GG
- 1. Kritik an der Auslegung des Missbrauchsbegriffs
- 2. Problematik des Menschenwürdekerns der Grundrechte
- V. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Artikel 18 des Grundgesetzes (GG), der die Verwirkung von Grundrechten bei deren Missbrauch zur Gefährdung der freiheitlich demokratischen Grundordnung (fdGO) regelt. Ziel ist es, den Artikel im Kontext der wehrhaften Demokratie zu analysieren und seine praktische Anwendung sowie die damit verbundenen Herausforderungen zu beleuchten.
- Die Idee der wehrhaften Demokratie und ihr Verhältnis zu Grundrechten
- Der Tatbestand des Art. 18 GG: Missbrauch und Gefährdung der fdGO
- Die Rechtsfolgen der Grundrechtsverwirkung nach Art. 18 GG
- Kritikpunkte an der Auslegung und Anwendung des Art. 18 GG
- Der Schutz des Menschenwürdekerns der Grundrechte
Zusammenfassung der Kapitel
I. Problemaufriss: Der einleitende Abschnitt thematisiert die Notwendigkeit einer wehrhaften Demokratie im Angesicht von Intoleranz und antidemokratischen Bestrebungen. Er verweist auf die historische Entwicklung und verfassungsrechtliche Grundlagen, insbesondere die Ewigkeitsklausel (Art. 79 III GG) und das Parteienverbot (Art. 21 II GG), um die Bedeutung von Art. 18 GG als Schutzmechanismus der freiheitlich demokratischen Grundordnung herauszustellen. Die zentrale Frage nach dem Umgang mit Grundrechtsmissbrauch wird formuliert und der Fokus auf Art. 18 GG gelegt, der die Verwirkung von Grundrechten ermöglicht, um die Freiheit anderer zu schützen. Der Abschnitt verbindet die Notwendigkeit der Verteidigung der Demokratie mit der besonderen Rolle von Art. 18 GG.
II. Verwirkung von Grundrechten: Dieses Kapitel analysiert umfassend den Artikel 18 GG. Es erörtert die "Idee der wehrhaften Demokratie" als philosophischen und rechtlichen Hintergrund, beleuchtet die historische Entwicklung des Artikels und seine systematische Stellung im GG. Der Tatbestand des Art. 18 GG wird detailliert untersucht, einschließlich der Definition des Normenadressaten, des Schutzgutes (fdGO), des Missbrauchsbegriffs und der verschiedenen Rechtsfolgen. Die Zusammenfassung der Rechtsfolgen umfasst die Verwirkung der Schutzdimension, der politischen Dimension sowie die spezifische Verwirkung im Kontext der missbräuchlichen Handlung. Das Verhältnis zu Art. 2 I GG wird ebenfalls diskutiert, was die Komplexität der rechtlichen Absicherung der wehrhaften Demokratie verdeutlicht. Die umfassende Analyse dieses Kapitels deckt die vielschichtigen Aspekte der Grundrechtsverwirkung auf.
III. Gefahrenbegriff: Dieses Kapitel fokussiert auf die Herausforderungen der praktischen Anwendung von Art. 18 GG. Es analysiert die Problematik der fehlenden Wirksamkeit der Verwirkung, die Rolle des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) und vergleicht Art. 18 GG mit anderen Normen. Es beleuchtet kritische Punkte und diskutiert die möglichen Konsequenzen fehlender oder unzureichender Anwendung, sowie die Implikationen für den Schutz der Demokratie.
Schlüsselwörter
Artikel 18 GG, Grundrechtsverwirkung, Wehrhafte Demokratie, Freiheitlich Demokratische Grundordnung (fdGO), Missbrauch, Gefahrenbegriff, Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Menschenwürde, Grundrechte, Verfassungsrecht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Verwirkung von Grundrechten nach Art. 18 GG"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert Artikel 18 des Grundgesetzes (GG), der die Verwirkung von Grundrechten bei deren Missbrauch zur Gefährdung der freiheitlich demokratischen Grundordnung (fdGO) regelt. Sie untersucht die Anwendung des Artikels im Kontext der wehrhaften Demokratie und beleuchtet die damit verbundenen Herausforderungen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Idee der wehrhaften Demokratie und ihr Verhältnis zu Grundrechten, den Tatbestand des Art. 18 GG (Missbrauch und Gefährdung der fdGO), die Rechtsfolgen der Grundrechtsverwirkung nach Art. 18 GG, Kritikpunkte an der Auslegung und Anwendung des Art. 18 GG sowie den Schutz des Menschenwürdekerns der Grundrechte. Sie umfasst einen Problemaufriss, eine detaillierte Analyse der Grundrechtsverwirkung, eine Betrachtung des Gefahrenbegriffs und ein Fazit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Kapitel I (Problemaufriss) führt in die Thematik ein. Kapitel II (Verwirkung von Grundrechten) analysiert Art. 18 GG detailliert, einschließlich der Rechtsfolgen und des Verhältnisses zu Art. 2 I GG. Kapitel III (Gefahrenbegriff) befasst sich mit den Herausforderungen der praktischen Anwendung. Kapitel IV (Kritik an Art. 18 GG) beleuchtet Kritikpunkte an der Auslegung und Anwendung. Kapitel V (Fazit) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Rechtsfolgen sieht Art. 18 GG vor?
Art. 18 GG sieht verschiedene Rechtsfolgen vor, einschließlich der Verwirkung der Schutzdimension eines Grundrechts, der Verwirkung der politischen Dimension und der spezifischen Verwirkung des Grundrechts in Bezug auf die missbräuchliche Handlung (Identitätslehre). Die Verhältnismäßigkeit der Entscheidung ist dabei stets zu beachten.
Welche Rolle spielt das Bundesverfassungsgericht (BVerfG)?
Das BVerfG spielt eine zentrale Rolle bei der Anwendung von Art. 18 GG. Es ist das ausführende Gericht, das über die Verwirkung von Grundrechten entscheidet und die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen prüft.
Welche Kritikpunkte an Art. 18 GG werden angesprochen?
Kritikpunkte beziehen sich auf die Auslegung des Missbrauchsbegriffs und die Problematik des Menschenwürdekerns der Grundrechte. Die Arbeit diskutiert die möglichen Konsequenzen fehlender oder unzureichender Anwendung von Art. 18 GG.
Was ist die "wehrhafte Demokratie"?
Die "wehrhafte Demokratie" ist ein Konzept, das die Notwendigkeit der Verteidigung der freiheitlich demokratischen Grundordnung gegen antidemokratische Bestrebungen betont. Art. 18 GG ist ein wichtiger Bestandteil dieses Konzepts.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Artikel 18 GG, Grundrechtsverwirkung, Wehrhafte Demokratie, Freiheitlich Demokratische Grundordnung (fdGO), Missbrauch, Gefahrenbegriff, Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Menschenwürde, Grundrechte, Verfassungsrecht.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für Wissenschaftler, Studierende der Rechtswissenschaften und alle Interessierten geeignet, die sich mit dem Thema Grundrechtsverwirkung und der wehrhaften Demokratie auseinandersetzen möchten.
- Quote paper
- Jakob Werling (Author), 2023, Art. 18 GG: Die Verwirkung von Grundrechten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1472072