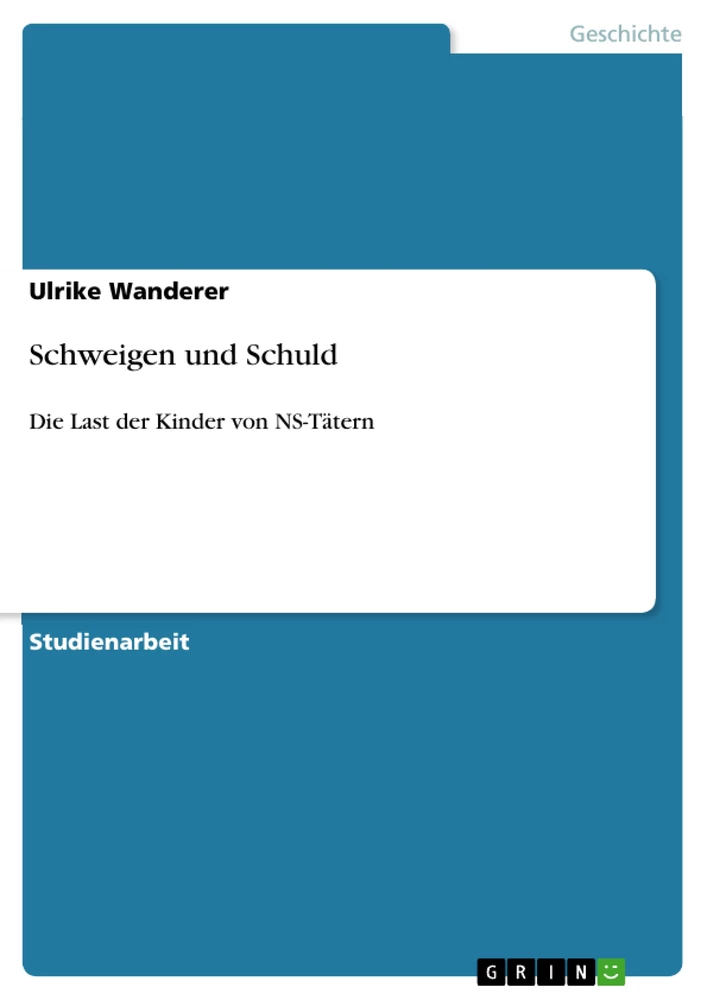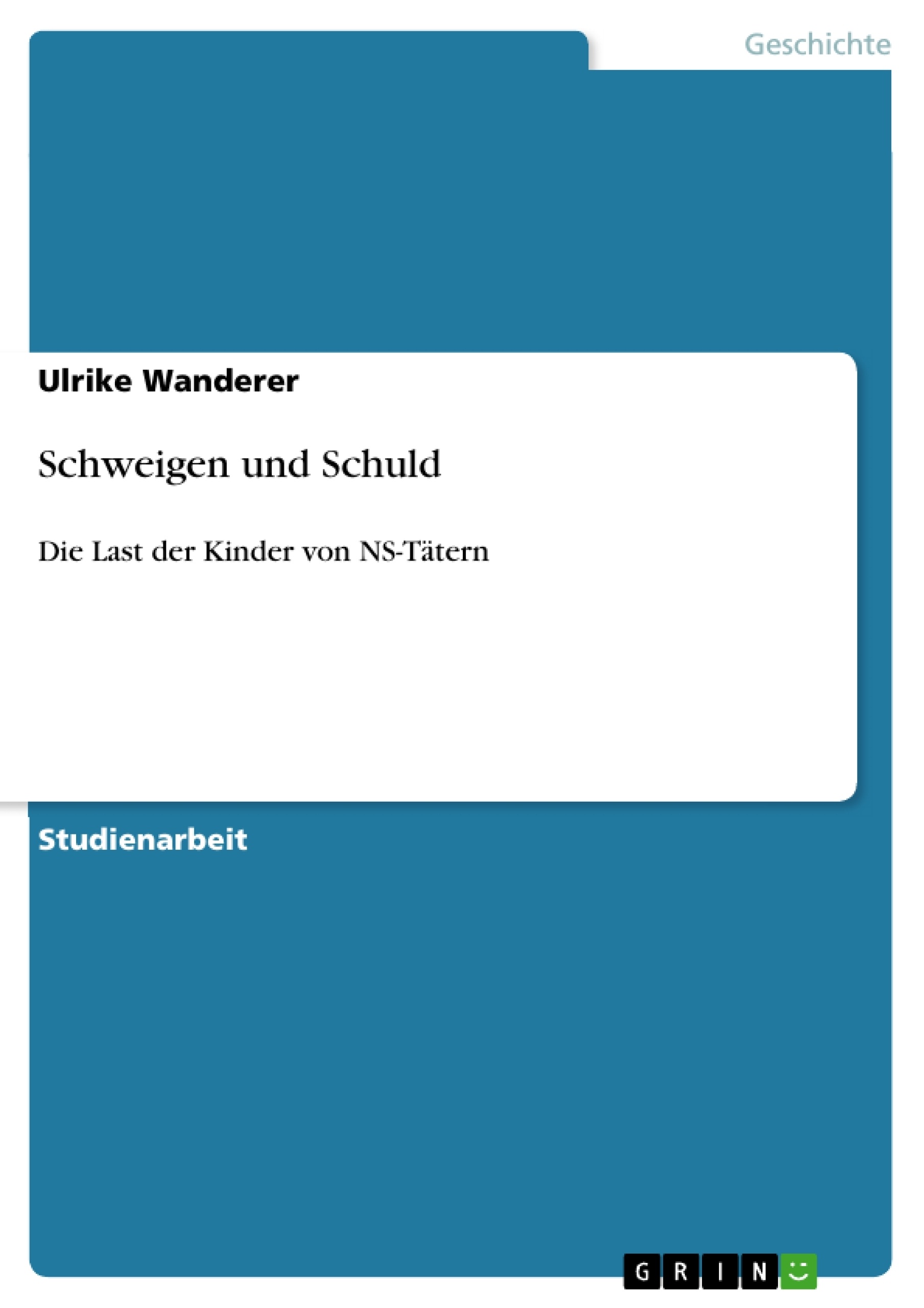Die mittlerweile unüberschaubare Flut von Veröffentlichungen von Nachkommen der NS-Täter zeigt ein größer werdendes Interesse an den Auswirkungen der NS-Vergangenheit für die nachfolgenden Generationen. In der vorliegenden Arbeit soll dargestellt werden, wie mit der Beteiligung von NS-Täter an nationalsozialistischen Verbrechen und Verfolgung in deren Familien umgegangen wurde und wie sich dieser Umgang auf deren Kinder ausgewirkt hat. Dazu soll zunächst kurz der allgemeinen Umgang mit der Geschichte des Dritten Reiches in der deutschen Nachkriegsgesellschaft dargestellt werden und anhand von einigen Fallbeispiel, welche Rolle in den Familie der Täter die Vergangenheit spielte, bzw. wie die Nachkommen von der Tätigkeit des jeweiligen involvierten Elternteils erfahren haben. Daraus ergibt sich die Frage, wie diesem Wissen von den Kindern bewertet wurde und welche Konsequenzen dies für deren eigenes Leben hatte.
Es wurde sich bewusst auf die zweite Generation beschränkt, da es beim Verarbeitungsstand und Umgang mit dem Thema Nationalsozialismus und der Beteiligung von Familienangehörigen am Holocaust deutliche Unterschiede zwischen der zweiten und dritten Generation gibt, wie sich aus der verwendeten Literatur ergibt. Darauf näher einzugehen ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich.
Zur Veranschaulichung und Annäherung an dieses Thema wird vor allem auf die Interviews des israelischen Soziologen Dan Bar-On mit Kindern von NS-Tätern zurückgegriffen. Bar-On selbst merkt an, dass die von ihm ausgewählten Interviewpartner sicher nicht repräsentativ für die gesamte Generation der NS-Nachkommen sein können, da es keine konkreten Daten über die Population der Täter gibt.1 Weiterhin geben Interviews immer nur einen subjektiven Einblick in das Leben der Gesprächspartner. Sie ermöglichen aber einen guten Überblick über die Vielzahl von Betroffenen, vom „kleinen Rädchen“ bis zum „hohen Tier“, aus dem sich einige Schwerpunkte bei der Verarbeitung des Themas herausarbeiten lassen.
Die in der Literatur teilweise verwendeten Decknamen wurden in dieser Arbeit übernommen. Sofern dies möglich ist, werden Rückschlüsse aus den gemachten biografischen Angaben über die wahre Identität der Elternteile gezogen und angemerkt.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit
- Die Nazi-Täter und ihre Kinder
- Der Umgang mit der NS-Vergangenheit in den Familien
- Die NS-Vergangenheit und der Umgang mit dieser anhand der Fallbeispiele
- Auswirkungen auf das Eltern-Kind-Verhältnis und die Konsequenzen für die eigene Biografie
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Auswirkungen der NS-Vergangenheit auf die Kinder von NS-Tätern. Sie untersucht, wie der Umgang mit der Beteiligung von NS-Tätern an nationalsozialistischen Verbrechen und Verfolgung in deren Familien erfolgte und wie sich dieser Umgang auf die Kinder auswirkte. Dabei wird zunächst der allgemeine Umgang mit der Geschichte des Dritten Reiches in der deutschen Nachkriegsgesellschaft betrachtet und anhand von Fallbeispielen die Rolle der Vergangenheit in den Familien der Täter beleuchtet.
- Die Auswirkungen des Schweigens über die NS-Vergangenheit auf die Familien der Täter
- Die Herausforderungen für die Kinder von NS-Tätern, mit dem Wissen über die Vergangenheit ihrer Eltern umzugehen
- Die Folgen für die eigene Biografie, die aus der Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit der Eltern resultieren
- Die Rolle des Vaters in der Entwicklung der Kinder von NS-Tätern
- Die Herausforderungen bei der Erforschung der NS-Vergangenheit und die Schwierigkeiten, repräsentative Daten zu erhalten
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort erläutert die Motivation für die Untersuchung und stellt den Fokus auf die zweite Generation von NS-Tätern, da sich der Umgang mit dem Thema Nationalsozialismus zwischen dieser und der dritten Generation deutlich unterscheidet. Das zweite Kapitel beleuchtet die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit in der deutschen Nachkriegsgesellschaft und zeigt, wie das Thema in der Öffentlichkeit lange Zeit totgeschwiegen wurde. Das dritte Kapitel befasst sich mit den Nazi-Tätern und ihren Kindern, wobei der Fokus auf der Rolle des Vaters in der Entwicklung des Kindes liegt. Im vierten Kapitel werden Fallbeispiele analysiert, die Einblicke in den Umgang mit der NS-Vergangenheit in den Familien der Täter und deren Auswirkungen auf die Kinder geben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der NS-Vergangenheit, dem Schweigen und der Schuld, sowie mit der individuellen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit der Geschichte. Weitere wichtige Schlüsselbegriffe sind: NS-Täter, Kinder von NS-Tätern, Familiengeheimnisse, Trauma, Schuld, Verdrängung, Erinnerungskultur, Holocaust, zweite Generation, Interviews, Fallbeispiele.
- Quote paper
- Ulrike Wanderer (Author), 2007, Schweigen und Schuld, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147203