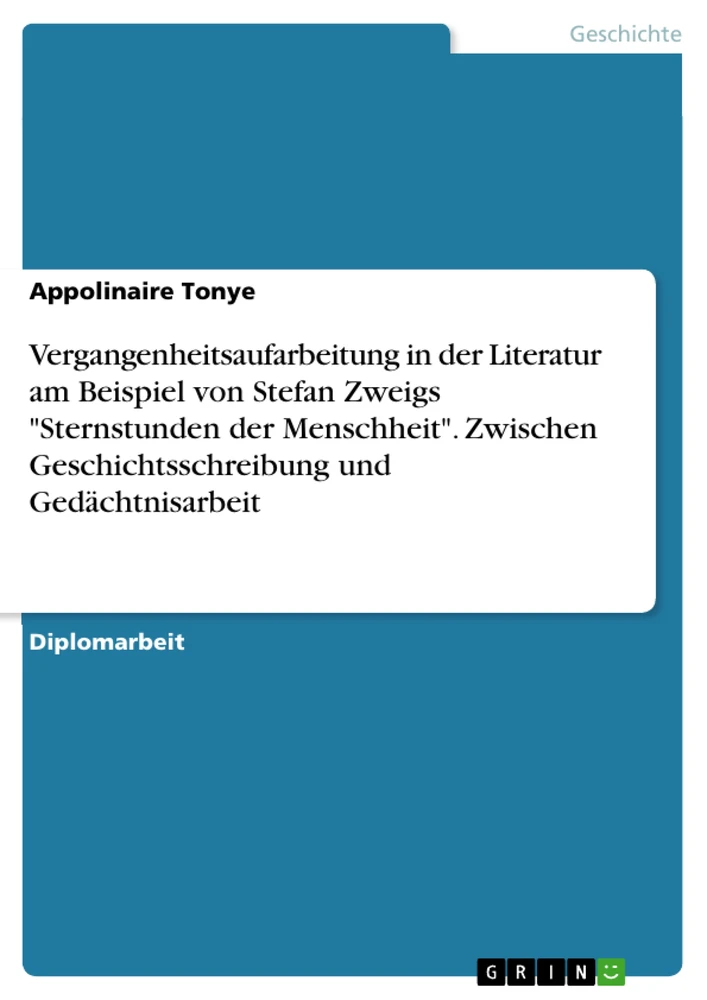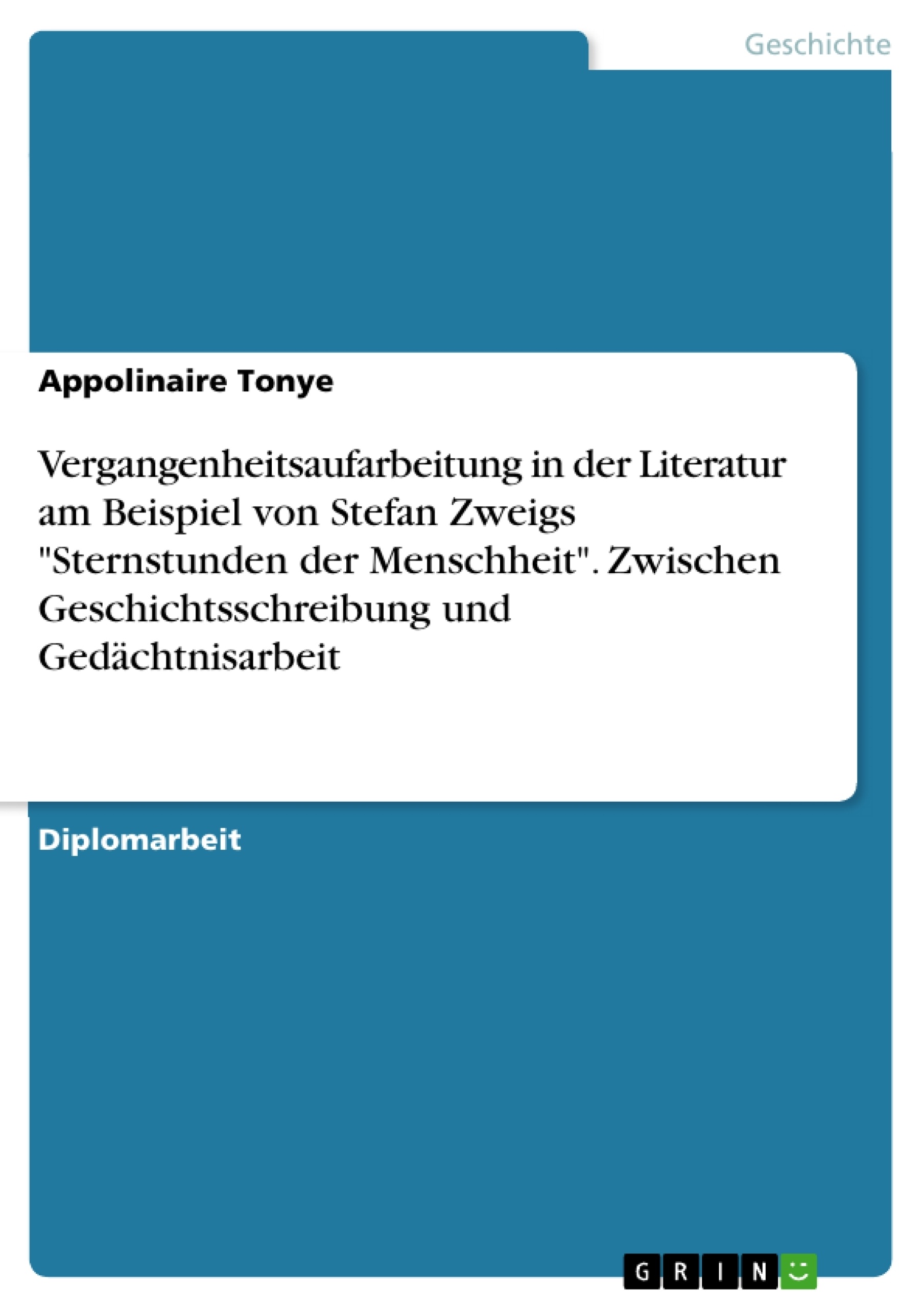Die vorliegende Arbeit versucht zu zeigen, wie die Literatur an der Geschichtsschreibung und der Gedächtnisarbeit teilnimmt und wie sie die Identität von Nationen und Völkern formt. Anhand der 14 Miniaturen, aus denen sich Stefan Zweigs "Sternstunden der Menschheit" zusammensetzt, wird untersucht, wie die Literatur anhand von Erzähltechniken und anderen stilistischen Stärken an der Geschichtsschreibung und der Konstruktion eines Gedächtnisses arbeitet. Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen zwei Fragen: Warum und wie schreibt die Literatur die Geschichte um und wie beteiligt sie sich an der Konstruktion und Dekonstruktion der Erinnerung? Wie und welche Identität bildet die Literatur aus den ausgewählten historischen Momenten und erinnerungswürdigen Figuren? Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Rolle der Literatur in der historiografischen und erinnerungspolitischen Debatte mehr denn je zu legitimieren und bei den Lesern literarischer Werke einen völlig neuen Blick auf die Literatur zu wecken, die oftmals auf den Bereich des Traums und der Fantasie reduziert wird.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Danksagung
Resume
Abstract
Kapitel 0: Einleitung
0.1. Motivation und Erkenntnisinteresse
0.2. Thema und Darstellung des Korpus
0.3. Problematik und Hypothesen
0.4. Ziele der Arbeit
0.5. Stand der Forschung
0.6. Theoretischer Rahmen
0.7. Gliederung der Arbeit
TEIL I: THEORETISCHE GRUNDLAGEN
Kapitel 1: Begriffsbestimmung
1.1. Vergangenheitsaufarbeitung
1.2. Die Triade Vergangenheit- Gegenwart-Zukunft
1.3. Literatur
1.4. Geschichtsschreibung
1.5. Geschichte
1.6. Geschichtswissenschaft
1.7. Gedächtnis
1.8. Erinnerung
1.9. Vergessen
Zwischenfazit
Kapitel 2: Literatur-Geschichte-Gedächtnis: Verhältnis unter den Kernkategorien
2.1. Gedächtnis und/gegen/mit Geschichte
2.1.1. Geschichte und Gedächtnis im Laufe der Zeit
2.1.1.1. Von der Antike bis in die Neuzeit
2.1.1.2. Das 19. Jahrhundert
2.1.1.3. „Geschichte und Gedächtnis nach 1945: Am Beispiel des Holocaust“
2.1.2. Der Standpunkt von einigen Gedächtnistheoretikern
2.1.2.1. Der Standpunkt von Maurice Halbwachs
2.1.2.2. Der Standpunkt von Pierre Nora
Zwischenfazit
2.2. Literatur und/gegen/mit Geschichte
2.2.1. Literatur vs. Geschichte
2.2.1.1. Der aristotelische Standpunkt
2.2.1.2. Warum soll man (nicht) an Geschichte glauben?
2.2.1.3. Sprache, Objektivität und Publikum als Unterscheidungsstütze
2.2.2. „Geschichte als Dichterin“: Der Standpunkt von Stefan Zweig
2.2.3. Literatur und Geschichtsschreibung
Zwischenfazit
2.3. Literatur und Gedächtnis („Schreiben als Erinnerungsarbeit“)
2.3.1. „Gedächtnis der Literatur“
2.3.2. „Gedächtnis in der Literatur“
2.3.3. „Literatur als Medium des Gedächtnisses“
Zwischenfazit
Kapitel 3: Die Triade Literatur- Geschichte und Gedächtnis: Alles ins Eins
3.1. „Das Po(i)etische der Erinnerungskultur“
3.2. „Das Erinnerungskulturelle der Literatur“
3.3. Über eine vielseitige/hybride Gattung: Erinnerungsliteratur
Zwischenfazit
TEIL II: TEXTANALYSE
Kapitel 4: Stefan Zweigs Biographie und Bestimmung von Kernbegriffen der Textanalyse
4.1. Biographie des Autors und deren Relationierung an die Auswahl von historischen Figuren und Ereignissen
4.2. Gattungsbezogene Definitionen
4.2.1. Was ist eine Miniatur und was kann sie?
4.2.2. Zum Begriff „Sternstunden“
4.3. Erzähltheorie im Überblick
4.3.1. Fabelanalyse
4.3.2. Erzählsituation
4.4. Begriffe der Erzähltechnik
4.4.1. Intermedialität
4.4.2. Collage und Montage
Kapitel 5: Analyse des Werkes
5.1. „Sternstunden der Menschheit“ als Darlegung von „European Lives“ und dessen Beitrag zur Konstruktion eines Europagedächtnisses
5.1.1. Sternstunden Russlands
5.1.1.1. „Heroischer Augenblick“
5.1.1.1.1. Zum Inhalt und Titel der Miniatur und deren Aufnahme in den Sternstunden
5.1.1.1.2. Erzählsituation und Fabelanalyse
5.1.1.1.3. Formanalyse
5.1.1.2. „Der versiegelte Zug“
5.1.1.2.1. Zusammenfassung
5.1.1.2.2. Wer war Lenin?
5.1.1.2.3. Fabelanalyse und Erzählsituation
5.1.1.3. „Die Flucht zu Gott“
5.1.1.3.1. Inhaltswiedergabe und Aufnahme der Miniatur in den Sternstunden
5.1.1.3.2. Wer war Leo Tolstoi?
5.1.1.3.3. Fabelanalyse und Erzählsituation
5.1.1.3.4. Formanalyse
5.1.2. Stefan Zweig, Russland und Europa
5.1.3. Sternstunden Amerikas
5.1.3.1. „Flucht in die Unsterblichkeit“
5.1.3.1.1. Zum Titel und zur Zusammenfassung
5.1.3.1.2. Wer war Vasco Nunez de Balboa?
5.1.3.1.3. Figurenkonstellation
5.1.3.1.3.1. De Balboas Mannschaft
5.1.3.1.3.2. Andere historische Figuren
5.1.3.1.4. Fabelanalyse und Erzählsituation
5.1.3.1.5. Formanalyse und Geschichtsschreibungsimplikationen
5.1.3.3. „Die Entdeckung Eldorados“
5.1.3.3.1. Inhaltsangabe und Biographie von Johann August Suter
5.1.3.3.2. Fabelanalyse und Erzählsituation
5.1.3.4. Die anderen Sternstunden Amerikas
5.1.4. Sternstunde Englands
5.1.4.1. „Der Kampf um den Südpol“
5.1.4.1.1. Zusammenfassung
5.1.4.1.2. Wer war Robert F. Scott?
5.1.4.1.3. Fabelanalyse und Erzählsituation
5.1.4.1.4. Formanalyse
5.1.5. Sternstunden Frankreichs
5.1.5.1. „Das Genie einer Nacht“
5.1.5.1.1. Zusammenfassung
5.1.5.1.2. Wer war Rouget de Lisle?
5.1.5.1.3. Fabelanalyse und Erzählsituation
5.1.5.1.4. Formanalyse und Geschichtsschreibungsimplikationen
5.1.5.2. „Die Weltminute von Waterloo“
5.1.5.2.1. Zusammenfassung und Aufnahme der „Weltminute von Waterloo“ in den Sternstunden
5.1.5.2.2. Wer war Marschall Grouchy?
5.1.5.2.3. Fabelanalyse und Erzählsituation
5.1.5.2.4. Formanalyse und Geschichtsschreibungsimplikationen
5.1.6. Die Sternstunde Deutschlands
5.1.6.1. Die Marienbader Elegie
5.1.6.1.1. Zusammenfassung, zum Titel und zur Aufnahme der Miniatur in den Sternstunden
5.1.6.1.2. Historische Gestalten
5.1.6.1.2.1. Johann Wolfgang von Goethe
5.1.6.1.2.2. Die Frauen
5.1.6.1.2.3. Goethes Freunde und Familie
5.1.6.1.3. Fabelanalyse
5.1.6.1.4. Erzählsituation
5.1.6.1.5. Formanalyse und Geschichtsschreibungsimplikationen
5.1.7. Die Sternstunde der Schweiz
5.1.7.1. „Georg Friedrich Händels Auferstehung“
5.1.7.1.1. Zusammenfassung, zum Titel und zur Aufnahme in den Sternstunden
5.1.7.1.2. Wer war Georg Friedrich Händel?
5.1.7.1.3. Die anderen Figuren
5.1.7.1.4. Fabelanalyse
5.1.7.1.5. Erzählsituation
5.1.7.1.6. Formanalyse und Geschichtsschreibungsimplikationen
5.1.8. Die Sternstunde Italiens
5.1.9. Die Sternstunde von der Türkei
Zusammenfassung
Kapitel 6: Stefan Zweig und die Welt bzw. die Menschheit
6.1. „Sternstunden der Menschheit“: Zwischen Geschichtsschreibung und Gedächtnisarbeit/Gedächtniskonstruktion
6.2. Stefan Zweig und das Abendland
6.2.1. Was das Abendland nicht sein sollte
6.2.2. Zweigs Europas Vorstellungen in „Sternstunden der Menschheit“
6.2.3. Dekonstruktion des zweigschen Abendlandgedächtnisses
6.3. Stefan Zweig und der Rest der Welt: Der Fall Afrikas
Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Widmung
Meinem gleichnamigen Großvater Tonye Kollo Appolinaire
Danksagung
An dieser Stelle möchte ich all jenen danken, die mich bei dem Verfassen dieser Arbeit moralisch, geistig und finanziell unterstützt haben.
Meinem Betreuer Dr. Jean Bertrand Miguoué bin ich für die wissenschaftliche Betreuung dieser Arbeit zum herzlichen Dank verpflichtet. Unsere die Entstehung sowie das Zustandebringen dieser Arbeit begleitenden Gespräche bleiben mir zeitlebens in Erinnerung.
Bei Herrn Professor Dr. Joseph Gomsu möchte ich mich bedanken, aus dessen Lehrveranstaltung über „Gedächtnis und Gedächtnistheorie“ ich wichtige Impulse für die Orientierung meiner Arbeit gewonnen habe.
Meinem Meister, dem frühverstorbenen Professor Dr. Alioune Sow, möchte ich auch hier danken, der mich in der Sache Literaturwissenschaft mit großem Interesse und großer Leidenschaft eingeweiht und jahrelang mit Strenge meine Persönlichkeit geschmiedet hat.
Ich danke den FreundInen und KommilitonInnen für das Korrekturlesen und ihre Ratschläge, nämlich Hamadou Nyadao Ngoei Ndinga, Jean Marie Bakaiwé Ngabra, Rayel Hidaya, Aristide Cédric Kana Messeni und Antoine Yannick Enyegue Ayi.
Mein spezieller Dank geht an Julia Alexandrova geb. Popovic, die zu meiner Verfügung Primär-, Sekundärliteratur sowie ihre Übersetzungstalente gestellt hat. Unsere Gespräche und ihre Ratschläge waren auch lehrreich und viel ermutigend für mich.
Bedanken möchte ich mich bei meinen Eltern, Luc Pouhe und Jacky Pulcherie Ngo Tonye, für ihre moralische und finanzielle Hilfe, meinem Bruder Marc Gabriel Pouhe Maa und meinem Neffen Luc Kévin Pouhe, die, bei der Erleichterung meines Stundenplans, mir immer zur Seite gestanden sind, damit ich mich auf meine Arbeit konzentrieren kann. Diese Arbeit gilt also als Belohnung für ihre Sorge und Hilfe.
Daniel Kak, Achille Rodrigue Soh Fomby, Brice Ncharé, Coralie Marlène Ebenye, Guy Stephane Nkou, Marthe Ngo Maa, Philibert Kollol und Paul Thomas Nkoma möchte ich für ihre Ermutigung, ihre moralische Hilfe und ihre facettenreiche Unterstützung danken.
Auch an diejenigen, die hier nicht genannt werden konnten, geht mein herzlicher Dank.
Appolinaire Tonye Kollo Jaunde, im April 2017
Résumé
Le présent travail intitulé « Traitement du passé dans la Littérature : entre historiographie et travail mémoriel à la lumière de « Sternstunden der Menschheit » de Stefan Zweig » s’efforce de montrer comment la littérature participe à l’écriture de l’histoire, au travail mémoriel et comment elle forge l’identité des nations et des peuples. À partir des 14 miniatures qui composent « Sternstunden der Menschheit », nous examinons comment la Littérature, à partir des techniques narratives et d’autres atouts stylistiques, travaille à l’écriture de l’histoire et à la construction d’une mémoire. Au cœur de ce travail sont deux questions : pourquoi et comment la littérature réécrit-elle l’histoire et comment participe- t- elle à la construction et à la déconstruction de la mémoire? Comment et quelle identité réussit-elle à former à partir des moments de l’histoire et des personnages dignes de souvenir qu’elle choisit? L’objectif de ce travail est de légitimer plus que jamais le rôle de la littérature dans les débats historiographiques et mémoriels et de susciter chez le lecteur des œuvres littéraires un tout autre regard sur la littérature qui se trouve bien souvent réduit au simple domaine du rêve et à l’imagination.
À partir des analyses menées sur le texte de l’écrivain autrichien Stefan Zweig, nous avons pu démontrer que le texte littéraire au moyen de sa littérarité et de la narrativité est capable de produire un discours complémentaire et des fois contraire sur l’écriture de l’histoire et la construction de la mémoire -mémoire qu’elle arrive parfois à déconstruire, provoquant ainsi le débat sur la question identitaire. La littérature se positionne donc comme une contre- histoire et une contre-mémoire. Cependant, nous avons pu constater que la littérature elle- même n’arrive pas toujours à se défaire de ses tares héréditaires que sont les penchants idéologiques. C’est ainsi que dans son écriture d’une histoire universelle, Stefan Zweig exclut, car mu par l’idéologie eurocentriste, les aires géographiques comme l’Afrique, l’Asie etc. Une telle écriture non-objective de l’histoire ainsi que de la soi-disant mémoire universelle construite n’a pas été épargnée par notre critique.
Mots clés: Littérature, histoire, historiographie, mémoire, Occident, Afrique, identité, narration.
Abstract
The present work entitled „Dealing with the past in the literature: between historiography and memorywork in the light of the "Sternstunden der Menschheit" of Stefan Zweig” strives to show how literature is involved in the writing of history and in the memorywork and how it forges the identity of nations and peoples. In the 14 miniatures that make up "Sternstunden der Menschheit", we look at how literature, from narrative techniques and other stylistic advantages, works on the writing of history and the construction of a memory. Two questions are at the heart of this work: why and how did literature rewrite history and how is it involved in the construction and deconstruction of memory? How and what kind of identity does it succeed to form using self-chosen historical moments and worthy of remembrance characters? The purpose of this work is to legitimize, more than ever, the role of literature in memorial and historiographical debates and to change the reader’s perception on Literature, which is as often as not assimilated to dream and imagination.
From the analyses conducted on the text of the austrian writer Stefan Zweig, we have been able to demonstrate that the literary text, through its literacy and narrativity, is able to produce complementary and sometimes contrary discourse on the writing of history and the construction of memory -memory that it is sometimes able to deconstruct, thus causing the debate on the question of identity. Literature is therefore positioned as counter-history and counter-memory. However, we have observed that literature itself does not always get rid of its hereditary defects such as ideology. So in his writing of a universal history, Stefan Zweig excludes, because he is driven by the eurocentric ideology, geographical areas such as Africa, Asia etc. Such a subjective writing of history as well the so-called constructed universal memory has not been spared by our critics.
Key words: Literature, History/Story, Historiography, Memory, Occident, Africa, identity, narration.
Kapitel 0: Einleitung
0.1.Motivation und Erkenntnisinteresse
Ich habe mir seit langem die Frage gestellt, wie und ob die Literatur mit Legitimität ein Wort über die Geschichtsschreibung sagen kann. Diese Frage ist wieder akuter in die Ehre gekommen, als ich im 3. Jahrgang an der Universität Jaunde 1 war. In der Tat hatten wir im Laufe jenes akademischen Jahres im Rahmen der Lehrveranstaltung ,,les grands classiques allemands“ gelesen, wie die österreichische Schriftstellerin Ilse Aichinger, mittels des Sammelbandes ,,der Gefesselte“, des Romans ,,die größere Hoffnung, usw., Widerstand gegen den herrschenden politischen Diskurs leistete, der über die Verantwortung Österreichs angesichts der Judenfrage zur Zeit des Zweiten Weltkrieges die Opferthese predigte. Aichingers Literatur konstituierte sich als Gegendiskurs bzw. Gegengeschichtsschreibung dazu und betrieb ebenfalls eine „dekonstruktivistische“ Gedächtnisarbeit (Csaky), indem sie etablierte bzw. bewies, dass Österreich selbstbewusst aus eigenem Willen an dem Holocaust beteiligt war.
Die Tatsache, dass ich eine Abschlussarbeit an der École Normale Supérieure de Yaoundé zu verfassen habe, ist also für mich die Gelegenheit zu sehen, ausgehend von meinen eigenen Forschungen, ob Literatur effizient an Geschichtsschreibung und Gedächtniskonstruktion irgendwelchen Anteil hat und wodurch sich dieser Anteil auszeichnet.
0.2.Thema und Darstellung des Korpus
Die Formulierung des Themas lautet: Vergangenheitsaufarbeitung in der Literatur: Zwischen Geschichtsschreibung und Gedächtnisarbeit. Eine Untersuchung am Beispiel von Stefan Zweigs ,, Sternstunden der Menschheit “. Stefan Zweig ist weltweit bekannt für seine historischen bzw. biographischen Texte. Es ist daher kein Zufall, dass ich mich im Rahmen dieser Arbeit auf Texte dieses Autors stütze.
„Sternstunden der Menschheit“ ist ein Sammelband von historischen Essays, ,,Prosastücken“ oder ,,Miniaturen“1, die die wichtigsten, erinnerungswürdigen Momente der Entdeckungs-, Erfindungs- und Schaffungsgeschichte der ,,Menschheit“ wieder- bzw. neu- oder aber nacherzählen: Von der Entdeckung des pazifischen Ozeans über die Erfindung des Telegraphs bis zur Entdeckung des Südpols. Für diese Arbeit bediene ich mich hauptsächlich, wegen ihres textimmanenzfördernden Charakters, der aus 12 Miniaturen bestehenden zweiten deutschen Ausgabe der „Sternstunden der Menschheit“ erschienen in Russland bei Kapo im Jahre 2012. Daneben benutze ich die sich aus 14 Miniaturen zusammensetzenden dritte Fassung der „Sternstunden der Menschheit“ erschienen bei S. Fischer2, wo die zwei erweiterten Miniaturen nämlich „Cicero“ und „Wilson versagt“ vorzufinden sind.
0.3.Problematik und Hypothesen
Meiner Abschlussarbeit liegen einige Forschungsfragen zugrunde:
- In welcher Beziehung stehen Zweigs Texte zu der Geschichtsschreibung bzw. der Gedächtniskonstruktion?
- Warum und wie stellt er die Vergangenheit -Gegenwart- Überbrückung an?
- Warum wird nur an bestimmte historische Persönlichkeiten bzw. Ereignisse erinnert?
- Wie erzählt Zweig die Geschichte wieder bzw. neu?
Auf diese Fragen habe ich folgende provisorische Antworte formuliert:
- Zweigs Texte haben mit Geschichtsschreibung und Gedächtniskonstruktionsarbeit zu tun, denn er erzählt in seinen „Miniaturen“ die Geschichte von historischen Gestalten wieder, die die „Weltgeschichte“ in einer ausschlaggebenden Weise geprägt haben. Das Menschheitsgedächtnis, wenn es so etwas gibt, ist demzufolge mit diesen Namen und Ereignissen allein verbunden.
- Stefan Zweigs fünf (05) erste „Miniaturen“ der 1. Auflage seiner „Sternstunden der Menschheit“ wurden vor Hitlers Machtergreifung veröffentlicht. Stefan Zweig ist von der Idee der Kontinuität der Geschichte überzeugt und ruft diese Erschlagene wieder, um zu beweisen, dass jeglicher Kampf des Individuums gegen die politische Maschine bzw. die soziale Gruppe umsonst ist, deswegen hat er Österreich, ohne zu kämpfen, verlassen und letztendlich in Brasilien sich das Leben genommen.
- Zweig wählt historische Gestalten aus, die sehr berühmt geworden sind. Sie haben alle gemeinsam, dass sie trotz ihrer Größe und Repräsentativität Erschlagene sind. Die haben wertvolles erreicht, aber die Geschichte hat sie nicht bzw. unwürdig geehrt. Sie hat sie eher in Vergessenheit fallen lassen. Zweig nimmt sie als Referenzen, als Beweis für die Tatsache, dass das Individuum der Gruppe immer unterworfen bleibt, aber trotzdem als Erniedrigte seine Würde beibehält. Diese Ereignisse bzw. Gestalten helfen ihm dazu, die Geschichtsschreibung der Geschichtswissenschaft zu kritisieren, da letztere ihren (Geschichts)Machern nicht so viel Ehre verleiht.
- Zweig erzählt die Geschichte wieder bzw. neu ausgehend von historischen Quellen; die Erzählstruktur seiner Texte hat eine pyramidale Form, die Erzählperspektive bzw. -situation sind nicht die eines Beobachters bzw. bloßen Wiedererzählers allein. Es gibt einen impliziten kritischen Diskurs, der in der Erzählstruktur steckt, sodass die Geschichte, die am Ende daraus entsteht, keine bloße Wiedergabe von dem ist, was er den historischen Quellen aufgeschnappt hat, sondern eine Erzählung aus seiner Perspektive, mit philosophischen Einstellungen mitunter.
0.4.Ziele der Arbeit
Ziel dieser Arbeit ist es, zunächst einmal die Eigenart der Literaturauseinandersetzung mit Geschichtstatsachen am Beispiel Stefan Zweigs Text zu eruieren. Das zweite Ziel ist es, zu zeigen, wie Stefan Zweigs Text an der Konstruktion eines europäischen Gedächtnisses und somit einer europäischen Identität beteiligt ist, indem er vergangene Ereignisse und Gestalten appräsentiert und ihnen neue Bedeutungen zuschreibt. Diese zweite Seite der Arbeit ist insofern wichtig, als wissenschaftliche Beiträge auf dem Gebiet der Gedächtnisforschung, zumindest was „Sternstunden der Menschheit“ anbelangt, quasi nicht vorhanden sind. Ein anderes Ziel besteht darin zu zeigen, dass „Sternstunden der Menschheit“ ein Zugeständnis von Stefan Zweigs Nivellierungsansprüchen ist.
0.5.Stand der Forschung
Sara Vorwalder hat 2012 an der Universität Wien eine Diplomarbeit vorgelegt und verteidigt zum Thema: „Geschichte(n) erzählen: Montage als Form der Geschichtsschreibung bei Walter Benjamin und Jean- Luc Godard“. In dieser Arbeit führte sie eine inhaltsreiche Diskussion über Benjamins Geschichtsphilosophie, die sich wiederum in der Geschichtsschreibungs- und Gedächtnisforschungsdiskussion von großem Interesse erweisen kann (siehe Kapitel 2 ihrer Diplomarbeit). Benjamin, nicht aus denselben Gründen wie Stefan Zweig, entscheidet sich für „Ausgeschlossene, Vergessene und Besiegte“, die in der Geschichtsschreibung genauso wie in der Gedächtniskonstruktion ihr Wort selbst nicht tragen können: Er ist Anhänger des historischen Materialismus. An dem Historismus kritisiert Benjamin seine selbstproklamierte Objektivität, die Teleologie und die Idee des Vorhandenseins einer Universalphilosophie (wie es in der Hegelschen Philosophie zu lesen gibt)3. Die Technik des Eingedenkens kann die „Zeit erlösen“. D.h. Vergessene bzw. Erniedrigte verlebendigen, Abgeschlossenes zu Unabgeschlossenem machen oder umgekehrt und die Bewusstmachung der Determiniertheit der Gegenwart durch die Vergangenheit vollziehen. Noch aufschlussreicher in dieser Arbeit ist die Benjamins Unterscheidung zwischen dem Historiker (dem Schreiber der Geschichte) und dem Chronisten (dem Geschichts-Erzähler). Während der Historiker, so Vorwalder, den Anspruch darauf erhebt, ein „Gesamtbild der Geschichte“ durch „vermeintlich wichtige Punkte der Vergangenheit“ zu zeichnen, erzählt der Chronist die Geschichte aus einem „subjektiven“4 Standpunkt. Aus dieser Unterscheidung Benjamins sei Zweig Historiker mit der Seele eines Chronisten.5
Die aktuellste wissenschaftliche Publikation „Sternstunden der Menschheit“ betreffend entkommt der Universität Masaryk in der Tschechischen Republik. In ihrer Diplomarbeit betitelt „Stefan Zweig: Sternstunden der Menschheit“ (2014) interessiert sich Michaela Slaná für eine einfache, nicht theoriegeladene Analyse des Textes. In der Tat lässt sich die Kandidatin sehr leicht von der von Zweig im Vorwort jenes Werkes angekündigten ,Nichtverfärbung‘ der Geschichte überzeugen. Diese Übereinstimmung mit Zweig lenkt bzw. bedingt dann ihre ganze Arbeit, die in drei (03) Momente strukturiert ist. Im ersten Kapitel bietet sie eine kurze Biographie Stefan Zweigs und wichtige allgemeine Merkmale seiner Texte dar. Im zweiten Kapitel werden ein paar Begriffe, nämlich „Essay“6, „Miniatur“ und „Sternstunden“ definiert. Nebenbei (Kapitel 2) examiniert sie die Erzählperspektive in „Sternstunden der Menschheit“ und fasst die 14 Miniaturen in einem höchstens zweizeilenlangen Satz zusammen. Im Kapitel 3 nimmt sie eine thematische Gruppierung der einzelnen Miniaturen sowie ihr Vergleich angesichts stilistischer Elemente vor. Diese Arbeit kränkt an ihrer Oberflächlichkeit und Naivität. Wie kann eine Geschichte ohne ,Erfindung‘ und ,Verfärbung‘ erzählt werden? M. E. erzählt Zweig die Geschichte aus einer subjektiven, z. T. (sehr) kritischen Perspektive. Da sind die Prämissen meiner Arbeitsperspektive.
In ihrem Artikel „Stefan Zweig ou ,l’esprit de l’Europe'“ bestimmt Ariane Charton (2012), die die Tatsache bedauert, dass Stefan Zweig in der Gestalt „le suicidé de l’Europe“ und nicht „le penseur de l’Europe“ berühmt geworden ist, Zweig als ein ,großer Europäer' („grand européen“), der aufgrund seiner „extremen Empathie“ (extrême empathie) gegenüber dem Schicksal der deportierten Juden und der Kriegsopfer, das ihm unerträglich geworden war, sich das Leben genommen hatte. Die Auswahl für Versager bzw. Erschlagene liege daran, dass Zweig vor seinem Tod wegen seiner Kriegsfronterfahrungen und dank Romain Rolland zu Pazifismus bekehrt wurde. Charton spricht da von „la noblesse du vaincu“. Biographisch gesehen als auch ganz literaturimmanent sei Zweig ein „penseur de l’Europe“. Zu seiner Lebenszeit sei er überall um Europa herum sowie nach Amerika, Indien und Nordafrika gereist. Sein Haus in Kapuzinerberg habe immer im Sommer viele europäische Künstler angelockt bzw. aufgenommen. Auch in der Literatur vor allem in „Sternstunden der Menschheit“, so Charton, entgehe Zweig dieser Logik der Konstruktion des kulturellen Europas nicht (Vgl. S. 52).
Ich bin damit einverstanden, dass Zweig als Europas Denker anerkannt wird und das ist offensichtlich legitim, wenn beobachtet wird, wie sehr seine Texte an der Gedächtnis- bzw. Identitätskonstruktion Europas Anteil haben. Ich bin hingegen gegen die Tatsache, dass Europa als Ersatz bzw. Maßstab für die ganze Menschheit angesehen wird. Anstelle „Sternstunden der Menschheit“ hätte dieser Sammelband „Sternstunden Europas“ bzw. „Sternstunden des Abendlandes“ heißen sollen. Ariane Charton hat den Verdienst, dass sie die Tragweite der Ereignisse bzw. der Heldenkämpfen zumindest am europäischen Boden eingegrenzt hat.
Dieser Stand der Forschung zeugt davon, dass die Stefan Zweig- Forschung, zumindest was „Sternstunden der Menschheit“ anbelangt, Wissenslücke im Bereich der Gedächtnisforschung aufweist.
0.6.Theoretischer Rahmen
Unter den Methoden bzw. Theorien meiner Arbeit tritt an der ersten Stelle den biographischen Ansatz des Positivismus auf. Der Biographismus in der Tat hilft mir dazu, die Auswahl des Zweigs erinnerungswürdigen Momente sowie seine subjektive kritische Perspektive des Erzählens zu erklären.
Die zweite Theorie, auf die Rekurs gemacht wird, ist die Erzähltheorie7. Indem ich textimmanent verfahre, antworte ich auf die Frage des Wie. D.h. wie wird das Erzählte in meiner Primärliteratur dargestellt? Diese Analyse, dank der Kategorien Zeit, Erzähltechnik und unter Berücksichtigung der Erzählsituation, ist bestrebt, die Eigenart der Literaturgeschichtsschreibung und Gedächtnisnarrative ans Licht zu bringen.
Die Psychoanalyse findet auch innerhalb dieser Arbeit Anwendung, aber nicht in einer so großen theoriegeladenen Form, damit Charakterzüge bzw. das Porträt der historischen Gestalten, die sehr oft kritisiert werden, ans Licht gebracht werden. Das Psychologische der Figuren fällt hier ins Gewicht, denn fast alle Stefan Zweig- Forscher bzw. -Leser stimmen darüber überein, dass Zweig in seinen historischen Essays bzw. Biographien das Psychologische zuungunsten des Geschichtlichen privilegiert.
Gedächtnistheorie und Ideologiekritik: Ich habe vor, mich an Jan und Aleida Assman und Moritz Csaky anzulehnen. Kategorien wie Gedächtnisort, „Enttemtorialisierung und Glokalisierung des Gedächtnisses“, Funktion des Gedächtnisses, Vergangenheit-GegenwartZukunft-Verhältnis, Konstruktion und Dekonstruktion von Gedächtnisorten sind für diese Untersuchung relevant. Dieser Theorie wird einen umfangreichen Platz in meiner Arbeit zugeschrieben. Erst dadurch wird letztendlich klar, weshalb Zweig sich an bestimmte Persönlichkeiten erinnert, aus welchen Inhalten sich das entterritorialisierte Menschheitsgedächtnis zusammensetzt und wie der Leser dieses Gedächtnis dekonstruieren kann. An Zweig kritisiere ich den Eurozentrismus, wobei festgestellt wird, dass er dazu neigt, die Welt auf Europa zu begrenzen8.
0.7.Gliederung der Arbeit
Die Arbeit setzt sich aus zwei (02) Teilen zusammen. Der erste Teil befasst sich mit theoretischen Grundlagen. Er beinhaltet drei (03) Kapitel, in denen abwechselnd auf die Bestimmung der in der Themaformulierung auftretenden Begriffe und deren Kollokationen (Kapitel 1), das Verhältnis zwischen Geschichte und Gedächtnis, Literatur und Geschichte, Literatur und Gedächtnis (Kapitel 2) und das Ineinanderverschmolzensein von Literatur, Geschichte und Gedächtnis (Kapitel 3) eingegangen wird. Der zweite Teil ist der Werk- bzw. Textanalyse gewidmet. Dieser Teil fängt mit Zweigs Biographie an und die Bestimmung von wichtigen Kategorien der Analyse (Kapitel 4). Im Anschluss daran werden im 5. Kapitel Zweigs Miniaturen immanenterweise analysiert bzw. interpretiert. Im 6. Kapitel wird zunächst bewiesen, dass Zweigs „Sternstunden der Menschheit“ in der erinnerungshistorischen Literatur beheimatet sind. Darüber hinaus werden aus „Sternstunden der Menschheit“ Kernpunkte des zu entstehenden kulturellen und geistigen Europas heraussortiert und letztendlich die Dekonstruktion des von Zweig konstruierten Europa- bzw. Menschheitsgedächtnisses operiert.
TEIL I: THEORETISCHE GRUNDLAGEN
Kapitel 1: Begriffsbestimmung
In diesem ersten Kapitel werden Begriffe definiert, die in der Themaformulierung auftauchen sowie diejenigen, die ihnen bedeutungsnah sind oder diejenigen, die in Konkurrenz mit ihnen stehen. Indem ich diese Begriffe definiere, decke ich zugleich die unterschiedlichen Konnotationen auf, die sie in der Arbeit tragen werden.
1.1. Vergangenheitsaufarbeitung
Dieses Kompositum besteht aus zwei (02) Begriffen, nämlich Vergangenheit und Aufarbeitung. Die Brockhaus Enzyklopädie (1974) definiert die Vergangenheit als „eine der drei Dimensionen der Zeit“ (S. 496), nämlich das „>Nicht-mehr<“. In der Psychologie ist die Vergangenheit „die im Gedächtnis aufbewahrten Erlebnisse eines Individuums oder einer Gemeinschaft (Nation)“ (ebd., S. 496). Der Begriff Aufarbeitung, so Brockhaus Wahrig (1980), ist ein Synonym für die ,Nachholung‘, die ,Nacharbeitung‘ am Liegenden; für die gründliche Erarbeitung’ von Problemen z. B.; für die ,neue Herrichtung’, die ,Auffrischung’ eines alten Gegenstandes; für die , völlige Verarbeitung eines Materials...’ (Vgl. S. 350). Vergangenheitsaufarbeitung ist daher die Auseinandersetzung mit Vergangenheit.
Dieser Begriff wird noch deutlicher in der Anstellung der Relation zwischen VergangenheitGegenwart und Zukunft explaniert sowie bei der Bestimmung des Literaturbegriffs.
1.2. Die Triade Vergangenheit- Gegenwart-Zukunft
Es gebe in der Gedächtnisforschung, so David Simo (2014), zwei (02) Richtungen, die die kausale Beziehung Vergangenheit-Gegenwart erklären: Den geschichtlichen und den ontogenetischen Ansatz.
Der geschichtliche Ansatz postuliert, Individuen bzw. soziale Gruppen werden von „kulturellen oder ethischen Merkmalen“ beim Denken und Handeln bestimmt. D. h. Menschen reproduzieren in der Gegenwart (bewusst oder nicht), was ihre Ahnen in der Vergangenheit (Familie, ganze Gruppe) übermittelt haben (Hier ist an Bourdieus „Habitus“9 - Begriff zu denken). „Das Gedächtnis ist in dieser Hinsicht die Erinnerung an einen Ursprung und steht in totaler Abhängigkeit von diesem“ (ebd., S. 92). Der geschichtliche Ansatz ist dem normalen Lauf der Geschichte unterworfen: Es sei die Vergangenheit, die die Gegenwart produziere. Diese Idee der „Präexistenz“10, wie sie bei Plato entwickelt wurde, führte Simo zur Anerkennung ,des Schreibens als Erinnerungsarbeit’ (und nicht als „Erfindung und Phantasie“). Die Aufgabe des Schriftstellers bestehe letztendlich darin, bruchstückhafte Erinnerungen „harmonisch zu ordnen“, und sich folglich die Vergangenheit „wieder zu gewinnen“ (ebd., S. 91f.).
Unter Freuds Einfluss postuliert der ontogenetische Ansatz, traumatische Erfahrungen der Vergangenheit, die das Volk oder die soziale Gruppe verdrängt hatte, tauchen in der Gegenwart wieder auf mit ,perversen’ und zerstörerisch negativen Folgen (wenn die Regierungskontrolle scheitert). Aber wenn das , Wiederhochkommen’ des Verdrängten sich problemlos realisiert, da ändern sich das Bild der Vergangenheit und seine Wirkung auf die Gegenwart. Die Vergangenheit kann somit zu Faszinationsort werden; sie wird zu einer „Alternative“ zu einer ,problematischen Gegenwart’. Darüber hinaus kann die Wiederentdeckung bzw. -forschung der Vergangenheit dazu helfen, mit der Darbietung von „Entwicklungsoptionen“ die Gegenwart zu heilen (Kreutzer, 1989, S. 13. zit. nach ebd., S. 94). „Sich erinnern ist demzufolge nicht nur eine retrospektive, sondern eine produktive Tätigkeit“ (Simo, 2014, S. 94). Der ontogenetische Ansatz verfährt konstruktivistisch und vertritt den Standpunkt, dass die Gegenwart die Vergangenheit „konstruiert und gestaltet“, denn die Vergangenheit an sich existiere nicht. Es ist dementsprechend die Rede von „erinnerter Vergangenheit“. Dass die Vergangenheit erinnernd entsteht, macht deutlich, dass das Gedächtnis erinnernd und in der Gegenwart zustande kommt. Diese Idee der Gegenwart, die die Vergangenheit bedingt und erhellt, scheint mittlerweile weit verbreitet zu sein. Italo Svevo bringt sie folgendermaßen zum Ausdruck:
Sie [Die Vergangenheit] verändert sich dauernd, wie das Leben fortschreitet. Teile von ihnen [sic]11, die in Vergessenheit versunken sind, tauchen wieder auf, andere wiederum versinken, weil sie weniger wichtig sind. Die Gegenwart dirigiert die Vergangenheit wie die Mitglieder eines Orchesters. Sie benötigt diese Töne und keine anderen. So erscheint die Vergangenheit bald lang, bald kurz. Bald klingt sie auf, bald verstummt sie. In der Gegenwart wirkt nur jener Teil des vergangenen hinein, der dazu bestimmt ist, sie zu erhellen oder zu verdunkeln (1959, S. 467. zit. nach Csaky, 2004, S. 7f.).
Die Zukunft ihrerseits sei m. E. eine Verlängerung der Gegenwart. Demnach kann die Vergangenheit die Gegenwart vorhersehen, so kann sie die Zukunft bereits antizipieren. Die Zukunft ist von der Gegenwart und vor allem der Vergangenheit bedingt12. Ihre Natur ist nur eine Folge der Vergangenheit-Gegenwart-Dialektik. Erinnern könne man sich aber nicht an künftige Ereignisse. Die Zukunft scheint, denn sie ist weder das Jetzige noch das Vergangene, das passive Moment zu sein. Aber das ist das krasse Gegenteil: Es gibt eine nahe und eine ferne Zukunft. Jede jetzige Handlung visiert das Bessersein des Morgens. Und von diesem Bessersein sind wir stets begleitet und dafür arbeiten wir.
Harald Welzer (2010) meint in diesem Sinne, „Erinnerung dient der Orientierung in einer Gegenwart zu Zwecken künftigen Handelns.“ (S. 22) Für Welzer sei es dem Menschen möglich, sich in die Zukunft zu projizieren, d.h. eine künftige Realität zu antizipieren durch den Gebrauch des „Futurum[s] II“ (Vgl. ebd., S. 22). Sein Artikel „Erinnerungskultur und Zukunftsgedächtnis“ ist somit ein „Plädoyer“ für die Anerkennung des Vorhandenseins des Zukunftsgedächtnisses -da Zukunft ein integrierender Bestandteil der Erinnerung sei- sowie dessen Leistungsvermögen. Dadurch wird klar, dass das Gedächtnis nicht nur einen retrospektiven, sondern einen „prospektiven“13 Charakter hat. Die Zukunft in dem Gedächtnis ist so zentral, dermaßen dass der Rückblick auf die Vergangenheit zum Ziel die ,Gestaltung‘ des Kommenden hat und wenn einer versucht, die Zukunft voranzukommen, ist es, damit sie ihm nicht mehr fremd erscheint bzw. überrascht. Welzer sagt letztendlich: „[...] da der funktionale Überlebenswert des Gedächtnisses von seinem Zukunftsbezug abhängt, ist es die Zukunft, die konstitutiv für das Gedächtnis ist, nicht die Vergangenheit. Die Zukunft macht Vergangenheit erst verstehbar und motiviert Geschichtsbewusstsein“ (ebd. S. 23).
1.3. Literatur
Literatur ist nach der Brockhaus Enzyklopädie (1970) im weitesten Sinne des Wortes: „Die Gesamtheit der schriftlichen Äußerungen des menschlichen Geistes“ und im engeren Sinne „das gesamte schöngeistige Schrifttum“, also Dichtung (S. 513). In der Brockhaus Enzyklopädie sind die Flüchtigkeit sowie die Veränderbarkeit von dem, was unter Literatur zu verstehen ist, hervorgehoben. Die Literatur wird je nach „Epochen, Völkern oder Sachgebiet“ unterschieden. Es ist die Rede namentlich von der Literatur des 17. Jahrhunderts, der Literatur des 18. Jahrhunderts; der englischen Literatur, der kamerunischen Literatur; der Literatursoziologie, der Literaturpsychologie usw. Eine andere Unterscheidung wird zwischen „Nationalliteraturen“ und „Weltliteratur“ hervorgehoben (Vgl. ebd., S. 513). Nun wird auf die begriffliche Annäherung von Fachleuten der Literatur eingegangen.
Bewusst von der Nichtbeantwortung der Frage „was ist Literatur?“14 entscheidet sich Achim Barsch und die Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie anstelle von „Literatur“ eher für „Literaturbegriff“, der hingegen definierbar bzw. typologisierbar ist. Das, was unter dem Literaturbegriff verstanden wird, hängt mit der Epoche und der „sozialen Gruppe“ zusammen (Vgl. Barsch, 2013, S. 455). In der Tat einigt sich eine Soziale Gruppe um eine bestimmte Epoche über das, was unter Literatur zu verstehen ist. Es ist diese „Konventionen“, die die Literarizität, die Produktion sowie die Rezeption eines als „literarisch gehaltenen Texte[s]“ bedingen (Vgl. ebd., S. 455). Im Laufe der Zeit und mit dem einhergehenden Konventionswandel wird ein literarischer Text zu einem nicht-literarischen Text und umgekehrt. Literaturbegriffe sind auch Sache der Literatur schul en und -Strömungen. Auch die Literaturkritik (innere Zensur) ist ein unvermeidlicher Akteur in der Bestimmung von dem, was Literatur ist. Jedermann erinnert sich wohl an den Fall des Literaturpapstes, der berühmteste Literaturkritiker des deutschsprachigen Raumes, Marcel Reich-Ranicki, der am Fernsehen in Livesendungen („Das literarische Quartett“) später gewordene Bestseller mit der Zuschreibung „(das ist) keine Literatur“ etikettierte. Außerhalb des Literatursystems (äußere Zensur) gibt es ebenfalls ,Einflüsse’: Das Politische, ,das Kirchliche’, das Ökonomische versuchen, die Literatur zu domestizieren und ihre Literaturauffassung durchzusetzen. Eine „dreidimensionale“ Typologie der Literaturbegriffe findet sich bei Herbert Grabes (1977, S. 61ff. zit. nach ebd., S. 456). Die erste Dimension ist die der „ontologischen Valenz“. Dadurch wird zwischen „fiktionalen“ und „referentiellen“ Texten unterschieden15. Die zweite Dimension ist die der „epistemologischen Valenz“. Dabei wird zwischen „realistischen“ und „phantastischen“ Texten differenziert16. Die dritte und letzte Dimension interessiert sich für die „ontische“ Valenz der Literatur und somit für die „drei Angaben“ der Literatur (wobei es das Schöne der Literatur ist, das hier ins Gewicht fällt): „Produzent, Werk und Rezipient“. Achim Barsch ist davon überzeugt, dass Herbert Grabes Typologie umfassend ist. Er beteuert diesbezüglich: „In dieses dreidimensionale Schema lassen sich alle Literaturbegriffe einordnen“ (Barsch, 2013, S. 456).
1.4. Geschichtsschreibung
Sie wird definiert als: „Die literarisch, geformte Darstellung vergangener oder zeitgeschichtlicher Ereignisse, Zustände, Gestalten auf Grund der Überlieferung, eigener Erfahrung oder kritischer Forschung (Geschichtswissenschaft)“ (Brockhaus Enzyklopädie, 1969, S. 193f.). In der Geschichtsschreibung seien hauptsächlich 02 Sachen relevant: „Die sachliche Zuverlässigkeit“ der Daten und die „Gestaltungskraft des Geschichtsschreibers“ (ebd., S. 194). Allerdings wie die Literatur ist die Geschichtsschreibung dem Politischen unterworfen, wie es der Fall unter dem Nationalsozialismus war. „Die historische Belletristik“ komme der Geschichtsschreibung zur Hilfe bei der Schreibung von der Geschichte „einzelner Epochen“ (Vgl. ebd., S. 194). Die Geschichte erhebt den Anspruch auf Universalen und in dieser Leistung scheitert sie, deswegen ist sie durch die Literatur („historische Belletristik“) abgelöst. In der Geschichtsschreibung treffen sich Geschichte, Gedächtnis und nicht zuletzt Literatur.
1.5. Geschichte
Sie ist „im weitesten Sinn der zeitliche Ablauf alles an Zeit und Raum gebundenen Geschehens (Erdgeschichte, Naturgeschichte). Im engeren Sinn wird Geschichte nur in Bezug auf den Menschen verstanden, [...]“ (ebd., S. 188). Auch wenn die Geschichte eines Individuums untersucht werden kann, ist es vorrangig vielmehr die Rede von Geschichte eines ,Kollektivums‘. Es ist die Geschichte, die uns zur Bewusstmachung bringt, dass der Mensch nicht das gleiche Wesen bleibt. Die Geschichte ist in drei Momente eingeteilt, nämlich die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft.
In der Literatur aber entstehe die Geschichte, nachdem Ereignisse zu Geschehen gemacht werden und es ist das Geschehen als Produkt der Ereignisfolge, das im Anschluss daran zur Geschichte werde (Vgl. Martinez/Scheffel, 2009, S. 25). Die Geschichte, die dann entsteht, entspricht den Besonderheiten der einzelnen Gattungen -also „witzig, märchenhaft, phantastisch, spannend usw.“ (Klopfer, 2013, S. 304).
In der Literatur bzw. in der Erzähltheorie verliert das Wort Geschichte17 seinen Bezug auf textexterne Wirklichkeit nicht. Bei Tzevan Todorov (1966) ist Geschichte („histoire“): „Eine bestimmte Realität, Ereignisse, die stattgefunden haben, Personen, die, aus dieser Perspektive betrachtet, sich mit solchen aus dem wirklichen Leben vermischen.“ (S. 132. zit. nach Matinez/Sheffel, 2009, S. 23). Der Strukturalist Gérard Genette (1996) definiert die Geschichte („histoire“) als „das Signifikat oder den narrativen Inhalt“ eines Erzähltextes (S. 16. zit. nach ebd., S. 24).
1.6. Geschichtswissenschaft
Sie ist die Wissenschaft, die die Geschichte als Untersuchungsgegenstand hat. Sie arbeitet an Geschichtsquellen. Ihre Aufgabe besteht darin, „alle bezeugten geschichtlichen Tatbestände möglichst genau[18] unbefangen und vollständig festzustellen, und ihre Zusammenhänge, Bedingtheiten und Wirkungen verständlich zu machen“ (Brockhaus Enzyklopädie, 1969, S. 195). Wenn diese Arbeit nach den Wissenschaftlichkeitsregeln betrieben ist, wird die Geschichtsschreibung folgerichtig wissenschaftlich. Die Geschichtswissenschaft und die Schrift (Literatur im weitesten Sinne) sind immer Hand in Hand gegangen. In der Tat arbeiteten von der Antike über das Mittelalter bis in die Neuzeit Historiker gern mit schriftlichen Quellen. Allerdings da die Geschichtswissenschaft davon bewusst ist, dass sie ohne Spezialisierung die Universalgeschichte nicht aufdecken kann, wird sie sich in einzelnen aber sich ergänzenden Bereichen entfalten. Daraus entstehen „Politische Geschichte, Rechtsund Verfassungsgeschichte, Kirchen- und Religionsgeschichte, Kultur- und Geistesgeschichte, Literatur- und Kunstgeschichte, [...]“ (ebd., S. 196). Die historische Methode sei die der Quellenkritik, die darin bestehe, schriftbasierte oder nichtschriftliche Quellen (wie Kunstwerke, Bräuche, Münze usw.) auszubeuten. Es wird also „Echtheit, Entstehungszeit und -ort, Anlaß und Urheber, Abhängigkeit von anderen Quellen, Situationsbedingtheit und Tragweite jedes Zeugnisses und seine Vereinbarkeit mit anderen [ge]prüf[t]...“ (ebd., S. 196). Ziele dieser Quellenkritik seien es, „Erkenntnis“ und „Wahrheit“ hervorzubringen (Vgl. ebd. S. 196).
1.7. Gedächtnis
Nach der Brockhaus Enzyklopädie (1969) bezeichnet der Begriff Gedächtnis:
de[n] Sachverhalt, daß Mensch und Tier einen Teil der Eindrücke, die sie aus ihrer Umwelt empfangen, sich einzuprägen und zu behalten vermögen und daß diese Eindrücke später wieder bewußt werden oder für die gegenwart nutzbar gemacht werden können (S.5).
Darüber hinaus setzt sich das Gedächtnis aus dem „ Gekonnten“, „ Gewußten“ und „ Erlebten“ zusammen. Das Gedächtnis, so die Brockhaus Enzyklopädie weiter, ließe sich auch angesichts seiner „Aspekte“ bestimmen. Es wird zwischen: Dem „ intentionalen Aspekt“ (das, was erlebt bzw. gespeichert wurde, wird mit neuartigen Emotionen erlebt) und dem „funktionalen Aspekt“ unterschieden. Das Gedächtnis zeichnet sich durch seine Speicherkapazität aus und das ist hauptsächlich seine bekannteste Rolle (Gedächtnis als „Speicher“). Aber da sein Umfang „begrenzt“ ist, wählt sich das Gedächtnis seine Inhalte, die also erinnerungswürdig sind, aus. Darum ist es ein „Selektor“. Diese ausgewählten Inhalte werden nicht nur ,selektiert‘, sondern auch ,modifiziert‘ (Gedächtnis ist ein „Modifikator“). Diese Modifikation ist Modifikationsprinzipien unterworfen u.a. dem „Prinzip der Energie- und Speicherplatzersparnis“, dem „Prinzip der Widerspruchsvermeidung und Erkenntnispräzisierung“[19] (ebd ., S. 5). Bei der Einspeicherung oder im Gedächtnis verwandeln sich Inhalte (das „Unübliche“ wird zum „Üblicheren“ und unwichtige Dinge zu wichtigen Dingen). Ein anderes Prinzip ist das Prinzip der „Konstanthaltung des psychodynamischen Gleichgewichts“[20]. Dies besagt, dass >tabuierte< bzw. zum Schweigen gezwungene Gedächtnisinhalte seltener als diejenigen Inhalte, die im Einklang mit unserer Persönlichkeit stehen, hochkommen. Damit die eingespeicherte Information in dem Gedächtnis auf Lebenszeit beibehalten wird, setzt sie von dem Ultrakurzzeitgedächtnis, über die Kurzzeitgedächtnis bis zu dem Langzeitgedächtnis über (Vgl. Meyers Großes Standard Lexikon, 1982, S. 703).
Es wird unter folgenden Formen des Gedächtnisses unterschieden (Simo, 2014, S. 97):
- „Nach dem Träger: Individuelles, kommunikatives und kulturelles Gedächtnis
- Nach dem Modus: Erlebtes und archiviertes Gedächtnis
- Nach dem Medium: Ritualisiertes, schriftliches, und elektronisches Gedächtnis
- Nach dem Erscheinungsort: Körpergeschichtliches und externalistisches Gedächtnis
- Nach dem Bezug zu Totengedenken: Nachruhm und historische Erinnerung
- Nach der Verfasstheit: Latenz-, Funktions- und Speichergedächtnis
- Nach dem Ziel: ,Heiße‘, ,kalte‘ Erinnerung“
Bezüglich der Funktionen des Gedächtnisses werden drei (03) Hauptfunktionen anerkannt (ebd., S. 95f.):
- „Therapeutische Funktion“: Um psychologische/psychischen Traumas zu heilen bzw. aufzuarbeiten
- „Ethische Funktion“: Es gibt historische Geschehnisse, die dem kollektiven Gedächtnis zugehörig sind, weil sie „nicht vergessen werden dürfen“. Paul Ricœur am Beispiel der Shoah spricht von « juste mémoire » (ou mémoire juste). Wenn Menschen über ihre Vergangenheit erhellt sind, dann werden sie im Denken sowie im Handeln „gerechter“ (Vgl. Simo, ebd. S. 95f.).
- „Identitätsstiftung“: Die ist die populärste Funktion in den Kulturwissenschaften und Literaturwissenschaft. Wenn das Individuum im Einklang mit seinem Gedächtnis ist, wird es ihm klar, wer er ist und wie er sein Leben lenken kann. Simo (2014) meint: die kulturelle Gedächtnisarbeit ist also eine Grenzarbeit, eine Arbeit, die Grenze zieht und Differenzen sichtbar macht. [...] Das kulturelle Gedächtnis hat also eine Geschichte, und diese geschichte ist die geschichte der abgrenzung von anderen kulturen (S. 96).
Gedächtnisarbeit ist ein Synonym für Gedächtnis(de)konstruktion und an Gedächtnis(de)konstruktion arbeiten, bedeutet wiederum an Identitätsstiftung arbeiten.
Ein anderer Begriff, der in Konkurrenz mit dem Begriff Gedächtnis tritt, ist die Erinnerung.
1.8. Erinnerung
Im Allgemeinen verweist der Begriff Erinnerung auf: „die Fähigkeit, Erlebnisinhalte der Vergangenheit [.] wieder bewußt werden zu lassen“. Die Erinnerung also taucht „beabsichtigt oder planmäßig“ oder „unwillkürlich“ auf (Brockhaus Enzyklopädie, 1968, S. 667). Ist die Erinnerung im Allgemeinen eine „Fähigkeit“, eine „Funktion des Gedächtnisses“ (so die Brockhaus Enzyklopädie), so ist sie in der Psychologie das „ Bewußtwerden21 und insbes. aktives Insbewußtseinheben von im Gedächtnis gespeicherten Wahrnehmungen, Erlebnissen, Vorgängen und Bedeutungen“ (Meyers Großes Standard Lexikon, 1982, S. 555).
Moritz Csaky kommt noch auf den Unterschied zwischen Gedächtnis und Erinnerung zurück. Für diesen Gedächtnistheoretiker kann der Unterschied auf folgender Ebene situiert werden: „Erinnerung ist ein dynamischer Vorgang, durch den Gedächtnis, das heißt die Inhalte, derer man sich erinnert, aktualisiert und Vergangenes angeeignet wird“ (Csaky, 2004, S. 8). Eine andere Differenz ist, dass Gedächtnis und Erinnerung ein Vor- und Nachzeitigkeitsverhältnis unterhalten. Zuzüglich der Tatsache, dass nur an das tatsächliche ,Erlebte’ bzw. ,Wahrgenommene’ erinnert werden kann, sind die in der Vergangenheit eingespeicherten Inhalte des Gedächtnisses nur in der Gegenwart oder zumindest in einer näheren Vergangenheit zu aktivieren. Für Siegfried J. Schmidt (2013) ist das Gedächtnis „eine neuronale Funktion“ und Erinnerung „eine kognitiv-psychische Konstruktion, die bewusst werden muss und dann sprachlich formuliert werden kann“ (S. 252). Es sei, so Schmidt, die Erinnerung, die die Vergangenheit ,konstruiere’ oder ihr eine „Identität“ zuschreibe (Vgl. ebd., S. 252). An dieser Stelle soll hervorgehoben werden, was unter Erinnerung en zu verstehen ist. Erinnerung im Plural ist kein Vorgang, keine Fähigkeit mehr, sondern etwas, was vorhanden ist. Erinnerung en seien also Vergangenheitsrepräsentationen. Die seien einem Individuum eigen oder innerhalb einer Gruppe akzeptiert und tradiert (Vgl. Lavabre, 2000, S. 52). Erinnerung en sind m. E. Gedächtnisinhalte.
Die Erinnerung erfüllt aber zahlreiche Funktionen. Für Jan Assmann zum Beispiel - in Anlehnung an Nietzsche (1960) - ist Erinnern das, was das Individuum zu Menschen bzw. Mitmenschen macht. Der Mensch wird ein sozialer Mensch bzw. ein Kulturmensch, erst weil er sich erinnern kann. Die Erinnerung ist für die Weitergabe von Werten wie „Dankbarkeit, Vergeltung, Verantwortung, Solidarität, Gemeinsinn, Recht und Gerechtigkeit“ (Jan Assmann, 1995, S. 53) zuständig und sie moralisiert folgerichtig die soziale Gruppe. Diesbezüglich sagt Jan Assmann (1995):
Gedächtnis braucht, wer sich verpflichten muß, wer sich bindet. Erinnerung vermittelt Zugehörigkeit, man erinnert sich, um dazugehören zu können, und diese Erinnerung hat verpflichtenden Charakter. Wir können sie daher die normative Erinnerung nennen. Die normative erinnerung vermittelt die einzelne identität und zugehörigkeit (S. 52).
Neben dieser „normativen Erinnerung“ unterscheidet auch Jan Assmann eine „zwanghafte Erinnerung“ und diesmal bei Freud22, der sie in der Religion verortet (Vgl. ebd. S. 62ff.).
Die Erinnerung, zumal sie erzählt wird, hat auch eine Befreiungsfunktion: Das Individuum äußert, erzählt von seinem Trauma, von dem, was es hantiert. Eine Art Katharsis ist die mündliche bzw. schriftliche Erzählung von Traumata, schmerzhaften und peinlichen Erfahrungen in dem Sinne, dass wenn einer davon erzählt, fällt ihm ein Stein vom Herzen, er erlebt eine Verhärtung, die ihm ermöglicht, mit dem peinlichen bzw. traumatisierenden Ereignis zu leben.
Eine andere Kategorie, die dem Kreis der „Grammatik“ der Gedächtnistheorie gehört, ist die des Vergessens.
1.9. Vergessen
Das Vergessen wird immer der Erinnerungsfähigkeit23 entgegengesetzt, deren „entgegengesetzter Pol“24 (Brockhaus Enzyklopädie, 1968 S. 667) sie ausmacht. Informationsverlust bzw. Vergessen hängt mit der Größe der zeitlichen Distanz zwischen der Gegenwartssituation und der erinnerten Vergangenheit zusammen. Es hängt auch mit der Natur des Inhalts („sinnarm“, „unwichtig“ oder „umfangreich“) und schließlich mit der „Art und Anzahl der [der Einspeicherung darauffolgenden] Eindrücke“ zusammen (Meyers Großes Standard Lexikon, 1982, S. 703). Vergessen kann bei der „Einprägung“, „während der Speicherung“ und bei der „Entspeicherung (Reaktivierung)“ vorkommen (Brockhaus Enzyklopädie, 1969, S. 5). Für Nietzsche (zit. nach Assmann, 2006, S. 36f.) sei das Vergessen eine Voraussetzung für die Glückseligkeit25, denn seines Erachtens reime sich ausgefülltes Gedächtnis auf ,Identitätsverlust‘.
Aber bei Aleida Assmann, die Gemäßigte, heißt vergessen nicht ein für alle Mal vergessen bzw. verloren. In ihrer Unterscheidung von Speicher- und Funktionsgedächtnis bestimmt sie das Vergessen als: „ein latentes Gedächtnis, zu dem wir das Kennwort [für einen Augenblick] verloren haben“26 (Assmann, 2006, S. 55). Aleida Assmann sieht das Vergessen nicht nur als eine „Normalität“, sondern als eine „kulturelle Strategie“ an27, denn jede Kultur verfügt über „Versicherungssysteme“28, die für die Auswahl bzw. die Zensur von bestimmten erinnerungswürdigen Inhalten zuständig sind. Nach einem Paradigmenwechsel allerdings können erinnerungsunwürdige Inhalte zu erinnerungswürdigen werden. Dies kommt nicht selten in dem nationalen Gedächtnis vor. Dieses Hand- in -Hand-Gehen vom Vergessen29 und Erinnern sowie die dazu entwickelten Strategien kommen zum Ausdruck in diesem scheinbar banalen aber tiefgreifenden zusammenfassenden Satz Simos: „Sich an manche Ereignisse und Personen [...] erinnern, bedeutet immer, andere [...] vergessen“ (Simo, 2014, S. 91).
Zwischenfazit
Dieses Kapitel zeigt vieles: Zum einen, dass die begrifflich angenäherten Begriffe schwer zu definieren sind, weil sie andere Konzepte evozieren, von denen eine Abgrenzung unerlässlich war. Es erweist sich zum zweiten, dass sowohl Geschichtswissenschaft als auch Literatur die Geschichte als Gegenstand haben und drittens, dass Geschichte und Gedächtnis bzw. Erinnerung von großer Bedeutung sind bei der Stabilisierung und dem Fortbestand der Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft-Brücke. Im Folgenden setzt sich die Diskussion fort. Diesmal, indem Verhältnisse unter den Kernkategorien der Arbeit ans Licht gebracht werden.
Kapitel 2: Literatur-Geschichte-Gedächtnis: Verhältnis unter den Kernkategorien
In diesem Kapitel wird abwechselnd das Verhältnis zwischen Gedächtnis und Geschichte, Literatur und Geschichte, Literatur und Gedächtnis und letztendlich Literatur, Geschichte und Gedächtnis examiniert. Ziel dieses Kapitel ist es, zu beobachten, wie diese Hauptkategorien der Arbeit umkehren und wie letztendlich Geschichte und Gedächtnis in der Literatur ineinander verschmolzen sind.
2.1. Gedächtnis und/gegen/mit Geschichte
2.1.1. Geschichte und Gedächtnis im Laufe der Zeit
2.1.1.1. Von der Antike bis in die Neuzeit
Bevor die Geschichtswissenschaft sich im 19. Jahrhundert als Wissenschaft etablierte,30 gingen Geschichte und Gedächtnis Hand in Hand.
In der Antike griffen Gedächtnis und Geschichte ineinander: „Alle frühen Formen von Geschichtsschreibung“ galten als ,Erinnerungsformen‘ bzw. ,Gedächtnisbewahrung‘ und die erstrangige Funktion der Historiographie lag in der „Geschichts- bzw. Vergangenheitspolitik“, also die Schaffung bzw. Konstruktion einer Vergangenheit oder eines Gedächtnisses, die oder das den „Interessen“ der Herrschenden dienen sowie ihre politische Legitimität gründen sollte (Vgl. Assmann, 2006, S. 44). Auch bei Herodot, der Grundvater der Geschichte, ist die Geschichtsschreibung eine „Gedächtnisübung“; die Historie übernimmt demzufolge eine „Memorialfunktion“31, wobei jedoch Gedächtnis -im Gegensatz zu Geschichte, die universal ist- mit „Ruhm“ und Identitätsstiftung einer Volksentität kollaboriert (Vgl. ebd., S. 45).
2.1.1.2. Das 19. Jahrhundert
Im 19. Jahrhundert tauchen Geschichte und Gedächtnis als getrennte Wissensbereiche vor allem auf, weil die Geschichte (als Wissenschaft) Ansprüche auf Objektivität, Wahrheit und Universalität erhob.
Auch wenn es prinzipiell diese Trennlinie zwischen der sich objektiv wollenden Geschichtswissenschaft des 19. Jahrhunderts und dem Gedächtnis gibt, ist es bis hierin nicht ausgeschlossen, dass sie nebenbei eine identitätsstiftende Funktion übernehmen kann. Denn auch Historiker von Beruf sind „Bindungen, Loyalitäten, Vorurteilen“ o. Ä. unterworfen (ebd., S. 47). Dennoch können sie an der Identitätsbildung einer Gruppe Teil haben, ohne dass ihr „Objektivitätsideal“ daran krankt: Wenn sie davon bewusst sind, dass am Eigenen arbeiten, heißt mit Vorurteilen umgehen, damit letztere nicht das Übergewicht ergreifen. „Historie, so Aleida Assmann, wurde im 19. Jahrhundert [...] weithin zur Grundlage kollektiver Identitätsbildung, sie vermittelte und verstärkte das Gefühl der Zugehörigkeit“ (ebd., S. 47). Diese Komplementarität von Geschichte und Gedächtnis ist noch an die Oberfläche gekommen, wenn es darum ging, die Geschichte des Holocausts zu schreiben.
2.1.1.3. „Geschichte und Gedächtnis nach 1945: Am Beispiel des Holocaust“
Nach 1980 wurde eine „Annäherung“ zwischen Geschichte und Gedächtnis festgehalten. Gedächtnis, zumindest das individuelle Gedächtnis (Zeitzeuge, Opfer), bot sich als Ergänzung bzw. Gegendiskurs zum Siegerdiskurs an, der in Geschichtsbüchern lange Zeit dargeboten wurde, um die Totalität dieses facettenreichen und multiperspektivischen historischen Ereignisses zu schreiben (Vgl. ebd., S. 47f.).
Für ein Geschichtsereignis wie den Holocaust ist die Frage nach der Legitimität des Gedächtnisses, aufgrund seines ,transnationalen‘ und ,transgenerationellen‘ Charakters, ein moralisches „Erinnerungsgebot“ (Vgl. ebd., S. 48). In der Behandlung der Holocaust-Frage wurden nicht nur Schriften, sondern auch Zeugnisse der Überlebenden der NS-Grausamkeit von Belang. Die Dissonanz zwischen dem, was in Geschichtsbüchern stand und dem Gesagten der Zeitzeugen machte auf die parteiische Geschichtsschreibung des Holocaust aufmerksam (Vgl. ebd., S. 49).
Das Gedächtnis ergänzt die Geschichtsschreibung in dreifacher Hinsicht durch: „Die Betonung der Dimension der Emotionalität und des individuellen Erlebens“, „die Betonung der memorialen Funktion von Geschichte als Gedächtnis“ und „die Betonung einer ethischen Orientierung“ (ebd., S. 50).
Daher erfüllt, so Aleida Assmann (ebd., S. 50f.), die Geschichtsschreibung drei (03) Funktionen, nämlich „die Memorialfunktion“, „die kritisch aufklärende Funktion“ und „die moralische Funktion“, wobei jedoch die zwei letzteren manchmal Hand in Hand gehen.
Aber „memoriale“ und „moralische Funktion“ bauen eine Brücke zwischen Geschichte und Gedächtnis, während die kritische Funktion sie voneinander abgrenzt bzw. Brüche einsetzt. Wie dieser Teil es am Beispiel des Holocaust deutlich macht, sei es vielmehr die Rede von Gedächtnis, wenn es sich um die dunklen Seiten („les pages noires“) der Nationalgeschichte handelt (Vgl. Lavabre, 2000, S. 51).
Diese diachronische Evolution des Verhältnisses der Geschichte zum Gedächtnis ist diskontinuierlich, in dem Sinne, dass es Zeitspannen gibt, wo Geschichte und Gedächtnis ineinandergreifen und andere, wo sie als Feinde auftreten. Ist diese Beziehung auch in den Augen der Gedächtnistheoretiker heterogen und wechselnd?
2.1.2. Der Standpunkt von einigen Gedächtnistheoretikern
2.1.2.1. Der Standpunkt von Maurice Halbwachs
Für Maurice Halbwachs unterscheiden sich Geschichte und (kollektives) Gedächtnis darin, dass sie unterschiedlich verfahren. Während die Geschichte auf „Differenzen und Diskontinuitäten“ aufmerksam ist, interessiert sich das kollektive Gedächtnis eher für „Ähnlichkeiten und Kontinuitäten“ (Vgl. Halbwachs, 1985b. zitiert nach Assmann, 2007, S. 42f.).
Bei der Unterscheidung zwischen Gruppengedächtnis und Geschichte aber, so Halbwachs, sei es genau das Umgekehrte: Das Gruppengedächtnis sei diesmal fokussiert auf die Differenz bzw. die Eigenart seiner Geschichte im Vergleich zu anderen Gruppengedächtnissen. Die Geschichte aber löst die Differenz zwischen einzelnen historischen Ereignissen auf. Sie nivelliert sie dergestalt, dass sie zueinander vergleichbar und gleichermaßen „wichtig“ werden. Weil sie keinen identitätsstiftenden Bestrebungen diene, sei die Geschichte ,objektiver‘ und ,weniger parteilich’. Für Halbwachs ist „die Historie kein Gedächtnis“, denn wenn die Geschichte universelle Ansprüche habe, sei das Gedächtnis seinerseits einer Gruppe eigen, deren Identität sie anstiftet (Vgl. ebd., S. 43).
Jan Assmann hat vehement Halbwachs vornehmlich bezüglich der sog. Objektivität und der Nichtparteilichkeit des Historikers kritisiert. Diese Unterscheidung scheint in seinen Augen holistisch bzw. idealistisch, zumal jedweder Geschichtsschreiber seiner „Zeit“, den „Interessen“ sowie seinen „Auftraggebern“ verhaftet ist. Letzter Unterschied, so Jan Assmann, ist, die „wissenschaftliche Geschichtsschreibung [gehört] zu den Formen einer „kalten“32 Erinnerung“ (ebd. S. 43).
Trotz dieser Differenzen kann eine gewisse Komplementarität zwischen beiden beobachtet werden.
Gedächtnis und Geschichte stehen in einem Ablösungsverhältnis: „Die Geschichte beginnt im Allgemeinen erst an dem Punkt, wo die Tradition aufhört und sich das soziale Gedächtnis auflöst“33 (Halbwachs, 1985b, S. 103. zit. nach ebd., S. 44). Daher sei die Geschichte dazu verurteilt, ,warten zu müssen’, bis die soziale Gruppe stirbt, damit sie eingreift, um das ZuRettende aus ihrer Existenz nämlich „das Bild und die Abfolge der Fakten“ zu „bewahren“ bzw. „festzulegen“ (Vgl. Assmann, 2006, S. 44).
2.1.2.2. Der Standpunkt von Pierre Nora
Pierre Nora, 60 Jahre nach Halbwachs, kommt wieder auf den Unterschied zwischen Geschichte und Gedächtnis in der Einleitung zu seinem Werk „Les Lieux de mémoire“ (1984, S. 19f. zit. nach Assmann, 2006, S. 44) zurück. Für ihn sind Gedächtnis und Geschichte keine „Synonyme“ überhaupt, sondern „in jeder Hinsicht Gegensätze“. Dieser Unterschied kann auf drei Ebenen situiert werden:
- „Das Gedächtnis ist ein stets aktuelles Phänomen, eine in ewiger Gegenwart erlebte Bindung; die Geschichte hingegen eine Repräsentation der Vergangenheit“
- „Das Gedächtnis rückt die Erinnerung ins Sakrale, die Geschichte vertreibt sie daraus, ihre Sache ist die Entzauberung34 “
- „Das Gedächtnis entwächst einer Gruppe, deren Zusammenhang es stiftet. [...] Die Geschichte dagegen gehört allen und niemandem, so ist sie zum Universalen berufen“.
Zwischenfazit
Zusammenfassend über dieses Unterkapitel kann behalten werden, dass Gedächtnis und Geschichte „als zwei konkurrierende, sich korrigierende und ergänzende Formen des Vergangenheitsbezugs“ (Assmann, 2006, S. 51) zu betrachten sind. Geschichte erkennen manche Geschichtstheoretiker die Identitätsstiftungsfunktion an und Gedächtnisforscher ihrerseits sind davon überzeugt, dass Gedächtnis nichts von den Mängeln der Geschichtswissenschaft hat und folgerichtig diese Letzte „korrigieren“ kann. Diese Interdependenz zwischen Geschichte und Gedächtnis resümiert Aleida Assmann mit folgenden Worten: „Die historische Forschung ist angewiesen auf das Gedächtnis für Bedeutung und Wertorientierung, das Gedächtnis ist angewiesen auf historische Forschung für Verifikation und Korrektur“ (ebd., S. 51).
2.2. Literatur und/gegen/mit Geschichte
Darf nur ein Mann über die Geschichte eines Mannes schreiben? Darf nur ein Jude über Juden schreiben? Nur der Ostler über den Osten? Nur die Deutschen über ihre Geschichte, ihre Teilung, ihre Grenze? Nur das Opfer über Opfer? Nur der Zeitzeuge über seine Zeit? Wer kann, wer darf, wer muss -und wem erteilt wer ein Verbot?“ (Julia Franck, Grenzübergänge. Autoren aus Ost und West erinnern sich, 2009)
2.2.1. Literatur vs. Geschichte
Im Folgenden werden einige Positionen über die Gegenüberstellung zwischen Literatur und Geschichtswissenschaft dargestellt.
2.2.1.1. Der aristotelische Standpunkt
Für Aristoteles (2010) liege nicht die Arbeit des Dichters darin, die wirkliche Geschichte zu repräsentieren, sondern die „mögliche“ Geschichte, die „den Regeln der Wahrscheinlichkeit und der Notwendigkeit“ folgt (Vgl. S. 29). Für Aristoteles ist es klar, dass Dichter und Geschichtsschreiber voneinander unterschiedlich sind. Der Geschichtsschreiber interessiere sich für „das wirklich Geschehene“35, während der Dichter eher einen Akzent auf das „mögliche“ Geschehen36 lege (Vgl. ebd., S. 29)37.
Da die Literatur im Gegensatz zur Geschichtsschreibung keine bloße Wiedergabe der Wirklichkeit macht, kommt Aristoteles zur Konklusion, dass die Dichtung im Vergleich zur Geschichtsschreibung ,philosophischer und ernsthafterer’ (ebd., S. 29) ist, denn sie repräsentiert „das Allgemeine“ und nicht „das Besondere“ bzw. „das Typische“. Das Allgemeine zielt darauf ab, Figuren (obwohl sie Eigennamen tragen) nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit und Notwendigkeit38 handeln zu machen. Das Besondere, indem es sich auf einen historischen Helden fokussiert, fragt nach dem, was der Held in der Geschichte getan hat und was ihm geschehen ist (Vgl. ebd. S. 31). Aristoteles ist davon bewusst, dass der Dichter sich des historischen Materials bedienen kann, aber „er ist also, auch wenn er wirklich Geschehenes dichterisch behandelt, um nichts weniger Dichter“ (ebd., S. 32).
Der Vorteil des Erfindens der Geschehnisse ist, dass es zum Vergnügen bereitet. Zwar lässt sich der Dichter von überlieferten Quellen inspirieren, aber es wäre „lächerlich“ für den Leser, dass er sich auf dieses zurückgelassene Material beschränkt, denn im Gegenteil zu dem, was man denkt, ist das Bekannte nur wenigen Leuten bekannt und daher bereitet das Lesen von dichterisch bearbeiteten historischen Quellen allen (mehr) Vergnügen (Vgl. ebd. S. 31). Dieses Vergnügen hängt von der Fabel39 und Handlungen der Handelnden ab, die sowie das Erzählte allgemein sind. Wenn es eine alternierende Erzählstruktur gibt, ist die Hervorbringung von Jammer und Schauder möglich.
2.2.1.2. Warum soll man (nicht) an Geschichte glauben?
In seinem Essay „Geschichtswissenschaft“ erschienen zum ersten Mal am 21. Juli 1927 in der Vossischen Zeitung und später in Glossen und Essays (1927) inszeniert Kurt Tucholsky zwei (02) namenlose Protagonisten, die sich über die Frage: „Glauben Sie an Geschichte?“ unterhalten. Der Eine antwortet auf die Frage mit „nein“ und der Andere mit „ja“, wobei sie jeweils Argumente zur Unterstützung ihrer jeweiligen Standpunkte herbeibringen. Dem Einen nach ist an Geschichte nicht zu glauben vorab aufgrund des Verlorengehens von Informationen wegen der räumlichen und zeitlichen Distanz40 (vom Geschehensort bis zum Berichterstattungsort), des Nichtwiederherstellungskönnens einer vergangenen Atmosphäre während der Geschichtsschreibung, der „Sprachimpotenz“41. Die Gestalt des Historikers selbst ist ein anderer Grund, weshalb Geschichte in Misskredit gerät. Da er unter dem Einfluss der Ideologie parteilich nach sog. wichtigen historischen Ereignissen sucht. Der letzte Grund, weshalb an Geschichte nicht zu glauben ist, ist, dass die Zutaten ihrer „Suppe“, nämlich, „die trüben Quellen“, „die Fehler“42, >[di]e Person< des Historikers; >seine Erziehung< (Sozialisation); >seine politischen Ansichten< und >die zufällige bzw. willkürliche Wahl< , die er unter der Quellenmenge trifft, von schlechter Qualität sind und erheben dementsprechend seine Arbeit zu einer ,Richteraufgabe‘ und die Geschichte zu einer „richterlichen“ Gewalt. Nachdem der Nein-Befürworter seine Argumente vorgelegt hat, kommt der für das Stellen der Frage an die Tagesordnung der Diskussion verantwortliche Protagonist nun zu Wort und rechtfertigt, warum er an Geschichte glaubt.
Er reagiert von vornherein auf die an der Geschichte formulierte Kritik. Für ihn seien die beobachteten „Variationen“ unter einzelnen historischen Fakten nur „Nuancen“, Details. Letztere seien „nicht so zahlreich“, weil die Geschichte einen wiederkehrenden Charakter habe und alle historischen Ereignisse fast identisch seien. Des Weiteren akzeptiert der Ja- Befürworter die Pertinenz der Kritik und bricht eine Lanze für Geschichte. Ihm zufolge darf man seitens der Geschichte nach der Wiederherstellung von Vergangenem in der „Atmosphäre“ dieser vergangenen Epoche nicht verlangen, denn „[keine Wissenschaft und] niemand kann das“. Und um die Kritik des Verlorengehens von Informationen zu kontern, sagt er, das „Wesentliche“ der alten Geschichte „ gelte mehr als die Ganzheit“, die niemand behalten kann. Letztes Ende und warum der Ja-Befürworter an Geschichte glaubt, ist dass die Geschichte einzelne historische Ereignisse relationiert und das Zeitkontinuum herstellt. Er sagt diesbezüglich: „Ich glaube an Geschichte, weil jede Epoche lange nicht so neu, so interessant, so einmalig, so grundsätzlich von allen andern verschieden ist, [...] Es verändert sich viel -es ändert sich nichts“. Auf der Suche nach „einem gesunden Kon[sens]“ stimmen die beiden Protagonisten damit überein: „An der Geschichtswissenschaft ist nichts daran, was nicht an ihr dran ist“. Dies besagt, das Leistungsvermögen der Historie soll nicht anderswo gesucht bzw. aufgeschnappt werden, da sie von ihren Stärken und Schwächen lebt. Es sollte nichts Zusätzliches von ihr erwartet werden, (indem sie beispielsweise mit einer anderen Wissenschaft bzw. Kunst verglichen wird).
An welchen anderen Punkten setzen Literatur und Geschichte einander entgegen?
2.2.1.3. Sprache, Objektivität und Publikum als Unterscheidungsstütze
Nina Postiasi (2010) zufolge unterscheiden sich Geschichte (als Wissenschaft) und Literatur in dreifacher Hinsicht, was die verwendete Sprache, das Postulat der Objektivität und die Rezeption ihrer jeweiligen Schriften bei dem Publikum angeht.
Die Sprache und das Erzählen sind gemeinsame Nenner zwischen Literatur und Geschichtswissenschaft. Während geschichtswissenschaftliche historiographische Texte <emplotted>43 seien, zeichnet sich die Literatursprache, die kein bloßes Spiegelbild der äußeren Realität ist, durch „l’effet de réel“ aus. Dadurch meint Roland Barthes (1968) die detaillierte Beschreibung der Figur bzw. das detaillierte Erzählen des historischen Tatbestandes, die bzw. das, selbst wenn das Beschriebene bzw. das Erzählte erfunden ist, die narrative Information bereichert und folgerichtig die Geschichte glaubwürdig macht. (Vgl. S. 88). Zwar wenden Geschichtswissenschaftler „a more formal languages and technical terms [...] describe, explain and concentrate on spécifie aspects“ an (Postiasi, 2010, S. 6), aber Dichter ebenfalls benutzen eine besondere Sprache . Diese Sprache kennt kein Tabu, sie fürchtet nicht die Dissonanz und die Disharmonie. Die sind ihre Waffen zwecks der Gegengeschichtsschreibung bzw. der alternativen Geschichtsschreibung (ebd., S. 5).
Objektivität ist der am weitesten attackierter Aspekt der geschichtswissenschaftlichen Geschichtsschreibung. Während der Dichter seine Subjektivität akzeptiert und sie fruchtbar macht44 -sie hat nämlich eine „schöpferische Kraft“-, kämpft der Geschichtsschreiber seinerseits gegen die Seinige (Vgl. von Humboldt, 1956, S. 100. zit. nach Kim, 2003, S. 18). Postiasi meint diesbezüglich: „Fiction differs from History in not making a claim to truth “45 (S. 336). Darüber hinaus ist Fiktion ein konstitutiver Teil des Wirklichen. Reinhart Koselleck spricht demzufolge von „Fiktion des Faktischen“: Das Vergangene kann nicht wieder erlebt werden und wenn einer es rekonstruiert, sind mehr oder minder Informationen verloren gegangen und somit sind die Lücken46 mit fiktiven Elementen ergänzt (Vgl. Koselleck, 1973, S. 567. zit. nach Ofner, 2004, S.14).
Die Sprache, das Format o. Ä. der Geschichtswissenschaft sowie der Literatur hängen von dem Zielpublikum -, das der Autor immer im Kopf während des Schreibens seiner Texte hat- ab. Der historische Roman -als prägendste Gattung der Domestizierung der Geschichte seitens der Literatur- und dazu alle seine Varianten47 wird so beliebt aufgrund seiner Konstitution. Kenntnisse des erzählten historischen Ereignisses bzw. der dargestellten historischen Gestalt sind nicht vorausgesetzt. Auch wenn die chronologische Kette des Lebens des Hauptprotagonisten beibehalten werden kann, entfallen selten „Privatereignisse“ und „Anekdote“ in historischen Romanen. Die Geschichte an sich wird „desakralisiert“, d.h. den Lesern zugänglich gemacht (Vgl. Huemer, 2010, S. 9). Auch wenn die Literatur sich an das Tatsächliche stützt, geht die Literarizität bzw. das Poetische niemals verloren.48
Vertritt auch Stefan Zweig den Standpunkt der oben diskutierten scharfen Gegenüberstellung zwischen Literatur und Geschichte?
2.2.2. „Geschichte als Dichterin“: Der Standpunkt von Stefan Zweig
Stefan Zweig hat sich für das Verhältnis zwischen Dichtung und Geschichte interessiert. Über Geschichte und Dichtung stellt Zweig eine Differenz an. Bereits in den „Drei Meister“ schreibt er über Balzac: „Die Effekte, die Tatsachen zu messen, bleibt Aufgabe der Geschichtsschreibung, die Ursachen, die Intensitäten freizulegen, scheint für Balzac die des Dichters“ (Zweig, 1999, S. 27. zit. nach Huemer, 2010, S. 26). Stefan Zweig schreibt der
Geschichte bzw. der Historie49 zwei Funktionen zu. Seines Erachtens (1983) ist die Geschichte herkömmlich „Chronistin“ bzw. „Tatsachenreferentin“:
[...] Aber manchmal , genau wie die Natur ohne menschliche Beihilfe oft makellose Kristalle in ihrem Schoße bildet, manchmal treten innerhalb der Geschichte einzelne Episoden, Menschen und Epochen uns entgegen in solcher Höchstspannung, in so dramatischer Fertigbildung, daß sie als Kunstwerk unübertrefflich sind und in ihnen die Geschichte als Dichtung des Weltgeistes, die Dichtung aller Dichter und jeden irdischen Geist beschämt (S. 252f. zit. nach ebd., S. 27).
Auch wenn es nur mitunter geschieht, braucht die Geschichte keinen Dichter, um als Dichterin zu handeln. Und wenn es ihr gelingt, sind ihre „Episoden“, „Epochen“ und historische Gestalten den der Dichtung überlegen.
Allerdings wenn es darum geht die „Weltgeschichte“ zu schreiben, ist die Dichtung bzw. der Dichter diesmal wieder an der Ehre, um diese zum Teil verschollene bzw. seitenleere „Weltgeschichte“ mittels der Fiktionalität zu „ergänzen“. Diesbezüglich sagt Stefan Zweig (1983):
Die Weltgeschichte - führen wir uns dies immer wieder vor Augen - ist ja kein komplettes, ausgedrucktes Buch, das man von Anfang bis zu Ende lesen kann, sondern sie ist ein riesiges Palimpsest, ein zusammengestoppeltes, nein, ein zu neun Zehnteln verdorbenes Manuskript; Hunderte Seiten sind unentzifferbar, Tausende aber verschollen und nur durch Kombination, durch Phantasie in ihrem Zusammenhang zu ergänzen. Diese zahllosen rätselhaften Stellen in der Geschichte müssen natürlich den Dichter zur Ergänzung, zur Erdichtung reizen. Hier wird er versuchen einzugreifen und aus dem Sinn der Geschichte, so wie er ihn begreift, das Fehlende zu erphantasieren, zu kombinieren, also das zu tun, was Michelangelo etwa an einer griechischen Statue getan, indem er versuchte, den fehlenden Arm, das fehlende Haupt aus der Wesensvision der Plastik zu ersetzen. Selbstverständlich sollte das aber der Dichter nur an jenen vieldeutigen Stellen versuchen, wo die Geschichte selbst nicht schon vollendet gedichtet hat, nicht an den eindeutigen, den vollendet klaren (S. 260f. zit. nach ebd., S. 28).
Überraschend ist, dass Stefan Zweig, als Dichter, nicht der Literatur mehr Kredit beimisst. Demgegenüber ist seine Position in dieser Debatte eine Mittelposition. Diese unklare Parteilosigkeit Zweigs verfehlte keine Kritik seitens Klaus Zelewitz (1982):
Er [Stefan Zweig] laviert so ständig geschickt 50 zwischen Forscher und Erzähler und versucht die Balance zwischen Kunst und Wissenschaft zu halten, beides zu beanspruchen und sich dadurch gleichzeitig doch von keiner Seite so recht kritisch fassen zu lassen (S.68. zit. nach ebd., S. 29).
Diese Angst vor der Kritik seitens der Geschichtswissenschaft (und der Literatur) lasse sich, so Huemer, bei Stefan Zweig selbst beobachten - besonders in seinen Biographien- dergestalt, dass er innerhalb seiner Texte Quellen angibt und originale historische „Dokumente“ inkorporiert. Der literarische Wert seiner Texte wird aber transparent durch die „Erzählweise“, die den Reportagestil und den psychologischen Blick kombiniert (Vgl. ebd., S. 28). Aus seiner Lektüre von Zweigs Aufsätze[50]51 gelangt Huemer zur Konklusion, dass die Biographie bei Stefan Zweig „die beste Form der Geschichtsschreibung“ ist und nicht der historische bzw. der biographische Roman (Vgl. ebd., S. 81).
Stefan Zweigs Standpunkt trotz seiner Parteilosigkeit beweist das Aneinandergrenzen zwischen Literatur und Geschichte. Allerdings welcher Umgang existiert wiederum zwischen Literatur und Geschichtsschreibung? Ist er im Rahmen der Synonymie oder der Antonymie zu situieren?
2.2.3. Literatur und Geschichtsschreibung
Es gebe Ansgar Nüninng (2013) zufolge drei (03) Gesichtspunkte, unter denen das Spannungsverhältnis zwischen Literatur und Historiographie verstanden werden kann. Es handelt sich um:
- „Die diachrone Entwicklung des Verhältnisses zwischen Historiographie und Literatur“: Historiographie und Literatur wurden bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts ineinander gewoben. „Geschichtsschreibung wurde an rhetorischen, stilistischen und künstlerischen Qualitäten sowie ihrem moralischen und didaktischen Nutzen gemessen“ (S. 304). Die Lage änderte sich mit dem Aufschwung der sich objektiv bzw. wahr wollenden Geschichtsschreibungspraxis der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Diese Situation verlängerte sich ins 20. Jahrhundert, als die zwei Bereiche sich spezialisierten. Mit der Entstehung von ,hybriden’ Gattungen in der Postmoderne aber kommen noch Historiographie und Literatur zusammen. Es ist somit mittlerweile beispielsweise die Rede von „historiographischer Metafiktion“ (Vgl. ebd., S. 304f.).
- „Die textuellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen literarischen und historiographischen Werken“: Aristoteles gilt als der Erste, der über diese Unterscheidung geschrieben hat (Siehe den Teil 2.2.1.1. „Der aristotelische Standpunkt“ in dieser Abschlussarbeit) und seine Unterscheidung hat lange Zeit geherrscht. Allerdings gibt es „Parallelen“ zwischen Historiographie und Literatur, was die „sprachliche Bedingtheit“, „die Zeichenvermitteltheit“ und die „Konstrukthaftigkeit jeglicher Form von Wirklichkeitserfahrung und Erkenntnis“ angeht (ebd., S. 305). Jene Aspekte sind von „neueren Diskurstheorien“ von dem „Poststrukturalismus“, von dem konstruktivistischen Ansatz’ und schließlich von den „narrativistischen Ansätzen“ an die Oberfläche gebracht (Vgl. ebd., S. 305).
- Versuch der „Nivellierung des Unterschieds zwischen Historiographie und Literatur“: Geschichtstheoretiker (deren Hauptrepräsentant Hayden White ist), die versuchen, diese „enge Verwandtschaft“ zwischen Historiographie und Literatur ans Licht zu bringen, zeigen, wie die Geschichtsschreibung „bei der Anordnung und Darstellung des Materials“ sich von der Literatur (z. B. ihre Stilmittel und Erzählformate bzw.“ - muster“) ernährt52 (Vgl. ebd., S. 305).
Dass Historiographie und Literatur eine „gemeinsame Narrativität“ haben, scheint Nünning reduktionistisch bzw. zu naiv, denn es gebe sowohl in der Historiographie als auch in der Literatur ,Produktions-‘ und ,Rezeptionskonventionen‘. Fiktionale Erzähltexte zeichnen sich durch ihre Erzählstruktur, durch die Nichtgleichsetzung von Autor und Erzähler, durch den Erzählblickwinkel, durch die Polyphonie, durch die Sprachpolysemie etc. aus. Bewusst von diesen Grenzen aber auch von dem Leistungsvermögen der Literatur arbeiten Ansätze wie der New Historicism, die New Cultural History und die Mentalitätsgeschichte an der Legitimierung der Literatur als eine ausbeutungswürdige Quelle der Geschichtsschreibung (Vgl. ebd., S. 305).
Zwischenfazit
Dieses Unterkapitel zeigt, dass es überhaupt nicht einfach ist, eine Grenze zwischen Literatur und Geschichte bzw. Geschichtsschreibung zu ziehen. Historiker werden dazu aufgefordert, dieses herkömmliche Hand-in-Hand-Gehen der Literatur mit Geschichte bzw. Geschichtsschreibung aufrechtzuhalten. Eung-Jun Kim (2003) sagt dazu:
Anders als die Historie, die sich als Wirklichkeitsaussage versteht und die Fiktion ausschließt, erlaubt die dichterische Darstellung der Geschichte die Fiktion. Der Literaturhistoriker zeichnet sich in der literarischen praxis durch eine interaktion von fiktion und realität aus (S. 22).
Im Folgenden wird der Zusammenhang zwischen Literatur und Gedächtnis analysiert.
2.3. Literatur und Gedächtnis („Schreiben als Erinnerungsarbeit“)
Manfred Schmeling (2010) ist der Meinung, dass das Erzählen zu den Erinnerungsformen gehört. Die Erinnerung lässt sich durch die formalen bzw. rhetorischen Mittel des Erzählens gestalten. Er sagt darüber hinaus: „Raconter, c‘est un combat contre l‘oubli, voir [sic]53 un combat contre la mort! “ (S. 26).
In der literaturwissenschaftlichen Beschäftigung mit Gedächtnis (Erll/Nünning, 2005) wird zwischen drei (03) „Grundrichtungen“ unterschieden: „Gedächtnis der Literatur“ (als Symbol- und Sozialsystem), „Gedächtnis in der Literatur“ und „Literatur als Medium des Gedächtnisses“. Im Folgenden wird abwechselnd auf diese drei (03) Grundrichtungen eingegangen.
1.3.1. „Gedächtnis der Literatur“
Diesem Begriff, so Erll und Nünning, verdanken wir Renate Lachmann54 55 (1990, S. 35). Sie meint: „Das Gedächtnis der Literatur ist seine Intertextualität“, denn intertextuelle Bezüge gelten als ,Erinnerungsakte‘. Indem die Literatur auf vorherige „Texte, auf Gattungen, Formen, Strukturen, Symbole und Topoi“ zurückgreift, erfüllt sie eine ,Selbsterinnerungsaufgabe‘55, denn dadurch werden sie ,wiederholt‘ bzw. ,aktualisiert‘ (vgl. Erll/ Nünning, 2005, S. 3). Allerdings kann der Begriff ,Gedächtnis der Literatur’ zweierlei verstanden werden: „ genetivus subjectivus“ („Literatur ,hat‘ ein Gedächtnis“) und „ genetivus objectivus“ („an Literatur wird erinnert“) also „Literatur als Symbolsystem“ und „Literatur als Sozi al system“. ,Gedächtnis der Literatur als Symbolsystem’ gleich „Intertextualität, Topiken und Gattungen“ (ebd., S. 3). Die Erinnerung an Literatur bzw. ,das Gedächtnis der Literatur als Sozialsystem‘ existiert dank disziplinärer und sozialer Praktiken wie „Kanonbildung und Literaturgeschichtsschreibung“56.
1.3.2. „Gedächtnis in der Literatur“
Diese Forschungsrichtung untersucht, wie Erinnerung und Gedächtnis in literarischen Texten ,dargestellt‘ bzw. ,repräsentiert’ werden (Vgl. ebd., S. 4). „Leitfrage ist dabei, mit welchen Verfahren die Inhalte und Funktionsweisen des Gedächtnisses thematisiert und inszeniert werden“ (ebd., S. 4). Während das Konzept ,Gedächtnis der Literatur’ diachron und intertextuell bzw. interkulturell verfährt, ist eher das Konzept ,Gedächtnis in der Literatur’ an „Formen und Strukturen einzelner Werke“ interessiert. Auch wenn es hierin ebenfalls eine gewisse Intertextualität gibt, ist sie synchroner Natur (die Frage lautet: Wie steht der literarische Text zu existierenden „Vergangenheitsversionen“ anderer zeitgenössischer Texte?) (Vgl. ebd., S. 4). In ,Gedächtnis in der Literatur’ ist auch die Frage nach den Formen von Belang. Es stellt sich dementsprechend die Frage zu wissen, welche narrativen Formen bzw. „Gedächtnisnarrativen“ ,erinnerungshaft’ sind. Dabei erfordert die Untersuchung der Formen (und deren Funktionen) das Verfahren des ,close reading’ bzw. eine textimmanente Lektüre.
1.3.3. „Literatur als Medium des Gedächtnisses“
„Bei der Stiftung, Aufzeichnung, Tradierung und Zirkulation von kollektiven Mythen schließlich spielen literarische Texte, Theaterstücke [...] eine herausragende Rolle“ (ebd., S. 7). Die Literatur partizipiert nicht nur an der Gedächtnisformation; sie ist auch in der Gedächtnisdekonstruktion durch Alternativen und „Gegengedächtnisse“ dank fiktionalisierter Effekte involviert. Literatur verfügt über Darbietungsmittel von den ins Gedächtnis eingetretenen Ereignissen wie „ästhetischen, rhetorischen und narrativen Strategien“. Beispiele für diese Darbietungsmittel sind u.a. Personenrede, Erzählhaltung, -perspektive. (Vgl. ebd., S. 7).
Neben den oben erwähnten erzähltheoretischen Merkmalen stehen auch andere Ansätze zur Verfügung, um Literatur als Medium des (kollektiven) Gedächtnisses zu untersuchen. Es handelt sich um: Den interpretativen Ansatz (für Gedächtnisnarrative), diskursgeschichtliche und neohistorische Ansätze, formästhetische und narratologische Ansätze und Rezeptionsästhetische und funktionsgeschichtliche Studien (Vgl. Erll, 2004, S. 125f.).
Zwischenfazit
Die Vergegenständlichung vom Gedächtnis durch Literatur angesichts der analytischen Ansätze macht deutlich, dass es möglich ist, Gedächtnistexte (text)immanent bzw. (text)transzendierend zu analysieren. Aber Errungenschaften der Gedächtnisnarrative bleiben nicht nur in der poetischen Welt wirksam. Die wirken in der objektiven Realität zurück, indem sie an der Gedächtniskonstruktion bzw. -dekonstruktion partizipieren. In dem nachfolgenden Kapitel wird untersucht, wie Geschichte und Gedächtnis in der Literatur zusammenfallen und wie es ihnen wiederum gelingt, die äußere Welt zu beeinflussen.
Kapitel 3: Die Triade Literatur- Geschichte und Gedächtnis: Alles in einem
Wir brauchen jetzt junge Schriftsteller, die das Gedächtnis der Zeugen, das Autobiographische der Zeugnisse, mutig entweihen. Jetzt können Gedächtnis und Zeugnis Literatur werden. (Jorge Semprun, Laudatio auf Norbert Gstrein, 2001).
Das Hand-In-Hand-Gehen der Literatur mit Geschichte und Gedächtnis ist in der erinnerungshistorischen Literaturwissenschaft eruiert worden, die auf Kultur- und Erinnerungsgeschichte fußt.
Erinnerungsgeschichte57 ist ein Zweig der Kulturgeschichte58 und somit ist wiederum erinnerungshistorische Literaturwissenschaft „ein Teilgebiet“ der kulturgeschichtlichen Literaturwissenschaft (Erll, 2004, S. 116), denn „Literatur [ist] ein konstitutiver Teil der Erinnerungskultur“ (ebd., S. 117). Die erinnerungshistorische Literaturwissenschaft beschäftigt sich mit dem ,Historischen‘ und ,Kulturellen’ „des Verhältnisses von Literatur und Erinnerungskultur“. Somit ist sie von großer Bedeutung in der Kulturpoetik und in der langdauernden „Text/Kontext-Diskussion“ (Vgl. ebd., S. 117). Im Folgenden wird in zwei Unterkapiteln untersucht, wie viel Literatur an Erinnerungskultur hat. Die sind: „Das Po(i)etische der Erinnerungskultur“ und „das Erinnerungskulturelle der Literatur“59.
3.1. „Das Po(i)etische der Erinnerungskultur“
Der legitime Platz der Literatur ist längst in der Erinnerungskultur zum Vorschein gebracht worden. Literatur habe demnach, so Erll (2004, S. 117ff.), insgesamt drei (03) erinnerungskulturelle Funktionen:
- „Verdichtungsfunktion“: „Narrationsmuster, sprachliche Bilder und Symbole sind ästhetische Verdichtungsformen“, womit eine „Fülle“ von vergangenen Ereignissen/Erfahrungen zu organisieren, zu harmonisieren, zu strukturieren’ aber vor allem ,prägnant zu kondensieren’ ist. Beispiele von Literaturformen, auf die Rekurs gemacht wird, sind: „Metapher, Metonymie, Synekdoche, Symbolik, Allegorie, und narrative Strukturierung“ (ebd., S. 117) in der Herausbildung (Deutung, Aneignung, Bearbeitung) des kollektiven Gedächtnisses. Diese narrative Strukturierung ist z. B. in der (Auto)biographie und in der Symbolik zu treffen dadurch, dass bestimmte Orte und Ereignisse zu Symbolen einer Volksidentität werden (Vgl. ebd., S. 117).
- „Sinngebungsfunktion“: Die Literatur erfüllt nicht nur die „Verdichtungsfunktion“, sondern die der „Sinngebung und Sinnanreicherung“. Genauso wie in der Literatur sind „in der Erinnerungskultur Formen eigenständige Bedeutungsträger“ (ebd., S. 117). Aber <Bedeutungen>, <Sinn>, von denen die Rede ist, sind im Laufe der Zeit bzw. im Zuge des sozio-kulturellen Wandels „zugeschrieben“ (Vgl. ebd., S. 118). Astrid Erll präzisiert etwas an der Stelle, was für mich sehr wichtig ist, nämlich dass „Geschichtsschreibung ein zentrales Medium des kulturellen Gedächtnisses“ ist (ebd., S. 118).
- „Stabilisierungsfunktion“: Die verdichteten und sinntragenden Gedächtnisinhalte werden von einer Generation zu einer anderen weitergegeben. Diese stabilisierende Funktion ist in Oralkulturen sichtbarer.
Form(ung) und Narrativität spielen eine unentbehrliche Rolle in dem Verhältnis LiteraturGeschichte -Gedächtnis. Erll sagt bezüglich der Formung Folgendes:
Poetische Formen sind also keine ,Ornamente‘, die bereits vorhandene Erinnerungen verzieren. Formung ist vielmehr ein gedächtniskonstitutives Verfahren. Das Poetische der Erinnerungskultur ist als poiesis -als eigenständiges, aktives und konstruktives Hervorbringen von Wirklichkeiten durch ästhetische Verfahren- zu begreifen (ebd., S. 118).
Die Narration bzw. die Narrativität ist ihrerseits auch wichtig für die Gedächtniskonstitution (und die Geschichtsschreibung), denn sie ist bemüht, durch Prozedere der „Auswahl“, „Verknüpfung“, , Strukturierung’ sowie der , Sinnstiftung’, das ,Vorsymbolische’ und , Pränarrative’ in strukturierte und kohärente kollektive bzw. individuelle Erinnerungen zu transformieren (Vgl. ebd., S. 118). Astrid Erll geht noch weiter, indem sie sich noch auf Jan (1992) und Aleida Assmann (1999) stützt, um die wichtige Rolle der Narration für das kulturelle Gedächtnis zu demonstrieren.
Für Jan Assmann sei Erinnerungskultur im größten Teil auch Schriftkultur. Damit Erinnerung, so Jan Assmann, ihre „normative und formative“ Rolle erfüllen kann, muss zunächst einmal „faktische Geschichte“ in „Mythos“ verwandelt werden (Vgl. S. 52. zit. nach Erll. Vgl. ebd., S. 119). Aleida Assmann (1999) ihrerseits zeigt, wie das kulturelle Funktionsgedächtnis entsteht und wie es am Leben gehalten wird. Das kulturelle (Funkti ons)gedächtnis entsteht zunächst einmal durch die , schriftliche Fixierung’ von Erfahrungen eines Individuums. Das Funktionsgedächtnis lebt auch von der Schrift, aber Schriften, die dazu zählen, werden sorgfältig ausgewählt (es sind kanonisierte Texte), verknüpft, um im Laufe der Zeit ,(neu)gedeutet/semantisiert‘ (Vgl. ebd., S. 119) zu werden. Die Narrativität ist sogar so wichtig, dass Erzählungen/ Narrationen vorhanden sein müssen, damit es von Deutung die Rede sein kann (, denn das, was nicht existiert, kann nicht gedeutet werden). Beispiele für solche „Gedächtnisnarrative“ seien „Mythen“ (als „Fernhorizont des kulturellen Gedächtnisses“) und „(„sinnstiftenden“) Alltagserfahrungen“ (als „Nahhorizont des kommunikativen Gedächtnisses“) (Vgl. ebd., S. 119).
Zum Schluss über dieses Kapitel präzisiert Erll: Auf der Ebene des individuellen sowie des kollektiven Gedächtnisses lassen sich „häufig“ Fiktives mit Realem, „Reales mit Imaginärem verbinden“. Dabei wird die Geschichtswissenschaft kritisiert, die, im Gegenzug zu der Gedächtnisforschung, die das Reales-Imaginäres-Paar akzeptiert, exklusiv daran arbeitet, reale von fiktiven historischen Tatsachen auszusondern (Vgl. ebd., S. 119f.).
3.2. „Das Erinnerungskulturelle der Literatur“
„(...) Jedes literarische Werk ist mit erinnerungskulturellen Prozessen verwoben“ (ebd., S. 120). Literarische Texte greifen in die „Traditionshaltigkeit“, in die Darstellung von Erinnerungsprozessen und „aktiv“ in die Formation bzw. „Transformation“60 des kollektiven Gedächtnisses und der Geschichtsschreibung sogar ein (Vgl. ebd., S. 120f.). Dieser Anteil der Literatur an der Gedächtnisformation und der Geschichtsschreibung lässt sich in „Reiseerzählungen“ -da beschriebene Orte, Ortschaften zu „bedeutungsgeladenen Erinnerungsräumen“ werden- Ich-Romanen ((Auto)biographien), lyrischen Gedichten (in dem Zusammenspiel „erinnerndes und erinnertes Ich“), „historischen Romanen“ . beobachten (Vgl. ebd., S. 121).
P.S.: Für Astrid Erll hat jedes Symbolsystem („Literatur, Geschichte, Mythos, Religion, usw.“), auch wenn es Gemeinsamkeiten61 unter ihnen gibt (<Form und Struktur>), ein poietisches Verfahren, das ihm relativ eigen ist. Alle aber <speisen sich aus> der „gemeinsamen Quelle“: „den symbolischen Ressourcen der Kollektivgedächtnisse und ihres jeweiligen Entstehungskontextes“. Somit ist „das kollektive Gedächtnis als gemeinsame Quelle erinnerungskultureller Praxis -der Geschichtsschreibung, der Gesetzgebung, des religiösen Rituals, aber auch der Literatur- zu verstehen, [...]“ (ebd., S. 121).
Literatur partizipiert dreierlei am erinnerungskulturellen Prozess durch: „Präfiguration“, „Konfiguration“ und „Refiguration“, die den „Kreis der Mimesis“ (Ricoeur) bilden (Vgl. Ricoeur (1988). zit. nach ebd., S. 122). Was kann unter „Präfiguration“, „Konfiguration“ und „Refiguration“ verstanden werden?
- „Erinnerungskulturelle Präfiguration“: Literatur mithilfe von Symbolen, Bildern antizipiert die „Wirklichkeit der Erinnerungskultur“. Dabei verbindet sie „Erinnertes mit Vergessenem und ,Imaginärem‘“ (Vgl. ebd., S. 122).
- „Konfiguration fiktionaler Erinnerung“: Literatur arbeitet an der „Gedächtnisdarstellung“ anhand von literaturästhetischen Mitteln (Metapher, Symbole, etc.). Sie reichert darüber hinaus das Gedächtnis mit vergessenen bzw. „verdrängten“ sowie subversiven Inhalten an. Die Art und Weise, was die Literatur für Inhalte hält und wie sie sie darstellt, löst „reflexive Implikationen“ seitens des Lesers aus. Deshalb sieht Erll die Literatur als eine „Beobachtungsinstanz“ an (Vgl. ebd., S. 122).
- „Kollektive Refiguration“: Die literarische Gedächtnisdarstellung , wirkt auf die objektive Wirklichkeit zurück‘. „Literatur war und ist an der Ausformung und Reflexion von Erinnerungskulturen [.] beteiligt“ (ebd., S. 122). Aber damit sie diese Rolle „aktiv“ spielt, ist erhebliche „Rezeption“ -also das Lesen beim Publikumvorausgesetzt. (Vgl. ebd., S. 122).
In der „Selektion und (Neu)Kombination von Realem und Imaginärem, Erinnertem und Vergessenem“ formt die Literatur bzw. korrigiert sie die Wirklichkeit bzw. die Vergangenheit. „Beide stiften Sinn durch stabilisierende, verdichtende und semantisierte Formen. Beide verarbeiten Zeiterfahrung über Narrationsmuster“. Eine andere Ähnlichkeit ist, Literatur (das Erzählte) sowie Kollektivgedächtnis (das kollektiv zu Erinnernde) und Fassungen von historischen Ereignissen zeichnen sich durch eine Bedeutungsfülle und eine beständige Sinnverleihung bzw. Auslegung aus. Literatur ist folgerichtig ein vollwertiges Medium der Erinnerungskultur (Vgl. ebd., S. 123).
Literatur, Geschichte und Gedächtnis kommen zusammen, weil „(...) -der literarische und der historiographische Text- in hohem Maße auf kollektive Gedächtnisnarrative zurückgreifen.“ (ebd., S. 123). Die erinnerungshistorische Literaturwissenschaft untersucht Gattungen und Formtraditionen, Kanon und Literaturgeschichtsschreibung, Literatur als Medium des kollektiven Gedächtnisses, die literarische Inszenierung des Gedächtnisses und die Gedächtnismetaphorik und ihre zwei populärsten Ansätze sind Intertextualität und Intermedialität (Vgl. ebd., S. 124f.).
3.3. Über eine vielseitige/hybride Literatur: Erinnerungsliteratur
In der Erinnerungsliteratur lässt sich noch deutlicher dieses Hand- in- Hand- Gehen von Literatur mit Geschichte und Gedächtnis offenbaren, denn „Schreiben, Bezeugen und Erinnern verbinden sich in dieser Gattung [.]“ (Assmann, 2011, S.79). Schreiben, Bezeugen und Erinnern, sind aber lediglich in Bezug auf vergangene historische Tatbestände zu verstehen. Die Erinnerungsliteratur ist bemüht, Erfahrungen als „Rohstoff“ der literarischen Werke zu machen (Vgl. ebd., S. 79). Aber diese Erfahrungen (z.B. historische Traumata) werden nicht so -wie sie erlebt wurden- übernommen: Sie werden der Fiktionalisierung -also ,literarisch ausgearbeitet’ bzw. verarbeitet- unterworfen. In der Erinnerungsliteratur ist die Auswahl zwischen Fakt und Fiktion ein „Sowohl-als-auch“. Ein Beispiel von Erinnerungsliteratur sei die Autobiographie. Diese Gattung bekräftigt noch die Flüchtigkeit der Grenzziehung zwischen Literatur, Geschichte und Gedächtnis, denn sie mitunter den Anspruch auf Wahrheit o.Ä. erhebt. Aber dabei ist diese Grenzziehung zunichte gebracht: (Erinnerungs)literatur zieht hauptsächlich keine „Lehren aus der Geschichte“, sondern arbeitet an der ,Ausfüllung der Geschichts- und Erinnerungsleeren’ (Vgl. ebd., S. 84). Darüber hinaus ist die Absicht der Erinnerungsliteratur, dass „die Geschichte neu besichtigt und rekonstruiert [wird] mit dem Anspruch, noch unbekannte62 Aspekte der historischen Wahrheit freizulegen“ (ebd., S. 84) und wenn jene Vergangenheit erhellt ist, ist sie vorwiegend dem dazugehörenden Volk bzw. den anderen Völkern „begehbar“ und „zugänglich“ (Vgl. ebd., S. 85).
Zwischenfazit
Mit der Literatur als gemeinsame Quelle für Geschichte und Gedächtnis wurde die Zirkularität des Triptychons Literatur-Geschichte-Gedächtnis an die Oberfläche gebracht. Der kommende Teil ist der Fruchtbarmachung der begrifflichen Annäherung und der daraufgefolgten theoretisch geladenen Diskussion gewidmet. Gedächtnis und historiographische Merkmale werden aus „Sternstunden der Menschheit“ (SSdM63 ) herausgearbeitet, um aufweisen zu können, wie Literatur die Vergangenheitsaufarbeitung problematisiert.
TEIL II: TEXTANALYSE
Kapitel 4: Stefan Zweigs Biographie und Bestimmung von Kernbegriffen der Textanalyse
In diesem Kapitel wird zunächst Zweigs Leben kurz dargestellt und dann abwechselnd gattungsbezogene, erzähltheoretische und erzähltechnische Begriffe explaniert.
4.1. Biographie des Autors und deren Relationierung an die Auswahl von historischen Figuren und Ereignissen
Stefan Zweig ist am 28. November 1881 in Wien geboren und hat sich am 23. Februar 1942 in Petropolis, in Brasilien, das Leben genommen. Er stammte aus einer jüdischen Familie. Sein Vater hieß Moritz Zweig und war ein jüdischer Textilfabrikant, seine Mutter hieß Ida Brettauer und sein Bruder Alfred (Vgl. http://wortwuchs.net/lebenslauf/stefan-zweig/ ).
Von 1892 bis 1900 besucht Zweig das Wiener Gymnasium Wasagasse, wo er 1899 seine Matura ablegte. Während seiner Gymnasialzeit erschienen seine ersten Gedichte unter dem Einfluss von Hugo von Hoffmannstahl u.a. Nach dem Gymnasium studierte er Philosophie, Germanistik und Romanistik an der Universität Wien und Berlin. Er promovierte 1904 mit einer Dissertation über Hippolyte Taine in Berlin. Nebenbei schrieb er weiter und knüpfte Freundschaft mit dem Verleger des Insel-Verlags, Anton Kippenberg (Vgl. http://wortwuchs.net/lebenslauf/stefan-zweig/ ).
Vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs reiste Zweig fast überall rund um alle Erdteile. Er reiste nach Belgien, Holland, Frankreich, England, Italien, Spanien, Indien, Nordafrika und Amerika. Auf Reisen (vor und zur Zeit des Ersten Weltkrieges) knüpfte er Freundschaft zu europäischen Künstlern und Intellektuellen wie Rania Maria Rilke, Romain Rolland, James Joyce, Emile Verhaaren, Sigmund Freud, Arthur Schnitzler und Maxim Gorki (Vgl. http://www.dieterwunderlich.de/Stefan Zweig.htm ).
Während des Ersten Weltkriegs ist Zweig zunächst einmal im Kriegsarchiv tätig und später als Journalist in Zürich. Nach dem Krieg kehrte er in Österreich zurück und ließ sich in Salzburg nieder mit Friderike von Winternitz, die 1940 seine Frau wurde. Sein Haus im Kapuzinerberg empfing die „geistige Elite Europas“. Von 1920-1933 engagierte sich Zweig für ein geistiges geeintes Europa. Im Jahre 1927 entsteht „Sternstunden der Menschheit“64. 1928 reiste Stefan Zweig nach Russland anlässlich des 100. Geburtstags Leo Tolstoi. Dabei entstanden seine Werke in der russischen Sprache. Nach Hitlers Machtergreifung und dem Verbot seiner Bücher sowie der Judenverfolgung emigrierte Zweig 1934 nach London, wo er, trotz der von Zeit zu Zeit Reisen nach anderen Ländern und Kontinenten, nach dem Bekommen der britischen Staatsbürgerschaft bis 1940 lebte. Als die durch den Zweiten Weltkrieg verursachten Verwüstungen ihm unerträglich wurden, emigrierte er nach Brasilien mit seiner zweiten Frau, seiner ehemaligen Sekretärin, Lotte, mit der er sich zwei Jahre später das Leben nahm (Vgl. http://wortwuchs.net/lebenslauf/stefan-zweig/ ).
Diese kurze Biographie Zweigs gibt Informationen über Zweigs Reiselust sowie sein Verhältnis zu berühmten europäischen Künstlern. Die Reise hat eine nicht zu vernachlässigende Tragweite in der Produktion dieses österreichischen Autors, dergestalt dass die historischen Gestalten, deren Geschichte in „Sternstunden der Menschheit“ erzählt wurden, aus den von ihm am meisten bereisten Räumen stammen (also Europa und Amerika) und wie er selbst Reisende sind.
4.2. Gattungsbezogene Definitionen
Im Folgenden werden abwechselnd die Begriffe „Miniatur“ und „Sternstunden“ definiert.
4.2.1. Was ist eine Miniatur und was kann sie?
Im Untertitel zu „Sternstunden der Menschheit“ bezeichnet Stefan Zweig seine historischen Texte „(...) historische Miniaturen“. Diesen Begriff hat er der Malerei entnommen, wo er als die „Reproduction de quelqu’un ou de quelque chose [de grand] en [quelque chose de] beaucoup plus petit“ (Dictionnaire pratique. Langue française, 2006, S. 289) definiert wird.
In seinem Werk „la poétique de l’espace“ (1961) interessiert sich der französische Philosoph Gaston Bachelard für den Begriff Miniatur. Er unterscheidet zwischen visueller Miniatur und Tonminiatur65. Bei Bachelard sei die Miniatur ein Appell an die Rückkehr zur Kindheit (Vgl. ebd., S. 141) aufgrund der Träumerei und des Imaginären, die verführerisch wirken (Vgl. ebd., S. 143). Weil die Miniatur sich auf „minuscule“, „détail“, „petit“ usw. reimt, ist sie eine Einladung zur Aufmerksamkeit, zum Halt. In visueller Miniatur sowie in Tonminiatur sind das Größe (le „grand“) und das Kleine (le „petit“) ineinander verwoben, derart dass der „grand écoutant“ (der Dichter) das Stumme bzw. das Leise ins Laute verwandeln kann. Die literarische Miniatur erlaubt den Lesenden darüber hinaus, die Realität in der Großzügigkeit zu sehen, indem sie die Details hervorhebt (Vgl. ebd. S. 146). Somit entstehe den Eindruck, dass der Dichter bzw. der Beschreiber eine Lupe habe (Vgl. ebd., S. 148). Aber diese Lupe ist der Miniatur inhärent, denn eine Lupe haben, bedeutet, aufmerksam auf Einzelheiten sein.
Und Aufmerksamkeit auf das Unsichtbare schenken, heißt von vornherein eine (unsichtbare) Lupe halten.
Bachelard ist aber der Ansicht, dass es nicht einfach ist, eine Miniatur zu produzieren: Der informationsreiche kurze Text ist nicht jedermanns Gabe (Vgl. ebd., S. 149). Aber damit die Miniatur, verstanden als die kleinere Repräsentation eines großzügigen Gegenstandes, als etwas Autonomes existieren kann, ist „le simple relativisme du grand et du petit“66 außer Kraft zu setzen. Um diese scheinbar kausale Relation zwischen dem Großen zu dem Kleinen zunichte zu machen, beweist Bachelard, dass der Strauch (das Kleine) zu einem Baum (das Große) wachsen könne, wohingegen das Umgekehrte unmöglich sei (Vgl. ebd., S. 152). Dies ist der Beweis dafür, dass die Imagination bei der Miniatur am Werk ist, vor allem, wenn es dem Erzähler darum geht, die von seiner Großmutter zugehörten Geschichten wieder zu erzählen. Um letztendlich den Binarismus „klein“ vs. „groß“ zu überwinden, macht Bachelard deutlich, dass die Miniatur als Miniatur und das Große als Große lediglich je nach der Distanz bzw. der Höhe zu dem beobachteten Objekt anzusehen sei (Vgl. ebd., S. 160).
Um den Streit um die Gattungszugehörigkeit67 der historischen Texte Zweigs auszuweichen, gebrauche ich die Bezeichnung „Miniatur“ aufgrund ihrer Neutralität.
4.2.2. Zum Begriff „Sternstunden“
Bevor ich in die Analyse der einzelnen „Sternstunden“ eingehe, finde ich es nicht überflüssig, auf den Begriff „Sternstunden“ zurückzukommen. In Nr. 6 der Zweighefte des Stefan Zweig- Centre Salzburg (2012) sind „Sternstunden“, wie Stefan Zweig selbst seinem Verleger des Insel-Verlags sagte, „kleine Büchel“, also „Essays in novellistischer Form“ (Stefan Zweig. Brief am Verleger. Zit. nach Renoldner, ebd., S. 4). Bevor er den „besseren“ Titel „Sternstunden der Menschheit“ fand, dachte er zunächst einmal an Titel wie „‘Große Augenblicke‘“ oder „‘Augenblicke der Weltgeschichte‘“ (ebd., S. 4). In dem Vorwort zu „Sternstunden der Menschheit“ (2012) erklärt Zweig, dass diese Stunden Sternstunden der Menschheit genannt sind, weil ihre Entstehung vorab den Beitrag von „Millionen Menschen“ oder „Millionen müßige Weltstunden“ erfordert (S. 7), also diffizil, „selten“ (S. 8) ist, „weil sie [Sternstunden der Menschheit] leuchtend und unwandelbar wie Sterne die Nacht der Vergänglichkeit überglänzen“ (ebd., S. 8) und weil ihre Entstehung „den Schicksalslauf der ganzen Menschheit“ in erheblichem Sinne modifiziere bzw. determiniere (Vgl. ebd., S. 8).
Darüber hinaus seien sie „den verschiedensten Zeiten und Zonen“ der Welt entkommen. Diese Geschichten seien wieder erzählt, wie sie ereignet seien, also ohne „Erfindung“, ,Verfärbung‘ o.Ä. (Vgl. ebd., S. 8). Alle Miniaturen der „Sternstunden der Menschheit“, so Renoldner im Editorial der Zweighefte Nr. 6, haben gemeinsam, dass sie ein „Plädoyer für die Scheiternden“ (S. 5) seien.
Die Auflage der „Sternstunden der Menschheit“, der Gegenstand meiner Analyse ist, setzt sich aus 12 Miniaturen zusammen, wobei hingegen die erste Fassung, die zu seiner Lebenszeit (im Jahre 1927) erschien, 5 Miniaturen enthält, nämlich „Die Weltminute von Waterloo“ (18. Juni 1815), „Die Marienbader Elegie“ (5. September 1823), „Die Entdeckung Eldorados“ (Januar 1848), „Heroischer Augenblick“ (22. Dezember 1849), „Der Kampf um den Südpol“ (16. Januar 1912). 13 Jahre später, also im Jahre 1940, erschien eine neue Ausgabe mit 12 Miniaturen. Zu den fünf Miniaturen kommen sieben hinzu: „Flucht in die Unsterblichkeit“ (25. September 1513), „Die Eroberung von Byzanz“ (29. Mai 1453), „Georg Friedrich Händels Auferstehung“ (12. September 1741), „Das Genie einer Nacht“ (25. April 1792), „Das erste Wort über den Ozean“ (Juli 1858), „Die Flucht zu Gott“ (Ende Oktober 1910), „Der versiegelte Zug“ (9. April 1917). Zu diesen 12 Miniaturen sind noch zwei (02) hinzugefügt worden, die erstmals 1943 in der englischen Ausgabe erschienen sind. Es handelt sich um „Cicero“ (43 v. Chr.) und „Wilson versagt“ (7. April 1919). Diese Auflistung der einzelnen Titel und überwiegend das Lesen der Untertitel machen aufmerksam auf das, was Stefan Zweig unter Menschheit versteht. Menschheit sei für ihn in Europa und in Amerika allein, aber keineswegs in Asien und Afrika zu lokalisieren.
4.3. Erzähltheorie im Überblick
In diesem Teil werden einige wichtigste Begriffe der Erzähltheorie bzw. der Erzähltechnik, die für die Analyse der einzelnen Miniaturen von Belang sind, definiert. Dabei werden operationalisierbare und prägnante Bestimmungen geliefert. Jürgen Schutte (1997) zufolge möchte man die Strukturanalyse eines narrativen Textes durchführen, fallen hauptsächlich zwei Oberkategorien ins Gewicht, nämlich die Fabelanalyse und die Erzählsituation. Im Folgenden werden kurz und bündig diese Grundbegriffe definiert und deren Typologie je nach Schutte68 präsentiert.
4.3.1. Fabelanalyse
Eine Fabelanalyse unternehmen, bedeutet auf die Frage: „Wie hängt das Geschehene miteinander zusammen?“ (Schutte, 1997, S. 121) antworten, denn die Fabel entstehe aus einer ,sinnzusammenhängenden‘ Geschichte (Vgl. ebd., S. 121).
Folgende Begriffe der Fabelanalyse werden definiert. Es handelt sich um: Erzählzeit, erzählte Zeit, chronologische Erzählung, Vorausdeutung und Rückwendung.
Die Erzählzeit bezeichnet die „Dauer des Erzählvorganges“; ihre Dauer wird objektiv, wenn Seiten bzw. Zeilen des Werkes gezählt werden (Vgl. ebd., S. 122). Von der Erzählzeit ist die erzählte Zeit zu unterscheiden. Sie verweist auf die „Dauer des Geschehens“ (ebd., S. 122). Eine Erzählung ist chronologisch, wenn sie die sukzessive Reihenfolge nachahmt (Vgl. ebd., S. 23). Eine anachronistische Erzählung bedient sich der Rückwendung bzw. der Vorausdeutung. Rückwendung/Rückblende/Analepse ist das „nachträgliche“ Erzählen eines „früheren“ Geschehens (Vgl. Martinez/Scheffel, 2009, S. 186), wohingegen Vorausdeutung/ Vorblende/Prolepse das antizipierte Erzählen eines künftigen bzw. späteres Ereignisses ist (Vgl. ebd., 192).
4.3.2. Erzählsituation
Die Erzählsituation ist „die Gesamtheit jener Bedingungen, unter denen erzählt wird“ (Schutte, 1997, S. 132). Die Erzählsituation sei ein Oberbegriff für Erzählform, Erzählerstandort, Erzählperspektive, Erzählverhalten und Darstellungsweisen (Vgl. ebd., S. 132).
Unter dem Begriff Erzählform wird verstanden: „Das personale Verhältnis ErzählerErzählgegenstand“ (ebd., S. 133). Es wird zwischen zwei Erzählformen unterschieden, nämlich der Ich-Erzählform und der Er-/Sie-Erzählform. Der Ich-Erzähler ist entweder Teilnehmer oder Erzähler (Vgl. ebd., S. 133). Der Er-/Sie-Erzähler ist Erzähler und Person (falls er von sich selbst spricht).
Der Erzählerstandort (Point of view, Blickpunkt): Ist die zeiträumliche Distanz des Erzählers zum Erzählten (Vgl. ebd., S. 134). Je nach dem Ort, wo der Erzähler steht, kann er mit Nähe, mit Distanz, überblickend... erzählen (Vgl. ebd., S. 134).
Erzählerstandort und Erzählperspektive greifen ineinander, aber sind keine Synonyme. Die Erzählperspektive fragt nach der „Vertrautheit oder Unvertrautheit des Erzählers mit den inneren Vorgängen der Figuren“ (ebd., S. 135). Es wird zwischen der Erzählperspektive nach der Innensicht und der Erzählperspektive nach der Außensicht unterschieden.
Das Erzählverhalten beantwortet die Frage: An wessen Optik bindet der Erzähler seine Aussage? (Vgl., ebd., S. 136). Folgende Erzählverhalten treten in einem Erzähltext vor: Das auktoriale Erzählverhalten oder der auktoriale Erzähler: Davon ist es die Rede, wenn der Autor durch Kommentare, Urteile, Reflexionen, Stellungnahme... deutlich identifizierbar ist (Vgl. ebd., S. 136f); bei dem personalen Erzählverhalten (auch personaler Erzähler genannt) sieht der Erzähler mit den Augen einer Figur (Vgl. ebd., S. 136). Das letzte Erzählverhalten ist das neutrale Erzählverhalten bzw. der neutrale Erzähler. Der Erzähler verhält sich neutral, wenn er ein objektiver Bericht, also ohne Kommentare und Wertungen, im Konjunktiv Präteritum darbietet (Vgl. ebd., S. 137). Der letzte Unterbegriff der Erzählsituation ist die Erzählhaltung.
Die Erzählhaltung ist die „[,psychologische’] Einstellung des Erzählers gegenüber den Begebenheiten und den Figuren“ (ebd., S. 137). Die Erzählhaltung kann implizit oder explizit sein. Ist sie explizit, da kann die Erzählerrede kritisch, pathetisch, satirisch, rhetorisch. sein (Vgl. ebd., S. 137).
In der Erzähltheorie sind Darstellungsweisen „sehr“ an der Erzählsituation gebunden. Darstellungsmöglichkeiten bzw. -formen sind: „Bericht, szenisches Erzählen, Kommentar, Figurenrede, innerer Monolog, erlebte Rede.“ (ebd., S. 133). Dabei werden nur zwei Darstellungsformen eruiert werden, nämlich der innere Monolog und die erlebte Rede. Der innere Monolog ist das Alleinselbstgespräch einer Figur (Vgl. ebd., S. 136). Bei der erlebten Rede hingegen wird aus der Optik einer Figur erzählt, deren Gedanken wiedergegeben werden (Vgl. ebd., S. 136).
4.4. Begriffe der Erzähltechnik
Definiert werden Intermedialität, Collage und Montage.
4.4.1. Intermedialität
Werner Wolf (2004) zufolge ist die Intermedialität eine manifeste Form der Intertextualität, wobei einzelne Medien in einem Text verwendet bzw. einbezogen werden (Vgl. S. 107). Folgende Funktionen der Intermedialität werden unterschieden: „Das experimentelle Ausloten und Erweitern der Grenzen des eigenen Mediums, das Schaffen metafiktionaler/ästhetischer Reflexionsräume oder die Stärkung, aber auch Unterminierung ästhetischer Illusion“ u.a. (ebd., S. 108). Intermedialität/Intertextualität geht Hand in Hand mit Collage - bzw. Montage - Prozessen.
4.4.2. Collage und Montage
Etymologisch heißt Collage Kleben und Montage Aufbau, Zusammensetzen. Im Allgemeinen verweisen die Begriffe Collage und Montage auf „den technischen Prozess des Zusammenfügens und seine Produkte“ verstanden (Voigts-Virchow, 2013, S. 540). Darum sind Collage und Montage „textgenerierende Prozesse“. Im engeren Sinne sind Collage und Montage ästhetische Prozesse und Werke, in denen Materialien, wie Zitate, Lieder, Textauszüge etc. aus unterschiedlichen Quellen zusammengefügt werden, sodass aber das Endprodukt „inhomogen“ wirkt (Vgl. ebd., S. 540). Für Anne Souriau (1990) aber ist die Montage - im Gegenzug zum Collage - eine ästhetische Form, die eine kohärente „forme d’ensemble“ realisiert (Vgl. S. 1025).
Kapitel 5: Analyse des Werkes
5.1. „Sternstunden der Menschheit“ als Darlegung von „European Lives“ und dessen Beitrag zur Konstruktion eines Europagedächtnisses
Ich lasse mich gern von der fremden Kritik helfen, denn es ist ja ein Irrtum zu glauben, der Autor selbst sei der beste Kenner und Kommentator seines eigenen Werkes. Er ist das vielleicht, solange er noch daran wirkt und darin verweilt. Aber ein abgetanes, zurückliegendes Werk wird mehr und mehr zu etwas von ihm Abgelöstem, Fremden, worin und worüber andere mit der Zeit viel besser Bescheid wissen als er, so daß sie ihn an vieles erinnern können, was er vergessen oder vielleicht sogar nie klar gewußt hat. (Thomas Mann, Vorsatz zu „Der Zauberberg“, S. 17f.).
Bevor ich mit der Analyse der Miniaturen beginne, möchte ich zur Erinnerung rufen, dass ich nicht völlig mit Zweigs angekündigter Geschichtsschreibung ohne Erfindung bzw. Verfärbung einverstanden bin. Damit die Analyse nicht in allen Richtungen geht und weil ich von der Grundannahme ausgehe, dass Stefan Zweig an der Konstruktion eines Europagedächtnisses bzw. der Schreibung der abendländischen Geschichte und nicht an der Konstruktion eines Menschheitsgedächtnisses bzw. der Schreibung der Menschheitsgeschichte arbeitet, gruppiere ich die Miniaturen je nach den Räumen, woraus die historischen Gestalten stammen oder wo die Geschichte sich abspielt, da diese Figuren, wie Zweig selbst, sich durch eine erhebliche Mobilität auszeichnen. Diese Räume bzw. Erdteile sind: Russland für „heroischer Augenblick“, „Der versiegelte Zug“, „Die Flucht zu Gott“; Frankreich für „Die Weltminute von Waterloo“, „Das Genie einer Nacht“; Großbritannien für „Der Kampf um den Südpol“; Deutschland für „Die Marienbader Elegie“, die Schweiz für „Georg Friedrich Händels Auferstehung“; Italien für „Cicero“, die Türkei für „Die Eroberung von Byzanz“; und Amerika für „Die Entdeckung Eldorados“, „Das erste Wort über den Ozean“, und „Wilson versagt“.
Da ich eine immanente Interpretation der Miniaturen durchführen möchte, arbeite ich hauptsächlich an der aus 12 Miniaturen bestehenden Ausgabe der „Sternstunden der Menschheit“ des Kapo-Verlags (2012). Die Besonderheit dieser Ausgabe ist, dass der Fußnotentext über jede genannte historische Figur, jedes historische Ereignis, jeden (Gedäclitnis)ort... informiert. Die Autonomie des literarischen Textes ist somit fundiert, dergestalt dass der Leser nicht mehr braucht, aus dem Text herauszukommen. Die Lektüre verläuft, sobald sie angefangen hat, immanent und ununterbrochen.
Die Anzahl der zu analysierenden Texte habe ich auf 10 reduziert. Ziel ist es, Raum für eine tiefgreifende Analyse der ausgewählten Miniaturen zu schaffen. Privilegiert wurden
Miniaturen, die einen Bezug auf Kunst69 haben oder wo historische Quellen und Erinnerungsmedien in erheblichem Maße enthalten und fiktionalisiert sind. Die 04 (vier) restlichen Miniaturen werden aber nicht beiseitegelassen, sondern zusammengefasst und in der zweigschen Europakonstruktion integriert.
5.1.1. Sternstunden Russlands
5.1.1.1. „Heroischer Augenblick“
5.1.1.1.1. Zum Inhalt und Titel der Miniatur und deren Aufnahme in den Sternstunden In dieser Miniatur ist es die Rede von Dostojewski, der eines Morgens unerwartet verhaftet und plötzlich, als er sich von der Welt innerlich verabschiedete, von dem Zaren amnestiert wurde.
Dostojewski wird eines Morgens, als er noch schlief, mit neun Genossen verhaftet und für Verrat zum Tod „durch Pulver und Blei“ verurteilt. Er wurde mit einem „Sterbehemd“ angezogen, er grüßt die „Gefährten“, küsst „den Heiland am Kruzifix“, wird mit Stricken an einem Pfahl genietet, er schluckt einen letzten Bissen von der Weltansicht, die er nicht mehr sehen wird, aber innerhalb seines Körpers fließt schon das rotfarbige Blut. Er wartet auf das Schoss, er ist bereit, klagt nicht, weint nicht, aber etwas, was in einer „Sekunde“ erledigt werden kann, „macht jahrtausende alt“. Und wie in einem Traum hört Dostojewski die Stimme der von dem Zaren verschickte Offizier, der sagte: „Der Zar hat in der Gnade seines heiligen Willens das Urteil kassiert, das in mildere Strafe kassiert wird“ (SSdM, 2012, S. 155).
Dostojewskis Körper wird nach und nach wieder lebendig: „Der Tod kriecht zögernd aus den erstarrten Gelenken“. Er schaut Richtung der Kirche, genießt die Natur. Wichtiger ist die Empathie, die er für seine Mitmenschen entwickelt: Es ist ihm möglich nun Geschrei, Klagen der Leidenden zu hören. Es wird ihm an diesem Augenblick bewusst, „Dass einzig das Leiden zu [barmherzigem] Gott aufschwebt“ (SSdM, S. 157), somit wurde es ihm klar, „Dass er in dieser einen Sekunde jener andere war, ...“ (SSdM, S. 158).
Heroisch ist dieser Augenblick für viele Gründe, denn der Zar, der Repräsentant Gottes auf Erde, hatte das Leben Dostojewskis erspart und hat somit ermöglicht, dass Leser um die Welt herum von seinem Vermögen konsumieren können. Zweitens, denn Dostojewski ist vor dem Tod stoisch geblieben und drittens, denn der Tod selbst ist heroisch gewesen, indem er Dostojewski ein für alle Mal markiert, seine Sensibilität, Einfühlungsvermögen o. Ä. an die Oberfläche gebracht hat.
5.1.1.1.2. Erzählsituation und Fabelanalyse
In dieser Erzählung ist das Erzählverhalten personal, denn der Erzähler vermittelt nur, was geschehen ist, das was Dostojewski erlebt, fühlt und denkt.
Das Handlungsgerüst ist chronologisch. Die Zeit, wie sie im Titel erscheint, ist ein „Augenblick“, aber ein Augenblick, der tausend Jahr zu dauern scheint: Dostojewski wartet auf seine Erschießung, die nicht vorkommt. Die Zeit des Erzählten ist relativ kurz: Der Hauptprotagonist wird in der Nacht festgenommen, sofort im Tribunal geführt und wieder unmittelbar nach dem Urteilsspruch, nach dem Erschießungsort geführt und nach seiner Freilassung wieder in den Zug nach seinem Zuhause zurück an der Morgenröte geworfen. Der Erwartungsaugenblick der Erschließung scheint, in seinen Augen, mehr als das davor Geschehene zu dauern. Die erzählte Zeit dauert ungefähr 24 Stunden und die Erzählzeit umfasst 8 Seiten. Die Dauer der Erzählzeit lässt sich auch dadurch begründen, dass der Text in Versen geschrieben ist. In dieser Miniatur lassen sich keine Reflexionen bzw. Kommentare des Erzählers lesen. Die historische Genauigkeit kann im Untertitel mit den Zeit-RaumAngaben beobachtet werden: „Dostojewski, Petersburg, Semenowskplatz 22. Dezember 1849“.
5.1.1.1.3. Formanalyse
„Heroischer Augenblick“ ist ein Gedicht mit unregelmäßigen Strophen und Versen. Es gibt Strophen, die sich aus neun, 11, 13, 33 usw. Versen zusammensetzen und Verse aus eins, zwei, fünf, sieben, 10, 11 usw. Silben. Bemerkenswert dabei ist aber, wie es Zweig gelingt, indem er sich an die formalen Zwänge der Lyrik hält, eine Geschichte zu erzählen. Seine Verse schwanken zwischen männlich und weiblich70 und der Rhythmus ist fallend und manchmal steigend71. Seine Überwindung der Gattungszwänge hört nicht hier auf. Verse sind immer reimartig geschrieben. Es wird zwischen Reimpaaren (aabb: Profos-los-Binde- Birkenrinde. SSdM, S.155), Kreuzreimen (abab: Schwachen-verschenkten-verlachen- Gekränkten. SSdM, S. 156) und eingeschlossenen Reimen (abba: Brust-grau-Frau-Lust. SSdM, S. 154) unterschieden. Symptomatisch für die Erzählung ist die Anwesenheit eines Erzählers bzw. eines lyrischen-Er, der sich der Er-Erzählform bedient, wobei er dem Leser das darbietet, was Dostojewski fühlt, sieht und denkt. Dieses Gedicht hat die Merkmale der Ballade, also „dramatisch erzählendes Gedicht“ (Textor, 2011, S. 43) mit wechselnden Reimen. Dadurch wird etwas anderes an die Oberfläche gebracht: Die Gattungshybridität, die Zweigs Fabrikmarke ist, und Zweigs Wohlgefühl in irgendwelcher Gattung.
5.1.1.2. „Der versiegelte Zug“
5.1.1.2.1. Zusammenfassung
Erzählt wird die Geschichte Lenins Rückkehr nach Russland und die Erklärung der russischen Revolution in einer Rede an dem Platz vor dem finnischen Bahnhof.
5.1.1.2.2. Wer war Lenin?
Bevor Lenin die Revolution lancierte, lebte er inkognito in der Schweiz besonders in Zürich. Sein Name Wladimir Iljitsch Ulianow ließ sich von seinen Hausgenossen nicht behalten. In der Schweiz, zu einer Zeit, wo die Spionage zu einem „Pandämonium“ geworden war, lebte er bei einem „Flickschuster“, in der Armut, reserviert, wenig gesprächig, gemeinsam mit seiner Frau im Ersparnis von Spionenaugen, die in keinem Augenblick ahnten, dass der hier Unbekannte eine Zelebrität in Sankt Petersburg war. Am 15. März 1917 liest Lenin eine falsche Nachricht in der Zeitung: Die russische Volksrevolution sei im Gang, der Zar abgestürzt, „die Duma“ an der Macht und dass alle Emigranten und Exilanten „als freie Bürger ins freie Land“ zu Heimkehr eingeladen seien. Als er die Wahrheit entdeckt, ist er enttäuscht, denn es handelt sich um eine Manipulation des russischen Volkes durch Engländer und Franzosen zum Zweck, dass der Friedensvertrag zwischen Deutschland und dem Zaren kaputt geht. Die falsche Nachricht bedeutet auch Falschheit des freiwilligen Heimkehrs. Lenin möchte aber, und ohne Zeit zu verlieren, unbedingt nach Russland, um den seit Jahrzehnten geschmiedeten Plan zu verwirklichen72. Die Schweiz73 durch den Ansatz des „Gefangenenaustausches“ arbeitete an der „legalen“ und „neutralen“ „Rückführung der russischen Revolutionäre“. Dieser Weg schien Lenin zu lang. Er entschloss sich, Verhandlungen mit den Deutschen74 zu eröffnen (obwohl diese Annäherung einen BumerangEffekt haben konnte). Die Schweiz half in erheblichem Maße in der Mediation zwischen beiden Parteien und im Endeffekt kommen Deutschland und Lenin zu einem heimlichen „Pakt“, der besagte, dem Zug, der Lenin und die Seinen nach Russland führen sollte, „das Recht der Exterritorialität zuerkannt“ wurde. Am 9. April 1917 „um drei Uhr zehn“ verließ das ,schicksalsentscheidendste‘ „Projektil“, das die „Weltuhr andern Gang“ geben sollte, den Züricher Bahnhof Richtung Russland.
5.1.1.2.3. Fabelanalyse und Erzählsituation
In dieser Miniatur ist das Präsens als Erzähltempus gebraucht, denn es appräsentiert das Erzählte und lässt uns daran glauben. Die episodenhafte Einteilung ist hier ein Beweis für die miniaturisierende Kraft Stefan Zweigs, der, indem er die Geschichte in Episoden teilt, wobei jede Episode einen Titel trägt, der eine semantische Einschränkung der Episode offeriert, sich zu einem Meister der Miniatur postuliert. Es wird also zu einer Miniatur in der Miniatur. Das Leistungsvermögen der Miniatur wird auch bei dem Umgang mit der Zeit sichtbar. In der Tat ist in dieser Miniatur -und das ist auch ein gemeinsamer Nenner vieler Miniaturen- die Erzählzeit kürzer als die erzählte Zeit (Zeitraffung). Die Erzählzeit umfasst 13 Seiten (S. 244 - 256) und die erzählte Zeit Monate (Anfang 1917 bis zum April 1917).
Das Erzählverhalten schwankt hier zwischen dem Auktorialen und dem Neutralen. Diese Miniatur zeichnet sich auch durch das Vorhandensein von Kommentaren und Reflexionen des Autors aus. Letzterer kritisiert den Auswahlcharakter der Geschichtsschreibung: Unter den 32 Leuten, die in „versiegelten Zug“ einstiegen, hat die geschichtswissenschaftliche Geschichtsschreibung nur 03 Namen ausgewählt, nämlich „Lenin“, „Sinowjew“ und Radek (SSdM, S. 253). Paradoxal findet er auch die Tatsache, dass es in Geschichtsbüchern steht, dass Ludendorff Lenins Auftrag akzeptiert und „zweifellos befürwortet“ hätte, während keinen materiellen Beweis dafür zu finden ist (SSdM, S. 253).
5.1.1.3. „Die Flucht zu Gott“
5.1.1.3.1. Inhaltswiedergabe und Aufnahme der Miniatur in den Sternstunden „Die Flucht zu Gott“ ist die letzte Miniatur über Russland. Diese Miniatur ist eine Miniatur suis generis, denn Stefan Zweig schreibt dabei einen „Epilog zu Leo Tolstois unvollendetem Drama „Und das Licht scheinet ins Finsternis““. Da dieses Werk eine im Jahre 1890 begonnene aber unvollendet nachgelassene „dramatische [kaschierte] Selbstbiographie“ Leo Tolstois ist, unternimmt Zweig das Projekt, einen Abschluss, ausgehend von Informationen über das wirkliche Leben Tolstois, zu diesem Theaterstück zu geben. Wie im Vorwort zu „Sternstunden der Menschheit“ bekennt sich Zweig hierin zu „historischer Treue“, die aus seiner „Ehrfurcht von den [historischen] Tatsachen und Dokumenten“ resultiert, wobei jedoch es nur die Rede von einem ,Versuch‘ ist (SSdM, S. 185). In dem Epilog tritt Tolstoi (83 Jahre alt) als Figur an der Stelle Nikolai Michelajewitsch Sarynzews auf. Andere Figuren sind: Sofia Andrejewna Tolstoi (die Gattin, die Gräfin), Alexandra Lwowna (mit Spitznamen „Sascha“, die Tochter), der Sekretär, Duschan Petrowitsch (Hausarzt und Freund Tolstois), Iwan Iwanowitsch Osoling (der Stationsvorsteher von Astapowo), Cyrill Gregorowitsch (der Polizeimeister von Astapowo), der erste Student, der zweite Student, und der Reisende. Die ersten beiden Szenen spielen sich während der letzten Oktober-Tage des Jahres 1910 im Arbeitszimmer in Jasnaja Poljana ab, die letzte am 31. Oktober 1910 im Wartesaal des Bahnhofs in Astapowo. Diese szenische Einteilung zeugt nochmals von Stefan Zweigs Miniaturkraft75.
In der ersten Szene (S. 187 - 202) wird über die Diskussion zwischen Tolstoi und den zwei Studenten, Wortführer für die russische Jugend, berichtet. Leo Tolstoi, der Pazifist und der unerschütterte Gläubige, soll auf die Frage: „Warum sind Sie nicht mit uns?“ (SSdM, S. 188) antworten. In der Tat verstehen die Jugendlichen nicht, warum Tolstoi, den sie verehren, ihnen in der Revolution nicht beisteht. Tolstoi wehrt sich mit dem Argument der Gewaltlosigkeitsphilosophie und des Mitleids für alle, sogar für die Unterdrücker, die trotz ihrer zahlreichen Missetaten auch seine „Brüder“ seien. Da ihm jegliches Leben gleichermaßen wertvoll ist, kann er kein Gewehr greifen. Die Jungen kritisieren an dieser Haltung die Gleichgültigkeit gegenüber dem Leiden der Armen, die Realitätsferne, die Passivität, die gewissermaßen Unschuld seien. Tolstoi gestehe es aber, es sei aus ,Feigheit‘, ,Scham‘, ,Unaufrichtigkeit‘, dass er sich nicht engagiert. Dadurch zeigt Tolstoi, dass er unter eigenem Luxus leidet. Für dieses Schütteln ist Tolstoi der Jugendlichen dankbar und die beiden Jungen sind von seinem Leiden berührt. Nachdem sie gegangen waren, suchte sich Tolstoi nach einem Brief, den er dreizehn Jahre zuvor geschrieben hat, in dem er sich von seiner Familie verabschiedete und sein Vermögen (Schriften und Geld) der Menschheit schenkte. Diesen Brief traute er sich nicht, zu dieser Zeit seiner Familie zu geben. Er traute sich sogar nicht, sich von seiner Familie zu trennen und ein Leben nach seinem Geschmack (in der Frömmigkeit und Bescheidenheit) zu führen. Da er nicht davon sicher war, dass seine Frau und seine Söhne seinen letzten Willen zur Verwirklichung hätten bringen werden, entschied er sich bereits am nachfolgenden Tag ein neues Testament im Geheimen seiner Frau zu schreiben.
Die zweite Szene (S. 202 - 212) spielt sich im Tolstois Arbeitszimmer am Abend ab. Seine Frau wollte, dass er sich von seinem Sekretär (der einzige Mensch, der seinen Glauben teilt) trennte, aber Tolstoi verneinte; sie wollte auch von dem Geheimnis wissen, Tolstoi versprach später nach der Rückkehr von Serjoschka und Andrey (seine Söhne) das Geheimnis offen zu sagen. Die Frau nahm an. Aber sobald Tolstoi ins Schlafzimmer ging, kam seine Frau Sonja um 03 Uhr mit einer Blendlaterne ausgerüstet ins Arbeitszimmer zurück, um seine Schriften, auf der Suche nach Informationen über das Geheimnis, zu durchsuchen. Es war aber eine Falle: Tolstoi hatte nicht an das Versprechen seiner Frau geglaubt und er hat getan, als sei er eingeschlafen. Das war das Anzeichen, worauf er lebenslang gewartet hat. Seine Frau liebte ihn nicht mehr: Er hatte somit nichts mehr in diesem Haus der Lüge zu tun. Er floh aus seinem Haus mit Duschan Richtung Kloster von Schamardino, um von seiner Schwester Abschied zu nehmen. Seine Tochter sollte ihm nachreisen, sobald ihre Brüder nach Hause zurückkamen. Es war am 28. Oktober 1910.
Die dritte Szene (S. 212 - 222): Am 31. Oktober 1910 erreichte ein Zug Astapowo mit dem „sehr müden“, fiebernden’ und ,zitternden‘ Tolstoi an dessen Bord. Er sollte sich ausruhen. Dabei gab es nur das ungemütliche „Eisenbett“ des Stationsvorstehers. Tolstoi ist in Frieden mit sich selbst. Er wird den „guten Tod“ kennen: Sein Körper leidet, er befindet sich in einem miserablen Ort, aber wird in dem Mut, in der Wahrheit und nicht in der Feigheit und Lüge sterben.
„Die Flucht zu Gott“ wird zu einer Sternstunde, da es die Stunde ist, an der der mutig gewordene Tolstoi, die Feigheit und Furcht überwindet und aus dem entsetzlichen Haus weggeht, um schließlich Ruhe am fremden und armen Boden zu finden.
5.1.1.3.2. Wer war Leo Tolstoi?
Aus diesem Epilog entkommen viele Informationen über Tolstois Lebensgeschichte, zumindest seine Geschichte während der letzten Monate seines Lebens. Die erste Information ist, dass Tolstoi am 31. Oktober 1910 im Alter von 83 Jahre alt gestorben ist. Im Alter von 83 leidet er an Gedächtnisschwäche, aber er bewegt sich noch schnell. Darüber hinaus erfährt der Leser, dass Tolstoi Diskussionen (mit jungen Leuten) (SSdM, S. 187) mag, aber was er nicht mag, sind ,Formen‘ besonders „Durchlaut“, obschon er ein Graf ist. Tolstoi zeichnet sich ferner durch seine Frömmigkeit (SSdM, S. 191) und seine Bescheidenheit (SSdM, S. 194) aus. Bemerkenswert bei ihm ist letztendlich, dass er ein Pazifist76 ist (SSdM, S. 190f.) und Artikel für englische Blätter schreibt. In der Familie kannte Tolstoi keine Heiterkeit. Er hatte bedauerlicherweise eine „hässliche“, „böse“, unehrliche, geldgierige Frau, die sein „religiöses Bewusstsein“ nicht teilte und mit der er vor 48 Jahren verheiratet war. Diese unmoralischen Charakterzüge haben die Söhne, Serjoschka und Andrey, von der Mutter geerbt. Nur die kleine Sascha hat das volle Vertrauen ihres Vaters.
5.1.1.3.3. Fabelanalyse und Erzählsituation
Das Erzählverhalten in dieser Miniatur ist neutral, von der historischen Treue motiviert. Zweig kommentiert nicht. Die erzählte Geschichte dauert 06 Tage (vom 26. bis zum 31. Oktober) und wird auf 40 Seiten (S. 184 - 222) erzählt. Diese Zeitdehnung ist durch den „effet de réel“ (Barthes) motiviert, da der Erzähler detailreich das Geschehene vermittelt. Die Geschichte zeichnet sich durch ein chronologisches bzw. lineares Handlungsgerüst aus.
Manchmal tritt ein Erzähler auf, der der Leserschaft die Geschichte vermittelt. Die Präsenz des Erzählers sowie die des Nebentextes werden kaligraphisch signalisiert: Sie erscheinen in der Kursivform. Ein Beispiel dafür ist auf der Seite 208 bis 210 zu finden, wo Tolstois Frau geheimer Eintritt in sein Arbeitszimmer auf der Suche nach dem Geheimnis erzählt wird. Somit schreibt Zweig ein Theaterstück über Tolstois letzte Lebensmomente, wobei ein Erzähler das Geschehene zeitweise vermittelt.
5.1.1.3.4. Formanalyse
Der Text an sich wird zu einer talentvollen Montage: Texte aus anderen Medien werden kohärenterweise zusammengefügt. Der Autor gilt hier als Orchestermeister, der die Harmonie unter diesen einzelnen Elementen schafft. Es gelingt ihm, mit intermedialen, intertextuellen, interdiskursiven und gattungshybriden Elementen umzugehen. Die Intermedialität, damit möchte ich anfangen, erscheint in der Kopfnote der ersten Szene durch die Verschriftlichung bzw. die Vertextung des Bildes (das Bild wird zu einem Text): „Das Arbeitszimmer Tolstois, einfach und schmucklos, genau nach dem bekannten Bild“ (SSdM, S. 187). Texte aus anderen Medien werden auch zu Literatur und integrieren ohne kaligraphische Hervorhebung den Geschichtslauf. Es handelt sich um einen Brief (SSdM, S. 198f.), eine Tolstoi von einem Alten erzählte Legende (SSdM, S. 203) und einen Auszug aus Tolstois Tagebuch (SSdM, S. 208). Die Erzählung von Kornej Wasiljew und seiner Frau unterhält intertextuelle Bezüge mit dem eigenen Leben Tolstois, der, weit von seinem Haus und zugleich von seiner Frau entfernt, die ihn „kränkte“, in der Armut aber heiter stirbt. Die Interdiskursivität erweist sich in der Gegenüberstellung zwischen Tolstoi und den Studenten über den Sinn des Engagements (Erste Szene), in der Religionsfrage zwischen Tolstoi und deren Frau und in der Meinungsverschiedenheit zwischen dem Polizeimeister und dem Stationsvorsteher über Tolstois Status: Gefahr oder großer Mann? Die Literatur wird zu jenem Ort, wo einzelne Diskurse sich treffen. Sie wird zu einem Interdiskurs (Vgl. Gerhard et al., 2004, S. 105).
5.1.2. Stefan Zweig, Russland und Europa
Der Platz, den Zweig Russland in „Sternstunden der Menschheit“ gönnt, überrascht nicht, wenn seine Biographie und seine Rezeption in Russland daran relationiert werden.
In ihrer „Thesis“, betitelt „Stefan Zweig and Russia“, kommt Lidia Zhigunova (2002) auf die Liebesgeschichte zwischen Zweig und Lenins, Dostojewskis und Tolstois Land zurück. Daraus ergibt sich, dass der junge und erwachsene Stefan Zweig sich als Leser genauso wie als Dichter für Russland interessiert hat, indem er Bücher von Dostojewski, Tolstoi und Gorki las sowie Biographien von diesen Riesen der russischen bzw. der europäischen Literatur und Kultur verfasste (Vgl. S. 25). Seine stetige Berühmtheit und Beliebtheit in Russland hat nicht nur damit zu tun, dass er etwas Russland in seinem Œuvre thematisierte, sondern denn „The soviet readers [really] appreciated Zweig’s Talent as an incredible Storyteller...“ sowie sein Einfühlungsvermögen (Vgl. ebd., S. 26). Nicht nur seine Schriften, sondern auch seine Präsenz auf dem russischen Boden erleichterten seine dortige Rezeption. In seinem Essay „Reise nach Rußland“ (2004), das er 1940, also ein Jahr nach seinem Gewesensein in Russland, anlässlich des 100. Geburtstags Leo Tolstois Tod, schrieb, spricht er von der Machbarkeit seines Traumes, dass Russland vollwertiger Akteur des geistigen geeinigten Europas wird. Zweig erfreut sich dementsprechend, dass Leute aus verschiedensten Erdteilen, also Japaner, Chinesen, Amerikaner und selbstverständlich Europäer „die Grenze Rußlands [täglich] überschreiten“ (Vgl. S. 279). Dieses Essay berichtet auch über die Städte, die Religion, die Seele des russischen Volkes im Vergleich zu anderen europäischen bzw. abendländischen Völkern. Zweig bedauert aber den fast totalen Verlust an Terrain der
Religion77 zugunsten der „Ideologie“, der „Führerverehrung“: Das „Heiligenbild der iberischen Muttergott“ bleibt „unbekümmert“, verbleicht, während Lenins Grabmal bzw. dessen Leiche „balsamiert, koloriert [...] raffiniert“ und lebensvoll ist (Vgl. ebd., S. 288f.). Bezüglich der Seele des russischen Volkes erinnert er sich an, im Gegensatz zu europäischen Ländern, ein ,geduldiges’ Volk, dessen „Wartenkönnen“ Revolutionen, Diktaturen o.Ä. überlebt hat. Diese „Energie in der Passivität“, „das gleichzeitig ironische und heroische „Nitschewo“ („Es macht nichts“) ist die „eigentliche und unvergleichliche Kraft“ (ebd., S. 281) des russischen Volkes. Daher kann eindeutig verstanden werden, warum Zweig im „Epilog“ zu seiner „Reise nach Rußland“ die Gleichgültigkeit und Ungerechtigkeit der Europäer gegenüber Russland kritisiert (Vgl. ebd., S. 318). Er lädt sie hingegen dazu ein, wie er selbst, Russland am eigenen Leib zu kosten, anstelle dieses Land wegen „Vorurteile“ und „Nachurteile“ unbereist zu lassen (Vgl. ebd., S. 319). Aufgrund all seiner Errungenschaften und Leistungen sieht Zweig das russische Volk -und deswegen sollte es nicht am Rande des vom ihm gewollten geistigen geeinigten Europas bleiben- als „eines der genialsten und interessantesten Völker dieser Erde“ an (ebd., S. 318).
5.1.3. Sternstunden Amerikas
Der erste Text, der von Amerika spricht, ist „Flucht in die Unsterblichkeit“, daneben haben wir „die Entdeckung Eldorados“ und „das erste Wort über den Ozean“.78
5.1.3.1. „Flucht in die Unsterblichkeit“
5.1.3.1.1. Zum Titel und zur Zusammenfassung
Diese Miniatur ist die Geschichte eines Reisenden bzw. eines Fliehenden namens Vasco Nunez de Balboa, der sein ganzes Leben auf Flucht verbracht hat. Er flieht aus Española, flieht als er weiß, er wird wegen Rebellion verurteilt und flieht wieder, als Pedestrias als Gouverneur in Darien ankommt. Aber jedes Mal ist es eine Flucht bzw. ein Kampf gegen den Tod, ein Kampf für die Unsterblichkeit. Auch wenn es ihm nicht für das zweite Mal gelingt, dem Tod zu entkommen, gelingt es ihm trotzdem, und deshalb ist er in die Sternstunden aufgenommen, den physischen Tod zu überwinden, also ein entkörpertes Überleben in Gedächtnissen und (Geschichts)Büchern.
Die Sternstunde der „Menschheit“, von der hier die Rede ist, ist die am 25. September 1513 stattgefundene Entdeckung des pazifischen Ozeans von Vasco Nunez de Balboa. Es ist „seit Kolumbus die größte Tat für die kastilische Krone“ (SSdM, S. 32). Die Miniatur „Flucht in die Unsterblichkeit“ erzählt von der Geschichte Vasco Nunez de Balboas79 von der Insel Española über die Entdeckung des Mar del Sur bis zu seiner Hinrichtung.
5.1.3.1.2. Wer war vasco Nuñez de Balboa?
Vasco Nuñez de Balboa ist einer der unzählbaren Spanier bzw. Europäer, die, nach Kolumbus Erzählungen von dem Vorhandensein eines Goldlandes in Amerika, Schiffe bestiegen. Und wie viele desillusionierte Segelnde siedle er, nachdem das versprochene Gold unauffindbar wurde, in der Insel Española, wo er genauso wie die anderen „Desperados“ zu einem Schuldner wird. Als Fernandez de Enciso, Rechtsgelehrter und einer der mächtigsten Männer der Insel, ein Schiff ausrüstet, um das von ihm in Castilia del Oro80 „investierte Geld zu retten“81, schmuggelte de Balboa innerhalb einer Kiste in dem Schiff. Unterwegs nach Castilia del Oro trafen sie Francisco Pizarro, der ihnen mitteilte, es gäbe nichts mehr in Kastilien del Oro zu retten. Er selbst wie andere Überlebende und die Kommandantur seien weg. De Enciso wollte nach Española. Da griff de Balboa ein: Er erzählte von einer Insel namens Darien, wo Gold gefunden werden könnte und wo Eingeborene „freundlich“ wären. Über das Gold hatte er die Wahrheit gesagt. Die Mannschaft setzte sich in Darien nieder und es dauerte nicht mehr lang, bis de Balboa die Kommandantur des Schiffes und die Kontrolle über die Insel übernimmt, da er im Gegensatz zu Enciso wusste, wo Gold gefunden werden konnte und da er darüber hinaus mit dem Golderhandeln mit Eingeborenen einverstanden war.
De Balboa ist aber nicht in Ruhe: Er hat sich gegen Enciso rebelliert, ihn vertreibt und den Tod Nicuesas82 verursacht. Er entscheidet sich also, „denn Gold ist Macht!“ (SSdM, S. 14), alle Edelsteine der Insel zu sammeln, um seinen Prozess zu vermeiden bzw. seine Freiheit zu kaufen. Er fängt mit seiner Suche nach Gold in der Umgebung Dariens an. Er unterwirft alle Kaziken83, die ihn sagten, wo er mehr Gold finden kann, also bei einem Volk, das über Darien hinaus und hinter den Bergen „von der mächtigen See“ lebt. Aus dieser Diskussion mit dem Häuptling Comagre erhält er zwei Informationen: Erstens ist, dass es einen anderen weiträumigen Ozean gibt und zweitens ein Ophir. Da war es die gute Gelegenheit, um den Pardon der Krone zu kaufen und mit der Entdeckung des Mal del Sur, seinen Namen unsterblich zu machen. Dem Fünftel des beraubten Goldes beigefügt, schickte er einen Brief mit Emissären nach der Krone, um die Nachricht anzukündigen und um eine ganze Flotte zur Eroberung des Ophirs zu bekommen. Mit dem beraubten Gold bekommt er vom königlichen Schatzhalter namens Pasamonte falsche Dokumente, die von ihm „Generalkapitän“ der Kolonie machten. Am 1. September 1513 startet de Balboa „seinen Marsch in die Unsterblichkeit“ (SSdM, S. 22). Wenige Tage danach, von Indios und seine 190 Soldaten begleitet, geht die Reise los. Über zwei Wochen später, genau am 24. September 1513, stand er vor dem Gebirgskamm. Am 25. September 1513 trotz aller Hindernisse des Dschungels unternimmt er mit 67 Mann den Aufstieg der Gebirge. Um 10 Uhr am selben Tag, da er dem Gipfel der Gebirge nah ist, befiehlt er seine Mann haltzumachen, damit er „allein und einzig“, als erster Spanier, Christ und Europäer seinen „lange[n] und ekstatisch[en]“ (SSdM, S. 27) Blick über das neue Meer werfen kann. Erst danach darf seine Mannschaft kommen, um zu erblicken und an der Besitzergreifungszeremonie84 teilzunehmen. Von den erbeuteten Indios erfährt de Balboa, dass das richtige Goldland sich noch nach Süden befindet. De Balboa kehrt zurück mit dem Rest seiner Mannschaft, um sich für die noch größere kommende Expedition vorzubereiten. Die Expedition zur Entdeckung des Ophirs wird er nie unternehmen. Er geht in die von Pedestria und Francisco Pizarro aufgestellte Falle, wobei er der Rebellion bezichtigt wurde. Er ist verurteilt und hingerichtet.
Aus dieser augenblicklichen Lebensgeschichte Vasco Nunez de Balboas können vieles über seine Charakterzüge gesagt werden: Balboa war ein ehrgeiziger, geldgieriger, egoistischer, hochmütiger, brutaler und gewaltsamer Mann. Das Leben seines Hundes ist wertvoller als das der Menschen selbst.
5.1.3.1.3. Figurenkonstellation
Damit eine Sternstunde zutage tritt, mahnte Stefan Zweig im Vorwort der „Sternstunden der Menschheit“, müssen „Millionen Menschen“ bzw. Stunden am Werk sein, deswegen wird im Folgenden alle für Zweig erinnerungswürdigen Figuren charakterisiert und ihre mittelbare bzw. unmittelbare Rolle in der Entdeckung des Pazifischen Ozeans unter die Lupe genommen.
5.1.3.1.3.1. De Balboas Mannschaft
Franzisco Pizarro: Er ist ein Überlebender aus Castilia del Oro. Lange Zeit ist er de Balboas „Waffenbruder“, „vertraute[r] Freund“ gewesen. Aber da er in de Balboas Schatten stand und nach Unsterblichkeit durstig geworden war, verbündete er sich Pedestrias, damit de Balboa nicht für das zweite Mal, sondern er, dank der Eroberung des Ophirs, ins Geschichtspantheon eintrat.
Leoncico: So heißt de Balboas Hund, der nach der Entdeckung des Mar del Sur und vor allem des Strandes der Perlen von seinem Meister mit 500 Goldpesos belohnt wurde, da „er so wacker [...] den Eingeborenen das Fleisch aus dem leibt gefetzt“ hatte (SSdM, S. 32).
Rodrigo de Bastidas: Mit seiner Lehre hat de Balboa die Küste Zentralamerikas bemeistern können (SSdM, S. 15).
Alonzo Martin: Die Gruppe unter seiner Kommandantur kam am raschesten am Strand beim Abstieg von den Gebirgen zum Meerstrand an. Wie sein Schreiber es verfasste, war er der erste, der seinen Füssen und seine Hände in Mar del Sur netzte (SSdM, S. 28).
Andres de Vara: Ist Pater. Er hat das Te Deum Laudamus (Danksagungsgebet) angestimmt und das Kreuz mit Initialen des Königs von Spanien eingraben lassen.
Andres de Valderrabano: Schreiber der Mannschaft.
5.1.3.1.3.2. Andere historische Figuren
Kazike: Zwei Kaziken werden im Text genannt. Es handelt sich um: Careta und Comagre. Careta war ein mit de Balboa verbündeter Häuptling. Als Beweis für seine „Treue“ hatte er ihm seine Tochter geschenkt. Sie wurde de Balboas Lebensgefährtin. Comagre ist der mächtigste Häuptling in Darien. Er ist derjenige, der dank seiner Informationen de Balboa auf den Weg zum Ozean und Ophir stellte.
Christoph Kolumbus: Er nimmt nicht an der Geschichte teil, er verschwindet nach den ersten Zeilen. Trotzdem ist er die erste genannte historische Figur. Von ihm sagt der Erzähler, er sei ein Fanatiker, dessen „erhabene Narrheit“ keine Grenze kenne. Die Schuld dafür, dass so viele Europäer nach ihm Schiffe bestiegen sind, ist ihm gegeben. Er hatte Geldgier in Europa exportiert und die Türe des neuen Kontinents „Desperados“, „Schuldnern“, ruinierten Existenzen geöffnet, die lediglich an der Zerstörung der Ruhe der Indios gearbeitet haben.
Der namenlose Gouverneur von Española: Er hatte umsonst versucht, aus Konquistadoren, zur Verminderung der Konflikte mit Eingeborenen, Farmer zu machen. Seine Kolonie war die Zuflucht der alle aus Europa stammenden ruinierten Existenzen.
Pedro Arias Da silva alias Pedrarias: Er ist neben Encisco und Pizarro de Balboas wildester Gegner. Er zeichnet sich durch seine Heuchelei aus. Seine in Spanien lebende Tochter verlobte er de Balboa. Er wurde nach Amerika als Gouverneur von dem König geschickt, um de Balboa zu urteilen, den letzten unbekannten Ozean zu entdecken und sich das Ophir im Namen der Krone anzueignen. Aber wegen de Balboas Errungenschaften, der vorangekommen ist, kann er nicht seine eigene Unsterblichkeit haben. Er ist derjenige, der de Balboa zum Tod verurteilt, um freie Hand für die Eroberung des Goldlandes zu haben.
5.1.3.1.4. Fabelanalyse und Erzählsituation
Die Erzählung verläuft größtenteils linear, denn sie ist episodenhaft geschrieben85, obwohl Vorausdeutungen zeitweise zu beobachten sind (SSdM, S. 22ff). Sie werden durch Wörter wie „später“ „noch nicht“ und den Gebrauch des Futurs 1 signalisiert. Ereignisse werden aus einem nahen Standort referiert. Die Erzählzeit umfasst 28 Seiten (S. 9-36) und die erzählte Zeit vier Jahre (1510 - 1514).
Das Verhalten des Erzählers ist teilweise neutral und auktorial. Er ist überall: In Spanien, in einzelnen Inseln Amerikas, auf dem Schiff, auf dem Ozean, auf der terra Firma. Wie ein (historischer) Reporter, der über ein Ereignis Bericht erstattet. Es gibt hinter dem Erzählten eine kritische Stimme, die sich da birgt.
5.1.3.1.5. Formanalyse und Geschichtsschreibungsimplikationen
Der Text zeichnet sich durch seine Polyphonie und seine Interdiskursivität aus. Und das ist einigermaßen verständlich aufgrund der Zahl der Figuren. Aber dies lässt sich nicht in der Textgestaltung immer einfach sehen. Figurenreden werden beispielsweise indirekt wiedergegeben, indem der Erzähler den Konjunktiv 1 bzw. den Konjunktiv 2 verwendet. Die Techniken der Collage und der Montage werden auch angewandt: Worte der Kaziken (SSdM, S. 18) werden nicht im Original dargeboten, sondern deren Übersetzung ins Präsens, ohne Anführungszeichen, ohne Quellenangabe. Jene Aneignung ist ein Beweis für Zweigs Quellenausbeutung. Andere Quellen werden im Text integriert ohne irgendwelche typographische Hervorhebung. Eine perfekte Form der Montage ist auf der Seite 28 vorzufinden, wo der Erzähler einzelne Sätze, diesmal in Anführungszeichen, der Urkunde des Schreibers einnimmt, um den eigenen Text zu schreiben.
Andere historische Dokumente werden auch in den Text eingegliedert. Es handelt sich um den Schluss des Berichts des Schreibers (geschrieben im Präteritum und in der übersetzten Form ohne Quellenangabe dargeboten), den von de Balboa abgelegten Eid während der Besitzergreifungszeremonie am Strand, die durch Anführungszeichen signalisiert werden.
In der Erzählung kommt es auch zu einer gewissen Intermedialität bzw. Gattungshybridität vor, die durch das Vorhandensein von einem sprechenden (SSdM, S. 29) und einem singenden Chor86 (SSdM, S. 27) veranschaulicht wird. Die kritische Stimme ist am Werk zu sehen, als Stefan Zweig die Geschichtswissenschaft kritisiert, da sie „immer nur an den Erfolgreichen rühmt“ (SSdM, S. 34). Deswegen hat er seinen Text so viel mit historischen Quellen geladen. In der Gegenüberstellung der historischen Quellen (SSdM, S. 28 vs. S. 30) weist Zweig darauf hin, dass de Balboa vielleicht als erste Spanier den Pazifischen Ozean erblickt hat, aber keineswegs als erste, was Alonzo Martin tat, seine Füße ins Gewässer des pazifischen Ozeans genetzt hat. Gewissermaßen beweist er, dass die geschichtswissenschaftliche Geschichtsschreibung einen Irrtum begangen bzw. eine Lüge geschrieben hat, der bzw. die er jetzt als Literat korrigiert. In „Flucht in die Unsterblichkeit“ wird die Debatte über das „Naturkind“ und dem „Kulturkind“ in die Tagesordnung gestellt.
Indios erleben einen Kulturschock, als sie Europäer bzw. Spanier beobachten, die bereit sind untereinander zu töten, für das, was in ihren Augen „das wichtigste Ding der Erde“ -also Gold- ist (SSdM, S. 18). Die sog. Eingeborenen ihrerseits sehen in Gold „Nichtigkeiten“ (SSdM, S. 18) „Muscheln und Sand“ (SSdM, S. 30) allein. Auch die Besitzergreifungszeremonie macht keinen Sinn für sie: Erstaunt, sehen sie nur zu (SSdM, 5.27) . Die Raumeroberung kennen sie nicht; sie wissen bzw. verstehen nicht, dass der sog. Kulturmensch ein Raumeroberer ist, der einen prononcierten Sinn für privates Eigentum hat. Auch Stefan Zweig scheint diesen Raumeroberungswettlauf sowie die Natur seiner Genossen nicht zu verstehen. Europäer seien so paradoxal, dass es sich in ihnen eine gewisse edle Wilderei hineinsteckt, darum „[...] rufen sie Gott aus inbrünstiger Seele an und begehen zugleich in seinem Namen die schändlichsten Unmenschlichkeiten“ (SSdM, S. 25).
5.1.3.3. „Die Entdeckung Eldorados“
5.1.3.3.1. Inhaltsangabe und Biographie von Johann August Suter
Johann August Suter ist ein europamüder und abenteuerlicher Schweizer, der, seine Frau und seine drei Söhne hinter sich lassend, 1834 nach den USA reist. Auf der Suche nach einem Ort, wo er sich wohl finden wird, reiste er von Städten nach Städten, Staaten nach Staaten. Seine Reise „ins Unbekannte“ kommt zu Ende, als er in San Franzisko, Hauptstadt Kaliforniens, ankam. Mit der Genehmigung des Gouverneurs Alvaro rekrutierte er „arbeitsame Farbigen“, die ihm bei dem (Aus)bau seines Neu-Helvetiens -durch landwirtschaftliche Arbeit- halfen. Seine „Armee“ hat so eine „gigantische“ Arbeit geleistet, dass Suter sich im Jahre 1839 schon ein riesiges Reich gebaut hatte. Er versorgt Van Couvert, die Sandwich-Inseln und alle Segler, die in Kalifornien landen. Daher wird er im Alter von 45 zu einem der reichsten Männer der Welt. Zu diesem Zeitpunkt knüpfte er Kontakte mit seiner im Stich gelassenen Familie. Im Januar 1848, da situiert Zweig die Sternstunde, nahm sein Leben eine Wende, als sein Schreiner, James W. Marshall, in einem seiner Farmen Gold fand. Als das Gerücht sich bewahrheitet und die Nachricht rund um den Globus ausdehnt, überschwemmen aus allen Ecken der Welt kommende geldgierige Leute, um ein Stückland Kaliforniens, dessen legale Besitzer Suter war, zu bekommen und somit Gold umgraben zu können. Die stehlen seine Landwirtschaftsgeräte und plündern sein Goldreservat. Sogar seine Diener verlassen ihre Arbeit bei ihm zugunsten Goldgrabens. So verschwindet das Neu-Helvetien, um EldoradoKalifornien Platz zu machen. Suter ist wieder ein Bankrotter, er kehrt in eine Farm zurück und verlässt sein Reich. Ein anderes Unglück kommt hinzu: Seine Frau ist mit den Söhnen gekommen und sobald sie ihre Füße in Kalifornien setzte, starb sie an „Erschöpfung“. Suter und seine Söhne treiben Landwirtschaft und bald findet er sein Prestige wieder.
Als Kalifornien zu einem Staat der Union der Vereinigten Staaten im Jahre 1850 geworden ist, startet Suter eine Justizprozedur gegen 16221 Farmer, er reklamiert Kalifornien 2.5 Millionen und die Union 2.5 Millionen auch zum „Schadenersatz“ und zur ,Wiedergutmachung‘. Nach vier (04) langen Jahren gewinnt Suter und dessen älterer Sohn (Emil), der sein Anwalt war, den Prozess. Richter Thompson ernannt ihn zum „vollkommen[en]“ Rechthaber auf Erde Kaliforniens. Diejenigen Desperados, die unehrlich reich geworden waren, sind nicht mit dem Urteilsspruch einverstanden. Also stecken sie das Parlamentshaus in Brand und rächen sich auf Suters Söhne, die sie ermordet oder zum Selbstmord zwingen. Suter ist verwüstet. Während der 20 folgenden Jahre seines Lebens sucht er nach Recht und Justiz über seine Rechthaberschaft auf Kalifornien. Von dieser Last machte ihn ein Herzschlag am 17. Juni 1880 frei.
5.1.3.3.2. Fabelanalyse und Erzählsituation
Die erzählte Zeit dauert 46 Jahre, die in 11 Seiten (141 - 150) erzählt werden. Dabei reüssiert Zweig dank des elliptischen Erzählens, den Geist der Miniatur aufrechtzuhalten. In der Tat wird über die Zeitspanne 1860 - 1880 in ein paar Zeilen von dem Routineleben Suters erzählt, der Tag um Tag den Kongresspalast „umlungert“. Die Geschichte wird, wie in fast allen Miniaturen Zweigs, episodenhaft erzählt und ins Präsens, damit der Leser die Illusion der Unmittelbarkeit, der zeitlichen Nähe hat. Die Handlungsstruktur aber beinhaltet viele Vorausdeutungen und wenige Rückblende. Die erste Rückblende weist auf die Benamsung San Franzisko hin, die „nach der Mission der Franziskaner genannt“ wurde (SSdM, S. 142). Eine andere Rückblende tritt bei Suters Vergleich mit dem König Midas auf, der als reichster Mann der Welt „im eigenen Gold erstickt“ (SSdM, S. 146).
Die Rückblende in dieser Miniatur lädt zur Verfremdung ein, sie lädt den Lesenden dazu ein, Recherche über Kaliforniens Benamsung und den König Midas zu machen. Die Vorausdeutung knüpft sich an die schon erwähnte Rückwendung an. Der Erzähler spricht von dem heutigen Kalifornien (einer Metropole) und Kalifornien, wo Suter sich niedersetzte. Als Suter in Kalifornien siedelte, war es „nur ein elendes Fischerdorf“ (SSdM, S. 142), das später durch seine Arbeit und die Emigration der Goldsuchenden zu einer Riesenstadt wurde. Die Vorausdeutung dient auch dem auktorialen, allwissenden, Erzähler. Der Erzähler täuscht den Leser, lässt die Spannung hoch werden. Er kündigt an, dass Johann August Suter der reichste Mann der Welt ist und in der darauffolgenden Zeile stellt er die Frage: „Der reichste Mann der Welt?“ (SSdM, S. 145 und S. 148). Auf diese Frage antwortet er selbst: „nein, [...] der ärmste Bettler“. Erst am Ende der Geschichte erfährt der Leser, dass die Antwort nicht paradoxal war, sondern eine Vorwegnahme über Suters Situation bzw. Aussehen während der letzten Jahre seines Lebens, die nur „erbärmliche Bettlerjahre“ waren. Eigentlich bettelt Suter, aber nicht um Münze, sondern um „Recht“, „Prozess“, selbst wenn es seine Kleider sind, die an einen Bettler denken lassen. Seine Armut reimt sich auf seine Einsamkeit. Er war vielleicht reich an Geld, aber arm an Wärme seiner Familienmitglieder. Er brauchte sie, um mit ihnen sein Vermögen zu teilen. Über Suters Elend drückt sich der Er- Erzähler in folgenden Worten aus:
„Er selbst will kein Geld, er hasst das Gold, das ihn arm gemacht, das ihm drei Kinder ermordet, das sein Leben zerstört [hat]. Er will nur sein Recht und verficht es mit der querulantischen Erbitterung des Monomanen. Er reklamiert beim Senat, [...] beim Kongress...“ (SSdM., S. 149).
Dies ist auch zugleich ein Beweis für die Vertrautheit des Erzählers mit der Hauptfigur, deren äußere Merkmale er beschreibt, aber auch von ihren Leiden und Plänen Bescheid weiß. Die Stimme des Autors lässt sich auch in „Die Entdeckung Eldorados“ geltend machen. Der auktoriale Erzähler meint, eine Frau habe das Geheimnis, dass Gold in einer Farm nach Coloma gefunden wurde, verraten, denn seines Erachtens sei die Frau „immer“ Verräterin gewesen (SSdM, S. 145). Das ist eine Generalisierung, die, für jemanden, der sich zu einer Geschichtsschreibung ohne ,Erfindung‘ und ,Verfärbung‘ bekennt, mit Skepsis zu betrachten ist. Trotz dieses misogynen Auswegs bleibt Stefan Zweig zum Teil objektiv. Die Miniatur „Die Entdeckung Eldorados“ kommt nicht zufällig nach „Flucht in die Unsterblichkeit“ vor. In der Tat haben diese Texte gemeinsam, dass sie den Kapitalismusaufstieg zum Thema machen.
5.1.3.4. Die anderen Sternstunden Amerikas
„Das erste Wort über den Ozean“ erzählt von der Verlegung des ersten Telegraphenkabels im Atlantik sowie der Vernetzung bzw. der Raum-Zeit-Verdichtung zwischen Amerika und Europa. Im Zentrum dieser Geschichte steht Cyrus W. Field.
Eine andere Sternstunde Amerikas ist „Wilson versagt“. Die ist in der aus 14 Miniaturen bestehenden Ausgabe, erschienen bei Fischer Taschenbuch Verlag, zu finden. In diesem Text kommt Zweig auf das politische Scheitern des 28. US-Präsidenten bei der Friedensverhandlung nach dem Zweiten Weltkrieg zurück.
5.1.4. Sternstunde Englands
5.1.4.1. „Der Kampf um den Südpol“
5.1.4.1.1. Zusammenfassung
In dieser Miniatur erzählt Zweig die Expedition nach dem Nordpol des Kapitäns Robert F. Scott wieder. Der Mann, der als Zweiter, nach dem Norweger Amundsen, den Nordpol gesehen hat.
5.1.4.1.2. Wer war Robert F. Scott?
Um sein physisches Porträt zu zeichnen, bedient sich Zweig impliziterweise Erinnerungsmedien wie des Fotos und des Tagebuches. Aus ihrer Ausbeutung ergibt sich, dass Scott „irgendein Kapitän“ ist, dessen Gesicht „kalt, energisch [und] ohne Muskelspiel“ ist. Sein Stil ist „klar und korrekt“, seine Schrift „irgendeine englische Schrift“. Er hat eine junge Frau und einen Sohn. Sein Schiff heißt „Terra Nova“ und hat 30 Mann. Er ist bei der Heimfahrt im Winter 1912 gestorben.
Trotz der Tatsache, dass „der erste alles ist und der zweite nichts“ (SSdM, S. 235), sind Scott und seine Mann in den „Sternstunden der Menschheit“ für ihren Mut, „Heroismus“ und ihren Ehrensinn aufgenommen. Helden sind sie, denn sie sind dem Tod mit Stolz entgegengestanden bzw. mit Entschlossenheit akzeptiert haben. Ewig wirken Scotts vier hinterlassene Briefe aufgrund ihres glokalen und entterritorialisierten87 Charakters. Zweig lässt diesbezüglich den Erzähler sagen: „An Menschen sind sie gerichtet und sprechen doch zur ganzen Menschheit. An eine Zeit sind sie geschrieben und sprechen für die Ewigkeit“ (ebd., S. 240). Es handelt sich um den Brief an seine Frau, den Brief „an die Frau und die Mutter seiner Lebensgefährten“, worin er ihr Heldentum lobt, den Brief an die Freunde, worin er seinen Stolz ausdrückt, Freunde wie die Seinigen zu haben und den Brief an die englische Nation, worin er die Hindernisse seines Kampfs um den Südpol kurz schildert und die letzte Tapferkeitslehre erteilt, nämlich dass Hintergebliebene niemals zu verlassen sind.
5.1.4.1.3. Fabelanalyse und Erzählsituation
Die erzählte Zeit geht vom 1. Juni 1910 (Abfahrttag) über den 18. Januar 1912 (Tag, an dem Scott mit seinen vier Erlesenen den Nordpol erreichten) bis zum 12. November 1912 (Tag, an dem die Rettungsexpedition Scotts, Wilsons und Bowers‘ Leichen in ihrem Zelt fand) über und die Erzählzeit aber von der Seite 223 bis 242. Die Geschichte läuft chronologisch.
Die Personenreden werden indirekt wiedergegeben. Manchmal ist der Erzähler auch dazu fähig, abgesehen von den Beschreibungen aus der Perspektive Scotts, in den Kopf der Figuren hinein zu penetrieren und deren intimsten Gedanken zum Ausdruck zu bringen. Er wird also personal und zugleich auktorial. Der Reporterstil und die Verwendung des Präsens als Erzähltempus geben dem Leser gegenüber dem Erzählten eine erhebliche Nähe. Der Erzähler vermittelt das Geschehen wie ein privilegierter Zeuge, der Scott und die Seinigen bei der Expedition begleitet.
5.1.4.1.4. Formanalyse
Diese Geschichte der Südpoleroberung hat Zweig dank Gedächtnisbewahrer wie des Tagebuches und Bilder Scotts und seiner Mann erzählen können. Jene Tagebuchaufzeichnungen, die mitunter direkt als auch paraphrasiert wiedergegeben werden, verhelfen dazu, dem Geschichtslauf zu folgen. In der Tat verzeichnet Scott darin in Breitengrad bzw. in Kilometer die restlichen Distanzen zu dem Südpol. Er drückt auch darüber hinaus darin seine Enttäuschung sowie seine Desillusionierung aus. Es ist auch dank dieses Tagebuchs und der hinterlassenen Briefe, dass die Namen der vier „Auserwählten“, die gemeinsam mit Scott den Nordpol gesehen haben dürften, bekannt wurden.
5.1.5. Sternstunden Frankreichs
5.1.5.1. „Das Genie einer Nacht“
5.1.5.1.1. Zusammenfassung
In der Nationalversammlung gehen Meinungen auseinander. Die Einen sind für die Erklärung des Kriegs an die „Koalition der Kaiser und Könige“ und die Anderen für Frieden. Am 20. April 1792 erklärt Ludwig XVI. „den Krieg an den Kaiser von Österreich und den König von Preußen“. Vom 20. bis zum 25. April finden Ausrüstungen und Vorbereitungen statt. Am 25. April erreicht die Nachricht Straßburg. Der Bürgermeister von Straßburg Friedrich Baron Dietrich liest die Kriegserklärung am Hauptplatz vor und organisiert ein Fest, um die Bevölkerung anzufeuern. Der Bürgermeister fragt den Musikdilettanten Kapitän Rouget de Lisle danach, ein Kriegs- bzw. ein Marschlied für die am folgenden Tag an die Front zu marschierende Rheinarmee zu komponieren. Rouget akzeptiert und in der Nacht vom 25. zum 26. April gelingt es ihm, dank einer wunderbaren Inspiration ein anziehendes Lied zu komponieren. Das Lied wurde vorgespielt, gedruckt und am Abmarschtag gespielt und ist dann ins Vergessen geraten. Am 22. Juni aber eignen sich die Marseiller dank Mireur88 dem Lied an, das letztendlich mit der Zeit Nationalhymne wird. Das Lied wird usurpiert und tritt in die Unsterblichkeit. Der Urheber aber stirbt in der Anonymität.
5.1.5.1.2. Wer war Rouget de Lisle?
Rouget de Lisle ist, dem Text nach, 1760 geboren und 1836 im Alter von 76 in Choisyle-Roi gestorben. Er war junger Hauptmann vom Festungskorp, der „in der Grande Rue 126“ in Straßburg wohnte und „Musikdilettant“, dessen Verse und Opern bis zu seinem patriotischen Marschlied stets „refüsiert“ waren. Nachdem er die Königsabsetzung und die Diktatur der Robespierristen überlebt und auf die von abwechselnd Carnot, Bonaparte und Louis Philippe Rehabilitierungsversprechen gewartet hat, stirbt er 1836 in dem Elend und der Anonymität.
5.1.5.1.3. Fabelanalyse und Erzählsituation
Diese Miniatur ist nicht episodenhaft geschrieben. Trotzdem können Leerstellen unter Abschnitten innerhalb des Textes beobachtet und somit die Momente der Geschichte daraus rekonstruiert werden. Die Einleitung des Textes geht von der Seite 93 bis 98 über und stellt den historischen Hintergrund der Komposition des Liedes dar; der Hauptteil von der Seite 98 bis 108 beschreibt die Nacht der Komposition des Liedes und dessen historischen Weg, bis es die Marseillaise (Nationalhymne) geworden ist; und von Seite 108 bis 111 behandelt der Text Rougets Untergang. Durch diese visuelle Teilung ist der miniaturisierende Geist beibehalten.
Die Zeitgestaltung entkommt auch diesem Miniaturgeist nicht. Die Erzählzeit umfasst 19 Seiten (S. 93 - 111) und die erzählte Zeit 44 Jahre (1792 - 1896). Diese Seitenökonomie (Zeitraffung) ist auf die elliptische Erzählung zurückzuführen: Einige Zeitspannen werden also nur vorübergehend erwähnt. Die Erzählung verläuft hauptsächlich chronologisch, obwohl es eine Vorausdeutung gibt, was den usurpierten Namen des Lieds -„die Marseilleise“- und seinen endgültigen Status -„das vorbildliche [...] Nationallied eines ganzen Volkes“ - (SSdM, S. 103) angeht. Der Blick des Erzählers auf das Erzählte zeichnet sich durch eine gewisse Vertrautheit aus. Die unterschiedlichen Möglichkeiten der Erzählperspektive, des Erzählverhaltens, des Erzählerstandorts sind am Werk. Der Erzähler ist der Hauptfigur nah, allwissend von seinem Leben, seinem Schicksal. Diese totale Kenntnis der Hauptfigur beweisen auch seine Reflexionen und Kommentare. Die Geschichte, indem sie sich damit nährt, wird detailreich und wirkt faktual. Wie in anderen Miniaturen üblich bedient sich der Erzähler des Präsens als Erzähltempus. Jenes historische Präsens hat eine aktualisierende
Funktion und schafft die Illusion der Teilnahme der Lesenden an der Geschichte. Figurenreden werden nicht unmittelbar wiedergegeben. Sie werden mittels der indirekten bzw. der erlebten Rede zur Sprache gebracht.
5.1.5.1.4. Formanalyse und Geschichtsschreibungsimplikationen
Das äußere Gerüst des Textes veranschaulicht die Techniken der Montage und der Collage. In der Tat werden Strophen der Marseillaise, nämlich die erste (SSdM, S. 99) und die vierte (SSdM, S. 100), im Text angeklebt. Dadurch wird die Hybridität bzw. die Intermedialität der Erzählung verdeutlicht: Verse werden in Umgang mit der Prosaform und Musik mit Literatur gebracht. Eine andere historische Quelle bzw. ein anderes Erinnerungsmedium, die bzw. das innerhalb des Textes vorzufinden ist, ist der ihrem Bruder geschriebene Brief der Gattin des Bürgermeisters, in dem sie die erfolgreiche Komposition eines „anziehend[en]“ Liedes mitteilte (SSdM, S. 102f.). Dieser Briefauszug wird ins Deutsche übersetzt, in Anführungszeichen gesetzt und im Text integriert. Auch Zitate der Anfeuerungsansprache des Bürgermeisters werden im Original, aber übersetzt wiedergegeben (SSdM, S. 96ff.). Die Übersetzung sowie das Vorhandensein der Originalfassung von historischen Texten zeugen von Zweigs Auseinandersetzung mit der Geschichte. An manchen Stellen macht er durch den Übersetzungsakt die Geschichte zugänglicher, gerade darum braucht er fast nie die Quelle (in ihrer Ganzheit) anzugeben. Vorteilhaft ist aber auch, dass der Erzähler so mutig und ehrlich ist, dass, er, wo historische Quellen fehlen, Lücken der Geschichte mit dem ,Wahrscheinlichen’ (SSdM, S. 102), dem ,Scheinbaren’ (SSdM, S. 102f.) und dem „Vielleicht“ (SSdM, S. 108) ausfüllt.
Der „discours“, der sich hinter die „histoire“ „das Genie einer Nacht“ verbirgt, so lassen Kommentare und Reflexionen des Erzählers darauf hindeuten, ist die Rehabilitierung Rougets bzw. der Stadt Straßburg und die Kritik an der geschichtswissenschaftlichen Geschichtsschreibung. Der Geschichtswissenschaft wird vorgeworfen, dass sie an dem historischen Irrtum und historischer Ungerechtigkeit gegenüber Rouget de Lisle schuld ist. In der Tat, während Rouget im „Dunkel“ „verdämmert“, sind die Marseiller und die Hymne in die Unsterblichkeit hineingetreten. Antithesen, auf denen der Text gebaut ist, unterstreichen das Gewicht dieser Ungerechtigkeit. Während „der höchst unberühmte Schöpfer [d]es ewigen“ Heimatsliedes vergessen wird und unbekannt stirbt, wirkt die Hymne international und ewig. Auch die Attitüde der politischen Gewalt, derer Rougets Rehabilitierung einerlei war, ist von Zweig stark kritisiert, dergestalt, dass der auktoriale Erzähler den Guillotinentod „heldischer“ als das „so klägliche Verdämmern im Dunkel“ findet (SSdM, S. 109), das Rouget zu seiner Lebenszeit hat ertragen müssen, da er ohnmächtig dem Ausschluss aus dem Erfolg seines Werkes beiwohnte. Wenn Geschichtswissenschaftler89 (rechtzeitig) ihre Arbeit gemacht hätten, hieße heute die französische Nationalhymne anstelle der „Marseillaise“ sicherlich die „Straßbourgeoise“90.
Der Erzähler kritisiert darüber hinaus die Tatsache, dass Generäle - „Immer Generäle“ (SSdM, S. 96) - und Politiker junge Leute und das Volk augenblicklich zerstreuen und täuschen, indem sie durch (Abend)feste und patriotische Lieder an die Kriegssiegessicherheit glauben machen und somit unschuldige und naive Leute zum Tod schicken (SSdM, S. 96f.). All dies, zuzüglich des tragischen Untergangs der Geschichte, schreibt dem Text einen tragisch-pathetischen und satirischen Grundton zu.
Der Erzähler interessiert sich letztendlich für die Komposition. Obwohl die wunderbare Inspiration nicht immer nach Belieben vorkommt, ist sie nur, wenn sie zutage tritt, einfaches Auflesen von dem Gehörten, dem Gelesenen, wobei die einzige mühelose Leistung des Komponisten darin besteht, Harmonie in der Komposition zu schaffen. In diesem genialen Augenblick ist der Dichter bzw. der Komponist kein ,Erfmder‘, er wird besessen, durch eine überlegene transzendentale Kraft instrumentalisiert. Rouget wird plötzlich inspiriert, als gebe es eine Muse, die an seinem Ohr spricht, findet „hastig“ die Worte und die dazu entsprechende Melodie, schläft ein und als er aufweckt, erinnert er sich weder an den Kompositionsakt noch an das -produkt.
Vielleicht ist es diese Erfahrung, die ihn von der Möglichkeit der „Geschichte als Dichterin“ überzeugt hatte, wobei die erstere -genauso wie Rouget im genialen Zustand- „gar nicht zu dichten, zu erfinden“ braucht und der Dichter als Harmoniebringer, als derjenige, der das Historische „nur in Reime“ bringt, dient. Somit wird es klar, am Beispiel Rougets, dass das künstlerische Schaffen nicht immer mit Schwitzen zu tun hat.
5.1.5.2. „Die Weltminute von Waterloo“
5.1.5.2.1. Zusammenfassung und Aufnahme der „Weltminute von Waterloo“ in den Sternstunden
In dieser Miniatur -im Gegensatz zu dem, was der Untertitel „Napoleon 18. Juni 1815“ ankündigt- geht es um die Geschichte von dem Marshall Grouchy, dem die Schuld für Napoleons Niederlage in der Waterloo-Schlacht gegeben wird, da er sich nicht traute, gegen die Befehle des Kaisers zu handeln.
Die „Weltminute von Waterloo“ gehört zu den Sternstunden der „Menschheit“ bzw. der „Weltgeschichte“, denn die sekundenlange ,Überlegung‘, Unentschlossenheit und Zögerung Grouchys hat „sein eigenes Schicksal, das Napoleons und das der Welt“ einen anderen Lauf gegeben.
5.1.5.2.2. Wer war Marschall Grouchy?
Der täuschende Untertitel lässt uns an Napoleon vorab denken, aber wenn die Geschichte bis zum Ende gelesen wird, kann festgestellt werden, dass Napoleon früher als Grouchy in der Geschichte verschwindet. Grouchy ist 1766 geboren und 1847 gestorben91. Er ist Marschall und:
ein mittlerer Mann, brav, aufrecht, wacker, verlässlich, ein Reiterführer [...] und nicht mehr. Kein heisser, mitreißender Kavallerieberserker wie Murat, kein Stratege, wie Saint-Cyr und Berthier, Kein Held wie Ney. [.] Zwanzig Jahre hat er gekämpft in allen Schlachten, von Spanien bis Russland, von Holland bis Italien [.](SSdM, S. 115).
Diese kleine Biographie und dieses Porträt Grouchys zeigen, dass er nichts in sich hat, was ihn zu Ruhm und Unsterblichkeit bereitet. Er hat zwar Erfahrung mit Krieg aber als „subalterner Mensch“. Es ist gegen seinen Willen, dass Napoleon, da die anderen Marschälle entweder gestorben oder müde waren, ihm den Auftrag dazu erteilt, die preußische Armee um Blücher bei der Verstärkung Wellingtons, der allein auf dem Waterloo-Schlachtfeld gegen Napoleon ist, zu verhindern92. Sein Scheitern ist aber darauf zurückzuführen, dass er an einer entscheidenden Minute weder Mut noch Kühnheit beweist: Als Grouchys Unteroffiziere Kanonentöne hörten und den Marschall über die Möglichkeit des Schlachtanfangs in Waterloo informierten, stellte er sich taub (SSdM, S. 120). Diesen Irrtum hat er die Angelegenheit zu korrigieren, als seine Unteroffiziere ihm Bescheid geben, dass es sehr möglich sei, dass der Rückzug der preußischen Armee eigentlich ein Flankmarsch zum Schlachtfeld ist (SSdM, S. 122). Aber diesmal noch, während er erst drei Stunden weit von Waterloo ist, beweist er keinen Initiativgeist, wobei er auf eine „Gegenordre vom Kaiser“ wartet. Als Grouchy erfährt, dass Napoleon -seiner Schuld wegen- gesiegt wurde, nimmt er öffentlich, in Tränen, vor seinen Unteroffizieren, die ganze Schuld auf sich und bittet um Pardon (SSdM, S. 127). Er wird aber bei Zweig zu einem Held -aber daran wollen sich geschichtswissenschaftliche Geschichtsschreiber nicht erinnern-, als es ihm gelingt, das restliche Heer unter seiner Kontrolle wohlbehalten zu Hause hin zurückzuführen (SSdM, S. 128). Es ist wegen dieser zwei historischen Akte: Öffentliche Verzeihung und „meisterhafte taktische Leistung“, dass Grouchy zu Hauptfigur der Waterloo-Schlacht und dementsprechend in den Sternstunden aufgenommen wird.
5.1.5.2.3. Fabelanalyse und Erzählsituation
Der Handlungsverlauf der Geschichte schwankt zwischen Chronologischem und Anachronistischem. Die erzählte Zeit geht vom 15. Juni 1815 bis zu Grouchys letzten Lebensjahren93 über. Die Erzählzeit, gemessen an die Seitenzahl, umfasst 16 Seiten (S. 112128). Neben der elliptischen Erzählung kann eine Zerstückelung der Zeit beobachtet werden. Der 17. und der 18. Juni, die die längsten Tage sind, werden nach Stunden bzw. nach Tageszeiten zum Zweck der details- bzw. informationsreichen Erzählung geteilt. In dieser Miniatur kommen Rückwendungen und Vorausdeutungen vor, die den Handlungsverlauf unterbrechen. Während Rückwendungen -wie es der Fall in zahlreichen Miniaturen ist- der Biographie dienen (SSdM, S. 115), erfüllen Vorausdeutungen eine antizipatorische Aufgabe, indem sie die Leserschaft über den Ausgang der Waterloo-Schlacht ins Vertrauen ziehen. Darum wird es deutlich, dass die Waterloo-Schlacht an sich weniger relevant als Grouchys Schicksal ist (SSdM, S. 121f.). Zweig kehrt die Geschichtsschreibungstechnik um, indem er das Nebensächliche zum Hauptsächlichen macht.
Der Erzähler in „Die Weltminute von Waterloo“ zeichnet sich durch seine Nähe gegenüber dem Erzählten aus. Der Erzähler scheint ein privilegierter Beobachter der Geschichte zu sein. Manchmal hat der Leser den Eindruck, dass der Standort, aus dem heraus der Erzähler beobachtet, der eines historischen Zeugen sei. Er hat keineswegs eine bloße globale Kenntnis des Erzählten. Diese Vertrautheit und Kenntnis können auch durch das Stunde-Nach-Stunde- Folgen des Erzählten bewiesen werden. Der Erzähler wird m. E. zu einem Berichterstatter bzw. einem Reporter. Es ist aber seine Aneignung und Domestizierung der historischen Quellen, die dabei diese Illusion schafft.
5.1.5.2.4. Formanalyse und Geschichtsschreibungsimplikationen
Der Text ist so genügend mit historischen Informationen geladen, dass der Leser nicht mehr braucht, in einem Geschichtsbuch nachzuschlagen. Die Glaubwürdigkeit zeigt bei Zweig ihre Überzeugungskraft. An Zweigs Geschichten wird geglaubt, denn er besitzt das Talent, sie glaubwürdig zu machen. Historische Daten werden mit Genauigkeit erwähnt, Tageszeit nach Tageszeit wird berichtet über, was passiert. Namen von historischen Gestalten werden erwähnt. Beispiele von solchen Namen sind: Wellington, Napoleon, Blücher, Grouchy, Gerard, Vandamme, Saint-Cyr, Desaix, Ney, Kleber, Lanne. In der russischen Ausgabe werden sie nicht bloß erwähnt, sondern in Fußnoten deren Geburts- und Todesjahr angegeben.
Die Figurenrede ist auch ein Beweis für die Glaubwürdigkeit der Geschichte. Der Leser glaubt einfach, denn er kann nicht kategorisch beteuern, dass die den Figuren zugeschriebenen Aussagen und Gedanken ihnen gehören oder nicht. Die Personenrede setzt sich aus auf Französisch Originalzitaten und ins Deutsche übersetzten Zitaten zusammen. Dies kann zweierlei interpretiert werden: Originalzitate auf Französisch verleihen dem Text eine gewisse historische Glaubwürdigkeit, während diejenigen auf Deutsch von Zweigs domestizierendem Umgang mit den historischen vorhandenen Quellen zeugt. Beispiele von direkten Redewiedergaben sind: „Vive l’Empereur!“94 (SSdM, S. 118), „sauve qui peut“95 (SSdM, S. 125); „Wo ist Grouchy? Wo bleibt Grouchy?“ (SSdM, S. 123)96.
Andere ästhetische Merkmarle des Erzähltens sind seine episodische Strukturierung und das Erzähltempus (das Präsens). Das historische Präsens aktualisiert, vergegenwärtigt bzw. appräsentiert die erzählte Geschichte, indem es die zeitliche Distanz mehr oder minder vernichtet. Durch die Technik des Nebensächlichen, des Fragmentarischen und der Nebengeschichte bzw. Rahmengeschichte gelingt es dem Autor, das Augenmerk des Lesers auf Grouchy zu deplatzieren und somit von ihm den besiegten Held zu machen. In der Miniatur wird kein Akzent auf die Schilderung der Waterloo-Schlacht gesetzt, weil Geschichte zu Dichterin wird. Der Dichter braucht demnach nicht mehr einzugreifen:
Sie [Die Waterloo-Schlacht] ist ein Kunstwerk der Spannung und Dramatik mit ihrem unablässigen Wechsel von Angst und Hoffnung, der plötzlich sich löst in einem äußersten Katastrophenmoment. Vorbild der echten Tragödie, weil in diesem Einzelschicksal das Schicksal Europas bestimmt war [...] (SSdM, S. 119).
Die Eigenart der zweigschen Waterloo-Schlacht entgegen derer anderer Literaten, wie Walter Scott und Stendhal liegt darin, dass er weder die Schlacht noch Napoleon ins Zentrum der Geschichte rückt (SSdM, S. 118).
5.1.6. Die Sternstunde Deutschlands
5.1.6.1. Die Marienbader Elegie97
5.1.6.1.1. Zusammenfassung, zum Titel und zur Aufnahme der Miniatur in den Sternstunden
In dieser Miniatur bietet Stefan Zweig die Entstehungsgeschichte des von Goethe im Alter von 74 geschriebenen Gedichts „Die Marienbader Elegie“ sowie seine Bedeutung für die spätere Produktion bzw. das Leben des deutschen Dichters dar.
„Die Marienbader Elegie“ mit Untertitel „Goethe zwischen Karlsbad und Weimar 5. September 1823“ gehört zu den Sternstunden der Weltgeschichte aus drei (03) Gründen: Erstens, was das Gedicht an sich angeht, ist es ein „großartiges Gedicht“ (SSdM, S. 135) aufgrund seiner ,magischen Verdichtung’ und der ,Leidenschaft', mit der Goethe es geschmiedet hat. Darüber hinaus zeichnet sich das Gedicht durch seine „kristallene[n] Strophen“ (SSdM, S. 134), die ferner die „reinsten Strophen“ aller Sprachen und aller Zeit seien (SSdM, S. 135). Zweitens ist Goethe wegen dieses Gedichts erkrankt worden, da es ihn an Ulrike von Levetzow erinnerte und weil seine Hausgenossen die Idee seiner eventuellen Heirat mit der 19-jährigen Ulrike mit Spott, „Hohn“ und „Hass“ empfangen hatten. Es ist drittens wiederum dieses Gedicht, das „Jugend“ in Goethes Körper zurückbringt. Zelter, der ihm zur Zeit seiner Krankheit nach Karlsbad das Gedicht jeden Tag vorlas, sprach eben von einer „Heilung vom [demselben] Speer, der ihn verwundet hatte“ (SSdM, S. 138). Es ist nach seiner Genesung, dass Goethe seiner pädophilen Liebe zu Ulrike von Levetzow den Rücken kehrt und seinem künstlerischen Schaffen nachgeht. Dies fasst Zweig zusammen, wie folgt: „[..] die „Marienbader Elegie“, [von Johann Wolfgang von Goethe, ist] das bedeutendste, das persönlich intimste und darum von ihm auch geliebteste Gedicht seines Alters, sein heroischer Abschied und sein heldenhafter Neubeginn“ (SSdM, S. 130).
5.1.6.1.2. Historische Gestalten
5.1.6.1.2.1. Johann Wolfgang von Goethe
Ausgehend von den sich im Texte befindenden Daten sowie die Altersangabe lässt sich Goethes Geburts- und Todesjahr leicht kalkulieren. Goethe ist 1749 geboren und 1830 im Alter von 81 in Weimar gestorben. Er ist der „großherzoglich sachsen-weimarsche Geheimrat“, Dichter und Gelehrte, also der „Mann, den Deutschland, den Europa als der Weisesten der Weisen, den reifsten und abgeklärtesten Geist des Jahrhunderts“ (SSdM, S. 132) bezeichnet. Das kaschierte bzw. das in seinen Biographien nicht erscheinende Bild ist nicht das des Gelehrten, des vernünftigen Mannes, sondern das des 74-jährigen genusssüchtigen Mannes, des sexuellen Vagabunden und des Frauenmannes, wobei diese „Frauennähe“ seine Inspirationsquelle und sozusagen sein Jungbrunnen ist. Es wird u. a. Frauen Lili Schönemann, „die schöne Polin, die Szymanowska“ und Ulrike von Levetzow genannt. Was diese Letzte angeht, hat sich Goethe ihr gegenüber wie ein Hexer bzw. ein Oger verhalten, der, ihr von Marienbad nach Karlsbad folgend, deren Jugend fressen wollte, um zu verjüngen. Somit wird der „Weiseste der Weisen“ als ein Pädophil persifliert, der mit einer einseitigen Liebe rechnet98.
5.1.6.1.2.2. Die Frauen
Ulrike von Levetzow ist 19 Jahre alt. „Vor fünfzehn Jahren hat er [Goethe] ihre Mutter geliebt und verehrt“. Zu dieser Zeit war sie noch vier. Ihr hat sich Goethe unter der Maske des Vaters bzw. des Paten angenähert und bald ging es um Werben. Da er sich aber dafür schändlich fühlte, verschickte er in seinem Namen den Großherzog, den „ältesten seiner Gefährten“, damit er an seiner Stelle bei Ulrikes Mutter die Hand ihrer Tochter gewinnt. Das Mädchen aber sieht Goethe als einen Vater an, den sie seit ihrem vierten Lebensjahr als den Freund ihrer Mutter kennt. Auch wenn sie Goethe küsst, darauf insistiert der Erzähler, geht es um einen „töchterliche[n]“ Kuss (SSdM, S. 133), den Goethe aufgrund dessen Zärtlichkeit in einen Liebeskuss verwandelt. Somit kommt es zu einem ,lächerlichen’ bzw. „grotesken“ Quiproquo zwischen Goethe und dem Mädchen. Der Erzähler zieht die Aufmerksamkeit der Lesenden auf die Unmöglichkeit dieser Liebesbeziehung, indem er mehr als zehnmal entweder Goethes Alter („der Vierundsiebzigste“) oder den Ausdruck „der greise Mann“ repetiert.
Über die „schöne“ Polin, „die Szymanowska“ und Lili Schöneman wird fast gar nichts gesagt. Das Einzige ist, dass Goethe ein Liebesverhältnis mit ihnen unterhielt, als er weniger als 30 war (SSdM, S. 131). Die sind einfach nicht bei Zweigs Goethes Lebenslauf wichtig - zumindest in diesem Augenblick der Wende in seinem Leben.
5.1.6.1.2.3. Goethes Freunde und Familie
Es handelt sich um Stadelmann, „der alte Diener“ und John, der Sekretär, „dessen Hand fast alle Goethe-Werke des neuen Jahrhunderts zum ersten Mal“ (SSdM, S. 129) schrieb. Diese zwei Figuren, vor allem John, sind Unbekannte der Geschichte und bekommen in Zweigs Geschichtsschreibung ihre Berühmtheit.
(Karl Friedrich) Zelter99 ist „der Vertrauteste seines Herzens“ (SSdM, S. 138) und dies gibt er zu erkennen, als Goethe nach seiner Rückkehr in Weimar schwerkrank wird. Der letzte Freund, von dem es die Rede ist, ist Eckerman. Er ist der erste100, der -nach Goethe selbst- die Marienbader Elegie liest. Damit wird er zum Lektor und vielleicht Verleger von Goethes Texte, da letzterer ihm Informationen über die Entstehung des Gedichtes liefert. In diesem Text ist es die Rede auch von Goethes namenlosem Sohn und Schwiegertochter. Über den Sohn gibt es allein zu wissen, dass er seinen Vater hasst, zumindest wenn er von seinem Heiratsplan mit dem 19.-jährigen Mädchen hört. Darum kümmert er sich nicht um seinen erkrankten Vater. Währenddessen ist die Schwiegertochter auf Reise.
Außer Goethes Sohn und dessen Frau, über die nichts Dichtes gesagt wird, liefert der Fußnotentext miniaturisierte Informationen (Ausgangsinformationen)101 über die anderen Figuren.
5.1.6.1.3. Fabelanalyse
„Die Marienbader Elegie“ ist episodisch erzählt, obwohl die einzelnen Episoden nicht durch den Autor deutlich signalisiert sind. In der Tat, ausgehend von den Leerstellen unter einzelnen Abschnitten, kann der Handlungsverlauf folgendermaßen rekonstruiert werden:
Von Seite 129 bis auf Seite 130 geht es um die Verfassung102 der Marienbader Elegie am 5. September 1823 und deren Einordnung unter den einzelnen Sternstunden der Weltgeschichte.
Die Seitenspanne von Seite 130 bis auf Seite 136 kann folgendermaßen untergliedert werden: Von Seite 130 bis auf Seite 131 tritt die erste Analepse auf (im Februar 1832 wird Goethe schwer krank, wobei es ihm gelingt, ohne medizinische Versorgung, die „schwerste Krankheit“ zu überstehen), von Seite 131 bis auf Seite 133 kommt die zweite Analepse vor (die behandelt Goethes Julireise nach Marienbad, Goethes hedonistischen Umgang mit Frauen, also vor allem Polin und Ulrike. Dieser Letzten folgt er von Marienbad nach Karlsbad, wo sie sich trennen, da er nach Weimar zurückkehren sollte.). Vom Ende der Seite 133 bis auf Seite 136 findet die positivistisch-psychologische Gedichtinterpretation seitens Zweigs selbst statt.
Und schließlich von Seite 137 bis auf Seite 139 geht es um Goethes Ankunft in Weimar, das Ins-Reimeschreiben der Marienbader Elegie, seine Erkrankung, seine Wiedergenesung, sein Traumsende von einer möglichen Liebe zu Ulrike, die Entstehung seiner Spätmeisterwerke und seinen Untergang, der sieben Jahre nach der Erscheinung der Marienbader Elegie vorkommt.
Die Seitenspanne 130-136 ist eine umfangreiche Klammer103, die, obwohl sie die narrative Struktur stört, die narrative Information jedoch bereichert. Somit kann schlussgefolgert werden, dass „Die Marienbader Elegie“ trotz ihres schicksalslaufbestimmenden Charakters nur eine Ausrede ist, um Goethes Leben am Abend seiner Existenz zu schildern. Die erzählte Zeit geht daher vom 5. September 1823 zu 1830104 (also 7 Jahre) über und die Erzählzeit, wie es das miniaturisierende Talent Zweigs demonstriert, nur von Seite 129 bis auf Seite 139 (10 Seiten) über.
5.1.6.1.4. Erzählsituation
Der Erzähler in diesem Text verwendet die Er-Form und sein Verhalten gegenüber dem Erzählten oszilliert zwischen dem Neutralen und dem Personalen. Es wird mit Nähe erzählt, die Genauigkeit sowie der Informationsreichtum lassen nochmals hier an die Perspektive des Reporters denken. Manchmal kommt es vor, dass der Erzähler die eigene Brille im Stich lässt und die der Hauptfigur trägt. Diese spezielle Brille verhilft ihm dazu, innerhalb des Kopfes der Figur hinein zu sehen, so dass es an dieser Stelle die Rede von Divinationskunst bzw.
Einfühlungsvermögen sein kann. Diese Nähe bzw. Vertrautheit mit dem Erzählten und der Figur wird in seiner Interpretation der Marienbader Elegie veranschaulicht. Der Erzähler entscheidet sich für die positivistische bzw. biographische Interpretation105 des Gedichts, weil er darin eine Deplatzierung „aus dem Erlebnis in die Dichtung“ sieht (SSdM, S. 133)106. Der Erzähler bedient sich der Figurenperspektive, um das, was Goethe während seiner Rückreise sieht, an den Inhalt des Gedichts zu relationieren, denn dadurch „fließt, so der Erzähler, das eben erst geschaute Bildnis [der böhmischen Landschaft] über sein Gedicht“ (SSdM, S. 134). Erst wenn der Erzähler interpretiert hat, klebt er eine Strophe, als Beleg, an.
5.1.6.1.5. Formanalyse und Geschichtsschreibungsimplikationen
Die sich im Text befindenden Passagen aus der Marienbader Elegie gehören somit nicht nur der Collage-Technik107, sondern der der Montage, wobei sie der erzählenden Miniatur einen hybriden Charakter zuschreiben. Die psychologische Interpretation erfüllt gegenüber der positivistisch-biographischen eine ergänzende Aufgabe und umgekehrt. In der Tat, indem der Erzähler die Seele Goethes (als Figur) penetriert, beschreibt er dessen Seelenzustand aus der Innensicht (seine Empfindungen und das Wieder-ins-Gedächtnisrufen seines Abschieds mit Ulrike. SSdM, S. 135) des Lyrischen Ich beim Schreiben seiner Verse, seiner Strophe und des Gedichts. Der Erzähler verhält sich teilweise auktorial auch, aber er kommentiert nicht selbst unmittelbar, sondern durch Mittelpersonen, deren Reden im Einklang mit seiner Denkweise stehen, die er zu Wort kommen lässt. Weil er Goethes pädophile Neigungen und Triebe kritisieren möchte, bedient er sich des inneren Monologs des Großherzogs (SSdM, S. 132).
Im Text verstreut können einzelne Zitate gefunden werden. Jene Zitate sind vielgestaltigen Quellen entkommen und beweisen Zweigs Umgang mit der Geschichte. Es handelt sich um Gespräche zwischen Goethe und Eckermann u.a., wobei ersterer sein Gedicht als das „Tagebuch innerer Zustände“ (SSdM, S. 130), als das „wundersame Lied, das uns bereitet“ (SSdM, S. 130) oder als „Produkt höchst leidenschaftlichen Zustandes“ (SSdM, S. 130) charakterisiert. Andere Gedächtnisstütze sind „lakonisch[e]“ Tagebuchaufzeichnungen und Briefwechsel. Goethes Tagebuchaufzeichnungen (SSdM, S. 130) geben Auskunft über die Dauer der Reise (von Karlsbad nach Weimar) und dementsprechend die Dauer der Arbeit an dem Gedicht. Daraus geht es hervor, dass Goethe mindestens eine Woche (vom 5. zu dem 12. September 1823) für das Schreiben der Marienbader Elegie benötigt hat. Briefwechselauszüge (SSdM, S. 138) zwischen Goethe und Zelter zu seiner Nachkrankheitszeit werden im Text zur Schaffung der Illusion eines erlebenden Dialogs zwischen den Beiden überschnitten. Auch wenn diese Quellen nicht gänzlich angegeben sind, lässt sich der Leser überzeugen, vor allem wenn Zweig von dem „blauen, wundervollen Leinwandband [...] im Goethe-Schiller-Archiv“ (SSdM, S. 137) spricht, mit dem Goethe das Manuskript der „Marienbader Elegie“ befestigt hatte. Die talentvolle Inkorporierung der Gedächtnis- und Geschichtsquellen schafft und konsolidiert die Glaubwürdigkeit der Erzählung.
5.1.7. Die Sternstunde der Schweiz
Wenn einer die Führungsrolle kennt, die Zweig der Schweiz in Europa zuschreibt (Vgl. Zweig, 2004, S. 221ff.), ist es daher keine Überraschung, dass dieses Land hier repräsentiert ist.
5.1.7.1. „Georg Friedrich Händels Auferstehung“
5.1.7.1.1. Zusammenfassung, zum Titel und zur Aufnahme in den Sternstunden
Wie der Titel es bereits verrät, ist die Miniatur „Georg Friedrich Händels Auferstehung“ in erster Linie die Entstehungsgeschichte von „The Messiah“, Händels berühmtester und von sich selbst geliebtester Oratorio108, dessen Text ihm von Charles Jennens vorgelegt wurde. Zweig begrenzt sich nicht nur darauf. Er erzählt bis zum Händels Untergang.
Diese Miniatur bzw. Händels ,Auferstehungstag’ gehört zu den Sternstunden der „Menschheit“, denn es ist an diesem Tag, dass Händel, indem er Jennens Brief und dem daran beigefügten Text las, Geschmack für die Komposition sowie seine Religiosität wieder gewann. Bevor Händel „The Messiah“ von Jennens las, war seine „Seele lahm“ und hatte alle „Schaffenslust“ verloren. Erst wenn er die ersten Zeilen des „The Messiah“ in der Nacht vom 21. August 1741 las, wurde er wieder „von aller Lust des Schöpfertums erfüllt“ (SSdM, S. 80) und fing sofort mit der Verwandlung des Wortes in Ton an. „The Messiah“ markiert eine Wende im Händels Leben, darum liebte er „den „Messiah“ [.] aus Dankbarkeit, weil e[r] ihn aus dem eigenen Abgrund gerettet, weil er sich in ihm selber erlöst [hat]“. Eine Wende für die „Menschheit“ markiert auch dieser Auferstehungstag, denn Händels bahnbrechendes Œuvre in der Weltmusik wäre, ohne diese Stunden an „The Messiah“, nie möglich gewesen.
5.1.7.1.2. Wer war Georg Friedrich Händel?
Georg Friedrich Händel ist 1685 geboren und 1759 im Alter von 74 gestorben. Er ist ein „jähzorniger“ (SSdM, S. 68), ein „cholerischer“ (SSdM, S. 69) und ein Mann mit einem „löwenhaften Zorn“ (SSdM, S. 83), der in London bzw. in Brookstreet lebt. Händels Biographie beginnt, als er 52 ist. Am 13. April 1737 erleidet er einen Hirnunfall, dessen Auslöser die Überarbeitung und durch die Inkompetenz seiner Opernmitarbeiter verursachter „viel Ärger“ sind. Die rechte Seite seines Körpers ist gelähmt und er kann dementsprechend nicht mehr komponieren. Händel findet die Genesung wieder, nachdem er in den berühmten Aachener Bädern 9 Stunden pro Tag während 2 Wochen verbracht hat. Diese Erfahrung der Lähmung und des Nicht-Mehr- Musizierenkönnens macht ihn „sonderlich fromm“ (SSdM, S. 74). Er schreibt in den nachfolgenden Jahren (also vom 1737 bis 140) drei Opern bzw. Oratorien, nämlich „Saul“, „Israel in Ägypten“ und „Allegro e Pensioroso“. Trotzdem wird der sozio-historische Kontext nicht kompositionsfördernd wegen des spanischen Krieges, des Winters, der mit dem Tod der Königin zusammengehenden Unterbrechung der Aufführungen und vor allem wegen seiner Schuldenlast. Händel ist seelisch verwüstet und denkt an Emigration bzw. an Selbstmord, er ist 55 Jahre alt. Das Wunder bzw. die seelische Auferstehung kommt am 21. August 1741, Tag, an dem Händel mit der Komposition von „The Messiah“ anfängt. Daran arbeitete er ununterbrochen drei Wochen lang, Tag und Nacht, ohne sein Zimmer zu verlassen, von den Sorgen der Welt getrennt und „[...] am 14. September, war das Werk beendet“ (SSdM, S. 84). Einige Monate später siedelte er nach Dublin über, wo die erste Aufführung des neuen Opus des „Meisters“ am 13. April 1742 in dem „Raum der Music Hall in Fishamble Street“ vor 700 Zuschauern stattfand. In den anschließenden Jahren hatte Händel „mit unermesslicher Seele“ weiter komponiert, obschon er inzwischen 1749, im Alter von 64, blind geworden war. Nach seinem kurzen Aufenthalt in Irland kehrte er nach England zurück und spielte den „Messiah“ Jahr für Jahr vor, dessen verdientes Geld den Not Leidenden geschenkt wurde. Am 6. April 1759, „schon schwer erkrankt“ und im Alter von 74, gab er seine letzte Aufführung in „Covent Garden“ und am 13. April, am Karfreitag, „der Tag, da sein „Messiah“ zum ersten Mal in die Welt geklungen“ hatte, verließen ihn seine Kräfte und am Karsamstag, sehr früh, verließ seine Seele seinen längst verstorbenen Körper.
Aus dieser Biographie lässt sich herausziehen, dass Händel ein „cholerischer“, ein frommer Mann und ein Künstler von großer Genialität war.
5.1.7.1.3. Die anderen Figuren
Die anderen Figuren dieser Miniatur sind: Der namenlose Diener, Doktor Jenkins, der Herzog Lord Chando (Händels Musikfreund und Gönner), Christof Schmidt „der Fabulus, der Helfer des Meisters“ (SSdM, S. 70) und Jennens.
Dieser Letzte ist ein Dichter, der Händel seine heiligen Texte wie z. B. „Saul“, „Israel in Ägypten“ und „The Messiah“ schickte, damit er daraus Oratorien schrieb. Indem Zweig vorwiegend die Urheberschaft des letztgenannten Oratoriums hervorhebt, knüpft er die Berühmtheit bzw. die Unsterblichkeit Händels und jenes Werkes an Charles Jennens‘ Namen an. Somit wird Georg Friedrich Händels Sternstunde unvermeidbar die Charles Jennens‘, sodass der intensive Rehabilitierungskampf des letzten Jahrzehntes des 21. Jahrhunderts um Jennens als Urheber des „Messiah“ bereits bei Stefan Zweig vorweggenommen wurde. Jennens wird bei ihm nicht zu diesem Unbekannten, zum Mann im Händels Schatten, der lange Zeit in der von Geschichtswissenschaftlern geschriebenen Geschichte vergessen wurde.
5.1.7.1.4. Fabelanalyse
Die Miniatur „Georg Friedrich Händels Auferstehung“ ist nicht episodisch geschrieben, aber chronologisch, ohne Vorausdeutungen und Rückblenden. Die Einfachheit der Erzählstruktur erlaubt es, der Geschichte ohne Mühe zu folgen.
Die erzählte Zeit in „Georg Friedrich Händels Auferstehung“ geht vom 13. April 1737 bis zum 13. April 1759 über. Sie umfasst also 22 Jahre. Die Ziffer 13 bzw. der 13. April nimmt eine mythische Bedeutung in Händels Biographie ein: Sie bzw. er ist der Tag (13. April 1737), an dem Händel den Hirnunfall erlitt, der Tag (13. April 1742), an dem den „Messiah“ zum ersten Mal gespielt wurde und letztendlich der Tag (13. April 1759), an dem Händel stirbt und ins Unsterbliche -dank der Erinnerung an ihn und sein Œuvre- hineintritt. Die Erzählzeit, die wie üblich ein Beweis für die Zeitraffung und Zweigs Miniaturvermögen ist, umfasst 24 Seiten (Seite 68 bis 92). Elliptisch bzw. sprunghaft wird zeitweise erzählt. Daher der miniaturisierte Umfang der Erzählung trotz der in 22 Jahren verteilten Informationsfülle.
5.1.7.1.5. Erzählsituation
Der Erzähler bedient sich der Er-Form, um das Geschehene zu vermitteln. Erzählt wird aus einer nahen Perspektive, aus der Perspektive eines Zeitzeugen, der Händel überall auf Reise begleitet, sogar wenn Letzterer allein und sehr spät in seinem Zimmer arbeitet. Sein Verhalten schwankt zwischen neutralem und personalem. In dieser Erzählung versetzt sich der Erzähler in der Psyche Händels nicht hinein. Vielleicht hat das mit dem sakralen Charakter des Mythos zu tun, den er nicht verzerren möchte. Somit sind Kommentare und Reflexionen selten oder zumindest kaschiert.
5.1.7.1.6. Formanalyse und Geschichtsschreibungsimplikationen
Gebraucht werden das Präsens und das Präteritum als Erzähltempora, da die Geschichte jeweils zwischen Historismus und Mythisierung schwankt, wie Hansjörg Bäzner und Gabriel Hennerici (2005) es mit folgenden Worten in Erinnerung rufen: „The story of his [gemeint ist Händel] life and his illnesses is full of myths109, invented and embellished by various biographies.“ (S. 150). Zweig ist von der nationsbildenden Rolle des Mythos bewusst, deswegen arbeitet er nicht dagegen, sondern mit ihm, wobei er zeitweise versucht, das Historische hervorzuheben. Händels Genialität nimmt manchmal mythische Züge ein. In der Tat wird der Komponist als „der hohe Genius der Musik, phoenix musicae“ (SSdM, S. 78) bezeichnet. Der Phönix ist in der altägyptischen Mythologie ein Zaubervogel, der die Fähigkeit besaß, beim Herannahen des Todes ins Feuer aufzugehen und danach aus Asche aufzuerstehen110. Händel gilt als der „phoenix musicae“ aus zwei (02) Gründen: Erstens denn er kann aus „armen Worten“ unsterbliche Töne machen und zweitens denn er ist auferstanden, indem er auf Musik aufging. Auch die Zeit, die er für die Komposition des „Messiah“ (3 Wochen) und für seine Genesung (2 Wochen) ausnutzt, dient der Mythisierung, indem sie von ihm ein Mann von außerordentlichen Attributen macht.
„Georg Friedrich Händels Auferstehung“ ist die Miniatur, in der Zweig Figuren am meisten direkt zu Wort kommen lässt. Dies kommt vor, als Händel den Gehirnunfall erlebt. Zweig inszeniert einen Dialog zwischen Schmidt und Dr. Jenkins über die gestellte Diagnose. Allerdings im Gegensatz zu anderen Miniaturen gibt es keine Angabe zu den für die Inszenierung dieses Dialogs ausgebeuteten historischen Quellen. Aber Eines ist sicher: -Auch wenn Figurenreden nicht unbedingt gehaltene Reden von den historischen Gestalten sind- Zweig hat sich auf historische Quellen gestützt, wie die Neurowissenschaftler Bäzner und Hennerici es in dem schon erwähnten Artikel beweisen. Ihnen zufolge habe Zweig „Memoirs of the Life of the Late George Frideric Händel“ von John Mainwaring ausgebeutet (Vgl. Bäzner/ Hennerici, 2005, S. 153), die ein Jahr nach Händels Tod, also 1760, in London erschienen ist. An den Passagen von Mainwaring, die sie zitieren, ist es die Rede von „Eruption of Anger“ und der Sängerinnen, die den Komponisten quälten (Vgl. ebd., S. 151f); von Händels Lähmung, von „violent deviations from reason“ (ebd., S. 152), „paralytic disorder“ (ebd., S. 153).
Figurenreden werden nicht nur direkt wiedergegeben. Indirekt wird also der Inhalt Jennens‘ Briefes an Händel (SSdM, S. 77f.) und Händels inneres Monologs, wobei er vom Gott verlangte, dass er die Welt wehrte (SSdM, S. 78), vermittelt. Andere Formalelemente sind die in Originalfassung (Englisch) angeklebten Auszüge aus dem „Messiah“. Die zeugen von der Natur des Textes und dessen Nichterfindung.
5.1.8. Die Sternstunde Italiens
Die verdanken wir der historischen Miniatur „Cicero“, dem Philosophen, Dichter und italienischen Staatsmann, dessen Wettlauf darin geschildert wird (SSdM, 2004).
5.1.9. Die Sternstunde von der Türkei
„Die Eroberung von Byzanz“ im Jahre 1453 markiert das Ende des Oströmischen Reiches. In diesem Text postuliert Zweig noch einmal gegen den Krieg und die Gewalt und bringt eine geschichtliche Wahrheit zum Ausdruck, nämlich dass Europa nicht nur ein jüdischchristliches Fundament hat, wie es bei den Überlegungen zur Entstehung der europäischen Union der Fall war, sondern auch dass Europa religiös bzw. kulturell gesehen jeweils islamisch und arabisch ist (Vgl. Csaky, 2004, S. 6).
Zwischenfazit
Zweigs Miniaturen haben gemeinsam folgende Merkmale: Jede Miniatur hat einen Titel und einen Untertitel, die die Sternstunde von vornherein ankündigen und gewissermaßen resümieren. Seine Texte heißen nicht Miniaturen umsonst. Die Mehrheit der Miniaturen ist in Episoden verfasst, wobei die daraus entstehende pyramidale111 Erzählstruktur ans Licht gebracht werden kann. Die Geschichte läuft meistens chronologisch, obwohl der Erzähler die Anachronie mag. Auf die Analepse wird sehr oft zurückgegriffen, um die Figuren zu biographieren bzw. zu porträtieren. In dem Verhältnis der Erzählzeit zu der erzählten Zeit herrscht die Zeitraffung. Weitere textinterne bzw. stilistische Charakteristiken der Texte sind das Präsens als dominierendes Erzähltempus, der pathetisch-elegisch und nicht selten satirische Grundton, die Gattungshybridität, die Intermediidität... Ein zusätzliches gemeinsames Merkmal ist die Tatsache, dass Figuren stets auf Reisen innerhalb und außerhalb Europas sind. Aufgrund ihrer Mobilität, und das haben sie mit Stefan Zweig selbst gemeinsam, sind die historischen Gestalten der analysierten Miniaturen Europäer bzw. schwache und besiegte Europäer. Auf die Frage zu wissen, warum Zweig sich erniedrigte Figuren112 aussucht, wird im Rahmen dieser Arbeit nicht mehr eingegangen. Meine Position ist aber, dass Stefan Zweig selbst sich als einen Erniedrigten betrachtete, dass er durch „Sternstunden der Menschheit“ hat zeigen wollen, dass die Genialsten, Weisesten und Größten der Weltgeschichte irgendwann in ihrem Leben auch Erniedrigte sind und dass für seinen Fall der Kampf gegen den Nationalsozialismus113 umsonst war. Gerade deswegen hatte er es vorgezogen, sich das Leben im Jahre 1942 zu nehmen, anstelle lebendig aber ohnmächtig, der Grausamkeit des Nationalsozialismus beizuwohnen.
Kapitel 6: Stefan Zweig und die Welt bzw. die Menschheit
6.1. „Sternstunden der Menschheit“: Zwischen Geschichtsschreibung und Gedächtnisarbeit/Gedächtniskonstruktion
Ist Zweigs „Sternstunden der Menschheit“ auf dem Boden der erinnerungshistorischen Literatur beheimatet? Auf diese Frage wird geantwortet, indem abwechselnd Rekurs auf Ansgar Nünnings (2000, S. 541f zit. nach Berube, 2009, S. 19f) Typologie von historischen Romanen und Paul Ricoeurs (1988 [1983]. Zit. nach Erll, 2004, S. 122) Kreis der Mimesis gemacht wird.
Nünnings unterscheidet 5 Typen von historischen Romanen. Aber da ich mit Texten arbeite und nicht Romanen, wird der Roman auf die Ebene des Textes reduziert. Es handelt sich somit um den dokumentarischen historischen literarischen Text, den realistischen historischen literarischen Text, den revisionistischen historischen literarischen Text, den metahistorischen literarischen Text und die metahistoriographische Fiktion. Diese Züge von historischen Texten können in Stefan Zweigs Miniaturen vorgefunden werden. Zweig verfährt dokumentarisch, obschon Belege in seiner Erzählung verschmolzen sind und Dokumente nicht immer deutlich, wie in „Amerigo“, angegeben und typographisch hervorgehoben werden. Realistisch sind auch seine Texte. Dies kann an der Chronologie und dem Informationsgehalt gemessen werden, der in der Erzählung sowie im Fußnotentext erscheint. Auch der Reporterblick, seine Nähe zum Erzählten und die Detailliertheit der Erzählung, partizipieren daran. Das revisionistische Merkmal passt auch zu Zweigs historischen Miniaturen, denn anstelle Sieger als Vorbilder einzunehmen, sucht er sich Erniedrigte und Vergessene aus. Zweig bereichert auch die Kenntnis von historischen Gestalten: Die Figur des alten Goethe als Pädophil, die Figur Rouget und der Straßburger als richtige Urheber der französischen Nationalhymne... wurden oben behandelt. Darum betreibt Zweig die Gegengeschichtsschreibung. Metahistorisch bzw. -histenographisch verfährt Zweig in „Flucht zu Gott“ und „Heroischer Augenblick“, wo er das Ineinandergreifen des historischen Faktums und der Fiktion bis in seine Grenzen treibt. Daher kann schlussgefolgert werden, dass Zweig, angesichts des Gehalts, die Geschichte ohne Erfindung, aber aus einer subjektiven Perspektive schreibt, die die von der Geschichtswissenschaft willentlich gelassenen Lücken ausfüllt oder die Geschichtswissenschaftspraxis selbst kritisiert. Er sei also Historiker mit Seele eines Chronisten114.
Aber da seine Erzählung eine Erzählung von zweitem Grad (Erzähltes über Erzähltes) ist, ist sie automatisch nicht überflüssig. Zweigs Erzählungen machen die stilistischen und ästhetischen Vorteile des Erzählens produktiv.
Ricoeurs „Kreis der Mimesis“ wurde in „Zeit und Erzählung“ (1988) entwickelt und sehr viel von Astrid Erll (2002 (zit. nach Hamann, 2005) und (2004) ausgebeutet, um zunächst auf Merkmale von Gedächtnisromanen hinzuweisen und später um „das Erinnerungskulturelle der Literatur“ ans Licht zu bringen. Der „Kreis der Mimesis“ setzt sich aus der „Präfiguration“, der „Konfiguration“ und der „Refiguration“ zusammen. Stefan Zweig ist zur erinnerungskulturellen Präfiguration fähig, dergestalt dass er die Kontinuität der Raumeroberung ankündigt und dass er die Grundlagen bzw. Modelle der Europäischen Union entwirft. Seine Texte konfigurieren die Gegenwart bzw. das Gedächtnis, indem sie das Vergessene bzw. das Verdrängte zu (Gegen)Gedächtnisinhalten machen. Darüber hinaus sind sie ein Medium zur „Sinnstiftung und Orientierung im Prozess der Bildung, Aushandlung, Verfestigung, Revision oder Reflexion“ (Hamann, 2005, S. 106) seiner individuellen und kollektiven Identität. Stefan Zweig wird somit zu einem „grand européen“, der die anderen Europäer zur Schaffung eines geistigen Europas auffordert -aus den von ihm vorgeschlagenen Vorbildern115. „Sternstunden der Menschheit“ sowie andere Zweigs Biographien, Essays und Romane haben das kollektive Gedächtnis refiguriert, indem sie Reflexion über die geschichtswissenschaftliche Praxis sowie die Grundlagen der Europäischen Union auslösen.
Daher wird „Sternstunden der Menschheit“ zu einem „metaphorischen Gedächtnisort“ (Csâky, 2004, S. 10) mit „translokalem“ bzw. hybridem Charakter, der eine individuelle bzw. kollektive Identitätsstiftungsfunktion hat.
6.2. Stefan Zweig und das Abendland
Im Grunde war Europa seine eigentliche Heimat - und das zu einer Zeit, als der Kontinent noch durch den extremen Nationalismus seiner Staaten zersplittert war. (Prater, Donald A. und Michels, Volker: Stefan Zweig. Leben und Werk im Bild. Leipzig-Weimar:1984, S. 10)
6.2.1. Was das Abendland nicht sein sollte
Unter den 12 Miniaturen der „Sternstunden der Menschheit“ ist es in sechs (06) die Rede von Eigentumskonflikten bzw. -kriegen, nämlich in „Flucht in die Unsterblichkeit“, „Die Eroberung von Byzanz“, „Das erste Wort über den Ozean“, „Der Kampf um den Südpol“,
„Die Entdeckung Eldorados“ und „Die Weltminute von Waterloo“. Diese „veloziferische“116 Eroberung wird bei Zweig stark kritisiert. Im Folgenden wird, in Anlehnung an Jean-Jacques Rousseau, auf die geldgierige und zerstörerische Natur des Europäers eingegangen, wovon die zu entstehende Europäische Union entgiftet werden sollte.
Jean-Jacques Rousseau (1971) in seinem « Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les Hommes » griff schon zu seiner Zeit vor Stefan Zweig diese possessive Natur des abendländischen Menschen an, die ihn im Laufe der Zeit außerhalb seines Landes, seines Erdteils und mittlerweile außerhalb seines Planeten Richtung Mond und März zumindest hinführt. Stefan Zweig war zu seiner Lebenszeit ein großer Reisender. Er beschämte sich, dass einige Zonen Europas unbereist blieben, aber er war nicht - als Pazifist- dafür, dass Menschenleben zum Zweck des Bodenbesitzes geopfert werden. Für Rousseau sind es Gold, Geld, Eisen, Weizen und Künste, die für die Ungleichheit unter Menschen verantwortlich sind, denn sie haben gewissermaßen zur Institutionalisierung des Faustrechts, Eigentumsrechts und Ungleichheitsrechts beigetragen und somit die Menschheit verdorben.
In dem Naturzustand lebten die Menschen in Ruhe und friedlich, denn sie waren physisch gleich und die Mutternatur gab ihren Leibern das, was sie nötig hatten. Aber „Le premier, qui ayant enclos un terrain, s’avisa de dire : Ceci est à moi117, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile“ (S. 222). Genau diese geldgierige und kriegerische Natur seiner Mitmenschen kritisiert Zweig, die bereit sind, für ein Stückgold bzw. ein Stückland einander zu töten bzw. miteinander Krieg zu führen. In „Flucht in die Unsterblichkeit“ beweist Zweig, dass die sog. „Naturmenschen“ (Einheimischen) gegenüber den sog. „Kulturmenschen“ (Konquistadoren) zivilisierter sind (SSdM, S. 168). Rousseau geht noch weiter und bezeichnet Europäer zur Zeit der Eroberung Amerikas als ,ungerechte Barbaren‘ (Vgl. 1971, S. 120), die mittels Kunst und Technik die Zivilisation jenes Erdteils verdorben bzw. unterminiert haben. Darum freute er sich, dass der afrikanische Boden Europäern unbekannt bzw. unpenetriert blieb. Um den afrikanischen Erdteil vor dem abendländischen verderbenden Körper und Geist zu schützen, war er bereit, dies zu machen: „Si j’étais chef de quelqu’un des peuples de Nigritie, je déclare que je ferais élever sur la frontière du pays une potence où je ferais pendre sans rémission le premier Européen qui oserait y pénétrer, et le premier citoyen qui tenterait d’en sortir“ (ebd., S. 120). Bedauerlicherweise wurde den afrikanischen Kontinent seiner Jungfräulichkeit durch den Koloniewettlauf beraubt. Es ist also wegen Profitmaximierung, Gewinn o.Ä., dass der europäische Mensch so individualistisch geworden ist. Letzterer beweist Gruppengeist, erst wenn er die Anderen braucht, um seinen Gewinn zu vermehren (Vgl. ebd., S. 224). Zum letzten Punkt werden „Weizen“ („céréales“) und „Eisen“ („fer“) als Auslöser der Entstehung des Sozialzustands analysiert.
In dem Sozialzustand besitzt jedes Individuum seinen eigenen Boden, kann also Landwirtschaft betreiben und somit seine Ernten kommerzialisieren, um Geld zu verdienen. Wiederum produziert die Metallindustrie Landwirtschaftsinstrumente. Aber da jeder Landwirt seine Familie ernähren und versorgen muss, muss er die besten und arbeitszeitersparenden Instrumente kaufen, damit er als Erster die Arbeit erledigt und seine Produkte verkauft. So schafft die Metallindustrie den Konkurrenzkampf und die Ungleichheit unter Menschen. Diesbezüglich schließt Rousseau mit folgenden Worten ab: „ Pour le poète c’est l’or et l‘argent, mais pour le philosophe ce sont le fer et le blé qui ont civilisé les hommes et perdu le genre humain“ (ebd., S. 232). Eine ähnliche Kritik auf dem deutschsprachigen Boden kann bei den Theoretikern der Frankfurter Schule der Kritischen Theorie und besonders bei Adorno und Horkheimer in ihrem berühmten Buch „Dialektik der Aufklärung“ gelesen werden, wo sie die Ideale der Aufklärung zunichtemachen.
6.2.2. Zweigs Europas Vorstellungen in „Sternstunden der Menschheit“
Unter den gefundenen Forschungsarbeiten118 an „Sternstunden der Menschheit“ ist Ariane Chartons (2012) Verdienst, dass sie in diesem Werk Zweigs Gedanken über das zu konstruierende Europa liest. Sie sagt diesbezüglich: „Dans les Très Riches Heures de l’humanité119, il [Zweig] a choisi d’évoquer des évènements qui ont eu des répercussions dans toute l’Europe, voire dans le monde entier. Des répercussions historiques et politiques, mais aussi culturelles et spirituelles [...] “ (S. 52). „Sternstunden der Menschheit“ ist dezidiert „Sternstunden Europas“. In der Tat kommt das Wort Europa bzw. Wörter aus dem Stamm „Europa“ 42 Mal in der 12 Miniaturen vor, während das Wort Menschheit nur 29 Mal erwähnt ist.
Zweigs Gedanken und Vorstellungen von einem geeinigten Europa lassen sich auch in „Sternstunden der Menschheit“ lesen. Diese Gedanken (Vgl. Fronz (2013) und (2014)) sind:
- Der Glaube an ein neues „Geschichtsverständnis“, das nicht mehr nationalistisch, sondern transnationalistisch bzw. völkerverbindend ist. Zweig sucht sich Reisende aus, da mit ihnen Überlappungen zwischen Nationalgeschichten ans Licht gebracht werden.
- Die Geburt eines neuen Europäers, nämlich des freien Geistes, der für seine geistige Freiheit bzw. Unabhängigkeit kämpft. Zweigs Figuren sind alle Erniedrigte, aber keine resignierte, sondern kämpfende Erniedrigte.
- Die Grundlage für die Entstehung eines geeinigten Europas ist, dass der Kultur und keineswegs der Politik, des Handels, der Armee... das Übergewicht beigemessen wird. Dieser Kampf zwischen Kultur/Kunst und Krieg/Kapitalismus inszeniert Zweig durch seine Miniaturen selbst. Es gibt offensichtlich sechs (06) Miniaturen, die den Kapitalismusaufstieg und den Krieg thematisieren und sechs (06) andere, die die Kunstwelt repräsentieren. Der Kultur wird der Vorrang zugeschrieben, denn erst dadurch kann Europa entgiftet werden. Und die kulturellen Ausdrucksformen, die am meisten wirken, sind die Bildung und die Erziehung, Literatur, Musik, Theater usw.
- Der übernationale Primat: In „Sternstunden der Menschheit“ schreibt Zweig keine Nation die in der europäischen Union Führungsrolle zu. Die kulturelle Diversität Europas soll beibehalten werden.
- Die Werte, die aus der Lektüre der „Sternstunden der Menschheit“ an die Oberfläche herauskommen, sind: Hilfsbereitschaft, Toleranz, Gedankenfreiheit, Gerechtigkeit, Mitleid, Güte usw. Jene Werte sind in „Verfassungstexten und Gründungsschriften der Europäischen Union“ zu lesen (Vgl. Fronz, 2014, S. 5).
Der Versuch, aus „Sternstunden der Menschheit“ Inhalte des Europagedächtnisses herauszuarbeiten, ist ein Plädoyer dafür, dass dieser Text neben den anderen Europatexten rangiert wird. Ohne diese Europatexte, nämlich „Der Turm zu Babel“ (1916), „Die moralische Entgiftung Europas“ (1932), „Der europäische Gedanke in seiner historischen Entwicklung“ (1932), „Die Geschichtsschreibung von Morgen“ (1939), „Die Geschichte als Dichterin“ (1939) und (Kapitel aus) Biographien wie „Romain Rolland. Der Mann und das Werk“ (1920), „Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam“ (1934), „Castellio gegen Calvin oder ein Gewissen gegen die Gewalt“, sei die gänzliche Rekonstruktion der Zweigs Europaideen unmöglich (Vgl. ebd., S. 2). In diesem umfangreichen Corpus hat und verdient „Sternstunden der Menschheit“ seinen Platz.
6.2.3. Dekonstruktion des zweigschen Abendlandgedächtnisses
Wie jedes Gedächtnis ist das von Zweig ausgeformte Gedächtnis selektiv und neigt manchmal zur Diskrimination und Exklusion. Erinnerungswürdige Sternstunden der Menschheit sind exklusiv europäisch bzw. abendländisch. Das hat nämlich etwas mit Identitätsstiftung zu tun. Zweig definiert sich zwar als ein Pazifist und hauptsächlich als ein Europäer, aber wie lässt sich die Tatsache erklären, dass sein Buch anstelle „Sternstunden Europas“ nämlich „Sternstunden der Menschheit“ nennt? Eine ideologiekritische120 Lektüre der Miniaturen lässt eurozentrische Züge bei ihm aufgrund seiner universalistischen Ansprüche erscheinen121. In „Sternstunden der Menschheit“ tritt der Begriff „Menschheit“ 29 Mal, „Geschichte der Menschheit“ zwei (02) Mal „Weltgeschichte“ acht (08) Mal und Europa 42 Mal auf. Da sind Beweise dafür, dass Europa in Stefan Zweigs Augen als „Standard“, Vorbild und Maßstab für alle Kulturen gelten kann. Sein Projekt war zu prätentiös, denn in der Schreibung der kompletten Europageschichte (Abendlandgeschichte) bzw. der Formation eines Europagedächtnisses (Abendlandgedächtnisses) ist es ihm nicht gelungen. Nur Länder wie Spanien, England, Deutschland, die Schweiz, Russland Frankreich, Italien, die Türkei und die USA fallen für ihn ins Gewicht. Zwar sind es Länder, wonach er gereist ist, aber er ist auch nach Indien, nach Nordafrika gereist, aber die haben ihn nicht so berührt, dass sie in seinem „Sternstunden-Olymp“122 aufgenommen werden. Würde es heißen, dass Leute wie Cervantes, Konfuzius, Shakespeare sowie kulturreiche Länder wie Ägypten zurzeit der Pharaos und Indien weniger wichtig oder eher unwichtig sind? Haben Afrika und Asien nichts zum Fortschritt der Menschheit geleistet? Sind Mesopotamien und Ägypten nicht frühe Schriftkulturen? Eine solche Geschichtsschreibung verurteilt Afrika und die anderen Erdteile zu Objekten und nicht Subjekten des Geschichtsschicksals und macht sie zu „kalten“ Gesellschaften, also <geschichtslose> Gesellschaften bzw. Gesellschaften <ohne Geschichtsbewußtsein> (Vgl. Levi-Strauss, 1962. Zit. nach Assmann, 2007, S. 68). Schon 90 Jahre, dass „Sternstunden der Menschheit“ rund um den Globus gelesen sind, aber niemand ist bereits einmal, meines Wissens, aufgestanden, um diesen Irrtum der Geschichte zu denunzieren.
Bemerkenswert neben den eurozentrischen Zügen ist auch der Ausschluss der Frauen aus dem „Sternstunden-Olymp“. In der Tat sind Frauen in „Sternstunden der Menschheit“ fast ganz abwesend und sogar als Nebenfiguren treten sie selten auf. Somit lässt sich schlussfolgern, dass Stefan Zweig Vertreter der patriarchalischen Gesellschaft ist.
Dieses nicht repräsentative Gedächtnis lässt verstehen, warum Susan Sontag in „Das Leiden Anderer betrachten“ ((2005). zit. nach Assmann (2006)) das Kollektivgedächtnis als „Ideologie“123 bzw. „Fiktion“ ansieht, denn seine Konstruktion Interessen und Ideologien selbst unterworfen ist. Wenn das Kollektivgedächtnis nicht existiert, ist es eindeutig, dass ein umfangreicheres Projekt wie das der Formation des Menschheitsgedächtnisses reziprokerweise unmöglich ist.
Wie lässt sich dieser Ausschluss der anderen Erdteile aus den Sternstunden der Menschheit erklären?
6.3. Stefan Zweig und der Rest der Welt: Der Fall Afrikas
Les peuples d’Afrique, de race noire, ont dans leur caractère un fond inépuisable de mouvement et de gaieté. (Alexander von Humboldt, Voyages aux régions équinoxales du nouveau continent).
Stefan Zweig ist, seinen Schriften nach, erstmals in Kontakt mit Schwarzafrikanern in den USA, im Jahre 1939, getreten. In seinem Reisebericht „Bilder aus Amerika“ (2004) gibt es ein Unterkapitel betitelt „Negerfrage“, worin er Afrikaner mit Juden vergleicht. Bemerkenswert dabei sind der Binarismus, der Pessimismus angesichts des Schicksals der in den USA lebenden Afrikaner und Verallgemeinerungen, die seinen Diskurs auszeichnen. In diesem Unterkapitel kommt er auf „die strengste Aussonderung“, die er in den USA zwischen „colored“ und „white“ Menschen beobachtet hat. Der Mangel an kritische Distanz gegenüber dem Negerbegriff sowie der Gebrauch von binären Oppositionen zeugen von dem Rassismus seitens Zweigs.
Im Gegensatz zu Juden, so Zweig, wisse der „Neger“ „nicht sich durchzusetzen“, er fühle sich, was die „Lebenshaltung“ anbelangt, den Weißen „näher“ (Vgl. Zweig, 2004, S. 374).
„Neger“124 sind auch als Last charakterisiert: Sie leben von der jüdischen heuchlerischen „Philanthropie“. Heuchlerisch ist diese Philanthropie, denn Juden helfen, weil sie ein gutes Image von sich in den USA darbieten möchten (Vgl. ebd., S. 375). „Neger“ seien ,kulturell und geistig‘ unterlegen; ethnologisch gesehen Untermenschen, schwach, feig und faul (Vgl. ebd., S. 377) und ontologisch „arme“ Leute bzw. von ihren Urgroßvätern her „Sklaven“. Ihre Armut ließe sich darüber hinaus auf ihre verschwenderische und nichtsparsame Natur zurückführen. Darum fehlt ihnen den , Aufstiegssinn’. Juden ihrerseits zeichnen sich durch Solidarität und Willen zum Aufstieg aus, „(...) während bei allen 125 diesen Negern keine Geschichte, kein Zusammenhang, keine geistige Erinnerung besteht und sie nichts gemeinsam haben als eben die schwarze Farbe und die typischen Rassenmerkmale“ (ebd., S. 378). Stefan Zweig leistet gegenüber Afrika zu Unrecht eine ungerechte „damnatio memorae“126 (Assmann, 2006, S. 105).
Stefan Zweig hat aber völlig Unrecht, wenn er meint, Afrikaner seien ontologisch arm und Sklaven. In einem einleuchtenden Artikel betitelt „Le « Noir »: Psychanalyse d’un concept et essai d’une critique racio-historique d’une vision péjorante“ kommt Bouba Hamman (2008) auf die Bedeutung des Adjektivs „schwarz“ im Laufe der Geschichte, sowohl in der Bibel, bei den griechisch-römischen Völkern als auch im pharaonischen Ägypten, zurück. Bemerkenswert dabei ist, dass das Bild des Schwarzen verzerrt und manipuliert zur Bestätigung der Überlegenheit der Weißen wird. Hamman beweist, dass schwarz kein Synonym für Teufel, Schmutz, Fluch o. Ä. ist, sondern für weise, reif, vollkommen, perfekt.
In derselben Richtung zeigt Helmut Heit (2004), indem er sich auf Cheikh Anta Diop, George James, André Pichot, Karl Jaspers und vor allem Martin Bernal stützt, wie die Wurzeln der griechischen Antike „schwarz“ sind, da die Griechen das in Afrika Übernommene nur transformiert haben. Somit beweist er das zeitliche Vorankommen der schwarzen Zivilisation (Vgl. S. 211f.).
Schlussbetrachtung
Chaque fois qu’on veut nier l’existence d’une nation, on tente de la déculturer, de lui arracher sa langue, de lui faire oublier sa tradition, de lui voler son héritage. Défendre sa langue, son histoire, sa mémoire, sa pensée, ses modes culinaires, son esthétique du corps, du vêtement et de sa maison, c’est aussi un acte et un combat politiques. Mais c’est aussi une nécessité du développement de l’homme dans la mesure où il se veut intégral et doit porter l’empreinte de notre visage spirituel. (Jean-Marc Ela, La Plume et la Pioche. Réflexion sur l’enseignement et la société dans le développement de l’Afrique noire. 2011. S. 101)
In der vorliegenden Arbeit bestand das ausproklamierte Ziel darin, zu zeigen, wie Literatur an der Geschichtsschreibung und der Gedächtniskonstruktion beteiligt ist. Durch seinen Umgang mit Gedächtnissaufbewahrern wie literarischen Texten, Briefen, Bildern, Tagebüchern usw. und seine Ausbeutung der historischen Quellen wurde gezeigt, wie Stefan Zweig in seinem „Sternstunden der Menschheit“ die Geschichte von „European Lives“127 schreibt und zur Konstruktion des geistigen Europas und dessen Identitätsbildung beiträgt. Indem er aber Erniedrigte als Hauptfiguren der Sternstunden auswählt, leistet er Kritik an der geschichtswissenschaftlichen Geschichtsschreibung und der (politisierten)
Gedächtnisforschung, die sich eher für starke und kriegerische Helden (wie Napoleon, Cäsar...) interessieren. Somit erweist sich, dass „Sternstunden der Menschheit“ sich als Gegengeschichtsschreibung und Gegengedächtnis positioniert. Zweig geht aber in die ideologische Falle, indem er Afrika und Asien aus seiner sog. „Sternstunden der Menschheit“ ausschließt. Es handelt sich also nicht um „Sternstunden der Menschheit “, sondern logischerweise um „Sternstunden Europas “ bzw. „Sternstunden des Abendlandes “, da der Autor sich von der eurozentrischen Ideologie lenken lässt.
Stefan Zweigs Erzählungen sind nicht überflüssig. Eine erzähltheoretische Lektüre der historischen Miniaturen hat die Gattungshybridität, den Reportagestil, die Erzähltechnik, die Zeitgestaltung des Erzählten, den domestizierenden Umgang mit den historischen Quellen und die kritische Stimme Zweigs ans Licht gebracht und dementsprechend bewiesen, dass Literatur, Geschichte und Gedächtnis ineinandergreifen, ohne dass die erstere ihre Autonomie verliert. „Sternstunden der Menschheit“ ist das harmonische Produkt von der „Geschichte als Dichterin“ (Stefan Zweig) bzw. „Der historische Text als literarisches Kunstwerk“ (Hayden White) und vom „Gedächtnisort als Text“ (Moritz Csaky). Diese Arbeit kann nicht abgeschlossen werden, ohne auf didaktische bzw. pädagogische Implikationen hinzuweisen.
Ohne Gedächtnis ist das Lernen bzw. das Lehren unmöglich. Individuen, die ein sehr labiles Gedächtnis oder eher an Gedächtnisschwäche erkranken, können keiner Gesellschaft angehören, denn soziale Gruppen entstehen und leben von gemeinsamen Erinnerungen. Wenn erfahrene Daten das Langzeitgedächtnis nicht erreichen, erhalten sie den Informationsstatus nicht und gehen somit sehr schnell verloren. Aber damit Gedächtnis entsteht, sind die Schrift, die Performanz (Vergegenwärtigung des Gewesenen durch Feste und rituelle Praktiken) und die soziale Kommunikation unabdingbar. Dies verlangt von dem Deutschlehrer, dass er im Rahmen seines Unterrichts drittes kombiniert und interagieren macht, nämlich das schriftlich Festgelegte, die szenischen Aufführungen und den kommunikativen Austausch. Diese Lern- bzw. Lehrstrategien hängen mit den Lerntypen zusammen, namentlich dem auditiven Lerntyp, dem visuellen Lerntyp, dem kommunikativen Lerntyp und dem haptischen Lerntyp, die bei der Unterrichtsplanung und -durchführung in Betracht zu ziehen sind (Vgl. Ende et al., 2013). Im Gehirn gibt es ein Schreibzentrum, ein Lesezentrum, ein Hörzentrum und ein Sprechzentrum und diese Zentren sind so verbunden, dass sie einander aktivieren (Vgl. Koeppel, 2013).
Da das Gedächtnis und die Geschichte „durch Erzählen, Vergegenwärtigen und kommunikativen Austausch“ entstehen, ist der Deutschunterricht, da sich Kulturen dabei treffen und gegeneinander kämpfen, die Bühne zur ständigen „Vergangenheitsbewahrung“ und „-bewältigung“. Für den kamerunischen Fall ist die Situation in dem Sinne beispielhaft, dass das Land, 57 Jahre nach der Unabhängigkeit, noch nicht im Klaren mit seiner Geschichte ist. Geschichtsschreiber denunzieren täglich die Tatsache, dass es junge KamerunerInnen eine verstümmelte Geschichte gelehrt wird. Dies ist auf die bereits angekündigte aber noch nicht effektiv gewordene Freilegung der sich in Frankreich befindenden Kolonialarchive zurückzufinden. Ohne dieses schriftlich Festgelegte bleibt das Kontinuum VergangenheitGegenwart-Zukunft stark gestört und somit die Formation eines kollektiven Gedächtnisses und die Identitätsstiftung unmöglich. In seiner in Kamerun am 5. Juli 2015 gehaltenen Rede erkannte der französische Präsident François Hollande die Tatsache an, dass Massaker während der Kolonisation in der Sanaga-Maritime und im Bamiléké-Land verübt wurden. Und damit diese gemeinsame schmerzliche Vergangenheit bewältigt wird, hatte er die baldige Freigabe der Kolonialarchive angekündigt. Die totale Geschichte des Landes ist unentbehrlich, damit Geschichtsschreiber ihre Arbeit leisten können, damit Geschichtserinnernde diese hantierende Vergangenheit überwinden können und damit Lehrer im Allgemeinen die richtige Geschichte des Landes erzählen bzw. lehren können. Allererst wichtig ist sie, damit die Identitätsstiftungsarbeit anfangen kann. Denn, wie es Gabriel Mbock uns noch in „C‘ Politik“128 am 11. April 2017 mahnte: „un peuple qui n’a pas d’histoire finit par se faire raconter des histoires“. Und damit diese Geschichte entsteht, kann vieles im Voraus getan werden. Ein Memorial gegen das Vergessen, ein Pantheon für die Hedden... können gebaut werden. Solange wir nicht im Einklang mit unserer Geschichte bzw. unseres Gedächtnisses sind, wird Kamerun ein Land bleiben und nie eine Nation sein.
Ein großes Paradoxon ist, dass viele kamerunische Deutschlehrer sich besser in der deutschen Geschichte als in der eigenen auskennen. Darum sind sie nicht dazu fähig, den fruchtbaren Kulturdialog im Deutschunterricht zu inszenieren und junge Kameruner auszubilden, die, von dem patriotischen Sinn genährt, nicht mehr in den Galliern ihre Ahnen sehen werden. Deshalb fordert uns Jean-Marc Ela (2011) dazu auf, einen kontextualisierten Unterricht und landesspezifische Lehrpläne, die im Einklang mit Bedürfnissen, Herausforderungen und Problemen stehen, zu schaffen. Diesbezüglich sagt er: „Un enseignement qui n’émane pas de la culture d’un peuple ne peut que produire des ratés, des complexés, des déchets, des épaves, c’est-à-dire, en somme, des gens qui n’ont absolument pas des racines et qui ne s’abreuvent à aucune source véritable“ (S. 21). Wenn diese eigengeschichtliche Ergänzung vorhanden ist, dann kann der Deutschlehrer als vollwertiger Vermittler zwischen den DACHL-Ländern129 und Kamerun gelten. Diese Ausbildung über die eigene Geschichte ist dementsprechend an Kinder, Schüler, Studenten, (Deutsch)lehrer, Erwachsene und Eltern gerichtet.
Literaturverzeichnis
Primärliteratur
Zweig, Stefan (2004): Sternstunden der Menschheit. 14 historische Miniaturen. 10. Auflage Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag.
- --. (2012): Sternstunden der Menschheit. Kapo Verlag.
Sekundärliteratur
Monographie und Artikel
Antor, Heinz (2013): Eurozentrismus. In: Nünning, Ansgar (Hrsg.) (2013): Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze-Personen-Grundbegriffe. 5. Auflage. Stuttgart-Weimar: J. B. Metzler Verlag. 196.
Aristoteles (2010): Die Poetik. Übersetzt und herausgegeben von Fuhrmann, Manfred. Ditzingen: Reclam.
Assmann, Aleida (2006): Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. München: C. H. Beck Verlag. - --. (2011): Die Vergangenheit begehbar machen. Vom Umgang mit Fakten und Fiktion in der Erinnerungsliteratur. In: Konrad-Adenauer-Stiftung (Hrsg.): Die Politische Meinung Nr. 500/501. Juli/August . 77 - 85.
Assmann, Jan (1995): Erinnern, um dazuzugehören. Kulturelles Gedächtnis, Zugehörigkeitsstruktur und normative Vergangenheit. In: Platt, Kristin und Dabag, Mihran (Hrsg.): Generation und Gedächtnis. Erinnerungen und kollektive Identitäten. Opladen: Westdeutscher Verlag. 51 - 75. https://archiv.ub.umheidelberg.de/propylaeumdok/2661/1/AssmannErinnemumdazuzugehoeren1995.pdf (letzter Zugriff am 02. April 2017).- --. (2007): Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität. 6. Auflage. München: C. H. Beck Verlag.
Bachelard, Gaston (1961): La poétique de l’espace. 3ème Édition. Paris : Presses Universitaires de France. 140 - 167.
Bänzner, Hansjörg/ Hennerici, Michael: Georg Friedrich Händel’s Strokes. In: Bogousslavsky J, Boller F (eds.): Neurological Disorders in Famous Artists. Front Neurol Neurosci. Basel, Karger, 2005, vol. 19. 150 - 159. http://www.karger.com/Article/PDF/85630 (letzter Zugriff am 12. April 2017).
Barsch, Achim (2013): Literaturbegriff. In: Nünning, Ansgar (Hrsg.) (2013). Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze-Personen-Grundbegriffe. 5. Auflage. Stuttgart-Weimar: J. B. Metzler Verlag. 455 - 456.
Barthes, Roland (1960): Histoire et Littérature: à propos de Racine. In : Annales. Economies, sociétés, civilisations. Volume 15, n° 3. 524 - 537. http://www.persee.fr/doc/ahess 03952649 1960 num 15 3 421625 (letzter Zugriff am 2. April 2017). - --. (1968): L’effet de réel. In : Communications, 11. Recherches sémiologiques [sur]le vraisemblable.84 - 89.http://www.persee.fr/doc/comm 0588 8018 1968 num 11 1 1158 (letzter Zugriff am 02. April 2017).
Bérubé, Claudia (2009): La poétique du roman historique d’Eveline Hasler. Université de Montréal. Thèse de Doctorat.https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/4067/Berube Cla udia 2010 these.pdf?sequence=2&isAllowed=y (letzter Zugriff am 20. Mai 2017).
Charton, Ariane (2012): Stefan Zweig ou l‘ »esprit de l’Europe ». In: Villa Europa N°3 2012. Universitätsverlag Saarbrücken. S. 47 - 54. http://universaar.uni-saarland.de/journals/index.php/villaeuropa/article/view/359/395 (letzter Zugriff am 11. November 2016).
Csaky, Moritz (2004): Die Mehrdeutigkeit von Gedächtnis und Erinnerung. Ein kritischer Beitrag zur historischen Gedächtnisforschung. Digitales Handbuch zur Geschichte und Kultur Russlands und Osteuropas. https://epub.ub.uni-muenchen.de/603/1/csaky-gedaechtnis.pdf (letzter Zugriff am 10. April 2017).
Ela, Jean-Marc (2011) : La Plume et la Pioche. Réflexion sur l’enseignement et la société dans le développement de l’Afrique noire. Yaoundé: Editions CLÉ.
Ende, Karin/ Grotjahn, Rüdiger/ Kleppin, Karin/ Mohr, Imke (2013): Deutsch lehren lernen 6. Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung. Klett - Langenscheidt, Goethe Institut.
Erll, Astrid (2004): Erinnerungshistorische Literaturwissenschaft: Was ist.und zu welchem Ende...? In: Nünning, Ansgar und Sommer, Roy (Hrsg.): Kulturwissenschaftliche Literaturwissenschaft. Disziplinäre Ansätze- theoretische Positionen- transdisziplinäre Perspektiven. Tübingen: Gunter Narr Verlag. 115 - 126.
Erll, Astrid/Nünning, Ansgar (2005): Literaturwissenschaftliche Konzepte von Gedächtnis: Ein einführender Überblick. In: Ders. (Hrsg.): Gedächtniskonzepte der Literaturwissenschaft: Theoretische Grundlegung und Anwendungsperspektiven. Berlin: Walter de Gruyter. S. 3 - 7. https://books.google.cm/books?id=dV23Idnq2zsC&pg=PR7&hl=fr&source=gbs selected pages&cad=2#v=onepage&q&f=false (letzter Zugriff am 2. April 2017).
Fronz, Maria (2013): Auf dem Weg nach Europa - Stefan Zweigs Ideen und Vorstellungen von einem geeinten Europa. Friedrich-Schiller-Universität Jena. Magisterarbeit. http://stefan-zweig.com/wp-content/uploads/2015/11/Magisterarbeit Maria Fronz.pdf (letzter Zugriff am 20. Mai 2017). (2014): Stefan Zweigs Ideen zu Europa und den europäischen Werten. Vortrag zur Jahrestagung der „Internationalen Stefan Zweig Gesellschaft“ in Zürich 13. 09. 2014. http://stefan-zweig.com/wp-content/uploads/2015/11/Fronz-Vortrag-Zweig-Zuerich.pdf (letzter Zugriff 21 März 2017).
Gerhard, Ute/ Link, Jürgen/ Parr, Rolf (2004): reintegrierender Interdiskurs. In: Nünning, Ansgar (Hrsg.) (2004): Grundbegriffe der Literaturtheorie. Stuttgart-Weimar: Verlag J. B. Metzler. 105.
Hamann, Jessica (2005) : Inszenierungen von Erinnerung und kollektivem Gedächtnis. Hermann Hesses Das Glasperlenspiel als Gedächtnisroman. A thesis presented to the University of Waterloo in fulfilment of the thesis requirement for the degree of Master of Arts in German. http://etd.uwaterloo.ca/etd/jhamann2005.pdf (letzter Zugriff am 09. Mai 2017).
Hamman, Bouba (2008): Le « Noir »: Psychanalyse d’un concept et essai d’une critique racio-historique d’une vision pejorante. In : Revue Internationale des Sciences Humaines et Sociales Volume 2, N°2. Yaounde: l’Harmattan. 151 - 175.
Heit, Helmut (2004): Die Griechen, die Barbaren und Wir: Kontinuität und griechischer Ursprung in westlichen Identitätsdiskursen. In: Därmann, Iris/Hobuß, Steffi/ Lölke Ulrich (Hrsg.): Konversionen Fremderfahrungen in ethnologischer und interkultureller Perspektive. Amsterdam - New York: Rodopi. 211 - 230.
Horkheimer, Max/ Wiesengrund Adorno, Theodor (2000): Dialektik der Aufklärung (philosophische Fragmente). Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
Huemer, Georg (2010): Stefan Zweig als Biograph von Balzac. Universität Wien. Diplomarbeit. http://othes.univie.ac.at/9637/1/2010-04-22 0448409.pdf (letzter Zugriff am 20. Mai 2017).
Joch, Markus (2009) : Literatursoziologie/Feldtheorie. In: Schneider, Jost (Hrsg.) (2009): de Gruyter Lexikon. Methodengeschichte der Germanistik. Berlin/New York: Walter de Gruyter. 385 - 420.
Kim, Eung-Jun (2003): Literatur als Historie. Zeitgeschichte in Thomas Manns „Doktor Faustus“ und Günter Grass' „Die Blechtrommel“. Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Dissertation. https://opus4.kobv.de/opus4-fau/files/69/DISSERTATION-KIM-PDF.PDF (letzter Zugriff am 02. Mai 2016)
Klopfer, Rolf (2013): Histoire vs. discours. In: Nünning, Ansgar (Hrsg.) (2013). Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze-Personen-Grundbegriffe. 5. Auflage. Stuttgart-Weimar: J. B. Metzler Verlag. 304.
Koeppel, Rolf (2013): Deutsch als Fremdsprache. Spracherwerblich reflektierte Unterrichtspraxis. 2. Auflage. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
Lavabre, Marie-Claire (2000): Usages et mésusages de la mémoire. In : Critique internationale, n° 7. Avril 2000. Culture populaire et politique. 48-57. http://www.persee.fr/doc/criti 1290-7839 2000 num 7 1 1560 (letzter Zugriff am 2. April 2017.).
Martinez, Matias/ Scheffel, Michael (2009): Einführung in die Erzähltheorie. 8. Auflage. München: C.H. Beck.
Nünning, Ansgar (2013): Historiographie und Literatur. In: Ders. (Hrsg.) (2013). Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze-Personen-Grundbegriffe. 5. Auflage. Stuttgart-Weimar: J. B. Metzler Verlag. 304-306.
Ofner, Verena (2004): Die historischen Romane Robert Neumanns. Eine Analyse. Universität Wien. Diplomarbeit. http://othes.univie.ac.at/147/1/ofner verena.pdf (letzter Zugriff am 20. Mai 2017).
Postiasi, Nina (2010): Rewriting History in the contemporary South African novel. Universität Wien. Diplomarbeit. http://othes.univie.ac.at/8776/ (Letzter Zugriff am 06 April 2017).
Renolder, Klemens (2012): Editorial. In: Stefan Zweig Centre Salzburg (Hrsg.): Zweigheft Nr. 06.http://www.stefan-zweig-centre-salzburg.at/pdf/zweigheft/zweigheft-06.pdf (letzter Zugriff am 06. April 2017).
Rensen, Marleen (2015): Writing European Lives. Stefan Zweig as a Biographer of Verhaeren, Rolland and Erasmus. In: European Journal of Life Writing vol. 4. http://ejlw.eu/article/view/162/294 (letzter Zugriff am 13. April 2017).
Rousseau, Jean-Jacques (1992): Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes. Discours sur les sciences et les arts. Paris : Flammarion. 167 - 257.
Sartre, Jean-Paul (1948 ): Qu’est-ce que la littérature? Paris: Éditions Gallimard.
Sazecek, Martin (2010): Stefan Zweig: Sternstunden der Menschheit. Masarykova univerzita. Bachelorarbeit.https://is.muni.cz/th/209573/pedf b b1/Sazecek Bachelorarbeit.pdf (letzter Zugriff am 20. Mai 2017).
Schmeling, Manfred: La notion de l’influence et la mémoire (inter)culturelle. In : Macedo, Ana Gabriela; Mendes de Sousa, Carlos; Vitor, Moura (dir.) Diacrítica. Dossier literatura comparada. Revista do Centro de estudos humanísticos da Universidade do Minho. Série Ciencias da Literatura. Nr. 24/03 2010. FCT - Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia. 15 - 30.
Schutte, Jürgen (1997): Einführung in die Literaturinterpretation. 4. Auflage. Stuttgart/Weimar: J.B. Metzler Verlag. 94 - 137.
Simo, David (2014): Erinnerungsinszenierungen im interkulturellen Kontext. Möglichkeiten und Notwendigkeit. In: Germanistik im Dialog. Deutsche Sprache und Kultur im afrikanischen Kontext. Beiträge der DAAD - Germanistentagung 2012 mit Partnerländern in der Region Subsahara-Afrika. Herausgegeben vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD): Wallstein Verlag. 87 - 99.
Slana, Michaela (2014): Stefan Zweig: Sternstunden der Menschheit. Masarykova univerzita. Diplomarbeit.https://is.muni.cz/th/383191/ff b/Stefan ZweigSternstunden der Menschheit.pdf (letzter Zugriff am 20. Mai 2017).
Schmidt, Siegfried J. (2013): Gedächtnis und Gedächtnistheorien. In: Nünning, Ansgar (Hrsg.) (2013): Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze-Personen- Grundbegriffe. 5. Auflage. Stuttgart-Weimar: J. B. Metzler Verlag. 252 - 254.
Souriau, Anne (1990): Montage. In: Souriau, Etienne (ed.) (1990): Le Vocabulaire d’Esthetique. Paris : Presses Universitaires de France. 1025.
Strasen, Sven-Knut (2013): Ideologie und Ideologiekritik. In: Nünning, Ansgar (Hrsg.) (2013): Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze-Personen-Grundbegriffe. 5. Auflage. Stuttgart-Weimar: J. B. Metzler Verlag. 326.
Tucholsky, Kurt (1927): Geschichtswissenschaft. In : Panter, Peter. Das Unterhaltungsblatt der Vossischen Zeitung Nr. 168, vom 21. Juli 1927. http://www.textlog.de/tucholsky- geschichte-1927.html (letzter Zugriff am 23. Dezember 2016).
Voigts-Virchow, Eckart (2013): Montage/Collage. In: Nünning, Ansgar (Hrsg.) (2013): Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze-Personen-Grundbegriffe. 5. Auflage. Stuttgart-Weimar: J. B. Metzler Verlag. 540 - 541.
Vorwalder, Sara (2012): Geschichte(n) erzählen. Montage als Form der Geschichtsschreibung bei W. Benjamin und Jean- Luc Godard. Universität Wien. Diplomarbeit. http://othes.univie.ac.at/19821/1/2012-04-02 0503447.pdf (letzter Zugriff am 20. Mai 2017.).
Welzer, Harald (2010): Erinnerungskultur und Zukunftsgedächtnis. In: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 25 - 26.16 - 23.
Wolf, Werner (2004): Intermedialität. In: Nünning, Ansgar (Hrsg.) (2004): Grundbegriffe der Literaturtheorie. Stuttgart-Weimar: Verlag J. B. Metzler. 107-108.
Zelewitz, Klaus (1995): Mimesis der Eingeweihtheit. In: Holzner, Johann/Wiesmüller, Wolfgang (Hrsg.) (1995): Ästhetik der Geschichte. Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. Germanistische Reihe, Bd. 54. 99-118.
Zhigunova, Lidia (2002): Stefan Zweig and Russia. Louisiane State University and Agricultural and Mechanical College. A Thesis submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in the Interdepartmental Program in Comparative Literature. http://digitalcommons.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2571&context=gradschool theses (letzter Zugriff am 25. April 2017).
Zweig, Stefan (2004): Die Schweiz als Hilfsland Europas. In: Beck, Knut (Hrsg.) (2004): Stefan Zweig auf Reisen. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag. 221-225. - --.: Reise ins Russland . In: Beck, Knut (Hrsg.) (2004): Stefan Zweig auf Reisen. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag. 277- 319.
Nachschlagewerke
Brockhaus Enzyklopädie in zwanzig Bänden. Siebzehnte völlig neubearbeitete Auflage des grossen Brockhaus. Fünfter Band DOM - EZ. Wiesbaden F.A. Brockhaus Verlag. 1968.
- Elfter Band L - MAH. Wiesbaden: F.A. Brockhaus Verlag. 1970.
- Neunzehnter Band TRIF - WAL. Wiesbaden: F.A. Brockhaus Verlag. 1974.
- Siebter Band GEC - GZ. Wiesbaden: F.A. Brockhaus Verlag. 1969.
- Zwölfter Band MAI - MOS. Wiesbaden: F.A. Brockhaus Verlag. 1971.
Dictionnaire Pratique. Langue Française (2006) : Eclairs de Plume.
Meyers Großes Standard Lexikon in 3 Bänden. Herausgegeben von der Lexikonredaktion des Bibliographischen Instituts. Band 1: A - Gh. Bibliographisches Institut Mannheim/Wien/Zürich: Meyers Lexikon Verlag. 1982.
Textor, A. M. (2011): Sag es treffender. Sag es auf Deutsch. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
Wahrig, Gerhard/Krämer, Hildegard/Zimmermann, Harald (Hrsg.) (1980): Brockhaus Wahrig. Deutsches Wörterbuch in sechs Bänden. Erster Band A - BT. Wiesbaden: F.A. Brockhaus Verlag und Stuttgart: Deutsche Verlags - Anstalt.
Webseiten
- http://wortwuchs.net/lebenslauf/stefan-zweig/ (letzter Zugriff am 19. Februar 2017. 22:50).
- http://www.dieterwunderlich.de/Stefan Zweig.htm (letzter Zugriff am 19. Februar 2017. 22:50).
[...]
1 So nennt sie Stefan Zweig selbst.
2 Die erste Fassung aber bestand aus 5 Miniaturen allein.
3 All diese Schwächen sind auch bei Zweig vorzufinden.
4 Subjektiv ist seine Perspektive des Erzählens, denn er pflegt einen bestimmten Umgang mit der erinnerten Epoche, die erinnert wird, weil etwas Besonderes in seiner Gegenwart zutage tritt.
5 Ich habe festgestellt, dass er aus einer subjektiven Perspektive erzählt, auch wenn er das nicht zugestehen will. Historiker ist er, weil er Schlüsselmomente der „Weltgeschichte“ selegiert und schreibt.
6 An dieser Stelle soll hervorgehoben werden, dass Slana Zweigs Miniaturen als Essays betrachtet.
7 Wie sie im Matias Martinez‘ und Michael Scheffels „Einführung in die Erzähltheorie“ und Jürgen Schuttes „Einführung in die Literaturinterpretation“ dargestellt wird.
8 Auch in seiner „Baumeister der Welt“ schreibt er die Biographien von 3 Europäern, die, wie der Name bereits verrät, die Welt gebaut hätten.
9 Den Habitus definiert Markus Joch als „Eine Matrix von Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsmustern, die dafür sorgt, dass Praktiken und Geschmacksäußerungen in den unterschiedlichsten Handlungsbereichen kongruieren.“ (Joch, 2009, S. 393). Anders gesagt ist der Habitus die Tradition, worunter das Individuum aufwächst und die somit sein Verhalten bedingt.
10 das Individuum ist bestrebt, in seinem Gegenwartsleben seine Kenntnisse (Wissen durch Sinnesorgane) von gestern ,wieder zu gewinnen’.
11 Teile von ihr
12 Walter Benjamin hat das geschichtliche Kontinuum seinetwegen erhellt. Er meint bezüglich der Trias : „Erinnerung und Geschichtsschreibung können unabgegoltene Potentiale des Vergangenen aktualisieren und entbinden. Und indem sie diese retten, formulieren sie Ansprüche auf die Zukunft.“ (Kramer, 2003. S. 116. zit. nach Vorwalder, 2012, S. 17).
13 Die Prospektion, von der hier die Rede ist, ist wiederum retrospektiv, denn sie findet in eine der wirklichen Zukunft vorankommende Zeit, sodass wenn die Vorhersage in der Zukunft zu einer Realität wird, werde sie zu dieser Zeit vergangen.
14 Auf diese Frage ist Jean-Paul Sartre (1960) eingegangen in „Qu’est-ce que la littérature?“ (seinem umfangreichen Essay von 306 Seiten). In der Tat antwortet er auf diese Frage in einer nicht unmittelbaren Weise. Er geht auf drei seines Erachtens um die Hauptfrage (Was ist Literatur?) umkreisende Fragen, nämlich „Qu’est-ce qu’écrire? (Was bedeutet schreiben?), „pourquoi écrit-on?“ (Warum schreibt man?) und „pour qui écrit-on?“ (Für wen schreibt man?). Diese Verfahrensweise ist ein Beweis dafür, dass die Literatur sich nicht einfach definieren lässt. Autorenpoetiken, Literaturtheorie bemühen sich, ihren Gegenstand (Literatur) zu definieren, aber umsonst. Da jeder davon bewusst ist, dass keine Literaturschule, keine Literaturströmung, keine Autorpoetik, kein Individuum... die Literatur in ihrer Ganzheit definieren kann, ist es eher mittlerweile die Rede von Literaturbegriff und nicht mehr von Literatur (der Fall in „Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie“). Jeder Literaturbegriff liefert nur eine Einsicht in die Literatur.
15 Referentielle Texte unterscheiden sich von fiktionalen Texten darin, dass sie einen Bezug zu äußerer Wirklichkeit haben.
16 Phantastische Texte haben überhaupt keinen Bezug auf die Realität im Gegenzug zu realistischen Texten, die einen relativen Grad an Fiktionalität beinhaltet.
17 In der Erzähltheorie aber ist der Begriff Geschichte nicht allgemeingültig. Konkurrierende Begriffe zu Geschichte sind Legion: „Fabula“ (bei den Formalisten), „Fabel“ (Lämmert), „story“ (White, Chatman, Rimmon-Kenan), „plot“ (Forster), „narrated“ (Prince). (Vgl. Martinez/Scheffel, 2009, S. 26). Neben dem Begriffe Geschichte (zumindest bei Todorov) ist der des „discours“ zu unterscheiden. Der „discours“ bei Todorov bezeichne die Art und Weise, wie der Erzähler dem Leser die Geschichte übermittelt (Vgl. Todorov, Ebd., zit. nach Martinez/Scheffel, 2009, S. 23). Marinez/Scheffel (2009, S. 22-25) in ihrer Unterscheidung von dem „Was“ und dem „Wie“ erhellen die Begriffspaare „fabula“ vs. „sjuzet“ bei den Formalisten (Tomasevskij); „histoire“ vs. „discours“ bei Todorov; und Genettes Trias „histoire“- „récit“ -„narration“.
18 Hervorgehoben von mir, T. K. A.
19 Hervorhebung im Original.
20 Hervorhebung im Original.
21 Hervorgehoben von mir, T. K. A.
22 Nietzsche und Freud seien der Meinung, dass es Gewalt und Zwang jeweils sind, die die Gedächtnisformation bedingen (Vgl. Jan Assmann, 1995, S. 62f.) während Halbwachs und Aby Warburg die „Liebe“, „die Affektivität“ bzw. die Gefühle als ,Kultur zusammenhaltende’ sowie erinnerungsformende Größen ansehen. (Vgl. ebd., S. 60)
23 Darum ist das Vergessen zugleich das Negative des Gedächtnisses und der Erinnerung, denn es vergangene Spuren löscht.
24 Aber Vergessen ist nicht nur dieser Gegensatz zu Erinnerung bzw. Gedächtnis. Es schützt das Gedächtnis vor Überdosis, indem es seine Speicherkapazität lindert.
25 Wir vergessen seines Erachtens nur das, was nichtlebensdienlich ist und behalten bzw. erinnern wir an Lebensdienliches.
26 Nur augenblicklich kann dieses Vergessen sein, denn wie ich es oben gezeigt habe, ist die Erinnerung „beabsichtigt oder planmäßig“ stimuliert, aber sie kommt auch, wie Aleida Assmann sagt „völlig unerwartet“ vor.
27 Siegfried J. Schmidt (2013) sieht auch hierin eine gewisse .Komplementarität' zwischen Erinnerung und Vergessen, da Gedächtnisinhalte oder das was in Vergessenheit gerät, von dem „sozialen Identitätsmanagement“ abhängen. Die Art und Weise, wie Kollektividentität von dem „Oben“ ,gemanagt‘ wird, hänge von „Affekten, [Interessen], Bedürfnissen, Normen und Zielen“ der Regierenden ab (Vgl. S. 253).
28 Diese „Versicherungssysteme“ sind „symbolische Medien“ und „Institutionen“. Die sind verantwortlich für die „Speicherung“ bzw. für die „Tradierung“ von dem, was nicht vergessen werden soll.
29 An dieser Stelle möchte ich nochmals auf den Unterschied zwischen Vergessen und Verdrängung zurückkommen. Das Vergessen ist etwas Unabsichtliches, während die Verdrängung eher etwas Absichtliches ist. Ein traumatisierendes Ereignis wird verdrängt (d.h. dessen ,Hochkommen‘ bewusst gehindert), aber kann in der Gegenwart mit perversen und zerstörerisch-negativen Folgen an die Oberfläche heraufkommen (Vgl. Simo, 2014, S. 93).
30 Das 19. Jahrhundert gilt in Aleida Assmanns (2006, S. 42) Augen als „Zeit der Historisierung“.
31 Cicero genauso wie Herodot sieht „in der Geschichtsschreibung eine Waffe gegen das Vergessen“ (Assmann, ebd., S. 45)
32 In Jan Assmanns Jargon sind „kalte“ Gesellschaften nicht mit ,primitiven’, ,schriftlosen’ und ,azephalen‘ Gesellschaften gleichzusetzen. ,Kälte’ in seinem Sinne -im Gegensatz zu Cl. Levi-Strauss (1960/1962) - sei kein Synonym für Mangel an etwas. ,Kalte’ Gesellschaften leben in einer anderen Erinnerung, aber damit sie in dieser Welt der „Kontinuität“, des „Regelmäßigen“ weiterleben können, müssen sie dem historischen Wandel Widerstand leisten. Techniken ,kalter‘ Erinnerung dienen dazu, Erinnerung zu bewahren und sowie Geschichte (, die Wandel zeitigt) fern davon zu halten. (Vgl. Assmann, 2007, S. 68)
33 Weil soziale Gruppen ihre Geschichte „in Erinnerung beh[a]lten“ (Assmann, 2006, S. 44)
34 Marie- Claire Lavabre (2000) in Anlehnung an Friedrich Nietzsche (1964) zeigt, dass es eine dreifache Form der Geschichte gibt. Dreifach ist sie, denn sie entspreche der Menschennatur. Es wird, so Lavabre, zwischen „histoire monumentale“, „histoire traditionaliste“ und „histoire critique“ unterschieden. Die „Histoire monumentale“ ist « un remède à la résignation, elle fonde la croyance en la cohésion et en la continuité de la grandeur à travers tous les temps : elle rapproche ce qui ne se ressemble pas, le généralise et le déclare identique. »; die « Histoire traditionaliste » entspreche der Menschennatur des Aufbewahrers und des Dankbaren für die Vergangenheit; und die « Histoire critique » ist beurteilender und verurteilender Natur. Sie begnügt sich nicht mit der Vergangenheit, sie ‘desakralisere’ sie. Es ist diese letzte Form, die an der „Entzauberung“ arbeitet, während die zwei ersteren aufgrund ihres aufbewahrenden Charakters und ihrer identitätsstiftenden Aufgabe dem, was mittlerweile unter dem Namen „Gedächtnis“ bekannt ist, entsprechen (Vgl. S. 52f.).
35 damit ist gemeint „das Einmalige, das Typische und das Repräsentative“ (Fuhrmann, 2010, S. 113)
36 gemeint sind „nicht einmalige“, sondern „allgemeingültige Handlungen“ (ebd., S. 113)
37 Aristoteles weist ab die zu seiner Zeit geltende naive Unterscheidung, dass der Geschichtsschreiber in Prosaform und der Dichter in Versen schreibt. Er sagt selbst, um diese Unterscheidung zunichte zu bringen: „-man könnte ja auch das Werk Herodots in Verse kleiden, und es wäre in Versen um nichts weniger ein Geschichtswerk als ohne Verse-“ (Aristoteles, 2010, S. 29).
38 Die Anwendung von Kategorien wie „dem Wirkliche“, „das Mögliche“, „das Wahrscheinliche“ und „das Glaubwürdige“ verhilft Aristoteles zur Differenzierung zwischen dem Literaturwerk und dem Geschichtswerk. Jene Kategorien sind also die „Seinsmöglichkeiten“ der Literatur. „Nachgeahmt werden wahrnehmbare Gegenstände, Charaktere und Handlungen im Ganzen; der Wahrscheinlichkeit unterliegen Ereignisfolgen“ (Fuhrmann, 2010, S. 166). Die Kategorie der Glaubwürdigkeit aber ist wichtig bei der Realisierung der „affektiven Wirkung“ der Dichtung (der Tatsache, dass das Publikum sich mit dem Dargestellten, also Figuren, Charakteren und Handlungen identifiziert). Mehr als die Möglichkeit und die Wahrscheinlichkeit verfügt die Glaubwürdigkeit über eine Überzeugungskraft: Sie lässt das lesende Subjekt bzw. der Zuschauer an der „Evidenz des Geschehens“ glauben, egal wenn das Geschehen unmöglich ist. Das möglich-Wahrscheinliche wirkt objektiv, während das Glaubwürdige eher subjektiv ist. Auch wenn „das Mögliche zugleich auch glaubwürdig sei“, habe eine glaubwürdig-unmögliche Handlung den Vorzug auf eine möglich-unglaubwürdige Handlung (Vgl. ebd., S. 171).
39 Also diejenige Fabel, die Erwartetes mit Unerwartetem; Logik mit Unlogik kombiniert
40 Die räumliche Distanz und die mit ihr einhergehenden Mankos können überwunden werden, wenn, so Kurt Tucholsky, .Kulturen ähnlich’ sind, d.h. sie sind ständig und regelmäßig in Kontakt: „Der Berliner war in Berlin, der Stockholmer kennt vielleicht Berlin“.
41 Der Begriff ist Peter Handke entnommen. Er wird verwendet hier, um zu zeigen, durch Übersetzungen von „Chameau“ mit „Kamel“, „fair“ mit „fair“, „Humour mit „Humor“ o. Ä., dass die Sprache defizitär ist.
42 entstanden, da der Historiker mit sehr alten Quellen arbeitet, die von der Zeit der „unvollkommenen Druckerkunst“ datieren.
43 <emplotted> Texte sind Texte mit außertextueller Wirklichkeit (Vgl. Erll, 2004, S. 123).
44 Es ist daher kein Zufall, dass Roland Barthes (1960) die Literatur als „ cet ensemble d’objets et de règles, de techniques et d‘œuvres, dont la fonction [.] est précisément d’institutionnaliser la subjectivité “ definiert (S. 536). Hervorhebung im Original.
45 Diese Unterscheidung ist nicht so weit von derer, die Benjamin (1991, S. 451) zwischen dem Historiker (Schreiber der Geschichte) und dem Chronisten (Geschichts- Erzähler) macht. Walter Benjamin privilegiert die Arbeit des Letzteren. Er erzählt die Geschichte (lange oder kurze) mit Subjektivität, denn die Epoche, aus der sie stammt, ist irgendwie mit seiner eigenen verbunden. Historiker hingegen erheben den Anspruch darauf, ein „Gesamtbild der [Welt]Geschichte“ zu zeichnen, indem sie sich „nur an den vermeintlich wichtigen Punkten der Vergangenheit orientier[en]“ (Vorwalder, 2012, S. 29). Der Chronist ist von seiner subjektiven Tendenz bewusst, akzeptiert sie und geht mit ihr um, im Gegenzug zum Historiker, der sich zur Objektivität, zur Wahrheit bekennt, der aber im Endeffekt Ideologie und Interessen dient.
46 Dabei sei der Dichter „viel freier“ als der Historiker, der sich zu der Wahrheit bekennt (Vgl. Ofner, 2004, S. 15).
47Claudia Berube (2009, S. 15ff.) bietet die zu ihrer Zeit 5 vorhandenen Typologien von historischen Romanen dar. Es handelt sich um: Die binäre Typologie von Geppert (1976): (der „übliche“ und der „andere“ Roman), die aus drei Typen bestehende Typologie von Joseph W. Turner (1979): („documented Historical Fiction“, „Invented Historical Novels“ und „Disguised Historical Novels), die Typologie von David Cowart (1989) mit 4 Romantypen („The Way it Was“, „The Way it Will Be“, „The Turning Point“ und „The Distant Mirror“) und die elaborierteste Typologie aus 5 historischen Romanen von Ansgar Nünning (2002): „Der dokumentarische historische Roman“, „der realistische historische Roman“, „der revisionistische historische Roman“, „der metahistorische Roman“ und „die metahisto[rio]graphische Fiktion“.
48 Denn, wie Aristoteles es mahnte, sei der Dichter, der sich an historischen Quellen anlehne, um nichts weniger ein Dichter.
49 Trotz des Vorschlags, dass es zwischen Geschichte und Historie differenziert werden sollte, wobei das Wort Geschichte bzw. geschichtlich auf das „Geschehen“, den geschichtlichen Tatbestand verweise und Historie bzw. historisch auf „die bewußte Aneignung oder Verarbeitung der Geschichte“ (Brockhaus Enzyklopädie, 1969, S. 188), sind beide Begriffe in dieser Arbeit als Synonyme gebraucht.
50 Hervorgehoben von mir, T. K. A.
51 „Geschichte als Dichterin„, „Ist die Geschichte gerecht?“ und „die Geschichtsschreibung von Morgen“ alle In: Ders.: Die schlaflose Welt. Aufsätze und Vorträge aus den Jahren 1909-1941. Herausgegeben und mit einer Nachbemerkung versehen von Knut Beck. Frankfurt am Main: S. Fischer 1983 (=Gesammelte Werke in Einzelbänden)
52 Denselben Standpunkt scheint Klaus Weimar zu unterstützen, denn Historiker, seines Erachtens, „schreiben nicht Geschichte, vielmehr schreiben sie Texte über Geschichte; Historiker erzählen nicht Geschichte, sie schreiben Texte über Geschichte, unter anderem auch 'narrative' Texte.“ (Klaus Weimar, 1990, S. 29. zit. nach Kim, 2003, S. 10). Dies ist ein Beweis dafür, dass es unmöglich ist die Geschichte zu erreichen. Es wird nur trotz der annoncierten Objektivität und Wahrheit seitens der Geschichte versucht, sich Geschichte anzunähern. Egal, welche Form er einnimmt, sei der Diskurs der Historie stets eine Erzählung. (Vgl. Kim, 2003, S. 21). Denn Tatbestände werden dergestalt zusammengebracht, dass sie eine Handlung mit einem Anfang und einem Ende ausmachen (ebd., S. 21).
53 voire
54 Manfred Schmeling (2010) sieht in der poststrukturalistischen (transkulturellen) Intertextualität die Theorie, die am besten das Literaturgedächtnis offenbart (S. 26). Er schreibt somit dem Dichter die Aufgabe der Aufbewahrung und Weitergabe des kulturellen Gedächtnisses zu (Vgl. ebd. S. 26f.). Denn wenn Kulturen sich begegnen, sind es auch Literaturen, die sich begegnen (die Metapher der „Kultur als Text“) (Vgl. ebd., S. 27).
55 Dieser Begriff ist von mir, T. K. A.
56 Erll und Nünning stützen sich auf Siegfried J. Schmidt (2000), um die Unterscheidung Symbol- und Sozialsystem anzustellen
57 Erinnerungsgeschichte legt den Fokus auf die ,prozesshafte‘ „Aneignung, retrospektive Deutung und Funktionalisierung [von historischen Ereignissen] durch soziale Gemeinschaften“ (Erll, 2004, S. 116) und nicht auf historische Ereignisse (egal ob sie die wirkliche objektive Wirklichkeit seien). Sie interessiert sich für das, was in einer Kultur bzw. einem Kollektiv als Wirklichkeit anerkannt und dargeboten wird. Dadurch gewinnt sie „Einblicke“ in „historische Erinnerungstechniken und -medien [womit wird erinnert?], soziale Rollen und Machtgefüge (wer darf erinnern/ die Vergangenheit deuten?), Identitäts- und Alteritätskonzepte (wessen Vergangenheit wird wie erinnert?), Werthierarchien und Normstrukturen (welche ,Lehren’ legen die Vergangenheitsversionen nahe?)“ (ebd., S. 116).
58 Kulturgeschichtliche Literaturwissenschaft sei bei Erll (2004) eine „disziplinübergreifende“ Forschungsrichtung in der Kulturwissenschaft, die sehr von ,geschichtswissenschaftlichen Ansätzen’ gewinnt. In der kulturgeschichtlichen Literaturwissenschaft werden „das Kulturelle der Literatur“ und „das Poetische der Kultur“ untersucht (S. 115). Es geht in Einzelheiten darum, wenn der Literaturwissenschaftler sich mit dem literarischen Text auseinandersetzt, die Ebene des Geschichtlichen mit derer des Poetischen zu verschmelzen (ebd., S. 116). Das Geschichtliche heißt, wie viele historische „Daten und Fakten“ der Text an sich hat und das Poetische lässt auf die Frage antworten, wie ,eignet sich an’, wie ,deutet’ und wie gearbeitet’ der Literat jene historische „Daten und Fakten“ bzw. vergangene „Wirklichkeit“ (Vgl. ebd., S. 116).
59 Diese Unterkapitel sind Zusammenfassungen aus Erlls (2004) Artikel, wobei sie auf die Frage „was ist erinnerungshistorische Literaturwissenschaft?“ eingeht.
60 Die Literatur kann den herrschenden Diskurs infrage stellen bzw. erschüttern, indem sie Gedächtnisinhalte in eine andere Perspektive untersucht und indem sie diese transformierte Gedächtnisinhalte wieder in das Kollektivgedächtnis hinzufügt.
61 Das Beispiel von der Historiographie im 19. Jahrhundert und dem historischen Roman.
62 „Unbekannt“ sind diese Aspekte, denn sie werden seitens der Geschichte oder im nationalen bzw. politischen Gedächtnis „dethematisiert, tabuisiert oder ganz einfach übersehen und vernachlässigt“ (Vgl. Assmann, 2011, S. 84).
63 So heißt die Abkürzung für „Sternstunden der Menschheit“, die in dem kommenden analytischen Teil gebraucht wird.
64 Diese Ausgabe beinhaltete fünf Miniaturen.
65 « Miniature visuelle » und « miniature sonore »
66 Vergleich des Umfangreichen zu dem Kleinen (übersetzt von mir, T. K. A.).
67 Stefan Zweig-Forscher betrachten seine einzelnen Miniaturen als Essays, Prosastücke, Doku-Fiktion, kurze biographische Erzählungen usw.
68 Die Fabelanalyse und die Erzählsituation kommen bei Martinez und Scheffel (2009) unter dem „Wie“ der Darstellung vor, wobei sie innerhalb des Wie die „Zeit“, den „Modus“ und die „Stimme“ als Oberbegriffe unterscheiden. Trotz der Tatsache, dass er genauso wie Schutte an literarischen Texten arbeitet, bereitet der theoretische Hintergrund -was in gewisser Hinsicht verständlich ist, denn ihr Buch ist eine Einführung in die Erzähltheorie - noch zu keinem leichteren praktischen Zweck. Bei Schutte aber findet keine Diskussion mehr statt, er ist präzis und bündig, genau das, was ich diesem Teil anvisiere. Es soll aber auch letztendlich hervorgehoben werden, dass Martinez’ und Scheffels Buch ein Lexikon der Begriffe der Erzähltheorie am Ende ihres Buches anbietet. Diese Bestimmungen sind mehr oder minder umfangreich und werden nebensächlich bzw. zeitweise in diesem Teil verwendet.
69 Da Stefan Zweig zur Konstruktion eines geistigen Europas beiträgt.
70 Männlich ist ein Vers, wenn die letzte Silbe steigend ist und weiblich, wenn sie fallend ist.
71 Fallend ist der Rhythmus des Verses, wenn die erste Silbe des Verses stark ist. Der steigende Rhythmus zeichnet sich dadurch, dass die erste Silbe schwach ist.
72 Stefan Zweig vergleicht diese augenblickliche Ohnmacht Lenins mit dessen Hindenburg, der in den ersten Tagen des Ersten Weltkriegs, der, nachdem er 40 Jahre lang „den Russenfeldzug manövriert und exerziert“ hatte, jetzt dazu verurteilt war, „auf der Landkarte mit Fähnchen die Fortschritte und Fehler der einberufenen Generäle“ zu verfolgen.
73 In seinem Essay „Die Schweiz als Hilfsland Europas“ (2004) stellt Zweig die Schweiz als Synonyme für „Neutralität“, „Aufbau“, „Heilung“, „Mitleid“, „Hingabe“, Geborgenheit, „Taktgefühl“ Im Gegensatz zu anderen Völkern Europas, die überall „Zertrümmerung“, „Verwundung“ und Leiden geschaffen haben, ist die Schweiz in Stefan Zweigs Augen das „Herz Europas“ (S. 222) und vielleicht ein Ersatz für Europa. Während des Ersten Weltkriegs hat sie dank des „Roten Kreuzes“ und der gebührenfreien „Postenvermittlung“ (Vgl. ebd., S. 222f.) nicht nur „Kriegsverwundeten“ ein Zuhause gegeben, sondern auch den Kontakt unter Millionen getrennten Familien aufrechterhalten. Zweig erkennt in der Schweiz letztendlich die „übernationale Macht der Gerechtigkeit und der Menschlichkeit“ (ebd., S. 222) und das echte „Symbol des Friedens“ (ebd., S. 225) an.
74 Lenin richtet sich an die deutsche Regierung, denn Deutschland und Österreich waren entgegen Frankreich und Italien keine Alliierte Russlands. Die Unterstützung Deutschlands bekommt er, da wie es Geopolitiker sagen: „Die Gegner meiner Gegner sind meine Freunde“.
75 An dieser Stelle soll noch etwas betont werden: Da Stefan Zweig sich an Tolstois Leben anlehnt, werden die Szenen in dieser Miniatur nicht nur zu bloßen Szenen eines Dramas. Sie werden darüber hinaus zu Lebensszenen. Dieser metaphorische Sinn hat auch damit zu tun, dass das Leben sehr oft im Vergleich zu einem Theaterstück steht. Ein Theaterstück, das eine Figur verlässt, erst wenn sie ihre Rolle bis zum Ende gespielt hat. Stefan Zweig führt also in einem Wort die Theatralisierung des (wirklichen) Lebens durch.
76 Diese Bekehrung zum Pazifismus hat Tolstoi mit Zweig selbst gemeinsam. Somit kann in dieser kurzen Biographie Tolstois die eigene Biographie Zweigs gelesen werden. Leo Tolstoi war nämlich Zweigs Vorbild.
77 Mit Vorwand: « Die Religion ist Opium fürs Volk » (S. 288)
78 Diese 3 Miniaturen gehören zur Sternstunden Amerikas, da ihre jeweiligen Geschichten sich in Amerika abspielen und nicht, weil die Hauptfiguren daraus stammen. Nur in „Das erste Wort über den Ozean“ ist Cyrus W. Field ein Amerikaner. In „Flucht in die Unsterblichkeit“ sind de Balboa und die Seinen Konquistadoren (Spanier) und in „Die Entdeckung Eldorados“ ist J. A. Suter ein Schweizer.
79 „Injerez de los Caballeres aus adeliger Familie geboren, war er als einfacher Soldat mit Rodrigo de Bastidas in die neue Welt gesegelt und schließlich nach manchen Irrfahrten mitsamt dem Schiff vor Espanola [sic] gestrandet“ (SSdM, S. 14).
80 Eine neben der Meerenge von Panama und der Küste von Venezuela von Alonzo de Ojeda und Diego de Nicuesa dank der Befugnis des Königs von Spanien gegründete Kolonie (SSdM, S. 12).
81 Denn es war zu scharfen Konflikten zwischen den Konquistadoren und den Eingeboren gekommen, wobei Letztere die Ersteren fast völlig ausgerottet hatten.
82 Ein Gouverneur der terra Firma, den der König dazu beauftragt hatte, Ordnung in Darien wieder zu bringen.
83 „Häuptling[e] bei den Indianer Süd- und Mittelamerikas“ (Textor, 2011, S. 213).
84 Ein Baum wurde niedergeschlagen, in Form eines Kreuzes geschnitten, auf dessen Oberfläche Initiale des Königs von Spanien geschrieben und letztendlich eingegraben (SSdM, S. 27). Da „schwenkt die Fahne [der Krone Kastiliens] nach allen vier Winden, um für Spanien alle Fernen in Besitz zu nehmen, welche diese Winde umfahren“ (SSdM, S. 27). Auch am Strande wurde zelebriert: De Balboa tritt ins Gewässer hinein mit einem Schwert in eine Hand und in die andere „die Fahne Kastiliens und das Bildnis der Mutter Gottes“ (SSdM, S. 29). Nachdem er den Eid gesagt und sein Mann wiederholt hat und vom Wasser gekostet hat, schreibt sich der Schreiber alles.
85 Jede Episode, wie es bei Zweig üblich ist, trägt einen zusammenfassenden Titel.
86 Der Chor in diesem Text wird zu einer Vermittlungsform bzw. einer Rekonstruktion des de Balboas Eides. Diese Unterbrechung in dem normalen Lauf der Erzählung dient auch zur Verfremdung. Da der Chor eine kollektive Figur ist, ist sie ein Beweis für das Beiseitelassen des Egoismus und Ausdruck des Patriotismus und der Ehrfurcht gegenüber der Krone. Eine nähere Betrachtung dieser Szene bringt zur Feststellung, dass sie der einzige Augenblick der Einstimmigkeit, des Einverständnisses ist.
87 Der Begriff Glokalisierung ist von Robert Robertson und Entterritorialiserung/Deterritorialisierng von Giles Deleuze.Glokalisierung ist der Beweis dafür, dass das reine Lokale eine Utopie ist, denn es birgt in sich das Globale. Der Begriff Entterritorialisierung/Deterritorialisierung drückt die Auflösung der geographischen, kiilturellen...Gren/en (Vgl. Csaky, 2004, S. 5) aus.
88 „Medizinstudent von der Uni in Montpellier“ (SSdM, S. 105)
89 Das haben sie nicht gemacht, denn sie waren den Interessen des Politischen unterworfen. In der Tat wurde der Charakter des Komponisten („Konterrevolutionär“) mit den Idealen des (Revolutions)liedes als inkompatibel betrachtet. Dies nennt der Erzähler „geniale Paradoxie, [..] [d]ie nur die Geschichte [als Wissenschaft] erfinden kann“ (SSdM, S. 109).
90 Dieser Begriff ist von mir, T. K. A.
91 Diese Information liefert der Fußnotentext der russischen Ausgabe des Kapo-Verlags.
92 An dieser Stelle soll ich noch die Zusammenfassung des historischen Hintergrunds, wie sie im Text dargestellt wird, darbieten. Als Napoleon den Kaisertitel usurpierte und seine Ambitionen für Europa bekundete, entschlossen sich Länder Europas (Russland, Preußen, Österreich, England) im Rahmen einer Einigung ihn zu kontern. Da Napoleon davon bewusst ist, dass er vereinigte Länder nicht trotzten kann, entscheidet er sich für Einzelangriffe. Nachdem er Blücher gesiegt hat, ist Wellington dran. Aber um den Sieg ohne Sorge erringen zu können, beauftragt er Grouchy dazu, sich um den preußischen Fall zu kümmern.
93 Der ist im Jahre 1847 gestorben.
94 Sagten mit Stolz die 17000 Soldaten vor dem Sturmanbeginn gegen die preußische Armee.
95 Sagten die Franzosen, als die Soldaten unter Wellingtons und Blüchers Autorität sie überschwemmten.
96 Murmelte Napoleon vor sich hin, sehend dass Wellingtons Truppen sich dem Schlachtfeld annäherten.
97 Die Elegie, so Textor (2011), ist ein „wehmütiges Gedicht“ (S. 108).
98 Diese Szene lässt an die pädophile aber auch homoerotische Liebe zwischen Tadzio und dem Dichter Gustav von Aschenbach im Thomas Manns „Der Tod in Venedig“ denken.
99 In der Miniatur wird einfach seinen Nachnamen angegeben.
100 Goethe hatte dieses Gedicht allen Hausgenossen versteckt.
101 Diese Ausgangsinformationen sind das Geburts- und Todesjahr.
102 Goethe hat sie während seiner Rückreise von Karlsbad nach Weimar geschrieben.
103 Da die chronologische Folge der ersten Seitenspanne sich auf der Seite 137 befindet.
104 Es wird aber elliptisch erzählt; so beschleunigt sich die Geschichte. Denn nach Eckermanns Besuch bei Goethe in Weimar am 27. Oktober 1823 vergehen die monatelange Krankheit und die sieben restlichen Jahre vor dem Untergang rasant bzw. sprunghaft und wird selektiv erzählt. Der Erzähler erwähnt nur en passant die Erscheinung von Goethes epochal bedeutendsten Werken, nämlich seinen „Gesammelte[n] Werke[n]“, „Wanderjahre“ (ehe sein 80. Geburtstag) und „Faust“ (1830), und dessen Tod.
105 Und diese scheint für dieses Gedicht eine gültigere Interpretation zu sein, denn da Zeit-Raum-Verweise im Text entfallen, ist sie bemüht den Text gesprächiger zu machen.
106 Hiermit operiert Zweig eine subtile Paraphrase, die sofort an Wilhelm Diltheys Werk „Das Erlebnis und die Dichtung“ denken lässt. Erlebnis in die Dichtung bedeutet, dass die Literatur eine Wiedergabe bzw. eine Widerspiegelung des Lebens des Literaten ist.
107 Die Collage unterscheidet sich von der Montage, insofern als sie bloßes Ankleben eines fremden Mediums im literarischen Text ist, während die Montage den Vorteil der Kohärenz hat.
108 Oratorio oder Oratorium genannt ist ein „Chorwerk mit Solostimmen und Instrumenten über epischdramatische, meist geistliche Texte“ (Textor, 2011, S. 311).
109 Das Wort Mythos ist doppeldeutig. Es bezeichnet einerseits in Bezug auf die Geschichtswissenschaft „Verfälschung“, „Lüge“ und andererseits eine Aneignung der Geschichte „mit den Augen der Identität“ (Vgl. Assmann, 2006, S. 40). Es gibt, so Aleida Assmann weiter, „02 Wege der Nationsbildung“, nämlich den „Weg der Modernisierung“ (der politischen Institutionen oder durch „Buchdruck und Alphabetisierung“) und den „Weg der Mythisierung“ (ebd., S. 40).
110 So wird der Phönix in der Fußnotenangabe definiert. Übersetzt aus dem Russischen ins Deutsche von Julia Alexandrova.
111 Diese Pyramide sieht genauso wie die aus 5 Akten bestehende klassische Tragödie aus. In der Tat fängt die Geschichte manchmal mit der Vorgeschichte und steigt schrittweise zu dem Höhepunkt (also die Sternstunde, nämlich die Entdeckung, die Komposition...). Nach dem kurzen Ruhmaugenblick kommt eine Wende in den Geschichtslauf vor, die langsam (Retardation) zu der Katastrophe hinführt. Daher ist es verständlich, warum Zweigs Miniaturen neben „Essay“ und „Doku-Fiktion“ auch „Prosastücke“ genannt werden.
112 Klaus Zelewitz (1995) hat die Beweggründe zur Auswahl der Figuren bei Zweig in anderen Biographien untersucht und macht davon eine Doppellektüre: Zweig wählt seine Figuren aus, weil sie Vorbilder sind, also „Erklärungen, Lehren [und] Warnungen für die gegenwärtige Situation“ (S.101). Der andere Grund sei, dass ihr Schicksal bzw. ihre Lage Zweigs Leben nah sind. Für Ariane Charton (2012) ist die Auswahl für Besiegte darauf zurückzuführen, dass Stefan Zweig nach seiner Bekehrung zum Pazifismus dank seiner Freundschaft mit Romain Rolland die Niederlage als eine Würde ansieht. Ariane Charton spricht somit von „la noblesse du vaincu“ (S. 49). Die Gründe des Scheiterns sind meines Erachtens ontologisch aber auch gesellschaftsbedingt. Die von Zweig ausgewählten Figuren seien also Archetype des Scheiterns der ganzen Gesellschaft, die sie nicht zur vollen Entfaltung befähigt. Georg Huemer (2010) seinerseits, der Zweigs Miniaturen als „kurze biographische Erzählungen“ bezeichnet, sieht in „Sternstunden der Menschheit“ nicht den heroischen Sieg, sondern den menschlichen Heroismus, wobei die ausgewählten historischen Gestalten gegen ihr Schicksal kämpfen und sich demzufolge in einigen „Schicksalssituationen“ heldenhaft verhalten. (Vgl. Huemer, S. 34).
113 Es muss nicht vor Augen verloren werden, dass die erste Ausgabe der „Sternstunden der Menschheit“ im Jahre 1927 erschienen ist, also 5 Jahre vor Hitlers Machtergreifung.
114 Nach Benjamins Unterscheidung zwischen Historiker und Chronistem (siehe S. 4 in dieser Abschlussarbeit).
115 Die historischen Gestalten der „Sternstunden der Menschheit“ sind nicht alle Vorbilder. Vorbilder sind diejenigen Gestalten, die an der Kunstwelt Anteil haben und die nicht geldgierig bzw. keine Vertreter des aufsteigenden Kapitalismus sind.
116 Neologismus von Goethe, der er gebraucht hat, um die Globalisierung zu bezeichnen. Veloziferisch (entstanden aus der Kombination von „velocitas“ und „luziferisch“) ist etwas, was rasant und mit dramatischen Folgen vorkommt.
117 Hervorhebung im Original.
118 Gemeint sind Martin Sazecek (2010) und Michaela Slana (2014), wobei beide Arbeiten sich nur mit einer thematischen Gruppierung der einzelnen Miniaturen begnügen. Slanas „Stefan Zweig: Sternstunden der Menschheit“ ist aber eine bloße Reprise der gleichnamigen Arbeit Sazeceks.
119 Hervorhebung im Original
120 Ideologiekritisch verfahren, bedeutet, „ideologische Verzerrungen der Wahrnehmung [...] durchschauen“ (Strasen, 2013, S. 326) durch die Hinterfragung der Objektivität der perzipierten Realität.
121 Universalistische Ansprüche, so Antor (2013), sind Merkmale des Eurozentrismus, wobei Eurozentrismus selbst „Prozesse und Verhältnisse politischer wie kultureller Hegemonisierung [bezeichnet], bei denen die Macht- und Wertestrukturen der (ehemaligen) europäischen Kolonialherren gegenüber denjenigen der (post-) kolonialen Staaten und Kulturen im Sinne einer vorausgesetzten Überlegenheit einseitig dominant sind“ (S. 196).
122 Dieser Begriff ist von Georg Huemer (2010).
123 Mit Ideologie gibt es zu verstehen, „(...) dass mit wirkmächtigen Bildern [sowie „Erzählungen, Orte[n], Denkmäler[n] und rituelle[n] Praktiken“] zugleich gefährliche und falsche Denk- und Wertsysteme transportiert werden (.)“ (Assmann, 2006, S. 30).
124 Neger bzw. Afrikaner sind mit „schmutzigbraunen, dickwulstigen, wollhaarigen und im Typhus oft gorillamäßigen Wesen“ gleichgesetzt.
125 Hervorgehoben von mir, T. K. A.
126 Dadurch versteht Aleida Assmann (2006) „eine Form der Verfolgung durch Vernichtung des Namens; hier geht es darum, die Spuren der Existenz eines Menschen zu löschen, ihn aus den Annalen der Geschichtsschreibung [...] zu tilgen“ (S. 105).
127 Marleen Rensen hat 2015 einen interessanten Artikel zum Titel „Writing European Lives: Stefan Zweig as a Biographer of Verhaeren, Rolland and Erasmus“ verfasst, indem sie zu meinem Verständnis bringt, dass der überzeugte Europäer Zweig die Biographien von Europäer wählte und schrieb, die am besten repräsentativ für seine Idee eines transkulturellen und geistigen Europas sind. Emile Verhaeren erscheint somit als „the Poet of Europe“, Romain Rolland als „The Conscience of Europe“ und Erasmus von Rotterdam als „The First Conscious European“.
128 „C‘ Politik“ ist eine dienstags in CRTV (Nationalfernsehen Kameruns) ausgestrahlte Sendung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau mit dem Titel, Inhaltsverzeichnis, Zielen und Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörtern.
Was ist das Inhaltsverzeichnis?
Das Inhaltsverzeichnis listet die verschiedenen Teile und Kapitel der Arbeit auf, einschließlich Widmung, Danksagung, Zusammenfassung, Abstract, Einleitung, theoretische Grundlagen, Textanalyse und Schlussbetrachtung.
Welche theoretischen Grundlagen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt theoretische Grundlagen wie Begriffsbestimmung (Vergangenheitsaufarbeitung, Triade Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft, Literatur, Geschichtsschreibung, Geschichte, Geschichtswissenschaft, Gedächtnis, Erinnerung, Vergessen), Verhältnis unter den Kernkategorien (Literatur-Geschichte-Gedächtnis) und die Triade Literatur-Geschichte und Gedächtnis.
Welche Begriffe werden im ersten Kapitel definiert?
Im ersten Kapitel werden die Begriffe Vergangenheitsaufarbeitung, Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft, Literatur, Geschichtsschreibung, Geschichte, Geschichtswissenschaft, Gedächtnis, Erinnerung und Vergessen definiert.
Was wird im zweiten Teil der Arbeit analysiert?
Der zweite Teil der Arbeit widmet sich der Textanalyse, beginnend mit Stefan Zweigs Biographie und der Bestimmung von Kernbegriffen der Textanalyse, gefolgt von einer detaillierten Analyse des Werkes "Sternstunden der Menschheit".
Welche Erzähltheorien werden in der Analyse verwendet?
In der Analyse werden Erzähltheorien wie Fabelanalyse (Erzählzeit, erzählte Zeit, chronologische Erzählung, Vorausdeutung, Rückwendung) und Erzählsituation (Erzählform, Erzählerstandort, Erzählperspektive, Erzählverhalten, Darstellungsweisen) verwendet.
Welche erzähltechnischen Begriffe werden definiert?
Die erzähltechnischen Begriffe, die definiert werden, sind Intermedialität, Collage und Montage.
Was ist das Ziel der Analyse des Werkes "Sternstunden der Menschheit"?
Das Ziel der Analyse ist es, die Eigenart der Literaturauseinandersetzung mit Geschichtstatsachen am Beispiel Stefan Zweigs Text zu eruieren und zu zeigen, wie der Text an der Konstruktion eines europäischen Gedächtnisses und somit einer europäischen Identität beteiligt ist.
Welche Länder bzw. Regionen werden in der Analyse der "Sternstunden der Menschheit" berücksichtigt?
Die Analyse berücksichtigt Miniaturen, die sich auf Russland, Amerika, England, Frankreich, Deutschland, die Schweiz, Italien und die Türkei beziehen.
Welche Kritik wird an Stefan Zweigs "Sternstunden der Menschheit" geübt?
Kritik wird an Zweigs eurozentrischer Perspektive geübt, da er Afrika und Asien aus seiner Darstellung der "Sternstunden der Menschheit" ausschließt.
Welche Rolle spielt die Erinnerungsliteratur in dieser Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet, wie Schreiben, Bezeugen und Erinnern sich in der Erinnerungsliteratur verbinden und wie diese Gattung zur Aufarbeitung der Vergangenheit beiträgt.
Welche Funktionen werden dem Gedächtnis zugeschrieben?
Dem Gedächtnis werden therapeutische, ethische und identitätsstiftende Funktionen zugeschrieben.
Was ist die Hauptaussage der Schlussbetrachtung?
Die Schlussbetrachtung fasst zusammen, dass Stefan Zweigs Werk, trotz seiner eurozentrischen Verzerrung, einen wichtigen Beitrag zur Konstruktion eines europäischen Gedächtnisses leistet und als Gegengeschichtsschreibung fungiert.
- Quote paper
- Appolinaire Tonye (Author), 2017, Vergangenheitsaufarbeitung in der Literatur am Beispiel von Stefan Zweigs "Sternstunden der Menschheit". Zwischen Geschichtsschreibung und Gedächtnisarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1472008