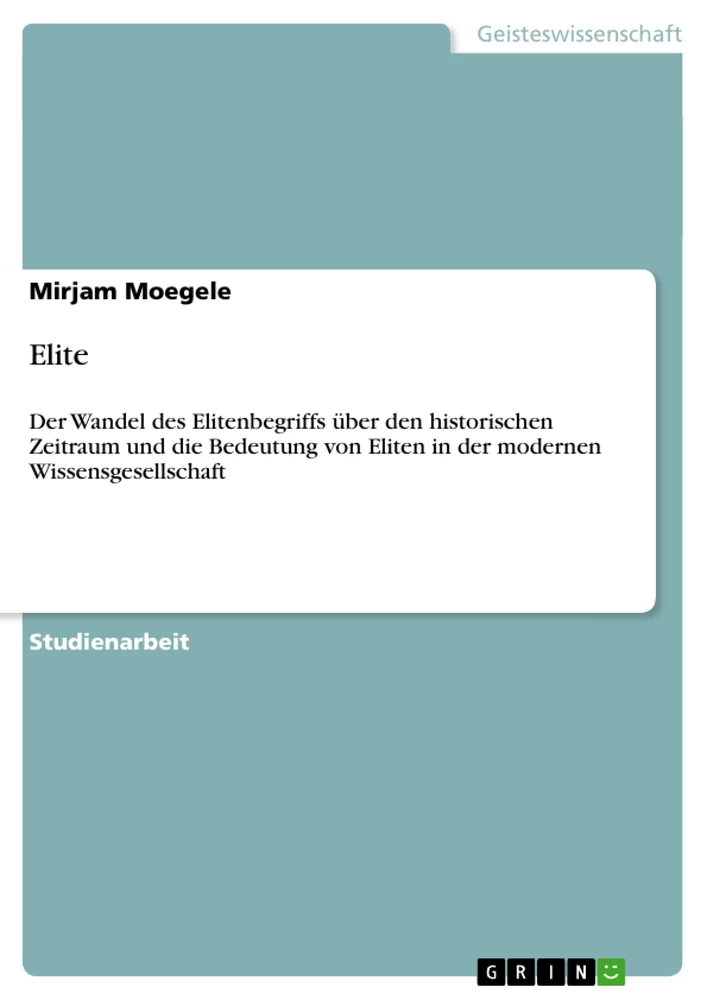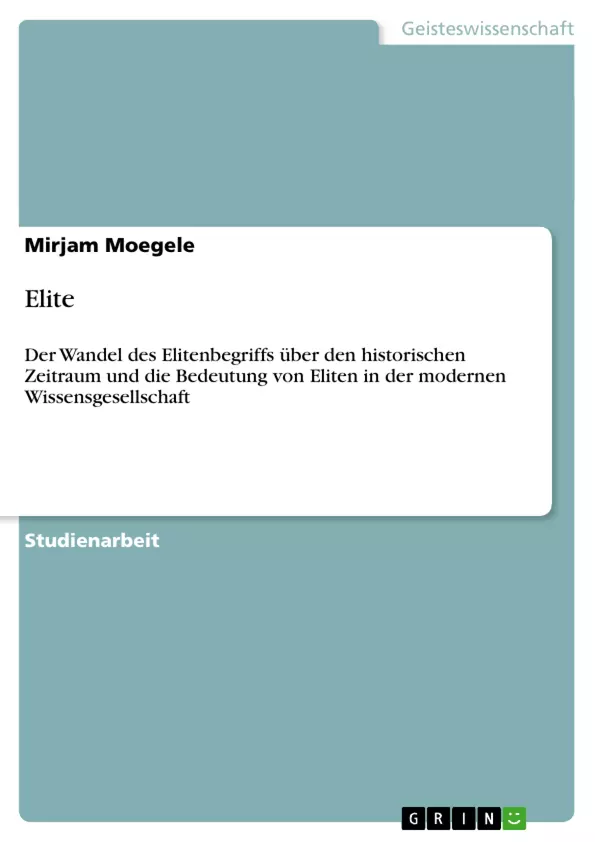Elite – was ist das, wo ist bei der Definition des Begriffs anzusetzen? Wie wandelten sich der Elitenbegriff und seine Definition in den Epochen? Nach welchen Kriterien werden Eliten heute ausgewählt? Wie sieht der Personenkreis der Elite überhaupt aus? Ab wann gehört man zur Elite? Wie wird der Elitenstatus vermittelt – durch Herkunft oder Leistung? Welche Eliten braucht die moderne Wissensgesellschaft in Zukunft?
Ist der Elitenbegriff in der heutigen Zeit ein Tabu-Begriff, der im Gegensatz zum Gleichheitsgrundsatz steht oder ist die „Elite“ etwa aufgrund der Etablierung von Elite-Universitäten und Exzellenzprogramme an Schulen und Hochschulen wieder salonfähig geworden? Der Aufbau sieht folgendermaßen aus:
Die aktuellen Theorien werden knapp beschrieben und sollen nur das Grundgerüst bilden, um Eliten zu verstehen. Die Untersuchung des Elitenbegriffs über den historischen Zeitraum gibt Aufschluss über die gesellschaftliche Akzeptanz eines Begriffes. Die Brisanz der Erforschung der Elitenthematik erstreckte sich in den 60er Jahren, führend hier der Elitenkritiker Dahrendorf.
Aber auch in den 90er Jahren bis Dato sind immer wieder neue Werke herausgekommen, die sich den Eliten widmen. Hervorzuheben sind hierbei die Mannheimer und Potsdamer Elitenstudie der 90er Jahre.
Ich stütze mich bei der Untersuchung der Historie vor allem auf Beate Krais und Rainer Geißler, die aktuellste Befunde der Elitenforschung auf den Punkt bringen.
Zudem wird im Rahmen der Frage heutiger Elitenkriterien der Gleichheitsgrundsatz diskutiert, es geht um Herkunftselite versus Leistungseliten. Wird der Status qua Geburt festgelegt oder hat jeder die Chance „Elite“ zu werden? Dieser Frage stellte sich Soziologe Michael Hartmann, dessen Studie über Topmanager wohl die aufschlussreichste auf dem Markt ist. Daneben steht Pierre Bourdieu, welcher sich mit dem klassenspezifischen Habitus am Beispiel der Gesellschaft in Frankreich beschäftigte. Um anzuführen, wie sich Eliten in Zukunft in einer globalisierten Wissensgesellschaft entwickeln könnten werde ich beispielsweise aus Bittlingmayer zitieren und eigene Anregungen in die Diskussion einbringen. Es ist mir selbstverständlich nicht möglich trotz Betrachtung der Historie des Elitenbegriffs eine weitreichende Prognose zu stellen. Dennoch: Die Elitenthematik hat große Brisanz und es ist wichtig, sich mit ihr auseinander zu setzen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- THEORIEN DES ELITENBEGRIFFS
- DER ELITENBEGRIFF IN SEINER HISTORISCHEN ENTWICKLUNG
- Kräfte ständischer Ordnung und Industrialisierung im 19.Jahrhundert.
- Die Weimarer Republik und der Aufstieg der Nationalsozialisten
- Eliten nach der „Stunde Null“.
- Die Elitendiskussion der 60er Jahre
- KRITERIEN DER ELITENZUGEHÖRIGKEIT UND DIE BEDEU- TUNG VON ELITEN IN EINER WISSENSGESELLSCHAFT
- RESÜMEE
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Wandel des Elitenbegriffs über den historischen Zeitraum und der Bedeutung von Eliten in der modernen Wissensgesellschaft. Sie analysiert die Entwicklung des Elitenbegriffs, untersucht die Kriterien der Elitenzugehörigkeit und diskutiert die Rolle von Eliten in einer Wissensgesellschaft.
- Historische Entwicklung des Elitenbegriffs
- Kriterien der Elitenzugehörigkeit
- Bedeutung von Eliten in der Wissensgesellschaft
- Gleichheitsgrundsatz und Eliten
- Zukunft der Eliten in einer globalisierten Wissensgesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Eliten ein und stellt die zentralen Fragestellungen der Arbeit vor. Sie beleuchtet die Vielschichtigkeit des Elitenbegriffs und die Bedeutung der Elitenthematik in der heutigen Zeit.
Das Kapitel „Theorien des Elitenbegriffs“ analysiert verschiedene soziologische Ansätze zur Definition von Eliten. Es werden verschiedene Elitenformen wie Leistungseliten, Machteliten, Funktionseliten und Werteliten vorgestellt und ihre jeweiligen Merkmale erläutert.
Das Kapitel „Der Elitenbegriff in seiner historischen Entwicklung“ untersucht die Entwicklung des Elitenbegriffs über verschiedene Epochen hinweg. Es beleuchtet die Bedeutung von Eliten in der ständischen Ordnung des 19. Jahrhunderts, die Rolle von Eliten in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus sowie die Elitendiskussion der 60er Jahre.
Das Kapitel „Kriterien der Elitenzugehörigkeit und die Bedeutung von Eliten in einer Wissensgesellschaft“ befasst sich mit den Kriterien der Elitenzugehörigkeit in der heutigen Zeit. Es diskutiert die Bedeutung von Herkunft und Leistung für den Elitenstatus und analysiert die Rolle von Eliten in einer globalisierten Wissensgesellschaft.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Elitenbegriff, die historische Entwicklung des Elitenbegriffs, die Kriterien der Elitenzugehörigkeit, die Bedeutung von Eliten in der Wissensgesellschaft, den Gleichheitsgrundsatz, die Leistungseliten, die Machteliten, die Funktionseliten, die Werteliten, die Elitenkritik, die Elitenforschung, die Wissensgesellschaft, die Globalisierung, die soziale Ungleichheit, die Klassengesellschaft, die Eliteakademie, die Eliteuniversitäten, die Exzellenzprogramme.
- Quote paper
- Mirjam Moegele (Author), 2007, Elite, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147120