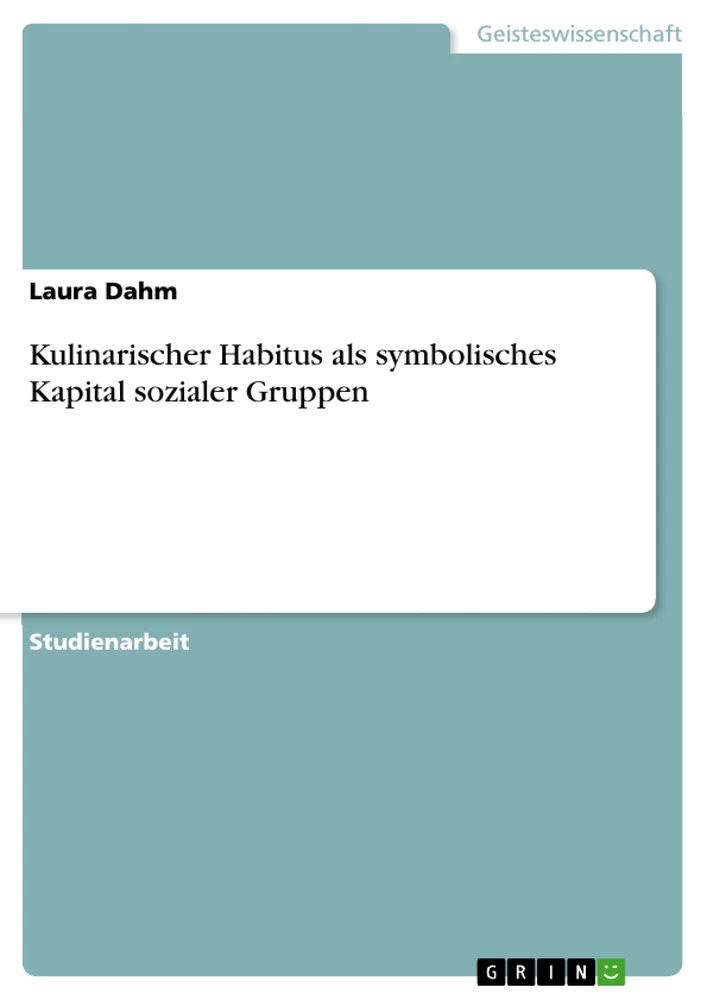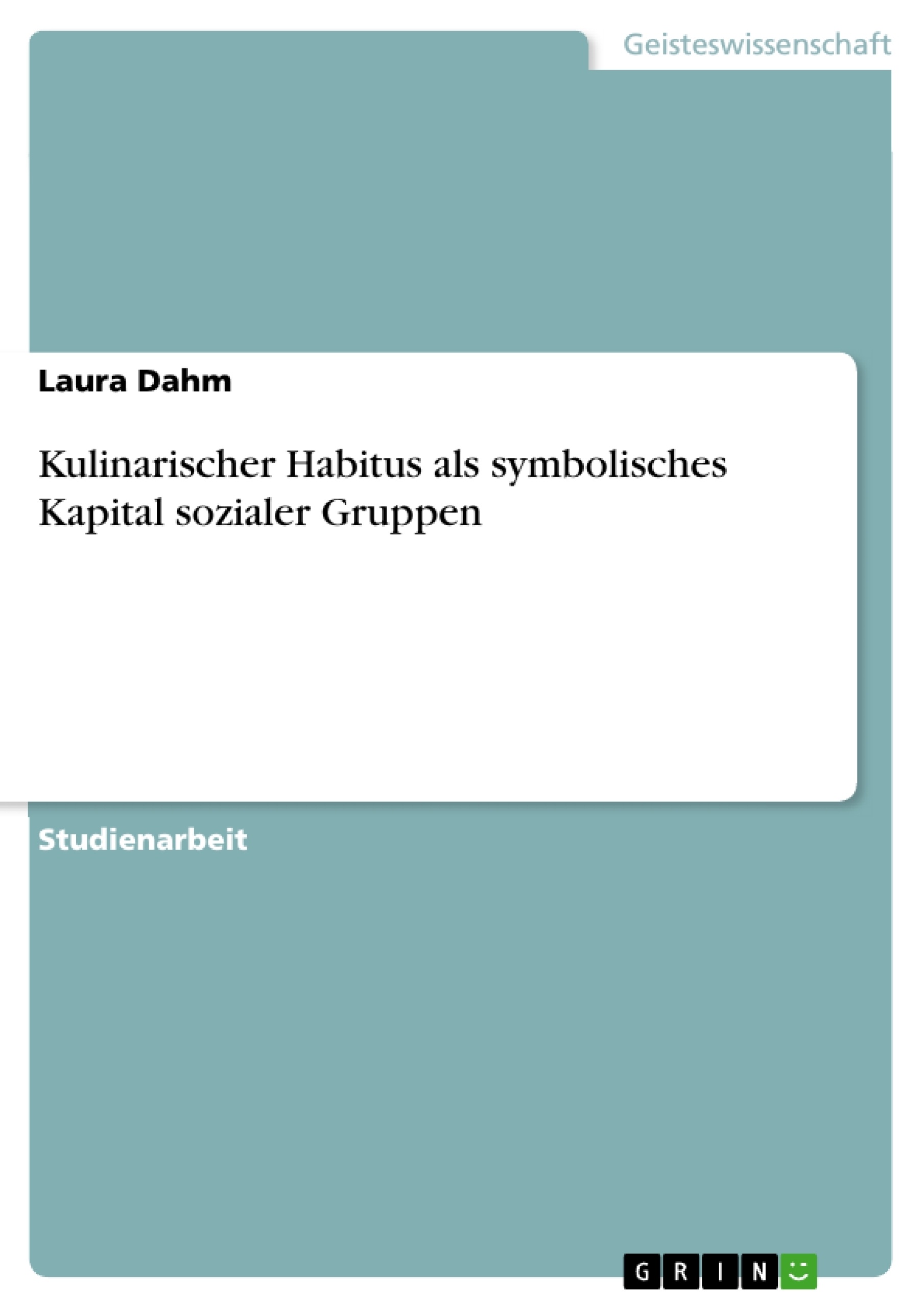Diese Arbeit widmet sich der Frage, ob es ein spezifisches Ernährungsverhalten innerhalb sozialer Gruppen gibt. Existieren also verschiedene Speisevorlieben und Mahlzeitrituale in den verschiedenen sozialen Gruppen? In der Volkskunde wird die Symbolbedeutung von Nahrungsmitteln und Mahlzeiten nur am Rande behandelt, da es sich hierbei eher um ein soziologisches Thema handelt. Trotzdem verkennt man die Problematik nicht. So beschreibt Martin Scharfe den Zweck der Nahrungsforschung folgendermaßen: „Das wissenschaftliche Hauptziel besteht in der Erkenntnis der sozialen Rolle und aller sozialen Vermittlungen der Nahrung (...)“ (Scharfe 1986, S. 16).
Im folgenden will ich versuchen, diese Fragen zu beantworten. Zunächst stelle ich Beiträge und Kommentare verschiedener Volkskundler, Ethnologen und Ethnographen zusammen, die sich auf diese Thematik, den kulinarischen Habitus als symbolisches Kapital sozialer Gruppen, beziehen (Kapitel 1). Das zweite Kapitel sollte dann einen kurzen historischen Überblick über Nahrungsgewohnheiten sozialer Klassen oder Schichten geben. Problematisch war hier allerdings die Einseitigkeit der Schilderungen zugunsten unterer Sozialschichten mit dem zusätzlichen Schwerpunkt auf dem 19. Jahrhundert. Trotzdem lassen sich daran ausreichend Unterschiede und Entwicklungstendenzen festmachen.
Schließlich wird natürlich noch unsere heutige Zeit hinsichtlich dinstinktiver Eßgewohnheiten in Augenschein genommen. Einer der interessantesten Texte hierzu ist „Die feinen Unterschiede: Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft“ von Pierre Bourdieu. Ein Analyseaspekt darin ist eben die Nahrung. Dieses Werk wird allerdings ausführlich von meiner Kommilitonin Julia Kühn bearbeitet. Bei mir werden sich deshalb eher Querverweise auf Bourdieu finden, besonders im dritten Kapitel. Eine Untersuchung von Utz Jeggle in der BRD der 80er Jahre dient hier vorzüglich als Gegenwartsanalyse gruppenspezifischer Ernährungsweisen, und sie läßt auch den Vergleich mit Bourdieus Untersuchung im Frankreich der 60er Jahre zu.
In der Schlußbetrachtung möchte ich noch eine kurze persönliche Einschätzung der Symbolbedeutung von Essen geben, wobei mir auch der Vergleich zweier Volksfeste, das Wilhelmstraßenfest in Wiesbaden und das Johannisfest in Mainz, helfen soll.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Soziale Differenzierung im Ernährungsverhalten
- 2. Historischer Überblick
- 3. Essgewohnheiten in heutiger Zeit
- 3.1. Zur Untersuchung und Methodik
- 3.2. Ergebnisse
- 3.3. Regionale und soziale Grenzlinien
- 4. Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Existenz gruppenspezifischer Ernährungsgewohnheiten und die Rolle von Nahrung als symbolisches Kapital. Sie verbindet volkskundliche Nahrungsforschung mit soziologischen Aspekten der Gruppendifferenzierung.
- Soziale Differenzierung im Ernährungsverhalten
- Historische Entwicklung von Essgewohnheiten sozialer Gruppen
- Gegenwartsanalyse gruppenspezifischer Ernährungsweisen
- Symbolische Bedeutung von Nahrung und Mahlzeiten
- Regionale und soziale Unterschiede im Essverhalten
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der gruppenspezifischen Ernährungsgewohnheiten ein und stellt die Forschungsfrage nach unterschiedlichen Speisevorlieben und Mahlzeitritualen in verschiedenen sozialen Gruppen. Sie begründet die Verbindung von volkskundlicher Nahrungsforschung mit soziologischen Aspekten und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich mit Beiträgen von Volkskundlern, einem historischen Überblick und der Analyse heutiger Essgewohnheiten befasst. Die Arbeit zielt darauf ab, Mechanismen der Nahrungsselektion und gruppenspezifische Merkmale der Nahrungsaufnahme zu untersuchen.
1. Soziale Differenzierung im Ernährungsverhalten: Dieses Kapitel analysiert die Bedeutung von Nahrungsmitteln und Mahlzeiten als Bedeutungsträger und Symbole gesellschaftlicher Differenzierung. Es wird die These vertreten, dass Essen mit einem Symbolbildungsprozess verbunden ist ("Der Mensch ist, was er isst!"). Die Arbeit diskutiert den kulturellen Aspekt der Nahrung, der die Selektion von Nahrungsmitteln durch bestimmte Bevölkerungsgruppen erklärt. Es wird die Korrelation zwischen Ernährungsmerkmalen und Werthaltungen sozialer Gruppen beleuchtet, wobei die Mahlzeit als Grundeinheit betrachtet wird, in der kulturelle Muster vereinnahmt und individuelle Begierden kulturell geformt werden. Die Bedeutung von klassenspezifischen Wohlseins- und Genußmodi und die Rolle von Nahrung bei Segregation und Kommunikation werden erörtert.
2. Historischer Überblick: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über die Ernährungsgewohnheiten verschiedener sozialer Klassen und Schichten, wobei die einseitige Darstellung zugunsten unterer Schichten im 19. Jahrhundert kritisch betrachtet wird. Trotz dieser Einschränkung werden Unterschiede und Entwicklungstendenzen in den Essgewohnheiten aufgezeigt, die für das Verständnis der heutigen Situation relevant sind. Es werden hier vermutlich Entwicklungen und Veränderungen im Essverhalten im Laufe der Zeit, möglicherweise bedingt durch wirtschaftliche und soziale Faktoren, beschrieben und analysiert.
3. Essgewohnheiten in heutiger Zeit: Dieses Kapitel befasst sich mit den distinktiven Essgewohnheiten in der Gegenwart. Es wird auf die Arbeit von Pierre Bourdieu verwiesen und der Fokus liegt auf einer Gegenwartsanalyse gruppenspezifischer Ernährungsweisen, möglicherweise unter Einbezug einer Untersuchung von Utz Jeggle in der BRD der 80er Jahre und eines Vergleichs mit Frankreich der 60er Jahre. Die Analyse umfasst wahrscheinlich regionale und soziale Unterschiede im Essverhalten und die Rolle von Kultur und Tradition in der Gegenwart.
Schlüsselwörter
Ernährungsverhalten, soziale Gruppen, symbolisches Kapital, Nahrungsmittel, Mahlzeiten, soziale Differenzierung, historische Entwicklung, Gegenwartsanalyse, Kultur, Tradition, Segregation, Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Soziale Differenzierung im Ernährungsverhalten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht gruppenspezifische Ernährungsgewohnheiten und die Rolle von Nahrung als symbolisches Kapital. Sie verbindet volkskundliche Nahrungsforschung mit soziologischen Aspekten der Gruppendifferenzierung und analysiert Unterschiede in Speisevorlieben und Mahlzeitritualen verschiedener sozialer Gruppen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die soziale Differenzierung im Ernährungsverhalten, die historische Entwicklung von Essgewohnheiten sozialer Gruppen, eine Gegenwartsanalyse gruppenspezifischer Ernährungsweisen, die symbolische Bedeutung von Nahrung und Mahlzeiten sowie regionale und soziale Unterschiede im Essverhalten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel zur sozialen Differenzierung im Ernährungsverhalten, einem historischen Überblick, einem Kapitel zu den Essgewohnheiten in der heutigen Zeit (inkl. Methodik, Ergebnissen und regionalen/sozialen Grenzlinien) und einer Schlussbetrachtung.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Mechanismen der Nahrungsselektion und gruppenspezifische Merkmale der Nahrungsaufnahme zu untersuchen. Sie beleuchtet die Korrelation zwischen Ernährungsmerkmalen und Werthaltungen sozialer Gruppen und erörtert die Bedeutung von Nahrung bei Segregation und Kommunikation.
Wie wird die historische Entwicklung betrachtet?
Das Kapitel zum historischen Überblick beleuchtet die Ernährungsgewohnheiten verschiedener sozialer Klassen und Schichten im Laufe der Zeit, kritisch hinterfragt die einseitige Darstellung unterer Schichten im 19. Jahrhundert und zeigt Unterschiede und Entwicklungstendenzen auf, die für das Verständnis der heutigen Situation relevant sind.
Wie wird die Gegenwart analysiert?
Die Gegenwartsanalyse konzentriert sich auf distinktive Essgewohnheiten, berücksichtigt möglicherweise die Arbeiten von Pierre Bourdieu, Utz Jeggle (BRD der 80er Jahre) und vergleicht diese gegebenenfalls mit Frankreich der 60er Jahre. Die Analyse umfasst regionale und soziale Unterschiede im Essverhalten und die Rolle von Kultur und Tradition.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ernährungsverhalten, soziale Gruppen, symbolisches Kapital, Nahrungsmittel, Mahlzeiten, soziale Differenzierung, historische Entwicklung, Gegenwartsanalyse, Kultur, Tradition, Segregation, Kommunikation.
Welche Methodik wird angewendet (Kapitel 3.1)?
Die Arbeit beschreibt die Methodik im Kapitel 3.1. Der genaue Inhalt der Methodik wird im vorliegenden Text nicht detailliert dargestellt.
Welche Ergebnisse werden präsentiert (Kapitel 3.2)?
Die Ergebnisse der Untersuchung werden im Kapitel 3.2 präsentiert. Der genaue Inhalt der Ergebnisse wird im vorliegenden Text nicht detailliert dargestellt.
Welche Rolle spielt die symbolische Bedeutung von Nahrung?
Die Arbeit betont die Bedeutung von Nahrungsmitteln und Mahlzeiten als Bedeutungsträger und Symbole gesellschaftlicher Differenzierung. Essen wird als Symbolbildungsprozess verstanden ("Der Mensch ist, was er isst!") und der kulturelle Aspekt der Nahrung, der die Selektion von Nahrungsmitteln erklärt, wird diskutiert.
- Quote paper
- Laura Dahm (Author), 1999, Kulinarischer Habitus als symbolisches Kapital sozialer Gruppen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14710