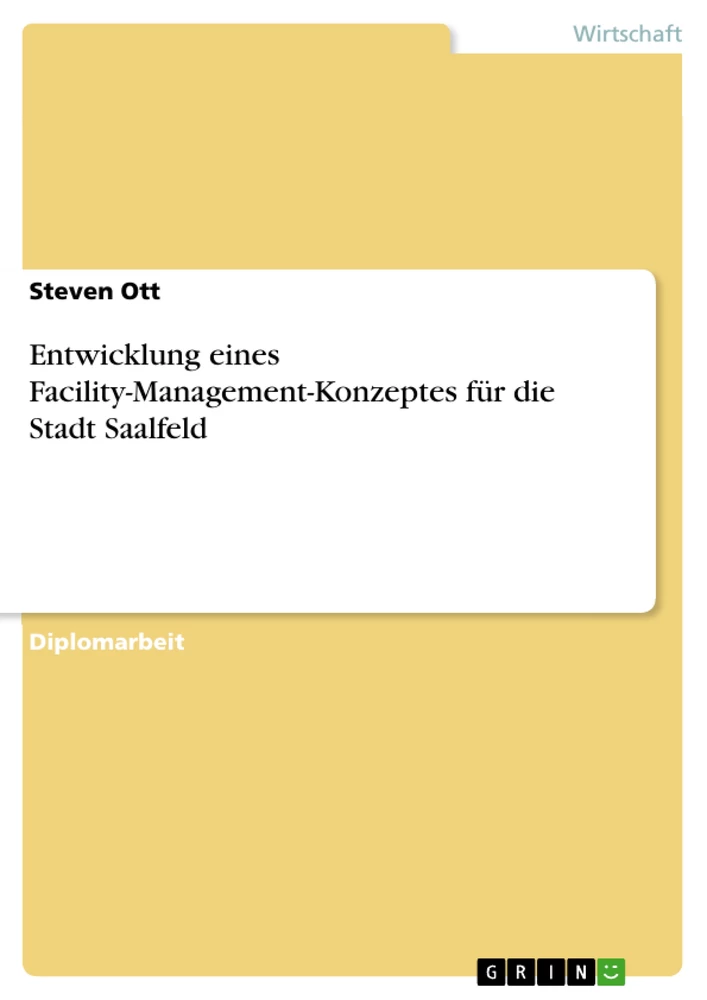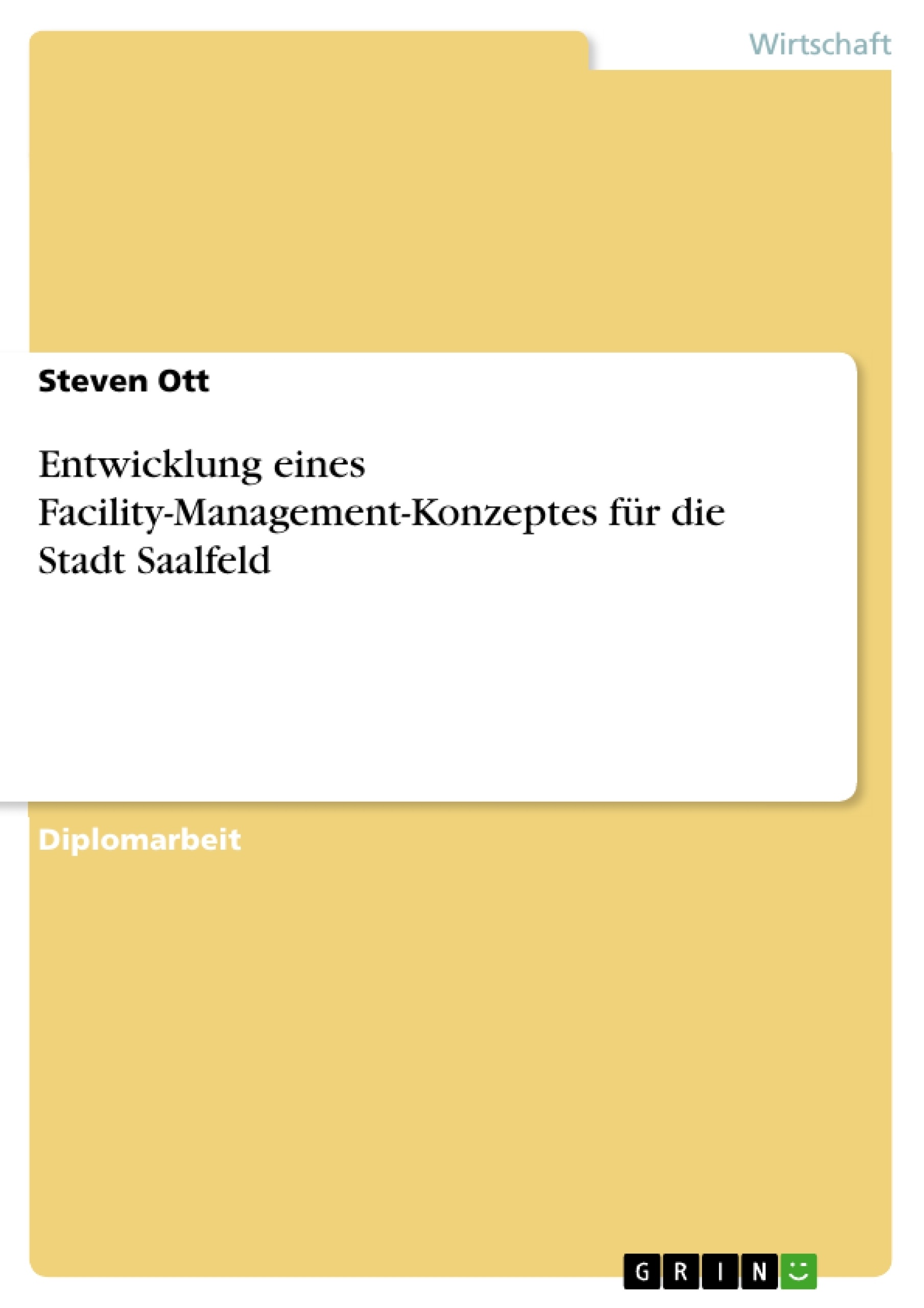Gegenstand dieser Diplomarbeit ist die Entwicklung eines Facility-Management-Konzeptes für die Stadt Saalfeld. Diese Untersuchung ist nicht zuletzt dem unbestritten großem Wertvolumen kommunaler Immobilien und ihres wesentlichen Einflusses auf die Finanzlage geschuldet. Ein weiteres Kernproblem besteht darin, dass bisher keine einheitlichen und adäquaten Instrumente und Strukturen geschaffen wurden. Die Verantwortung für die kommunalen Immobilien wird nicht ganzheitlich, sondern zumeist aus spezifischer Sicht wahrgenommen und führt so zu einer Zersplitterung der Aufgabenwahrnehmung. So liegt es auf der Hand, dass die Stadt Saalfeld versucht im Wege eines effizienten Verwaltungsmanagements Einsparpotenziale zu erzielen.
Die Diplomarbeit bedient sich zweier Methoden. Mit Hilfe der aktuellen Fachliteratur, speziell auch für den kommunalen Bereich, werden die Grundlagen und Bestandteile des Facility Managements sowie die organisatorischen Gestaltungsmöglichkeiten vorgestellt. Aufbauend erfolgt eine Ist-Analyse der bebauten Grundstücke der Stadt Saalfeld. Für die weiteren Überlegungen ist es notwendig, aus der Vielzahl von bebauten Grundstücken die herauszufiltern, die als Basis für die organisatorische Untersuchung dienen sollen. Ausgehend von einer Aufgabenanalyse erfolgt dann die Zuordnung gebäudespezifischer Leistungen zu den einzelnen Ämtern und Abteilungen. Die Aufgabenanalyse bildet so den Ausgangspunkt für die Definition von einheitlichen Standards bei der Bewirtschaftung und die Erarbeitung eines Facility-Management-Konzeptes für die Stadt Saalfeld. Die Schwerpunkte liegen dabei auf der Auswahl einer geeigneten Rechts- bzw. Organisationsform, die Regelung interner Leistungsbeziehungen sowie der Aufgabensynthese, d. h. der zukünftigen Strukturierung eines zentralen Liegenschaftsmanagements.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Relevanz der Problemstellung
- 1.2 Methodik und Ziele der Untersuchung
- 2 Einführung und Grundlagen des Facility Managements
- 2.1 Historische Entwicklung des Facility Managements
- 2.2 Grundlagen und Begriffsdefinitionen
- 2.2.1 Immobilien
- 2.2.2 Ansätze des betrieblichen Immobilienmanagements
- 2.2.2.1 Corporate Real Estate Management
- 2.2.2.2 Facility Management
- 2.2.2.3 Begriffsabgrenzung Corporate Real Estate Management und Facility Management
- 2.3 Bedeutung und Ziele des Facility Management
- 2.4 Der Immobilienlebenszyklus als Grundgedanke des Facility Managements
- 2.5 Facility Management im 3-Phasenmodell des Immobilienlebenszyklus
- 2.5.1 Entstehungsphase
- 2.5.2 Nutzungsphase
- 2.5.2.1 Flächenmanagement
- 2.5.2.2 Technisches Gebäudemanagement
- 2.5.2.3 Infrastrukturelles Gebäudemanagement
- 2.5.2.4 Kaufmännisches Gebäudemanagement
- 2.5.2.5 Umnutzung / Umbau / Erneuerung
- 2.5.3 Verwertungsphase
- 3 Theoretische Grundlagen einer Neuorganisation
- 3.1 Grundbegriffe der Organisation
- 3.2 Aufbauorganisation
- 3.2.1 Aufgabenanalyse
- 3.2.2 Aufgabensynthese
- 3.2.2.1 Stellenbildung
- 3.2.2.2 Kompetenzen und Verantwortlichkeiten
- 3.2.2.3 Information und Kommunikation
- 3.2.3 Organisationsmodelle
- 3.2.3.1 Einliniensystem
- 3.2.3.2 Mehrliniensystem (oder Funktionssystem)
- 3.2.3.3 Stab-Liniensystem
- 3.2.3.4 Spartensystem
- 3.2.3.5 Matrixsystem
- 3.3 Ablauforganisation
- 4 Die Liegenschaftsverwaltung in der Stadt Saalfeld – Eine Ist-Analyse
- 4.1 Zahlen und Daten
- 4.2 Die Liegenschaftsabteilung
- 4.2.1 Organisatorischer Aufbau
- 4.2.2 Mitarbeiter und Aufgabenschwerpunkte
- 4.2.3 Vergleichsring
- 4.3 Zusammenstellung der relevanten bebauten Grundstücke
- 4.3.1 Schulgebäude und Grundstücke
- 4.3.1.1 Überblick
- 4.3.1.2 Hausmeisterdienste
- 4.3.1.3 Aufgabenanalyse
- 4.3.2 Verwaltungsgebäude
- 4.3.2.1 Überblick
- 4.3.2.2 Hausmeister- und Reinigungsdienste
- 4.3.2.3 Aufgabenanalyse
- 4.3.3 Villa Bergfried
- 4.3.3.1 Überblick
- 4.3.3.2 Hausmeisterdienste
- 4.3.3.3 Aufgabenanalyse
- 4.3.4 Obdachlosenwohnheime und Übergangswohnheim
- 4.3.4.1 Überblick
- 4.3.4.2 Hausmeisterdienste
- 4.3.4.3 Aufgabenanalyse
- 4.3.5 Zusammenfassung
- 5 Facility-Management-Konzept – Eine organisatorische Neuausrichtung
- 5.1 Untersuchung von Rechts- bzw. Organisationsformalternativen
- 5.1.1 Überblick und Nutzwertanalyse
- 5.1.2 Zusammenfassung und Beurteilung
- 5.2 Organisationsmodelle
- 5.2.1 Eigentümer-Modell
- 5.2.2 Mieter-/Vermieter-Modell
- 5.2.3 Management-Modell
- 5.2.4 Zusammenfassender Überblick und Beurteilung
- 5.3 Aufgabensynthese im Sinne des Facility-Managements
- 5.3.1 Interne und externe Leistungserstellung – die Make-or-Buy-Entscheidung
- 5.3.1.1 Reinigungsleistungen
- 5.3.1.2 Hausmeisterleistungen an Schulen
- 5.3.1.3 Hausmeisterleistungen an Verwaltungsgebäuden
- 5.3.2 Strukturierung des zentralen Liegenschaftsmanagements
- 5.3.3 Zusammenfassung
- 5.4 Projektorganisation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit zielt auf die Entwicklung eines Facility-Management-Konzeptes für die Stadt Saalfeld ab. Der Fokus liegt auf der Optimierung der Liegenschaftsverwaltung durch eine organisatorische Neuausrichtung, um die Wirtschaftlichkeit zu steigern und die Effizienz zu erhöhen.
- Analyse der Ist-Situation der Liegenschaftsverwaltung in Saalfeld
- Untersuchung verschiedener Rechts- und Organisationsformen für ein zentrales Liegenschaftsmanagement
- Entwicklung eines Facility-Management-Konzeptes, inklusive Make-or-Buy-Entscheidungen
- Erarbeitung eines Organisationsmodells für die Zusammenarbeit zwischen dem zentralen Liegenschaftsmanagement und den Nutzern
- Planung der Implementierung des neuen Konzeptes mittels einer Projektorganisation
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung präsentiert die Relevanz eines Facility-Management-Konzeptes für die Stadt Saalfeld aufgrund des hohen Immobilienwertes und des Kostendrucks im kommunalen Bereich. Es werden zentrale Fragen zur Immobilienverwaltung aufgeworfen, die die Notwendigkeit einer umfassenden Optimierung verdeutlichen. Die Methodik und Ziele der Arbeit werden ebenfalls vorgestellt, mit Fokus auf die Analyse der aktuellen Bewirtschaftung und die Entwicklung eines ganzheitlichen Konzeptes.
2 Einführung und Grundlagen des Facility Managements: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Facility Managements, definiert zentrale Begriffe wie Immobilien und Facility Management, und grenzt Facility Management von Corporate Real Estate Management ab. Die Bedeutung und Ziele des Facility Managements werden diskutiert, mit besonderem Augenmerk auf die Wirtschaftlichkeit und die Werterhaltung kommunaler Immobilien. Das 3-Phasenmodell des Immobilienlebenszyklus wird detailliert erklärt, inklusive der einzelnen Phasen: Entstehung, Nutzung und Verwertung. Die Nutzungsphase wird weiter untergliedert in Flächenmanagement, technisches, infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement.
3 Theoretische Grundlagen einer Neuorganisation: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die organisatorische Neuausrichtung der Liegenschaftsverwaltung. Es werden grundlegende Begriffe der Organisation und der organisatorischen Gestaltung erläutert und verschiedene Organisationsmodelle (Einlinien-, Mehrlinien-, Stab-Linien-, Sparte- und Matrixsystem) vorgestellt und verglichen. Der Fokus liegt auf der Aufbau- und Ablauforganisation und deren Relevanz für die Entwicklung eines effektiven Liegenschaftsmanagements.
4 Die Liegenschaftsverwaltung in der Stadt Saalfeld – Eine Ist-Analyse: Dieses Kapitel liefert eine detaillierte Ist-Analyse der Liegenschaftsverwaltung in Saalfeld. Es präsentiert Zahlen und Daten zu den kommunalen Immobilien, beschreibt den Aufbau und die Aufgaben der Liegenschaftsabteilung und analysiert die aktuelle Bewirtschaftung eines ausgewählten Gebäudepools (Schulen, Verwaltungsgebäude, Villa Bergfried, Obdachlosenheime). Die Aufgabenanalyse zeigt die Zersplitterung der Verantwortlichkeiten und die daraus resultierenden Ineffizienzen auf.
5 Facility-Management-Konzept – Eine organisatorische Neuausrichtung: Dieses Kapitel entwickelt ein umfassendes Facility-Management-Konzept für die Stadt Saalfeld. Es untersucht verschiedene Rechts- und Organisationsformalternativen für ein zentrales Liegenschaftsmanagement und führt eine Nutzwertanalyse durch. Es werden verschiedene Organisationsmodelle (Eigentümer-, Mieter-/Vermieter- und Management-Modell) vorgestellt und das Mieter-/Vermieter-Modell als optimalste Lösung empfohlen. Die Aufgabensynthese im Sinne des Facility Managements wird detailliert beschrieben, einschließlich Make-or-Buy-Entscheidungen für Reinigungs- und Hausmeisterleistungen. Schließlich wird eine Projektorganisation für die Implementierung des neuen Konzeptes skizziert, mit Fokus auf CAFM, Portfolio-Management und Benchmarking.
Schlüsselwörter
Facility Management, Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung, kommunale Immobilien, Organisationsgestaltung, Kostenoptimierung, Reorganisation, Aufgabenanalyse, Aufgabensynthese, Mieter-/Vermieter-Modell, Outsourcing, Projektorganisation, Kosten- und Leistungsrechnung, Benchmarking, CAFM.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Facility Management Konzept für die Stadt Saalfeld
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit entwickelt ein Facility-Management-Konzept für die Stadt Saalfeld. Der Schwerpunkt liegt auf der Optimierung der Liegenschaftsverwaltung durch eine organisatorische Neuordnung, um Wirtschaftlichkeit und Effizienz zu steigern.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst eine Ist-Analyse der bestehenden Liegenschaftsverwaltung in Saalfeld, die Untersuchung verschiedener Rechts- und Organisationsformen für ein zentrales Liegenschaftsmanagement, die Entwicklung eines umfassenden Facility-Management-Konzeptes (inkl. Make-or-Buy-Entscheidungen), die Erarbeitung eines Organisationsmodells für die Zusammenarbeit zwischen dem zentralen Liegenschaftsmanagement und den Nutzern, und die Planung der Implementierung des neuen Konzeptes mittels einer Projektorganisation.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine Kombination aus deskriptiver Analyse der Ist-Situation, der Untersuchung verschiedener theoretischer Organisationsmodelle und einer Nutzwertanalyse zur Bewertung verschiedener Rechts- und Organisationsformen. Die Entwicklung des Facility-Management-Konzeptes basiert auf den Ergebnissen der Ist-Analyse und den theoretischen Grundlagen.
Welche Organisationsmodelle werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Organisationsmodelle für das zentrale Liegenschaftsmanagement, darunter das Eigentümer-Modell, das Mieter-/Vermieter-Modell und das Management-Modell. Diese Modelle werden hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile verglichen und bewertet.
Welche Entscheidungen zur Leistungserstellung werden getroffen (Make-or-Buy)?
Im Rahmen der Aufgabensynthese werden Make-or-Buy-Entscheidungen für verschiedene Leistungen getroffen, insbesondere für Reinigungs- und Hausmeisterleistungen an Schulen und Verwaltungsgebäuden. Diese Entscheidungen basieren auf einer Kosten-Nutzen-Analyse.
Welches Organisationsmodell wird empfohlen?
Die Arbeit empfiehlt das Mieter-/Vermieter-Modell als optimale Lösung für das zentrale Liegenschaftsmanagement der Stadt Saalfeld.
Wie wird die Implementierung des neuen Konzeptes geplant?
Die Implementierung des neuen Facility-Management-Konzeptes wird über eine Projektorganisation geplant. Die Arbeit skizziert die notwendigen Schritte und berücksichtigt Aspekte wie CAFM, Portfolio-Management und Benchmarking.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Einführung und Grundlagen des Facility Managements, Theoretische Grundlagen einer Neuorganisation, Die Liegenschaftsverwaltung in der Stadt Saalfeld – Eine Ist-Analyse, und Facility-Management-Konzept – Eine organisatorische Neuausrichtung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Facility Management, Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung, kommunale Immobilien, Organisationsgestaltung, Kostenoptimierung, Reorganisation, Aufgabenanalyse, Aufgabensynthese, Mieter-/Vermieter-Modell, Outsourcing, Projektorganisation, Kosten- und Leistungsrechnung, Benchmarking, CAFM.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt auf die Entwicklung eines ganzheitlichen Facility-Management-Konzeptes für die Stadt Saalfeld ab, welches die Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Liegenschaftsverwaltung verbessert. Dabei steht die Optimierung der Prozesse und die effiziente Nutzung der kommunalen Immobilien im Mittelpunkt.
- Quote paper
- Steven Ott (Author), 2006, Entwicklung eines Facility-Management-Konzeptes für die Stadt Saalfeld, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147079