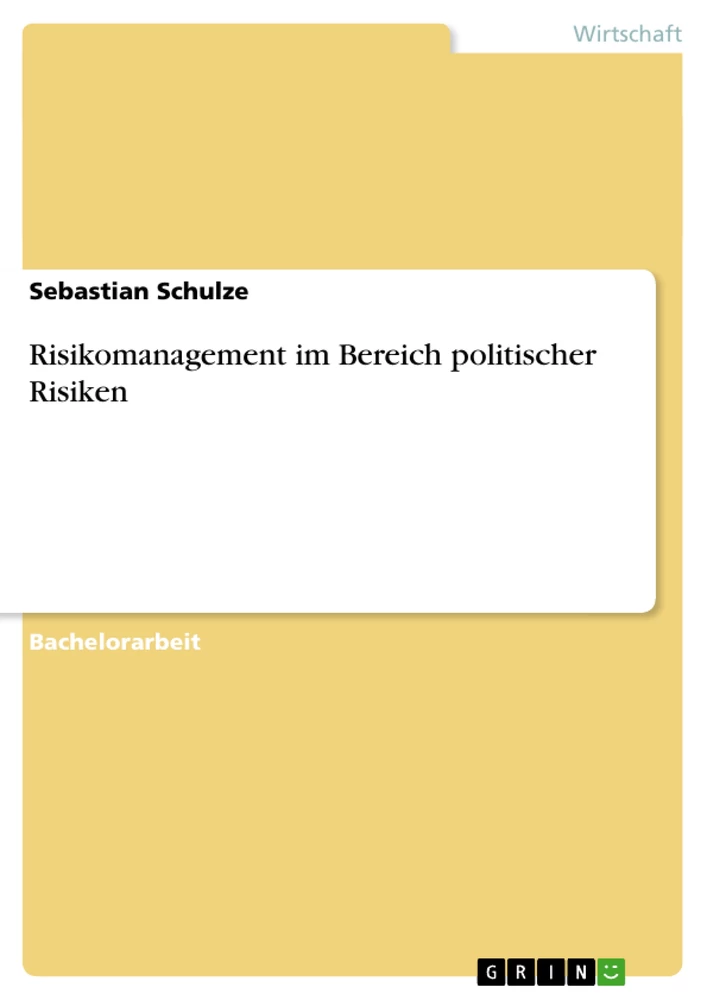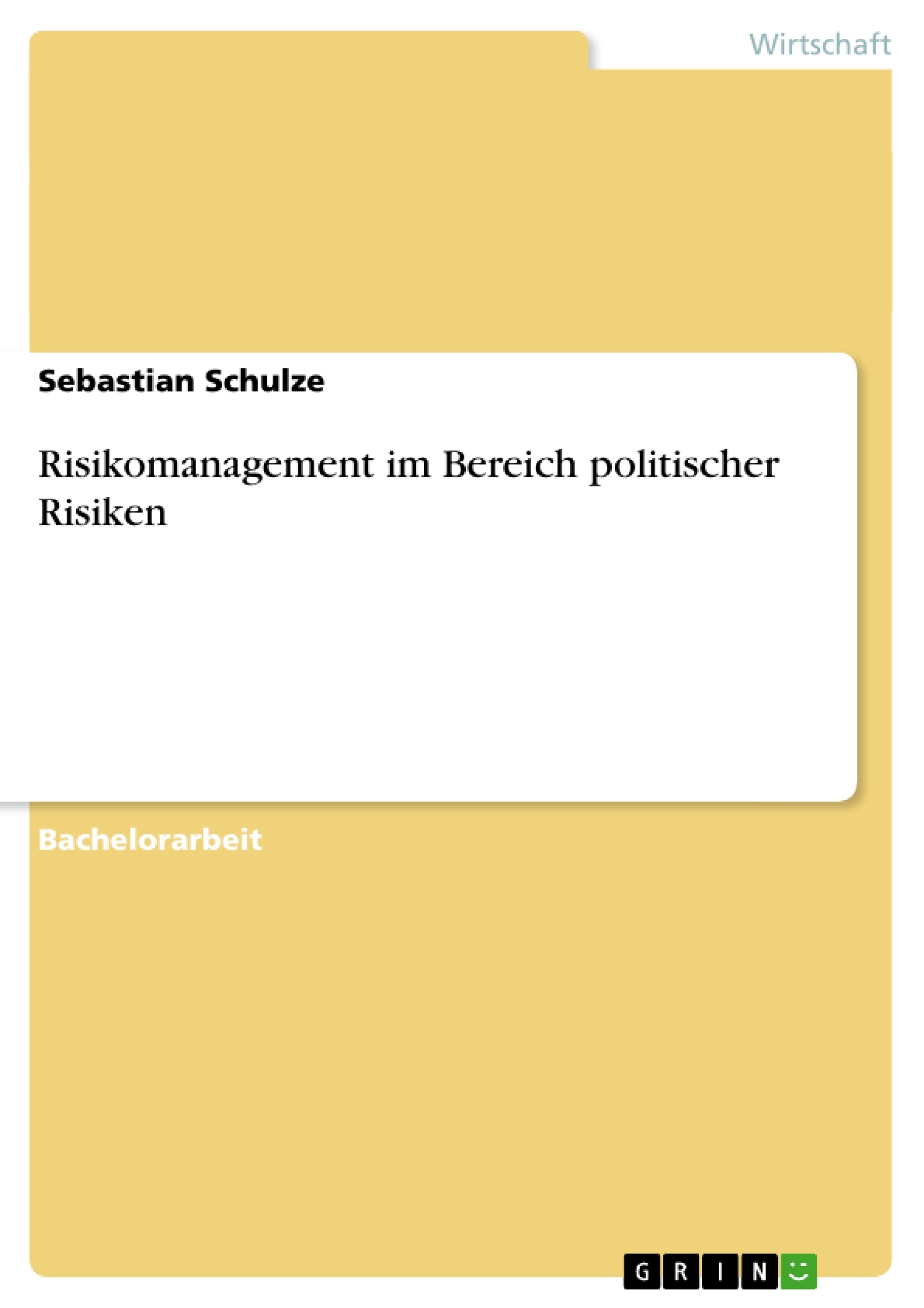Die Arbeit bewegt sich in vielfältiger Form entlang der Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft und diskutiert die Ausgestaltung sowie das Management politischer Risiken. Sie orientiert sich in ihrer Struktur am Risikomanagementprozess. Im ersten Kapitel wird der Begriff des politischen Risikos erörtert und der Fokus auf die Begriffsbestimmung und Identifizierung politischer Risiken gelegt. Demnach wird der Leser in den Abschnitten 1.1. bis 1.3. in das Thema der Arbeit eingeführt, indem politische Risiken definiert, abgegrenzt und klassifiziert werden. Die Diskussion einer empirischen Analyse der Ökonomen Busse und Hefeker (2007) setzt den Akzent im vierten Abschnitt des ersten Kapitels. Dabei werden die Methodik und die Ergebnisse der Studie, die den Zusammenhang zwischen politischen Risiken und ausländischen Direktinvestitionen in Entwicklungsländern untersucht, vorgestellt und kritisch betrachtet. Die Risikobewertung und die Erörterung diverser Managementmethoden stehen im Mittelpunkt des zweiten Kapitels. Der Abschnitt 2.1. befasst sich mit verschiedenen Ansätzen zur Evaluation politischer und länderspezifischer Risiken und zementiert die Bedeutung der Risikobewertung innerhalb des Risikomanagementprozesses. Der zweite Teil des zweiten Kapitels erstellt ein Panorama unterschiedlicher Methoden und Maßnahmen, die in Theorie und Praxis für das Risikomanagement politischer Risiken eine Rolle spielen. Am Anfang jedes Kapitels wird eine kurze Einführung gegeben, um einen Überblick über die Inhalte der einzelnen Kapitel zu vermitteln und den roten Faden zu ebnen. Eine zusammenfassende Darstellung wird die Arbeit abschließen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Terminologie und empirische Evidenz
- 1.1. Definition und Begriffseinordnung in der Literatur
- 1.2. Politisches Risiko vs. Länderrisiko
- 1.3. Klassifizierung politischer Risiken
- 1.4. Empirische Analyse
- 1.4.1. Einführung und Vorbetrachtung
- 1.4.2. Datensatz und Variablendefinition
- 1.4.3. Methodik und Ergebnisse der empirischen Analyse
- 1.4.4. Kritische Würdigung der Ergebnisse
- 2. Management politischer Risiken
- 2.1. Risikomessung und Bewertungsmethoden
- 2.1.1. Politischer Index nach der ICRG-Methodik
- 2.1.2. Länderrisikoanalyse nach der ICRG-Methodik
- 2.1.3. Weitere Ansätze im Überblick und Fazit
- 2.2. Risikomanagementmethoden in Theorie und Praxis
- 2.2.1. Vorbetrachtung
- 2.2.2. Integrative Managementmethoden
- 2.2.3. Risikovermeidung und Diversifikation
- 2.2.4. Schützende Managementmethoden und Finanzinstrumente
- 2.2.5. Politische Risikoversicherung
- 2.1. Risikomessung und Bewertungsmethoden
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht das Risikomanagement im Bereich politischer Risiken. Ziel ist es, den Begriff des politischen Risikos zu definieren, abzugrenzen und verschiedene Ansätze zur Bewertung und zum Management dieser Risiken zu analysieren. Die Arbeit stützt sich dabei auf bestehende Literatur und eine empirische Studie.
- Definition und Abgrenzung von politischem Risiko
- Klassifizierung und Bewertung politischer Risiken
- Empirische Analyse des Zusammenhangs zwischen politischen Risiken und ausländischen Direktinvestitionen
- Vorstellung verschiedener Risikomanagementmethoden
- Analyse von Methoden zur Risikomessung und -bewertung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Risikomanagements im Kontext politischer Risiken ein und beschreibt die Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft. Sie erläutert die verwendeten Definitionen von "Politik" und "Risiko" und gibt einen Überblick über die Struktur der Arbeit, die sich am Risikomanagementprozess orientiert.
1. Terminologie und empirische Evidenz: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und Einordnung des Begriffs "politisches Risiko" in der wissenschaftlichen Literatur. Es werden verschiedene Definitionen von Autoren wie Kennedy, Lessard, Kobrin und Howell vorgestellt und verglichen. Der Unterschied zwischen politischem und Marktrisiko wird diskutiert. Ein wichtiger Teil dieses Kapitels ist die Darstellung und kritische Betrachtung einer empirischen Analyse von Busse und Hefeker (2007), die den Zusammenhang zwischen politischen Risiken und ausländischen Direktinvestitionen in Entwicklungsländern untersucht. Die Iranische Revolution von 1979 dient als Beispiel für die massiven Auswirkungen politischer Risiken.
2. Management politischer Risiken: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Bewertung und das Management politischer Risiken. Zuerst werden verschiedene Methoden zur Evaluation politischer und länderspezifischer Risiken vorgestellt, unter anderem der politische Index nach der ICRG-Methodik. Im zweiten Teil werden verschiedene Risikomanagementmethoden in Theorie und Praxis diskutiert, einschließlich Risikovermeidung, Diversifikation, schützender Maßnahmen und Finanzinstrumente sowie politischer Risikoversicherungen. Der Fokus liegt auf der Integration dieser Methoden in einen umfassenden Risikomanagementprozess.
Schlüsselwörter
Politisches Risiko, Länderrisiko, Risikomanagement, Risikomessung, Risikobewertung, ICRG-Methodik, Ausländische Direktinvestitionen, Entwicklungsländer, Risikovermeidung, Diversifikation, Risikoversicherung, Empirische Analyse.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Risikomanagement Politischer Risiken
Was ist der Gegenstand der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit befasst sich mit dem Risikomanagement im Bereich politischer Risiken. Sie untersucht die Definition, Abgrenzung und verschiedene Ansätze zur Bewertung und zum Management dieser Risiken. Die Arbeit kombiniert Literaturrecherche mit einer empirischen Studie.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und Abgrenzung von politischem Risiko, Klassifizierung und Bewertung politischer Risiken, empirische Analyse des Zusammenhangs zwischen politischen Risiken und ausländischen Direktinvestitionen, Vorstellung verschiedener Risikomanagementmethoden und Analyse von Methoden zur Risikomessung und -bewertung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, zwei Hauptkapitel und eine Schlussbetrachtung. Kapitel 1 befasst sich mit der Terminologie und empirischen Evidenz, inklusive einer Definition von politischem Risiko, einem Vergleich mit Länderrisiko, einer Klassifizierung politischer Risiken und einer empirischen Analyse (u.a. Datensatz, Methodik, Ergebnisse und deren kritische Würdigung). Kapitel 2 konzentriert sich auf das Management politischer Risiken, indem es Risikomessungs- und Bewertungsmethoden (wie die ICRG-Methodik) und verschiedene Risikomanagementmethoden (Risikovermeidung, Diversifikation, schützende Maßnahmen, Finanzinstrumente und politische Risikoversicherungen) darstellt.
Welche Methoden zur Risikomessung und -bewertung werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt verschiedene Methoden zur Evaluation politischer und länderspezifischer Risiken vor, wobei der politische Index nach der ICRG-Methodik im Detail erläutert wird. Weitere Ansätze werden im Überblick präsentiert.
Welche Risikomanagementmethoden werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert Risikomanagementmethoden in Theorie und Praxis, inklusive Risikovermeidung, Diversifikation, schützenden Maßnahmen, Finanzinstrumenten und politischer Risikoversicherung. Der Fokus liegt auf der Integration dieser Methoden in einen umfassenden Risikomanagementprozess.
Welche empirische Studie wird durchgeführt?
Die Arbeit beinhaltet eine empirische Analyse, die den Zusammenhang zwischen politischen Risiken und ausländischen Direktinvestitionen untersucht. Der Datensatz, die Variablendefinition und die Methodik werden detailliert beschrieben. Die Ergebnisse werden kritisch gewürdigt.
Welche Autoren werden zitiert?
Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene Autoren, unter anderem Kennedy, Lessard, Kobrin und Howell, sowie Busse und Hefeker (2007).
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit verwendet?
Schlüsselbegriffe sind: Politisches Risiko, Länderrisiko, Risikomanagement, Risikomessung, Risikobewertung, ICRG-Methodik, Ausländische Direktinvestitionen, Entwicklungsländer, Risikovermeidung, Diversifikation, Risikoversicherung, Empirische Analyse.
Welche Beispiele werden genannt?
Die Iranische Revolution von 1979 dient als Beispiel für die massiven Auswirkungen politischer Risiken.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, den Begriff des politischen Risikos zu definieren und abzugrenzen und verschiedene Ansätze zur Bewertung und zum Management dieser Risiken zu analysieren.
- Quote paper
- Sebastian Schulze (Author), 2009, Risikomanagement im Bereich politischer Risiken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147068