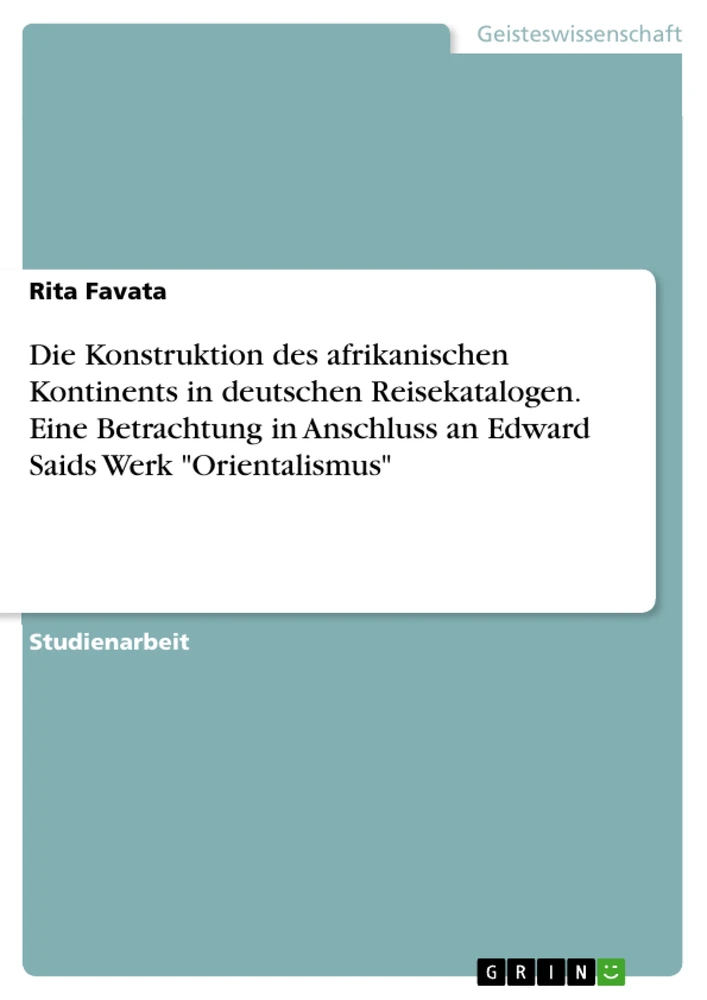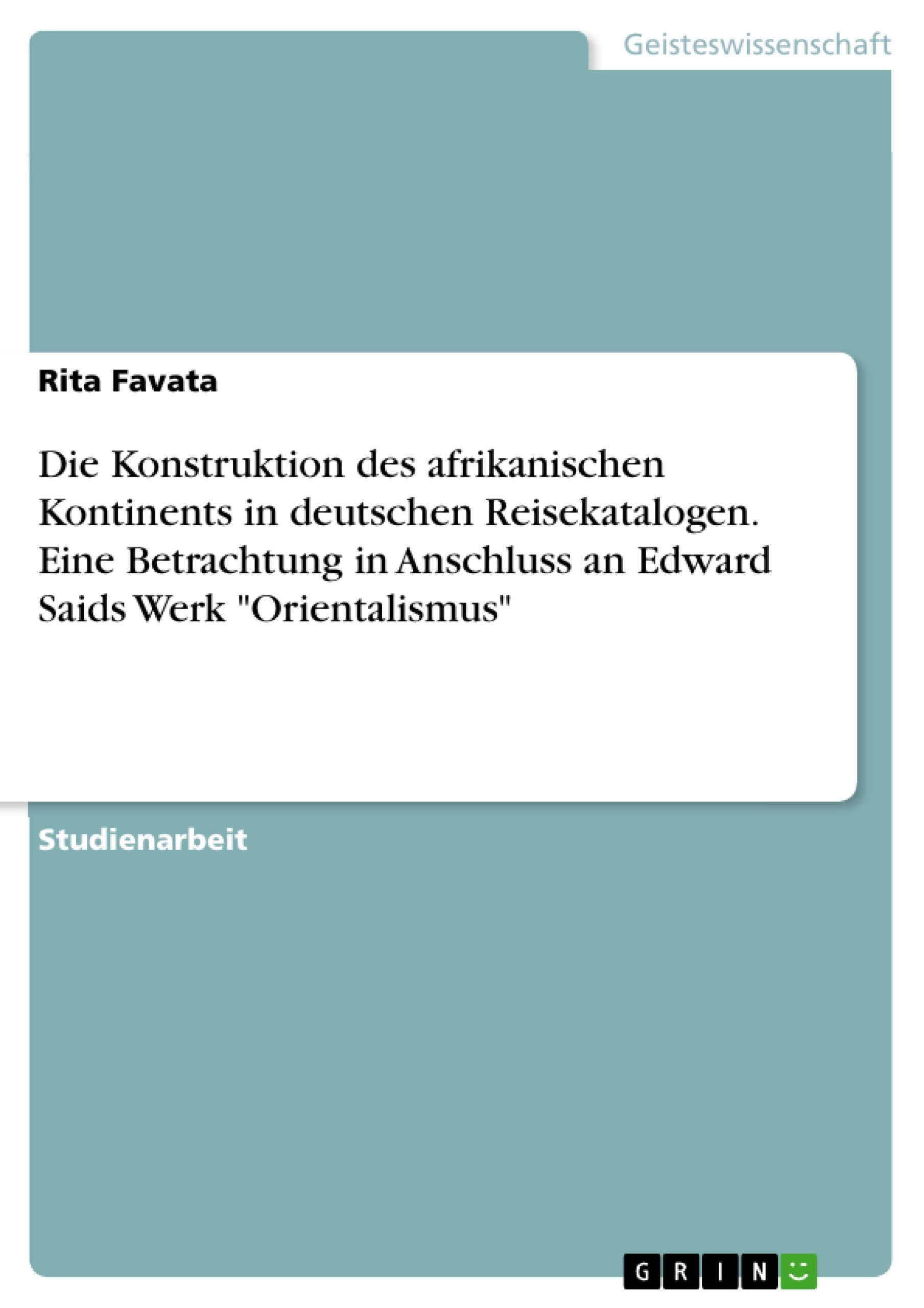Inwiefern werden die Bewohner Afrikas in deutschen Reisebroschüren als „die Anderen“ verkörpert und einem „Wir“, welches als westlich geprägte homogene Gesellschaft bezeichnet wird, entgegengesetzt?
Zunächst werden im theoretischen Zusammenhang Michel Foucaults Diskurs-Theorie und Edward Saids Orientalismus - Theorie skizziert, der Grund hierfür ist, dass Said sich in seinem Werk darauf beruft, mit Foucaults Methoden gearbeitet zu haben, „dessen Werk ich sehr viel verdanke“ (Said 2009).
Im dritten Kapitel findet ein kurzer Ausblick über die deutsche koloniale Vergangenheit statt, um anschließend den Forschungsstand von Afrika-Darstellungen in Reisebroschüren aufzeigen zu können. Die Reflexion über die vorgenommene Untersuchung erfolgt in der Diskussion im fünften Kapitel. Schlussfolgernd komplettiert das Fazit das vorliegende Projekt.
Wenn einer eine Reise tut dann kann er was erzählen, so sagt es jedenfalls der Volksmund. Reisen scheint ein Bedürfnis des Menschen zu sein, welches schon in der Kindheit durch Lesen und Hören von Fantasie- und Abenteuergeschichten in Märchen geweckt wird. Die Deutschen haben in den letzten Jahrzehnten den Titel als „Reiseweltmeister“ errungen, unternahmen sie doch 2019, ca. siebzig Millionen Urlaubsreisen, eine so hohe Zahl wie nie zuvor. Folglich boomt die Tourismusbranche und mit diesem stetigen Anstieg der Reisen wächst auch der Wettbewerb der Reiseveranstalter untereinander für ihre Reisen zu werben. Tagtäglich begegnen uns diese Reiseinformationen durch verschiedene Medien: Printmedien, Fernsehen und Internetplattformen. Besonders die Fernreisen werden mit nachdrücklichen Slogans promotet, Afrika fällt in diesem Kontext besonders auf: „Auf einer Kenia-Reise werden Sie zum Entdecker“ (Meiers Weltreisen 2023). Der Kontinent Afrika wird bunt,
ursprünglich und wild dargestellt, so reduziere diese Werbung ihn auf Safaris, wilde Tiere, Lebensfreude und einfache, arme, aber glückliche und fröhliche Menschen. Das Fremde soll die Reiseinteressenten anlocken, neugierig machen und sie aus einem grauen, industriellen, europäischen Alltag in eine bunte, fröhliche Gegenwelt holen. [...]
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theoretischer Bezugsrahmen
2.1 Foucault - Diskurs
2.2 Said - Orientalismus
3. Koloniale Vergangenheit Deutschlands
4. Afrika-Darstellungen in deutschen Reisebroschüren
5. Diskussion, Reflexion und Perspektive
6. Fazit
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Gender-Hinweis
Die in dieser Hausarbeit verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich immer gleichermaßen auf weibliche und männliche Personen. Auf eine Doppelnennung und gegenderte Bezeichnungen wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.
1. Einleitung
Wenn einer eine Reise tut dann kann er was erzählen, so sagt es jedenfalls der Volksmund. Reisen scheint ein Bedürfnis des Menschen zu sein, welches schon in der Kindheit durch Lesen und Hören von Fantasie- und Abenteuergeschichten in Märchen geweckt wird. Die Deutschen haben in den letzten Jahrzehnten den Titel als „Reiseweltmeister“ errungen, unternahmen sie doch 2019, ca. siebzig Millionen Urlaubsreisen, eine so hohe Zahl wie nie zuvor (vgl. Graefe 2023). Folglich boomt die Tourismusbranche und mit diesem stetigen Anstieg der Reisen wächst auch der Wettbewerb der Reiseveranstalter untereinander für ihre Reisen zu werben. Tagtäglich begegnen uns diese Reiseinformationen durch verschiedene Medien: Printmedien, Fernsehen und Internetplattformen. Besonders die Fernreisen werden mit nachdrücklichen Slogans promotet, Afrika fällt in diesem Kontext besonders auf: „Auf einer Kenia-Reise werden Sie zum Entdecker“ (Meiers Weltreisen 2023). Der Kontinent Afrika wird bunt, ursprünglich und wild dargestellt, so reduziere diese Werbung ihn auf Safaris, wilde Tiere, Lebensfreude und einfache, arme, aber glückliche und fröhliche Menschen (vgl. Rosdorff 2020: 51f.). Das Fremde soll die Reiseinteressenten anlocken, neugierig machen und sie aus einem grauen, industriellen, europäischen Alltag in eine bunte, fröhliche Gegenwelt holen. Obgleich im Kontext der aktuellen Einwanderungs- und Asylpolitik, Personen aus Afrika als „die Anderen“ wahrgenommen werden und das Fremde eher als gefährlich erscheint. In den letzten Jahren wurde diese Personen-Gruppe zunehmend zum Politikum, nicht zuletzt wegen etlichen Gewaltverbrechen welche ihr zuzuschreiben ist (vgl. BKA 2022). Allerdings wird nicht zwischen ihren Kulturen differenziert, sondern schwarze Menschen werden in Deutschland auf ein kollektives Ganzes reduziert, das es eigentlich nicht gibt, Afrika setzt sich aus vierundfünfzig Staaten zusammen und es existieren bis zu 2000 Sprachen (vgl. Brenzinger 2005).
Dieser Kontinent ist zu groß, als dass man ihn beschreiben könnte. Er ist ein regelrechter Ozean, ein eigener Planet, ein vielfältiger, reicher Kosmos. Wir sprechen nur der Einfachheit, der Bequemlichkeit halber von Afrika. In Wirklichkeit gibt es dieses Afrika gar nicht, außer als geografischen Begriff (Kapuscinski 2016: 8).
Dieser Vorgang, der Homogenisierung einer Gruppe, wird als Kulturrassismus definiert, weil er Menschen aufgrund ihrer kulturellen Herkunft als höher- oder minderwertig kategorisiert. Das konzipierte Fremde stellt eine Gefahr für die Mehrheitsgesellschaft dar. Entscheidend wurde dieses Thema durch Edward Saids „Orientalismus“ Studie geprägt. Eine Denkweise, welche den Westen dem Orient als überlegen, aufgeklärt und emanzipiert darstellt und diesen als primitiv, unzivilisiert und minderwertig projektiert (vgl. Said 2009). Dieser Ansatz machte Said zu einem der wichtigsten Vertreter des Postkolonialismus. Im Kontext dessen und mithilfe Saids „Othering“, hat die vorliegende Arbeit das Ziel, in Reisewerbungen nach Orientalismus zu suchen. Sie geht der Frage nach:Inwiefern werden die Bewohner Afrikas in deutschen Reisebroschüren als „die Anderen“ verkörpert und einem „Wir“, welches als westlich geprägte homogene Gesellschaft bezeichnet wird, entgegengesetzt?
Zunächst werden im theoretischen Zusammenhang Michel Foucaults DiskursTheorie und Edward W. Saids Orientalismus - Theorie skizziert, der Grund hierfür ist, dass Said sich in seinem Werk darauf beruft, mit Foucaults Methoden gearbeitet zu haben, „dessen Werk ich sehr viel verdanke“ (Said 2009: 34). Im dritten Kapitel findet ein kurzer Ausblick über die deutsche koloniale Vergangenheit statt, um anschließend den Forschungsstand von Afrika-Darstellungen in Reisebroschüren aufzeigen zu können. Die Reflexion über die vorgenommene Untersuchung erfolgt in der Diskussion im fünften Kapitel. Schlussfolgernd komplettiert das Fazit das vorliegende Projekt.
2. Theoretischer Bezugsrahmen
2.1 Foucault - Diskurs
Der französische Philosoph Michel Foucault (1926-1984), dessen Anschauung von großen Gelehrten wie Nietzsche, Heidegger, Kant, Marx, Hegel, Freud etc. beeinflusst wird (vgl. Kleiner 2001: 205-237), verknüpft Merkmale des Strukturalismus mit hermeneutischen Ansätzen. Seine Analyse der historischen Diskurse führt dazu, dass das Subjekt in den Vordergrund gestellt wird, ferner gilt er als Begründer der Diskurs-Analyse. Diesbezüglich hat er ein umfangreiches Gesamtwerk verfasst, welches sich in drei große Abschnitte gliedert: Entwicklung der Diskurs-Theorie, Entwicklung der Macht-Theorie und Entwicklung der Ethik des Selbst (vgl. Ruoff 2013: 15). Foucaults Theorien haben den Vorteil, dass sie nicht nur für eine wissenschaftliche Disziplin geeignet sind, vielmehr, dass sein Denken und seine zentralen Auslegungen inzwischen im gesamten Wissenschaft-Spektrum aufgegriffen wurden (vgl. Kammler et.al. 2014: 233). Seine Theorie-Bildungsprozesse sind flexibel, seine Konzepte sind frei für Um- und Neuinterpretationen, so bezeichnet er seine Konzepte auch als Werkzeugkisten: „Was ich geschrieben habe sind keine Rezepte, weder für mich noch für sonst jemand. Es sind bestenfalls Werkzeuge [...]“ (Foucault 1996: 25). Vor allem Foucaults Sicht auf die Thematik des Diskurses ist für die Bearbeitung der Reisebroschüren relevant. Der Diskurs nimmt in Foucaults Arbeiten „Archäologie des Wissens“ und „Die Ordnung der Dinge“ eine bedeutende Position ein, jedoch ist kontextuell „Die Ordnung des Diskurses“ sein informativstes Werk (vgl. Ruoff 2013: 37). In dieser Schrift macht er über den Diskurs folgende Aussage: „Ich setze voraus, daß in jeder Gesellschaft die Produktion des Diskurses zugleich kontrolliert, selektiert, organisiert und kanalisiert wird - und zwar durch gewisse Prozeduren [...]“ (Foucault 2017: 10-11). Insofern definiert er den Terminus Diskurs als: „Eine Menge von Aussagen, die einem gleichen Formationssystem zugehören“ (Foucault 2015: 156). Er spricht hier von Formationsregeln welche nachstehende vier Komponenten beinhalten, die Formation der Aussagen, die Formation der Gegenstände, die Formation der Begriffe und die Formation der Strategien (vgl. Ruoff 2013: 129). Der Grundgedanke hinsichtlich dessen ist das Geschick des Diskurses sich zu ergänzen, d.h. „Diskurs ist selbst zu seiner produktiven Erweiterung in der Lage“ (Ruoff 2013: 35). Außerdem führt Foucault auf, dass der Diskurs mit seinen Erscheinungsregeln ein nützliches Gut sei: „Ein Gut, das infolgedessen mit 3 seiner Existenz (und nicht nur in seinen >praktischen Anwendungen<) die Frage nach der Macht stellt. Ein Gut, das von Natur aus der Gegenstand eines Kampfes und eines politischen Kampfes ist“ (Foucault 2015: 175). Eindeutig ist hier die Verknüpfung zwischen Diskurs und Macht zu erkennen. In seiner Antrittsvorlesung am Collège de France, mit dem Titel: „Die Ordnung des Diskurses“, verdeutlicht Foucault seine Konzeption bezüglich des Diskurses und ändert seine bisherige Sichtweise indem er den Schwerpunkt auf dessen Kontrollverfahren legt. Er findet heraus, dass auf DiskurseAusschluss- und Verknappungsmechanismenregulierend wirken. In diesem Kontext determiniert er dreiAusschließungssysteme, welche den Diskursextrinsischsteuern: 1. Das Verbot > Sprechverbot. 2. Grenzziehung > Ausgrenzung des Wahnsinns. 3. Dualismus von wahr und falsch > Der Wille zur Wahrheit (vgl. Ruoff 2013: 85). Foucault verbindet nun in seinen Untersuchungen den Willen zur Wahrheit mit dem Willen zur Macht:
Wenn der wahre Diskurs seit den Griechen nicht mehr derjenige ist, der dem Begehren antwortet oder der die Macht ausübt, was ist dann im Willen zur Wahrheit, im Willen den wahren Diskurs zu sagen am Werk - wenn nicht das Begehren und die Macht? (Foucault 2017: 17).
Als Beispiel diesbezüglich benennt er die Vererbungslehre Gregor Mendels, welche von Biologen des 19. Jahrhunderts nicht legitimiert wurde: „Mendel sagte die Wahrheit, aber er war nicht > im Wahren < des biologischen Diskurses seiner Epoche“ (Foucault 2017: 25). Des Weiteren ordnet er den Kommentar denVerknappungssystemen(Kontrolle von Innen) zu, dieintrinsischauf Diskurse einwirken. Demzufolge hat der Kommentar die Funktion dasVerschwiegenenachzuweisen (vgl. ebd. 2017: 19). Insofern wird nach Foucault der Autor als Schreiber der Zeichen marginalisiert: „Der Schreiber bringt die Sprache zu Papier, aber er ist nicht ihr Sprecher“ (Ruoff 2013: 86). Gleichermaßen versteht Foucault das gesellschaftliche Erlernen des Diskurses als eine Form der Verknappung: „Jedes Erziehungssystem, ist eine politische Methode zur Aneignung des Diskurses sowohl desWissensals auch derMachtden Diskurs aufrecht zu erhalten oder zu verändern“ (Foucault 2017: 30). Nach Foucault ist somit der Diskurs eineSpiegelung der Wahrheit,es könne Alles die Struktur eines Diskurses erlangen. DasGesagte, ferner dasNicht-Gesagtewirke folglich als Macht auf den Diskurs ein (vgl. Foucault 2017: 32). In diesem Kontext lässt sich herleiten, dass bezüglich von Diskursen, dasWissenundNicht-Wissenein erheblicher Machtfaktor ist. Insofern veranschaulicht Stuart Hall in seinem Buch „Der Westen und der Rest“, dass dasWissen, das ein Diskurs produziert:
Eine Art von Macht [konstatiert], die über jene ausgeübt wird, über die ,etwas gewusst wird’, wenn dieses Wissen in der Praxis ausgeübt wird, werden diejenigen, über die ,etwas gewusst wird’ auf eine besondere Weise zum Gegenstand der Unterwerfung [...]. Diejenigen, die den Diskurs produzieren, haben also die Macht, ihnwahr zu machen, [...] (Hall 1994: 154).
MachtundDiskurssind demnach eng verknüpft und bilden eine Formierung desWissensund derMachtab. Insofern beeinflussen die aufgeführten Systeme >Diskursregulierungen< eines Diskurses bei der Repräsentation und Konstruktion „der Anderen“. Im Folgenden wird auf die „Anderen“ eingegangen.
2.2 Said - Orientalismus
Edward Wadie Said, Initiator des Konzepts des Orientalismus, gilt als einer der bedeutsamsten Kulturwissenschaftler des 20. Jahrhunderts. Seine Kritik an einem zeitgenössischen Eurozentrismus, zusätzlich dem fragwürdigen Nexus vonWissenundMachtin Nord-Süd-Beziehungen, hat die Geisteswissenschaft und viele Fachdisziplinen geprägt. Er war Literaturwissenschaftler und -kritiker, politischer Publizist, politischer Aktivist, Pianist und Musikkritiker. Said wurde 1935 als Sohn palästinensischer Christen in Jerusalem, damals als Völkerbund-Mandat für Palästina unter britischer Herrschaft, (vgl. lpd 2023) geboren. Größtenteils verbrachte er seine Jugend in Kairo. Hier eignete er sich durch Schule und Elternhaus die Grundlagen der europäischen Bildung an. Als Erwachsener wanderte er in die USA aus, wo er mehrere akademische Grade erwarb und schließlich als Professor für Englisch und Komparatistik an der Columbia University sowie in Harvard und Yale tätig wurde. Im Jahr 2000 wurde Said in die American Philosophical Society sowie 2002 in die American Academy of Arts and Letters gewählt. Außerdem erhielt er 2002 die Auszeichnung des Prinz-von-Asturien-Preises. Bis zu seinem Tod im Jahr 2003, galt Edward Said in den USA als bedeutendster politisch aktiver Palästinenser. Aufgrund dieser politischen Aktivitäten wurde er vom FBI beobachtet, bis zu seinem Lebensende wuchs seine FBI-Akte auf 238 Seiten an (vgl. McCarthy 2021).
Dass sich Said so intensiv politisch engagierte und zum Kulturkritiker wurde, war der politischen Lage Palästinas, 1948-Trauma Palästinas durch den SechsTage Krieg mit Israel (vgl. lpb 2023), in seiner Kindheit und seinem Heranwachsen in verschiedenen Welten geschuldet. So besuchte er während des britischen Mandats eine europäische Schule (GPS), darauf folgend eine amerikanische Schule (CSAC) und das ägyptische Victoria College (vgl. Said 2000: 61, 76 und 127). Said äußert sich zu dieser Identität-Zerrissenheit so:
Ich habe niemals gewusst, welche Sprache ich als erste gesprochen habe, arabisch oder englisch, oder welche von beiden denn nun wirklich ohne jeden Zweifel die meine war. Ich weiss jedoch, dass die beiden in meinem Leben immer gemeinsam aufgetreten sind, wobei die eine in der anderen wiederklang, manchmal ironisch, gelegentlich nostalgisch, meistens einander korrigierend und kommentierend. Jedekannals meine Muttersprache gelten - keine von beiden ist es (Said 2000: 12).
Neben der Sprache liegt im Kern meiner Erinnerungen an diese frühen Jahre die Geographie - vor allem in der entfremdeten Form von Abreisen, Ankünften, Abschieden, Exil, Heimweh, Nostalgie, Zugehörigkeit und des Reisens selbst. Jeder der Orte an denen ich lebte - Jerusalem, Kairo, der Libanon, die Vereinigten Staaten - , war von einem komplizierten Geflecht von Wertigkeiten geprägt, das mich in besonderer Weise in meinem Heranwachsen begleitete, in der Identitätsfindung [...] (Said 2000: 9).
1978 schrieb Said sein bekanntestes Werk „Orientalismus“, das als „Gründungsdokument postkolonialer Theorie“ (Castro Valera und Dhawan 2015: 96) gilt und welches ihn als anerkannten Kulturkritiker etablierte. In diesem Buch kritisiert er den Orientalismus als Wurzel der falschen kulturellen Repräsentationen, mit denen die westliche Welt den Nahen Osten wahrnehme. Nach Said:
ist der Orientalismus ein durch Wissenschaft, den Reisebericht und die fiktive Literatur elaborierter Diskurs, durch den sich Europa seiner politischen, sozialen, militärischen, wissenschaftlichen und kulturellen Überlegenheit über den Orient versichert, der als das grundsätzlich Fremde stilisiert wird (Bernsen und Neumann 2006: 1).
Des Weiteren „[...] versteht Said unter Orientalismus generell westliche Darstellungen des Orients, in denen dieser als das ,Andere’ Europas vorgestellt wird“ (Wiedemann 2021: 2-3). Nach seiner Auffassung werde der Orient durch die Beschreibungen der Orientalisten des Westens, des Okzidents: „als feminin, irrational und primitiv im Gegensatz zum maskulinen, rationalen und fortschrittlichen Westen entworfen“ (Castro Varela und Dhawan 2015: 99) und kritisiert dabei die damit verbundenen Machtverhältnisse. So würde nach Said ein Stereotypenregime zwischen Orient und Okzident gebildet, während sich der Westen mit seiner eigens zugeschriebenen Überlegenheit über den Orient stelle und ihn unterdrücke (vgl. Castro Varela und Dhawan 2015: 99 ). Weiterhin erläutert er den Orientalismus als „ein das europäische Denken seit der Antike durchziehendes Repräsentationssystem, in dem Okzident und Orient als asymmetrische Gegenbegriffe fungieren und letzterer immer als das exotisierte, es- sentialisierte und enthistorisierte Andere vorgestellt wird“ (Wiedemann 2012: 3). In diesem Kontext behauptet Said, dass der Gegenstand Orientalismus von seinen Betreibern dieser Wissenschaft beeinflusst werde, er konkretisiert Orientalisten als „[...] anyone, who teaches, writes, about or, researches the orient [...]“ (Said 2003: 2). Said hat dementsprechend das Prinzip des „Othering“ in Methoden und Texten der Orientalisten herausgefunden. Das Othering ist ein psychosozialer Prozess, der Imaginationen von anderen auslöst, um Imaginationen vom eigenen, vorwiegend positiv, hervorzuheben. Dies bedeutet, eine Konstruktion des „Anderen“ um sich selbst abzugrenzen und aufzuwerten (vgl. Universität Köln 2022). Said unterscheidet drei Ausprägungen wie er Orientalismus versteht. Erstens: Die klassische Forschung und Aussagen über den Orient. Zweitens: Das binäre Gefüge mit dem Okzidentalismus. Drittens: Ein hegemonialer Diskurs über den Orient welcher der Beherrschung dient, der als Begleiterscheinung des europäischen Kolonialismus gilt. Orientalismus sei zum einen derWillezumVerstehenund zum anderen dasWissen, zukontrollierenundmanipulieren. Hier nimmt Said Bezug auf Gramscis Terminus der „kulturellen Hegemonie“ und auf Foucaults Theorie zum Kontext vonWissen und Macht(Kapitel 2.1: 4-5). Dieser Orient-Okzident-Dualismus sei nach Said nicht natürlich, weil jener durch einen signifikanten Dominanz-Diskurs hervorgegangen sei (vgl. Castro Varela und Dhawan 2015: 100). Schließlich charakterisiert er die Konsequenz des orientalistischen Diskurses als „imaginative geography“ (Said 2003: 57). Demgemäß bezieht sich die Geografie des Orients nicht auf ein klar abgetrenntes Gebiet, sondern auf das Denken der Orientalisten. Schlussfolgernd fokussiert sich Said in seiner postkolonialen Theorie auf die Ebene weiterführender Dominanz, Autorität und Hegemonie des Westens, in welcher der Orientalismus als einBegleitumstanddes europäischen Kolonialismus konstatiert wird. Ob dieserhegemonialer dominante Diskurs,welcher mit abwertenden,kolonial geprägten, rassistischen Orientstereotypen im Europades neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert sehr verbreitet war, trotz Dekolonisierung-Prozess in den letzten Jahrzehnten, immer noch existiert, wird nachfolgend bearbeitet. Said hat zwar in seinem Buch vorwiegend den britischen und französischen Kolonialismus kritisiert, auf diese zusätzlich einzugehen würde allerdings die Tragweite des vorliegenden Projekts sprengen, deshalb wird im nächsten Kapitel nur die deutsche koloniale Geschichte vorgestellt.
3. Koloniale Vergangenheit Deutschlands
Bevor explizit auf die deutsche Kolonialgeschichte eingegangen wird, soll zunächst erklärt werden, was Kolonialismus ist. Er ist zu verstehen als eine von Kolonialmächten organisierte Politik, welche sich auf den Erwerb und Ausweitung von Ländern/Kolonien stützt. Diese Politik wurde als Imperial-Politik beschrieben und hatte die Intention, politische und wirtschaftliche Macht über Gebiete/Kolonien und deren Bevölkerung zu gewinnen. Der Kolonialismus zeichne sich dadurch aus, die primitive, unterlegene, unzivilisierte Rasse zu erziehen und zu missionieren (vgl. Conrad 2006: 42 und 74).
Das neunzehnte- und der Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts war geprägt von territorialer Expansion durch europäische Mächte. Es fand eine unvergleichliche Kolonisierung auf dem Erdball statt. Schon in der Mitte dieses Jahrhunderts waren 35 % der Welt unter westeuropäischer Kontrolle. Zu Beginn des 1. Weltkriegs waren es unglaubliche 85%. In dieser Zeit des Imperialismus ist hauptsächlich der afrikanische Kontinent unter den westlichen Großmächten aufgeteilt worden (vgl. Conrad 2006: 37). Das britische Empire zählte zwar zu den größten Herrschaftsmächten der damaligen Epoche, allerdings konnte das deutsche Kolonialreich als viertgrößte Macht beim Wettstreit der Welt-Kolonisierung recht gut mithalten (vgl. Zimmerer 2020: 11). Das deutsche Kaiserreich verleibte sich 2,5 Millionen Quadratkilometer koloniale Flächen ein (vgl. Giebel 2022), welche sich in Afrika, Ostasien und Ozeanien befanden: Deutsch-Südwestafrika (heute: Namibia); Kamerun; Togo; DeutschOstafrika (heute: Tansania, Burundi und Ruanda); Neuguinea (heute: nördliche Teil Papua-Neuguineas); Marshall-Inseln; Kiautschou (heute: Teil Chinas); Karolinen, Palau und Marianeninseln (heute: Mikronesien); Samoa-Inseln (heute: Westsamoa). In diesen Kolonien lebten ungefähr 12 bis 13 Millionen Menschen, im Gegensatz zu lediglich ein paar Zehntausend Kolonialisten vor Ort (vgl. Scriba 2014). Sebastian Conrad führt in seinem Buch „Globalisierung und Nation im Deutschen Kaiserreich“ auf, dass der Kolonialismus nicht nur ein ökonomisches und politisches System gewesen sei, sondern einem kulturellen Plan folgte, welchem der „Aufrechterhaltung der kulturellen Differenz zwischen Kolonialherren und Kolonisierten“ (Conrad 2006: 42) diente. Die Kolonisierten wurden ausgebeutet und alsexotische Fremde, Primitive, Nackte, Wilde, Urmenschennach Europa transportiert und inMenschenzoos, in sogenannten„Völkerschauen“, ausgestellt. Der Hamburger Tierpark Hagenbeck war zu Beginn des 20. Jahrhunderts Marktführer jenen „Handels“ in Deutschland und zog ein Millionen Publikum an. So galten diese „Menschenzoos“ als Rechtfertigung des Kolonialismus. Die zivilisierten weißen Europäer seien den anderen Kulturen überlegen, deshalb habe man das Recht sie zu beherrschen, auszubeuten und zu unterdrücken (vgl. Starkloff 2012: 165-168). Das Selbstbild, der Überlegenheit, des Publikums der Menschenzoos wurde somit bestätigt. Weiterhin wurde jene Haltung durch die Wissenschaft bekräftigt, welche begann, die Menschheit in Rassen aufzuteilen, dementsprechend entwickelten sich Forschungen wie, die derRassentheoretiker- Existenz einer herrschenden Rasse; die derSozialdarwinisten- Die Stärkeren überleben; und die derRassenhygieniker- Zucht der Menschheit. Diese pseudowissenschaftlichen Ansätze wurden dann später im Nationalsozialismus benutzt und als „NS-Rassenleh- re“ optimiert (Husemann 2016). In ihren Kolonien unterdrückten die Kolonialherren mit diesem Selbstbild die einheimische Bevölkerung und (zwangen sie indirekt) für das Mutterland zu arbeiten. Kirchliche und staatliche Institutionen der Kolonialherren begannen mit der Missionierung „den arbeitsscheuen Eingeborenen nach und nach zur freiwilligen Arbeit zu erziehen“ es begann „Die Erziehung des Negers zur Arbeit“, welche als „Eingeborenenpolitik“ bezeichnet wurde (Conrad 2006: 42 und 74). Dass Unterdrückung meistens zu Unruhen, Aufstand und infolgedessen zur Gewalt führt, beweist der Genozid an den Herero und Nama, welcher durch die deutschen Kolonialisten in DeutschSüdwestafrika (heute Namibia) verursacht wurde (vgl. Zimmerer 2020: 11-12). Obwohl nach dem zweiten Weltkrieg die Dekolonialisierung begann und Deutschland heute keine Kolonien mehr besitzt, wirken die beschriebenen, beabsichtigten, kulturellen Differenzen bis heute nach. Deutschlands koloniale Vergangenheit, der „Kolonialismus war keine Einbahnstraße“. Er hat dazu geführt, „[...] daß auch die europäischen Gesellschaften durch die koloniale Interaktion geprägt worden sind“ (Conrad 2006: 43). Hier spricht Conrad von einer „Rückwirkung“, welche der Fokus der Postkolonialen Studien ausdrücke (Conrad 2006: 43). In diesem Kontext und mit Rückblick auf Edward Saids Postkoloniale Theorie, dass der Orientalismus alshegemonialer dominanter DiskurseineBegleiterscheinungdes europäischen Kolonialismus sei (Kapitel 2.2: 7) wird nachfolgend versucht, dieseRückwirkungsichtbar zu machen.
4. Afrika-Darstellungen in deutschen Reisebroschüren
Nachdem im vorigen Kapitel herausgearbeitet wurde, dass die deutsche Gesellschaft durch ihre koloniale Vergangenheit geprägt wurde, folgt nun ein Ausblick auf den Forschungsstand zu kolonialen Sichtweisen über Afrika in deutschen Reisekatalogen. Aufgrund des größeren Interesses an den postcolonial studies in den letzten Jahren; die auch zu politischen Reaktionen in Deutschland geführt haben, z.B. Deutsche Entwicklungsministerin entschuldigt sich 2004 in Namibia für den deutschen Völkermord an Herero und Nama oder das deutsche Versöhnungsabkommen 2021 mit den Herero und Nama durch den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier; existieren bereits Forschungsarbeiten, welche sich mit diesem Spannungs-Nexus, Kolonialismus und Tourismus, auseinandergesetzt haben. Ein besonderes Augenmerk gilt vorab dem Feld der Afrika-Darstellung in Reisebroschüren durch Reiseveranstalter. Eine ausführliche Studie liefert hierzu die Magisterarbeit von Carolin Maevis, sie analysiert in ihrer Arbeit unter anderem Werbebroschüren, Reisekataloge und Internetseiten verschiedener Tourismus-Dienstleister ausschließlich für Kenia. Sie entdeckt, dass in den Broschüren sehr oft alte Kolonialromane für Werbezwecke benutzt werden um romantische Bilder von Kenia zu produzieren, welche bei Reisekunden Kenia-Nostalgie wecken soll. So führt sie das Beispiel von Karen Blixen auf, die den Roman „Out of Africa“ geschrieben hat, der später verfilmt und in Deutschland mit dem Titel „Jenseits von Afrika“ bekannt wurde. Blixen kreiert in ihrem Roman ein romantisiertes Bild Afrikas, voller wilder, unberührter Natur, Safaris, malerischer Sonnenuntergänge und „Eingeborenen“ denen sie eine Nähe zur Natur zuschreibt, welche bei Europäern nicht mehr vorhanden sei.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: MWR, Afrika Orient. Kenia &Tansania. 2022/2023: 143.
Das mit diesen Wahrnehmungen verbundene Gefühl, wurde als „Out of Africa feeling“ populär und hielt sogar Einzug in den allgemeinen Sprachgebrauch, um ein bestimmtes Bild von Afrika zu charakterisieren (vgl. Maevis 2012: 45). Das „Out of Africa-feeling“ wird dementsprechend für Werbung in Reisebroschüren benutzt, insofern wirbt Meiers Weltreisen unkritisch mit dem Kolonialstil und fordert die Reisewilligen auf, den einstigen kolonialen Charme von Kenia zu genießen und auf den Spuren von Karen Blixen zu wandern. So dominieren die Bilder von Wildnis, unberührter Natur, romantische Sonnenuntergänge und eine ganz besondere Magie für Afrika, im Reisekatalog als auch im Kolonialroman (vgl. Maevis 2012: 49). In ihrer Forschung fallen Maevis weitere Narrative auf, welche im Afrika-Diskurs der deutschen Gesellschaft weit verbreitet sind und diesen dominieren. Hierbei handelt es sich um die Sichtweise die Welt einzuteilen, in ein Afrika alshomogener Kontinentundunterentwickelt, ferner eine westliche Welt (Europa, USA, Australien) alszivilisiertundweiterentwickelt(vgl. Maevis 2012: 50-52). Schließlich ist an den Ergebnissen zu bemerken, dass das Afrika-Bild in der Studie das „Safari-Kenia“ sehr ambivalent ist, einerseits sei die Ursprünglichkeit, das Wilde, „typisch Afrikanische“ geschätzt und zum Erhalten wert, andererseits sollte sich die Infrastruktur, Bildung und Gesundheitswesen auf westliche Standards weiterentwickeln (vgl. Maevis 2012: 53). Eine weiteres Projekt, welches zum Verständnis des Afrika-Bilds in Reisebroschüren beiträgt, ist die Arbeit, „Südafrika a la carte [...]“ von Mark Holthoff. Er untersucht die Darstellung Südafrikas in deutschen Reisekatalogen und bemerkt, dass in sämtlichen Werbebroschüren der Reiseveranstalter, afrikanische Menschen, aufgrund der assoziierten besonderen Naturnähe, in die Sichtweite der Tiere gebracht werden, das Animale, das Wilde, das Tierhafte wird dementsprechend postuliert. „Menschen und Tiere erscheinen dann als Teil der Landschaft“ (Holthoff 2006: 110).
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: MWR, Afrika Orient. Südafrika 2022/2023: 209.
„Berge, Tiere und Zulus“ „Swazi, Zulus und Rhinozerosse“ (Holthoff 2006: 109), mit diesen kurzen prägnanten Werbeslogans wird beabsichtigt möglichst viele Assoziationen beim Reisekunden hervorzulocken. In diesem Kontext deckt Holthoff auf, dass die Reputation des Volks der Zulu als wild und grausam gilt, was mit der Erzählung über den großen Helden Shaka Zulu zu tun hat, der der Gründer des Zulu Reiches war. Er wird der „schwarze Napoleon“ genannt, weil er im 19. Jahrhundert eins der mächtigsten Königreiche im südlichen Afrika erkämpfte und aufbaute (vgl. Holthoff 2006: 113-114). Wichtig hierzu ist die Aussage Holthoffs: „Der Topos des schwarzen bzw. afrikanischen Napoleon ist eine beliebte Bezeichnung für herausragende Nichteuropäer [...] Die Bildung von Analogien zu europäischen Persönlichkeiten wie Napoleon oder Caesar ist Ausdruck einer eurozentrischen Perspektive“ (Holthoff 2006: 115). Die Reiseveranstalter, welche ständig mit neuen Marktstrategien wetteifern, greifen sich die Geschichte von Shaka Zulu auf und werben mit zahlreichen Stereotypen ihre Reisen an: „Zulu-Erlebnis auf Shakaland“ oder:
Bekannt geworden durch den Film Shaka Zulu, erleben Sie hier die traditionelle Lebensweise der stolzen Zulu Nation. Auf einer geführten Tour erfahren Sie mehr über die Geschichte von Shaka Zulu, einst König des Zulustammes. Das traditionelle Mittagessen ist eingeschlossen. Stammestänze, Medizinmänner und Speer-Herstellung sind nur einige der Etappen im Unterhaltungsprogramm (Holthoff 2006: 116-117).
Ein weiteres Reiseangebot: „Tanzende Zulus im Takt durchdringender Trommeln, nur erleuchtet vom Widerschein des lodernden Feuers erzeugen eine schaurige Gänsehaut der besonderen Art“ (Holthoff 2006: 116). Laut Holthoff fänden sich in allen seinen untersuchten Reiseprospekten solche „tribalistische verzerrte Darstellungen des einen oder anderen südafrikanischen Volkes“ (Holthoff 2006: 116) und würden nicht das moderne Südafrika repräsentieren. So schließt Holthoff seine Arbeit mit Folgendem ab: „[...] das klischeehafte Afrikabild wird durch die Reisekataloge vielfach reproduziert und bestätigt [...]“ (Holthoff 2006: 122).
Parallel zur Erforschung der Reiseveranstalter existieren auch Studien über deutsche und internationale Freiwilligen-Dienste, ferner über den Voluntouris- mus. In diesem Feld wird, was zahlreiche Studienarbeiten beweisen, hinsichtlich der Fortsetzung globaler Machtverhältnisse und der Reproduktion von kolonialen Stereotypen, geforscht. Aufgrund des sozialen Aspekts der internationalen Freiwilligen-Dienste, ist in den letzten Jahren ein enormer globaler Tourismusmarkt entstanden. In ihrer Bachelorarbeit analysiert Henriette Seydel Webseiten und Kataloge von Voluntourismusveranstaltern. Sie konzentriert sich vorwiegend auf Tansania und legt den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf Othe- ringmechanismen, welche in ihrer Untersuchung aufgedeckt werden (Seydel 2016). Vergleichbar zu dieser Studie gestaltet sich die Arbeit von Ulrike Müller. Sie betrachtet die Angebote und desgleichen die Webseiten verschiedener Voluntourismus-Firmen in Afrika (Müller 2016). Eine andere Studie, welche Josia Tiedtke durchgeführt hat, erforscht staatliche, deutsche FreiwilligenDienste und private Veranstalter in Namibia in Blog-Einträgen und Rundschreiben der Freiwilligen (Tiedtke 2016). Alle aufgeführten Studien sind in ihren Resultaten konform, so stellten die Forscher fest, dass koloniale Denkmuster und Vorstellungen bei den Volunteers weit verbreitet sind. Bei der Gestaltung der Projekte würden die Anbieter, Otheringmechanismen einsetzen, aber auch die Volunteers mit ihren Erfahrungen würden auf diese binäre Divergenz zurückgreifen, indem sie als helfende Akteure, die afrikanischen Menschen als passive, hilfsbedürftige Objekte behandeln (vgl. Seydel 2016 und Müller 2016). Die Volunteers und die Freiwilligen fänden sich stets in der aktiven Rolle als Helfer, welche den passiven Bedürftigen in den verschiedenen 13
Ländern zu Hilfe kommen müssten, um sie aus ihrer „unterentwickelten“, „primitiven“ und „ärmlichen“ Lage zu befreien. Während die Freiwilligen in den Werbekampagnen für die Projektländer als überlegen, als „Experten“ dargestellt werden, werden die afrikanischen Menschen alsandersundunterlegenkonstruiert. Nach wie vor zeige sich, dass der Voluntourismus geprägt sei vonOtheringmechanismen,welche aufEurozentrismus, StereotypisierungundRassismusbegründet sei (vgl. Tiedtke 2016: 32-34). Erwähnenswert für das vorliegende Projekt, ist folgende Erkenntnis, die Tiedtke herausgefunden hat: „Obgleich die Kolonialgeschichte und ihre Nachwirkungen in den untersuchten Reiseberichten weitestgehend unerwähnt bleiben, sind die Denk- und Wahrnehmungsmuster der Freiwilligen von ihr geprägt“ (Tiedtke 2016: 34).
5. Diskussion, Reflexion und Perspektive
In Anlehnung an Edward Saids Orientalismus - Theorie welche als ein hegemonialer, dominanter Diskurs und daher als ein kolonialer Begleitumstand des europäischen Kolonialismus konkretisiert wird, sind im vorliegenden Projekt deutsche Reisebroschüren überprüft worden. Anhand der verschiedenen vorgestellten Forschungsarbeiten wurde aus postkolonialer Perspektive die Darstellung Afrikas im touristischen Kontext betrachtet.
Offenkundiges Ergebnis dieser Untersuchung ist, dass Mechanismen des Othe- ring, die infolge kolonialistischer, eurozentristischer, rassistischer und stereotypen Denkweisen legitimiert sind, bei Afrika-Darstellungen in der Tourismusbranche immer noch vorherrschen und durch derer Werbekampagnen weiterhin reproduziert werden. Die Konstruktionen der „Anderen“ sind also auf Eurozentrismus, Kolonial-Rassismus und Stereotypisierungen und das „Wir“ auf Überlegenheit konzipiert. Der koloniale Diskurs mit seinem Denkschemata unterteilt die Welt in:
- Fortschrittlicher Westen (Europa, USA, Australien) > Homogenes Konstrukt
- Unterentwickelter Kontinent (Afrika) > Homogenes Konstrukt
Die beabsichtigte Konzeption der Homogenität der beiden Narrative „Wir“ und die „Anderen“ im kolonialen Diskurs (obwohl Europa aus ganz unterschiedlichen 47 Staaten besteht und auf diesem Erdteil insgesamt 700 Millionen Menschen leben. Afrika ein riesiger Kontinent mit 55 unterschiedlichen Staaten ist, auf dem insgesamt 1,4 Milliarden Menschen leben), können im Sinne Saids als einedominante manipulativePraxis (Kulturrassismus) reflektiert werden, welche das Wissen formatiert und somit wieder auf die Praxis einwirkt. Das Wissen aus den Reisebroschüren wird kontinuierlich reproduziert und beeinflusst den gesellschaftlichen Diskurs und umgekehrt. Dementsprechend ist mit diesem Ergebnis die Forschungsfrage, inwiefern die Bewohner Afrikas in deutschen Reisebroschüren als „die Anderen“ verkörpert werden und einem „Wir“, welches als westlich geprägte homogene Gesellschaft bezeichnet wird, entgegengesetzt, beantwortet. Auffallend bei der Untersuchung des vorliegenden Projekts ist die Rolle der Freiwilligen-Dienste. Obwohl die Kolonialgeschichte und ihre Nachwirkungen in den Broschüren nicht angemerkt werden, wird der koloniale Diskurs im Bereich des Freiwilligen-Dienstes fortgeführt (Kapitel 4: 14). Diese Feststellung ist konform mit Conrads Behauptung, dass die deutsche Gesellschaft durch ihre koloniale Interaktion geprägt worden sei und diesbezüglich von einerRückwirkungspricht (Kapitel 3: 10). DieseRückwirkungensind als Otheringmechanismen im vierten Kapitel sichtbar gemacht worden und verifizieren Saids Kritik einer Kontrastierung desWestensmit demOrient. In den Broschüren und den Webseiten des Voluntourismus steht ein abgegrenzterWesteneinemAfrikagegenüber. Deswegen bilden sich hierzu weitere Fragen: Inwiefern ist das System der Freiwilligen-Dienste, als kontinuierter, softer Kolonialismus anzusehen? Inwieweit sehen sich die Freiwilligen als „Entwicklungshelfer“ und heben sich dadurch mit einem „Wir“ gegenüber den „Anderen“ ab? In diesem Kontext sollte mit der postkolonialen Perspektive weiter geforscht werden um den Verantwortlichen der Tourismusbranche aufzeigen zu können, dass sie die Verantwortung für die Reproduktion von Otheringmechanismen tragen, demgemäß die Gesellschaft beeinflussen und deshalb eine Reflexion ihrer kolonialen Denkweise notwendig wäre. Die Gesellschaft ist der Ort an dem Diskurse (re)produziert werden, sie hat die Macht Diskurse zu beeinflussen (Foucault und Said Kapitel 2.1 und 2.2: 3-7). Reisebroschüren wel- 15 che als Print-Versionen, online und als Blogs in sozialen Netzwerken etabliert sind beeinflussen das Wissen und die Meinung der Gesellschaft. Demgemäß sollten die Reiseveranstalter/Freiwilligen-Dienstleister verantwortungsbewusst ihre Werbungen gestalten. So könnten die Texte und Fotos in Reisekatalogen objektiver formuliert und präsentiert werden. Werbeslogans in Reisebroschüren sollten vorurteilsfrei sein. Des Weiteren sollten Bilder in Werbekampagnen gewissenhaft eingesetzt werden. Erinnern doch Abbildungen von afrikanischen Menschen neben Tieren (Kapitel 4: 11 und 12) an die Menschenzoos > Völkerschauen am Anfang des 20. Jahrhunderts (Kapitel 3: 9). Das Hinzufügen von Publikationen über die Moderne in den unterschiedlichen Staaten in Afrika, wäre ein Anfang den kolonialen Diskurs zu unterbrechen. Ein Beispiel diesbezüglich wäre das Silicon Vally von Ostafrika, das Silicon Savannah in Nairobi der Hauptstadt Kenias, in Reisekatalogen vorzustellen (vgl. Sturmer 2021).
Reisebroschüren sind Medien die, weit verbreitet sind und im Kontext der Darstellung Afrikas in Reisebroschüren, koloniales Wissen transportieren und reproduzieren. Weitere Forschungen, zusätzlich eine reflektierende Betrachtung der unterschiedlichen afrikanischen Staaten, könnte dazu beitragen, eurozen- tristisches stereotypes, rassistisches Denken abzubauen und dementsprechend ein besseres gerechteres Afrika-Bild generieren.
6. Fazit
Inwiefern werden die Bewohner Afrikas in deutschen Reisebroschüren als „die Anderen“ verkörpert und einem „Wir“, welches als westlich geprägte homogene Gesellschaft bezeichnet wird, entgegengesetzt? Das war die zentrale Frage des vorliegenden Projekts. Mithilfe einiger Studienarbeiten sind Reisekataloge diesbezüglich überprüft worden.
Eingangs wird der theoretische Hintergrund Foucaults Diskurs und Saids Ori- entalismus erörtert. Anschließend folgt die Veranschaulichung der deutschen kolonialen Vergangenheit und danach die Thematisierung des Untersuchungsgegenstands. Die Ergebnisse dieser Überprüfung haben nachgewiesen, dass die Bewohner Afrikas in deutschen Reisebroschüren mit Konzeptionen des Eurozentrismus, des Kolonial-Rassismus und der Stereotypisierungen als die „Anderen“ - Unterlegenen (Orient) ausgegrenzt dargestellt und dem „Wir“ - Überlegenen (Westen) gegenübergestellt werden. Es konnte nachgewiesen werden, dass die Reiseveranstalter ihr koloniales (Wissen) Denken in die Gesellschaft transportieren und somit reproduzieren. Im Kontext dessen und im Kontext der Freiwilligen-Reiseveranstalter haben sich neue Fragen herausgebildet die nach wie vor erforscht werden sollten. Des Weiteren werden in der Diskussion, Perspektiven behandelt, welche die koloniale Denkweise in der deutschen Gesellschaft korrigieren könnten. Mit folgenden Maßnahmen: Reflektierende Berichterstattung, über Afrika und seine unterschiedlichen Staaten, durch die Medien; weitere Postkoloniale Forschung; wäre der Wandel des Afrika-Bilds in der deutschen Gesellschaft realisierbar.
Die vorliegende Arbeit macht deutlich, dass Deutschland eine Mitverantwortung für die Katastrophen in Afrika trägt. Im Kontext der deutschen kolonialen Vergangenheit und dem damit verbundenen Genozid an Herero und Nama, ist eine sensiblere Berichterstattung in deutschen Medien > Reisebroschüren < notwendig.
Die Ergebnisse einer intensiveren, expandierenden Postkolonialen Forschung sollten den Verlagen der Reiseveranstalter zugeführt werden um eine reflektierte Gestaltung des Afrika-Bilds in Reisebroschüren zu generieren. Indem den Bürgern in Deutschland die Folgen und Nachwirkungen des Kolonialismus, ihren dominanten Diskurs, ihren Orientalismus bewusster gemacht wird, ist ein Revidieren in einen gerechteren Diskurs möglich. Um es im Sinne Saids und Foucaults zu äußern, aus ihrerKonstruktion der Wirklichkeiteinen objektiveren Diskurs zu legitimieren. Als interessante Herausforderung in diesem Kontext sollte ein Bogen gespannt werden zwischen kolonialem Diskurs, der aktuellen Migrations-Debatte und der Rassismus-Debatte, welche wiederum zu einer engeren Zusammenarbeit der verschiedenen Forschungsgruppen als Folge haben könnte. Das bedeutet, eine Kooperation der Postkolonialen Forschung mit der Migrations- und der Rassismus - Forschung, würde zu weiteren aufschlussreichen Ergebnissen führen.
Wir gehören keiner Rasse und keinem Volk an.
Wir sind die Bewohner dieser Erde und gehören nur uns selbst.
Frederica de Cesco in (Der rote Seidenschal)
Literaturverzeichnis
Bernsen, Michael und Neumann, Martin (2006):Die französische Literatur des 19. Jahrhunderts und der Orientalismus.Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
BKA (2022): Kernaussagen „Kriminalität im Kontext von Zuwanderung“https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Jahresbe-richteUndLagebilder/KriminalitaetlmKontextVonZuwanderung/kernaus- sagenKriminalitaetZwwanderung2022.html?nn=62336zugegriffen am 04.06.2023.
Brenzinger, Matthias (2005): Sprachenvielfalt auf dem afrikanischen Kontinent.https://www.bpb.de/themen/afrika/dossier-afrika/58933/sprachen-vielfalt-auf-dem-afrikanischen-kontinent/zugegriffen am 02.06.2023
Castro Varela, María do Mar und Dhawan, Nikita (2015):Postkoloniale Theorie. Eine kritische Einführung. Bielefeld: transcript Verlag.
de Cesco Frederica: Der rote Seidenschal.hllps:www.myzitate.de/frederica-de-cesco/zugegriffen am 16.07.2023.
Conrad, Sebastian. (2006):Globalisierung und Nation im Deutschen Kaiserreich.München: C. H. Beck Verlag.
Foucault, Michel (1996).Diskurs und Wahrheit: Die Problematisierung der Parrhesia.Sechs Vorlesungen, gehalten im Herbst 1983 an der Universität von Berkeley/Kalifornien: 197 - Softcover. Berlin: Merve Verlag.
Foucault, Michel (2015):Archäologie des Wissens.Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 356, Suhrkamp Verlag.
Foucault, Michel und Ralf Konersmann. (2017):Die Ordnung des Diskurses.Frankfurt am Main: FISCHER Taschenbuch.
Giebel Marcus (2022): Alle Kolonien von Deutschland: Wann und welche gab es?https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/alle-kolonien-von- deutschland-wann-und-welche-gab-es-id63943906.htmlzugegriffen am 04.07. 2023.
Graefe, L. (2023): Reiseverhalten der Deutschen.https://de.statista.com/the-men/1342/reiseverhalten-der-deutschen/#topicOverviewzugegriffen am 31.05.2023.
Hall, Stuart (1994): Der Westen und der Rest, Diskurs und Macht. In:Rassismus und kulturelle Identität.Ausgewählte Schriften 2, hrsg. Stuart Hall, 137-179. Hamburg: Argument-Verlag.
Holthoff, Mark (2006): Südafrika a la carte: die Konstruktion eines Landes in deutschen Reisekatalogen.https://stichproben.univie.ac.at/fileadmm/user upload/p stichproben/Artikel/Nummer10/Nr10 Holthoff.pdfzugegriffen am 11.07.2023.
Kapuscinski, Ryszard (2016):Afrikanisches Fieber.München/Berlin: Piper Verlag.
Kammler, Clemens und Parr, Rolf und Schneider, Ulrich Johannes (Hg.) (2014):Foucault Handbuch.Leben-Werk-Wirkung Sonderausgabe. Stuttgart, Weimar: J.B. Metzler Verlag.
Kleiner, Marcus S. (2001):MICHEL FOUCAULT. Eine Einführung in sein Denken. Frankfurt/Main: Campus Verlag GmbH.
lpb Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (2023): Die Geschichte Palästinas.https://www.lpb-bw.de/geschichte-
palaestinas#c22239zugreifen am 28.08.2023.
Husemann, Mirjam (2016): Die NS-Rassenpolitik. Lemo Lebendiges Museum Onlinehttps://www.dhm.de/lemo/kapitel/ns-regime/innenpolitik/rassen- politik.htmlzugegriffen am 04.07.2023.
McCarthy, Conor (2021): Edward Said zeigt Intellektuellen, wie man politische Haltung mit Wissenschaft verbindet.https://jacobin.de/artikel/edward-said-zeigt-intellektuellen-wie-man-politische-haltung-mit-wissenschaft- verbindet-orientalismus-noam-chomsky-palastina-zionismus/zugegriffen am 28.06.2023.
Maevis, Carolin (2012): Die Vermittlung von Unmittelbarkeit. Bilder und Erleben „ursprünglicher Natur“ von Safari-TouristInnen am Naivashasee, Kenia.https://kups.ub.uni-koeln.de/4831/1/Heft40 Maevis.pdfzugegriffen am 08.07.2023.
Meiers Weltreisen (2023): Afrika-Kenia Urlaub.https://www.meiers-weltrei-sen.de/reiseziele/afrika/keniazugegriffen am 01.06.2023.
Müller, Ulrike Luise (2016): Voluntourismus aus Sicht des Postkolonialismus. Eine Diskursanalyse.https://epub.ub.uni-muenchen.de/29505/1/132 O- pen%20Acces Ulrike%20M%C3%BCller.pdfzugegriffen am 08.07.2023.
Rosdorff, Julia (2019): Der Einfluss des Afrika-Images auf die Reiseentscheidung der Deutschen: Probleme und Herausforderungen für das Tourismusmarketing afrikanischer Staaten. In Hartmann, Rainer (2019): Tourismus in Afrika: Chancen und Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklunghttps://books.google.de/books? id=jrztDwAAQBAJ&pg=PA50&lpg=PA50&dq=UNTWO-Kategorisie- rung,+als+afrikanischen+Staat,+wenn+keine+andere+Kennzeich- nung + vorhanden + ist.https://doi.org/10.1515/9783110626032-002&source=bl&ots=bbrAgFZe&sig=ACf- U3U2dtTzcldEhTTMf-jKshtrwWEGt A&hl=de&sa=X&ved=2ahUKE- wj l v 9 6 u- aaAAxVkhv0HHVLdBjAQ6AF6BAgMEAM#v=onepage&q=UNTWO- Kategorisierung%2C%20als%20afrikanischen%20Staat%2C%20wenn% 20keine%20andere %20Kennzeichnung%20vorhanden%20ist.https%3A %2F%2Fdoi.org%2F10.1515%2F9783110626032-002&f=falsezugegriffen am 31.05.2023
Ruoff, Michael. (2013):Foucault-Lexikon.Paderborn: Wilhelm Fink UTB GmbH & Co. Verlags-KG.
Said, Edward W. (2000):Am falschen Ort. Autobiografie. Berlin: Berlin Verlag.
Said, Edward W. (2003):Orientalism.UK: Penguin Random House.
Said, Edward W. (2009):Orientalismus.Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag GmbH.
Scriba, Arnulf (2014): Statistische Angaben zu deutschen Kolonien. Lemo Lebendiges Museum Onlinehttps://www.dhm.de/lemo/kapitel/kaiserreich/aussenpolitik/statistische-angaben-zu-den-deutschen-kolonien.htmlzugegriffen am 04.07.2023.
Seydel, Henriette Friederike (2016): Reproduktion globaler Ungleichheit durch Voluntourismus - eine postkoloniale Analyse von Otheringmechanismen in Werbekatalogen am Beispiel von Tansania.https://docplayer.org/81877475-Reproduktion-globaler-ungleichheit-durch-voluntourismus- eine-postkoloniale-analyse-von-otheringmechanismen-in-werbekatalo-gen-am-beispiel-tansania.htmlzugegriffen am 09.07.2023.
Starkloff, Kristina (2012): Völkerschauen/Zurschaustellungen.https://www. de- gruyter.com/document/doi/10.1524/9783486714012.165/html?lang=dezugegriffen am 05.07.2023.
Sturmer, Martin (2021): Die Silicon Savannah steht hoch im Kurs.https://afri- ka.info/die-silicon-savannah-steht-hoch-im-kurs/zugegriffen am 16.07.2023.
Tiedtke, Josia (2016): Postkoloniale Perspektiven auf die deutschen Freiwilligendienste in Namibia.https://www.wusgermany.de/sites/wusgermany. - defiles/contentfiles/tiedtke.pdfzugegriffen am 09.07.2023.
Universität Köln (2022): Othering.https://vielfalt.uni-koeln.de/antidiskriminie-rung/glossar-diskriminierung-rassismuskritik/otheringzugegriffen am 19.07.2023.
Wiedemann, Felix (2021): Orientalismus.https://docupedia.de/zg/Wiedeman-n orientalismus v2 de 2021zugegriffen am 28.06.2023.
Zimmerer, Jürgen (2020): Der Völkermord in Deutsch-Südwestafrika (1904-1908).https://www.kath-akademie-bayern.de/fileadmin/user u-pload/Voelkermord.pdfzugegriffen am 05.07.2023.
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: MWR, Afrika Orient 2022/2023: Kenia & Tansaniahttps://ww- w.meiers-weltreisen.de/service-kontakt/online-katalogezugegriffen am 05.07.2023
Abbildung 2: MWR, Afrika Orient 2022/2023: Südafrikahttps://www.meiers-weltreisen.de/service-kontakt/online-katalogezugegriffen am 05.07.2023
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht, inwiefern die Bewohner Afrikas in deutschen Reisebroschüren als "die Anderen" verkörpert und einem "Wir", welches als westlich geprägte homogene Gesellschaft bezeichnet wird, entgegengesetzt werden. Sie analysiert Afrika-Darstellungen in Reisebroschüren unter Bezugnahme auf postkoloniale Theorien, insbesondere Edward Saids Orientalismus-Theorie und Michel Foucaults Diskurs-Theorie.
Welche theoretischen Grundlagen werden in der Hausarbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich hauptsächlich auf Michel Foucaults Diskurs-Theorie und Edward W. Saids Orientalismus-Theorie. Foucaults Theorie hilft, die Machtmechanismen in Diskursen zu verstehen, während Saids Theorie des Orientalismus die Darstellung des Orients durch den Westen als Konstruktion beleuchtet.
Welche Rolle spielt die deutsche Kolonialgeschichte in der Analyse?
Die deutsche Kolonialgeschichte wird als Hintergrund betrachtet, um die Kontinuität kolonialer Denkmuster in aktuellen Darstellungen Afrikas zu verstehen. Die Arbeit untersucht, wie koloniale Erfahrungen die Wahrnehmung und Darstellung Afrikas in der deutschen Gesellschaft und insbesondere in der Tourismusbranche beeinflussen.
Wie werden Afrika-Darstellungen in deutschen Reisebroschüren analysiert?
Die Analyse konzentriert sich darauf, wie Afrika und seine Bewohner in Reisebroschüren dargestellt werden, insbesondere ob und wie Stereotypen, "Othering"-Mechanismen und eurozentrische Perspektiven verwendet werden. Es wird untersucht, ob die Broschüren ein homogenes Bild von Afrika zeichnen und ob sie die kulturelle Vielfalt des Kontinents angemessen repräsentieren.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Hausarbeit?
Die Hausarbeit kommt zu dem Schluss, dass Mechanismen des "Othering", die auf kolonialistischen, eurozentristischen und stereotypen Denkweisen basieren, in Afrika-Darstellungen in der Tourismusbranche immer noch vorherrschen. Diese Darstellungen konstruieren ein "Wir" (den Westen) als überlegen und "die Anderen" (Afrika) als unterlegen.
Welche Kritik wird an Freiwilligendiensten geübt?
Die Hausarbeit weist darauf hin, dass Freiwilligendienste, obwohl oft gut gemeint, koloniale Denkmuster reproduzieren können, indem sie Freiwillige als helfende Akteure und afrikanische Menschen als passive, hilfsbedürftige Objekte darstellen. Es wird die Frage aufgeworfen, inwiefern Freiwilligendienste als eine Form von "softer" Kolonialismus betrachtet werden können.
Welche Perspektiven werden für zukünftige Forschung aufgezeigt?
Die Hausarbeit schlägt vor, dass zukünftige Forschung sich stärker auf die Rolle von Freiwilligendiensten und die Verantwortlichkeiten der Tourismusbranche konzentrieren sollte. Es wird betont, dass eine reflektierende Auseinandersetzung mit kolonialen Denkweisen notwendig ist, um ein gerechteres Afrika-Bild zu fördern. Des Weiteren wird eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Postkolonialer Forschung, Migrationsforschung und Rassismusforschung vorgeschlagen.
- Quote paper
- Rita Favata (Author), 2023, Die Konstruktion des afrikanischen Kontinents in deutschen Reisekatalogen. Eine Betrachtung in Anschluss an Edward Saids Werk "Orientalismus", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1470676