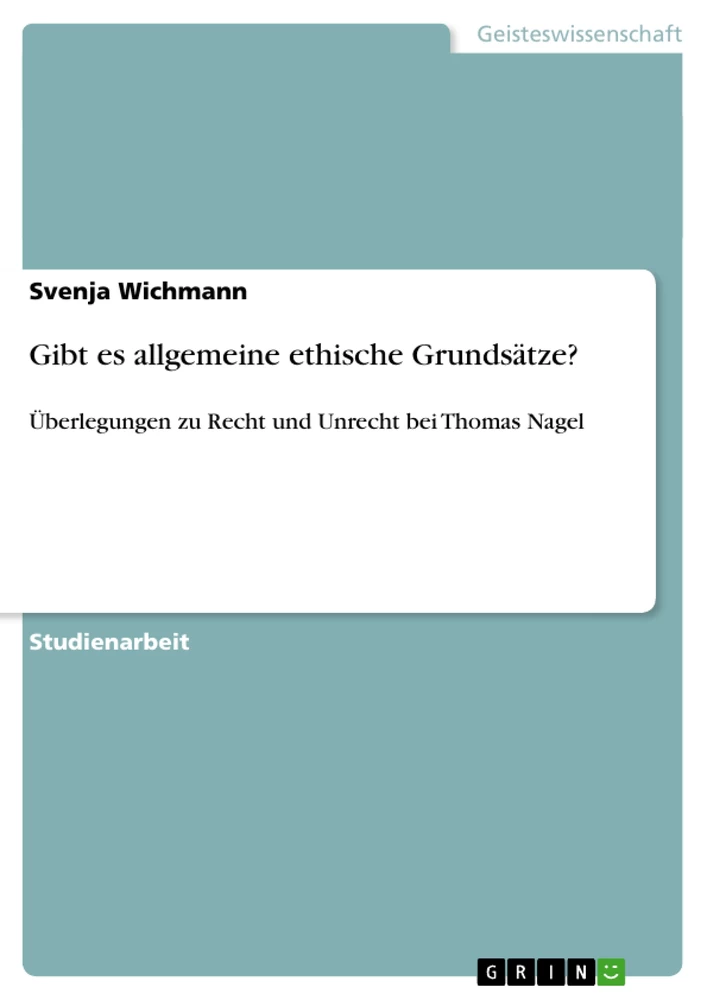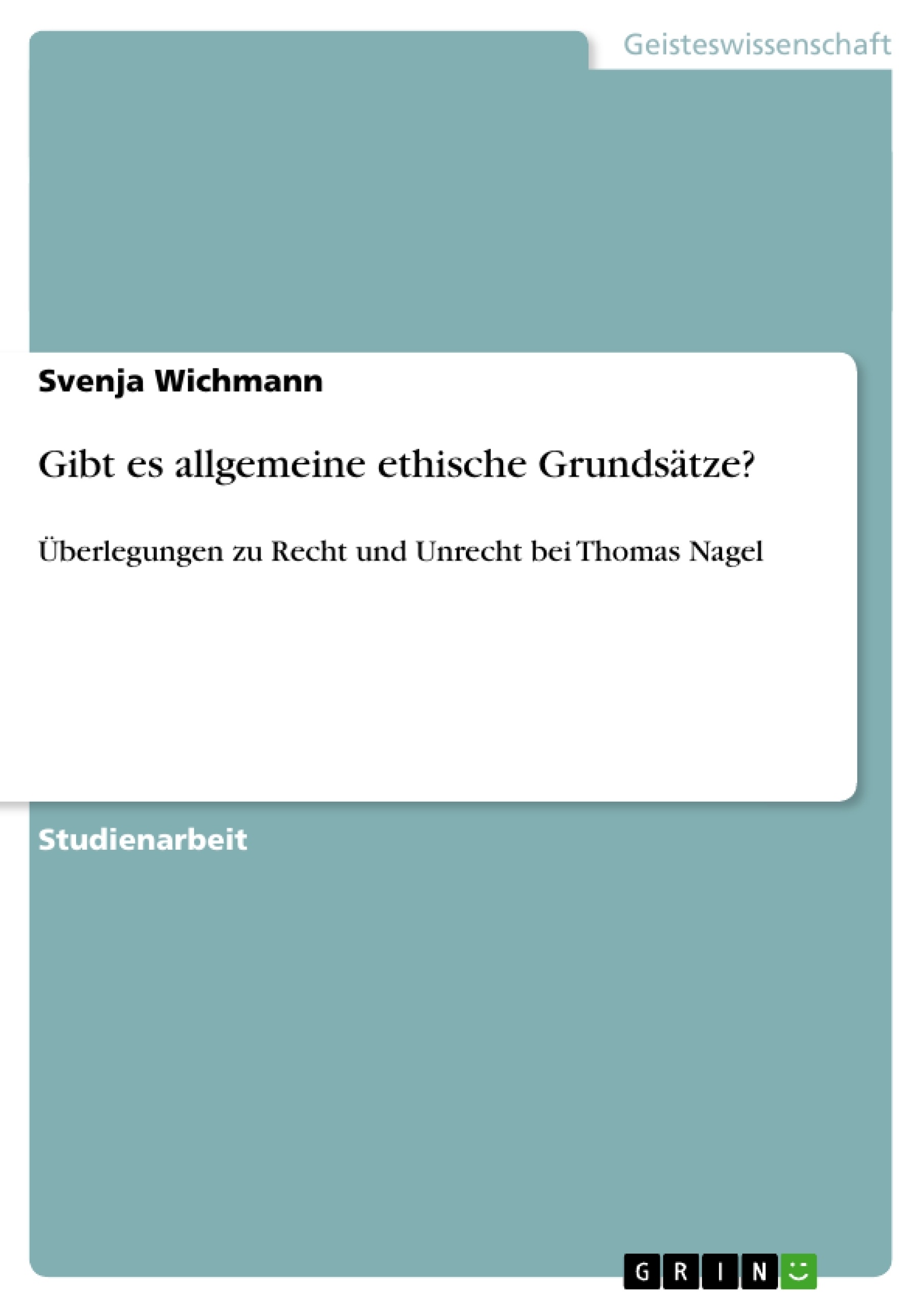Die meisten Menschen leben in einer Gemeinschaft mit anderen Menschen, sei es im kleinen Kreis der Familie oder im größeren Zusammenhang der Gesellschaft eines Staates, in unserer Vorstellung sogar mit allen Menschen auf der Erde. Jede Art des Zusam-
menlebens mit Anderen baut auf einem rücksichtsvollen, sittlichen Verhalten gegenüber den anderen Mitgliedern der Gemeinschaft auf, anders könnte keine Gemeinschaft, ob in großen oder kleinen Zusammenhängen existieren.
Ein Zusammenleben von Menschen erfordert also ethische Grundsätze und im allgemeinen nehmen wir an, dass diese existieren und für jeden dieselben sind. Betrachtet man jedoch das alltägliche Zusammenleben von Menschen, ergeben sich immer wieder sittli-
che Probleme, die nicht eindeutig durch die Sittenlehre oder Ethik (vom gr. Ethos ≈ Sitte, Charakter, Gewohnheit) gelöst werden können. Häufig stehen bei einem konkreten zwischenmenschlichen Problem mehrere ethische Grundsätze im Konflikt miteinander und es ist unklar ob ein ethischer Grundsatz höher gestellt werden kann als ein anderer.
Die Idee von Recht und Unrecht baut auf ethischen Grundsätzen auf. Es zeigt sich aber oft, dass es schwierig ist, ethische Grundsätze in allen Wechselfällen des Lebens so zu konkretisieren, dass man eindeutig Recht und Unrecht daraus ableiten könnte. Recht
und Unrecht sind nicht immer eindeutig bestimmbar.
Es stellt sich die Frage ob man, auch wenn ethische Grundsätze nicht eindeutig konkretisierbar sind, von der Existenz allgemeiner ethischer Grundsätze ausgehen kann. Oder ist es vielmehr so, dass es allgemeine Ethische Grundsätze überhaupt nur geben kann, wenn sie sich auch in allen Fällen konkret formulieren und anwenden lassen? Muss man wenn eine konkrete Formulierung ethischer Grundsätze nicht möglich ist, davon ausgehen, dass es keine ethischen Grundsätze geben kann?
Diese Fragen sollen nun anhand der Thesen zu Recht und Unrecht von Thomas Nagel an einem Beispiel verdeutlicht, erörtert und geklärt werden. Zunächst sollen die grundlegenden Thesen die Thomas Nagel in seinem Buch „Was bedeutet das alles? Eine ganz
kurze Einführung in die Philosophie“ bespricht, dargelegt werden. Im weiteren Verlauf werden diese Thesen am Beispiel geprüft und erörtert um die Grundlagen für ein abschließendes Fazit zu schaffen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Recht und Unrecht bei Thomas Nagel (Thesen)
- 3. Überlegungen zu Recht und Unrecht am Beispiel Folter
- 3.1 Recht und Unrecht sind unabhängig von Regeln und Gesetzen
- 3.2 Wir handeln moralisch, weil wir selbst moralisch behandelt werden wollen
- 3.3 Recht und Unrecht sind möglicherweise relativ
- 3.4 Ethik existiert möglicherweise überhaupt nicht
- 3.5 Ethik appelliert an eine unparteiische Motivation
- 4. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Thomas Nagels Thesen zu Recht und Unrecht, wie sie in seinem Werk „Was bedeutet das alles? Eine ganz kurze Einführung in die Philosophie“ präsentiert werden. Ziel ist es, die zentralen Argumente Nagels nachzuvollziehen und anhand eines Beispiels – der Folter – zu erörtern und zu analysieren, ob und wie sich allgemeine ethische Grundsätze in konkreten, moralisch schwierigen Situationen anwenden lassen.
- Die Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht und Gesetzen/Regeln
- Die Rolle der Motivation im moralischen Handeln
- Die Problematik der Relativität von Recht und Unrecht
- Die Frage nach der Existenz allgemeiner ethischer Grundsätze
- Der Konflikt zwischen individuellen und unparteiischen Motivationen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Frage nach der Existenz allgemeiner ethische Grundsätze und deren Anwendbarkeit in konkreten Situationen. Sie verweist auf die Schwierigkeiten, ethische Prinzipien in alltäglichen Konflikten eindeutig anzuwenden und kündigt die Analyse von Thomas Nagels Thesen an, um diese Problematik zu beleuchten. Der Fokus liegt auf der Klärung der Frage, ob die Nicht-Konkretisierbarkeit ethischer Grundsätze deren Existenz ausschließt. Die Arbeit verspricht eine Erörterung von Nagels Thesen anhand des Beispiels der Folter.
2. Recht und Unrecht bei Thomas Nagel (Thesen): Dieses Kapitel präsentiert Nagels fünf Kernthesen zu Recht und Unrecht, die im weiteren Verlauf der Arbeit analysiert werden. Es werden die zentralen Argumente Nagels knapp zusammengefasst. Die Thesen bilden die Grundlage für die anschließende Fallstudie der Folter. Der Überblick dient der Strukturierung der Argumentation und der Vorbereitung der folgenden Kapitel.
3. Überlegungen zu Recht und Unrecht am Beispiel Folter: Dieses Kapitel untersucht Nagels Thesen anhand des Beispiels der Folter, einer Handlung, die intuitiv als unmoralisch empfunden wird, aber in bestimmten Kontexten (z.B. zur Verhinderung größerer Übel) moralisch gerechtfertigt werden könnte. Die Analyse beleuchtet den Konflikt zwischen dem intuitiven Verständnis von Recht und Unrecht und der Anwendung ethischer Prinzipien in komplexen Situationen. Die einzelnen Unterkapitel (3.1-3.5) befassen sich jeweils mit einer von Nagels Thesen im Kontext der Folter, analysieren deren Relevanz und zeigen die Schwierigkeiten bei der ethischen Bewertung solcher Fälle auf.
Schlüsselwörter
Recht und Unrecht, Thomas Nagel, Ethik, Moral, Folter, allgemeine ethische Grundsätze, Relativität von Moral, unparteiische Motivation, egoistische Motive, Regeln, Gesetze.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von Thomas Nagels Thesen zu Recht und Unrecht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Thomas Nagels Thesen zu Recht und Unrecht, wie sie in seinem Werk „Was bedeutet das alles? Eine ganz kurze Einführung in die Philosophie“ präsentiert werden. Der Fokus liegt auf der Anwendbarkeit allgemeiner ethischer Grundsätze in konkreten, moralisch schwierigen Situationen, veranschaulicht am Beispiel der Folter.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht und Gesetzen/Regeln, die Rolle der Motivation im moralischen Handeln, die Problematik der Relativität von Recht und Unrecht, die Frage nach der Existenz allgemeiner ethischer Grundsätze und den Konflikt zwischen individuellen und unparteiischen Motivationen. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die Nicht-Konkretisierbarkeit ethischer Grundsätze deren Existenz ausschließt.
Welche Methode wird verwendet?
Die Arbeit untersucht fünf Kernthesen von Thomas Nagel zu Recht und Unrecht. Diese Thesen werden anhand des Beispiels der Folter analysiert, um die Anwendbarkeit ethischer Prinzipien in komplexen, moralisch schwierigen Situationen zu beleuchten. Die Analyse zeigt die Schwierigkeiten bei der ethischen Bewertung solcher Fälle auf und untersucht den Konflikt zwischen intuitivem Verständnis und der Anwendung ethischer Prinzipien.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Darstellung von Nagels Thesen, ein Hauptkapitel mit der Fallstudie Folter (unterteilt in fünf Unterkapitel, die jeweils eine These im Kontext der Folter untersuchen) und eine Schlussbetrachtung. Sie enthält außerdem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht keine expliziten Schlussfolgerungen im Sinne einer endgültigen Antwort auf die Frage nach der Existenz und Anwendbarkeit allgemeiner ethischer Grundsätze. Sie beleuchtet vielmehr die Komplexität der Thematik und die Schwierigkeiten, ethische Prinzipien in konkreten Situationen anzuwenden. Die Analyse der Fallstudie Folter veranschaulicht diese Schwierigkeiten und regt zur weiteren Diskussion an.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Recht und Unrecht, Thomas Nagel, Ethik, Moral, Folter, allgemeine ethische Grundsätze, Relativität von Moral, unparteiische Motivation, egoistische Motive, Regeln, Gesetze.
Worum geht es in den einzelnen Kapiteln?
Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in die Thematik, Problematik der Anwendung ethischer Prinzipien, Ankündigung der Analyse von Nagels Thesen.
Kapitel 2 (Nagels Thesen): Darstellung von Nagels fünf Kernthesen zu Recht und Unrecht.
Kapitel 3 (Folter): Analyse von Nagels Thesen anhand des Beispiels Folter, Untersuchung des Konflikts zwischen intuitivem Verständnis und ethischen Prinzipien in komplexen Situationen.
Kapitel 4 (Schlussbetrachtung): Zusammenfassung und Reflexion der Ergebnisse.
- Quote paper
- Svenja Wichmann (Author), 2009, Gibt es allgemeine ethische Grundsätze?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147041